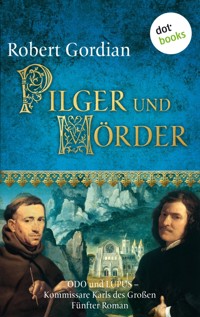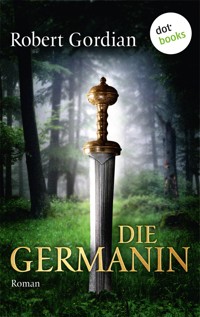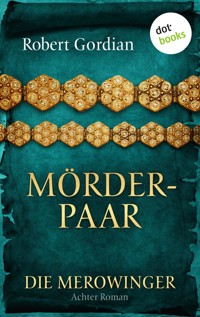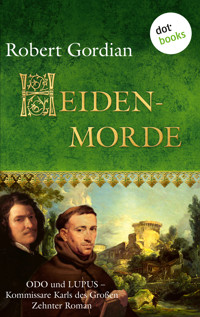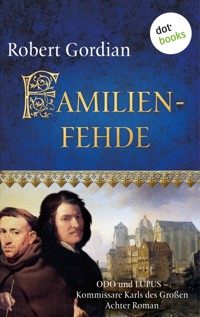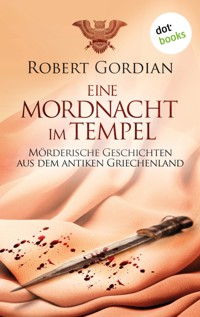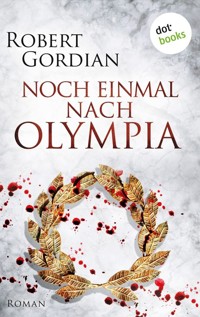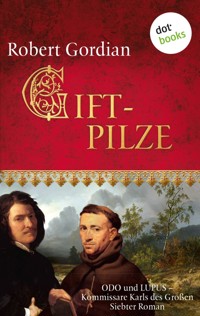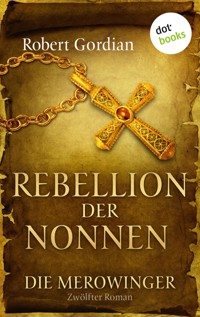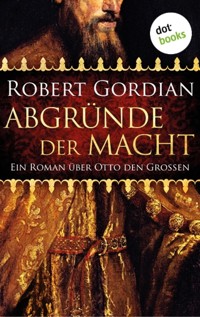
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer herrschen will, muss kämpfen: "Abgründe der Macht", der Roman von Robert Gordian über den Sachsenkönig Otto den Großen, als eBook bei dotbooks. Es beginnt mit einem Fest – und wird bald zum brutalen Kampf: Als Otto von Sachsen im Jahre 936 den Thron des Ostfrankenreichs besteigt, scheint auch die Kaiserkrone des deutsch-römischen Reiches zum Greifen nah zu sein. Der junge König weiß, dass es Neider und Nebenbuhler gibt, die alles daran setzen, ihn zu stürzen. Doch er hat nicht damit gerechnet, dass die Feinde auch aus seiner eigenen Familie stammen … Der fesselnde Roman über einen Ruhelosen und Getriebenen: Erfolgsautor Robert Gordian setzt dem großen Sachsenkönig Otto ein Denkmal und durchleuchtet schonungslos das dichte Geflecht aus Neid, Intrigen und Gewalt, das jene umgibt, die nach der Macht greifen. "Robert Gordian beschreibt die Wirren und Machtspiele des 10. Jahrhunderts mit viel Detailreichtum und Hintergrundwissen. Ein lesenswerter Roman nicht nur für Geschichtsinteressierte." www.tempus-vivit.net Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Abgründe der Macht" von Robert Gordian, einem der vielseitigsten historischen Romanautoren Deutschlands. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Es beginnt mit einem Fest – und wird bald zum brutalen Kampf: Als Otto von Sachsen im Jahre 936 den Thron des Ostfrankenreichs besteigt, scheint auch die Kaiserkrone des deutsch-römischen Reiches zum Greifen nah zu sein. Der junge König weiß, dass es Neider und Nebenbuhler gibt, die alles daran setzen, ihn zu stürzen. Doch er hat nicht damit gerechnet, dass die Feinde auch aus seiner eigenen Familie stammen …
Der fesselnde Roman über einen Ruhelosen und Getriebenen: Erfolgsautor Robert Gordian setzt dem großen Sachsenkönig Otto ein Denkmal und durchleuchtet schonungslos das dichte Geflecht aus Neid, Intrigen und Gewalt, das jene umgibt, die nach der Macht greifen.
»Robert Gordian beschreibt die Wirren und Machtspiele des 10. Jahrhunderts mit viel Detailreichtum und Hintergrundwissen. Ein lesenswerter Roman nicht nur für Geschichtsinteressierte.« www.tempus-vivit.net
Über den Autor:
Robert Gordian (1938–2017), geboren in Oebisfelde, studierte Journalistik und Geschichte und arbeitete als Fernsehredakteur, Theaterdramaturg, Hörspiel- und TV-Autor, vorwiegend mit historischen Themen. Seit den neunziger Jahren verfasste er historische Romane und Erzählungen.
Robert Gordian veröffentlichte bei dotbooks bereits die Romane MEIN JAHR IN GERMANIEN, NOCH EINMAL NACH OLYMPIA, XANTHIPPE – DIE FRAU DES SOKRATES, DIE EHRLOSE HERZOGIN und DIE GERMANIN sowie drei historische Romanserien:
ODO UND LUPUS, KOMMISSARE KARLS DES GROSSEN
Erster Roman: »Demetrias Rache«
Zweiter Roman: »Saxnot stirbt nie«
Dritter Roman: »Pater Diabolus«
Vierter Roman: »Die Witwe«
Fünfter Roman: »Pilger und Mörder«
Sechster Roman: »Tödliche Brautnacht«
Siebter Roman: »Giftpilze«
Achter Roman: »Familienfehde«
DIE MEROWINGER
Erster Roman: »Letzte Säule des Imperiums«
Zweiter Roman: »Schwerter der Barbaren«
Dritter Roman: »Familiengruft«
Vierter Roman: »Zorn der Götter«
Fünfter Roman: »Chlodwigs Vermächtnis«
Sechster Roman: »Tödliches Erbe«
Siebter Roman: »Dritte Flucht«
Achter Roman: »Mörderpaar«
Neunter Roman: »Zwei Todfeindinnen«
Zehnter Roman: »Die Liebenden von Rouen«
Elfter Roman: »Der Heimatlose«
Zwölfter Roman: »Rebellion der Nonnen«
Dreizehnter Roman: »Die Treulosen«
ROSAMUNDE, KÖNIGIN DER LANGOBARDEN
Erster Roman: »Der Waffensohn«
Zweiter Roman: »Der Pokal des Alboin«
Dritter Roman: »Die Verschwörung«
Vierter Roman: »Die Tragödie von Ravenna«
Ebenfalls erschien bei dotbooks die beiden Kurzgeschichtenbände EINE MORDNACHT IM TEMPEL und DAS MÄDCHEN MIT DEM SCHLANGENOHRRING sowie die Reihe WÄREN SIE FRÜHER GESTORBEN mit kontrafaktischen Erzählungen über berühmte historische Persönlichkeiten:
WÄREN SIE FRÜHER GESTORBEN: Caesar, Chlodwig, Otto I., Elisabeth I., Lincoln, Hitler
WÄREN SIE FRÜHER GESTORBEN: Napoleon, Paulus, Themistokles, Dschingis Khan, Bolívar, Chruschtschow
WÄREN SIE FRÜHER GESTORBEN: Karl der Große, Arminius, Gregor VII., Mark Aurel, Peter I., Friedrich II.
***
eBook-Neuausgabe Mai 2016
Copyright © der Originalausgabe 2011 by Verlag Philipp von Zabern, Darmstadt/Mainz
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung eines Bildmotiv von shutterstock/nikolaich
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-110-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Abgründe der Macht« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Robert Gordian
Abgründe der Macht
Ein Roman über Otto den Großen
dotbooks.
Nachdem der größte und beste der Könige, der Herr Heinrich, entschlafen war, erkor das Volk der Franken und Sachsen dessen Sohn Odda zu seinem Gebieter.
Er war der älteste und beste der Brüder, er zeichnet sich durch Frömmigkeit aus, ist in seinen Unternehmungen unter allen Sterblichen der beständigste, ist abgesehen von den Schrecken des königlichen Ernstes immer freundlich, im Schenken freigebig, im Schlafen mäßig und während des Schlafes redet er immer, sodass es den Anschein hat, als ob er stets wache.
Widukind von Corvey
ERSTER TEIL
Kapitel 1
Es war spät, nahe Mitternacht. Die Kerzen an den mannshohen Kandelabern brannten herunter und Diener gingen umher, um neue aufzustecken. Die Luft war erfüllt von Rauch und Bratenduft. Noch immer wurden Schüsseln mit Wildbret und Zuspeise aufgetragen, die Diener mit den Weinkannen mussten sich sputen, weil ihnen von allen Seiten mit herrischem Zuruf geleerte Becher entgegen gestreckt wurden. Musikanten flöteten, fiedelten, zupften. Gaukler zeigten ihre Kunststücke. Links und rechts an den langen Tischen hatten die Herzöge, Grafen, Erzbischöfe und Bischöfe mit ihrem vornehmen Anhang die steife Würde der Krönungsfeier längst abgelegt, Scherzworte flogen hin und her, lösten krachendes Gelächter aus. Damen kreischten, wenn ihnen unter den Tischen wuselnde, nach Brocken schnappende Hunde zwischen die Beine gerieten. Fettglänzend waren die Wangen, aus Mundwinkeln rannen Weinbäche, vom Rauch gerötet waren die Augen, kunstvoll geflochtene Zöpfe lösten sich auf. Mancher in Seide gezwängte Jungfrauenbusen hob sich mit kurzem Atem, wenn einer der jungen Männer sein letztes heldenhaft bestandenes Abenteuer berichtete. Unter den Tischen fanden sich Hände und Füße.
Nicht alle Reden waren nur laut und leichtfertig. Grauhaarige, mit kostbarem Schmuck behängte Damen erörterten augenrollend und fuchtelnd das Für und Wider von Heiratsprojekten. Würdige Herren standen in Grüppchen beisammen und tauschten ernste Ansichten über die Lage im Reich und jenseits der Grenzen, die Köpfe nah beieinander, um den Dialekt des anderen zu verstehen. Nicht oft sahen sich die Großen aus Bayern, Franken, Schwaben, Sachsen und Lothringen. Manche waren sich jahrelang nicht begegnet oder erinnerten sich nur eines unangenehmen Zusammentreffens irgendwann, irgendwo auf einer Walstatt. In den meisten Fällen lag das lange zurück, unter König Heinrich hatte, ungewöhnlich genug, zwischen den großen Stämmen jahrelang Eintracht geherrscht. Zwar beschossen sich einige alte Widersacher mit scheelen, finsteren oder herausfordernden Blicken, viel häufiger aber sah man Händedrücke, Umarmungen, Küsse.
Es war ein fröhliches Krönungsfest an diesem sich neigenden 7. August des Jahres 936 in der großen Halle der Königspfalz zu Aachen. Am Morgen hatten die Großen des Ostfränkischen Reiches den neuen König gewählt, den vierundzwanzigjährigen Sachsen Otto, und waren damit einer dringenden Empfehlung seines Vaters Heinrich gefolgt, die der bereits vom Tode Gezeichnete im Frühjahr auf einem Hoftag in Erfurt ausgesprochen hatte. Nach der Wahl wurde Otto, der aus Achtung vor der Tradition fränkisch, das heißt mit einer eng anliegenden Tunika bekleidet war, von seinen hochadeligen Wählern in den Säulengang bei der Basilika geleitet. Hier bestieg er einen erhöhten Sitz, auf dessen Stufen die Großen einer nach dem anderen niederknieten, um ihm den Treueid zu leisten und ihre gefalteten Hände zwischen die seinen zu legen. Danach zogen alle in das berühmte karolingische Oktogon, um die Entscheidung der weltlichen Machthaber durch das kirchliche Ritual überhöhen und veredeln zu lassen. Hildebert, der Erzbischof von Mainz, höchster Priester der katholischen Kirche im Reich, trat dem jungen König entgegen, ergriff seine Hand und führte ihn in die Mitte, sodass ihn alle, die Zutritt gefunden hatten, auch einfaches Volk darunter, sehen konnten, und dann forderte er die Versammelten auf, ihre rechte Hand zu heben, wenn sie der Wahl der Mächtigen zustimmten. Dies war natürlich nur eine Formsache, die unter Jubelgeschrei vollzogen wurde. Aus den Händen Hildeberts empfing Otto das Reichsschwert mit dem Wehrgehenk, den Königsmantel mit den kostbaren Spangen, schließlich Zepter und Stab, die Insignien seiner Herrschaft. Zur Krönung mit dem goldenen Diadem und zur Salbung mit dem heiligen Öl lieh der Erzbischof von Köln, Wichfrid, dem Mainzer Amtsbruder, seinen Beistand und schließlich stieg der Gewählte, Gekrönte und Gesalbte die Wendeltreppe zum Thron Karls des Großen hinauf. Hier nahm er Platz und ließ sich noch einmal feiern.
Nach der Krönungsmesse zog er mit seiner Gemahlin, der in einer gesonderten Zeremonie gesalbten Königin Edgith, und seinem Gefolge in die Halle hinüber, wo er Hunderten Gästen ein Festmahl gab. Vier Herzöge warteten dabei in den traditionellen Ämtern auf, die schon die Merowingerkönige eingeführt hatten. Giselbert von Lothringen, zu dessen Herzogtum die Pfalz Aachen gehörte, hatte als Kämmerer die Oberaufsicht und war für den reibungslosen Ablauf des Festes verantwortlich. Eberhard von Franken besorgte als Truchsess den Tisch, Hermann von Schwaben war oberster Mundschenk. Arnulf von Bayern als Marschalk hatte das Lager für die vielen Gäste eingerichtet und kümmerte sich um die Versorgung der Pferde. Der junge König zeigte sich freigebig, wie es sich für einen neuen Herrscher gehörte, und geizte nicht mit Geschenken, die er während des Festes überreichte, in ihrem Wert dem Ansehen und der Bedeutung der Empfänger entsprechend. Manche Kostbarkeit aus dem königlichen Schatz wechselte den Besitzer.
So nahm das herrliche Fest seinen Lauf und je länger es sich hinzog, desto weniger kümmerten sich die Gäste um das Paar, das vorn allein an der zu den beiden langen Tischreihen quer gestellten Tafel saß. Anfangs hatte es die Stimmung in der Halle ein wenig gedrückt, dass die beiden, so sichtbar räumlich von allen anderen geschieden, auf hohen Armstühlen saßen und auf die Versammelten herabblickten. Das Lächeln der jungen Königin Edgith, einer sehr schlanken, blassen, flachsblonden Angelsächsin, schien in ihre Züge gemeißelt zu sein, huldvoll und freundlich, doch eher teilnahmslos. Otto, der neue junge König saß breit und gedrungen auf seinem Armstuhl wie Stunden zuvor in der Basilika auf dem Thron Karls des Großen, trank diesem und jenem zu, sprach ein paar Worte, wenn sich ihm einer der Gäste näherte, verzog aber kaum die reglose Miene seines runden Gesichts und richtete nur von Zeit zu Zeit einen langen, durchdringenden Blick der kleinen, lebhaften, funkelnden Augen auf diesen oder jenen, welcher, wenn er dessen gewahr wurde, einen leichten Kälteschauer verspüren mochte. Je mehr man auftrug und einschenkte, desto mehr löste sich aber die anfängliche Beklemmung und an den Tischen wurde sogar hinter der vorgehaltenen Hand gewitzelt, anscheinend langweile sich der junge Herrscher auf seinem Hochsitz und man werde ihn aus den Wolken herabholen und beschäftigen müssen. Anlässe gebe es ja genug.
Die witzigen Herren ahnten nicht, dass hinter der breiten Stirn des frisch Gekrönten, die der mit Edelsteinen bestückte Goldreif umspannte, derselbe Gedanke schon kräftig weiterwucherte. Als es nun spät wurde, begann König Otto, nachdem er lange geschwiegen hatte, plötzlich zu reden, endlos, wie es, wenn er einmal angefangen hatte, seine Gewohnheit war. Bei dem Stimmengewirr, der Musik und dem Lärm brauchte er sich nicht vorzusehen und musste die Worte nicht allzu sorgfältig wählen. Er stützte den Ellbogen auf die Armlehne, neigte sich seiner Gemahlin zu, damit sie ihn besser verstand und sagte:
»Was meinst du? Welcher von ihnen wird anfangen?«
Die junge Königin vergaß einen Augenblick zu lächeln und blickte auf ihn herab. Auch im Sitzen überragte sie ihn um eine halbe Kopflänge.
»Womit anfangen?«
»Nun, ich meine, wer wird der Erste sein, der mich lieber tot als lebendig sähe und versuchen wird, mich von dem Thron zu stoßen, auf den sie mich gerade gehoben haben?«
»Odda!«, erwiderte sie vorwurfsvoll. »Hast du nicht gerade heute erlebt, dass alle dir treu ergeben sind und …«
»Was sind ihre Treueschwüre wert?«, unterbrach er sie. »Wie lange werden sie halten? Was dachten die Herren in dem Augenblick, als sie ihre Hände in die meinen legten und die Eidesformel sprachen? Dachten sie, dieser Mann ist schon tot und bald werden wir an seinem Grab stehen und für sein Seelenheil beten, da ihm irdisches Heil nun mal nicht beschieden war?«
»Wie kannst du so entsetzliche Dinge sagen! Sieh mal, Herzog Eberhard trinkt dir zu! Wenn einer dir wohlgesinnt ist, dann ist er es. Willst du ihm nicht danken?«
Ein stattlicher, reich gekleideter Mann mit Silbermähne, der mit geistlichen Würdenträgern beisammen stand, hatte seinen Becher erhoben und blickte herüber, die langen, gelblichen Zähne entblößend und eine Verbeugung andeutend.
Otto ergriff seinen Goldpokal, schwenkte ihn lässig, trank einen Schluck und murmelte: »Ich danke Euch, Herzog Eberhard. Auch ich trinke auf Euer Wohlergehen und lobe Euch nochmals für Euer Kommen. Seid versichert, Ihr seid die stärkste und unverzichtbarste Säule meines Reiches.«
Er stieß ein trockenes Lachen aus.
»Du bist ungerecht!«, sagte Edgith, die ebenfalls an ihrem Pokal genippt und dem Herzog zugelächelt hatte.
»Aber ich lobe ihn doch«, sagte Otto.
»Du kannst ihn nicht leiden. Warum nur?«
»Weil er der Gefährlichste ist, dieser Herzog von Franken. Man sieht es ihm nicht an. Er liebt die Geselligkeit bei Tische, den Scherz unter Männern, sein Lachen ist ansteckend. Niemals werde ich so beliebt sein wie er, so unbefangen unter meinen Leuten umhergehen, diesem auf die Schulter klopfen, jenen umarmen … Mein Vater konnte das auch, nicht so gut wie er, doch er konnte es. Ich kann es nicht. Mich durchzuckt gleich ein Schauder, wenn mir nur jemand zu nahe kommt und mir seinen stinkenden Atem ins Gesicht bläst.«
»Er ist nun mal nicht so empfindsam wie du«, sagte die Königin nachsichtig. »Aber deshalb ist er noch nicht gefährlich.«
»Oh nein!«, sagte Otto höhnisch. »Er ist nur ein lieber, unterhaltsamer älterer Herr! Da ist er schon wieder umringt, erzählt eine seiner Geschichten und alles biegt sich vor Lachen. Auch die Pfaffen – und sogar meine Sachsen.«
»Du beneidest ihn.«
»Ich misstraue ihm. Er will König werden.«
»Das ist doch Unsinn!«
»Oh nein! Er will es noch immer. Er wollte es schon vor achtzehn Jahren, als sein Bruder starb, König Konrad. Doch diesem frömmelnden Schwächling gelang am Ende seiner kurzen Regierung noch eine gute, die rettende Tat – er verhinderte es. Und er gab ihm auf dem Sterbebett einen Befehl. Ich kann mir vorstellen, wie sich der eitle Eberhard sträubte. Aber was hatte er vorzuweisen? Nichts. Sein einziges Heldenstück war die blutige Niederlage an der Eresburg gegen das Aufgebot meines Vaters. Aus Regensburg, wo er kurze Zeit Präfekt von Bayern war, wurde er fortgejagt. Du bist nicht mächtig und nicht fähig genug, sagte Konrad, du bist wie ich, hast nicht das Königsheil, bist kein Sieger. Es würde dir schlimmer ergehen als mir, du würdest in kurzer Zeit alles verlieren – das Reich, dein Herzogtum, dein Leben, alles. Deshalb reite zu Heinrich, dem Sachsenherzog, dem Stärksten, bringe ihm die insignia regis und sorge dafür, dass er zum König gewählt wird. Was ging da in diesem Eberhard vor? Sein Ehrgeiz kämpfte mit seinem Kleinmut – sein Kleinmut gewann und er gehorchte. Bereute es aber, bereute es bitter, das weiß ich zuverlässig! Das hat er mal, als er bis zum Rande mit Bier gefüllt war, dem Gero gestanden.«
Otto stieß ein verächtliches Lachen aus. Edgith hatte ein paar Mal geseufzt, denn sie kannte die Geschichte ja längst. Ehe sie aber etwas entgegnen konnte, neigte der König sich wieder ihrem Ohr zu und fuhr fort: »Er fürchtete sich vor meinem Vater, nur deshalb verhielt er sich ruhig, nur deshalb! Mit mir ist es anders, mich fürchtet er nicht. Wie er mir heute Morgen beim Schwur in die Augen sah – da war ein Lauern, da war auch eine versteckte Drohung. Als wollte er sagen: ›Warte nur ab! Dein Vater hat rechtzeitig dafür gesorgt, auf dem Hoftag in Erfurt, dass du sein Nachfolger wurdest. Da war nichts zu machen, das mussten wir schlucken. Aber nun ist der starke Heinrich tot. Nun wollen wir sehen, wie weit es sein Söhnchen ohne ihn bringt!‹ Er wird es versuchen, und zwar bald! Er ist mehr als fünfundzwanzig Jahre älter als ich, über fünfzig, ein hohes Alter. Lange wird er also nicht warten, er hat keine Zeit. Und nur mein Tod kann ihm seinen Wunsch noch erfüllen.«
»So schweig doch, Odda! Ich will das nicht hören!«
Edgith wandte sich ab und lächelte wieder, wie sie es an diesem Tag für ihre Pflicht hielt. Ihr Blick fing den einer dunkelhaarigen Dame, die etwa in ihrem Alter war, Mitte der zwanziger, aber in ihrer Robe aus golddurchwirktem Brokat, mit Edelsteinen im Haar und am Hals mehr Glanz verbreitete als die dagegen eher schlicht gekleidete und nur wenig geschmückte Königin. An der Seite der üppigen Schönheit hockte wie ein dürftiger Schatten ihr hagerer, rotbärtiger, wesentlich älterer Ehemann.
König Otto bemerkte den Blicktausch der beiden Frauen.
»Mein Schwesterchen lächelt uns an, wie freundlich. So sieht man auch mal eine Schlange lächeln, ein seltener Anblick. Ob sie glücklich ist mit dem Fuchsgesicht an ihrer Seite, mit Giselbert, dem Herzog von Lothringen? Fuchs und Schlange, ein gefährliches Paar, und auf Glück kommt es auch weniger an, mehr auf Macht. Das hat Gerberga schon lange begriffen … nein, nicht begriffen, es liegt in ihrer Natur, damit ist sie nach unserer Mutter geraten. Das Fuchsgesicht blickt auch her und trinkt mir zu. Gesundheit, Heil und Gottes Gnade. Elender Heuchler! Im Stillen wünscht er mir Gift in den Becher. Es tut ihm längst leid, dass er sein Land vor acht Jahren, als ihm das Wasser bis zum Halse stand, von meinem Vater zum Lehen nahm. Jetzt möchte er zurück zu den Westfranken oder – noch besser – ein unabhängiges Reich Lothringen regieren. Hat er das vor? Will er das alte Mittelreich wieder herstellen? So wie es war, nach der Teilung unter die Söhne des frommen Ludwig? Zu Lothringen eines Tages Burgund, später vielleicht auch Italien? Mein Schwesterchen sehnt sich nach einer Krone. Vielleicht sogar der einer Kaiserin.«
»Glaubst du wirklich, dass sie so hoch hinaus will?«, fragte die Königin.
»Ich glaube es nicht nur, ich weiß es! Sie fühlte sich damals betrogen, als unser Vater, ein König, sie nur einem Herzog gab. Schon als Kind stolzierte sie aufgeputzt mit einer Krone umher. Sie hat Verstand und sie wird ihn gebrauchen. So wie beim Brettspiel, wenn sie mich mit ihren Steinen besiegte und spottete: ›Zieh lieber meinen Wagen, Odda!‹ Und das tat ich sogar, wenn sie mit meinem älteren Bruder oder mit einem meiner Freunde, mit Hermann oder Gero, die alle einen Kopf größer waren als ich, König und Königin spielte. Wie falsch sie lächelt und uns dabei abschätzig mustert! Das ist nicht nur Eifersucht, das ist Feindseligkeit.«
»Aber sie hat mich vorhin so herzlich umarmt und noch einmal beglückwünscht!«
»Und dabei gedacht: ›Diese verfluchte Inselbarbarin ist nun seit heute Morgen, was ich selbst gern wäre – Königin! Kann ich das hinnehmen? Ich, eine Liudolfingerin?‹ Sie wird …«
»Ich bitte dich, Odda, lass das, Gerberga ist deine Schwester, sie liebt dich, sie wird uns nicht schaden!«, unterbrach Edgith ihren Gemahl und suchte ihn abzulenken. »Sieh doch mal dort, die Bayern! Ist das nicht lustig? Sie zeigen ihre heimatlichen Tänze!«
»Wahrhaftig, sehr lustig«, fand auch König Otto, nachdem er einen Augenblick zugesehen hatte, wie ein paar bärtige Herren in Lederwämsern zwischen den langen Tischen die Beine warfen. »Herzog Arnulf ist schon ein bisschen wacklig, gleich wird ihm die Luft ausgehen. Zahm ist er geworden, der Alte, ich brauche ihn nicht mehr zu fürchten. Kaum zu glauben, dass die Prälaten ihn noch immer Arnulf den Bösen nennen.«
»Er sieht so freundlich und harmlos aus«, sagte Edgith. »Tun sie das wirklich?«
»Ja, und sie haben Grund dazu. Den Beinamen verdiente er sich schon vor dreißig Jahren, als er Klöster enteignete und Kirchengut einzog, um seine Leute zu versorgen. Das war richtig, obwohl er zu weit ging, aber er musste die Männer entlohnen, weil sie ihm halfen, mit der Magyarenplage fertig zu werden. Er zeigte auch meinem Vater die Zähne. Wollte nicht hinnehmen, dass nun ein Sachse das Reich regierte, ließ sich selbst zum König erheben. Nun, zwei Feldzüge brachten ihn zur Vernunft. Den Vasalleneid ließ er sich aber teuer bezahlen. Er bekam Privilegien, die einem Herzog nicht zustehen: Bischofsinvestitur, unbeschränkte Nutzung von Krongut … Das alles werde ich rückgängig machen, den bayerischen Eigensinn muss ich brechen, diesen ewigen Anspruch auf Sonderwege. Aber das braucht seine Zeit …«
»Jetzt geht ihm tatsächlich die Luft aus, hoffentlich hat er sich nicht überanstrengt!«, sagte die Königin besorgt. »Oh, sieh mal, wie liebevoll ihn die drei Söhne zu seinem Platz führen!«
»Liebevoll?«, hakte Otto ein. »Nur solange sie noch nicht geerbt haben. Eberhard, Arnulf und Hermann … drei Wölfe, die gezähmt werden müssen. Aber wie zähmt man Wölfe? Alle drei sind Querköpfe, Fleisch gewordener Widerstand. Der Älteste, Eberhard, ist so alt wie ich, im selben Jahr geboren. Nun werden wir sehen, wer den härteren Schädel hat. Ich hatte heute schon ein erstes Geplänkel mit ihm.«
»Etwa wegen der Heirat mit Heinrich?«, fragte die Königin Edgith aufmerksam.
»Ja, ich fand deinen Vorschlag vernünftig und sprach die Bayern darauf an. Der Alte schien nicht abgeneigt, seine Tochter dem jüngeren Bruder des Königs zu verheiraten. Ich wollte die Sache gleich fest machen. Aber der Sturkopf Eberhard war dagegen. Angeblich ist sie noch zu jung. Ich widersprach, doch er behauptete, es ginge nicht ohne sein Einverständnis. Ich sagte: ›Du bist weder ihr Muntwalt noch Herzog!‹ Da erwiderte er: ›Herzog bin ich schon!‹ ›Was?‹ rief ich. ›Wie kannst du denn Herzog sein? Dein Vater steht doch lebendig neben dir!‹ Da sagt er: ›Seit einem Jahr bin ich Herzog, schon von den Bayern als Nachfolger meines Vaters erwählt!‹ Ich: ›Darüber entscheiden nicht die Bayern, darüber entscheidet der König, der die hohen Ämter vergibt!‹ ›Nicht bei uns!‹, schreit er. Ich: ›Das werden wir sehen!‹ Da fällt ihm nichts mehr ein, er schweigt tückisch. Auch seine Brüder glotzen feindselig. Sie wünschen mich alle zum Teufel, drei Todfeinde mehr. Wir werden uns wohl bald woanders begegnen … vielleicht auf der Walstatt. Reichsrecht vor Landesrecht – das muss ich – das werde ich durchsetzen!«
Otto kniff die Augen zusammen und starrte hinüber zu den Bayern. Edgith legte beruhigend ihre Hand auf die seine.
»Aber du darfst nicht alles auf einmal wollen! Du darfst sie nicht vor den Kopf stoßen! Wenn du von Anfang an übertreibst, wirst du alles verderben!«
Der König wollte etwas erwidern, doch im selben Augenblick spürte er eine Berührung und sah eine behaarte Hand auf seiner Schulter. Er fuhr herum und blickte in ein zerfurchtes, von einer Hiebnarbe entstelltes Gesicht, das zu einem kahlen, vogelartigen Kopf gehörte.
»Was willst du, Onkel Wichmann?«
»Oh, nichts Besonderes«, kam es mit einer Weinfahne aus dem fast zahnlosen Mund. »Die Männer sagten mir, hehe, kümmere dich mal um unseren König, wenn er sich schon nicht um uns kümmert. Und um unsere schöne, traurige Königin!«
»Aber Onkel Wichmann, ich bin doch nicht traurig!«, sagte Edgith.
»Dann bin ich beruhigt, mein Kind.«
Der alte Kriegsmann trat hinter ihren Stuhl und küsste sie auf den Nacken.
»Verschwinde!«, sagte Otto ungehalten. »Du bist betrunken! Ich schätze es nicht, wenn man mir auf die Schulter haut und die Königin abschmatzt!«
»Wie? Was?«, protestierte Wichmann. »Ich werde mir doch noch erlauben dürfen, eine liebe Verwandte, hehe …«
Doch schon wurde er gepackt und fortgezerrt. Der König hatte einem in der Nähe stehenden Leibwächter ein Zeichen gegeben.
»Nun schwankt er davon und ist wieder einmal beleidigt«, sagte Otto, abfällig lachend.
»War das nötig?« Edgith hatte jetzt Mühe, ihre Verärgerung nicht zu zeigen. »Musstest du ihn so zurechtweisen?«
»Er muss lernen, dass er sich nicht mehr jede Freiheit herausnehmen darf, nur weil er mit der Schwester meiner Mutter verheiratet ist. Hat er dich besabbert? Ekelst du dich nicht vor ihm? Er hasst mich schon jetzt und bald wird auch er mein Todfeind sein, dessen bin ich gewiss. Er hält sich für einen großen Feldherrn und glaubt, als Verwandter der Liudolfinger ist er einer der Ersten im Reich und darf die höchsten Ansprüche stellen. Schon trompetet er überall herum, dass er demnächst das Kommando über alle sächsischen Truppen erhält. Dass er Markgraf an der unteren Elbe wird. Angeblich hat ihm mein Vater das zugesagt. Aber der liegt im Grab und ich kann auf dem Posten keinen brauchen, dessen letzte Heldentat viele Jahre zurückliegt. Keinen gealterten, versoffenen Höfling. Auch wenn er kluge Reden führt und alle glauben macht, niemand sei so gebildet wie er. Wundern wirst du dich, Onkel Wichmann, wen ich an deiner Stelle ernennen werde!«
»Er wird zu deiner Mutter gehen und sich beschweren. Und es wird wieder schreckliche Szenen geben.«
»Nun wenn schon. Mag sie zetern und mich einen Grobian, einen ungeschliffenen Tölpel nennen. Weil mir alter Adel, Ansprüche und Verdienste gleichgültig seien. Weil mir die Geheimnisse der Macht für immer verborgen bleiben würden. Gott sei gelobt! Ich bin nun König und nichts verpflichtet mich noch, ihr zuzuhören!«
»Das wird sie nicht hinnehmen. Ach, ich hab keine guten Ahnungen! Ich fürchte mich jetzt schon. Was soll daraus werden?«
Der König winkte dem Leibwächter, der den alten Wichmann gepackt und weggeführt hatte.
»Komm her, Gunzelin! Was hatte ich dir befohlen? Ich hatte gesagt: ›Halte dein Schwert über mich!‹«
Die Hand des Mannes, eines schwarzbärtigen Hünen, fuhr unter den weiten Mantel.
»Ach, Dummkopf, zieh es nicht aus der Scheide, nicht jetzt! Ich meinte damit: Du sollst nicht zimperlich und zurückhaltend sein und niemanden mehr als drei Schritte an mich heran lassen!«
»Ich dachte, Herr, weil es Euer Verwandter …«
»Verwandter, Herzog, Erzbischof, Papst oder sonst wer! Halte ihn auf, stoße ihn weg, überwältige ihn, wenn es sein muss! Sind deine Leute auf ihren Posten?«
»Ja, Herr!«
Der König bedeutete ihm, sich zu entfernen, und fuhr fort: »Es könnten einige hier im Saal sein, denen es nicht schnell genug geht. Sie spielen die Arglosen, trinken mir zu, feiern fröhlich und haben vielleicht schon in aller Heimlichkeit etwas vorbereitet. Das wäre doch mal eine große Sache: ein König, der noch am Tag seiner Krönung verreckte! Der Täter könnte ein Werkzeug Gottes, die Tat ein Zeichen von oben sein. Wer brauchte danach noch einen Herrscher, der dieses auseinander fallende Reich zusammenhielte? Später erführe man aus den Geschichtsbüchern, dass König Otto der Letzte nur einen Tag lang regierte!«
Er lachte laut auf. Einige, die in der Nähe saßen, blickten erstaunt zu ihm hin und tauschten flüsternd Bemerkungen.
»Ich bitte dich, Odda, du erschreckst sie!«, raunte die Königin.
»Warum? Der König ist heiter! Das kann ihnen doch nur recht sein. Es beweist ihnen, dass er nichts ahnt.«
»Odda! Hör auf damit.«
»Schon gut, ich werde schweigen.«
Eine Weile hielt er sich an sein Versprechen. Edgith saß kerzengerade und zwang sich, wieder zu lächeln. Otto, zurückgelehnt, zupfte an seinem blonden Bart und blickte gelangweilt auf das ausgelassene Treiben.
»Fressen, Saufen, Geschrei und die Misstöne der Musikanten«, bemerkte er schließlich. »Dabei fühlen sie sich sauwohl, das gefällt ihnen. Hinterher huren sie oder prügeln sich. Aber Festgelage sind unvermeidlich, wir müssen ja unsere Leute bei Laune halten. Auch teuer sind sie, weil alle Geschenke erwarten. Meinem Vater warfen sie vor, dass er zu selten Hoftage abhielt. Er wusste warum! Dabei verstand er gut, bei solchen Gelegenheiten neue Anhänger zu gewinnen und seine Stellung zu verbessern. Stundenlang ging er von einem zum anderen, hörte sich an, was sie ihm vorschwatzten, gab Ratschläge, erteilte Auskünfte, versprach Hilfe. Er behandelte sie wie seinesgleichen, wollte nur princeps inter pares sein. Regierte mit Schwurfreundschaften. Gelobte ihnen feierlich Freundschaft, nachdem sie ihm den Vasalleneid geleistet hatten. Meine Art ist das nicht. Nein, so werde ich das Reich nicht regieren, ich werde niemandem Freundschaft schwören! Von heute an bin ich nicht mehr Ihresgleichen – ich bin der Herrscher, dem man Gehorsam schuldet! Ich sitze auf meinem erhöhten Platz und rühre mich nicht von hier fort. Wer mit mir sprechen will, mag sich achtungsvoll nähern und aus gehörigem Abstand sein Anliegen vorbringen. Heimo, gib mir noch etwas Wein!«
Ein Diener, der mit zwei Kannen in den Händen wartete, trat heran.
»Und gieß tüchtig Wasser dazu, ich muss klaren Sinnes bleiben. Übrigens habe nicht gesehen, dass du den Wein gekostet hast. Es ist Herzog Hermanns Wein. Der ist zwar ein Freund, aber kann man wissen … Koste noch einmal!«
Der grauhaarige Diener goss gleichmütig etwas Wein in ein altertümliches Trinkhorn, das er von seinem Gürtel genommen hatte, trank und drehte es um zum Zeichen, dass es geleert sei.
Otto nickte befriedigt.
Er wollte seiner Gemahlin zutrinken, doch da bemerkte er die Träne, die über ihr schmales, blasses Gesicht lief.
»Was ist mit dir, Edgith?«, fragte er und versuchte, seiner etwas näselnden Stimme die zur Gewohnheit gewordene Schärfe zu nehmen. »Du lächelst, aber du bist nicht fröhlich. Schon wieder Tränen? Die sitzen dir wahrhaftig sehr locker. Höre, wir schicken gleich in den nächsten Tagen eine Gesandtschaft zu deinem Bruder, meinem teuren Schwager Aethelstan, den ich leider nicht kenne, obwohl wir schon sieben Jahre verheiratet sind. Mit einem kostbaren Geschenk, versteht sich, und mit der Nachricht, dass seine geliebte Schwester nun Königin ist. Es wird den Herrscher der Angelsachsen freuen, einen gleichrangigen Schwager zu haben. Was, denkst du, sollten wir ihm schenken?«
»Vielleicht ein Evangeliar«, sagte sie aufschluchzend und wischte mit einem Tüchlein die Träne von ihrer Wange.
»Meinetwegen ein Evangeliar. Es muss aber prachtvoll ausgeführt sein, damit es Eindruck macht. Mit schönen Bildern und Goldschrift.«
»Wir sollten es auch im Namen deiner Mutter schenken. Sie ist eine Heilige, mein Bruder verehrt sie. Und es wird sie ein bisschen versöhnen.«
»Versöhnen?« Otto trank einen Schluck und stellte den Goldpokal hart auf den Tisch zurück. Er schob das Kinn vor und blies ein paar Mal die vollen, stark geröteten Wangen auf, als wollte er sich zwingen, auf die letzte Bemerkung seiner Gemahlin keine Antwort zu geben. Aber dann konnte er, wie es nun einmal in seiner Natur lag, seinen Unmut nicht zurückhalten.
»Versöhnen?«, wiederholte er. »Hat sie denn einen Grund, schon wieder beleidigt zu sein? Beleidigt sein könnte doch eher ich! Sie wurde eingeladen – aber am wichtigsten Tag meines Lebens bleibt sie fort! Erscheint nicht zu meiner Krönung!«
»Es wird einen zwingenden Grund geben«, sagte Edgith beschwichtigend. »Vielleicht ist sie krank oder wurde unterwegs aufgehalten. Hoffentlich ist ihr nichts passiert! Sie trauert auch sehr um deinen Vater, er ist ja erst drei Monate tot. Da hielt sie es vielleicht nicht für angemessen, ein rauschendes Fest zu besuchen.«
»Ich glaube eher, sie könnte es nicht ertragen, nicht mehr die Erste im Reich zu sein. Du bist eine gute Seele, Edgith. Du grämst dich – als sei es deine Schuld, dass mein Vater tot und die hohe Frau Mathilde nur noch Königinmutter ist. Nach siebenjähriger Drangsal macht es dir ein schlechtes Gewissen, weil du die Heilige des Thrones beraubt hast. Sehr edel – doch völlig unnötig! Ich würde gern annehmen, dass meine Mutter nur der beschwerlichen Reise wegen nicht hier ist. Aber wahrscheinlich sitzt sie in Quedlinburg, am Grab meines Vaters, und grollt. Vielleicht grollt sie auch in der Merseburg, gemeinsam mit meinem Bruder Heinrich, ihrem Liebling. Natürlich grollen sie nicht deinet-, sondern meinetwegen. Weil der hässliche, plumpe Odda mit dem struppigen Bart und nicht der gertenschlanke, reizende Heinrich mit der gepflegten Lockenmähne nun König ist. Darüber werden sie nicht fertig! Vielleicht grollt noch ein Dritter mit ihnen, der mir am liebsten ans Leder gehen würde.«
»Ach, Odda!«, sagte die junge Königin, die ihre Verstimmung nun kaum noch verbergen konnte. »Siehst du denn überall nur Feinde? Meinst du Tammo?«
»Wen sonst?«
»Er ist ein guter Kerl und ich mag ihn!«, sagte sie mit einem strengen Blick auf ihren Gemahl.
»Ich mag ihn auch, aber er mag mich nicht«, erwiderte Otto und bemühte sich um ein harmlos-treuherziges Lächeln. »Warum ist er nicht gekommen? Die Boten mit der Einladung, die ich in Magdeburg absandte, können ihn unmöglich verfehlt haben. Andere aus der Ecke des Reiches, die ich zur Krönung lud, sind hier.«
»Auch er kann Gründe haben …«
»Vielleicht hat der Neid inzwischen seinen Verstand zerfressen. Der Neid ist ein böser Wurm und er begann schon an ihm zu nagen, als er, kaum sechs Jahre alt, meinen ersten Schrei hörte und man ihm sagte: Es ist ein Junge. Seine Stiefmutter hatte einen Sohn geboren. Er wird in dem zarten Alter schon geahnt haben, was das Leben für ihn bereit hielt: Unterordnung, Verzicht, falsche Hoffnungen. Aber muss er mich dafür hassen?«
»Er hasst dich nicht!«
»Oh doch, er hasst mich. Deshalb versuchte er auch er immer wieder, mich herabzusetzen. Lange Zeit war ich ja der Schwächere. Oft genug hat er mir heimlich ein Bein gestellt, als ich noch Kind war, und wenn ich dann auf die Nase fiel, verhöhnte er mich vor aller Ohren, meiner Blödheit und Ungeschicklichkeit wegen.«
»So etwas musst du ihm doch nicht mehr nachtragen!«
»Das tue ich auch nicht, obwohl ich allen Grund dazu hätte. Ich wäre sogar bereit, seine Stellung zu verbessern, ihm ein Amt zu übertragen … natürlich nur eines, wozu seine geringen Fähigkeiten ausreichen. Sogar die Nachlassregelungen meines Vaters, soweit sie ihn betreffen, ein bisschen zu seinen Gunsten zu verändern. Aber das Mindeste, was ich dafür verlangen kann, ist Anerkennung, Vertrauen, Treue. Auch von einem neidischen älteren Stiefbruder.«
»Eines vergiss nicht«, sagte Edgith noch einmal verweisend. »In ihm fließt dasselbe Blut wie in dir!«
»Das ist nicht zu bestreiten«, erwiderte Otto, wobei er sich in eine Ecke des Prunksessels drückte, eines seiner kurzen Beine über das andere schlug und mit dem Fuß wippte. »Aber in mir fließt es rascher und deshalb werde ich schneller sein als sie alle! Ich bin mit großem Abstand der Klügste in meinem Reich, alle diese Möchtegern-Herrscher bringen gemeinsam nicht so viel Verstand zusammen, wie ich hier in meinem dicken Kopf habe. Was immer sie planen – ich werde es herausfinden! Was immer sie unternehmen – ich werde ihnen zuvorkommen! Da ich nun einmal geboren bin, um König zu sein, will ich nicht vor der Zeit abtreten wie so viele, die dazu geboren wurden, weil sie nicht wachsam waren, weil sie unter Herrschen nur Prassen, Huren und das Treiben von Affenpossen verstanden. Nun sieh dir an, was die dort wieder anstellen! Würfeln, betrügen, beschimpfen sich. Gleich wird es losgehen, gleich werden Fäuste fliegen und einige werden sich blutige Köpfe holen. Ich sollte die Kerle vor die Tür setzen lassen, alle, auch wenn unter ihnen Prälaten und Grafen sind. Heute will ich noch nachsichtig sein, weil es der erste Tag meiner Herrschaft ist, aber ich werde ihnen klar machen müssen, wie sie sich künftig in Gegenwart ihres Königs und ihrer Königin zu benehmen haben. Wir sollten uns jetzt zurückziehen …«
Kapitel 2
Auf dem Wehrgang der Merseburg standen an einem kühlen Spätsommertag desselben Jahres unter wolkenverhangenem Himmel zwei Männer und blickten lange schweigend hinunter auf die bewaldete Ebene südöstlich des Burgbergs. Der Ältere, über die Fünfzig hinaus, weißhaarig, etwas gebeugt, mit den verwitterten Zügen des Kriegsmannes, war Markgraf Siegfried, ein Vetter der ersten Gemahlin des verstorbenen Königs Heinrich, der seit Jahrzehnten das Grenzgebiet zu den wendischen Kleinstämmen östlich von Elbe und Saale bewachte. Der Jüngere, um die Dreißig, war Thankmar, Tammo genannt, sein Großneffe, der einzige Sohn der Frau Hatheburg, die Heinrich nach kurzer Ehegemeinschaft verstoßen hatte, um eine andere zu heiraten. Er war hager und hoch gewachsen, unter seinem Helm stahl sich langes, weißblondes Haar in dünnen Strähnen hervor. Der düstere, stechende Blick und das trotzig vorgeschobene Kinn schienen seit langem und fast unveränderlich das Gesicht eines Mannes zu prägen, dessen Stellung nicht seinem Stolz entsprach.
»Ich möchte wissen, wo Asik bleibt«, sagte schließlich der alte Markgraf. »Vor neun Tagen brachte der Bote die Siegesmeldung. Die Mesaburier und die aus dem Hassegau müssten längst zurück sein. Siehst du auch nichts?«
»Nichts«, erwiderte Thankmar und wieder schwiegen sie eine Weile.
»Ich hoffe, er unternimmt nichts auf eigene Faust«, bemerkte dann der Markgraf. »Asik ist alles zuzutrauen. Mit wenigen Leuten hat er früher gut gesicherte Kaufmannszüge überfallen.«
»Bist du es gewesen, Onkel, der ihm das Kommando übertragen hat?«, fragte Thankmar.
»Nein, das war noch dein Vater selbst. Er verurteilte Asik zum Tode, weil er fünf Männer ermordet hatte, und dann unterhielt er sich mit ihm, begnadigte ihn und sagte zu mir: ›Der ist der Richtige, der soll die Mesaburier anführen!‹«
»Ich war immer dagegen, einen Heerhaufen aus Verbrechern zu bilden«, sagte Thankmar. »Solche Leute sind unzuverlässig, von Zucht und Gehorsam halten sie nichts. Auf die Dauer werden sie Schaden stiften. Ich habe das auch meinem Vater gesagt. Aber er hörte nicht auf mich, meine Meinung galt ja bei Hofe nichts. Galt niemals etwas!«, fügte er gallig hinzu.
»Ganz unnütz sind sie ja nicht, die dreckigen Schufte«, fand Markgraf Siegfried, die letzten Worte des Großneffen überhörend. »Und eigentlich war die Idee deines Vaters nicht schlecht. Diese Leute fürchten den Teufel nicht und verstehen, mit Waffen umzugehen. Wir haben in letzter Zeit so viele wehrhafte Männer auf den Schlachtfeldern verloren, dass es Verschwendung gewesen wäre, sie hinzurichten oder auf dem Sklavenmarkt zu verkaufen. Und seit sie hier sind, gibt es viel weniger Ärger mit denen von drüben. Und nun sollen sie sogar den Boleslaw bezwungen haben, den Böhmer …«
»Trotzdem«, sagte Thankmar schroff, »wenn eines Tages ich hier gebieten werde, dann …«
Er vollendete den Satz nicht, räusperte sich ärgerlich und rückte seinen Wehrgurt zurecht.
Der Markgraf warf ihm einen kurzen, forschenden Blick zu und sagte: »Wenn dieser Tag nahe wäre … Gottes Segen mit dir. Ich würde meine alten Knochen gern ausruhen. Du hättest gut daran getan, Neffe, nach Aachen zur Krönung zu reisen. Wer bei einem Machthaber etwas erreichen will, auch wenn es ein naher Verwandter ist, muss ihm huldigen und möglichst oft vor seinem Thron erscheinen.«
»Ich hätte es nicht ertragen, mit anzusehen, wie Odda den Thron bestieg!«, stieß Thankmar hervor. »Dieser Zwerg – den Thron des großen Karl!«
»Nun, Zwerg … damit untertreibst du wohl.«
»Er reicht mir kaum bis zur Schulter. Ich meinte es aber anders. Was steckt schon drin – in seinem runden Bauernschädel? Etwa die Fähigkeit zu herrschen?«
Markgraf Siegfried seufzte und sagte vorwurfsvoll: »Hast du es denn immer noch nicht verwunden, Tammo? Wozu soll es gut sein, dass du dich quälst und weiter hinauf starrst zu den Früchten, die nun einmal für dich zu hoch hängen?«
»Ich bin und bleibe der älteste Sohn König Heinrichs!«
»Aber seit er vor sieben Jahren seine Hausordnung verkündete, wusstest du, dass du nicht mehr sein Nachfolger werden konntest. Ich dachte, du hättest dich damit abgefunden. Froh sein kannst du, meine ich, dass du nicht als illegitim giltst.«
»Das wäre zum Himmel schreiendes Unrecht. Meine Mutter war rechtmäßige Gemahlin!«
»Der Bischof von Halberstadt war anderer Meinung.«
»Natürlich. Weil der Kirche ihr reiches Erbe entging.«
»Sie war Witwe und hatte bereits den Schleier genommen. Ich selbst war Zeuge der Zeremonie.«
»Aber sie hatte noch nicht alle Gelübde abgelegt. Die Ehe war gültig! Nur meine Stiefmutter wollte sich nicht damit abfinden, damit ihre eigenen Söhne bevorzugt wurden.«
»Wir wollen der hohen Frau Mathilde nicht Unrecht tun«, sagte der alte Markgraf tadelnd. »Sie konnte doch nichts dafür, dass damals dein Vater und vor allem dein Großvater nach einer noch reicheren Braut Ausschau hielten. Ich brachte, wie du weißt, deine Mutter ins Kloster zurück und erinnere mich, dass sie sehr gefasst war. Ihre Vorwürfe galten nur deinem Vater, nicht ihrer unschuldigen Nachfolgerin. Die war ja erst vierzehn Jahre alt, ein verschüchtertes kleines Mädchen, von Nonnen erzogen, vollkommen fremd in der Welt.«
»Es dauerte aber nicht lange, bis sich das verschüchterte kleine Mädchen gut in der Welt zurechtfand«, sagte Thankmar mit bitterem Spott. »Und da missfiel es ihr sehr, dass es darin einen wie mich gab.«
»Ich bitte dich, Tammo, Frau Mathilde, wenn sie das nächste Mal von Quedlinburg zu uns herüber kommt, nicht wieder durch Reden und Anspielungen zu reizen. Bedenke, sie hat als Königinmutter nach wie vor großen Einfluss. Ich verstehe, offen gesagt, noch immer nicht«, fuhr er nach kurzem Schweigen fort, »warum sie sich die Krönung entgehen ließ. Ihr Ältester erhielt die Krone des Reiches, alle Großen waren da und feierten ein Fest, aber sie kam hierher und besucht ihren Zweiten, den Heinrich.«
»Das hat zwei Gründe, Onkel. Der eine: Sie steht nun im Schatten von Oddas Frau Edgith, der neuen Königin, der Angelsächsin. Als Mutter des Königs nur die Zweite zu sein ist ihr aber zuwider – so zieht sie sich lieber ganz zurück. Der andere Grund: Sie kam, um ihren Hätschelbengel zu trösten.«
»Trost hatte er nötig, das ist wahr«, stimmte der alte Markgraf zu. »Dass sein Bruder ihn von der Krönung ausschloss und mir strengen Befehl gab, ihn nicht von hier fortzulassen, hatte ihn schwer getroffen. Mal wütete er und stieß Drohungen aus, dann wieder weinte er … es war nichts mit ihm anzufangen. Als seine Mutter kam, beruhigte er sich ein bisschen. Freilich beging sie wieder den Fehler, ihm einzureden, dass eigentlich er der Bessere sei und die Krone verdiente. Aber sie macht ja auch sonst kein Geheimnis daraus: Viel lieber hätte sie ihn auf dem Thron gesehen als Otto.«
»So ist es, sie kann ihren ältesten Sohn fast ebenso wenig leiden wie mich, ihren Stiefsohn«, sagte Thankmar. »Wie hat sie sich mit meinem Vater gestritten und immer wieder verlangt, er solle den Herzögen den ›Purpurgeborenen‹ empfehlen. Ihren Purpurgeborenen! Das habe ich selber von ihr gehört, zuletzt noch in Erfurt, beim Hoftag. Der Alte lag im Bett, man hatte ihn gerade zur Ader gelassen. Die Schüssel mit Blut stand noch da. Odda und ich standen auch herum, weil wir dachten, er stürbe. Plötzlich rauscht sie herein mit einem Schwarm von Bischöfen und Äbten. Am Tag zuvor hatte er Odda der Reichsversammlung empfohlen und nun verlangte sie, er solle die Empfehlung zugunsten Heinrichs zurücknehmen. Rannte auf und ab, rang die Hände, behauptete, Gott würde ihn strafen. Odda packte sie schließlich am Arm und schob sie hinaus. Vater blieb unnachgiebig, aber glaub mir, Onkel, das hat ihn mehr Kraft gekostet als die Schlacht bei Riade gegen die Magyaren.«
»Ich kann nicht finden, dass Heinrich geeigneter wäre«, bemerkte Markgraf Siegfried nachdenklich. »Er ist schlau, hat gute Anlagen, und – auch das muss man zugeben – er wäre der schönste König, der je regierte. Aber er ist gerade erst siebzehn Jahre alt. Ich erinnere mich nur mit Unbehagen an die Zeit, als das Kind regierte, Ludwig der Vierte, der Letzte vom Karolingerstamm. Da ging es drunter und drüber im Reich, und die Einzigen, die davon Vorteile hatten, waren die Prälaten.«
»Auch Odda ist viel zu jung und unerfahren. Schlimm wird es uns allen ergehen, Onkel – unter seiner Regierung! Wir müssen froh sein, wenn es uns gelingt, unser Eigentum zu retten. Sobald Odda aus Aachen zurück ist, werde ich das Erbteil meiner Mutter zurückfordern. Ungeteilt! Wozu hat es mein Vater behalten, als er sie ins Kloster zurückschickte? Für wen wohl? Für mich! Daran soll sich jetzt niemand vergreifen. Alles will ich … die Burg, das Land ringsum und später auch dein Amt, Onkel Siegfried. Das kann für ihn nur zum Vorteil sein. Wenn er dann als König gescheitert ist und ihn alle mit Hunden jagen, wird er mich hier in der Merseburg um Asyl bitten müssen. Wie freue ich mich auf diesen Augenblick!«
Thankmar stieß ein trockenes Lachen aus.
Der alte Markgraf seufzte, verzichtete aber auf eine Erwiderung. Er trat an eine der Zinnen und warf einen Blick hinunter.
»Was ist denn das?«, rief er erschrocken.
Unten bewegte sich langsam eine Kolonne von zwanzig, dreißig Männern den Burgberg herauf. Es war ein erbärmlicher Zug halbnackter Gestalten, die einen Karren zogen und schoben, auf dem ein paar Habseligkeiten, Waffen und blutige Lumpen lagen.
Als sie unter den Bäumen hervorkamen, sah der Markgraf, dass die meisten von ihnen mit Wunden bedeckt waren, humpelten und einander stützten.
Er erkannte gleich die Ersten.
»Mesaburier!«, schrie er hinunter. »Wo kommt ihr her?«
»Aus der Hölle!«, schrie einer herauf.
»Und die anderen? Unser siegreiches Heer?«
»Hat Boleslaw, der Teufel, geholt!«
Kapitel 3
Boleslaw aus dem Geschlecht der Presmysliden war der Fürst von Prag, der das Land Böhmen beherrschte. Obwohl er nur das tat, was alle taten, die Macht hatten und noch mehr davon wollten, verdiente er sich den Beinamen »der Grausame«. Dies vor allem, weil er im September 935 seinen Bruder Wenzel mit eigener Hand ermordet hatte, den ersten christlichen Fürsten seines Landes. Böhmen hatte nun einen heiligen Märtyrer und einen Tyrannen.
Gleich in seinem ersten Regierungsjahr suchte Fürst Boleslaw seine Macht nach Norden auszudehnen. Er griff einen der benachbarten slawischen Stämme an, der aber, von König Heinrich unterworfen, bereits den Sachsen tributpflichtig war. Sein Knes sandte Boten zu Markgraf Siegfried mit der Bitte um Waffenhilfe. Der schickte Asik mit seiner Schar begnadigter Verbrecher, die »Mesaburier«, verstärkt durch einen Haufen aus dem Hassegau. Es war nur ein kurzer Feldzug mit einer vernichtenden Niederlage.
Ermutigt durch den Erfolg Fürst Boleslaws und seiner Böhmer, erhob sich sogleich ein anderer slawischer Stamm, den König Heinrich bekämpft und tributpflichtig gemacht hatte – die Redarier. Ein Flächenbrand drohte, die Elbe schien als Reichsgrenze nicht mehr sicher zu sein. Das endlose Grenzgeplänkel mit den wendischen Kleinstämmen auf der anderen Seite, die offensichtlich den Wechsel an der Spitze des Reiches ausnutzen wollten, wurde plötzlich zur ernsten Bedrohung. Otto, der neue König, sah sich schon kurz nach seinem Regierungsantritt in einer kritischen Lage und musste schnell und entschlossen handeln. Er setzte mit einem Heer über den Unterlauf des Flusses und rückte in das Gebiet der Redarier ein. In der klugen Einsicht, dass seine eigenen militärischen Fähigkeiten begrenzt waren, ernannte er zuvor einen neuen Feldherrn, zu dem er Vertrauen hatte. Es war kein Fehlgriff. Hermann Billung bewährte sich glänzend, schlug den Aufstand nieder und die Redarier verschwanden in ihren schwer zugänglichen Rückzugsgebieten. Mehr war nicht zu erreichen. Die Sachsen kehrten zur Elbe in ihr Lager zurück, wo König Otto sie erwartete. Er belohnte seine erfolgreichen Kämpfer und ernannte ihren Feldherrn zum princeps militiae, zum Oberkommandierenden in den Gauen der unteren Elbe.
Mit dieser Entscheidung allerdings stach der junge König – wie mit fast allem, was er tat – in ein Wespennest. Ein halbes Dutzend sächsischer Edelinge, die auf einen so angesehenen und einträglichen Posten unter dem neuen Herrscher gehofft hatten, fühlte sich zurückgesetzt, wenn nicht beleidigt. Besonders einer machte kein Hehl aus seiner Enttäuschung und Verbitterung.
***
Am Tage nach der Rückkehr des siegreichen Heeres wurde das Lager abrissen und die Verschiffung über die Elbe vorbereitet. Zimmerleute überprüften noch einmal die Sicherheit der Boote und Flöße und das Beutegut wurde schon nach und nach hinübergebracht. Ein einziges Zelt war noch nicht abgebaut, das des Königs, der sich, nachdem er während der nächtlichen Siegesfeier kaum Ruhe gefunden hatte, auf seinem Lager ausstreckte, um abzuwarten, dass das Schiff, mit dem er übersetzen wollte, bereit war. Er wurde schläfrig, doch da man sich immer noch auf feindlichem Boden befand und alle Sinne auf Alarm eingestellt waren, schreckte er gleich auf, als er am Zelteingang ein Geräusch hörte.
»Was gibt es, Gunzelin?«
»Er ist wieder da«, antwortete der schwarzbärtige Leibwächter. »Wartet draußen.«
König Otto warf die Felldecke ab, richtete sich ächzend auf und setzte die Füße auf den Grasboden des Zeltes. Mit der Linken kratzte er sich die Brust, während er mit der Rechten nach der Bierkanne griff, die auf der Bank neben der Pritsche stand.
»Der denkt immer noch, dass er der Erste an meinem Thron ist«, sagte er verdrießlich. »Glaubt, dass ich mir nicht erlauben kann, seine Ansprüche zu missachten. Und wie ich es kann! Um mit den Wenden fertig zu werden, genügt es nicht, der Mann meiner Tante zu sein. Aber wie soll man ihm das nur klar machen, diesem aufgeblasenen alten Raufbold! Lass ihn hereinkommen.«
Gunzelin ging hinaus. Otto setzte sich auf die Bank, gähnte, fuhr sich ein paar Mal mit allen zehn Fingern durch das bis auf die Schultern fallende Haar und langte nach seinem Wehrgurt. Von draußen ertönte Kommandogebrüll. Ein Windstoß ließ die Pfosten des Zeltes erzittern.
Im Zelt erschien Wichmann, der ältere der beiden Billunger. Er trug einen bis an die Knöchel reichenden Bärenfellmantel, aus dem sein kleiner, kahler Vogelkopf mit der Hiebnarbe etwas kümmerlich hervorsah. Gunzelin trat hinter ihm ein und blieb am Zelteingang stehen.
»Was willst du schon wieder, Onkel Wichmann?«, fragte der König, ohne aufzublicken und mit der Schnalle seines Gurtes beschäftigt.
»Ich habe mit dir zu reden«, krächzte der alte Kriegsmann. »Aber schicke den dort erst hinaus.«
»Einen Schluck Bier?«, fragte Otto, ohne die Aufforderung zu beachten. »Da steht noch eine halbvolle Kanne.«
Wichmann nahm die Kanne, trank und verzog das Gesicht.
»Das bekommt mir nicht, ich vertrage kein Bier.«
»Ja, natürlich, du trinkst lieber Wein. Lässt ihn dir sogar aus Italien und Spanien kommen. Zur Sache! Ich bin überrascht, Onkel, über das, was man mir vorhin meldete. Ein Teil deiner Leute sei schon bei Sonnenaufgang über die Elbe gegangen und abgerückt. Ist das wahr? Ich kann es nicht glauben.«
»Es stimmt«, erwiderte Wichmann ärgerlich, weil diese Einleitung des Gesprächs ganz und gar nicht nach seinem Geschmack war. »Einige Haufen sind schon …«
»Hast du selbst den Befehl gegeben?«, unterbrach ihn der König.
»Wer sonst? Ich dachte …«
»Seltsam«, sagte Otto, der noch immer keinen Blick auf den Besucher geworfen hatte und nun damit beschäftigt war, Grashalme von seiner Hose zu pflücken. »Weit ist es ja nicht bis zu deiner Grafschaft, dem Bardengau. So hätten sie eigentlich warten können, bis für alle der Befehl zum Rückmarsch gegeben wurde. Warum diese Hast? Hattest du Angst um deine Beute? Dachtest du, die Redarier könnten zurückkommen und sie dir wieder abjagen?«
Der alte Wichmann schnappte nach Luft. Da war er gekommen, um sich zu beschweren, doch kaum hatte er den Mund aufgetan, warf ihm Otto einen Brocken hinein, an dem er würgen musste.
»Aber … aber … was unterstellst du mir da? Feigheit? Habgier?«
»Nur Leichtsinn und Ungehorsam!« Otto stand auf und richtete so plötzlich den Blick seiner kleinen, funkelnden Augen auf den Besucher, dass dieser erschrak und unwillkürlich einen Schritt zurückwich. »Den Befehl zum Rückzug gibt der Feldherr oder – wenn er, wie in diesem Fall, im Lager anwesend ist – der König. Hat dir einer von beiden den Befehl erteilt?«
Das war ein noch härterer Brocken. Die Lippen des Alten zitterten, jedes Barthaar schien sich zu sträuben.
»Der Feldherr?«, stieß er stammelnd hervor. »Ich kann es nicht glauben … noch immer nicht! Du erwartest von mir … mutest mir zu, meinem jüngeren Bruder zu gehorchen, der … der so jung ist, dass er mein Sohn sein könnte. Das … das soll ich … soll ich hinnehmen …«
»Ich weiß, ich weiß, es ist bitter für dich!«, sagte der König. Indem er die Hände auf dem Rücken verschränkte, begann er mit kurzen Schritten um seinen alten Verwandten herum zu gehen. Wichmann suchte der Bewegung zu folgen, drehte sich trippelnd, sein Vogelkopf ruckte vor und zurück.
»Aber du wirst dich damit abfinden müssen«, fuhr Otto fort. »Seit gestern ist dein Bruder Hermann mein princeps militiae für alle Gaue an der unteren Elbe, der oberste Heerführer gegen Dänen, Abodriten, Liutizer. Er ist damit allen Grafen des nördlichen Sachsenlands vorgesetzt – auch dir!«
»Aber … aber dann ist er ja fast so viel wie ein Herzog! Das ist doch … das ist ein Scherz …«
»Ich scherze nicht, Onkel Wichmann!«, sagte Otto schneidend. »Und was dich betrifft … du solltest stolz darauf sein, dass es dein Bruder Hermann war, der die Redarier so glänzend besiegt und uns damit an den Wenden gerächt hat – für die Niederlage der Mesaburier. Dass er sich damit den hohen Posten verdient hat. Eine Ehre ist das für die ganze Familie der Billunger!«
»Die Redarier hätte ich auch besiegt!«, ereiferte sich der Kahlkopf. »Viel besser und vollständiger! Hermann hat Glück gehabt, dass es gut ging! Dabei hat er nur Fehler gemacht, er griff zu spät an und verfolgte sie nicht und … und überhaupt ist er ein Grünschnabel, macht alles falsch. Ich war unter den Ersten, die vor acht Jahren die Brandenburg stürmten! Bei Gana war ich dabei und bei Lenzen! Wie viele Wendendörfer hab ich dem Erdboden gleich gemacht! Dein Vater schätzte mich hoch. Du aber … du erniedrigst mich. Wofür hältst du mich?«
»Wofür ich dich halte?« Otto blieb stehen, griff mit beiden Händen in den Bärenpelz und zog Wichmann zu sich heran. »Für einen alten Hahn, der seine schönsten Federn längst verloren hat. Der nur noch krähen kann, schrill und misstönend. Der hinter meinem Rücken hetzt, der behauptet, ich sei ein bösartiger Gnom, meine Frau ein dummes Schaf, meine Mutter heiliger als der Papst und mein Bruder Heinrich der wahre Thronerbe. So hat man es mir berichtet.«
»Niederträchtige Schmähung! Verleumdung!«
»Das wohl nicht. Doch sei versichert, es wäre mir vollkommen gleichgültig, wenn ich dir zutrauen könnte, ein Heer zu führen. Wenn du imstande wärst, den empfindlichsten Teil der Reichsgrenze zu sichern. Wenn ich überzeugt wäre, in dir einen Vollstrecker meines Willens zu finden. Wenn du einer von denen wärst, die mir helfen könnten, die gewaltige Aufgabe anzupacken, die uns die Völker jenseits der Elbe stellen. Dein Bruder Hermann ist der Richtige. Was dich betrifft … du solltest dich ausruhen.«
»Ah, ausruhen soll ich mich! Willst du mir auch noch den Bardengau nehmen?«
»Wie kommst du darauf? Was hältst du von mir? Ich sollte so grausam sein, einen alten Hahn von seinem Misthaufen zu vertreiben? Oh nein! Dort können dich die Hühner noch lange bewundern.«
Der König wandte sich ab, zum Zeichen, dass das Gespräch für ihn beendet sei.
»Das tust du nur«, sagte Wichmann hartnäckig, »weil ich dich damals, Odda … damals, als dein Lehrer … weil ich dich immer scharf herannahm … dich nicht vorzog als Sohn des Königs. Dein Vater war damit einverstanden, aber du … du kannst mich seitdem nicht leiden … Dabei verdankst du mir alles … alles, was du vom Krieg und vom Waffenhandwerk verstehst … das verdankst du mir … nur mir …« Plötzlich trat er mit ein paar taumelnden Schritten beiseite. »Aber was ist das? Ich sehe nichts mehr, mir wird schwarz vor Augen … Das Bier … es war nicht mehr gut …«
Er machte zwei schwankende Schritte und ging plötzlich in die Knie. Gunzelin sprang hinzu, hielt ihn aufrecht. Der Kahlkopf war auf die Brust gesunken.
»Graf Wichmann hat anscheinend einen Schwächeanfall«, sagte König Otto. »Zwei Dinge verträgt er nicht: unser Bier und die Wahrheit. Bring ihn zu seinem Zelt, Gunzelin. Und schick ihm den Medicus.«
Er fasste zu, als sich der herkulische Wächter den stöhnenden Alten wie einen Sack auf den Rücken lud.
»Hoffentlich hast du es nun begriffen«, murmelte Otto, nachdem Gunzelin mit seiner Last das Zelt verlassen hatte. Er nahm die Bierkanne, trank sie leer, warf sie weg und nach seiner Gewohnheit, Gespräche fortzusetzen, auch wenn niemand mehr anwesend war, ging er, die Hände auf dem Rücken verschränkt, in dem engen Raum auf und ab.
»Dankbarkeit forderst du, Onkel Wichmann? Was verdanke ich dir denn schon? Was bin ich dir schuldig? Als Lehrer im Waffenhandwerk hast du mir nicht viel beibringen können. Jedenfalls war es nicht mehr als das, was du allen Jungmannen beibrachtest – vorwärts stürmen und tüchtig draufhauen. Was ich als König über den Krieg wissen muss, konnte ich bei dir nicht lernen … Ja, ich weiß, du hast manches Heldenstückchen geliefert. Warst im dicksten Getümmel ein tollkühner Kämpfer. Zeigtest uns hundert Mal deine Narben. Aber was nützt es mir heute, wenn schon beim ersten Anstürmen Hunderte solcher Giganten im Pfeilregen der Magyaren niedersinken, ohne nur einen einzigen Schwertstreich zu tun! Solche Helden kann ich nicht brauchen!«
Otto gab der hölzernen Bierkanne, die auf dem Zeltboden lag, einen Fußtritt und traf den Mann, der im selben Augenblick eintrat. Es war Hermann, der jüngere der beiden Billunger. Als Einziger im Feldlager hatte er freien Zugang zum König und musste nicht angemeldet werden. Die beiden waren fast gleichaltrig, hatten dieselbe Erziehung genossen und waren schon als Kinder unzertrennlich gewesen.
Hermann rieb sich das Schienbein.
»Kein schlechter Schuss, König«, sagte er. »Aber du solltest versuchen, den Feldherrn des Feindes außer Gefecht zu setzen – nicht deinen eigenen!«
»Danke für den Rat«, erwiderte Otto. »Bei der nächsten Belagerung stellst du mich unter die Katapultschützen.«
Sie gaben sich lachend die Hand. Hermann Billung, nur wenig größer als der König, hager, mit grauen Augen, scharf geschnittenen, kantigen Zügen und einem gesträubten, verwegenen Schnurrbart, riss sich die Fellkappe vom Kopf und warf sie auf die Bank.
»Wichmann war bei dir? Hat er sich noch einmal beschwert?«
»Ja«, sagte Otto. »Dein Bruder trat zu seinem letzten Gefecht an und musste vom Schlachtfeld getragen werden.«
»Ich sah es. Seit gestern spielt er den Kranken.«
»Aber vor allem den Gekränkten.«
»Ich hörte gerade noch, wie du sagtest, dass du solche Helden nicht brauchen kannst.«
»Jedenfalls nicht zu viele davon und nicht an der Spitze des Heeres. Zu viele Helden im Heer sind die beste Voraussetzung für eine Niederlage.«
Die alten Freunde lachten.
»Inzwischen hast du noch einen weniger davon in deinem Aufgebot«, sagte Hermann. »Ich weiß aber nicht, ob er mehr Held oder Maulheld war.«
»Wen meinst du?«
»Ekkehard, Liudolfs Sohn.«
»Was ist mit ihm?«
»Er ist tot. Rannte in eine Falle und wurde von den Redariern niedergemacht. Mit ihm noch siebzehn andere.«
»Ist das wahr?«, rief Otto. »Wie das?«
»Ich hab mich beeilt, um es dir zu melden. Ein Einziger kam davon, verwundet. Sie waren neunzehn und alle anderen liegen jetzt da hinten im Moor. Möchte wissen, welcher Teufel diesen Ekkehard ritt, die geschlagenen Wenden noch einmal anzugreifen!«
Der König ließ sich auf die Bank sinken.
»Der Teufel war ich«, knurrte er.
»Das erkläre mir«, sagte der Billunger.
»Die Erklärung ist einfach: Wenn du solchen Herren etwas verbietest, dann tun sie es gerade! Das hätte ich bedenken müssen.«
»Wusstest du denn davon, dass er …?«
»Ich hätte es ahnen müssen. Gestern Abend kam er zu mir, ganz grün vor Wut. Noch einer, der sich benachteiligt und übergangen fühlte. ›Warum ernennst du den Billunger zum Feldherrn, König? Ist er mehr wert als ein Sohn des Liudolf, aus alter Familie? Glaubst du, nur er kann ein Heer zum Sieg führen? Ich werde dir noch heute beweisen, dass ich mit weniger Männern einen viel größeren Sieg erringen kann!‹ Ich fragte ihn, ob er betrunken sei. Als ich aber merkte, dass es ihm Ernst war, sagte ich: ›Der Krieg ist zu Ende! Unser Ziel ist erreicht, sie sind unterworfen und werden wieder Tribut zahlen. Ich verbiete dir, noch einmal anzufangen!« Da machte er kehrt und ging beleidigt davon.«
»Und dann ging er von Zelt zu Zelt«, sagte Hermann, »und sammelte Freiwillige. Und als es heute Morgen hell wurde, zogen sie los. Hinein in den Sumpf, hinter dem die Burg liegt, in die sich die Redarier geflüchtet haben. Diese Wahnsinnigen! Dringen in ein Sumpfgebiet ein, das ihnen unbekannt ist, wo sich aber der Feind bestens auskennt und Wachen aufgestellt hat. Kaum sind sie drinnen, sehen sie sich umzingelt. Pfeile und Lanzen fliegen heran. Sie flüchten tiefer hinein, versinken in Moorlöchern, werden niedergemacht. Bis auf den einen.«
»Das kommt nur daher«, sagte König Otto, düster vor sich hin starrend, »dass sie nicht zu gehorchen gelernt haben. Nicht nur die Herzöge, nicht nur die Grafen … in diesem Reich ohne Zucht und Ordnung glaubt immer noch jeder kleine Edeling, er könne Krieg auf eigene Faust führen. Eine giftige Pflanze ist dieser Eigensinn, die man ausrotten muss!«, schrie er plötzlich. »Glück hatte er, der verdammte Ekkehard, Gott war ihm gnädig, er hat ein Grab im Sumpf, ist in Ehren ersoffen. Hätte ich es gewusst und ihn vorher erwischt – er hätte gehangen!«
Hermann Billung erwiderte nichts. Er kannte solche Zornesausbrüche seines Freundes, des Königs, der mit gerötetem Gesicht die Bewegung des Henkers beim Zuziehen einer Schlinge machte.
Sie schwiegen ein paar Atemzüge lang und Otto, der sich schnell beruhigte, fragte dann: »Hast du noch mehr so schöne Nachrichten?«
»Eine habe ich noch«, sagte Hermann. »Ein verspäteter Haufen aus dem Hassegau ist eingetroffen. Von denen erfuhr ich, dass es schlecht steht um Markgraf Siegfried. Er liegt im Sterben.«
»Das fehlte gerade«, bemerkte Otto. »Dann werden die Raben, meine geliebten Brüder, schon an der Beute zerren.«
»Und auf der Merseburg wird Unordnung herrschen«, ergänzte Hermann. »Und unsere östliche Flanke ist offen. Sorben, Daleminzier, Magyaren …«
»Ich werde darüber nachdenken«, sagte der König gedehnt, seinen großen, schweren Kopf hin und her wiegend, »wie ich den Raben die Beute entreißen kann.«