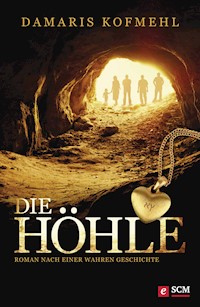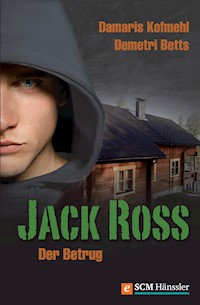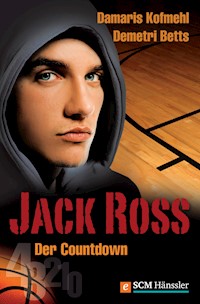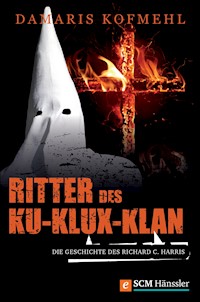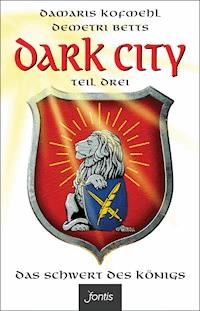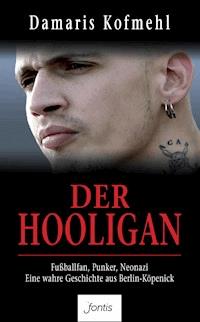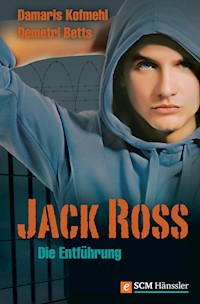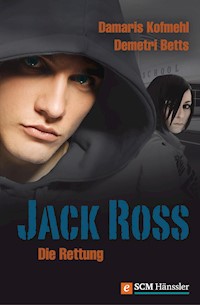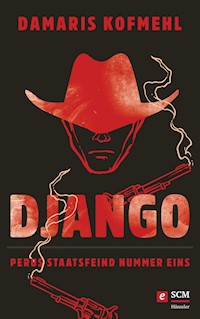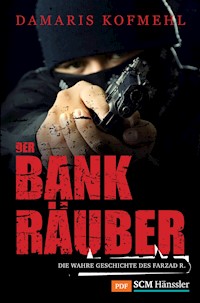Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SCM Hänssler
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nach dem erfolgreichen ersten Bibel-Thriller »Noah« der Bestseller-Autorin Damaris Kofmehl, geht es nun weiter mit ihrem nächsten Buch »Abraham«. Dieser ahnt schon als kleiner Junge: Irgendwo ist da ein Gott, der größer ist als alle anderen Götter, die um ihn herum angebetet werden. Jahre später hört er den Ruf dieses einen Gottes - und folgt ihm. Abraham verlässt alles, was er kannte, und zieht fort aus seiner Heimat im Vertrauen darauf, dass ihm ein neues Zuhause geschenkt werden wird - und ein Nachkomme. Über alle Hindernisse hinweg hallt Gottes Versprechen in Abraham wider: "Ich werde dich zu einem Vater vieler Völker machen." Als sich diese Verheißung endlich zu erfüllen scheint, wird Abrahams Gottvertrauen auf die härteste Probe seines gesamten Lebens gestellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SCM Hänssler ist ein Imprint der SCM Verlagsgruppe,die zur Stiftung Christliche Medien gehört, einer gemeinnützigen Stiftung,die sich für die Förderung und Verbreitung christlicherBücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.
ISBN 978-3-7751-7600-2 (E-Book)ISBN 978-3-7751-6138-1 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book: Satz: Satz & Medien Wieser, Aachen
© 2023 SCM Hänssler in der SCM Verlagsgruppe GmbHMax-Eyth-Straße 41 · 71088 HolzgerlingenInternet: www.scm-haenssler.de · E-Mail: info@scm-haenssler.de
Die Bibelverse sind folgender Ausgabe entnommen:Neues Leben. Die Bibel, © der deutschen Ausgabe 2002 und 2006 SCM R.Brockhaus inder SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen.Lektorat: Christina BachmannUmschlaggestaltung: Stephan Schulze, StuttgartTitelbild: Komposition: Unsplash - k-mitch-hodge und intricate-explorerAutorenfoto: © Nakischa ScheibeSatz: Satz & Medien Wieser, Aachen
Ich widme dieses Buch Tirza Schmidt,einer unglaublich starken Frau, derenGlaube so stark ist wie der Abrahamsund die sich durch nichts aufhalten lässt,ihre Berufung zu leben.
Inhalt
Über die Autorin
Über das Buch
Vorwort
Personen und Namensbedeutungen
1. Mose 11,27-12,3 | Die Suche
Blutmond
Gespräch in der Nacht
Der Streit
Terach
1. Mose 12,4-9 | Das verheißene Land
Der Aufbruch
Das Land, das ich dir zeigen werde
Die Orakeleiche
Ankunft in Sichem
1. Mose 12,10-20 | Ägypten
Eine schwere Entscheidung
Die Schönheit Sarais
Im Palast des Pharao
Der Gott Abrams greift ein
1. Mose 13-14 | Der Krieg der neun Könige
Lot und Amunet
Die Trennung
Die Schlacht
Harus letzte Mission
Rettung in der Nacht
Im Königstal
1. Mose 15-16 | Hagar und Ismael
Die Vision
Sarais Bitte
Hagars Flucht
Der Gott, der mich sieht
Ismael
1. Mose 17-19 | Sodom und Gomorra
Sarais Gebet
Abrahams Lachen
Die drei Wanderer
Ringen um Sodom
Unerwarteter Besuch
Die Meute
Das Gericht
1. Mose 21,1-21; 22 | Isaak
Ismaels Schicksal
Isaaks Lachen
Die schwerste Prüfung
Das Opfer auf dem Berg
Nachwort
Anmerkungen
Leseempfehlungen
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Über die Autorin
DAMARIS KOFMEHL ist Bestsellerautorin und erzählt wahre Begebenheiten als True-Life-Thriller, Fantasy und Biografien. Ihre Buchrecherchen führten sie unter anderem nach Brasilien, Pakistan, Guatemala, Chile, Peru, Australien und in die USA. Sie lebte lange unter Straßenkindern in Brasilien und heute wieder in ihrem Heimatland, der Schweiz.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Über das Buch
EIN VERSPRECHEN.EINE HOFFNUNG.EINE GLAUBENSPROBE.
Abraham ahnt schon als kleiner Junge: Irgendwo ist da ein Gott, der größer ist als alle anderen Götter, die um ihn herum angebetet werden. Jahre später hört er den Ruf dieses einen Gottes – und folgt ihm. Er verlässt alles, was er kannte, und zieht fort aus seiner Heimat im Vertrauen darauf, dass ihm ein neues Zuhause geschenkt werden wird – und ein Nachkomme. Über alle Hindernisse hinweg hallt Gottes Versprechen in Abraham wider: »Ich werde dich zu einem Vater vieler Völker machen.« Als sich diese Verheißung endlich zu erfüllen scheint, wird Abrahams Gottvertrauen auf die härteste Probe seines gesamten Lebens gestellt.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Geschichte Abrahams ist hochdramatisch und packend wie ein Thriller. Das wurde mir beim Schreiben einmal mehr bewusst. Was für ein unglaublicher Mann, was für ein unglaublicher Weg, den Gott mit ihm gegangen ist!
Vielleicht kennst du ja den einen oder anderen Ausschnitt aus seinem Leben, zum Beispiel die Vernichtung von Sodom und Gomorra, das bewegende Schicksal von Hagar und Ismael oder die menschlich kaum fassbare Erzählung der Opferung Isaaks. Das und vieles mehr ist Teil von Abrahams Geschichte, in die ich eingetaucht bin, um sie für dich, liebe Leserin und lieber Leser, greifbar zu machen.
In enger Anlehnung an den biblischen Bericht habe ich Szenen ausgeschmückt und Charaktere dazuerfunden, damit man beim Lesen das Gefühl bekommt, mittendrin im Geschehen zu sein. Ich habe auch einiges über Abrahams Zeit nachgeforscht und das Internet und meine theologischen Fachbücher dazu durchforstet. Zu einigen Aspekten findest du ein paar interessante Hintergrundinfos im Nachwort. Außerdem habe ich den Bibeltext immer und immer wieder durchgelesen und mich von Gott inspirieren lassen. Das Resultat ist der vorliegende Roman.
Ich hoffe, du findest die Geschichte Abrahams beim Lesen genauso faszinierend wie ich beim Schreiben. Und ich wünsche mir, dass dir das eine oder andere zur Inspiration für dein eigenes Leben wird. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei meinem Bibel-Thriller Abraham.
Damaris Kofmehl
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Personen und Namensbedeutungen
Terach – Vater von Abraham, Haran und Nahor
Abraham – Bedeutung: Vater vieler Völker (Abraham hieß bis zu seinem 99. Lebensjahr Abram, bis Gott ihm den Namen Abraham gab. Abram bedeutet: erhabener Vater.)
Haran – Bruder von Abraham, Vater von Milka und Lot
Nahor – Bruder von Abraham, verheiratet mit dessen Nichte Milka
Milka – Frau von Nahor, Schwester von Lot
Sara – Halbschwester und Frau von Abraham, Bedeutung: Fürstin, Prinzessin (Sara hieß bis zu ihrem 89. Lebensjahr Sarai, bis Gott ihr den Namen Sara gab. Was der Name Sarai im Unterschied zu Sara bedeutet, ist unklar.)
Isaak – Sohn von Abraham und Sara, Bedeutung: Kind des Lachens
Ismael – Sohn von Abraham und Hagar, Bedeutung: Gott hört
Hagar – Mutter von Ismael, Saras Magd
Lot – Neffe Abrahams
Elieser – ältester Knecht Abrahams
»Durch Noah habe ich den Menscheneinen Neuanfang geschenkt.Mit dir aber, Abraham, beginnt mein Rettungsplanfür die ganze Welt.«
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
1. Mose 11,27-12,3
Die Suche
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Blutmond
Im Stadtzentrum von Ur, Südmesopotamien,im 20. Jahrhundert v. Chr.
»Der Gefangene ist entkommen!«, hallte eine Stimme durch die Nacht.
Abram meinte, ihm müsste das Herz stillstehen. Es hatte begonnen. Das tödliche Ritual hatte begonnen und nichts und niemand konnte es jetzt noch aufhalten. Der Blick des zwölfjährigen Jungen schweifte hoch zum Blutmond, der schaurig und blutrot am Himmel stand. Es hieß, er wäre getränkt vom Blut der zahlreichen Opfer, die der Mondgott Nanna darbrachte, um das Land vor dem drohenden Unheil zu retten und den Zorn der sieben dämonischen Unterweltgötter zu besänftigen.
Warum die Götter bei jeder Mondfinsternis zornig waren, wusste niemand so genau. Nur eines wussten alle: Gelang es dem Mondgott nicht, ihren Zorn wieder abzuwenden, würde das Land in Chaos und Finsternis versinken und die Menschen würden in tiefste Verzweiflung und Not gestürzt. Mondfinsternisse waren gefährliche Vorboten für Hungersnöte und Seuchen, bis hin zu Krieg. Das Gleichgewicht der himmlischen Ordnung geriet durcheinander und die dämonische Unterwelt drohte die Macht zu übernehmen.
Dabei stand nicht nur das Wohlergehen des Volkes auf dem Spiel, sondern auch das Leben des Königs als Vertreter des ganzen Landes. Blieb er während einer Mondfinsternis auf dem Thron, war sein Tod unausweichlich. So hatten die Sterndeuter und Mondpriester es anhand der Konstellation der Sterne und Planeten auch dieses Mal vorausgesagt und dem König dringendst empfohlen, noch vor der Mondfinsternis abzudanken und einen Ersatzkönig einzusetzen, der für die Zeit des Blutmondes sein Amt übernähme und anschließend an seiner Stelle getötet würde. So würde der Zorn der dämonischen Götter sich am Ersatzkönig entladen, das Leben des echten Königs bliebe verschont und mit etwas Glück würde auch das drohende Unheil vom ganzen Volk abgewendet. Aber es musste geschehen, solange der Blutmond über dem Tempel Nannas stand, oder es wäre zu spät.
Das Ersatzkönigritual war ein grausiges Schauspiel, das in aller Öffentlichkeit stattfand. Von nah und fern waren die Menschen gekommen, um ihm beizuwohnen. Die gesamte Bevölkerung von Ur würde in dieser verhängnisvollen Nacht Zeuge der rituellen Tötung des unglücklichen Ersatzkönigs sein. Abram war dies alles zutiefst zuwider. Natürlich war ihm die Gefahr bewusst, die von einer Mondfinsternis ausging. Doch warum musste deswegen ein Unschuldiger sterben? Und was hatten sie alle denn so Schreckliches getan, um den Zorn der Unterweltgötter heraufzubeschwören?
»Der Gefangene ist entkommen!«, schallte die Stimme erneut über die Terrasse, über die langen Treppen und massiven Mauern des mächtigen Stufenturms und Tempels des Mondgottes Nanna hinweg.
Der zwölfjährige Abram stand zusammen mit seinem Vater und seinen beiden Brüdern ganz oben an der Treppe des Tempelturms. Mit ihnen zusammen hatten sich Tausende beim Tempel eingefunden. Dicht gedrängt standen sie unterhalb des Turms und oben auf der Terrasse und warteten auf den Gefangenen, der nicht wirklich entkommen war, sondern sich als Teil des Rituals von seinen Fesseln befreit hatte und nun gezwungen wurde, den Platz des Königs einzunehmen, um an seiner Stelle zu sterben.
Der Austausch des Königs hatte bereits am Abend stattgefunden. Man hatte irgendeinen Gefangenen ausgewählt und ihn zum Ersatzkönig gemacht. Und heute Nacht während des Blutmondes spielte man die Thronbesteigung erneut nach. Der Ersatzkönig würde den Thron besteigen, die bösen Vorzeichen auf sich nehmen und anschließend ermordet werden. Der echte König würde überleben und die Gefahr für das ganze Land wäre gebannt. Zumindest hofften das alle. Ganz sicher konnte man sich nie sein bei der Unberechenbarkeit der Götter.
Abram wurde speiübel, wenn er daran dachte, was er bald zu Gesicht bekäme. Es war das erste Mal für ihn, doch von den Erzählungen der anderen wusste er, was geschehen würde. Er wollte das nicht sehen. Es war so ungerecht und grausam! Warum waren die Opfer Nannas nicht genug? War er nicht der große Mondgott, der Herr von Ur? Hatte er nicht sogar die Macht, über Tote zu richten? Warum konnte er die sieben Götter der Unterwelt nicht ohne solch einen Mord besänftigen? Wo doch einer von ihnen, der Unterweltgott Nergal, sogar sein eigener Bruder war?
»Da kommt er! Schaut!«, rief jemand.
Der Blick des Jungen wanderte hinab zu den Menschenmassen unterhalb des Stufenturms. Die Menge teilte sich. Und da sah er ihn. Wie benommen stolperte der in Lumpen gehüllte Gefangene zwischen den Menschen hindurch und schleppte sich die lange von Fackeln beleuchtete Treppe hinauf. Jeder Schritt, den er tat, jede Stufe, die er erklomm, schien ihn unsägliche Kraft zu kosten. Er wusste, was ihn erwartete. Jeder wusste es. Er erklomm den Berg seiner eigenen Hinrichtung. Sein Leben für das des Königs. Sein Tod für die Rettung des Königs und des gesamten Volkes.
Zwei Krieger und zwei Priester begleiteten den Mann. Eine Schwere hing in der Luft, eine Finsternis, die man mit Händen greifen konnte, während der Blutmond sein gespenstisches Licht auf den Tempelturm warf. Es kam Abram vor, als würde das gesamte Universum den Atem anhalten.
Jetzt hatte der Gefangene die oberste Stufe erreicht. Er stolperte und fiel der Länge nach hin, gleich neben Abram. Die Menschen wichen zurück. Nur Abram blieb wie erstarrt stehen und schaute voller Mitleid und Entsetzen auf den Mann hinab, der zitternd neben ihm auf dem Boden kniete. Sein Anblick ging ihm durch Mark und Bein. Er sah die Verzweiflung in seinen Augen, die reine Todesangst.
»Auf! Weiter!«, schimpfte einer der Krieger und zog den Gefangenen wieder auf die Beine.
Eine Schneise bildete sich in der Mitte der Menschen und der Ersatzkönig trat seinen letzten Gang über die Terrasse an. Er ging auf den Thron zu, der vor dem Eingang des Tempels des Mondgottes aufgebaut worden war.
»Komm, Abram, lass uns einen besseren Platz ergattern«, sagte Abrams Bruder Haran und zog den Jungen am Ärmel hinter sich her. Abram wollte eigentlich gar nicht weiter nach vorne, doch von einer zwiespältigen Neugier gepackt, folgte er seinem älteren Bruder. Sie nutzten die natürliche Schneise, die sich in der Menge gebildet hatte, und gelangten unmittelbar hinter dem Gefangenen in die vorderste Reihe der Zuschauer. Hier blieben sie stehen und hatten freie Sicht auf den Thron und den Tempel, den König und all seine Ratgeber, Astronomen, Zauberer und Tempelpriester. Vor den mächtigen Tempelsäulen brannten zwei riesige Feuer in Feuerschalen. Die Bühne für das Ersatzkönigritual war vorbereitet.
Der Gefangene taumelte zum Thron, auf dem der Königsmantel und die königliche Krone lagen. Der König selbst hatte sie dort wie beiläufig abgelegt. Nun schlüpfte der Gefangene zitternd in den königlichen Mantel, setzte sich die Krone auf und nahm auf dem Thron Platz. Wie die Zeremonie es verlangte, drehte sich der König daraufhin erschrocken um, ging auf den Mann zu und fragte ihn laut: »Wer seid Ihr, um auf meinem Thron zu sitzen und meinen Mantel und meine Krone zu tragen? Warum habt Ihr das getan?«
Der Gefangene antwortete nicht. Eigentlich hätte er sagen sollen, dass er nicht wisse, warum er das getan habe, und keinen triftigen Grund dafür nennen könne. Doch er war außerstande zu sprechen und klammerte sich mit den Händen krampfhaft an der Thronlehne fest, das Gesicht aschfahl vor Furcht.
»Ihr nehmt meinen Platz ein und könnt keinen Grund dafür nennen?«, rief der König theatralisch und wandte sich den Omendeutern zu. »Was ratet ihr mir, Deuter der Omen? Wie soll ich mit diesem Mann verfahren?«
Ein Mann in einem wallenden dunkelblauen Gewand, mit goldenem Kopfschmuck und einem langen Bart trat vor und verkündete das Urteil: »Dieser Mann hat sich der königlichen Insignien bemächtigt und ist damit an Eurer Stelle König geworden, o Herr. Somit muss er an Eurer Stelle den Tod erleiden, der durch die Omen vorausgesagt wurde, um das himmlische Gleichgewicht wiederherzustellen und den Zorn der Götter von Euch und uns allen abzuwenden!« Er wandte sich dem Ersatzkönig zu. »Seid Ihr bereit, die Vorzeichen auf Euch selbst zu nehmen und zu sterben?«
Die Lippen des Ersatzkönigs zuckten. Er brachte keinen Ton heraus.
»So sei es!«, rief der Omendeuter.
Er zog einen langen Dolch unter seinem Gewand hervor und schritt auf den Thron zu. Abram biss sich auf die Lippen und knetete nervös seine Finger. Sein Herz raste. Jetzt war es so weit. Zwei Krieger traten auf je eine Seite des Thrones und hielten den Ersatzkönig an den Armen fest, während der Omendeuter den Dolch zum klaren Nachthimmel emporhob und Gebete vor sich hin murmelte. Abram hielt es kaum noch aus. Wie gebannt starrte er auf den Dolch und vom Dolch auf den Gefangenen in dem Königsmantel, der nun heftig atmete und strampelte und vergeblich versuchte, sich aus den Griffen der Krieger zu winden, die ihn auf dem Thron festhielten.
Abram wollte die Augen schließen, um die Ermordung des Ersatzkönigs nicht mitanzusehen. Aber er konnte seinen Blick nicht von der makabren Szene abwenden. Sie zog ihn wie magisch in ihren Bann. Dann ging alles ganz schnell. Der Omendeuter beugte sich über den König und mit einer ruckartigen Bewegung rammte er ihm den Dolch mitten ins Herz. Kein Schrei drang aus der Kehle des Unglücklichen. Der Gefangene zuckte noch einmal, dann sackte er auf dem Thron zusammen. Die Krone fiel ihm vom Kopf und rollte über den steinernen Boden.
Nun war es totenstill. Keiner rührte sich. Niemand schien zu atmen. Die Stimmung war zum Zerreißen gespannt. Mit geweiteten Augen blickte Abram auf den toten Ersatzkönig, der zusammengesunken auf dem Thron saß. Er hatte das Gefühl, als würde der Dolch in seinem eigenen Herzen stecken. Der Omendeuter drehte sich um. Er riss den blutigen Dolch aus dem Körper des Mannes, breitete die Arme aus und reckte sein Kinn empor.
»Es ist vollbracht!«, rief er laut in die Nacht hinaus.
Einen Moment noch war es still. Dann brach die Menge in tosenden Jubel aus. Sie klatschten und hoben ihre Hände zum Himmel empor, sie dankten dem Mondgott, der in seiner Güte so viele Opfer dargebracht hatte, um die Menschen vor dem Zorn der Unterweltgötter zu beschützen, und der in seiner Barmherzigkeit den König gewarnt hatte, damit er rechtzeitig einen Ersatzkönig einsetzen konnte und nicht selbst sterben musste. Einige Menschen weinten vor Dankbarkeit. Viele lagen sich in den Armen.
Doch Abram hätte nur noch schreien können. Alles in ihm zog sich zusammen. Was war das für ein grausames Spiel, das die Götter mit den Menschen trieben, wo die Menschen ihnen doch täglich die nötigen Opfer brachten, den nötigen Respekt zollten und alle Regeln befolgten, die sie ihnen auferlegten? Ständig musste man vor ihnen kriechen und konnte nie wissen, was sie wirklich im Sinn hatten. Sie waren launisch, unberechenbar und zerstritten, doch die Menschen mussten ihren Zorn ertragen, an dem sie keinerlei Schuld trugen! Sie mussten sogar ihren König opfern, um sie zu besänftigen! Das war alles so falsch! So furchtbar falsch und makaber und verdreht! Merkte das denn keiner? Wo waren die Götter, wenn man sie wirklich brauchte? Wo waren sie, wenn man zu ihnen schrie? Wo waren sie? Gab es denn nicht einen, nicht einen einzigen Gott, dem das Schicksal der Menschen nicht egal war?
Wo seid ihr?!, schrie Abram in seinem Herzen, während er vom toten Ersatzkönig zum blutenden Mond hochsah. Tränen der Wut, Verstörung und Hilflosigkeit rollten dem Zwölfjährigen über die Wangen.
Wo seid ihr?!
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Gespräch in der Nacht
Siebzehn Jahre später, außerhalb von Ur
Finster war die Nacht. Finster waren Abrams Gedanken, die wie Peitschenhiebe sein Herz aufrissen. Unruhig wälzte der Neunundzwanzigjährige sich auf seinen Fellen hin und her und fand keinen Schlaf. Nichts machte Sinn. Einfach gar nichts. Es war alles so furchtbar leer und hoffnungslos. Ein einziger brodelnder Wirrwarr!
»Rede mit mir!«, flüsterte Abram. »Rede mit mir!«
»Abram?«
Eine zarte Hand berührte den jungen, kräftigen Mann an seiner Schulter. Abram zuckte zusammen und drehte sich seiner zierlichen Frau zu. Er konnte sie nicht sehen in der Dunkelheit. Doch allein ihre sanfte Berührung und die Art und Weise, wie sie seinen Namen aussprach, hatten etwas Beruhigendes an sich.
»Sarai?«
»Liebster, was ist los?«
»Es tut mir leid, Liebste, ich wollte dich nicht wecken.«
»Was hast du denn?«
»Nichts. Es ist nur …«
»Was?«
Abram tastete in der Dunkelheit nach Sarais Hand und hielt sie fest, als wäre es das Einzige, das ihm noch Halt gab.
»Meine Gedanken zerreißen mich fast.«
»Was für Gedanken?«
»Dunkle Gedanken. Verbotene Gedanken, die ich nicht haben dürfte. Und dennoch quälen sie mich. Ich halte es kaum noch aus. Aber ich will dich nicht damit belasten, Sarai. Ich will nicht, dass du denkst, dein Mann hätte den Verstand verloren.«
»Abram. Wie könnte ich jemals so etwas von dir denken? Wir kennen uns seit unserer Kindheit. Ich bin deine Frau. Es gibt nichts, was du mir nicht erzählen könntest.«
»Du würdest es nicht verstehen.«
»Was nicht verstehen?«
»Ich kann nicht«, stöhnte Abram. »Ich … ich kann das einfach nicht mehr!«
»Was kannst du nicht? Wovon redest du?«
»Ich muss raus.«
»Abram!«
Abram warf mit einem Ruck die Felle des Bettlagers zurück und sprang auf. Barfuß stolperte er über die Teppiche ihres geräumigen Nomadenzeltes, hob den Zipfel der Eingangsdecke aus Ziegenfell leicht an und schlüpfte ins Freie. Ein kühler Wind wehte ihm ins Gesicht. Doch Abram war nicht kalt. Ihm war glühend heiß und sein Herz hämmerte wie verrückt gegen seine Brust. Er hob seinen Blick zum Himmel, zu der Mondsichel und den Sternen, die sich wie eine Kuppel, wie ein gewölbter Teppich aus Milliarden von Lichtern von einem Horizont zum anderen erstreckten. Sie hatten etwas Magisches an sich, etwas Majestätisches, Unergründliches und gleichzeitig Beschützendes und Tröstliches. Abram fühlte sich immer winzig klein, wenn er in den Sternenhimmel blickte, aber nicht verloren oder unwichtig, ganz im Gegenteil. Er fühlte sich eher so, als wäre er Teil von etwas Großem, Gewaltigem, das er allerdings nicht zu ergründen vermochte. Doch er spürte es tief in seinem Inneren. Da war etwas, das größer war als der Mondgott Nanna, mächtiger als der Windgott Enlil oder der Feuergott Nusku, ja, als alle Götter zusammen. Er hatte keinen Namen dafür, auch keine Vorstellung.
Er wusste nur das eine: Da ist mehr!
Dieser Blick in den Himmel erfüllte ihn jedes Mal mit Ehrfurcht und Neugier zugleich. Aber nicht heute Nacht. Alles, was er heute Nacht empfand, war eine tief sitzende Verwirrtheit. Und eine lähmende Angst. Angst davor, was wäre, wenn er seinen gefährlichen Zweifeln noch mehr Raum gewährte. Angst davor, dass alles, seine ganze Welt, sein ganzes Leben, vielleicht sogar seine gesamte Familie auseinanderbrechen würde, wenn er sich noch eine einzige weitere dieser Fragen erlaubte, die sich seit Jahren wie eine bedrohliche Dunkelheit auf ihn herabsenkten und ihm manchmal schier die Luft abschnürten. Und heute Nacht schienen all diese Gefühle ihren Höhepunkt zu erreichen.
Wahrscheinlich lag es daran, dass er am Nachmittag mit seinem Vater und seinen Brüdern auf dem Tempelturm gewesen war, dem Götterberg, wie sie den Stufenturm in Ur auch nannten. Dort in der Tempelhalle vor der gewaltigen steinernen Statue des Mondgottes hatten sie gekniet und ihn um Vermehrung ihrer Schaf- und Ziegenherden gebeten, um Wohlstand und Gesundheit für ihre Familie und zuletzt um Fruchtbarkeit für ihre Frauen.
»Ganz besonders flehen wir für den Schoß Sarais, o großer Nanna«, hatte Terach gesagt und Nahor hatte Abram auf dem Heimweg eine kleine tönerne Figur der Fruchtbarkeitsgöttin Inanna zugesteckt und ihm zugeflüstert, Sarai solle sie in der Nacht beim Liebesspiel in der Hand halten. Das würde bestimmt helfen. Abram hatte ihm die Statue mit einem verärgerten Blick zurückgegeben und den ganzen Nachmittag kein einziges Wort mehr gesagt und dumpf vor sich hin gebrütet. Er hatte das alles so was von satt! Er konnte es nicht mehr hören! All diese Götter, all diese Beschwörungsformeln, Zaubersprüche, Heiltränke und Opfergaben, das war alles so sinnlos und krank. War er eigentlich der Einzige, der das so sah?
»Abram?«
Abram war so in Gedanken versunken gewesen, dass er gar nicht bemerkt hatte, dass seine Frau neben ihn vor das Zelt getreten war.
»Willst du mir nicht sagen, was dir den Schlaf raubt?«, fragte sie, legte ihre Hand auf seinen nackten Oberkörper und sah liebevoll zu ihm hoch. Sie war sehr zierlich und klein und da Abram von überaus großer und kräftiger Statur war, reichte sie ihm nur knapp bis zur Achselhöhle. Selbst im schwachen Mondlicht und mit ungekämmtem Haar und verschlafenem Blick fiel ihm ihre Schönheit auf, die wie die einer Prinzessin war.
Abram liebte Sarai über alles. Das hatte er von dem Tag an getan, als sie sich vor seinen Augen von einem Kind in eine wunderschöne junge Frau verwandelt hatte. Sarai war seine Halbschwester und zehn Jahre jünger als Abram. Ihre Mutter war eine Nebenfrau Terachs gewesen und bei Sarais Geburt gestorben. Als Sarai fünfzehn Jahre alt geworden war, hatte Abram sie zur Frau genommen. Eine enge Blutsverwandte zu heiraten, war nichts Ungewöhnliches und Abram hätte ohnehin keine andere außer ihr haben wollen. Sie war das mit Abstand schönste Mädchen, dem er je begegnet war. Sie war sanftmütig, klug und fleißig und schon mit dreizehn Jahren in ihn verliebt gewesen, wie sie ihm kürzlich gestanden hatte. Damit war sie bei Weitem nicht die Einzige. Viele Mädchen aus Ur warfen dem hochgewachsenen, gut aussehenden jungen Mann noch heute verstohlene Blicke zu, wenn er an ihnen vorbeiging. Manche versuchten sogar, ihn zu verführen, was ihnen aber nie gelang. Abram hatte nur Augen für seine Sarai.
Umso schmerzhafter war es für ihn, dass sie auch nach vier Jahren Ehe noch immer nicht schwanger geworden war, was in ihrer Kultur eine große Schande war und als Strafe der Götter angesehen wurde. Die entsprechenden Anspielungen und Bemerkungen seines Vaters und seiner Brüder gaben ihm jedes Mal einen Stich ins Herz.
»Ist es wegen mir?«, fragte die neunzehnjährige Sarai und holte Abram aus seiner Gedankenwelt.
»Wegen dir?«
»Quälst du dich meinetwegen herum? Weil ich unfruchtbar bin?«
»Nein, Liebling, nein. Wie kannst du so etwas denken?«
»Ich habe das mit der Statue Inannas gehört, die Nahor dir geben wollte. Milka hat es mir gesagt.« Sie ließ traurig ihre Hand von seiner Brust sinken. »Vielleicht sollten wir es probieren, Abram.«
»Was? Nein!«, rief Abram energisch aus. »Nein! Das tun wir nicht! Du glaubst diesen Schwachsinn doch nicht etwa auch? Man wird nicht schwanger, wenn man einen vollbusigen Tonklumpen in den Händen hält. Das ist purer Schwachsinn! Du willst wissen, was mir den Schlaf raubt? Genau das ist es! All diese Götter! Die Rituale! Die bösen Omen! Dieser ganze Wahnsinn!«
Sarai sah ihren Ehemann irritiert an. »Ich verstehe nicht.«
Abram kam nun regelrecht in Fahrt. Er konnte sich nicht mehr zurückhalten und es brach alles aus ihm heraus.
»Ich habe mich bemüht, Sarai. Jahrelang. Das habe ich wirklich. Ich habe versucht, die Götter zu erreichen. Nanna als Erstes. Schließlich ist er unser Hausgott. Aber da er offenbar taub ist, habe ich es mit allen anderen versucht. Ich habe sie alle angerufen: An, Enki, Utu, Ninlil, Enlil, Inanna, Nusku, jeden von ihnen. Selbst die sieben dämonischen Unterweltgötter! Aber ich erreiche sie nicht! Keinen von ihnen! Kannst du mir sagen, wieso? Wieso reden sie nicht mit mir? Sind sie zu beschäftigt? Wollen sie mich bestrafen? Oder können sie mich vielleicht gar nicht hören, weil es sie gar nicht gibt?!«
Sarai sah ihn erschrocken an. »Liebster, was sagst du da?«
»Entschuldige, Sarai.« Er schüttelte aufgebracht den Kopf. »Entschuldige, ich weiß, was für blasphemische Gedanken das sind. Aber ich kann an nichts anderes mehr denken. Ich weiß mir einfach nicht mehr zu helfen. Meine Gedanken treiben mich noch in den Wahnsinn.«
Abram ging ein Stück vom Zelt weg, fuhr sich mit den Händen durch sein gelocktes schwarzes Haar, schüttelte erneut energisch den Kopf, als könne er die Gedanken damit abschütteln. Dann stieß er die Luft aus den Wangen, ging ein Stück weiter und kehrte schließlich wieder zurück. Er war immer noch aufgewühlt, bemühte sich aber, seine Gefühle wieder einigermaßen unter Kontrolle zu bringen. Er mutete seiner jungen Frau ganz schön viel zu, dessen war er sich bewusst. Aber er konnte es nicht länger für sich behalten. Nicht einen Tag länger.
»Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht damit belasten und nun habe ich es doch getan.« Er wedelte mit den Händen durch die Luft. »Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Vergiss es einfach. Mach dir keine Gedanken darüber. Es genügt, wenn ich mich damit herumquäle.«
»Ich glaube, du quälst dich schon viel zu lange allein damit herum«, sagte Sarai und fasste seine Hand. Die anfängliche Verunsicherung in ihrem Gesicht wich einem Ausdruck von Mitgefühl und Verständnis. »Ich sage nicht, dass ich verstehe, was du sagst, aber … ich bin hier, Abram. Was auch immer dich beschäftigt, es macht mir nichts aus, es mit dir auszuhalten. Und mögen deine Gedanken noch so verrückt sein.«
»Wirklich?«
»Wirklich, Abram.«
»Danke, Sarai. Das bedeutet mir sehr viel.«
Abram zog Sarais Hand an seine Brust und umklammerte sie, während seine aufgepeitschte Seele allmählich ein wenig ruhiger wurde. Er hatte wirklich nicht vorgehabt, darüber zu reden. Doch jetzt, wo es ausgesprochen war, wo er endlich jemandem seine innere Verzweiflung gestanden hatte, schonungslos und mit allen damit verbundenen Risiken, fühlte er sich irgendwie erleichtert. Sarai hatte recht: Er hatte das schon viel zu lange allein mit sich herumgeschleppt. Eigentlich seit siebzehn Jahren. Seit jenem Tag, als er mit zwölf Jahren das erste Mal gesehen hatte, wie ein Ersatzkönig ermordet worden war. Da hatten ihn zum allerersten Mal Zweifel beschlichen und ein Gefühl der Ohnmacht gegenüber all diesen launischen Göttern, die die Geschicke der Menschen lenkten und vor denen man stets auf der Hut sein musste, weil man nie genau wusste, was sie als Nächstes vorhatten.
»Weißt du, Sarai, ich habe so viele Zweifel«, gestand Abram seiner Frau nach einer langen Pause. »So viele Fragen, die mir niemand beantworten kann. Hast du nie das Gefühl, dass unsere Gebete ins Leere gehen? Dass die Götter uns überhaupt nicht zuhören? Dass es ihnen im Grunde egal ist, wie es uns geht?«
»Ich weiß nicht, Abram …«
»Wir bauen ihnen Tempel. Wir verehren sie. Wir besingen sie. Wir stellen Figuren aus Metall, Holz und Ton her, um uns dann vor ihnen niederzuwerfen. Unser ganzes Leben richten wir nach ihnen aus. Und wozu? Sie lassen uns ja doch hängen, wenn wir sie brauchen, und eilen uns nicht zu Hilfe, wenn wir sie anrufen. Genauso gut könnten wir Steine aus dem Flussbett holen und diese anbeten. Es ist alles so sinnlos. So unfassbar sinnlos!«
Sarai schwieg. Was hätte sie auch sagen sollen. Abram atmete tief durch. Das Gefühl, dieses dunkle Geheimnis endlich mit jemandem teilen zu können, war unglaublich befreiend. Je mehr er darüber redete, desto mehr schien sich das erdrückende Gewicht, das seit Jahren auf seiner Brust lastete, von ihm zu heben.
»Weiß Vater davon?«, fragte Sarai schließlich.
»Niemand weiß davon. Du bist die Erste, der ich es erzähle.«
»Aber wirst du es ihm sagen?«
»Um Himmels willen, nein!«, rief Abram entsetzt. »Vater ist den Göttern treu ergeben. Ich werde es niemandem erzählen, nicht meinen Brüdern und ganz gewiss nicht Vater. Es würde ihn ins Grab bringen, dass sein Sohn die Götter anzweifelt. Dann wäre ich auch noch schuld an seinem Tod. Nein, ich werde schweigen bis zu meinem Lebensende. Ich fühle mich schon schlecht genug, dass ich überhaupt solche Gedanken habe. Aber sie drehen und drehen sich in meinem Kopf und ich werde sie nicht mehr los. Ich stelle Fragen und habe Angst, die Antworten darauf zu hören.«
»Was für Fragen?«
»Unzählige. Und hinter jeder Frage verbergen sich weitere Fragen, die noch gewagter, noch gefährlicher sind. Was, wenn ich recht habe? Was, wenn die Götter, die wir anbeten, gar keine sind? Was, wenn sie gar nicht existieren? Was würde das bedeuten? Dass wir komplett auf uns allein gestellt sind? Dass niemand da ist, der auf uns achtgibt? Dass unser irdisches Leben im Grunde völlig bedeutungslos ist? Hohl und leer wie die Götterstatuen, die wir anbeten?« Ein wehmütiges Seufzen ging durch seine Brust. »Ach, Sarai. Ich habe das Gefühl, im Treibsand festzustecken, und jeder meiner Gedanken zieht mich weiter in die Tiefe. Ich suche nach etwas und weiß nicht einmal, wonach! Was, wenn meine Suche ins Leere geht?«
»Was, wenn nicht?«, fragte Sarai zurück.
Ihre Frage blieb unbeantwortet, aber mit einem zarten Hauch von Hoffnung in der kühlen Nachtluft hängen. Abram hatte alles gesagt, was ihm auf der Seele lag. Dass ihm seine Frau so geduldig zugehört und seine Gedanken nicht als lächerlich oder verboten bezeichnet hatte, tat ihm unglaublich gut. Vielleicht, vielleicht würde er ja tatsächlich finden, wonach er suchte – was auch immer es sein mochte! Vielleicht würde am Ende seiner Reise nicht das Nichts auf ihn warten, sondern alles, wonach sein Herz sich sehnte. Vielleicht war sein Ringen nicht umsonst. Vielleicht ergab irgendwann alles einen tieferen Sinn.
Sie schwiegen beide eine lange Weile. Abram schlang von hinten seine Arme um Sarai und spürte ihren warmen Körper an seiner nackten Brust. Sein Blick wanderte hoch zum Sternenhimmel, der sich funkelnd über ihnen ausspannte. Je länger Abram zu den Sternen hochschaute, desto mehr wich seine innere Panik und Friede und Ruhe kehrten in seinen Körper und seinen Geist zurück. Und da hörte er sie wieder, diese leise, geheimnisvolle Stimme in seinem Innern, die ihm zuflüsterte, was er mit all seinen Sinnen zu erahnen glaubte, auch wenn er es nicht greifen konnte.
Da ist mehr!
Aber was?, fragte sich Abram. Was bloß?!
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Der Streit
Vierunddreißig Jahre später,am Stadtrand von Haran, Obermesopotamien
Sarai lachte frei und herzhaft. Ihre rechte Hand ruhte auf der Schulter ihrer Schwägerin Milka und Milkas Hand ruhte auf der ihren, während sie zusammen mit einer Gruppe von Mägden im Reigentanz um das große Feuer herumhüpften. Der alte Terach hatte die große Trommel hervorgeholt und gab den Takt vor, sein jüngster Sohn Nahor spielte auf der Flöte und Harans dreizehnjähriger Sohn Lot sowie Abram und sämtliche Knechte ihrer Sippe sangen aus voller Kehle uralte Hirtenlieder. Sarai liebte das Fest der Schafschur. Es war immer ein herrlich fröhlicher Anlass. Während die Männer über mehrere Tage von morgens bis abends mit dem Scheren der Schafe beschäftigt waren, bereiteten die Frauen die leckersten Speisen zu. Wenn das letzte Schaf geschoren war, feierten sie abends in der Mitte der Nomadenzelte ein großes Fest mit Musik, Tanz und Essen im Überfluss. Es gab Lammeintopf, gewürzt mit feinkörnigem Salz, mit Zwiebeln, Lauch, Milch und getrocknetem Gerstenbrot. Es gab Brot, das mit geriebenem Käse verfeinert wurde, gebratenes Ziegen- und Schaffleisch, Granatäpfel, Datteln, getrocknete Weinbeeren und Honig. Es gab Dattelwein und Krüge voll mit edelstem Bier. Alle feierten mit, die gesamte Sippe Terachs, alle Familien mit all ihren Mägden, Knechten, Sklaven, Hirten und ihren Kindern, dazu viele geladenen Gäste aus der Stadt Haran. Es waren fast dreihundert Menschen, die sich in der Mitte ihres Zeltlagers unter freiem Sternenhimmel versammelt hatten. Sie lagerten sich in kleinen Gruppen auf ausgelegten Teppichen und Polstern um silberne Schalen voller Fleisch, Brot und Früchte und aßen, tranken, plauderten und tanzten. Die Stimmung war hervorragend.
Sarais langes, gelocktes Haar wirbelte um ihre schmalen Schultern. Die goldenen Kettchen an ihren Fußgelenken und die vielen Armspangen an ihren Unterarmen klimperten lustig. Sie hatte sich schon lange nicht mehr so unbeschwert gefühlt. Ach, sie liebte es, zu tanzen! Sie schielte hinüber zu Abram, der sie offenbar schon eine ganze Weile beobachtete und ihr zulächelte wie ein verliebter Knabe. Sarai lächelte zurück und fühlte ein Kribbeln in ihrem Bauch wie damals, als sie sich als junges Mädchen hoffnungslos in ihn verliebt hatte. Er war schon immer ein Hingucker gewesen, groß, muskulös und braun gebrannt, mit schulterlangen Locken, die ihm verspielt ins Gesicht fielen. Er hätte jede Frau haben können. Aber er hatte sich für sie entschieden. Und ihre Liebe war so leidenschaftlich wie am ersten Tag. Auch nach all diesen Jahren begehrten sie einander immer noch und es wäre Abram nicht im Traum eingefallen, sich eine Nebenfrau zu nehmen, wie es sonst gang und gäbe war.
»Sarai, du bist die Liebe meines Lebens«, so pflegte er oft zu sagen. »Ich will keine andere. Nur dich. Ich will mit dir zusammen alt und schrumpelig werden, zweihundert Jahre alt oder mehr.«
Zweihundert Jahre alt zu werden war gar nicht einmal so abwegig. Ihr gemeinsamer Vater Terach war bereits hundertdreiundneunzig Jahre alt und sprühte noch immer vor Lebensenergie. Ihr Urgroßvater Serug war zweihundertdreißig Jahre alt geworden, einige ihrer Vorväter sogar über vierhundert Jahre alt. So alt wurden die Menschen allerdings nicht mehr. Sie erreichten hundertfünfzig bis zweihundert Jahre. Die dreiundfünfzigjährige Sarai und Abram mit seinen dreiundsechzig Jahren standen also in der Blüte ihres Lebens. Abram war stark wie ein Ochse und nahm es mit jedem Jüngling auf. Und Sarai war hübscher als alle jungen Mädchen der Stadt Haran zusammen. Das behauptete zumindest Abram. Vielleicht sagte er es auch nur, um sie darüber hinwegzutrösten, dass sie noch immer keine Kinder bekommen hatte. Sarai war unfruchtbar, was ihr schwer zu schaffen machte. Achtunddreißig Jahre waren sie schon verheiratet und noch immer hatte sie Abram keine Nachkommen schenken können. Kinderlosigkeit war ein furchtbares Schicksal. Ein Mann, der keinen Sohn hatte, hatte keine Zukunft. Es bedeutete, dass seine Familie mit ihm aussterben würde. Es war ein unsägliches Leid, das kaum zu ertragen war. Für Sarai war es noch viel mehr als das. Sie fühlte sich schuldig und machte sich große Vorwürfe, auch wenn sie nichts tun konnte, um es zu ändern. Manchmal weinte sie heimlich, vor allem, wenn ihre Schwägerin Milka ihr wieder einmal einen ihrer vielen gut gemeinten Ratschläge erteilte, was sie noch ausprobieren sollten und woran es liegen könnte, dass sie nicht schwanger wurde.
»Versucht es doch einmal mit einem Liebeszauber oder einem Fruchtbarkeitsritual. Du hast bestimmt Schuld auf dich geladen und die Götter mit irgendetwas verärgert, sonst würden sie nicht so viele Jahre deinen Schoß verschließen. Vielleicht musst du mehr beten. Ich sage es ja nur ungern, Sarai, aber viel Zeit bleibt dir nicht mehr. Noch ein paar Jahre, allerhöchstens ein Jahrzehnt, und du bist zu alt, um überhaupt noch Kinder zu gebären. Dann werden auch die Götter dir nicht mehr helfen können. Wir wissen beide: Abram braucht einen Erben. Und wenn du ihm keinen geben kannst, wird er gezwungen sein, eine andere zu heiraten. Vielleicht gibt er dir sogar einen Scheidebrief und schickt dich fort. Wer könnte es ihm verübeln!«
Solche Bemerkungen stürzten Sarai zuweilen in tiefste Verzweiflung, auch wenn ihr Abram versicherte, er würde so etwas niemals tun.
»Dich fortschicken? Wie kann sie nur so etwas behaupten?«, entgegnete er empört. »Ich würde dich niemals fortschicken, geschweige denn eine andere heiraten, nur, um Kinder zu bekommen. Du bist mir wertvoller als hundert Kinder, Sarai. Hör nicht auf Milka! Hör überhaupt nicht hin, wenn sie solche dummen Dinge sagt.«
Das war einfacher gesagt als getan. Manchmal waren es auch nur flüchtige Bemerkungen von Milka, die Sarai kränkten. Wahrscheinlich war nichts davon böse gemeint. Im Grunde sprach Milka nur aus, was Sarai selbst insgeheim dachte. Am schlimmsten war es, schwangere Mägde oder Sklavinnen mit ihren Kindern zu beobachten. Da Terach und seine Söhne viele Dutzende Mägde und Knechte besaßen, wurden auch jedes Jahr viele Kinder geboren. Jede einzelne Geburt durchbohrte Sarais Herz wie ein Schwert und erinnerte sie an das eine, was sie ihrem Ehemann nicht zu geben vermochte.
Doch in dieser Nacht, dem Fest der Schafschur, als Sarai zusammen mit ihrer Schwägerin und all den Mädchen und Frauen unbeschwert ums Feuer tanzte, dachte sie wenigstens für eine Weile nicht an ihre Schmach und was für eine Bürde sie damit ihrem Ehemann auflud. Sie war einfach nur glücklich und tanzte, bis ihr der Schweiß übers Gesicht lief.
Lot saß in der großen Familienrunde, zusammen mit seinen Onkeln Nahor und Abram, seinem Großvater Terach, seiner Mutter, seiner Schwester Jiska, seinen vier Cousins Uz, Bus, Kemuël und Kesed, dazu mit ein paar edlen Herren aus der Stadt, die Terach zum Fest eingeladen hatte. Lot klatschte und sang inbrünstig, während er immer wieder einen Blick auf seinen gut gelaunten Onkel Abram warf, dessen kräftige Stimme alle anderen übertönte. Manchmal sah er, wie Abram verstohlen zu Sarai blickte, die mit den anderen Frauen Arm in Arm im Reigen um das große Feuer tanzte. Lot war jedes Mal aufs Neue beeindruckt von Abrams leidenschaftlicher Liebe zu Sarai.
Wenn ich eines Tages heirate, will ich auch so eine Liebe, dachte der Dreizehnjährige. Er bewunderte seinen Onkel sehr. Abram war für ihn wie ein Vater. Alles, was er vom Leben wusste, hatte Abram ihm beigebracht. Lots leiblicher Vater, Haran, war kurz nach seiner Geburt überraschend verstorben. Sie hatten damals alle noch in Ur in Chaldäa gelebt. Doch nach Harans Tod hatte Terach, Lots Großvater, beschlossen, mit der ganzen Sippe aus Ur fortzuziehen. Weswegen, das hatte er nie erklärt, und Lot hatte auch nie danach gefragt. Vielleicht hatte ihn der Schmerz über den Verlust seines Sohnes zu sehr erschüttert und er hatte gedacht, er käme anderswo besser damit klar. Lot war damals noch ein Baby gewesen. Was auch immer seinen Großvater dazu veranlasst hatte, Ur zu verlassen, sie waren losgezogen und in Haran gelandet, tausenddreihundert Kilometer nördlich von Ur an der babylonischen Grenze. Der eigentliche Plan war gewesen, bis ins Land Kanaan auszuwandern, so hatte Abram ihm einst erzählt. Aber auf halber Strecke waren sie hängen geblieben und hatten ihre Zelte außerhalb von Haran aufgeschlagen. Dass die Stadt denselben Namen trug wie Lots Vater lag übrigens daran, dass Terach ihn einst nach eben dieser Stadt benannt hatte.
Als Lot ihn einmal nach dem Grund gefragt hatte, hatte ihm sein Großvater erklärt: »Du weißt ja, dass die bedeutendsten Städte, die unseren Mondgott Nanna verehren, Ur und Haran sind. Und weil ich Nanna für die Geburt deines Vaters ganz besonders danken wollte, benannte ich ihn eben nach der Stadt Haran.«
»Wieso nicht nach Ur?«
»Der Klang von Haran gefiel mir besser«, hatte Großvater schmunzelnd geantwortet.
In den zwölf Jahren, in denen sie nun in Haran lebten, hatten sich ihr Besitz und ihre Herden um ein Vielfaches vergrößert. Terachs Sippe war eine der wohlhabendsten in der ganzen Gegend. Sie besaßen große Herden an Schafen, Ziegen und Rindern und verkauften ihr Leder, ihre Felle, Wolle, Milch, Käse und Fleisch in den umliegenden Dörfern und Städten. Sie hatten Gold und Silber und mehr Reichtum, als sie jemals ausgeben konnten. So war Lot aufgewachsen, inmitten von Wohlstand und einer liebevollen Großfamilie. Er lebte mit seiner Mutter und seiner zwei Jahre älteren Schwester Jiska in einem großen Nomadenzelt aus Ziegenfellplanen. Er hütete die Ziegen und Schafe, die einst seinem Vater gehört hatten, und eines Tages, wenn er alt genug wäre, würde er die Verantwortung für den gesamten Besitz seines Vaters übernehmen. Aber bis dahin verwaltete sein Großvater Terach die Erbschaft für ihn.
Am liebsten war der Dreizehnjährige mit seinem Onkel Abram unterwegs. Abram hatte ihn nach dem Tod seines Vaters wie einen Sohn angenommen und liebte ihn über alles. Abram war es, der ihm zeigte, wie man ein Schermesser führte, und der ihm half, sein allererstes Schaf zu scheren. Abram zeigte ihm, wie man das Schaf nach der Schur mit Salzwasser abwusch und wie man das Fell der Schafe drei Tage lang mit einer Flüssigkeit aus gekochten Lupinen, dunklem Olivenabwasser und Dattelwein behandelte. Abram war es auch, der ihm das Rechnen und sogar ein paar Zeichen der Keilschrift beibrachte, ein Privileg, das nur wenigen vergönnt war. Aber das Wichtigste, das Abram ihm beibrachte, war, alle Menschen mit Würde zu behandeln und jedem zu helfen, der in Not war.
Lot sah zu Abram auf und war stets darum bemüht, ihm zu gefallen. Er konnte sich keinen edleren Menschen vorstellen als seinen Onkel. Es schien, als hätte Abram immer für alles eine Lösung parat. Er wusste immer, was zu tun war. Er war gerecht und gütig und begegnete allen mit Respekt und Wertschätzung.
Lots Onkel Nahor war da ganz anders. Er war zwar witzig und redegewandt, redete aber die meiste Zeit nur von sich und seinen erfolgreichen Geschäften und wie man dies und das zu Geld machen könne. Er war zweifelsohne ein ausgezeichneter Geschäftsmann. Doch einmal hatte Lot aufgeschnappt, dass seine Geschäfte nicht immer ganz sauber seien. Nahor sei stets auf seinen eigenen Vorteil bedacht und habe schon so manchen Käufer übers Ohr gehauen. Ob das stimmte, vermochte Lot nicht zu sagen. Jedenfalls strahlte Nahor nicht halb so viel Ruhe und Autorität aus wie Abram, weswegen Lot sich lieber Abram zum Vorbild nahm. Er wollte so sein wie er. Großzügig und großherzig. Ja, das wollte er.
Und so saß Lot an diesem Abend direkt neben Abram in der Runde der Männer und versuchte, genauso laut und inbrünstig zu singen wie er. Und als Abram ihm einmal anerkennend zuzwinkerte, füllte sich das Herz seines Neffen mit Stolz und Freude.
Abram war in bester Laune, während er klatschte und sang und seiner Frau beim Reigentanz zuschaute. Er fühlte sich wie ein König. Er nannte die schönste Frau der Welt sein Eigen, er war reich, angesehen bei den edlen Herren der Stadt und Teil einer Sippe, deren Familienbande und Loyalität unglaublich stark waren. Jeder konnte sich auf jeden verlassen. Sie waren füreinander da und teilten alles miteinander, Freud und Leid.
Natürlich gab es auch Auseinandersetzungen. Abram hatte zum Beispiel keinerlei Verständnis für die Geldgier seines Bruders und der wiederum warf Abram vor, viel zu spendabel und gutgläubig zu sein. Manchmal gerieten sie sich deswegen in die Haare, versöhnten sich dann aber schnell wieder. Was Abram hingegen wirklich zu schaffen machte, war, noch immer keinen leiblichen Sohn zu haben. Was nützte ihm all sein Reichtum, wenn er niemanden hatte, dem er eines Tages all seine Güter vererben konnte? Er sah, wie Sarai sich deswegen quälte, und versuchte, sie zu trösten und für sie stark zu sein, obwohl er genauso litt wie sie. Sein Bruder war überzeugt davon, dass Sarai den Mondgott Nanna in irgendeiner Weise verärgert und er deswegen ihren Schoß verschlossen hatte.
»Wieso sonst sollte er sie und nur sie bestrafen? Sieh doch, wie sehr Nanna unsere Sippe sonst gesegnet hat!«, hatte Nahor ihm erklärt. »Unsere Herden sind fruchtbar. Meine Frau und die Frauen unserer Knechte und Sklaven sind fruchtbar. Wir genießen ein glückliches Familienleben, sind wohlhabend, erfolgreich in all unseren Geschäften. Das einzige Übel ist Sarais Kinderlosigkeit. Das kann doch kein Zufall sein! Von Bruder zu Bruder: Euch läuft die Zeit davon. Geh zu den Priestern, meinetwegen den Zauberern, bring Nanna mehr Opfer, gib Sarai die Kräuter, von denen ich dir erzählt habe. Tu irgendwas, Abram, bevor es zu spät ist.«
Doch Abram wollte nichts davon wissen. Er glaubte nicht daran, dass die Götter etwas mit Sarais Unfruchtbarkeit zu tun hatten. Er glaubte überhaupt nicht mehr an die Götter, jedenfalls nicht so wie sein Vater, sein Bruder und alle anderen Menschen in Haran. Die grüblerischen Gedanken, die ihn seit seiner frühen Jugend beschäftigten, verfolgten ihn nun schon sein ganzes Leben lang. Aber er hatte es stets vermieden, sich irgendjemandem anzuvertrauen. Außer Sarai wusste niemand etwas von seinen Zweifeln. Und das war wohl auch besser so. Abram wollte seinen Vater und seinen Bruder nicht vor den Kopf stoßen mit seinen Ideen. Er hatte sich vor vielen Jahren geschworen, das Geheimnis seiner Zweifel an den Göttern mit ins Grab zu nehmen. Und daran hätte sich auch nichts geändert, wäre an jenem Abend beim Fest der Schafschur nicht alles außer Kontrolle geraten …
Elieser stand, wie es sich für einen Knecht ziemte, in einigem Abstand hinter der fröhlichen Runde, in der der singende Abram saß, und beobachtete ihn mit einem Lächeln im Gesicht. Er liebte es, seinen Herrn glücklich zu sehen. War sein Herr glücklich, war er es auch. Abram war ein guter Herr und begegnete ihm stets auf Augenhöhe, wohlwollend und respektvoll. Ja, er hatte es wirklich gut getroffen, einen Herrn wie Abram zu haben. Elieser wurde von allen Elieser aus Damaskus genannt. Dabei kannte er Damaskus nur vom Hörensagen und war selbst nie dort gewesen. Seine Mutter stammte jedoch aus Damaskus und war von Sklavenhändlern nach Ur verschleppt worden, wo der Stammesfürst Terach sie erworben hatte. Elieser war kurz darauf im Hause Terachs zur Welt gekommen. Abram war zu diesem Zeitpunkt ein Junge von elf Jahren gewesen und Sarai gerade mal ein Jahr alt.
Elieser hatte von klein auf gelernt, hart zu arbeiten und alles zu tun, um seinen Herrn Terach zufriedenzustellen. Seine Mutter hatte ihm stets eingeschärft, sich nie zu beschweren und immer mehr zu tun, als von ihm verlangt wurde: »Je fleißiger du bist, desto weniger brauchst du die Bestrafung deines Herrn zu fürchten.«
Sie hatte ihm furchtbare Geschichten von Sklaven erzählt, die von ihren Besitzern ausgepeitscht oder gar zu Tode geprügelt worden waren, weil sie ungehorsam oder faul gewesen waren oder versucht hatten, davonzulaufen. Elieser hatte sich das nie wirklich vorstellen können. Konnten Menschen tatsächlich so grausam sein? Sein Herr Terach war es jedenfalls nicht. Er war streng, ja, aber er erhob nie eine Hand gegen einen seiner Knechte oder Sklaven. Und sie hatten stets genug zu essen.
Schon als Junge von knapp vierzehn Jahren übertraf Elieser alle anderen mit seinem Arbeitseifer und seinen natürlichen Führungsqualitäten. Er stach so sehr heraus, dass Abram seinen Vater bat, ihn ihm abkaufen zu dürfen. Terach hatte eingewilligt, und so war Elieser für einen symbolischen Preis von Vater zu Sohn übergegangen.
Seither stand er im Dienste Abrams, was Elieser als große Ehre empfand. Abram war ihm von allen drei Brüdern am liebsten. Da war etwas an Abram, das ihn schon immer fasziniert hatte, auch wenn er nicht hätte sagen können, was genau es war. Es war, als würde eine höhere Macht seine Hand über ihm halten. Und damit meinte er nicht die Götter, sondern etwas anderes, was er aber nicht hätte benennen können. Es erschien ihm immer, Abram wäre für Großes bestimmt, was auch immer das sein mochte. Jedenfalls wurde Elieser das Gefühl nie ganz los, dass er nicht bis an sein Lebensende hier in Haran bleiben würde und dass irgendwo jenseits des Euphrats ein großes Abenteuer auf ihn wartete. Und irgendwie hatte dieses Abenteuer mit seinem Herrn Abram zu tun. Doch dies waren Eindrücke, die Elieser mit niemandem teilte.
An diesem Abend beim Fest der Schafschur hielt er sich stets in der Nähe Abrams auf, um gleich zur Stelle zu sein, wenn sein Herr etwas brauchte. Alle waren bei bester Laune. Keiner ahnte, dass die Stimmung dabei war umzuschlagen, auch Elieser nicht. Es kam für alle völlig unerwartet …
Nachdem die Frauen nass geschwitzt und glücklich ihren Tanz beendet und Sarai und Milka sich wieder zu ihren Männern auf den Boden gehockt hatten, ergriff Nahor das Wort. Er war schon leicht angeheitert von dem vielen Dattelwein, den er getrunken hatte.
»Meine Lieben, hört alle her! Ich habe eine wichtige Ankündigung zu machen!«, rief er munter in die Runde und wedelte mit den Händen herum, bis einigermaßen Ruhe eingekehrt war. Dann krächzte er gut gelaunt: »Meine geliebte Milka ist wieder schwanger!«
Begeisterter Jubel ergoss sich über das glückliche Paar. Nahor zog seine Frau zu sich herüber und küsste sie leidenschaftlich, vielleicht in seinem angetrunkenen Zustand ein wenig zu leidenschaftlich. Eliesers Blick huschte zu Abram und Sarai. Natürlich beglückwünschten sie Nahor und Milka ebenfalls. Doch die Betrübnis in ihren Augen war nicht zu übersehen und als Abram die Hand seiner Frau fester drückte als sonst, wusste Elieser genau, was in seinem Herrn vorging.
»Darauf müssen wir anstoßen!«, rief das Oberhaupt Terach und gab Elieser einen Wink, damit er mehr Wein holte. Dienstfertig kam Elieser seinem Wunsch nach und füllte die Trinkbecher auf. Alle hielten die mit Wein gefüllten Silberbecher in die Höhe und Terach verkündete: »Nanna hat uns reich gesegnet. Auf meinen Sohn und meinen ungeborenen neuen Enkel! Mögen Nanna und alle Götter mit ihm sein!«
Sie tranken von dem Wein, dann ergriff Nahor erneut das Wort. »Ich habe noch eine zweite Ankündigung zu machen!«, rief er mit schwerer Zunge. »Da ich zum vierten …« – er kicherte – »Verzeihung, zum fünften Mal Vater werde, habe ich beschlossen, ein neues Geschäft zu eröffnen!« Er klopfte sich kurz auf die Brust, hickste und fuhr dann fort: »Ihr kennt ja alle die große Karawanenstraße, die nach Damaskus und Ägypten führt. Ihr wisst, wie viele Soldaten, Kaufleute und Beamte dort täglich unterwegs sind, dazu … dazu all die Babylonier, die nach Kanaan reisen, und all die Kanaaniter, die nach Haran kommen. Nun … ich habe direkt an der Karawanenstraße ein kleines Steinhäuschen erworben. Und darin eröffne ich demnächst einen Laden und werde Götterstatuen und Ritualgegenstände an die Durchreisenden verkaufen. Meine Frau wird die Götterfiguren selber töpfern und brennen. Unser Motto: Ein Gott für jede Gelegenheit. Die ersten Statuen sind bereits fertig gebrannt, nicht wahr, Milka? Seht her!«
Er griff hinter sich, holte einen in Stoff eingewickelten Gegenstand hervor und enthüllte ihn feierlich. Es war ein ungefähr einen Fuß großer, aufrecht stehender Mann mit langem, gewelltem Bart und einer Mondsichel in der Hand. Eine Statue des Mondgottes Nanna. Nahor grinste zufrieden. »Die Menschen werden uns regelrecht …« Er hickste erneut. »Regelrecht überrennen. Das wird eine Goldgrube! Eine … eine wahre Goldgrube. Na, was sagst du, Vater? Wie findest du meine Geschäftsidee?«
»Ausgezeichnet, ich finde sie großartig, Nahor«, sagte Terach anerkennend. »Du hattest schon immer einen Riecher fürs gute Geschäft. Ich bin sicher, der Laden wird ein voller Erfolg, so wie alles, was du anpackst.«
Nahor wölbte stolz seine Brust und wandte sich dann mit vom Alkohol glänzenden Augen seinem Bruder Abram zu. »Und du, Bruderherz? Was denkst du?«
Alle Anwesenden schauten gespannt zu Abram, um zu hören, was er zu sagen hatte. Doch Abram schwieg, als wolle er sich bewusst nicht dazu äußern. Das konnte aber Nahor nicht auf sich sitzen lassen und forderte ihn erneut auf: »Sag schon, Abram. Ich möchte deine Meinung hören. Was denkst du?«
»Tu, was du für gut befindest«, antwortete Abram ausweichend.
Doch damit gab Nahor sich natürlich nicht zufrieden. »Komm schon, ich kenne dich, Abram. Ich kann doch deine Gedanken lesen. Was ist es, das du sagen willst? Spuck es aus! Ich will es hören. Wir alle wollen es hören!«
»Du willst es wirklich hören? Ich denke, wir sind schon reich genug, Nahor. Wozu brauchst du einen Laden, der Götterstatuen verkauft?«
»Pah!« Nahor wedelte beleidigt mit der Hand durch die Luft. »Wusste ich's doch. Ich wusste, du würdest dagegen sein! Du bist immer dagegen, wenn es um die Götter geht! Immer!«
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Aber gedacht hast du's, Abram. Gedacht«, lallte Nahor und deutete mit ausgestrecktem Zeigefinger auf seinen Bruder. »Verrate mir eines, mein teurer Bruder: Was ist so falsch daran, Götter zu verkaufen? Hm? Was ist so falsch daran?«
»Als ob im Ofen gebrannte Figuren Götter wären«, antwortete Abram gereizt.
»Was soll das nun wieder heißen? Behauptest du etwa, Nanna wäre kein Gott? Willst du etwa die Götter beleidigen?«
»Die Götter beleidigen sich doch selbst, wenn sie sich in Figuren aus gebranntem Ton verehren lassen!«, konterte Abram und straffte seinen Rücken. »Sag mir dies, Nahor: Wie kann ein Mensch mit seinen eigenen Händen Götter formen? Götter, die dem Menschen doch weit überlegen sein sollten? Wie kann man Götter herstellen aus demselben Lehm, aus dem die Töpfe sind, in denen wir Linsenbrei und Eintopf kochen? Und wir werfen uns sogar vor ihnen nieder, vor leblosen Tonfiguren, die wir selbst hergestellt haben! Wir verehren das Werk unserer eigenen Hände! Merkst du nicht, wie verdreht das ist?«
»Verdreht?« Verständnislosigkeit glühte in Nahors Augen auf. »Verdreht sagst du?! Ist es deswegen, dass du dich weigerst, die Statue Nannas in deinem Zelt aufzustellen? Weil es verdreht ist, an seine göttliche Kraft zu glauben?«
»Fang jetzt bitte nicht damit an!«
»Du hast doch damit angefangen!«, rief Nahor mit schwerer Zunge und trotz seines leicht betrunkenen Zustandes war deutlich zu hören, wie empört er war. »Also gib mir eine ehrliche Antwort. Ich habe mich schon lange gefragt, was mit dir los ist, warum du all meine Ratschläge ignorierst, sobald sie mit Nanna zu tun haben. Zweifelst du etwa seine Macht an? Kein Wunder, dass deine Frau nicht schwanger wird! Kein Wunder, dass Nanna ihren Schoß verschließt!«
»Nahor, lass es. Wir haben Gäste hier.«
»Ich werde zum fünften Mal Vater, Abram, zum fünften Mal! Und du? Wann wird Sarai dir endlich einen Erben schenken? Wann?!«
»Hör auf, Nahor! Es reicht!«
»Ich habe dir hundertmal gesagt: Nanna wird dich erhören, wenn du aufrichtig zu ihm betest. Hier.« Er streckte Abram die Statue Nannas entgegen. »Ein Geschenk von mir. Stell Nanna so auf, dass er euch beim Liebesspiel zuschaut. Es funktioniert, ich schwöre es dir.«
»Nein danke.«
»Willst du keinen Erben?«
»Nahor, hör jetzt bitte auf damit …«
»Willst du nicht, dass deine Frau endlich ein Kind bekommt? Schau dir Milka an. Vier Kinder, Abram. Vier Kinder und erneut schwanger. Ihr Schoß ist gesegnet, Abram, gesegnet von Nanna! Und was ist mit Sarai?«
»Hör endlich auf damit!«, fuhr Abram ihn an. »Du bist betrunken, Nahor!«
»Ja, das bin ich. Aber im Gegensatz zu dir habe ich vier Kinder, das fünfte ist auf dem Weg. Und du bist kinderlos, Abram! Kinderlos!«
»Nahor, es reicht!«, knurrte Abram, während seine Brust sich hob und senkte unter seinem Gewand.
Doch Nahor ließ nicht locker und hielt die Götterfigur Nannas demonstrativ in die Luft. »Warum weigerst du dich, Nanna in dein Zelt zu nehmen? Warum?«
»Nahor, bitte …«
»Es muss doch einen Grund geben«, beharrte Nahor.
»Nahor, Schluss jetzt.«
»Sag es mir! Warum verschmähst du unseren Gott?!«
»Du willst es wirklich wissen?! Weil ich nicht an ihn glaube!«, schrie Abram mit bebender Stimme. Und dann platzte es regelrecht aus ihm heraus wie aus einer aufgestochenen Eiterbeule, so als würde er dieses blasphemische Geheimnis schon eine Ewigkeit in seinem Herzen hüten und könnte es nicht länger ertragen. »Ich glaube nicht mehr an Nanna oder die Götter! Schon lange nicht mehr! Schau dir doch deinen Mondgott an! Er hat Ohren und kann nicht hören, er hat Augen und kann nicht sehen. Er hat Füße und kann nicht gehen. Hohl und leer, Nahor. Hohl und leer ist er!«
Nahor sah seinen Bruder mit aufgerissenen Augen an. Auch alle anderen starrten Abram entgeistert an, Nahor, Terach, Milka, Lot und alle geladenen Gäste in der Runde. Nur Sarai hielt ihren Kopf gesenkt. Sie schien nicht schockiert, dafür aber den Tränen nahe.
Elieser blickte zu seinem Herrn und sah einen Eifer und eine Verzweiflung in seinen Augen, die er in dieser Art noch nie bei ihm gesehen hatte. Eine beklemmende Stimmung breitete sich unter der Festgesellschaft aus. Abram ergriff erneut das Wort. Keiner unterbrach ihn. Keiner wagte es, auch nur zu atmen. Es war zu ungeheuerlich, was Abram ihnen da offenbarte, zu schwerwiegend, zu gefährlich. Doch Abram hielt sich nicht länger zurück. Er hatte wohl zu lange geschwiegen.
»Du bist fünfzig Jahre alt, Nahor, und wirfst dich vor einem Gott nieder, der gerade mal einen Tag alt ist? Den deine Frau aus nassem Lehm geformt, getrocknet und im Feuer gehärtet hat? Wie kannst du so naiv sein und glauben, dass Gott in diesem Tonklotz lebt? Er kann sich ja nicht einmal bewegen! Sieh ihn dir doch an! Er ist nichts als gebrannte Erde! Wenn du ihm einen Schubs gibst, fällt er um und zerbricht in hundert Scherben! Was für ein erbärmlicher Gott ist das! Wo ist seine Macht? Wo? Wenn er sich nicht einmal auf seinen eigenen Füßen halten kann! Sag es mir, Nahor! Wo?«
»Schweig, Abram!«, erschallte da eine gebieterische Stimme, laut wie ein Donnergrollen. Es war Terach. Bisher hatte er sich komplett aus dem Streit herausgehalten. Doch jetzt reichte es ihm offenbar. Sein Blick war finster, seine Haut über den Wangenknochen gestrafft.
»Vater, verzeiht mir«, sagte Abram. »Ich wollte Euch da nicht hineinziehen …«
»Kein Wort mehr!«, donnerte Terach.
»Ich weiß, wie viel Euch die Götter bedeuten.«
»Ich sagte: Kein Wort mehr!« Terachs Stimme dröhnte, von glühendem Zorn gepackt, während er sein Trinkgefäß zu Boden schleuderte. Es kam nicht oft vor, dass der Stammesfürst seine souveräne Haltung verlor. So aufgebracht hatte Elieser ihn wahrhaftig noch nie erlebt.
»Ketzerei«, murmelte Terach in seinen Bart. »Ketzerei, Gotteslästerung!«
»Vater …«, wandte Abram vorsichtig ein.
Terach hob den Kopf, sah seinen Sohn direkt an und knurrte: »Wie kannst du es wagen …«
»Vater …«
»Fort mit dir! Ketzer! Fort mit euch beiden! Geh mir aus den Augen, Sohn! Ich will dich nicht mehr sehen!«
Die Luft vibrierte vor Spannung. Eliesers Herz klopfte heftig. Er schaute zu Nahor, der trotz seines Alkoholpegels langsam zu begreifen schien, was er mit seiner Provokation angerichtet hatte. Ein Ausdruck von Entsetzen und Beschämung lag auf seinem von der Aufregung glänzenden Gesicht. Seine Frau Milka biss verlegen die Lippen aufeinander und zupfte an ihrem Kleid herum. Der junge Lot, Abrams und Nahors Neffe, starrte mit offenem Mund auf seinen Onkel Abram und wirkte völlig durcheinander.
Sarai wischte sich die Tränen aus den Augen. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, fasste Abram sie an der Hand und zog sie hoch. »Komm Sarai, wir gehen.«
Er legte seinen Arm um sie und die beiden gingen davon. Keiner hinderte sie daran.
Noch immer sagte niemand ein Wort. Doch jeder spürte, dass diese Eskalation nicht ohne Konsequenzen bleiben würde. Terach hatte seinen eigenen Sohn einen Ketzer genannt. In Anwesenheit des gesamten Stammes und sämtlicher nobler Gäste aus der Stadt. Elieser wollte sich gar nicht erst ausmalen, was das für seinen Herrn in Zukunft bedeuten würde. Nichts Gutes jedenfalls. Gar nichts Gutes.
Nachdem Abram und Sarai sich in ihr Zelt zurückgezogen hatten, ließ sich Sarai auf die Knie fallen und weinte bitterlich. Sie weinte über die Schande der Kinderlosigkeit, die ihr Nahor wieder einmal mehr als deutlich vor Augen geführt hatte. Sie weinte, weil Abram ihretwegen von seinem Bruder bloßgestellt und von seinem eigenen Vater zurechtgewiesen worden war. Ihretwegen hatte er in aller Öffentlichkeit sein Gesicht verloren. Und das war so ziemlich das Schlimmste, was einem angesehenen Mann wie Abram passieren konnte. Ihretwegen hatte er sich provozieren und dazu hinreißen lassen, Nanna in aller Öffentlichkeit anzuzweifeln. Es war alles ihre Schuld! Oh, warum konnte sie ihrem Mann bloß keinen Sohn gebären? Warum blieb ihr Schoß verschlossen? Wie lange noch konnte sie dieses Schicksal ertragen, bevor sie daran zerbrechen würde?
»Es ist nicht deine Schuld, Sarai«, sagte Abram leise, als hätte er ihre Gedanken gelesen, und legte von hinten seine Hand auf ihre gebeugte Schulter. »Nahor ist betrunken. Er wusste nicht, was er sagte.«
»Doch, das wusste er!«, schniefte Sarai. »Und er hat ja recht. Ich bin unfruchtbar, Abram! Ich werde dir nie einen Sohn gebären! Und jetzt denken alle, es wäre eine Strafe Nannas, weil du nicht mehr an ihn glaubst!«
»Sollen sie doch denken, was sie wollen. Du weißt, was ich davon halte.«
»Und wenn sie recht haben? Wenn Nanna es ist, der meinen Leib verschlossen hat?«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: