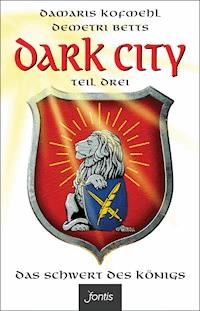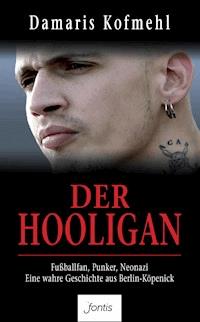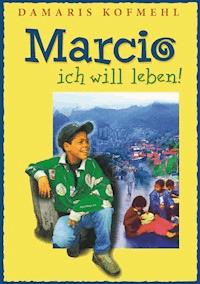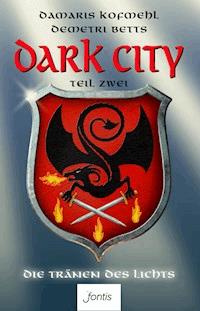Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Abenteuerklasse
- Sprache: Deutsch
Die Jungen und Mädchen der Abenteuerklasse gehen in Wohlen – das liegt in der Schweiz – zur Schule. Anscheinend üben sie auf Abenteuer eine große Anziehungskraft aus. Wie ist es sonst zu erklären, dass immer wieder so aufregende Dinge geschehen? Diesmal bekommen sie sogar offiziell schulfrei, denn Conny ist ausgerissen, einfach verschwunden! Warum nur? Ob die Klasse vielleicht auch ein wenig schuld daran hat? Conny jedenfalls setzt alles daran, auf ihrer verzweifelten Flucht nicht entdeckt zu werden – weder von der alarmierten Polizei noch von ihren Klassenkameraden. Aber das hat schlimme Folgen, denn sie tappt in eine böse Falle! Schaffen es die Freunde, sie noch rechtzeitig aufzuspüren?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Conny reißt aus
Die Abenteuerklasse – Band 1
Damaris Kofmehl
Impressum
© 2016 Folgen Verlag, Bruchsal
Autor: Damaris Kofmehl
Cover: Eduard Rempel, Düren
Lektorat: Mark Rehfuss, Schwäbisch Gmünd
ISBN: 978-3-944187-33-4
Verlagsseite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Inhalt
Ein fester Entschluss
Zwanzig Franken
Mitternacht
Die Polizei schaltet sich ein
Tina plant Böses
Die sieben Spürnasen
Bremgarten ist verdächtig
Auf der Flucht
In der Falle
Keine Chance
Die Überraschung
Die Suchaktion
Der kleine Zwischenfall
Verhängnisvolle Bekanntschaft
Eine schreckliche Nacht
Der Einbruch
Auf Verbrecherjagd
Roman
Der Traum
Großmutter
Der Empfang
Ein fester Entschluss
Conny lag wach in ihrem Holzbett und starrte aus dem kleinen Fenster in die schwarze Nacht. Kein Stern war zu sehen, nur der große, weiße Vollmond ließ einen schwachen Lichtstrahl in das Kämmerlein fallen, so dass eine alte, wurmstichige Kommode matt beleuchtet wurde. Ein paar welke Blumen lagen darauf, die Conny vor ein paar Tagen gepflückt hatte, um ihr kahles Zimmer ein wenig zu schmücken. Denn außer einem schäbigen Tischchen, einem verlotterten Kasten, ihrem Bett und der wurmstichigen Kommode befand sich nichts Anschauliches darin. Das offene Fenster, dessen Scheibe durch einen Jungenstreich völlig zersplittert worden war, bot den Spinnen einen herrlichen Platz für ihre Netze, eine staubige Petroleumlampe sorgte für die Beleuchtung und in einer Schüssel, die zum Waschen diente, lagen tote Fliegen und Mücken. Conny atmete die feuchte Nachtluft tief ein und zog die Bettdecke etwas höher, worauf ihre schmutzigen, braun gebrannten Füße zum Vorschein kamen. Eine Träne kullerte über ihre Wange.
»Es ist ungerecht, es ist einfach ungerecht«, murmelte sie, »alle sind gegen mich – alle!« Es schnürte Conny die Kehle zu und sie biss sich auf die Lippen, um nicht loszuheulen.
»Niemand hält zu mir«, sagte sie tonlos, »Frau Wenger beschimpft mich, wo sie nur kann, und Tina, Stöff und alle anderen machen mir das Leben schwer, so oft sie eine Gelegenheit dazu finden ... Womit habe ich das bloß verdient?« Sie schnäuzte sich die Nase und ließ ihren Tränen freien Lauf. Sie rannen über ihre etwas hervorstehenden Backenknochen, die dunklen Haare entlang bis hinunter an die Ohren, von wo aus sie aufs Kopfkissen tropften. Conny schüttelte den Kopf. Sie war verzweifelt. Was sollte sie tun? Seit gut einem Jahr hielt sie das nun schon aus, ohne Kommentar, ohne Murren. Aber nun war es ihr endgültig zu viel!
»Ich habe es satt! Ich kann mir das doch nicht gefallen lassen!« Conny legte sich eine Hand auf die Stirn und seufzte. Eine Falte zeigte sich zwischen ihren großen, grauen Augen und sie fühlte ihren Puls bis in den Kopf.
»Du musst etwas unternehmen!«, redete sie sich mutig zu. »Lass das nicht wortlos auf dir sitzen!« Ein Schluchzen stieg in Conny hoch und ohne es zu wollen, begann sie wieder zu heulen. Schnell wendete sie sich im Bett und drückte ihren Kopf ins Kissen, um nicht laut zu weinen. Sie wollte nicht, dass Frau Wenger, ihr Mann oder eines der Kinder ihretwegen erwachte. Denn die Folgen waren kaum auszudenken, zudem wollte Conny mit ihrem Kummer allein sein.
Sie wimmerte leise vor sich hin. Ein heftiges Zucken durchfuhr sie, als stecke ihr ein Klotz in der Luftröhre und ihr Atem ging stoßweise und unregelmäßig. Die Augen waren noch rot geweint, als das Mädchen sich einigermaßen erholt hatte. Eine undurchdringliche Stille lag über ihrem kleinen Zimmer, beinahe furchterregend und Conny sehnte sich nach irgendeinem Geräusch, damit sie sich nicht so allein fühlte.
Da! Ein leises Schaben und Kratzen an der Tür ließ Conny aufschrecken.
»Miau!«, drang es kläglich zu ihr hinüber. Conny lächelte unter ihren Tränen, wischte sich mit dem Handrücken über die brennenden Augen und warf die Bettdecke zurück. Vorsichtig, um jedes knarrende Geräusch auf dem Holzboden zu vermeiden, stand sie auf.
»Miau«, ertönte das Jammern wieder.
»Ja, Mizzi, ich komme doch schon!« Im weißen Nachthemd lief das Mädchen zur Tür und öffnete sie einen kleinen Spalt, worauf sogleich ein schwarzer Schatten ins Zimmer huschte. Leise schloss Conny sie wieder und ging auf die Waschschüssel zu, die in einer Ecke auf einem wackligen Tischlein stand. Mit einem raschen Handgriff entfernte sie die Haare und toten Insekten und füllte das Becken mit etwas Wasser, das in einem Krug bereit stand. Mizzi hob erwartungsvoll den Kopf und begann gleich zu lecken, obwohl die Schüssel noch gar nicht einmal auf dem Boden stand. Conny lächelte, nachdem sie der Katze eine Weile zugesehen hatte.
»Na, schmeckt’s?« Sie fuhr dem Tierchen durchs weiche, schwarze Fell. Mizzi sah kurz auf und leckte dann weiter.
»Ja, ja«, seufzte Conny, während sie am Boden kauerte, »ihr Katzen habt es doch schön, keine Sorgen quälen euch, ihr könnt den ganzen Tag machen, was euch passt und niemand stört euch dabei. Ihr werdet gestreichelt, wenn ihr jemandem um die Beine streicht und habt Frieden ...« Mit diesen Worten erhob sich Conny, warf sich aufs Bett und begann von neuem zu schluchzen. Es war ihr plötzlich wieder eingefallen, was sich an diesem Tag alles zugetragen hatte und sie musste weinen. »Miau!«, klagte Mizzi, die das Verhalten ihrer Gefährtin nicht ganz begriff. Schnurrend sprang sie aufs Bett und ließ sich neben Connys Kopf nieder.
»Ach, Mizzi«, schluchzte Conny leise und kraulte der Katze den Hals, »ich bin ja so verzweifelt! Du kannst dir nicht vorstellen, wie mir zumute ist ... dabei habe ich doch nichts verbrochen! Es ist einfach ungerecht, furchtbar ungerecht ... oh, Mizzi, meine gute, alte Freundin, wenn du mich doch verstehen könntest!« Mizzi bog den Kopf zurück, schloss genießerisch die Augen und schnurrte. Das Mädchen heulte noch immer.
»Hätte ich sie doch nie kennengelernt! Wäre doch Mutti noch am Leben, dann müsste ich nicht bei dieser alten Hexe wohnen!« Die alte Hexe war Frau Wenger, bei der Conny seit einem Jahr lebte. Sie war ihre Pflegemutter, denn ihre eigentliche Mutter war bei einem Autounfall gestorben. Conny war damals dreizehn Jahre alt gewesen und genoss das Leben in vollen Zügen. Ihren Vater hatte sie zwar nie gekannt, da er sich kurz nach ihrer Geburt von Mutti trennte und nichts mehr von seiner Familie wissen wollte, doch das kümmerte Conny wenig. Sie hatte ihre liebe Mutter und Mizzi, das Kätzchen, das Connys treuester Gefährte war und mit dem sie durch dick und dünn ging. Oft spazierten die zwei miteinander durch den Wald, spielten Verstecken oder veranstalteten Wettrennen, bei denen Mizzi immer haushoch gewann.
Doch all das änderte sich von einem Tag auf den anderen. Kurz nach Connys dreizehntem Geburtstag verunglückte ihre Mutter auf der Straße und wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, an denen sie bald darauf starb.
Nach dem Tod ihrer Mutter brach für Conny eine Welt zusammen. Eine Woche später musste sie dann zu einer Bauernfamilie nach Wohlen reisen, bei der sie von nun an leben sollte. Ein Leben voller Enttäuschungen, Niederlagen und Demütigungen begann für Conny, denn Wengers hatten Conny nicht als ihre eigene Tochter, sondern nur mit dem stillen Gedanken aufgenommen, eine billige Hilfe für den Hof zu bekommen – und dazu war sie überhaupt nicht geeignet. Beim Melken warf sie den Kessel um, beim Frühstück verschüttete sie die Milch und zum Füttern der Schweine mischte sie dem Futter zu teure Sachen bei. Kein Wunder, dass das der geldgierigen Frau Wenger nicht passte und so beschimpfte sie Conny wegen jeder Kleinigkeit.
Aber nicht nur zu Hause wurde Conny oft das Opfer schonungsloser Kritik, nein, auch in der Schule war das so. In der Pause musste sie sich Bemerkungen und spöttisches Gelächter anhören, ohne Murren, ohne Kommentar, denn jeder Satz, den sie aussprach, wurde sofort derart verdreht, dass er Anlass zu neuer Kritik gab. Einzig Bärbel, eine gleichaltrige Klassenkameradin, hielt einigermaßen zu Conny und half ihr, mit ihren Problemen fertig zu werden, denn Probleme hatte sie wirklich zur Genüge.
Mizzi schnurrte zufrieden und schmiegte ihren Kopf an Conny. »Ach, Mizzi«, klagte das Mädchen, »was soll ich bloß tun? Gestern habe ich dem kranken Jöggi eine zu teure Medizin gekauft und schon hat mich Frau Wenger behandelt, als hätte ich ...« Wieder schluchzte sie. »Ach, es ist so schrecklich!«
Conny schüttelte es vor Kummer und sie weinte bitterlich. Was war die Welt doch so ungerecht, so furchtbar ungerecht! Sie konnte sich kaum mehr beruhigen und wischte sich die Tränen aus den Augen.
»Weißt du noch, wie wir gemeinsam spazieren gingen?«, sagte sie zu ihrer Katze. »Weißt du noch, wie wir auf Fischfang gingen im klaren Bachwasser neben dem Haus?« Ein Lächeln huschte über Connys Gesicht. »Ich lag jedes Mal selbst im Bach und der Fisch war längst verschwunden ...«
»Miau!«, gab Mizzi ihren Kommentar dazu und schnurrte dann friedlich weiter.
»Erinnerst du dich noch an Großmutter und ihre feinen Schokoladentorten?« Conny seufzte und schloss die Augen, während sie sich all ihre schönen Kindertage durch den Kopf gehen ließ.
»Und nun ist alles vorbei«, sagte sie, »alles ... alles.« Zwei kleine Tränen lösten sich von ihren glänzenden Augen und kullerten ihr über die Wangen. »Alles ... alles ...«, flüsterte sie wie im Traum.
Ein sanftes Lüftchen wehte durchs offene Fenster herein und strich über Connys Haar. Irgendwo in der Ferne heulte ein Hund. Das Mädchen starrte auf die Kommode mit den verwelkten Blumen und strich Mizzi durchs weiche Fell.
Plötzlich verfinsterte sich Connys Gesicht. Lange Zeit blieb ihr Blick an den vertrockneten Pflanzen hängen, bis sie sich schließlich ihrer Katze zuwandte und sie ernst, aber mit einem vertrauensvollen Blick, ansah.
»Ich habe einen Entschluss gefasst«, sagte sie leise. Sie betrachtete Mizzi schweigend, als erwarte sie eine Reaktion von ihr und seufzte dann tief.
»Wir reißen aus!«
Conny war erstaunt über ihren verrückten Gedanken, aber es war ihr voller Ernst.
»Wir reißen aus«, wiederholte sie, »du und ich, wir beide.«
Mizzi hörte auf zu schnurren und sah ihre Herrin verständnislos an. Sie schien zu spüren, dass etwas nicht wie sonst war, doch wusste sie Connys Verhalten nicht zu deuten.
»Ja, wir reißen aus«, sagte das Mädchen ein drittes Mal, »irgendwohin, wenn wir nur von hier fortkommen!« Ja, wenn sie nur endlich von hier loskam, keinen Monat wollte sie mehr länger bleiben, keine Woche ... keinen Tag!
»Hier ist nicht der richtige Platz für uns«, sagte Conny bestimmt, »das ist kein Leben, wir gehen fort ... fort ... verstehst du, Mizzi? Fort, einfach weg, keiner wird je erfahren, wo wir geblieben sind und sie sollen es auch nie zu wissen bekommen, nie!« Doch auf einmal wurde sie wieder nachdenklich. Ja, ausreißen, das klingt vielleicht gut, wie in einem Roman, aber ... wohin sollten sie denn eigentlich flüchten? Conny seufzte niedergeschlagen und fuhr sich über die Stirn. Alle ihre Pläne schienen dahin zu sein. Wohin sollten sie gehen? Sie hatte keine Verwandten, weder in der Schweiz noch im Ausland, keine Bekannten, keine Freunde ... außer ...
»Großmutter!« Mit einem Ruck sprang Conny auf, worauf Mizzi erschrocken zusammenfuhr. Raschen Schrittes lief sie zu ihrer Schulmappe, die am Boden lag. Sie holte eine Karte aus der Ledertasche und faltete sie auseinander.
»Wohlen ... St. Gallen ... Wohlen.« Conny schätzte die Distanz mit den Fingern.
»Das sind ungefähr hundert Kilometer.« Sie stutzte und maß die Strecke noch einmal, aber es waren und blieben hundert Kilometer. Für einen Augenblick verlor Conny den Mut. Das Funkeln in ihren Augen erlosch.
»Hundert Kilometer!«, murmelte sie mit starrem Blick. »Meine Güte, wie soll ich das schaffen?«
»Miau!« Mizzi wollte sich bemerkbar machen. Sie tappte auf Conny zu und strich ihr um die Beine. Doch das Mädchen beachtete sie nicht. Hundert Kilometer! »Ich muss nach St. Gallen, koste es, was es wolle!«, murmelte Conny. »Großmutter ist die einzige Person, die mich nicht zurück-weisen würde.« Ja, Großmutter war eine prächtige Frau. Als Mutter noch lebte, gingen sie die alte Frau oft besuchen. Conny erinnerte sich wieder der feinen Torten, die sie jedes Mal aufgetischt hatte, wenn sie und ihre Mutter bei ihr zu Besuch waren. Torten, wie man sie nirgends sonst hatte! Conny leckte sich die Lippen und das Wasser lief ihr im Mund zusammen. Sie musste zu Großmutter! Nicht nur um der Torten willen, nein, Großmutter war auch eine Frau, mit der man offen sprechen konnte.
»Sie würde mich bestimmt verstehen«, meinte Conny überzeugt, »sie kennt mich und ich habe Vertrauen zu ihr.« Sie setzte sich aufs Bett und Mizzi machte es sich sogleich wieder auf ihrem Schoß bequem.
»Du magst Großmütter doch auch, nicht wahr?«
Mizzi gab keine Antwort, sondern genoss Connys Kraulen in vollen Zügen.
»Du Schleckmaul bist ja schärfer auf die Torten als ich«, lächelte das Mädchen, »ich sehe dich doch genau vor mir, wie du auf den Tisch gesprungen bist und ...« Ihr Gesicht verfinsterte sich wieder und nachdenklich fuhr sie fort:
»Aber Großmutter ist in St. Gallen, hundert Kilometer von uns entfernt ... hundert Kilometer!« Sie seufzte. »Stell dir einmal vor, wie viel das Bahngeld für hundert Kilometer kostet ... bestimmt zwanzig Franken ...« Conny biss sich auf die Lippen und schüttelte mit gerunzelter Stirn den Kopf.
»Zwanzig Franken ... das, das ist ein Vermögen!« Sie ließ sich zurückfallen und seufzte tief. Was sollte sie tun? Alles aufgeben und sich das Geschrei der Bäuerin noch weiter anhören? Nein, auf keinen Fall! Sie wollte nicht mehr länger hierbleiben!
»Nein«, flüsterte sie, »nein, ich kann hier nicht bleiben, ich muss fort, fort von diesem Ort, fort nach St. Gallen!« Aber wie? Sie hatte nicht genug Geld für eine Fahrkarte, woher sollte sie es auch haben? Taschengeld bekam sie nicht, da die Bauersfamilie genug zu tun hatte, um die Familie mehr schlecht als recht durchzubringen. Sollte sie es vielleicht stehlen? Schließlich wusste sie, an welchem Ort Herr Wenger sein Geld aufbewahrte; was sollte sie daran hindern, es zu nehmen? Conny erschrak über diesen Gedanken.
»Das tust du nicht!«, redete sie sich zu. »Stehlen? Überleg’ dir doch, was das bedeutet!« Da verstieß sie ja gegen das Gesetz! Aber ausreißen war doch auch gesetzwidrig ... Ach, was sollte sie nur tun? Conny überlegte. »Ich brauche das Geld«, murmelte sie, »ich muss es einfach bekommen, egal wie, wenn ich nur nach St. Gallen komme!« Aber woher sollte sie sich denn zwanzig Franken beschaffen? Conny war ratlos. Aufgeregt drehte sie sich hin und her und strich sich nervös über die Stirn. Stehlen ... stehlen. Sie hatte noch nie in ihrem Leben gestohlen, bloß mal ein Bonbon von einem fremden Tisch entwendet und als sie es dann in den Mund steckte, bekam sie ein so schlechtes Gewissen, dass sie immer wieder daran denken musste.
»Nein, ich kann nicht stehlen«, sagte Conny kopfschüttelnd, »das kann ich einfach nicht.« Doch wie sollte sie sonst zu dem Geld kommen? Vielleicht wäre es möglich, sich als blinder Passagier in den Zug zu schmuggeln. Im Gepäckwagen zum Beispiel.
»Das geht nicht«, meinte Conny entschieden, »früher oder später entdeckt man mich ja doch ... und dann mal gute Nacht!« Also ging auch das nicht. Aber wie um alles in der Welt ...
»Ich hab’s!«, rief sie da, worauf Mizzi vor Schreck das Schnurren einstellte und kläglich miaute, weil es bereits das zweite Mal war, dass Conny sie derart erschreckte.
»Das ist die Lösung!«, wiederholte Conny. »Ich frage Bärbel. Ihr Vater verdient viel und Bärbel erhält jeden Monat acht Franken Taschengeld ... ja, ich frage Bärbel, sie wird mir helfen, davon bin ich überzeugt, sie wird mich nicht verraten ...« Nein, das täte sie nie, das wusste Conny genau. Bärbel hatte sie noch nie verraten, noch nie. Klar, sie lachte manchmal mit, wenn Conny in der Stunde eine ulkige Bemerkung machte oder sich komisch benahm, was ja nur zu oft vorkam, aber im Grunde war Bärbel ein guter Kerl. Und wenn sie sich auch ab und zu auf die Seite der anderen Klassenkameraden stellte, blieb sie Conny trotzdem eine treue Freundin.
»Nein, sie würde mich nie verraten«, sagte Conny bestimmt. Eine Weile lag sie nachdenklich da, starrte aus dem offenen Fenster in die Nacht und streichelte ihre Katze ... Ob es wohl wirklich richtig war, was sie sich jetzt vorgenommen hatte? War es denn vernünftig, Bärbel in ihre Pläne einzuweihen? War es nicht besser, alles für sich zu behalten?
»Ach, Quatsch!«, meinte Conny, um sich aufzumuntern, »das wird schon klappen. Gleich morgen werde ich Bärbel fragen!« Sie war selbst noch nicht ganz davon überzeugt, aber sie fühlte trotzdem eine Spur von Sicherheit. Ein triumphierendes Lächeln huschte über ihr Gesicht.
»Die werden sich wundern!«
Zwanzig Franken
Es war kurz vor acht. Die Sonne warf ihre ersten Strahlen auf die Erde, der Wind ließ das Laub in den Bäumen rascheln und ein Hahn kündigte mit einem krächzenden »Kikeriki« den neuen Tag an.
Die Schulmappe unter den Arm geklemmt, schlenderte Conny über den Kiesweg, der zu ihrem Schulhaus führte. Es war ein schmaler Weg, kaum einen Meter breit und er schlängelte sich mitten durch eine Anzahl niedriger Bäume, die den Pfad wie eine kleine Allee wirken ließen. Conny liebte diesen Weg, denn unter den rauschenden Bäumen, von deren Kronen sich manchmal ein kleiner Vogel zwitschernd in die Luft schwang, konnte sie für einen kurzen Augenblick alles um sich herum vergessen. Es war ja bloß ein kurzer Weg, aber er genügte, um eine Minute frei zu sein, frei von allen Sorgen, frei von den Schlägen der Bauersfrau, von den spottenden Rufen der Schüler, einfach frei. Und Conny brauchte das.
Trotzdem konnte sie den Weg diesmal nicht so recht genießen. Ihre Gedanken kreisten die ganze Zeit um Bärbel. Wie sollte sie es anpacken? Wann und bei welcher Gelegenheit sollte sie sie ansprechen? Den ganzen Weg hatte sie sich schon überlegt, was sie Bärbel sagen sollte, damit sie ihre Lage begreifen würde. Hundertmal hatte sie sich die Situation schon durch den Kopf gehen lassen, hundertmal hatte sie sich einen Gesprächsbeginn ausgedacht und hundertmal war sie zu dem Schluss gekommen, dass es so nicht ging. Gerade überlegte sie sich wieder ihre Rede, als sie auf dem Schulhof ankam. Es war ein geteerter Platz, umgeben von Wiesen und einigen Büschen und hinter diesem Platz schimmerte ein kleines, rotes Haus zwischen den Bäumen hindurch. Über und über war es mit Efeu bedeckt, so dass man vom eigentlichen Schulhaus kaum noch etwas erkennen konnte. Nur die Fenster erschienen noch einigermaßen in ihrer wahren Größe und starrten wie viereckige Augen auf den Hof hinaus, den Conny soeben erreicht hatte.
Conny ging einige Schritte weiter und blieb dann erstaunt stehen. Normalerweise fand sie den Schulhof als riesigen Tummelplatz vor. Hier spielten die einen mit dem Ball, dort jagten sich zwei Schüler nach, in dieser Ecke tuschelten ein paar Mädchen miteinander und in jener Ecke kicherten einige Schülerinnen.
Doch an diesem Morgen schien der Platz wie ausgestorben. Leer und verlassen lag er da und Conny kam sich beinahe wie ein unerwünschter Fremdling vor, als sie einige Schritte weiter ging. Eigenartig still war es rundherum ... Die Turmuhr schlug acht. Conny zählte jeden einzelnen Schlag und schüttelte verständnislos den Kopf.
»Seltsam«, murmelte sie und ließ ihren Blick über den leeren Hof gleiten. Nichts rührte sich, keine Menschenseele war zu sehen. Wo waren sie alle? Saßen sie bereits brav auf ihren Schulbänken und lösten die vergessenen Hausaufgaben? Aber nein, die Schule begann erst in fünf Minuten und die Schüler waren noch nie früher als zehn Sekunden vor der Stunde ins Zimmer gestürmt. Wo also waren sie? Conny überlegte. Sie trat in die Mitte des Hofes und klemmte ihre Mappe krampfhaft unter den Arm. Ein unbehagliches Gefühl stieg in ihr hoch, das sie nicht zu deuten vermochte und das sie auf unerklärliche Weise festhielt. Schweigend starrte sie auf ein hohes Gestrüpp und es war ihr, als verberge dieses ein Geheimnis vor ihr. Es raschelte und ein kleiner Vogel flatterte ängstlich davon. Conny kniff die Augen zusammen und versuchte, die unsichtbare Gefahr zu erkennen, die dort saß und lauerte ... aber sie sah nichts. Und doch fühlte sie sich von allen Seiten beobachtet und das beunruhigte sie.
Da, ein Pfiff! Und im nächsten Augenblick ging ein wildes Kriegsgeschrei los. Hinter jedem Busch tauchten ein bis zwei Schüler auf und ehe Conny die Lage übersah, hatte ihr einer schon die Mappe aus der Hand gerissen und warf sie in hohem Bogen seinem Kollegen zu, der sie geschickt auffing und einem anderen zuschleuderte. Conny wurde rot vor Wut und versuchte krampfhaft, die Mappe zurückzuerobern, allerdings ohne Erfolg. Die Schüler lachten und grölten, als Conny ihnen nachlief und verzweifelt mit den Armen in der Luft herumfuchtelte, um die Mappe zu erhaschen. Einige gaben sich besonders Mühe, das Errungene möglichst lange zu behalten und dann so geschickt weiterzuwerfen, dass es nur wenige Zentimeter an Connys Kopf vorbeisauste.
»Komm doch, hol dir deine Mappe!«, rief Stöff und blickte das Mädchen herausfordernd an. Conny ging langsam auf ihn zu. Ihr Blick durchbohrte ihn, so dass Stöff beinahe zusammenfuhr.
»Na, komm!«, sagte er mit einem geringschätzigen Lächeln, »oder hast du etwa Angst?« Er lachte und streckte ihr die Mappe entgegen wie ein rotes Tuch dem Stier.
»Ha, ha!«, war Connys Antwort. »Findest du dich eigentlich lustig?« Mit einem Satz sprang sie auf ihn zu, doch schon schwirrte die Mappe in hohem Bogen durch die Luft und landete in Katharinas Händen.
»Pech gehabt!«, Stöff grinste übers ganze Gesicht.
»Bääh!«, machte Conny und streckte ihm die Zunge heraus, worauf alle schallend zu lachen begannen. Vor allem Stöff konnte sich kaum mehr beruhigen.
»Oh!«, meinte er und zog die Augenbrauen hoch. »Conny wird charmant!« Die anderen klatschten Beifall. »Nochmal, Conny! Zeig’ uns deine reizende Zunge!« Stöff lächelte boshaft. Er verneigte sich tief und setzte die Miene eines galanten Herrn auf, der zum ersten Mal um ein Mädchen wirbt.
»Hochgeehrte, tiefverachtete Cornelia! Im Namen meiner Mitbürger möchte ich mir die Erlaubnis nehmen, Sie zu fragen, ob es Ihnen etwas ausmachen würde, diese hochbegehrte, unmoralische Verlängerung des Mundes nochmals vorzuführen!« Er lachte schallend und auch die Umstehenden mussten sich die Bäuche halten. Nur Conny blieb ernst. Mit halbgeschlossenen Augen starrte sie Stöff lange an und wartete. Auch er wartete – alle Schüler warteten und jeder war gespannt, was geschehen würde. Aber es geschah nichts. Die Spannung stieg.
»Oh, Conny ist beleidigt!«, fügte Stöff hinzu, um sie endlich zur Explosion zu bringen. Conny kochte vor Wut, aber sie konnte sich beherrschen. So schnell ließ sie sich nicht unterkriegen!
»Und vor lauter Beleidigung hat sie sogar ihre Mappe vergessen!« Es war Tina, die diese Bemerkung gemacht hatte und Connys Mappe nun extra weit nach vorn streckte, damit sie ihr auch ja ins Auge steche.
»Komm doch, dann geb’ ich sie dir.«
»Du gibst sie mir ja doch nicht«, sagte Conny kalt, ohne Katharina dabei anzusehen.
»Wenn du herkommst, kannst du sie haben!« Conny warf einen Blick in die Runde. Feindselig, so schien es, starrten alle sie an. Da stand Katharina mit ihren abscheulichen Schlangenaugen, dort Thomas, der Nimmersatte, der dem Ganzen mehr oder weniger gleichgültig zusah und an seinem Brötchen knabberte, hier standen Daniel und Hans, zwei Fußballhelden, die außer Fußball nichts heißer liebten als Schlägereien und deshalb mit Spannung den Lauf der Dinge abwarteten. Neben ihnen stand Rudi, der Klassenbeste und zu guter Letzt gafften Britta und Paula, zwei Mädchen, deren Meinungen und Laune immer von der großen Masse abhingen, neugierig über die Schultern von Stöff. Aber da war noch jemand. Conny erkannte sie erst, als Britta und Paula etwas zur Seite rückten, um eine bessere Sicht zu gewinnen. Es war Bärbel. Sie saß im Hintergrund auf einem Stein und sah Conny mitfühlend an. Vielleicht war es Connys Gedanke an die Bitte, die sie Bärbel vorbringen wollte, vielleicht war es auch dieser mitfühlende Blick, der Conny neuen Mut gab, jedenfalls wandte sie sich jäh um und sprang auf Tina zu. Aber sie stolperte und fiel zur Belustigung der Zuschauer der Länge nach hin. Krebsrot vor Wut raffte sie sich wieder auf und wischte sich den Staub von den Kleidern. Stöff lachte laut.
»Oh, Conny, hast du dich verletzt?« Doch da landete eine derbe Ohrfeige in seinem Gesicht, und als er – überrascht von dieser Reaktion – aufsah, spuckte ihm Conny zur Verstärkung vor die Füße.
»Ich pfeife auf diese Art von Begrüßung!«, rief sie laut. Ihre Hände zitterten und ihre Augen funkelten böse. »Du ... du Mistvieh!« Voller Verachtung sah sie Stöff an. Das Lachen ringsherum verstummte. Stöff rieb sich die Wange, die vom Schlag noch immer brannte. Einen Augenblick verlor er seine überlegene Haltung, aber dann zischte er: »Pass auf, was du sagst ...« Er presste die Lippen aufeinander und packte Conny am Kragen. Die Schüler drängten sich dichter heran.
»Ich werde dir zeigen, wie ich mit Leuten umgehe, die ...« Weiter kam er nicht, denn mittendrin schrillte die Schulglocke. Stöff stieß Conny unsanft zurück.
»Es gibt ja immerhin noch eine Pause ...«, sagte er und lief davon. Die anderen watschelten hinterher, bis Conny allein zurückblieb. Sie seufzte, nahm die Mappe vom Boden, die Tina großzügiger Weise hatte liegenlassen, strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn und ging dem Schulhaus entgegen. Bärbel wartete am Eingang auf sie und hielt ihr die Türe auf.
»Kopf hoch!«, tröstete sie Conny und klopfte ihr auf die Schulter.
*
Obwohl Connys zehnköpfige Klasse seit Jahren zu einer der kleinsten zählte, richtete es der Lehrer oft so ein, dass er mit den einen etwas an der Tafel besprach, während er die anderen mit schriftlichen Aufgaben beschäftigte. Jeweils nach einer bestimmten Zeitspanne wurde gewechselt.
Normalerweise hasste Conny diese Art von Schulstunden, aber heute kam es ihr wie gerufen. Als Herr Gerber mit den einen Schülern eine schwierige Rechnung an der Tafel löste, bot sich ihr nämlich eine günstige Gelegenheit, sich mit Bärbel zu unterhalten.
Connys Herz klopfte wild vor Aufregung. Sie spähte vorsichtig nach allen Seiten. Sollte sie es nun wagen? Der Lehrer war mit sechs Schülern beschäftigt, da achtete er bestimmt nicht auf anderes. Katharina und Stöff waren in die Aufgaben vertieft ... also worauf sollte sie noch warten? Jetzt! Conny fasste sich ein Herz und schob sich etwas näher zu Bärbel.
»Du, Bärbel«, begann sie und spürte, wie ihr heiß wurde.
»Was ist?«
»Ich möchte dich etwas fragen.«
»Verstehst du die Rechnung nicht?«
»Nein, es ist etwas anderes, es ist ...« Conny biss sich auf die Lippen und suchte nach passenden Worten. »Es ist ...«
»Ach, du meinst wegen vorhin?«, fragte Bärbel. Sie warf einen Blick auf Tina und Stöff und fügte dann etwas leiser hinzu: »Keine Angst, Conny, wenn du im Zimmer bleibst, können die dir nichts antun.« Conny schüttelte den Kopf.
»Es ist nicht das, ich meine, das heißt ...«
»Ja, was denn?«
»Ich ... ich brauche Geld, Bärbel.« Jetzt war es raus. Conny war erleichtert und ängstlich zugleich. Was würde Bärbel nun denken? Wie würde sie reagieren? »Du brauchst Geld?«, wiederholte sie erstaunt. »Wozu brauchst du denn Geld?«
»Psst!«, machte Conny und hielt den Zeigefinger vor den Mund, um Bärbel klarzumachen, dass sie nicht so laut sprechen dürfe. Unauffällig warf sie wieder einen Blick in die hintere Bankreihe. Aber Tina und Stöff arbeiteten ruhig weiter.
»Ja, ich brauche Geld«, begann Conny noch einmal, »es ist ... ich habe dir vielleicht schon erzählt, dass der kleine Jöggi schwer krank ist und ...«
»Cornelia!« Conny fuhr zusammen und sah auf. Der Lehrer sah sie streng an.
»Was gibt es da zu schwatzen?«
»Ich musste Bärbel etwas fragen.«
»Fragen kannst du mir stellen, Cornelia, dazu ist nicht der Nachbar da.« Conny nickte verlegen. Der Lehrer wandte sich wieder seinen Schülern zu, die im Halbkreis um die Tafel standen und sich von ihm etwas erklären ließen. Bärbel und Conny warfen sich einen vielsagenden Blick zu und beugten sich wieder über ihre Hefte.
»Also, was war mit Jöggi?«, flüsterte Bärbel nach einer Weile. Conny überzeugte sich rasch, ob der Lehrer auch wirklich in seine Arbeit vertieft sei und antwortete dann genauso leise:
»Weißt du, ich musste ihm eine starke Medizin kaufen, damit er wieder zu Kräften kommt und ich hatte dummerweise ein falsches Mittel nach Hause gebracht.«
»Und was hat das mit dem Geld zu tun?«, wollte Bärbel wissen.
»Frau Wenger hat mir mit Schlägen gedroht, wenn ich nicht bis morgen Abend das richtige Mittel habe.« Conny stockte und sah Bärbel flehend an. »Bitte, hilf mir. Ich brauche das Geld dringend!« Bärbel seufzte nachdenklich.
»Und ich soll dir nun das Geld besorgen, wenn ich dich richtig verstehe«, murmelte sie.
»Bitte«, sagte Conny nochmals, »ich weiß, ich habe nicht das Recht, dich so etwas zu fragen, aber ...« »Wie viel brauchst du?«, fragte Bärbel sachlich.
»Ich kann es nicht genau sagen, vielleicht so ungefähr zwanzig Franken.«
»Zwanzig Franken?«, wiederholte Bärbel etwas zu laut. Herr Gerber wurde aufmerksam.
»Bärbel!«, rief er das Mädchen auf. »Was gibt es denn nun schon wieder zu schwatzen?« Bärbel suchte nach einer Ausrede, fand jedoch keine.
»Ich wollte nur ...«
»... Cornelia etwas fragen«, vervollständigte der Lehrer den Satz und fuhr dann strenger fort: »Es ist das letzte Mal, dass ich euch aufrufe, Bärbel und Cornelia. Andernfalls sehe ich mich gezwungen, euch auseinanderzusetzen. Ich hoffe, ich habe mich klar genug ausgedrückt.« Er kehrte ihnen wieder den Rücken zu. Die beiden Mädchen hielten es fürs beste, eine Weile den Schnabel zu halten und so vertieften sich beide in ihre Rechnungen. Natürlich waren sie nur halb bei der Sache, immer mussten sie an das Geld denken. Besonders Bärbel beschäftigte das Problem sehr.
»Zwanzig Franken«, ging es ihr durch den Kopf, »ich soll ihr zwanzig Franken geben. Einfach so ... zwanzig Franken, was hat sie sich denn dabei gedacht? Ich bekomme acht Franken Taschengeld pro Monat und sie will zwanzig Franken! Ich soll ihr zwanzig Franken geben, damit sie dem Jöggi eine Medizin kaufen kann. Weshalb gerade ich? Weshalb kann ihr nicht Frau Wenger das Geld geben? Soll sie doch selber zwanzig Franken auftreiben, wenn ihr so viel daran liegt. Was geht es mich an, wenn Jöggi krank ist?« Nachdenklich schielte sie zu Conny hinüber. Da saß sie, den Kopf in die Hände gestützt und starrte auf die Rechenaufgabe vor sich. Als Bärbel sie so sah, verspürte sie eine Art Mitleid für ihre Kameradin.
»Frau Wenger hat mir mit Schlägen gedroht, wenn ich nicht bis morgen Abend das richtige Mittel habe«, hatte Conny gesagt. Mit Schlägen hat sie gedroht. Bärbel schauerte es bei dem Gedanken, dass es Leute gab, die einem Kind mit Schlägen drohten. Es musste wohl fürchterlich sein, den ganzen Tag die Angst mit sich herumzutragen, dass man abends zu Hause Schläge bekommen könnte.
»Arme Conny«, dachte Bärbel, »ich glaube, wenn ich zu Hause geschlagen würde, bloß weil ich keine Medizin nach Hause brächte, würde ich ausreißen.« Bärbel musterte Conny, bis diese aufsah.
»Du bekommst wirklich Hiebe, wenn du die Medizin nicht bringst?«
Conny nickte stumm und sah ihre Nachbarin flehend an. Die biss sich mit gerunzelter Stirn auf die Lippen und atmete tief ein.
»Okay«, flüsterte sie dann, »ich geb’s dir!« Conny traute ihren Ohren nicht.
»Du willst mir tatsächlich helfen?« Ihre Augen begannen zu leuchten, am liebsten wäre sie Bärbel um den Hals gefallen.
»Du bist einfach Spitze!« Bärbel winkte bescheiden ab. »Ich bring’s dir morgen mit«, sagte sie nur. Doch da fuhr Conny auf.
»Nein, das geht nicht, das ist zu riskant.«
»Aber weshalb denn?« Conny antwortete nicht gleich.
Dann flüsterte sie so leise, dass Bärbel Mühe hatte, es zu verstehen: »Leg es heute Abend in die kleine Höhle, die sich zwischen den Wurzeln der Buche befindet.«
»Welche Buche?« Conny überzeugte sich mit einem raschen Blick, dass ihnen niemand zuhörte, und raunte dann noch leiser:
»Vor dem Schulhaus steht doch die Buche. Sie hat eine Höhle in den Wurzeln. Es ist das beste Versteck, das ich kenne.«
»Aber ich kann dir das Geld doch morgen in der Schule geben, weshalb ...«
»Glaub’ mir, es gibt einen guten Grund dafür, aber ich kann es dir nicht erklären, jetzt nicht! Bitte, leg es dorthin.«
»Aber ...« Bärbel seufzte und kratzte sich an der Stirn. »Aber nur, weil du’s bist ...«, sagte sie.
*
Als Conny an diesem Tag den Heimweg antrat, war sie ganz durcheinander und nervös. Einmal prallte sie heftig mit einer alten Dame zusammen, die vor Schreck ihre Tasche fallen ließ und etwas weiter vorn quietschten die Bremsen eines Autos, weil Conny blindlings über die Straße gegangen war. Sie murmelte eine Entschuldigung und stolperte weiter. Ihre Gedanken kreisten die ganze Zeit um ihre Flucht. Ob Bärbel ihr Versprechen wohl hielt?
»Sie muss es bringen«, sagte Conny zu sich selbst, »ich wüsste nicht, was ich ohne das Geld machen könnte, ich wäre total aufgeschmissen. Ach, Quatsch, Bärbel ist ein anständiges Mädchen, sie würde es nie wagen, ein Versprechen zu brechen, nein, darum brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Heute Nacht hole ich mir das Geld und dann geht’s ab nach St. Gallen. Es wird nichts schiefgehen, bestimmt nicht.« Und trotzdem, ganz so sicher war sich Conny auch wieder nicht. Es bestand ja ohne Zweifel die Möglichkeit, dass sich Bärbel das Ganze anders überlegte ... Die Turmuhr schlug sechs Mal. Conny fuhr zusammen.
»Meine Güte, das Abendessen!« Vor lauter Überlegen hatte Conny die Zeit völlig vergessen. Jetzt musste sie sich aber sputen, um noch rechtzeitig zu Hause zu sein, denn um fünf nach sechs wurde bei Wengers zu Abend gegessen, und wenn Conny auch nur eine Minute später eintraf, wurde Frau Wenger fuchsteufelswild. »Das gibt Ärger!« Und damit behielt sie Recht. Die Hände in die Seiten gestützt, erwartete die Frau Conny am Eingang und dann ging es los ...
»Wo bleibst du so lange? Du weißt ganz genau, dass um diese Zeit gegessen wird, aber nein, Conny macht wieder eine Ausnahme. Du solltest dich schämen!« Frau Wenger holte Luft. »Alle sitzen bereits am Tisch, nur du nicht. Wo hast du dich bloß so lange herumgetrieben? Um fünf ist die Schule aus und jetzt ist es sechs! Nein, sogar sieben Minuten nach sechs! Seit wann brauchst du eine Stunde zu Fuß von der Schule nach Hause?«
»Ich habe einen kleinen Umweg gemacht ...«, log Conny und sah auf ihren Schuh, der kleine Kreise in die Erde zeichnete. »Sieh mich an! Du hast also einen kleinen Umweg gemacht? Das glaubst du doch wohl selbst nicht – einen Umweg, ha, das ist ja gelacht! Nun gut, lassen wir das, aber ich wünsche, dass das in Zukunft nicht mehr vorkommt, hast du mich verstanden? Ich frage dich, ob du mich verstanden hast!«
»Ja, ich habe verstanden«, antwortete Conny seufzend. »Ich hoffe es für dich«, sagte die Bauersfrau. »So, und nun marsch, an den Tisch!« Breitbeinig lief Frau Wenger voraus in die Küche. Sechs Augenpaare starrten Conny an, als sie mit hängenden Schultern eintrat und sich stumm auf ihren Platz setzte. Schweigend guckte sie in die Runde. Da saßen die fünfjährigen Zwillinge Röbi und Hansli, der kranke siebenjährige Jöggi und Ernst, der älteste Sohn, der bei seinem Vater in die Lehre ging. Eine Glocke des Schweigens hing über den Sitzenden, die erst gebrochen wurde, als Eddie das Tischgebet sprach. Ohne ein Wort zu sagen, begann die Familie zu essen. Conny saß gedankenversunken da und strich ihr Brot, obwohl die Konfitüre schon längst verstrichen war. Sie spürte, wie sie von allen Seiten angestarrt wurde, und sie kam sich auf einmal klein und verlassen vor inmitten dieser Bauernfamilie. Und je länger, desto mehr wuchs der Hass in ihr und sie sehnte sich immer mehr nach der Nacht, denn noch in dieser Nacht sollte es losgehen – in dieser Nacht, noch bevor es zwölf Uhr schlug. Dann sollte sich ein Mädchen, begleitet von einer schwarzen Katze, hinaus in die unheimliche Nacht schleichen und niemand würde es je wieder finden ...
»Bist du bald fertig mit Konfitüre streichen?« Es war Ernst, der diese Bemerkung hatte fallenlassen und die andern zum Lachen brachte. Conny sah verstört auf und legte das Messer zur Seite.
»Ich wollte ...«, murmelte sie, aber als die vier Jungen weiterlachten, ersparte sie sich eine Erklärung und griff zur Milchkanne, um ihre Verlegenheit zu verbergen.
»Sag mal, Conny, was ist eigentlich los mit dir?«, mischte sich Eddie ein. »Hast du zu wenig geschlafen?« Conny winkte eifrig ab.
»N ... nein, nein, ich ... ich habe sogar sehr ... sehr gut geschlafen ...«
»Ach, wirklich? Und mir schien, als wärst du die ganze Zeit in deinem Zimmer spazieren gegangen.« Conny zuckte zusammen. Hatte man sie etwa gehört? Nein, das durfte doch nicht wahr sein!
»Ja, das ist mir auch aufgefallen«, mischte sich jetzt Ernst ein, »das Rumoren in ihrem Zimmer war ja unüberhörbar. Ich dachte natürlich, ich phantasiere bloß, aber als die Geräusche längere Zeit anhielten ...« Frau Wenger schlug mit der Faust auf den Tisch und sah Conny streng an.
»Mit dir hat man wirklich nichts als Ärger! Was hast du letzte Nacht getrieben? Ich verlange eine klare Antwort!«
»Ich weiß es nicht«, log Conny mit klopfendem Herzen. Ernst lachte.
»Das glaubst du doch selbst nicht! Mit deiner roten Birne verrätst du ja selbst, dass du etwas im Schilde geführt hast.«
»Ich weiß wirklich nichts, ehrlich ... ich habe die ganze Zeit geschlafen, ich ...« Sie spürte ihr Herzklopfen bis in den Kopf.
»Wenn da nichts los war, will ich Fritz heißen! Ich hörte doch ganz genau ...«
»Was war da oben los?« Die Bauersfrau schrie es beinahe.
»Nichts«, versicherte Conny, obwohl sie glaubte, ihre Herzschläge müsste man von weitem hören, »ich habe geschlafen.«
»Etwas laut, wenn du mich fragst«, fügte Ernst hinzu. »Ich frage dich aber nicht!«, gab Conny zurück und würgte schnell zwei Brotbissen hinunter, um sich eine freche Bemerkung zu verkneifen. Zu dumm, dass Eddie ausgerechnet auf dieses Thema zu sprechen gekommen war. Was sollte sie sagen? Irgendetwas musste ihr doch einfallen! Die Bauersfrau wurde ungeduldig.
»Zum letzten Mal: Was war der Grund für diesen Lärm?«
Conny suchte krampfhaft nach einer Lösung. »Ich habe Mizzi zu trinken gegeben«, antwortete sie schließlich.
»So«, meinte Frau Wenger, »und deshalb erwachen Ernst und mein Mann? Zum Teufel mit dir und deiner ewigen Katze! Wenn das noch einmal vorkommt ...« Weiter kam sie nicht, denn mit einem Mal sprang Conny auf und lief zur Küche hinaus; dann hörte man Schritte, und eine Tür fiel krachend ins Schloss.
»Ich werde dich lehren!«, rief ihr die Frau mit geballter Faust und böse funkelnden Augen hinterher.
Conny saß auf ihrem Bett, den Kopf auf die Hände gestützt und schluchzte, dass ihr die Tränen nur so über die Wangen liefen. »Zum Teufel mit dir und deiner ewigen Katze!«, wiederholte sie. »Ich kann euch alle nicht mehr hören, ich hasse euch, ich hasse euch alle!« Sie schnäuzte sich die Nase mit den zittrigen Fingern und heulte weiter.
»Du, Ernst, mit deiner hinterlistigen Zunge, glaubst du etwa, ich merke nicht, dass du dir all diese Bemerkungen erlauben kannst, weil du unter dem Schutz deiner Eltern stehst? Und Jöggi, weshalb plapperst du deinem größeren Bruder alles nach, obwohl du nicht begreifst, worum es eigentlich geht? Eddie, du Egoist, hast du wirklich das Gefühl, dass deine Frau immer die Wahrheit spricht, oder bist du zu feige, um deine Meinung zu vertreten? Und du, Helga, Schlangenkönigin, ist dein Mund zu stolz, um ein einziges Mal ein Kompliment über die Lippen zu bringen? Bin ich denn kein Mensch, dass ihr mich wie einen Hund behandelt? Aber wartet nur, wartet, heute ist es das letzte Mal, dass ich mir das gefallen lasse, heute habt ihr mich zum letzten Mal verhöhnt und verspottet! Wartet nur bis morgen, dann wird es euch leid tun, wie ihr mich behandelt habt, aber dann ist es zu spät ...«
Mitternacht
Ein Blitz erhellte für den Bruchteil einer Sekunde die dunkle Kammer und ein gewaltiger Donnerschlag ließ das kleine, zersplitterte Fenster vibrieren. Der Wind heulte. Conny schloss die Augen und ließ sich zum letzten Mal ihren Fluchtplan durch den Kopf gehen, denn heute Nacht sollte es losgehen. Heute Nacht um zwölf ... Connys Herz klopfte wild vor Aufregung und Angst und vor lauter Nervosität wusste sie kaum, wie sie dasitzen sollte.
»Also«, sagte sie und biss sich auf die Lippen, »um zwölf gehe ich hinunter in die Küche, um Mizzi zu holen. Dann schleichen wir uns durch den Hinterausgang aus dem Haus, über den Hof und auf dem direktesten Weg zum Schulhaus. Dort hole ich mir das Geld und gehe anschließend zu Fuß nach Bremgarten. Wir müssten das Dorf– falls alles gutgeht – gegen drei, halb vier erreichen und hätten noch ein bis zwei Stunden Zeit, uns auszuruhen. Dann können wir gleich den ersten Zug nach Zürich nehmen und von dort weiter nach St. Gallen reisen. Ja, wenn wir erst mal in Bremgarten sind, ist der Rest ein Kinderspiel. Aber bis wir dort sind ...«
Mit gerümpfter Nase blickte Conny hinaus in die schwarze Nacht. Große, schwere Wolken schoben sich über den klaren Sternenhimmel und ballten sich zu einem völlig undurchsichtigen Mantel zusammen. Noch regnete es nicht, aber es würde wohl nicht mehr lange dauern, bis sich diese Wolken entluden. Conny schauderte bei dem Gedanken daran und sie wünschte sich, sie könnte hier bleiben, hier, unter dem schützenden Dach. Doch sie wusste genau, dass das nicht möglich war – sie musste fort, noch bevor der Hahn auf dem Mist den neuen Tag ankündigte, sie musste noch heute hinaus in die unheimliche Nacht. Nur noch wenige Augenblicke trennten sie davon ... Conny dachte daran, wie sie in strömendem Regen, allein und verlassen, durch diese furchtbare schwarze Nacht gehen würde, ganz allein, nur von einer schwarzen Katze begleitet; es lief ihr kalt den Rücken hinunter. Ängstlich blickte sie in den Himmel. Kein einziger Stern war nun zu sehen, alles war mit grauen, dichten Wolken bedeckt ... Da! Wieder ein Blitz! Conny fuhr zusammen. Ja, bestimmt dauerte es nicht mehr lange, bis der Regen kam, das spürte sie.
»Ach, wären wir doch schon bei Großmutter!«, seufzte sie und ließ sich aufs Kopfkissen zurückfallen. Aus weiter Ferne drangen Glockenschläge an ihr Ohr, es war jetzt genau elf Uhr.
»Elf Uhr«, murmelte Conny. Also hatte sie noch eine Stunde Zeit, eine Stunde, nur noch eine Stunde ... Conny stand wieder auf und schlenderte, die Hände auf dem Rücken, durchs Zimmer. Sie überlegte. Gab es nicht noch etwas, das sie vor der Abreise dringend tun musste? War alles bereit? Hatte sie nichts vergessen? Ach, wenn es doch etwas gäbe, das sie tun könnte, nur etwas Kleines, es brauchte bloß etwas zu sein, dass die Zeit ein paar Minuten vorwärts rückte. Denn Conny hielt das Warten kaum mehr aus.
»Warten«, murmelte sie, »was für ein schreckliches Wort ...« Ja, es war wirklich ein schreckliches Wort und deshalb wollte Conny auch dringend etwas tun, egal was, wenn sie auch nur kontrollierte, ob sie alles Notwendige für die Reise eingepackt hatte. Sie öffnete die angelehnte Kastentür und bückte sich, um das Bündel, das sie für die Flucht bereitgelegt hatte, aus dem Kastenfuß zu nehmen. Es war ein großes Dreieckstuch, vollgestopft mit Dingen, die sie mitnehmen wollte. Alle drei Ecken des Tuches waren zu einem Knoten verschlungen und hielten so den Inhalt zusammen. Conny öffnete den Knoten, breitete das Bündel auf dem Boden aus und überflog mit einem raschen Blick die einzelnen Gegenstände. Da waren zum Beispiel zwei Scheiben hartes Brot, die Conny den Schweinen gestohlen hatte, damit sie auf der langen Reise auch etwas zum Knabbern hatte. Dazu hatte sie Salami und etwas Käse eingepackt, was sie heimlich aus der Vorratskammer entwendet hatte, damit sie das Brot nicht so verspeisen musste. Der Rest bestand aus Kleidung: ein Paar Handschuhe, die sie selbst einmal gestrickt hatte, drei gestickte Taschentücher und ihr Lieblingsrock. Das war alles.
Nein, halt, es war noch etwas dabei: ein Schmuckstück, eine Brosche. Conny nahm das kostbare Schmuckstück in ihre Hände und betrachtete es lange. Es war ungefähr so groß wie eine Pflaume, flach und oval. Die weißen Rosen, die die Brosche umrahmten, leuchteten hell im Dunkeln und die Inschrift, die in der Mitte mit elegant geschwungenen Buchstaben geschrieben stand, glänzte wie Feuer in Connys Hand. »GOTT SCHÜTZE DICH«, lautete sie.
Conny konnte mit diesen Worten nicht viel anfangen, aber trotzdem wollte sie gut auf die Brosche achten, denn es war die einzige Erinnerung an ihre verstorbene Mutter. Ihr hatte dieser Schmuck einst gehört und als Conny nach ihrem Tod packen musste, um nach Wohlen zu reisen, hatte sie diese Brosche als Erinnerungsstück mitgenommen. Aber nicht die Verzierungen waren es, die Conny dazu bewogen hatten, dieses Amulett zu behalten, nein, der wahre Grund war ein anderer. Die Brosche barg nämlich ein kleines Geheimnis. Man konnte sie durch einen Trick öffnen, worauf ein winziges Foto zum Vorschein kam: das Bild von Connys Mutter. Gerade jetzt öffnete Conny das Schmuckstück und sah ihrer Mutter in die Augen. Sanft strich sie über die Fotografie und seufzte dabei tief. Ein unsagbarer Schmerz stach ihr mitten ins Herz.
»Mutter«, sagte Conny und küsste das Bild, »Mutter ...« Sie trat ans Fenster und starrte eine Weile gedankenlos hinaus in die schwarze Nacht. Die Wolkenwand hatte sich inzwischen über dem ganzen Himmelsgewölbe ausgebreitet und ließ die Gegend noch unheimlicher erscheinen, als sie es ohnehin schon war. Ein Blitz spaltete die Wolken entzwei und fast gleichzeitig grollte der Donner. Connys Blick fiel wieder auf ihre Mutter, die sie freundlich anlächelte.
»Meine Mutter«, murmelte sie, »weshalb hast du mich verlassen? Du kannst dir ja nicht vorstellen, wie sehr ich dich vermisse, du weißt ja nicht, wie schrecklich das Leben sein kann ohne dich ... oh, Mutter, meine liebe, gute Mutter ...« Conny hielt die Brosche ganz nahe vors Gesicht und sah ihre Mutter durchdringlich an.
»Was glaubst du, ist es richtig, was ich jetzt tue?« Sie wartete eine Weile, als ob sie von der Mutter eine Antwort erhalten könnte und nickte dann ernst.
»Ja, ich weiß, ich spüre es genau: Du willst nicht, dass ich es tue, nicht wahr?« Conny seufzte und ließ den Arm, mit dem sie das Schmuckstück festhielt, schlaff fallen.
»Du verstehst mich nicht«, meinte sie, »aber du kannst ja nicht wissen, wie ich hier behandelt werde. Du weißt ja nicht, wie oft ich geschlagen werde ... begreife doch, ich halte es hier nicht mehr aus, ich muss fort von hier, verstehst du? Ich werde fliehen, nach St. Gallen zu Großmutter ... sobald es zwölf Uhr schlägt ...« Conny ließ die Brosche in ihre Tasche gleiten und kniete sich auf den Boden, um das Bündel wieder zusammenzuknoten. Dann fuhr sie sich über die Stirn und setzte sich aufs Bett zurück. Sie tippte sich aufgeregt aufs linke Knie. Ach, wäre es doch endlich zwölf Uhr! Noch nie hatte sie sich mehr nach dieser Zeit gesehnt und noch nie war die Zeit langsamer dahingekrochen. »Diese ewige Zeit«, dachte sie. »Immer, wenn sie schnell vorübergehen soll, schleicht sie dahin und lässt Sekunden zu Stunden werden. Es ist genau wie in der Schule – wenn man sich eine Pause wünscht, ist es, als bliebe die Zeit stehen und wenn die langersehnte Pause endlich da ist, dauert es keine drei Sekunden, bis die Schulglocke schon wieder schrillt. Wirklich ärgerlich!«
Wie lange dauerte es wohl noch? Eine halbe Stunde, eine Viertelstunde oder gar nur noch fünf Minuten? Sie wusste es nicht, sie hatte das Zeitgefühl völlig verloren. Und dennoch war es ihr, als hätte sie die festgesetzte Zeit schon längst verpasst, ja, es kam ihr vor, als säße sie schon Jahre da, um auf den Zwölfuhrschlag der Dorfglocke zu warten. »Zu dumm, dass ich keine Uhr habe!«
Ja, es war ärgerlich ohne Armbanduhr, vor allem in Connys Lage. Bis jetzt hatte sie es noch nie für nötig befunden, eine eigene Uhr zu besitzen, aber nun wünschte sie sich eine, nun war sie neidisch auf alle, die eine hatten. Alles hätte sie gegeben, um wenigstens für eine Stunde eine Uhr zu tragen. Denn nun blieb ihr nichts anderes übrig, als sich auf die einzige Richtlinie zu verlassen: die Dorfuhr. Und so saß sie da und wartete ... und wartete ...
Es war wohl eine Ewigkeit vergangen, bis ein leises Geräusch an ihr Ohr drang. Augenblicklich zuckte sie zusammen und atmete innerlich auf.
»Zwölf Uhr«, sagte sie und ergriff ihr Bündel, »es ist soweit.« Sie wartete, bis die Glockenschläge verklungen waren und wandte sich der Tür zu. Sie stand auf. Leise und vorsichtig lief sie zur Tür und öffnete sie so weit, dass sie gerade durch den Spalt schlüpfen konnte. Ein Blitz fuhr vom Himmel herab und beleuchtete die Kammer für einen kurzen Moment.
»Mach’s gut, mein Zimmer«, flüsterte Conny noch, bevor sie sachte die Tür hinter sich schloss und verschwand. Draußen begann es zu regnen.
Die Polizei schaltet sich ein
Lesen Sie weiter in der vollstädigen Ausgabe.
Tina plant Böses
Lesen Sie weiter in der vollstädigen Ausgabe.
Die sieben Spürnasen
Lesen Sie weiter in der vollstädigen Ausgabe.
Bremgarten ist verdächtig
Lesen Sie weiter in der vollstädigen Ausgabe.
Auf der Flucht
Lesen Sie weiter in der vollstädigen Ausgabe.
In der Falle
Lesen Sie weiter in der vollstädigen Ausgabe.
Keine Chance
Lesen Sie weiter in der vollstädigen Ausgabe.
Die Überraschung
Lesen Sie weiter in der vollstädigen Ausgabe.
Die Suchaktion
Lesen Sie weiter in der vollstädigen Ausgabe.
Der kleine Zwischenfall
Lesen Sie weiter in der vollstädigen Ausgabe.
Verhängnisvolle Bekanntschaft
Lesen Sie weiter in der vollstädigen Ausgabe.
Eine schreckliche Nacht
Lesen Sie weiter in der vollstädigen Ausgabe.
Der Einbruch
Lesen Sie weiter in der vollstädigen Ausgabe.
Auf Verbrecherjagd
Lesen Sie weiter in der vollstädigen Ausgabe.
Roman
Lesen Sie weiter in der vollstädigen Ausgabe.
Der Traum
Lesen Sie weiter in der vollstädigen Ausgabe.
Großmutter
Lesen Sie weiter in der vollstädigen Ausgabe.
Der Empfang
Lesen Sie weiter in der vollstädigen Ausgabe.
Unsere Empfehlungen
Damaris Kofmehl: Der Banküberfall | Die Abenteuerklasse – Band 2
Folgen Verlag, ISBN: 978-3-944187-33-4
Die Jungen und Mädchen der Abenteuerklasse gehen in Wohlen – das liegt in der Schweiz – zur Schule. Anscheinend üben sie auf Abenteuer eine große Anziehungskraft aus. Wie ist es sonst zu erklären, dass immer wieder so aufregende Dinge geschehen?
Diesmal bekommen sie sogar offiziell schulfrei, denn Conny ist ausgerissen, einfach verschwunden! Warum nur? Ob die Klasse vielleicht auch ein wenig schuld daran hat?
Conny jedenfalls setzt alles daran, auf ihrer verzweifelten Flucht nicht entdeckt zu werden – weder von der alarmierten Polizei noch von ihren Klassenkameraden. Aber das hat schlimme Folgen, denn sie tappt in eine böse Falle! Schaffen es die Freunde, sie noch rechtzeitig aufzuspüren?
Damaris Kofmehl: Der Schatz auf der Insel | Die Abenteuerklasse – Band 3
Folgen Verlag, ISBN: 978-3-95893-029-2
Aus einem alten, abbruchreifen Haus dringen verdächtige Töne. Ob es darin spukt? Die merkwürdigen Ereignisse häufen sich, und da steht für die Schüler der Abenteuerklasse der Entschluss fest: Sie werden herausfinden, was es mit diesem Haus alles auf sich hat! Aber anscheinend sind sie nicht die einzigen, die einem Geheimnis auf die Spur kommen wollen. Hans und Conny beobachten bei einem nächtlichen Ausflug sogar eine schreckenerregende Gestalt – und dann sind Tina und Stöff plötzlich verschwunden!
Damaris Kofmehl: Gefahr im Zeltlager | Die Abenteuerklasse – Band 4
Folgen Verlag, ISBN: 978-3-944187-62-4
Roman und Jörg sind eifrig dabei, die alte Fahrradwerkstatt bei Dottikon wieder instand zu setzen. Da taucht auf einmal ein mysteriöser Motorradfahrer auf. Jörg ist von seinem Erscheinen total geschockt. Warum nur? Und warum stellt der Motorradfahrer dem Jungen nach?
Als kurz darauf die beiden Freunde mit ins Klassenlager dürfen, überschlagen sich die Ereignisse. Ist Jörg tatsächlich in einen Rauschgiftschmuggel verwickelt? Oder versucht jemand, ihm etwas anzuhängen? Ein Tauziehen um Jörg beginnt. Wird sich die Freundschaft der Klasse bewähren, oder wird ihr Mißtrauen ihn in die Hände der Gangster treiben?
Damaris Kofmehl: Die geheimnisvolle Brosche | Die Abenteuerklasse – Band 5
Folgen Verlag, ISBN: 978-3-95893-028-5
Ein rätselhafter Brief bringt Conny völlig durcheinander – warum ist ein Unbekannter so sehr an der Brosche interessiert, die sie von ihrer Mutter geerbt hat? Soll sie sich wirklich auf seinen Vorschlag einlassen, sich mit ihm zu treffen?
Als Tina ihr nachspioniert und sich in die Sache einmischt, kann Conny schließlich nicht mehr zurück. Doch was ist, wenn Adrians haarsträubender Verdacht stimmt – wenn die Brosche tatsächlich etwas mit Connys verschwundenem Vater zu tun?