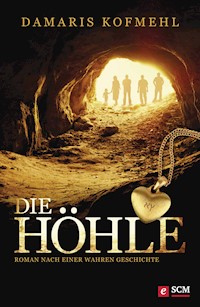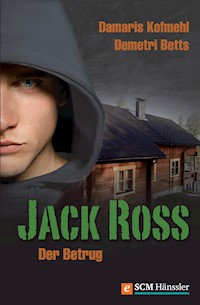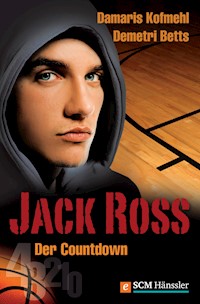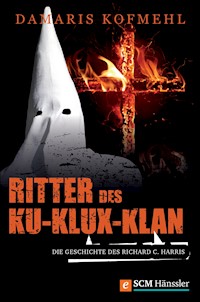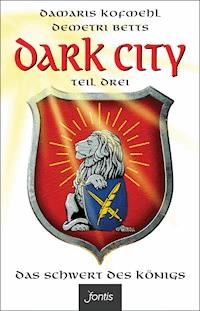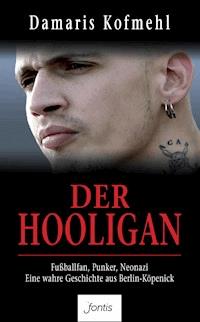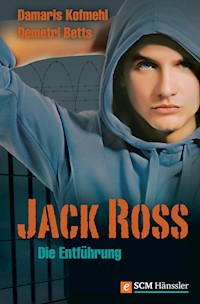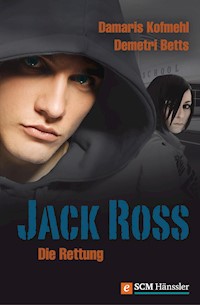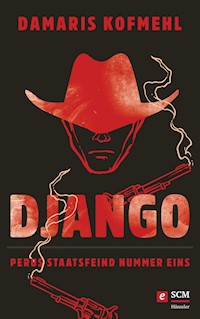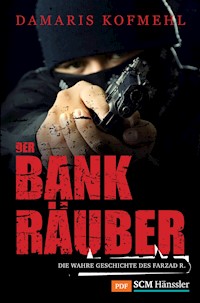Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SCM Hänssler
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein packender Fantasy-Roman mit geistlicher Wahrheit aus der Feder von Bestseller-Autorin Damaris Kofmehl! Leandro ist auf Löwenjagd. Plötzlich stürzt er durch einen unsichtbaren Durchgang in eine andere Welt: Thabur. Er erfährt, dass er Teil einer uralten Prophezeiung ist. Gemeinsam mit einem geheimnisvollen weißen Löwen soll er das Volk aus der Knechtschaft des Tyrannen Rhakan befreien. Das kämpferische Waldmädchen Tajana, der unmusikalische Barde Björg und der einbeinige Schmied Jahron werden seine Gefährten. Doch Rhakans beste Krieger sind ihnen auf den Fersen. Gelingt es dem Tyrannen, den weißen Löwen zu töten, ist das Schicksal Thaburs besiegelt. Gejagt von Schattenkriegern und finsteren Kreaturen suchen Leandro und seine Freunde verzweifelt nach Verbündeten, um Rhakan vom Thron zu stürzen. Die Schlacht um Thabur hat begonnen... Damaris Kofmehl trägt den Stoff dieser Geschichte schon über zehn Jahre im Herzen. Eindrücklich werden geistliche Wahrheiten greifbar: Christus lebt in uns wie das Löwenblut in Leandro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 703
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Damaris Kofmehl
Der weiße Löwe von Thabur
Die Löwenblut-Saga
SCM Hänssler ist ein Imprint der SCM Verlagsgruppe, die zur Stiftung Christliche Medien gehört, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.
ISBN 978-3-7751-7473-2 (E-Book)
ISBN 978-3-7751-6027-8 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book: CPI books GmbH, Leck
Dieser Roman erschien zuvor unter einem anderen Titel unter der ISBN 978-3-7751-5910-4.
© 2019 SCM Hänssler in der SCM Verlagsgruppe GmbH
Max-Eyth-Straße 41 · 71088 Holzgerlingen
Internet: www.scm-haenssler.de · E-Mail: [email protected]
Die Bibelverse sind folgender Ausgabe entnommen:
Neues Leben. Die Bibel, © der deutschen Ausgabe 2002 und 2006
SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH Witten/Holzgerlingen.
Lektorat: Christina Bachmann
Umschlaggestaltung: Kerstin ter Veen, Bundes-Verlag GmbH, Witten
Titelbild: Illustration: Kerstin ter Veen, Bundes-Verlag GmbH, Witten;
gettyimages.de, Bild-ID: 514987426; Unsplash.com, Arleen Wim
Satz: Breklumer Print-Service, Breklum
Ich widme dieses Buchmeinem über alles geliebten Mann Demetri Betts,der viel zu früh von uns ging.
Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen.Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben.Durch seine Wunden wurden wir geheilt!
Jesaja 53,5
INHALT
Über den Autor
Vorwort
Teil 1Die Prophezeiung
Am Abgrund
Der Angriff
Die Einladung
Löwenjagd
Thabur
Der Pakt
Die Prophezeiung
Der Schwertträger Arkyns
Kampftraining
Der Rat der Zwölf
Der Verrat
Teil 2Der schwarze Berg
Die Geister, die ich rief …
Das Verhör
Der Wald
Der Schmied
Trond
Das Juwel des Königs
Die Sümpfe
Der Barde
Antaras
Teil 3Die Tempelstadt
Die Spiele
Die Lüge
Im Kerker
Die Flucht
Lord Elrik
Der Schlachtplan
Die Hinrichtung
Unter der schwarzen Sonne
Teil 4Der weiße Berg
Begegnung mit dem Schatten
Der Felsenhorst
Windgeflüster
Nachricht von Lord Elrik
Der Angriff
Finstere Pläne
Die Minen Dravans
Die Brücke
Das Opfer
Der Preis
Der weiße Löwe
Teil 5Die Schlacht um Thabur
Der Brustschild Salems
Die Schlacht
Der letzte Kampf
Freiheit
Die Rückkehr
Löwenblut
Nachwort
Nachwort von Angelo Nero alias Leandro – Ein Spiegel
Namen und ihre Bedeutung
Bibelverse und Parallelen
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
ÜBER DIE AUTORIN
DAMARIS KOFMEHL ist gebürtige Schweizerin und schrieb bisher 40 Bücher, darunter eine Fantasy-Trilogie und 23 Thriller, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Ihre Buchrecherchen führten sie unter anderem nach Brasilien, Pakistan, Guatemala, Chile, Peru, Australien und in die USA. Heute lebt sie in der Schweiz.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
VORWORT
Vor über zehn Jahren waren mein Mann Demetri und ich bei einer Familie zum Abendessen eingeladen. Plötzlich fiel mein Blick auf eine Weinflasche mit dem Etikett »Löwenblut«. Was für ein starkes Wort!, dachte ich bei mir, und im selben Moment wusste ich, dass ich eines Tages ein Buch mit diesem Titel schreiben würde. Jahre später erzählte ich Demetri davon und er war begeistert. Wir tauschten ein paar Ideen aus und planten einen Fantasyroman, den wir zusammen schreiben wollten. Leider kam es nie dazu, weil Demetri im Frühling 2017 überraschend verstarb. Aber der Titel und die Ideen dazu ließen mich nicht mehr los. Ich beschloss, das Buch trotzdem zu schreiben und Demetris Ideen einfach miteinfließen zu lassen.
Als ich mir dann das Konzept zurechtlegte und in Gedanken die Geschichte formte, kam mir eine ziemlich verrückte Idee: Wie wäre es, wenn ich ein paar Personen nehme, die tatsächlich existieren, und diese in meine Fantasywelt hineinverpflanze? Eine True-Life-Fantasy-Geschichte sozusagen? Ich glaube nicht, dass es dieses Genre offiziell überhaupt gibt. Ich habe es einfach erfunden das Ergebnis ist in der Tat ein True-Life-Fantasy-Roman. Denn sowohl für Leandro wie Tajana, Jahron und auch Björg gibt es reale Personen, die mir eine Inspiration waren - alles gute Freunde von mir mit krassen Storys. Vieles, was ich von ihnen schreibe, basiert auf ihren ganz persönlichen Erlebnissen und spiegelt ihre individuellen Charaktere. Von Angelo Nero, der das Vorbild für meinen Protagonisten Leandro ist, durfte ich sogar Ausschnitte aus seiner selbst veröffentlichten Biografie miteinflechten, was seine Geschichte umso authentischer macht. Welche Geschichten wahr sind und welche Fantasy, das zu beurteilen überlasse ich allerdings dir, lieber Leser.
Ich wünsche mir, dass du Spaß hast beim Lesen. Ich hoffe aber auch, dass es dir gelingt, die geistlichen Wahrheiten zu entdecken, die ich in der Geschichte versteckt habe. Mein allergrößter Wunsch ist, dass einige davon tief in deinem Herzen haften bleiben und dich stark machen für dein eigenes Leben. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude bei der Lektüre von dieser True-Life-Fantasy-Geschichte.
Damaris Kofmehl
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
AM ABGRUND
Leandro hielt sich rücklings am Brückengeländer fest und starrte hinab in den tosenden Gebirgsfluss. Es war eine graue, sternenlose Nacht. Regnerische Windböen bogen die Baumkronen des Waldes und spuckten dem jungen Mann voller Verachtung ins Gesicht. Sein langer schwarzer Ledermantel schlackerte um seine Beine. Ein Schritt und der Albtraum wäre vorbei. Nur ein Schritt über die schmale Kante hinaus und endlich wäre sein armseliges Leben zu Ende.
Lass los, säuselte eine Stimme in seinem Kopf. Lass einfach los. Sei kein Feigling. Tu es einfach!
Leandro lehnte seinen Oberkörper nach vorne. Tief unter sich sah er die schäumende Gischt, hörte er das Gurgeln und Rauschen der Fluten. Die Schlucht zog ihn wie magisch in ihren Bann. Der Regen peitschte ihm ins Gesicht und tropfte von seinen langen schwarzen Haarsträhnen. Der Schatten rief ihn. Er forderte sein Leben. Hier und jetzt. Leandro spürte es mit jeder Faser seines Körpers. Der Sog war unglaublich stark. Dennoch krallten sich seine Finger wie verbissen um das Geländer und ließen nicht los. Sie waren rebellischer als er selbst.
Entspann dich! Hab keine Angst, ich fang dich auf! Nur ein Schritt und du bist frei. Du schaffst das!
»Ich schaffe das«, wiederholte Leandro und spürte, wie sein Griff sich lockerte und seine Finger über das kalte Metall glitten.
Gut so, spornte ihn die Stimme weiter an. Lass einfach los! Dann tut es nicht mehr weh. Es hat keinen Wert mehr weiterzuleben. Du bist ein schlechter Mensch.
»Ich weiß«, sagte Leandro, den Blick in die Tiefe gerichtet.
Du tust damit allen einen Gefallen. Denk an all den Schmerz, den du verursacht hast. Du hast keine Wahl. Du musst es tun.
»Ich weiß …«
Mehr und mehr lullte ihn die Stimme ein. Der Gedanke, es zu beenden, war so verlockend, so tröstend. Er hatte es verdient zu sterben. Es war an der Zeit, den Preis für seine Sünden zu bezahlen. Er wollte loslassen, doch noch immer weigerten sich seine Finger, ihm zu gehorchen. Langsam wurde der Schatten ungeduldig.
Worauf wartest du?, drängte er ihn. Spring endlich!Setz deinem erbärmlichen Leben ein Ende! Gib auf! Glaubst du wirklich, es gäbe noch Rettung für jemanden wie dich? Glaubst du das wirklich? Nach allem, was du getan hast? Du Narr! Lass dich fallen!
»Ich kann das nicht«, flüsterte Leandro, seine Hände um das Brückengeländer verkrampft.
Natürlich kannst du! Komm schon! Bring es hinter dich! Es gibt keinen anderen Weg!
»Und wenn doch?«
Du hast dich entschieden, mein Lieber. Denk dran, du hast einen Pakt mit mir geschlossen …
»Ich weiß …«
Dann sei ein Mann und spring!
»Neeeein!«
Ein gellender Schrei hallte durch die Nacht. Entflammt von einem urplötzlichen Kampfgeist, streifte Leandro die Klauen des Todes gewaltsam von sich ab und zog seinen Körper an die Brüstung zurück.
»Nicht heute Nacht!«, schnaubte er provokativ über den schwarzen Wald hinweg. Sein Puls raste. Alles in ihm zitterte. Unter Aufbringung all seiner Kraft drehte er sich um und kletterte über das Geländer zurück auf die Brücke. Dort sank er erschöpft in die Knie. Bebend und nass bis auf die Knochen, legte er den Kopf in den Nacken und begann bitterlich zu weinen. Er weinte und schrie, er ballte die Fäuste und wiegte seinen Körper vor und zurück, während der Regen auf ihn niederprasselte und die zerfetzten dunkelgrauen Wolken über ihn hinwegzogen.
»Gott! Wenn du noch irgendeine Verwendung für mich hast, dann tu etwas!«, schrie er mit tränenerstickter Stimme in den bleiernen Himmel hinauf. »Tu irgendetwas! Ändere mein Leben! Ich flehe dich an!«
Die Augen nach oben gerichtet, wartete er auf irgendein göttliches Zeichen, einen grellen Blitz oder einen Donnerschlag. Doch nichts dergleichen geschah. Nur der plätschernde Regen war zu hören, das Rauschen des Flusses und der Wind, der in den Wipfeln der Bäume spielte. Wie lange Leandro auf der Brücke kniete, vom Regen durchweicht und völlig entkräftet, hätte er nicht sagen können. Irgendwann richtete er sich auf und stolperte taumelnd von der Brücke. Er fühlte sich leer, absolut leer und zerbrochen. Wie ein alter Mann schleppte er sich die steinige Straße den Berg hinunter. Er erreichte seinen Wagen, fuhr hinab ins Tal und war eine Stunde später an seiner Wohnung angekommen. Patschnass und mit zitternden Fingern schloss er die Tür auf, schlüpfte aus den schwarzen Lederstiefeln und dem mit Regen vollgesogenen schwarzen Ledermantel und schlurfte wie ein Schlafwandler in sein Zimmer, wo er sich mitsamt seinen triefenden Kleidern aufs Bett warf.
»Nicht heute Nacht …«, waren seine letzten geflüsterten Worte, bevor er die Augen schloss und in einen traumlosen Schlaf fiel.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
DER ANGRIFF
Tajana wirbelte herum und warf das Messer. Es zischte durch das Baumhaus und blieb surrend in der dicht geflochtenen Schilfverkleidung neben dem Fenster stecken. Mit zusammengekniffenen Augen suchte die Zwölfjährige die dunkle Hütte ab. Sie hätte schwören können, dass da jemand gewesen war. Sie hatte seinen düsteren Blick ganz deutlich im Nacken gespürt und ihr schauderte beim Gedanken, was das für sie und ihr ganzes Dorf bedeuten könnte. Zu schrecklich waren die Geschichten, die Überlebende ihnen von den Schattenkriegern Rhakans berichtet hatten. Aber da war niemand beim Fenster. Offenbar hatte ihr das tagelange Eingesperrtsein doch stärker zugesetzt als erwartet. Oder es war die Wirkung des öligen Pflanzensaftes, den sie zur Betäubung der bevorstehenden Schmerzen getrunken hatte. Denn heute Nacht würde sie in den Stand einer Erwachsenen erhoben. Jedes zwölfjährige Kind vom Volk der Maripós durchlief dieses Ritual. Dabei wurde ihm mit einem glühenden Eisen das Zeichen des Schmetterlings auf die rechte Schulter gebrannt. Tajana hatte keine Angst davor. Mit Schmerzen kannte sie sich aus, vor allem mit denen, die in ihrem Innern schwelten.
Sie ging zum Fenster, zog das Messer aus dem Schilf und warf einen prüfenden Blick auf den Wald hinab. Die jahrtausendealten Erlen mit ihren dicken Stämmen und dem knorrigen Geäst sahen aus wie schwarze Riesen aus einer anderen Welt. Alle Baumhäuser, bis dicht hinauf zu den Baumkronen, waren mit Laternen erleuchtet. Die geschlängelten Brücken, Wendeltreppen und hängenden Gärten zwischen den mehrstöckigen Schilfhütten waren geschmückt mit Girlanden aus Blumen und bunten Federn. In einigen mächtigen Bäumen wanden sich die Treppen sogar innerhalb des Stammes in die Höhe. Die nächtlichen Geräusche des Waldes vermischten sich mit den Klängen von Trommeln, Flöten, dem leisen Wiehern von Pferden und Kinderlachen. Die letzten Vorbereitungen für die große Zeremonie waren in vollem Gange. Die Frauen eilten mit Körben voller Baumfrüchte, Nüsse, gerösteter Wurzeln und Brot über die hängenden Pfade, die Männer brieten Fische und Hirschkeulen über den Feuern auf dem Waldboden. Junge Männer übten ihre erdverbundenen Tanzschritte, zupften sich die Lederkostüme zurecht und bemalten sich gegenseitig eine Hälfte des Gesichts und die Oberarme mit roter Farbe. Einige Knaben hockten im Schneidersitz auf dem Boden und trommelten auf Riesenkalebassen herum. Kuruani, der Dorfälteste, sein Kopf in einem Bärenschädel mit scharfem Gebiss steckend, schürte das Ritualfeuer auf dem Dorfplatz. Ein paar Kinder rannten zwischen den Bäumen hin und her und übten sich im Bogenschießen.
Freudige Erregung lag in der Luft. Nichts deutete darauf hin, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Und dennoch wurde Tajana das Gefühl nicht los, dass sie in unmittelbarer Gefahr schwebten. Vielleicht war der Schatten beim Fenster nicht nur Einbildung gewesen. Vielleicht war ihr Dorf bereits umzingelt. Vielleicht lauerten die Schattenkrieger ihnen gerade in diesem Moment hinter den Bäumen auf.
Nein, dachte Tajana mit aller Überzeugungskraft, die sie aufbringen konnte. Es war der Pflanzensaft, der meinen Sinnen einen Streich gespielt hat. Ganz bestimmt.
»Es ist so weit, Tajana.«
Tajana drehte sich um. Ihre Mutter stand in einem eleganten Kleid aus Leder, Fell und Federn im Eingang und lächelte sie stolz an. Ihr langes schwarzes Haar hatte sie mit farbigen Bändern zu einem Zopf zusammengebunden. Um den Hals trug sie eine Kette mit einem Anhänger aus Metall. Es war ein Schmetterling, dessen Flügel in Flammen standen. Tajana war barfuß und trug ein weißes, schulterfreies Baumwollkleid und einen Blumenkranz im pechschwarzen offenen Haar, die traditionelle Kleidung der Initianten.
»Komm«, sagte die Mutter und streckte ihr die Hand entgegen.
Tajana ergriff ihre Hand. Ihr Schilfhaus befand sich weit oben, in schwindelerregender Höhe. Gemeinsam schritten Mutter und Tochter die Wendeltreppe, die sich um den wuchtigen Baum wand, hinab auf den Waldboden. Sie wurden bereits erwartet. Zwischen den vielen Menschen hielt Tajana Ausschau nach ihrer Großmutter und Naliya, ihrem zweijährigen Schwesterchen, konnte die beiden aber nirgendwo entdecken. Eine Schneise öffnete sich vor ihnen. Die Dorfbewohner traten zur Seite, breiteten einen Teppich aus großen Blättern vor Tajana aus und gaben den Weg zum Ritualfeuer frei. Tajanas Mutter ließ ihre Hand los. Ab jetzt musste die Zwölfjährige allein weitergehen. Sie reckte ihr Kinn und ging furchtlos auf das Feuer zu. Kuruani erwartete sie bereits. Die Maripós bildeten einen großen Kreis um das Feuer, und Tajana trat in die Mitte. Der Dorfälteste stieß einen lauten kehligen Schrei aus, den das ganze Volk erwiderte. Die Knaben begannen zu trommeln. Die jungen Männer formierten sich zum Tanz, hielten sich an den Schultern und stampften um das Feuer herum, während die Frauen sich im gleichen Rhythmus hin- und herwiegten und einen monotonen Gesang anstimmten. Zwei Männer bliesen die Kutua-Flöten, lange geschnitzte Hörner, die länger waren als sie selbst. Die dunklen Klänge hatten etwas Mystisches an sich. Der ganze Waldboden vibrierte von ihren Schwingungen.
Nachdem der Tanz zu Ende war und die Instrumente verstummten, kniete sich Tajana vor Kuruani auf den Boden. Unverständliche Worte raunend, tauchte er zwei seiner Finger in eine mit Blut gefüllte Schale und zeichnete einen Schmetterling auf Tajanas Stirn. Dann griff er nach dem Brandeisen, das bereits im Feuer lag und dessen Spitze vor Hitze weiß glühte. Tajana schloss die Augen und atmete tief ein. Jetzt war es so weit. Es wurde von den Initianten erwartet, dass sie weder schrien noch weinten, wenn ihnen das Feuermal in die Schulter gebrannt wurde. Dadurch bewiesen sie, dass sie keine Kinder mehr waren und die innere Stärke besaßen, die Schwelle zum Erwachsenenleben zu überschreiten. Eine angespannte Stille herrschte, als der Dorfälteste Tajana das glühende Eisen auf die nackte Haut presste. Es zischte und roch nach verbranntem Fleisch. Der Schmerz war so entsetzlich, dass Tajana fürchtete, in Ohnmacht zu fallen. Am liebsten hätte sie laut geschrien, doch sie biss tapfer die Zähne aufeinander und gab keinen Laut von sich. Kuruani legte das Brandeisen weg, nahm Tajanas Hand und zog sie in die Höhe. Feierlich und laut verkündete er:
»Tajana, kunan qamkuna sayaq runa!«, woraufhin das ganze Volk in Jubel ausbrach. Tajana lächelte glücklich. Jetzt war sie offiziell eine Erwachsene. Von allen Seiten wurde sie beglückwünscht und mit Blumenkränzen behängt. Die Tänzer stampften erneut ums Feuer, die Trommler trommelten, die Flötenspieler bliesen in die Hörner und die Frauen klatschten und sangen. Eine ältere gebückte Frau kam nach vorne, an der Hand ein kleines Mädchen, das einen Blumenkranz in seinen speckigen Fingerchen hielt.
»Großmutter«, sagte Tajana und küsste die Frau auf die Stirn.
»Ich bin so stolz auf dich, Tajana«, sagte die alte Frau und betrachtete das Brandmal auf Tajanas Schulter. »Du bist sehr tapfer gewesen.«
»Ich hab’s versucht«, sagte Tajana und beugte sich hinunter zu dem kleinen Mädchen. Es hatte große smaragdgrüne Augen wie sie selbst, mit dem beneidenswerten Unterschied, dass sich darin noch eine kindliche Unschuld widerspiegelte, etwas, was Tajana längst abhandengekommen war. Naliya hängte ihrer großen Schwester den Blumenkranz um den Hals. Tajana bedankte sich bei ihr und fragte sie dann:
»Und wo bleibt mein Schmetterlingslied?«
Sofort streckte Naliya ihr den kleinen Finger entgegen. Sie verhakten ihre kleinen Finger und bewegten ihre Hände, als wären sie Flügel eines Schmetterlings. Gemeinsam begannen sie zu singen. Naliya war noch nicht in der Lage, alle Worte korrekt auszusprechen, aber die Melodie des Kinderliedes kannte sie in- und auswendig.
»Tanz, Schmetterling, tanz! Tanz mit den Sternen, dem Mond und der Nacht. Tanz, wenn die Sonne am Morgen erwacht. Tanz, wenn das Feuer den Himmel entfacht. Tanz, Schmetterling, tanz!«
Zum Schluss strahlte Naliya vor Freude. Tajana stupste mit dem Finger ihre Nasenspitze an, woraufhin die Kleine die Schultern hochzog, als würde es sie kitzeln. Nun trat Tajanas Mutter vor sie hin. Mütterlicher Stolz und Tränen der Rührung glänzten in ihren Augen.
»Ich hab ein Geschenk für dich«, sagte sie. Sie nahm die Halskette von ihrem Hals und hängte sie ihrer Tochter um. »Mein Vater hat sie mir am Tag meiner Initiation geschenkt. Jetzt sollst du sie haben.«
»Danke, Mutter«, murmelte Tajana verlegen und strich mit den Fingern über den metallischen Anhänger mit den brennenden Schmetterlingsflügeln. Dann umarmten sie einander.
»Du bist das Beste, was mir je passiert ist«, flüsterte die Mutter ihr sanft ins Ohr. »Ich liebe dich.«
»Ich liebe dich auch, Mutter.«
Gerade als sich Tajana von der Umarmung löste und sich mit ihrer Familie zum Festbüfett begeben wollte, zerriss ein gellender Schrei die Nacht. Die Maripós erstarrten. Tajana zuckte zusammen.
»ASKAREN!«, schrie jemand durch den Wald. »ASKAREN!!!«
Ein Schauer durchfuhr Tajana. Es war also doch keine Einbildung gewesen! Das, von dem sie gehofft hatte, dass es nie geschehen würde, war eingetroffen. Sie wurden angegriffen! Die Schattenkrieger Rhakans griffen ihr Dorf an! Bevor sich irgendjemand in Sicherheit bringen konnte, wurden die Waldmenschen von allen Seiten unter Beschuss genommen. Brutal. Gnadenlos. Tödlich. Ein Speer sauste um Haaresbreite an Tajanas Schulter vorbei und bohrte sich in die Brust ihrer Großmutter. Von der Wucht wurde die alte Frau mehrere Armlängen nach hinten geschleudert und prallte hart gegen eine Baumwurzel.
»Großmutter!«, schrie Tajana und stürzte sich auf sie, während Speere und Pfeile über ihr durch die Luft schossen und weitere Männer und Frauen niederstreckten. Wirbelnde schwarze Schatten tauchten hinter den Bäumen auf und fegten durch das Dorf. Die Maripós stoben schreiend auseinander. Einige versuchten, zu den Pferden zu gelangen. Tajanas Mutter warf sich schützend über die kleine Naliya, die unverzüglich zu weinen anfing.
»Großmutter!!!«, brüllte Tajana. Die Großmutter lag auf dem Rücken und starrte ihre Enkeltochter mit weit aufgerissenen Augen an.
»Tajana«, röchelte sie und griff nach Tajanas Arm. Sie wollte ihr etwas sagen, doch es gelang ihr nicht.
»Großmutter! Bleib bei mir!«, flehte Tajana sie an. »Bleib bei mir!«
Großmutters Blick verschleierte sich. Seltsame Wortfetzen kamen raunend über ihre Lippen. Es hörte sich an, als würde sie in einer anderen Sprache sprechen. Plötzlich huschten ihre Augen zurück zu Tajana, ihr Blick war so eindringlich, dass es Tajana beinahe Angst machte, und mit letzter Kraft presste sie drei Worte hervor.
»Er … wird … kommen!«
Dann atmete sie aus, ihr Kopf drehte sich zur Seite, ihre Hand erschlaffte, und sie blieb reglos liegen. Tajanas Eingeweide krampften sich zusammen. Doch für Trauer war keine Zeit. Die Askaren waren überall. Die Menschen schrien und flohen, doch die Schattenkrieger ließen keinen entkommen. Entsetzt sah Tajana, wie sämtliche alten Männer und Frauen von Speeren, Pfeilen und Schwertern durchbohrt zu Boden gingen, während die jüngeren Maripós zum Dorfplatz getrieben wurden. Gellende Schreie hallten durch den Wald, vermischt mit dem Wiehern der Pferde, die in Panik davongaloppierten. Einige Schilfhütten hatten Feuer gefangen und brannten lichterloh. Das gesamte Dorf hatte sich in ein einziges blutiges, brennendes Inferno verwandelt. Der Wald brannte. Die Menschen schrien vor Entsetzen und Angst. Tajana drehte sich nach ihrer Mutter und kleinen Schwester um, doch sie waren nicht mehr da. Verzweifelt suchte sie den Wald nach ihnen ab.
»Mutter!«, schrie sie. »Naliya!«
Da packte sie jemand grob am Arm und riss sie herum. Tajana blickte in zwei finstere, feindselige Augen. Mehr war von dem vermummten Kopf nicht zu sehen. Der Krieger war ganz in Schwarz gehüllt, mit schwarzen Stiefeln und einem breiten Ledergurt mit mehreren Messern um die Hüften. Er hatte ein von Blut getränktes Schwert in der linken Hand, während er mit der rechten Hand Tajanas Arm festhielt und seine Beute in Richtung Feuer zu den andern Dorfbewohnern schleifte. Der Mann war unglaublich kräftig. Tajana hatte nicht den Hauch einer Chance. Doch irgendwie gelang es ihr, einen kleinen spitzen Ast vom Waldboden aufzuheben und dem Askaren in den Handrücken zu rammen. Er schrie kurz auf, ließ sie los und Tajana nutzte den Moment, rollte flink unter ihm hinweg und sprang auf die Füße. Sie raffte ihr weißes Kleid hoch und rannte um ihr Leben. Der Askare nahm die Verfolgung auf, aber Tajana war schneller. Sie schaute weder nach links noch nach rechts und rannte barfuß quer durch den Wald, rannte, wie sie noch nie in ihrem Leben gerannt war, während ihr geliebtes Dorf hinter ihr in Flammen aufging.
Die Schreie ihres Volkes hörte sie selbst dann noch, als sie den Fluss erreichte. Völlig außer Atem versteckte sie sich im hohen Schilf, und als sie sicher war, dass sie den Schattenkrieger abgehängt hatte, ließ sie ihren Tränen freien Lauf. Die Fingernägel in die Handballen gegraben, weinte sie und trauerte um ihre Familie, um ihre Großmutter, ihre Mutter und ihre kleine Schwester. Die Wunde auf ihrer rechten Schulter brannte höllisch. Doch das war nichts im Vergleich zu den Qualen ihrer Seele. Jetzt hatte sie nichts und niemanden mehr auf der Welt. Die Askaren hatten ihr in einem einzigen Augenblick alles genommen, was ihr lieb und wert war, ihre Heimat, ihre Familie, ihr Zuhause. Sie war mutterseelenallein. Sie weinte so lange, bis keine Träne mehr in ihr war und sie vor Schwäche und Schmerzen hilflos in sich zusammensackte.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
DIE EINLADUNG
Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, als Leandros Handy klingelte. Ein müdes Grummeln war zu hören. Der Zwanzigjährige streckte seine Hand unter der Bettdecke hervor, tastete blind auf dem Nachttischchen herum, bekam das vibrierende Mobiltelefon zwischen die Finger und zog die Hand zurück unter die warme Decke.
»Ja? Hallo?«
»Hey, Leo! Bist du das?«
»Ja«, brummte der junge Mann müde. »Wer ist da?«
»Ich bin’s, dein Freund Benni!«
»Ich kenne keinen Benni.«
»Wir sind zusammen in die sechste Klasse gegangen! Erinnerst du dich nicht an mich? Benni, dein Freund und Leidensgenosse?«
»Benni?!« Leandro warf die Bettdecke zurück und blinzelte gegen das Tageslicht. »Benni Meier?!«
»Ganz genau! Ich hatte gehofft, dass du noch dieselbe Nummer hast. War mir nicht sicher nach all den Jahren. Lange her, was?«
»Eine Ewigkeit!« Erst jetzt bemerkte Leandro, dass er noch immer dieselbe nasse Kleidung trug wie auf der Brücke. Die Feuchtigkeit hatte sich in die Bettdecke und das Spannleintuch gesogen.
»Wie geht’s dir?«, fragte Leandro seinen alten Schulkameraden aus reiner Höflichkeit. Eigentlich hatte er keinen Bock, sich mit ihm zu unterhalten. Sie waren zwar zusammen zur Schule gegangen, aber dicke Freunde waren sie nie gewesen.
»Mir geht’s gut«, sagte Benni fröhlich und kam gleich auf den Punkt. »Ich würde dich über Pfingsten gerne nach Afrika einladen. Hättest du Lust?«
»Afrika? Wie kommst du darauf, mich nach Afrika einzu-laden?«
»Ein Freund ist kurzfristig abgesprungen. Und da bist du mir eingefallen. Keine Ahnung wieso. Jedenfalls ist die Safari bereits gebucht und wir haben einen Platz frei. Na, was sagst du?«
Leandro dachte kurz nach. An Pfingsten hatte er noch nichts vor, und dass Benni ihn nach jahrelanger Funkstille ausgerechnet am Morgen, nachdem er beinahe von einer Brücke gesprungen war, kontaktierte, konnte kaum ein Zufall sein. Außerdem hatte er Gott um ein Zeichen gebeten. Vielleicht war das ein Zeichen.
»Wer ist sonst noch dabei?«
»Zwei Freunde von mir, Daniel und Philipp. Sind beide aus meiner Kirche.«
»Aha«, sagte Leandro. Er hatte befürchtet, dass es einen Haken gab. »Du weißt schon, dass ich die Fronten gewechselt habe, Benni, oder?«
»Wie, die Fronten gewechselt?«
»Ich gehör nicht mehr zum frommen Lager. Ich meine, wirklich nicht mehr.« Er betrachtete die Klauenringe an seinen Fingern.
»Oh«, meinte Benni, machte eine Pause und fügte hinzu: »Na, dann haben wir uns ja einiges zu erzählen auf dem Flug nach Lumbana! Du müsstest dich übrigens noch gegen Dengue impfen lassen. Und dein Reisepass sollte noch mindestens sechs Monate gültig sein. Du hast doch einen Reisepass, oder?«
»Hab ich, ja, aber …«
»Gut! Ich schick dir die Reisedetails auf dein Handy. Das wird super!«
Leandro gab es auf. Offenbar war es in Bennis Augen bereits eine beschlossene Sache, dass er mitkam.
Nun, vielleicht wird es ja ganz amüsant werden, überlegte Leandro. Und falls mir die drei frommen Pappnasen zu langweilig oder zu nervig werden, kann ich immer noch mein eigenes Ding durchziehen. Bestimmt würde er irgendwo einen interessanten Voodooladen finden. Man konnte nie wissen, was das Schicksal in Afrika für ihn bereithielt.
Zwei Wochen später traf sich Leandro mit Benni, Daniel und Philipp am Flughafen. Um sicherzugehen, dass sie wussten, mit wem sie es zu tun hatten, zog Leandro seine schwarze Kluft und alle Klauenringe an, die er finden konnte, und schminkte sich schwarz um die Augen. Er hätte es genauso gut lassen können, denn es schien keinen zu interessieren, dass er wie ein Zombie gekleidet war. Stattdessen kam Benni – der sich kein bisschen verändert hatte, wie es schien – strahlend auf ihn zu, umarmte ihn stürmisch und sagte:
»Schön, dich zu sehen, Leo! Mann, ist das lange her! Darf ich vorstellen: Daniel und Philipp.« Sie schüttelten sich gegenseitig die Hände. Die Jungs sahen extrem langweilig und brav aus. Daniel trug eine dicke Brille und sah aus wie ein Computerfreak, Philipp trug Kleider wie ein Opa und hatte fettige Haare. Benni war so pummelig wie früher und für Leandros Geschmack viel zu gut gelaunt. »Daniel, Philipp: Das ist mein Schulfreund Leo.«
»Kollege«, verbesserte ihn Leandro, aber Benni plapperte bereits munter weiter:
»Ich sag euch: Leo war krass drauf damals. Er musste einiges einstecken für seinen Glauben, mehr noch als ich. Die ganze Schule wusste, dass er Christ ist.«
»War. Nicht ist, war«, korrigierte ihn Leandro. »Ich sagte dir schon am Telefon, dass ich mit Gott und dem ganzen christlichen Zirkus nichts mehr am Hut habe.«
»Wieso?«, fragte Philipp sichtlich betroffen. »Was ist passiert?«
»Wieso? Hast du ein Problem damit?«, gab Leandro provokativ zurück. Er wollte jetzt wirklich nicht darüber reden und war ganz froh, dass Benni unbekümmert fortfuhr:
»Schau, ich hab sogar ein Foto von uns ausgegraben.« Er streckte Leandro sein Handy entgegen und zeigte ihm ein altes Klassenfoto. »Da, das bist du. Und ich steh gleich neben dir. Wir waren zwölf Jahre alt, ist das zu fassen? Das bedeutet, wir haben uns acht Jahre nicht gesehen! Acht Jahre!«
»Hat sich einiges verändert seit damals«, murmelte Leandro mit einem bitteren Unterton in der Stimme, und um nicht weiter in der Vergangenheit herumzustochern, fügte er rasch hinzu:
»Wir verpassen noch unseren Flug, wenn wir noch länger hier rumstehen und quatschen.«
Sie machten sich auf den Weg zu ihrem Gate und ließen sich im Wartebereich nieder. Daniel war nicht sehr kommunikativ. Er hatte sich am Automaten eine Tüte Chips geholt und knabberte die Dinger wie ein Hamster, während er auf seinem Handy herumtippte. Benni laberte indessen fast ununterbrochen. Philipp hörte ihm brav zu, nickte und warf zwischendurch ein »Hm« oder »Finde ich auch« oder »Ach sag bloß« ein. Leandro saß schweigsam daneben und kam sich vor wie ein Außerirdischer. Warum um alles in der Welt hatte er sich darauf eingelassen, mit drei Christen in die Ferien zu gehen? Und dann noch mit drei absoluten Losern, wie es schien? Er war keiner mehr von ihnen. Er war durch mit dem Thema Kirche und Christentum, und das aus gutem Grund.
Seine Eltern waren Christen und hatten ihn von klein auf mit in die Kirche geschleppt. Mit zehn Jahren wusste er alles über den christlichen Glauben, was es darüber zu wissen gab, und kannte sämtliche biblischen Geschichten auswendig. Eine bewusste Entscheidung für Gott hatte er nie getroffen, betrachtete sich aber dennoch als Christ. So war er aufgewachsen und erzogen worden. Was sollte er sonst sein? Mit zwölf Jahren hörte er in einem Gottesdienst, dass man als Christ zu seinem Glauben stehen müsse. Also nahm er am nächsten Tag die Bibel mit in die Schule, setzte sich in der Pause auf ein Mäuerchen und las darin. Die Spötter ließen nicht lange auf sich warten. Kai, ein großer arroganter Junge, stellte sich mit verschränkten Armen vor ihn hin, im Schlepptau drei Jungs, die ihren Anführer überallhin begleiteten.
»Seht euch den Spinner an! Bist du jetzt total von der Rolle? Du glaubst nicht ernsthaft an Gott und die Bibel, oder?«
Leandro reckte sein Kinn, nahm all seinen Mut zusammen und erklärte mit fester Stimme: »Doch, das tue ich. Ich bin nämlich Christ!«
Die Jungs brachen in schallendes Gelächter aus. Leandro war sowieso nicht sehr beliebt an der Schule und als schräger Kauz und Einzelgänger verschrien. Sogar die Lehrer waren der Meinung, er gehöre in eine Sonderschule, weil er sich keine fünf Minuten auf etwas konzentrieren konnte und sehr wirre und morbide Fantasien hatte. Dass er sich jetzt auch noch als Christ outete, war ein gefundenes Fressen für seine Feinde.
»Du bist Christ? Na, dann lass mal sehen!«
Ehe Leandro etwas dagegen unternehmen konnte, landete Kai eine derbe Ohrfeige auf seiner Wange. Die Jungs grölten schadenfroh. »Jetzt musst du mir noch die andere Wange hinhalten. So steht’s in der Bibel!«
Kai holte zu einem zweiten Schlag aus, doch Leandro duckte sich instinktiv, was seinen Kontrahenten nur umso mehr in Fahrt brachte.
»Hey, du Pfeife, du darfst dich nicht wehren! Das ist gegen die Regel!«
Leandro wollte aufstehen und davonlaufen, aber die Jungs ließen ihn nicht durch. Einer stieß ihn gegen die Schulter, der zweite schlug ihm die Bibel aus der Hand. Und dann bearbeiteten sie ihn von allen Seiten mit ihren Fäusten. Leandro hob schützend die Hände vor den Kopf. Er verlor das Gleichgewicht und stürzte, wobei er sich den Ellbogen aufschürfte. Die Jungs trampelten so lange auf ihm herum, bis ein Lehrer angerannt kam und ihn befreite. Als er nach der Pause mit einem blutenden Ellbogen und einer aufgeplatzten Lippe zurück ins Schulhaus humpelte, die zerknitterte Bibel unter dem T-Shirt vergraben, stupste ihn plötzlich jemand von hinten an. Es war Benni aus seiner Klasse. Benni wurde wegen seines Glaubens schon länger von allen belächelt und gehänselt.
»Das war sehr mutig von dir, Leo«, flüsterte er, als sollte das irgendein Trost sein. »Du und ich, wir müssen zusammenhalten.«
Von diesem Tag an waren Benni und Leandro heimliche Verbündete. Es nützte ihnen allerdings herzlich wenig. Jetzt, wo es sich herumsprach, dass auch Leandro Christ war, wurden sie eben beide gemobbt. Sie waren die Ausgestoßenen, die, auf denen jeder nach Belieben herumhacken konnte. Die Mädchen tuschelten hinter vorgehaltener Hand und kicherten, wenn sie im Flur an ihnen vorbeigingen.
»Igitt, die Jesus-Freaks sind im Anmarsch!«, spotteten sie. »Eklig! Kommt uns bloß nicht zu nahe, ihr Verlierer!«
Von Kai und seiner Bande wurden sie fast täglich beklaut oder zusammengeschlagen. Mit der Zeit forderten sie sogar Schutzgeld von Leandro, und wenn er ihnen keine Videospiele oder einen Teil seines Taschengeldes mehr lieferte, gab es Prügel. Jedes Mal, wenn die Schule aus war, fürchtete sich Leandro vor dem Nachhauseweg. Denn dort lauerten sie ihm besonders oft auf. Sobald er ein ungewöhnliches Geräusch in der Hecke neben dem Gehweg hörte, zuckte er zusammen und rannte in die entgegengesetzte Richtung davon. Doch Kai und seine Bande waren meistens schneller. Sie kamen johlend aus dem Gestrüpp gesprungen, jagten ihm nach, holten ihn ein und schleuderten ihn mit aller Wucht auf den Asphalt.
»Na, du Superchrist? Wo ist jetzt dein Gott?«, grölten sie. »Macht wohl gerade seinen Mittagsschlaf, was? Zu blöd aber auch. Jetzt bist du ganz alleine!«
Und dann traten sie so lange auf ihn ein, bis seine Nase blutete oder er ein blaues Auge hatte. Selbst wenn er sich wimmernd auf dem Boden krümmte, prügelten sie weiter auf ihn ein. Abend für Abend weinte Leandro zu Hause unter der Bettdecke und flehte Gott an, einzugreifen und irgendetwas zu tun, damit die Jungs ihn endlich in Ruhe ließen. Aber nichts änderte sich, gar nichts. Die Jungs ließen ihn nicht in Ruhe, und Gott – von dem behauptet wurde, er wäre gütig und gut – ließ ihn weiter leiden, Tag für Tag. Er ließ ihn einfach im Stich! Das war der Dank dafür, dass er sich öffentlich zu ihm bekannte! Das war die Belohnung für seinen Mut!
Mit jedem Fußtritt, jeder Demütigung rauschte Leandros Selbstwertgefühl weiter in den Keller. Und mit jeder herablassenden Bemerkung über ihn und seinen Glauben wallte die Wut auf Gott mehr in ihm auf. Warum sollte er sich zu einem Gott bekennen, der sich nicht zu ihm bekannte? Warum? Es war besser, sich von ihm loszusagen, so überlegte er. Einem solchen Gott wollte er nicht länger angehören. Es war an der Zeit, die Würfel neu zu werfen. Es war an der Zeit, aus der Rolle des armseligen Fußabtreters auszusteigen und seinen Peinigern und der ganzen Welt zu zeigen, wozu er in der Lage war. Er war kein Opfer! Er, Leandro, würde das jetzt selbst in die Hand nehmen! Und wenn Gott ihm nicht dabei helfen wollte, dann würde er sich eben an die Gegenseite wenden. O ja, er würde den Leibhaftigen selbst um Hilfe bitten! Der würde ihn mit Sicherheit nicht von sich stoßen! Die Leute würden sich alle noch wundern und sich wünschen, ihm nie ein Haar gekrümmt zu haben! Er, Leandro, würde sich mit dem Schatten verbünden. Das war sein Plan, koste es, was es wolle!
»Flug 242 nach Lumbana ist jetzt zum Einstieg bereit.«
Die freundliche Stimme über Lautsprecher holte Leandro in die Gegenwart zurück.
»Es geht los! Auf, Jungs!«, rief Benni aufgeregt und sprang von seinem Sitz. »Afrika, wir kommen!«
Sie erreichten Lumbana am nächsten Morgen um acht Uhr in der Früh, fuhren mit einem Taxi zum Hotel und deponierten ihr Gepäck. Die Safari begann erst einen Tag später, also hatten sie einen ganzen Tag Zeit, die Stadt zu erkunden. Es war drückend heiß. Benni, Philipp und Daniel hatten sich im Hotel umgezogen und trugen schrecklich blumige Hawaiihemden, kurze Hosen und hässliche Jesus-Sandalen. Leandro hatte absichtlich seine schwarze Kluft anbehalten, mit Mantel und Stiefeln, um sich ganz bewusst von den drei frommen Spinnern abzugrenzen. Er schwitzte zwar wie ein Schwein darin, aber das war es ihm wert. Sie schlenderten durch die staubigen Straßen, kauften ein paar Souvenirs und kamen schließlich zu einem großen Basar. Hier gab es von farbigen Gewürzen, Früchten, Stoffen, aufgespießten Skorpionen und lebenden Waranen bis hin zu Taschenuhren, Schmuck und geflochtenen Körben so ziemlich alles zu kaufen, was man sich denken konnte. Daniel kaufte sich eine Tüte Nüsse und stopfte sie sich eifrig in den Mund. Leandro beschloss, ihn »Hamster« zu nennen und Philipp »Fetthaar«.
Während Benni mit einem Händler über den Preis einer geschnitzten Holzfigur verhandelte, fiel Leandros Blick auf einen kleinen Laden an der Straßenecke. Holzmasken, getrocknete Pflanzenbüschel, Federn und Hühnerkrallen hingen vor dem Eingang und zogen Leandro wie magisch in ihren Bann.
Ein Voodooladen!, dachte er begeistert. Na endlich! Neugierig näherte er sich dem Geschäft und trat ein.
Der Laden war nur mit Kerzen beleuchtet. Es roch nach Leder, Holz und Weihrauch. Die Wände waren voll von Masken und Tierschädeln. Von der Decke hingen Schrumpfköpfe, getrocknete Fledermäuse, Knochen und kleine Strohpuppen. Auf den Regalen standen seltsame Holzfiguren, tanzende Skelette und Fläschchen mit eingelegten Reptilien. Begeistert schlenderte Leandro durch den Laden. Das hier war genau sein Ding. Die Reise nach Afrika hatte sich also doch gelohnt. Ganz hinten, vor einem Muscheltürvorhang, der den vorderen von einem hinteren, wahrscheinlich privaten Raum abtrennte, entdeckte Leandro eine große Metallskulptur. Sie stellte einen schwarzen Drachen dar, der mit einem weißen Löwen kämpfte. Die Tiere waren bis ins kleinste Detail ausgearbeitet und wirkten unglaublich lebendig.
Leandro hatte schon als Kind Drachen geliebt. In der Oberstufe hatte er einmal ein Bild von einem Drachen gemalt, das für helle Empörung gesorgt hatte. Seine Kunstlehrerin hatte ihn deswegen sogar zum Schuldirektor gezerrt. Das war nichts Ungewöhnliches. Er wurde sogar ziemlich oft zum Direktor zitiert. Die Lehrer beschwerten sich andauernd über seine düsteren Bilder, seine düsteren Aufsätze und seine düstere Kleidung. Das hatte schon die Lehrer in der Unter- und Mittelstufe beunruhigt, so sehr, dass Leandro zum Kinderpsychologen geschickt worden war, wo er Bäume zeichnen sollte, um seine Psyche zu erforschen. Er zeichnete Bäume mit Wurzeln, die zwischen Totenschädeln und Skeletten nach Wasser suchten, und von deren Ästen tote Ratten hingen. Die Aufsätze, die er in der Schule verfasste, waren nicht weniger gruselig. Die Worte trieften nur so von Blut, und zum Schluss waren meistens alle tot bis auf Leandro. Einmal wählte er bei einem Buchvortrag nicht wie alle andern Kinder ein Buch von »Die drei ???« oder »Der Schlunz«, sondern stellte den Horrorroman »Berge des Wahnsinns« vor.
Seine Eltern beobachteten mit wachsender Sorge, wie Leandro sich immer mehr dem Okkulten zuwandte, und schickten ihn ab der siebten Klasse auf eine christliche Privatschule in der Hoffnung, dies würde ihn auf den rechten Weg zurückbringen. Leandro dachte jedoch nicht im Traum daran, sich zu ändern. Die Lehrer wussten bald nicht mehr, was sie mit ihm anfangen sollten.
Er trug nur noch schwarze Kleider, einen langen schwarzen Ledermantel und hohe schwarze Lederstiefel. Von nun an trampelte keiner mehr auf ihm herum. Keiner wagte es mehr, ihn anzutasten. Wenn der Dreizehnjährige die linke Hand mit den Klauenringen hob, verstummte jeder, und seine dunkle Präsenz flößte jedem Respekt, ja sogar Angst ein. Er hatte es geschafft. Er war nicht mehr der Unterdrückte, der Außenseiter. Er war die oberste Autorität seiner eigenen Welt und ließ sich von niemandem mehr vorschreiben, wie er zu leben hatte, weder von seinen Eltern noch von den Lehrern oder seinen Mitschülern und am allerwenigsten von Gott.
Das Bild von dem Drachen setzte dem Ganzen die Krone auf. Nach einem Besuch im Kunstmuseum sollten die Schüler ein surrealistisches Bild malen. Leandro malte einen Furcht einflößenden Drachen mit bluttriefenden Zähnen. Vor seinem aufgerissenen Maul stand ein Kreuz, das durch die Flammen aus seinem Rachen lichterloh brannte.
»Dieser Junge ist vollkommen gestört!«, empörte sich die Kunstlehrerin und klatschte dem Direktor das abscheuliche Kunstwerk auf den Tisch. »Sehen Sie selbst! Und das in einer christlichen Schule! Das ist Blasphemie! Ich weigere mich, diesen Jungen noch länger zu unterrichten!«
Leandro saß schweigend auf einem Stuhl und amüsierte sich köstlich. Er hatte gehört, dass im Lehrerzimmer sogar schon Wetten abgeschlossen wurden, was ihm als Nächstes einfallen würde, um sie zu ärgern. Dem Direktor gelang es, die aufgebrachte Lehrerin zu beruhigen, und er forderte sie sogar auf, das Bild nicht nach dem Inhalt, sondern rein technisch zu beurteilen. Denn gemalt war es wirklich gut. Murrend zog sich die Lehrerin aus dem Büro zurück, während Leandro auf dem Stuhl sitzen blieb und geduldig auf die Moralpredigt des Direktors wartete. Doch die blieb aus. Stattdessen nahm der Direktor das Bild in die Hand, studierte es eingehend und fragte Leandro schließlich:
»Die eigentliche Frage ist die: Widersteht dein Kreuz dem Feuer des Drachen oder wird es verbrennen?«
»Man fragt sich, wer von den beiden gewinnt, nicht wahr?«
Letztere Frage kam nicht mehr von dem Direktor und riss Leandro abrupt aus seiner Gedankenwelt zurück in den Voodooladen in Afrika. Er drehte sich um. Hinter ihm, wie aus dem Nichts aufgetaucht, stand ein braun gebrannter, schlanker Mann in einem kakifarbenen Hemd und einer Militärhose. Sein dunkelbraunes Haar hatte er zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Eine lange Narbe zog sich über sein linkes Auge und einen Teil seiner Wange. Er sah nicht sehr afrikanisch aus, eher wie ein Abenteurer oder Auswanderer, dem Akzent nach aus Australien.
»Die Skulptur kam erst gestern an. Ich könnte sie stundenlang betrachten.«
»Ist das Ihr Laden?«, fragte ihn Leandro.
»Der meiner Lebenspartnerin. Sie ist die Sammlerin. Ich bin der Jäger.«
»Sie jagen? Dann stammen all die Tierschädel an der Wand von Ihnen?«
»Die hässlichen Dinger?« Der Mann lachte. »Touristenkram. Meine Trophäen hängen hinten. Sind allerdings unverkäuflich. Willst du sie sehen?«
»Gerne!«
»Dann komm mit.«
Er ging an Leandro vorbei, schob den Muschelvorhang zurück und betrat den hinteren Teil des Ladens. Leandro folgte ihm. Im flackernden Kerzenschein ließ er seinen Blick über die Wände gleiten. Sie waren behängt mit Dutzenden riesiger Tierkopfpräparate: Gazellen, Gnus, Zebras, Rhinozerosse, Wasserbüffel, Leoparden, Elefanten und sogar mehrere Löwen. Leandro blieb die Spucke weg.
»Die haben Sie alle erlegt?«
»Hab ich. Ein paar sogar damit.«
Der Jäger griff nach einem Speer an der Wand. Leandro schüttelte ungläubig den Kopf. »Sie nehmen mich auf den Arm, oder?«
»Tu ich nicht«, sagte der Mann. »Aus sicherer Distanz mit einem Gewehr schießen, das kann jeder. Aber sich so nah an einen Löwen heranschleichen, dass du ihn mit einem einzigen Speerwurf töten kannst, das, mein Freund, ist Jagdkunst in Perfektion.« Er warf Leandro den Speer zu. Der junge Mann fing ihn auf. Er war ziemlich schwer. »Liegt gut in der Hand, nicht wahr? Kennst du dich aus mit Waffen?«
»Mit Gewehren ja. Ich hab Militärdienst geleistet«, antwortete Leandro. »Aber Speere haben wir da keine geworfen.«
»Ich sag dir eins: Wenn du damit dein erstes Raubtier durchbohrst, weißt du erst, wie sich wahre Überlegenheit anfühlt. Das Blut rauscht durch deine Adern und du fühlst dich, als wäre dir die ganze Welt untertan.«
»Das Gefühl kenn ich«, murmelte Leandro und strich fasziniert mit den Fingern über die scharfe Speerspitze. Der Jäger beobachtete ihn von der Seite.
»Hättest du Lust, deinen eigenen Löwen zu töten?«
Leandro sah verwundert auf. »Wie meinen Sie das?«
»Ich seh doch das Glitzern in deinen Augen. Den Jagdinstinkt. Du hast ihn in dir.«
O ja, den hast du in dir, flüsterte eine Stimme in Leandros Kopf. Den Drang nach Blut. Den Drang zu töten …
Leandros Herz begann schneller zu schlagen.
»Und ich geh morgen mit ein paar Eingeborenen auf Löwenjagd. Ich kann dich mitnehmen, wenn du möchtest.«
»Ist das Ihr Ernst?«
»Mein voller Ernst. Oder hast du für morgen schon andere Pläne?«
»Na ja, ich bin mit ein paar Freunden hier, und für morgen ist eine Safari geplant.«
Der Jäger lachte. »Das Touri-Programm also. Mit dem Bus durch die Steppe donnern und im Vorbeifahren Fotos von Tieren schießen, die so weit entfernt sind, dass du sie später nur als unscharfe Miniflecken auf deinen Ferienfotos erkennst. Klingt nach wahnsinnig viel Aufregung.«
Leandro betrachtete den Speer in seiner Hand und runzelte die Stirn. Das Angebot, an einer echten Löwenjagd teilzunehmen, war schon ziemlich verlockend. Wann würde sich ihm je wieder so eine Gelegenheit bieten?
»Und … wie viel würde mich das kosten?«
»Über den Preis verhandeln wir, wenn wir zurück sind. Also, was ist, bist du dabei?«
Ein unternehmungslustiges Lächeln huschte über Leandros Gesicht, dann nickte er. »Bin dabei! Wann und wo treffen wir uns?«
Der Jäger zupfte eine schwarze Visitenkarte mit silberner Schrift aus der Brusttasche seines Hemdes und reichte sie Leandro. »Damian Price – Löwentöter« stand vorne und auf der Rückseite eine Adresse mit Telefonnummer. »Hier meine Nummer für alle Fälle. Wir fahren um vier Uhr in der Früh von hier los. Zieh dir bequeme Kleidung und feste Schuhe an. Um alles andere kümmere ich mich.« Leandro ließ die Karte in seine Manteltasche gleiten. Damian nahm ihm den Speer ab und klopfte ihm kameradschaftlich auf die Schulter. »Mach dich auf den Trip deines Lebens gefasst, Junge.«
Als Leandro den mystischen Laden wieder verließ und auf den farbenfrohen, von Menschen wuselnden Basar zurückkehrte, kam es ihm vor, als hätte er das alles nur geträumt. Doch die Visitenkarte in seiner Hand bestätigte das Gegenteil. Leandro drehte die Karte zwischen den Fingern und spürte eine erregte Anspannung in sich aufsteigen. Da war er noch keine fünf Stunden in Afrika, und schon wurde er von einem wildfremden Mann eingeladen, mit ihm auf Löwenjagd zu gehen. War das zu fassen? Sollten Benni und seine Kirchenmäuse ruhig auf Safari gehen. Er würde in der Zwischenzeit einen Löwen erlegen! Einen echten Löwen!
»Hey, Leo, da bist du ja!« Benni winkte ihn aufgeregt zu sich. Er, Daniel und Philipp standen immer noch am selben Stand wie vor zehn Minuten.
»Sieh mal, was ich ersteigert habe!«, rief Benni und hielt eine geschnitzte Holzfigur hoch. »Ist die nicht toll? Ich hab sie runtergehandelt auf zehn Dollar. Wo warst du eigentlich die ganze Zeit?«
»Ach, nirgendwo. Ich werde übrigens morgen nicht mit auf Safari kommen.«
»Was? Wieso nicht?«
»Ich hab bereits andere Pläne.«
»Pläne? Wie kannst du andere Pläne haben? Wir sind doch eben erst angekommen.«
»Unwichtig. Mann, hab ich einen Durst«, wechselte Leandro das Gesprächsthema. »Ich glaube, da hinten verkaufen sie irgendwelche afrikanischen Getränke. Kommt ihr?«
Und damit schritt er mit wallendem Ledermantel davon, während ihm die drei Jungs etwas verdattert hinterhertrotteten und Benni ihm immer wieder hinterherrief:
»Was für Pläne, Leo? Was für Pläne denn?«
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
LÖWENJAGD
Ein Hahn krähte. Die Straßen waren menschenleer. Der Basar mit all seinen Düften und Farben und Menschen, den sie tags zuvor besucht hatten, hatte sich komplett in Luft aufgelöst. Nur ein paar schmutzige Köter suchten zwischen dem Müll nach etwas Essbarem. Der Himmel war sternenklar. Leandro hatte sich ein Taxi genommen und erreichte den vereinbarten Treffpunkt kurz vor vier Uhr in der Früh. Ein offener Geländewagen stand mit Licht und laufendem Motor auf der leeren Straße und Damian war dabei, Proviant und Jagdausrüstung aufzuladen.
»Morgen!«, begrüßte er Leandro und musterte ihn von Kopf bis Fuß. »Schwarz? Was anderes hast du nicht zum Anziehen gefunden?«
Leandro blickte an sich hinunter. Er trug lange schwarze Hosen, ein schwarzes T-Shirt und darüber ein luftiges schwarzes Hemd.
»Du weißt schon, dass wir in Afrika sind, ja?«
»Tut mir leid«, sagte Leandro. »Außer Schwarz trag ich nichts.«
»Na dann viel Spaß in der Hitze«, meinte Damian, während er einen Wasserkanister auf die Ladefläche des Jeeps wuchtete. »Pack mal mit an!« Leandro hob die Gewehre und Speere vom Boden auf und reichte sie dem Jäger.
»Du hast gestern versäumt, mir deinen Namen zu nennen, Junge.«
»Leandro.«
»Leandro«, wiederholte Damian, während er die Waffen neben die Wasserkanister legte. »Meinen kennst du ja bereits. Steht auf der Visitenkarte. Damian Price. Kannst mich Damian nennen.« Er hievte zwei große Stofftaschen auf den Jeep und klappte die Lade hoch. »Fahren wir! Ist ein gutes Stück bis zum Dorf der Eingeborenen.«
Leandro schwang sich auf den Beifahrersitz, Damian nahm neben ihm Platz und startete den Motor. Sie fuhren aus der Stadt hinaus. Auf holprigen Landstraßen ging die Fahrt quer durch die Steppe. Die Sonne ging blutrot am Horizont auf. Gazellen, Giraffen und mehrere Elefanten kreuzten ihren Weg. Leandro knipste alle paar Sekunden ein Foto mit seinem Handy. Er war mächtig beeindruckt von all den Tieren in freier Wildbahn. Und er konnte es kaum erwarten, auf Löwenjagd zu gehen. Nach zwei Stunden erreichten sie ein paar runde Lehmhütten. Kinder kamen ihnen lachend und winkend entgegengerannt.
»Wir sind da«, sagte Damian und brachte den Jeep zum Stehen. Gertenschlanke afrikanische Männer und Frauen traten aus den Hütten. Sie waren alle barfuß. Die Männer waren nackt bis auf einen Lendenschurz, die Frauen trugen zusätzlich farbige Ohr-, Hals- und Armreifen. Jeder der Männer hielt einen Speer in der linken Hand.
»Kweku, alter Freund!«, rief Damian, sprang aus dem Wagen und ging auf einen der Männer zu. Die beiden begrüßten sich mit einem komplizierten Handschlag und wechselten ein paar Worte in Kwekus Muttersprache. Ein paar andere Männer gesellten sich dazu und begrüßten den Jäger mit demselben Handschlag. Leandro kletterte vom Beifahrersitz und fand sich auf der Stelle von einem Dutzend nackter Kinder umzingelt. Sie kicherten, zupften neugierig an seinen Kleidern und waren ganz begeistert von seinen schulterlangen schwarzen Haaren. Leandro versuchte, den Kindern seinen Namen beizubringen, als sich ihm plötzlich eine schrumpelige alte Frau näherte. Sie trug ein Kostüm aus Bast und ihr Gesicht war mit weißer Farbe bemalt, was ihrem Blick etwas Unheimliches verlieh. Zielstrebig kam sie auf Leandro zu, durchbohrte ihn mit ihren gelb unterlaufenen Augen und murmelte immer und immer wieder dieselben Worte:
»Ibhubesi elimhlophe! Ibhubesi elimhlophe!«
Leandro hatte keine Ahnung, was das bedeutete. Die Frau streckte ihre knochigen Finger aus und betastete damit Leandros Wange. Sie wirkte sehr erstaunt und wie von einer tiefen Ehrfurcht ergriffen. Plötzlich jedoch veränderte sich ihr Gesichtsausdruck. Sie kreischte auf und wich zurück, als hätte sie ein Gespenst gesehen.
»Idrako elimnyama! Idrako elimnyama!«, rief sie, die Augen vor Entsetzen geweitet, und deutete auf Leandro.
Angelockt von ihrem Gekrächze, kam das ganze Dorf herbei. Die Frau redete wild gestikulierend mit den Dorfbewohnern und deutete immer wieder auf Leandro. Ihre Worte brachten die Eingeborenen völlig durcheinander. Eine heftige Diskussion entbrannte. Die eben noch unbeschwerte, fröhliche Stimmung wandelte sich jäh in etwas Unheimliches. Die Frauen und Männer warfen Leandro beunruhigte Blicke zu. Einige Blicke waren regelrecht feindselig. Andere schauten so erschrocken drein, als wäre ihnen der Leibhaftige erschienen. Damian redete mit den Männern und versuchte sie zu beschwichtigen, was ihm nicht so recht gelingen wollte. Die Männer wurden immer lauter, fuchtelten in der Luft herum und hörten nicht auf, auf Leandro zu zeigen. Und die Alte stand kurz vor einem Kollaps, so schien es.
»Ukwelelesa!«, hörte Leandro sie ständig krächzen. »Ukwelelesa!«
Ihm war gar nicht mehr wohl in seiner Haut. Damian wurde immer aufgebrachter, bis er mit finsterer Miene zum Geländewagen zurückstapfte und Leandro unwirsch befahl, einzusteigen. Er sprang auf den Fahrersitz, knallte die Tür zu und drehte den Zündschlüssel. Leandro sah, wie Kweku sich mit seinem Speer hinten auf die Ladefläche schwang. Kerzengerade, stumm und im Gegensatz zu allen anderen völlig ruhig saß er auf der hochgeklappten Lade, während das ganze Dorf in Aufruhr war.
»Was um alles in der Welt ist hier los?«, fragte Leandro Damian.
»Aberglaube und Geistermärchen«, knurrte der Jäger und drückte aufs Gaspedal. Die Eingeborenen blieben in der aufwirbelnden Staubwolke hinter ihnen zurück. Kweku hielt sich an der Kante fest und blickte gelassen nach vorne. Damian fuhr wie ein Henker über die Schlaglöcher in der Straße und sagte kein Wort. Leandro wartete, bis seine mürrische Stimmung etwas verflogen war, bevor er die Frage stellte, die ihm schon die ganze Zeit auf der Zunge brannte.
»Was hat die Alte denn gesagt?«
»Sie sagte, sie sehe den weißen Löwen über dir.«
»Den weißen Löwen? Was bedeutet das?«
»Es ist ein Mythos. Der weiße Löwe ist seit Jahrhunderten ausgestorben. Doch die Eingeborenen sind davon überzeugt, dass noch ein einziger übrig ist, ein heiliges Tier, das über die Steppe wacht und das Böse von den Menschen fernhält. Keiner hat ihn je gesehen, aber es heißt, wer ihn erblickt, ist für Großes bestimmt. Manche sagen sogar, er wird den Lauf der Geschichte verändern.«
»Und die Alte glaubt, ich wäre dieser Auserkorene?«
»Wohl eher der Verfluchte. Sie hat nämlich noch etwas anderes über dir gesehen, und das hat das ganze Chaos erst ausgelöst.«
»Was hat sie denn gesehen?«
»Den schwarzen Drachen.«
»Den schwarzen Drachen?«
»Ja. Das bedeutet Unheil und Tod. Und deswegen wollte uns außer Kweku keiner der Männer mehr auf die Jagd begleiten. Sie fürchten, du würdest sie alle ins Verderben stürzen.«
»Was?« Leandro schob sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »So ein Schwachsinn.«
»Sag das den Männern, die zurückgeblieben sind.«
»Wir gehen aber trotzdem auf Löwenjagd, oder?«
Damian sah den Burschen von der Seite an und grinste abenteuerlustig. »Hölle ja! Und falls du diesen mysteriösen weißen Löwen zu Gesicht bekommst, spießt du ihn mit deinem Speer auf!«
Sie lachten beide und Leandro spürte, wie das Jagdfieber ihn erneut packte.
Irgendwo in der Pampa ließen sie den Jeep zurück, stopften Wasser und Proviant in zwei Rucksäcke, schulterten die Gewehre und Speere und gingen zu Fuß weiter. Kweku ging voraus. Er marschierte in einem unglaublichen Tempo, und das, obwohl er barfuß war. Er redete nicht viel. Manchmal ging er in die Knie und untersuchte Tierspuren am Boden. Sie kamen an einer großen Zebraherde vorbei, sie sahen Strauße und Antilopen und sogar Hyänen, die sich mit Geiern um einen Kadaver stritten. Leandro verspürte große Lust, den Speer nach einem der Tiere zu werfen, aber Damian hielt ihn jedes Mal zurück und sagte:
»Spar dir die Kraft für die Löwen, Junge!«
Es war so heiß, dass die Luft über dem trockenen Boden flimmerte. Der Schweiß tropfte Leandro von der Stirn und seine schwarzen Hosen und sein schwarzes Shirt klebten ihm am Leib.
Schönheit hat eben ihren Preis, sagte er sich, wohl wissend, dass er in der Tat die denkbar schlechteste Kleidung für eine Löwenjagd trug.
Sie hielten auf eine rostrote Felskette zu, eine weithin sichtbare Landmarke in der flachen Landschaft. Nach mehrstündigem, kräftezehrendem Marsch standen sie am Fuße des zerklüfteten Hügelzugs und machten eine kurze Pause. Leandro trank gierig aus seiner Wasserflasche. Während er seinen Blick über die ausgedörrte Ebene gleiten ließ und über die Worte nachdachte, die die Alte über ihm ausgesprochen hatte, trug der Wind plötzlich ein unverkennbares Brüllen zu ihnen. Die Männer sahen sich an und waren augenblicklich in höchster Alarmbereitschaft: Löwen! Damians Augen leuchteten gefährlich. Kweku deutete auf die Felsen. Leandro wurde noch heißer, als es ihm ohnehin schon war. Jetzt wurde es ernst. Jetzt würde sich zeigen, ob er tatsächlich den Mumm in den Knochen hatte, sich so nah an einen Löwen heranzuschleichen, dass er ihn mit einem Speer erlegen konnte. Die Frage erübrigte sich allerdings, denn Damian nahm ihm kurzerhand den Speer aus der Hand und sagte:
»Sorry, Junge. Heute nicht. Das Speerwerfen überlässt du besser den Profis.«
»Aber ich dachte …«
»Halt einfach deine Büchse bereit«, sagte Damian und klopfte auf das Gewehr, das über Leandros Schulter hing. »Man weiß nie, wie die Biester reagieren, wenn man sie aufmischt. Die Situation kann sehr schnell eskalieren. Und Löwen können sechs Meter weit springen. Bevor du überhaupt reagieren kannst, sind sie über dir und zerfleischen dich. Also, wenn ich dir sage, du sollst schießen, schießt du, verstanden?«
»Verstanden«, nickte Leandro.
Sie legten die Rucksäcke auf den Boden. Kweku ging mit seinem Speer vorneweg, Damian und Leandro folgten ihm mit umgehängten Gewehren, Damian zusätzlich mit dem Speer griffbereit in der Hand. Sie kletterten zwischen den Felsen den Hügel hinauf. Je höher sie kletterten, desto näher klang das Gebrüll. Sie umrundeten einen großen Felsen und entdeckten ein Rudel von vier Löwen, drei Weibchen und ein Männchen. Träge lagen die Tiere auf einem überhängenden Felsvorsprung, von wo aus sie die gesamte Steppe überblicken konnten. Hinter ihnen ging es mindestens fünfzig Meter steil nach unten. Damians Mundwinkel verzogen sich zu einem siegesgewissen Grinsen.
»Das Männchen gehört mir«, verteilte er mit gesenkter Stimme die Aufgaben. »Kweku, du übernimmst das vorderste Weibchen. Leandro, auf mein Zeichen schießt du auf die anderen beiden Weibchen und hältst sie uns vom Leibe. Jede Sekunde zählt. Klar?«
Leandro nahm die Flinte von der Schulter und nickte. »Klar.«
»Dann los!«
Geduckt pirschten sie sich zum nächsten niedrigen Felsen vor, um die Löwen in Wurfweite der Speere zu haben. Mit schweißigen Fingern klammerte sich Leandro an sein Gewehr. In seinem ganzen Leben war er wilden Löwen noch nie so nahe gewesen. Sie waren keine zwanzig Meter von ihnen entfernt!
Drei Sprünge und sie haben uns!, dachte er. Hoffentlich weiß Damian, was er tut!
Und das wusste er offenbar. Er holte aus und schleuderte seinen Speer mit voller Kraft auf das Männchen. Die Wucht warf den Löwen zur Seite und tötete ihn auf der Stelle. Die Weibchen sprangen auf die Beine. Mit gesenkten Köpfen blickten sie fauchend in ihre Richtung.
»Jetzt!«, rief Damian. »Schieß!«
Leandro nahm eines der Weibchen ins Visier, zögerte aber zu lange, woraufhin Kweku geistesgegenwärtig seinen Speer warf und eines der drei Weibchen an der Flanke traf. Das Tier brach tot zusammen, während die übrigen zwei Löwen kurzerhand zum Angriff übergingen. Mit riesigen Sprüngen setzten sie über die Felsen hinweg und kamen direkt auf die Jäger zu. Sie waren unglaublich schnell. Damian riss das Gewehr von seiner Schulter und streckte eines der Weibchen nieder. Es überschlug sich und blieb in einer Staubwolke liegen.
»Schieß!«, befahl Damian Leandro erneut, während er das Gewehr nachlud. »Schieß, verflucht noch mal!«
Doch Leandro war wie gelähmt. Die letzte der vier Raubkatzen setzte zum Sprung an. Leandro sah ihr furchterregendes Gebiss und ihre scharfen Klauen über sich und glaubte, sein letztes Stündlein hätte geschlagen. Aber Damian war schneller. Ein Schuss und das Weibchen krachte unmittelbar vor ihnen zu Boden und rührte sich nicht mehr.
»Warum zum Geier hast du nicht geschossen?!«, schrie Damian wütend. »Sie hätte uns töten können!«
Leandro brachte keinen Ton heraus, starrte bloß auf die Löwin zu seinen Füßen und war froh, noch am Leben zu sein. Worauf hatte er sich da bloß eingelassen? Zumindest war kein Löwe mehr übrig, der sie angreifen konnte. Alle vier waren tot, soweit Leandro das beurteilen konnte. Damian und Kweku waren in der Tat gute Schützen. Damian stupste die Löwin mit seinem Gewehr an, nur um sicherzugehen, dass sie wirklich tot war.
Da erklang über ihnen plötzlich ein furchterregendes Brüllen. Jäh wirbelten die Jäger herum. War da etwa noch ein fünfter Löwe? Das Brüllen kam von dem großen Felsen direkt über ihnen. Sie wichen zurück und blickten nach oben. Und da sahen sie ihn: einen gewaltigen Löwen. Sie konnten nur seine Umrisse sehen, da die Sonne ihm im Rücken stand. Geblendet stolperten sie nach hinten, den Blick auf die riesenhafte Silhouette über ihnen gerichtet, bis der Löwe an die Felskante vortrat und in seiner ganzen Größe sichtbar wurde. Es war ein weißer Löwe! Ein atemberaubendes Tier mit prächtiger Mähne und riesigen Pranken! Nie zuvor hatte Leandro ein derart majestätisches Tier gesehen.
»Unmöglich!«, flüsterte Damian.
»Ibhubesi elimhlophe!«, hauchte Kweku bestürzt.
Der Löwe brüllte erneut, so laut, dass die Erde davon erbebte. Die Jäger erzitterten und fielen rückwärts zu Boden. Damian nestelte nervös an seinem Gewehr herum und feuerte einen Schuss in Richtung des Löwen ab, woraufhin der Löwe noch lauter brüllte und zum Sprung ansetzte. Die Flinte erneut schussbereit zu machen, hätte zu lange gedauert. Er fuhr herum, einen Ausdruck von Entsetzen in den Augen.
»Töte ihn!«, schrie er Leandro zu, dann ließ er das Gewehr fallen und rannte davon, als wäre der Teufel hinter ihm her. Kweku stob in entgegengesetzter Richtung davon, und Leandro, von Panik erfasst, ließ ebenfalls sein Gewehr fallen und ergriff kopflos die Flucht nach vorne. Er hetzte quer über die Felsen bis zur überhängenden Felsplatte, auf der die beiden von Speeren durchbohrten Löwen in ihrem Blut lagen. Er hoffte, der weiße Löwe würde sich nicht ausgerechnet an seine Fersen heften, aber da hörte er auch schon ein knurrendes Keuchen hinter sich. Als er sich umdrehte, erschauerte er. Der Löwe war keine drei Meter von ihm entfernt. Schleichend, fast in Zeitlupe, setzte er eine Pfote vor die andere, fixierte ihn mit seinen klaren blauen Augen und kam unaufhaltsam auf ihn zu. Ein Sprung und die Raubkatze würde ihm das Genick brechen. Besorgt darum, ihre eigene Haut zu retten, hatten Damian und Kweku Leandro im wahrsten Sinne des Wortes dem Löwen zum Fraß vorgeworfen.
Von Todesangst gepackt und gänzlich unbewaffnet, überlegte Leandro fieberhaft, was er tun sollte. Vor ihm befand sich der Löwe, zwei Meter hinter ihm der gähnende Abgrund. Es gab keinen Ausweg. Jeder von Leandros Muskeln war bis zum Äußersten angespannt. Erstaunlicherweise griff ihn der weiße Löwe nicht an. Er schüttelte bloß seine Mähne und zeigte dem jungen Mann seine messerscharfen Zähne, während er ihn weiter in Richtung Felskante drängte. Was hatte er vor? Warum zögerte er?
Und falls du diesen mysteriösen weißen Löwen zu Gesicht bekommst, spießt du ihn mit deinem Speer auf!, dröhnten Damians Worte in Leandros Kopf.
Jäh fiel Leandros Blick auf das tote Löwenmännchen, das Damian mit einem einzigen Speerwurf erlegt hatte. Die Lanze steckte immer noch in seiner Flanke, und das in greifbarer Nähe!
Töte ihn!, schrie Damian in seinem Kopf. Töte ihn!
Noch immer standen er und der weiße Löwe sich Auge in Auge gegenüber. Leandro spürte eine unglaubliche Macht von dem Tier ausgehen und musste unweigerlich an den Mythos denken, den Damian ihm von dem weißen Löwen erzählt hatte. Sein Herz pochte wie wahnsinnig in seiner Brust. Er fühlte sich auf unerklärliche Weise zu dem Löwen hingezogen, als wären ihre Schicksale auf mysteriöse Weise miteinander verbunden. Was um alles in der Welt ging hier vor? Und warum griff ihn der Löwe nicht an? Worauf wartete er?
Töte ihn!, stachelte der Löwentöter ihn in seinem Kopf an. Töte ihn!
Leandro wurde schwindlig. Angst, Neugier, aber auch eine unbändige Wut, dass dieser Löwe ihn in diese ausweglose Lage gebracht hatte und ihn sein Leben kosten würde, jagten durch seinen Kopf, während Damians Stimme immer weiter anschwoll.
Töte ihn! Nimm den Speer und spieß ihn auf! Töte ihn!