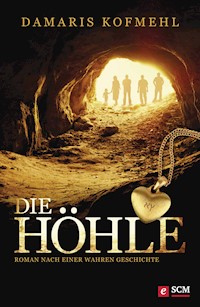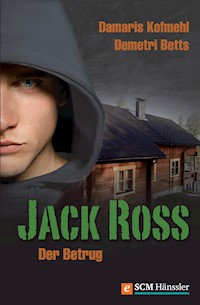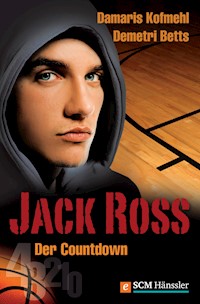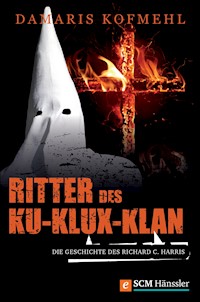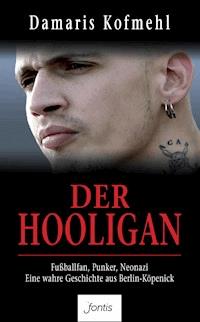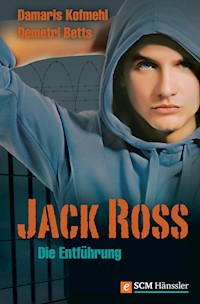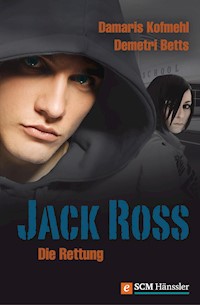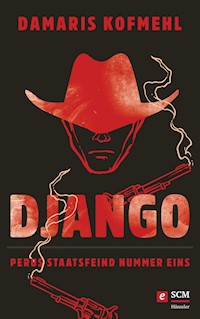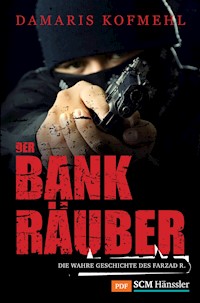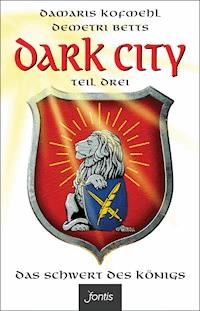
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fontis AG
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die paradiesische Insel Shaíria liegt seit einer Naturkatastrophe in Schutt und Asche. Auf ihr leben die Bürger der Stadt Dark City ohne jedes Sonnenlicht, eingeschlossen innerhalb eines riesigen Mauerrings, den sie unter Todesdrohung niemals verlassen können. Und der geheimnisvolle König Shaírias – der Einzige, der weiß, wo der Schlüssel zum großen Ost-Tor ist – bleibt verschollen. Doch fünf Jugendliche mit besonderen Fähigkeiten wurden auserwählt, um sich auf die Suche nach diesem König zu machen und ihm das letzte Buch der Prophetie und das flammende Schwert zu geben, damit er das Licht nach Dark City zurückbringen und das verlorene Paradies wiederherstellen kann. Drakar der Zweite, der über Dark City herrscht und dessen Bewohner knechtet, setzt indessen alles daran, den Erfolg der fünf Jugendlichen zu verhindern. Er spürt sie auf, und gerade in dem Moment, als sie es am wenigsten erwarten, geraten sie in einen bösen Hinterhalt. Ein Krieg ist nicht mehr aufzuhalten, und in der weiten Ebene vor dem großen Ost-Tor kommt es schließlich zur alles entscheidenden Schlacht …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Damaris Kofmehl & Demetri Betts
Dark City:Das Schwert des Königs
Damaris Kofmehl&Demetri Betts
Dark City
Das Schwert des Königs
www.fontis-verlag.com
Ich widme dieses Buch meiner geliebten Frau Damaris.
Ich wünsche dir nur das Beste für dein Leben,deine Zukunft und deinen Dienst.
Ich liebe dich.
Demetri Betts
Ich widme dieses Buch meinem geliebten Mann Demetri.
Ohne dich hätte ich mich nie an eine Fantasy-Serie wie diese herangewagt.Du hast das Beste aus mir herausgeholt und mir geholfen zu wachsen.Ich liebe dich.
Damaris Kofmehl
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnetdiese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sindim Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2009 by `fontis - Brunnen Basel
E-Book: © 2013 by `fontis - Brunnen Basel
Umschlag: Roloff, Basel
Karte im Innenteil: Roloff, Basel
E-Book-Herstellung: mbassador GmbH
E-ISBN 978-3-03848-574-2
Prolog
Odomar rammte das Schwert in die senkrechte Felswand. Es drang in den Felsen ein wie ein heißes Messer durch Butter. Der junge Mann schnitt eine Kerbe heraus und schuf sich so seinen nächsten Tritt. Wie auf einer senkrechten Treppe, deren Stufen nach innen gekehrt waren, kletterte er an der Wand hoch. Odomar war fünfundzwanzig Jahre alt, kräftig gebaut, hatte dunkelbraunes, leicht gewelltes Haar und blaugrüne Augen. Auf seinem Rücken trug er einen kleinen Rucksack aus dunkelbraunem Wildleder; ein langes, aufgerolltes Seil hatte er sich quer über die Schulter gehängt, und an seinem Gürtel war griffbereit ein großes Jagdmesser befestigt.
Er war die ganze Nacht durchgeritten und hatte das Atha-Gebirge kurz nach Sonnenaufgang erreicht. Niemand durfte erfahren, dass er das Schwert des Königs aus dem Tempel entwendet hatte, um es in den Bergen zu verstecken. Dies war der letzte Wille des Königs gewesen, und Odomar hatte ihm bei seinem Leben versprochen, das Schwert sicher aus der Stadt zu bringen, bevor es in falsche Hände geriet. Er liebte Herausforderungen, und er liebte seinen Herrn und König, dem er seit seiner Jugend von ganzem Herzen diente und für den er bereit war, alles zu geben, sogar sein Leben, wenn es sein musste. Dass der König ausgerechnet ihm sein Schwert anvertraut hatte, erfüllte ihn mit Ehre und Stolz.
Es war ein besonderes Schwert. Es hieß, es wäre aus einem Metall geschmiedet, das nicht von dieser Welt war. Es war größer als ein normales Schwert. An der breiten Parierstange zwischen Klinge und Heft befanden sich sechs Messer, drei auf jeder Seite. Wie die Zacken einer Gabel zeigten sie in dieselbe Richtung wie die zweischneidige Mittelklinge. Ein roter Rubin von der Größe einer Glasmurmel war in die Mitte der verzierten Parierstange eingelassen. Es wurde behauptet, der Geist des Königs würde auf diesem Schwert ruhen, und daher wurde es auch landläufig «das flammende Schwert» genannt.
Weiter und weiter hinauf kletterte Odomar, bis er in schwindelerregender Höhe endlich die Spalte erreichte, die er vom Fuß des Berges aus gesehen und zu seinem Ziel erklärt hatte. Es war nichts weiter als ein schräger Riss im Felsen, zwei Armspannen lang und knapp zwei Ellen breit. Wie weit er in den Berg hineinreichte, war nicht zu erkennen.
Odomar kroch in die Spalte hinein, lehnte sich erschöpft gegen den Felsen und genoss für einen Augenblick die herrliche Aussicht. Es war ein wunderschöner Tag. Die Sonne strahlte von einem wolkenlosen Himmel, und die Bergluft war klar und frisch. Im Osten, versteckt hinter zwei kahlen Berggipfeln, war ein Stück der Mauer zu sehen, im Süden schlängelte sich der Fluss durch das grüne Tal. Ein kräftiger Wind wehte durchs Gebirge. Unterhalb der Felswand stand Odomars Pferd und graste zwischen den Bäumen.
Der junge Mann legte das Schwert neben sich, schnallte den Rucksack ab und holte eine Fackel heraus. Er zündete sie an und leuchtete damit in die Felsspalte hinein. Der schmale Gang neigte sich schräg nach unten und verlor sich irgendwo in der Tiefe des Berges. Odomar hielt es für sicherer, das Schwert nicht gleich beim Höhleneingang liegen zu lassen. Also schulterte er den Rucksack wieder und folgte dem Spalt ein Stück weit in den Berg hinein. Und so nahm das Schicksal seinen tragischen Lauf …
Er war noch nicht weit gekommen, als plötzlich ein eigenartiges Rumoren erklang. Es hörte sich an wie Donnergrollen oder wie das Magenknurren eines Steinriesen. Fast gleichzeitig begannen der Boden und die Wände zu zittern.
Ein Erdbeben!, durchfuhr es Odomar. Ihm war klar, dass ein Riss im Berg nicht gerade ein geschickter Ort war, um sich bei einem Erdbeben dort aufzuhalten. Und dann geschah es auch schon: Ganze Felsstücke schälten sich von der Decke, und bevor Odomar Zeit hatte, sich zurück zum Eingang durchzuarbeiten, stürzte die Höhle mit einem lauten Krachen ein. Der Gang, der eben noch zwei Ellen hoch gewesen war, wurde wie von einem riesigen Schraubstock zusammengepresst, und Odomar robbte so schnell wie irgend möglich weiter in den Berg hinein. Es war der einzige Fluchtweg, der ihm geblieben war. Er konnte nur hoffen, dass er das Schwert rechtzeitig irgendwo in Sicherheit bringen konnte, bevor der gesamte Tunnel über ihm zusammenbrach oder ihn gnadenlos zerquetschte.
Der ganze Berg vibrierte, und als Odomar sich nun gebückt weiter vorankämpfte, machte er plötzlich einen Schritt ins Leere. Ein Loch tat sich vor ihm auf, und mit einem gellenden Schrei stürzte er kopfüber in die Tiefe. Die Fackel und das flammende Schwert fielen ihm aus der Hand, und im freien Fall konnte er gerade noch erkennen, dass er in einer riesigen Grotte mit einem unterirdischen See gelandet war. Dann klatschte er in das eisige Wasser. Das Schwert versank irgendwo neben ihm, und die Fackel erlosch.
Es wurde völlig dunkel um ihn herum. Für einen Moment verlor Odomar komplett die Orientierung und wusste nicht mehr, was oben und unten war. Vollkommene Finsternis hüllte ihn ein. Kurz darauf tauchte er prustend an der Wasseroberfläche auf und schwamm aufs Geratewohl in irgendeine Richtung, bis er festen Boden unter den Füßen spürte. Zähneklappernd schleppte er sich an Land.
Er legte seinen Rucksack ab, öffnete ihn und tastete in der Dunkelheit nach der wasserdichten Box mit der Kerze und einer Zunderbox darin. Er zündete die Kerze an, und die kleine Flamme leuchtete mit ihrem schwachen Schein die gesamte Grotte aus. Es war ein gutes Gefühl, wieder etwas sehen zu können, und Odomar staunte darüber, wie eine einzige Kerze mit einem Schlag die Schwärze einer gesamten Höhle verdrängen konnte. Im Kerzenschein entdeckte er auch die Fackel, die dicht am Ufer zwischen ein paar Steinen im See trieb. Er zog sie heraus und schüttelte mit ruckartigen Bewegungen das Wasser von der öligen Oberfläche. Zufrieden mit dem Ergebnis, steckte er sie in Brand und hielt sie über seinen Kopf, um die Höhle genauer in Augenschein zu nehmen. Die Grotte war imposant. Das kristallklare Wasser war türkisblau, und der gigantische See hatte mehrere Biegungen, die auf ein weitverzweigtes Höhlenlabyrinth schließen ließen.
Vielleicht ist es möglich, über einen der vielen Seitenarme einen Ausgang zu finden, dachte Odomar. Ein Boot wäre dafür ganz nützlich gewesen. Aber natürlich hatte er kein Boot, und so beschloss er, erst einmal nach einem anderen Ausstieg zu suchen – wenn es denn überhaupt einen Ausstieg aus dieser Höhle gab.
Längst hatte das Erdbeben aufgehört, und der Berg hatte sich wieder beruhigt. Das einzige Geräusch, das man noch hörte, waren glucksende Wassertropfen, die von gewaltigen Stalaktiten tropften. Die Oberfläche hatte sich so weit geglättet, dass Odomar das Schwert am Grund des Sees sehen konnte. Es glitzerte wie ein kostbarer Schatz. Eigentlich hätte er es einfach hierlassen können. Er solle es gut verstecken, hatte der König gesagt. Und ein besseres Versteck als auf dem Grund eines verborgenen unterirdischen Sees konnte es wohl kaum geben. Aber andererseits war ein Schwert, das durch Stein schneidet, auch sehr nützlich, wenn man in einer Höhle feststeckte und sich vielleicht seinen Weg nach draußen freischneiden musste.
«Ich nehme es mit», beschloss Odomar. «Erst finde ich hier raus. Dann suche ich ein neues Versteck.» Er verkeilte die Fackel zwischen zwei Steinen und trat ans Ufer. Gerade wollte er den ersten Stiefel ins Wasser setzen, als er glaubte, etwas durchs Wasser huschen zu sehen. Er konnte nicht erkennen, was es war, aber es war groß und lang und ziemlich beweglich. Odomar zögerte.
Eine Seeschlange?, dachte er beunruhigt. Er blieb stehen und beobachtete für eine Weile aufmerksam das Wasser, konnte aber nichts Auffälliges mehr sehen. Nur dort, wo ein Seitenarm hinter einem Felsen verschwand, kräuselte sich ab und zu das Wasser. Aber das war bestimmt nur wegen der tropfenden Stalaktiten. Er wartete mehrere Minuten, dann machte er zögernd den ersten Schritt ins Wasser.
«Da ist nichts», sprach er sich selbst Mut zu. «Und wenn da was wäre, dann bestimmt nichts, was mir gefährlich werden könnte.»
Und so watete er, bevor er es sich anders überlegte, in den kalten See hinein und verschwand mit einem Kopfsprung im eisigen Wasser. Der See war hier, in Ufernähe, nicht besonders tief, und mit nur wenigen kräftigen Stößen erreichte Odomar das flammende Schwert, ergriff es und tauchte wieder auf. Dass sich genau in diesem Moment die kräuselnde Welle hinter ihm in Bewegung setzte und sich rasch auf ihn zubewegte, bemerkte er nicht.
Und dann geschah es: Etwas schlang sich um seinen rechten Fuß und zerrte ihn gewaltsam unter Wasser.
Die Seeschlange!, durchfuhr es Odomar. Er umklammerte das Schwert, wirbelte herum und schlug zu, ohne auch nur einmal zu zögern. Das, was sich wie eine fleischige Liane um sein Bein gewickelt hatte, wurde mit einem einzigen Schwerthieb durchtrennt, fiel von ihm ab, und eine grünblaue Flüssigkeit trat aus. Odomar schwamm an die Wasseroberfläche und hatte kaum Zeit zum Luftschnappen, als etwas seinen linken Fuß packte und ihn erneut in die Tiefe zog. Wieder schlug er mit dem Schwert zu, und ein Schauer durchfuhr ihn, als er sah, was es wirklich war, das ihn angriff. Es war keine Seeschlange, wie er gedacht hatte. Es war ein Höhlenkrake!
Und er war wirklich riesig! Seine Tentakel waren mindestens sechs Armspannen lang, und seine Haut glühte orangerot. Man erzählte sich die wildesten Geschichten über diese hochintelligenten Tiere. Sie hatten drei Herzen und neun Gehirne, ein Haupthirn und acht weitere, in jedem Arm eines. Da sie weder Gräten noch Knochen besaßen, konnten sie sich durch kleinste Felsspalten zwängen. Sie waren aggressive Jäger, und wenn sie ihre Beute mit den Saugnäpfen gepackt und zum Mund geführt hatten, spritzten sie einen Verdauungssaft in sie hinein, der ihr Fleisch von innen heraus auflöste. Der daraus entstandene Brei wurde anschließend in aller Ruhe aufgesaugt. So oder so, die Begegnung mit einem Höhlenkraken endete in den meisten Fällen tödlich. Und wenn Odomar sich nicht rechtzeitig aus dessen Umklammerung befreien konnte, würde ihn dasselbe Schicksal ereilen.
Nachdem er sich mehrmals um seine eigene Achse gedreht hatte und von dem Kraken heftig durchgeschüttelt worden war, schaffte er es, den zweiten Tentakel abzutrennen. Er strampelte sich frei und schwamm um sein Leben. Das Ufer war ganz nah, rückte aber gleich wieder in unerreichbare Ferne, als der gewaltige Krake seine Tentakel ausrollte, sich an Odomars Körper festsaugte und ihn wieder unter Wasser zog. Der junge Mann verteidigte sich mit dem Schwert, so gut er konnte, aber immer wenn er einen Fangarm erwischte, griff bereits ein anderer nach ihm. Ja, es schien geradezu, als würden die abgetrennten Glieder ständig nachwachsen!
Das Blut des Kraken färbte das klare Wasser grünblau. Die Bestie peitschte mit ihren Tentakeln wütend den See auf. Ihre Hautfarbe war jetzt feuerrot vor Zorn.
Odomar wurde unter Wasser hin und her geschleudert. Seine Lungen brannten, während er gegen das Monster kämpfte. Er brauchte dringend Luft. Endlich gelang es ihm mit mehreren Schwertstreichen, dem Kraken zu entkommen. Nach Atem ringend und zitternd vor Kälte schleppte er sich ans Ufer und stolperte weit genug in die Grotte zurück, um außer Reichweite der Fangarme zu sein. Die Tentakel schossen wie Schlangen hinter ihm her, waren aber zu kurz, um ihn zu ergreifen, und Odomar sank erschöpft auf den Boden und schloss für einen Moment die Augen.
Geschafft!, dachte er erleichtert. Doch leider hatte er sich zu früh gefreut. Und das, was er nun zu Gesicht bekam, stellte alles in den Schatten, was er jemals über diese Ungeheuer gehört hatte: Der Koloss stieg aus dem Wasser! Ja, er zog sich mit den Saugnäpfen seiner acht Tentakel – sie waren tatsächlich wieder völlig intakt! – an Land und bewegte sich ringelnd auf Odomar zu! Der Krake gab einen schauerlich quietschenden Ton von sich, der von den Grottenwänden widerhallte. Seine Farbe hatte sich jetzt in ein giftiges Gelb verwandelt, gefährlich – und tödlich.
Odomar konnte den riesigen Körper der Bestie sehen, ihre großen Augen und ihren elastischen Schnabel in der Mitte der Tentakel, der gierig schmatzte und nur danach lechzte, ihn auszusaugen. Er wusste, das Schwert allein würde nicht ausreichen, um das Tier zu bezwingen. Dessen abgeschlagene Arme wuchsen viel zu schnell nach, und wenn man bedachte, dass jeder Arm sein eigenes Gehirn hatte, so war es, als müsste er nicht gegen ein Tier ankämpfen, sondern gegen acht. Er brauchte also dringend eine andere Waffe! Und er wusste auch schon, welche. Er hatte sie bisher nur zum Spaß gebraucht, aber nie, um sein Leben zu verteidigen. Und er war sich auch nicht sicher, ob sie ausreichen würde, um den Kraken zu besiegen. Aber er musste es wenigstens versuchen. Es war seine einzige Chance!
Eilends flüchtete er so weit in die Höhle zurück, bis es nicht mehr weiterging. Da stand er, mit dem Rücken zur Wand, das flammende Schwert verteidigend vorgestreckt, und ließ den Kraken auf sich zukommen.
«Schön, du willst mit mir spielen?», rief er ihm zu. «Dann spielen wir!» Er streckte seinen linken Arm aus, öffnete seine Faust, und aus seiner Handfläche schoss ein Strahl aus purem Eis. Er traf einen der Tentakel, welcher sofort an der Spitze einfror. Odomar schoss ihm einen weiteren Strahl entgegen, und die Kälte wanderte von der Spitze weiter nach hinten, bis der halbe Arm steif geworden war. Der Krake brüllte wütend auf, und Odomar lachte erleichtert.
«Na, wie gefällt dir das? Noch mehr gefällig?»
Er ließ die Spitze des nächsten Tentakels einfrieren und hielt sich gleichzeitig die andern Arme vom Leib, indem er sie immer aufs Neue mit dem Schwert abhackte, wenn sie ihm zu nahe kamen. Natürlich wuchsen sie sofort wieder nach, und die eingefrorenen Tentakel tauten auch schneller wieder auf, als es ihm lieb war. Seine anfängliche Zuversicht verflog im Nu. Wenn jetzt nicht ein Wunder geschah, war er verloren. Und das Wunder geschah.
Eigentlich war es nur ein Versehen. Da sich Odomar auf so vieles gleichzeitig konzentrieren musste, verfehlte er einen Tentakel, und sein Eisstrahl fror stattdessen ein Stück des Bodens ein und überzog es mit einer dünnen Eisschicht. Aber genau das war seine Rettung. Als nämlich der Krake rein zufällig damit in Berührung kam, blieb er prompt mit den Saugnäpfen daran kleben! Er quietschte verärgert und zerrte wie verrückt an dem Tentakel, um ihn wieder vom Boden wegzukriegen, doch es nützte alles nichts: Er klebte daran fest und kam nicht mehr los.
Als Odomar sich der glücklichen Fügung bewusst wurde, schöpfte er neue Hoffnung. Rasch begann er, weitere Teile des Bodens einzufrieren, und es funktionierte tatsächlich: Je mehr das Monster um sich schlug, desto mehr Saugnäpfe kamen mit der Eisfläche am Boden in Berührung und blieben daran haften.
«Nettes Spiel, was?», kicherte Odomar.
Der Krake wurde grellgrün vor Wut und stieß merkwürdige Geräusche und blaue Tinte aus, während er sich am Boden wand und sich genau dadurch selbst außer Gefecht setzte. Schließlich war er so weit festgefroren, dass er Odomar nicht mehr gefährlich werden konnte. Der Bursche kletterte auf seinen Rücken, hob das Schwert dreimal über seinen Körper und stach es dem Kraken mitten in jedes seiner drei Herzen. Mit einem leisen Stöhnen brach das Ungeheuer endgültig zusammen und färbte sich augenblicklich steingrau.
Odomar sprang von dem toten Kraken hinunter, steckte das Schwert in die Scheide, die an seinem Gürtel befestigt war, und atmete befreit auf.
Das ist gerade noch mal gutgegangen, dachte er. Jetzt aber nichts wie raus hier.
Entkräftet kehrte er ans Ufer des Sees zurück, schulterte seinen Rucksack und nahm die Fackel in die rechte Hand. Er suchte die ganze Grotte nach einem Ausgang ab, konnte aber keinen finden, nicht einmal die kleinste Felsspalte.
«Dann muss ich wohl doch übers Wasser gehen», murmelte er, obwohl er von der Idee nicht sehr begeistert war. Wer konnte schon wissen, ob noch mehr von diesen Ungeheuern in der Tiefe des Sees lauerten. Er hätte keine Kraft übrig gehabt, noch eines von der Sorte zu erledigen. Aber ob es ihm passte oder nicht: Der einzig mögliche Weg aus dem Berg führte nun mal durch diesen See. Und so fasste sich Odomar ein Herz und streckte seinen linken Arm aus. Der Eisstrahl, der aus seiner Handfläche hervorschoss, ließ das Wasser in Ufernähe gefrieren. Als die Eisschicht dick genug war, um sein Gewicht zu tragen, trat er vorsichtig ein Stück auf den See hinaus und fror den nächsten Abschnitt ein. Langsam bahnte er sich eine Eisstraße über den See, immer schön an den Felswänden entlang und immer mit einem prüfenden Blick auf das Wasser.
Alles schien ruhig zu sein. Der See lag friedlich und still. Kein Monster weit und breit. Nur das Klicken der Wassertropfen, die auf die Wasser- und die Eisoberfläche fielen. Und Odomars riesenhafter Schatten, den die Fackel an die Wand warf. Sonst nichts.
Der See verzweigte sich in drei Arme, und Odomar wählte den rechten aus. Die Decke wurde niedriger, und hinter der nächsten Rechtsbiegung entdeckte Odomar zu seiner großen Freude einen seitlich abzweigenden Höhlengang in der Felswand. Wohin er führte, wusste er nicht. Aber das war ihm im Augenblick ziemlich egal. Hauptsache, er kam aus dieser unheimlichen Grotte heraus. Er warf einen letzten Blick zurück auf den unterirdischen See, und da blieb ihm schier das Herz stehen: Das Wasser kräuselte sich. Und das nicht nur an einer Stelle. Wo er auch hinsah, bildeten sich kleine Wellen, und sie kamen mit rasender Geschwindigkeit auf ihn zu.
Nein! Nicht schon wieder!
So schnell er konnte, kletterte er in das Loch hinein, gerade noch rechtzeitig, bevor der erste Tentakel aus dem Wasser schnellte. Odomar zog sein Bein hoch und schleuderte mit seiner freien Hand mehr Eis auf den See. Die Eisfläche breitete sich rasch aus, konnte die Monster aber nicht lange aufhalten. Ein Krake versuchte sich daran hochzuziehen, fror mit seinen Saugnäpfen fest und riss eine große Eisscholle aus der Fläche heraus. Er wiederholte den Vorgang mehrmals und pflügte sich damit wie ein Eisbrecher bis zur Höhlenwand durch. Ein paar andere tauchten unter die Eisdecke und durchbrachen sie einfach von unten mit ihren kräftigen Körpern. Gleichzeitig saugten sich mehrere Kraken an den Wänden fest und zogen sich daran aus dem Wasser. Sie waren zwar um einiges kleiner als der Riesenkrake, den Odomar getötet hatte, aber es waren so viele, dass ihm nur noch eines übrig blieb: Flucht.
Um sich einen Vorsprung zu verschaffen, vereiste er den Einstieg. Dann krabbelte er auf allen vieren, die Fackel in der rechten Hand, durch den engen Höhlengang. Hinter sich hörte er es quietschen und schreien. Er hoffte, es wären genug Kraken mit ihren Tentakeln in dem Loch festgefroren, dass sie sich gegenseitig den Weg versperrten. Aber schon bald hörte er, wie das Quietschen näher kam, und wusste deshalb, dass einige doch durchgekommen waren, wie auch immer sie das angestellt hatten.
Er kroch weiter. Der Gang endete abrupt, und Odomar schlitterte in eine weitere große Höhle hinein. Es war eine gigantische Halle. In der Mitte ragte ein einzelner Felsen hervor wie ein von der Natur geschaffener Obelisk. Odomar nahm die Fackel in die linke Hand, riss mit der rechten das Schwert aus der Scheide und rannte los. Die Kraken waren ihm dicht auf den Fersen. Und es wurden immer mehr. Einer erwischte ihn am Bein. Doch Odomar wirbelte herum und schlug ihm den Tentakel ab. Er schaffte es bis zum Obelisken, bevor er realisierte, dass er von allen Seiten eingekesselt war. Es waren mehr, als er zählen konnte; eine Horde hungriger gelbgrüner Bestien. Er steckte die Fackel in den Boden und schoss Eisblitze in alle Richtungen. Ein paar Kraken blieben mit ihren Saugnäpfen daran hängen, aber die andern kletterten einfach über ihre Brüder hinweg oder wichen den gefrorenen Stellen geschickt aus, gerade so, als hätten sie aus den Fehlern ihrer Artgenossen gelernt und die Gefahr des Festklebens erkannt.
Näher und näher kamen sie. Ihre Schnäbel klapperten und schmatzten gierig. Odomar stand mit dem Rücken zum Obelisken und verteidigte sich mit dem flammenden Schwert und mit Eisstrahlen, so gut er irgend konnte. Doch er wusste sehr wohl, dass er hier nicht mehr lebend herauskommen würde. Die Mission, das Schwert des Königs zu verstecken, würde ihn sein Leben kosten. Mit einem letzten lauten Schrei durchtrennte er mehrere Tentakel gleichzeitig, bevor ein Fangarm sich von oben um seinen Hals schlang und ihm die Luft abschnürte.
«Bis in den Tod der Eure», hauchte Odomar, umklammerte das Schwert des Königs mit beiden Händen und presste es leidenschaftlich an seine Brust, während er rasch das Bewusstsein verlor.
Er spürte nicht mehr, wie die Kraken über ihn herfielen und sich um seinen Körper schlangen …
Und so erfüllte sich, was von Anfang an geschrieben stand. Das Schwert des Königs sollte im Schatten der Berge ruhen, bis die Zeit reif war, dass es wiedergefunden würde – und bis der Moment gekommen war für den letzten Kampf …
1
Shaíria im Jahre Tausend des Zeitalters der Könige. 34 Jahre vor der großen Nebelkatastrophe.
Das Geschrei von Hunderten von Babys erfüllte die Säulenhalle des Kyros-Tempels. Mütter und Väter warteten voller Ungeduld mit ihren Neugeborenen im Arm darauf, bis die goldenen Türflügel der Marmorhalle geöffnet würden. Sie hatten keinen Weg gescheut und waren von allen Enden der Insel herbeigekommen, um an diesem großen Tag dabei zu sein, an dem das königliche Paar sich aus den Säuglingen des Volkes einen Thronfolger aussuchen würde. Nie zuvor hatte ein König etwas Derartiges getan. Aber König Kyros war schon fünfundachtzig Jahre alt, und seine vierzigjährige Gemahlin, Königin Keyla, konnte keine Kinder bekommen. Also hatten sie im ganzen Land verkünden lassen, dass sie ein Kind adoptieren würden. Alle Eltern, die sich wünschten, dass ihr neugeborener Sohn in die Linie der Könige Shaírias aufgenommen wird, sollten ihn am ersten Tag des Monats Adar zum Kyros-Tempel bringen.
Und so hatten sich Hunderte auf den Weg gemacht, und lange vor Sonnenaufgang des besagten Tages hatte sich eine unzählbare Schar von Leuten in der Säulenhalle, auf der Treppe vor dem Tempel und rund um den Tempel herum eingefunden: Eltern mit ihren Neugeborenen, aber auch viele Menschen aus der Königsstadt Vardja und Umgebung, die bei diesem einmaligen Ereignis mit dabei sein wollten.
Voller Spannung erwartete die Menge den König und die Königin. Schon drangen die ersten Sonnenstrahlen über die hohen Gipfel des schneebedeckten Ysah-Gebirges und streiften mit ihrem warmen Licht die grünen Wiesen und goldenen Kornfelder des fruchtbaren Mirin-Tales, als der Schall von Fanfaren das königliche Ehepaar ankündigte. Die Menge teilte sich und kniete links und rechts am Wegrand und auf den von steinernen Löwen flankierten Stufen der Tempeltreppe nieder. Voller Ehrfurcht senkten die Menschen ihre Häupter, als sich der königliche Tross näherte.
Der Zug wurde angeführt von berittenen Fanfarenbläsern, gefolgt von Trägern, die sich beim Marschieren schwere Fahnenstangen mit dem Wappen Shaírias in die Hüften stützten. Das Wappen zeigte einen aufrecht stehenden Löwen, die Pranke auf einen Schild gelegt, und Strahlen gingen von ihm aus. Hinter den Fahnenträgern kamen Blumenmädchen, die rote Rosenblätter auf den Weg streuten. Danach kamen die Propheten. Sie trugen Kleider aus farbigen Tüchern, die sie sich um den Körper geschlungen hatten und mit deren Enden sie ihre Köpfe bedeckten. An ihren Füßen trugen sie Sandalen, an ihrer rechten Hand steckte ein Siegelring aus Gold.
Und dann kam die offene königliche Kutsche, gezogen von zwei gewaltigen weißen Langhorntigern mit langem Horn auf der Stirn. Ein paar Knaben liefen neben ihnen her und kraulten sie ab und zu hinter den Ohren, was die riesigen Katzen schnurrend mit sich geschehen ließen. König Kyros und Königin Keyla, in lange Samtkleider gehüllt, saßen in der Kutsche. Der König strahlte mit seinem weißen Haar und seinem weißen Bart eine unvergleichliche Würde aus, die nur noch von der Eleganz und Anmut seiner schönen Gemahlin übertroffen wurde.
Die Kutsche machte am Fuße des Klippenfelsens Halt, auf dem der Tempel errichtet worden war. Dann stiegen die Fanfarenbläser die Treppe zur Säulenhalle hoch, positionierten sich auf der obersten Stufe und bliesen in ihre langen, geraden Instrumente. Die Fahnenträger verteilten sich auf den vielen Stufen der Tempeltreppe und bildeten mit nach innen geneigten Fahnen einen Korridor für das königliche Paar. Begleitet von den Propheten und gestützt von seinen Dienern stieg der alte König zusammen mit seiner Gemahlin die lange Treppe hinauf zur großen Säulenhalle. Oben angekommen, drehte sich der König schwerfällig seinem Volk zu, hob zitternd die Hand und verkündete mit gebrochener Stimme:
«Ich grüße euch, Volk von Shaíria, und danke euch, dass ihr unserem Ruf vertrauensvoll gefolgt und mit euren Kindern hergekommen seid. Gott stehe uns bei, dass wir am heutigen Tag den richtigen Thronfolger für unser Land wählen! Möge das Volk von Shaíria durch seine Herrschaft in Frieden leben bis in Ewigkeit. Lang lebe Shaíria!»
Und das Volk antwortete im Chor:
«Lang lebe das Wort!»
Wieder erschallten die Fanfaren, die Propheten stießen die schweren Flügeltüren des Innentempels auf, und der König und die Königin traten in die berühmte Marmorhalle ein. Die Halle wurde von riesigen, mit Gold überzogenen Säulen getragen. Der Boden war aus Marmor und mit farbenprächtigen Mosaikbildern geschmückt. An den Wänden waren Fresken, die die Geschichte Shaírias darstellten. Hier in der Marmorhalle versammelten sich jeden Abend bei Sonnenuntergang Hunderte von Menschen, um den Propheten zu lauschen, wenn sie ihnen aus dem Buch der Prophetie, dem «Wort», wie es auch genannt wurde, vorlasen.
Das Wort war es, das der Insel und ihren Bewohnern tausend Jahre lang Frieden gebracht hatte. Das Wort war es, das vor tausend Jahren, nach einem langen und blutigen Krieg, das Paradies auf der Insel und in den Herzen der Menschen wiederhergestellt hatte. Das Wort war es, das einstmals wilde Tiere wie die Langhorntiger in zahme Katzen verwandelt und das Band zwischen Mensch und Tier, wie es im Anbeginn gewesen war, zurückgebracht hatte. Wölfe und Lämmer wohnten beieinander, und kleine Kinder tollten mit Löwen herum und spielten mit Schlangen. Das Land war so fruchtbar wie nie zuvor, und die Menschen waren weise und intelligent und starben nach einem sorgenfreien Leben. Es gab keinerlei Bosheit mehr auf Shaíria, denn das ganze Land war erfüllt von der Erkenntnis des Wortes. Ja, das Buch der Prophetie hatte alles verändert.
Auf der ganzen Insel gab es handgeschriebene Kopien des Wortes, und die Propheten genossen im ganzen Land hohes Ansehen. Denn sie waren die Einzigen, die die geheimnisvollen Worte des Buches lesen und verstehen konnten. Das Original des Buches der Prophetie wurde seit tausend Jahren von Herrscher zu Herrscher weitergereicht, und König Kyros hatte vor über zwanzig Jahren beschlossen, nebst den bereits bestehenden Tempeln einen besonderen Tempel zu errichten, in dem das wertvolle Original dieses Buches aufbewahrt werden sollte.
Der Bau des Kyros-Tempels, wie man ihn nannte, dauerte fünfzehn Jahre. Der imposante Tempel war am Rande der Königsstadt Vardja errichtet worden. Er lag auf einem Felsenriff unmittelbar am Meeresstrand, und wenn die Abendsonne glühend rot im Meer versank, tauchte sie den Tempel in ein zauberhaftes Licht. Es sah aus, als hätten die Steine Feuer gefangen.
Vorne in der Marmorhalle, dort, wo das aufgeschlagene Buch der Prophetie auf einem Tisch und das flammende Schwert auf einem Altar lagen, waren zwei geschnitzte Sessel mit hoher Lehne für das königliche Paar aufgestellt worden. Der König und die Königin setzten sich und gaben ihren Dienern mit der Hand ein Zeichen, dass sie bereit waren. Die Diener ließen die Menschenmasse bis zu einer Absperrung in die Halle eintreten und wiesen sie an, sich in eine Reihe zu stellen. Der ganze Raum war erfüllt vom Schreien und Weinen von Säuglingen.
Das erste Ehepaar wurde durch die Absperrung gelassen. Mann und Frau warfen sich vor dem König und der Königin nieder. Die Frau streckte ihnen ihr Kind entgegen, und Königin Keyla nahm das schreiende Bündel in ihre Arme und versuchte es zu beruhigen.
«Wie ist sein Name?», erkundigte sich die Königin.
«Marcos, Eure Hoheit», antwortete die junge Mutter und sah auf. «Er ist unser erstes Kind.»
«Und ihr würdet euren Erstgeborenen tatsächlich an euren König abtreten und auf das elterliche Recht verzichten?», fragte der König und strich dem kleinen Marcos mit dem Finger über sein winziges Gesichtchen, das ganz rot war vom Weinen.
Der Vater des Kindes hob den Blick. «Ja, das würden wir, Eure Hoheit», sagte er und gab sich Mühe, seine Stimme nicht schwermütig klingen zu lassen. «Wir sind sieben Tage quer durchs Land gereist, um Euch unseren Sohn zu weihen. Nehmt ihn, wenn es Euch beliebt. Er soll Euer sein.»
Der König und die Königin betrachteten das Kind. Dann warf der König seiner Gemahlin einen Blick zu, worauf sie kaum merklich den Kopf schüttelte und der Mutter den Säugling zurückgab.
«Ihr habt einen wunderschönen Jungen zur Welt gebracht», sagte sie sanft. «Sorgt gut für ihn.»
Die Augen der Mutter leuchteten. «Das werden wir, Eure Hoheit», sagte sie und drückte den kleinen Marcos fest an ihre Brust. Die Erleichterung und Freude, ihren Sohn wiederzuhaben, waren weit größer als die Enttäuschung, dass ihr Kind nicht auserwählt worden war, um später einmal König zu werden.
«Und vergesst nicht, euer Kind von den Propheten segnen zu lassen, bevor ihr geht», ergänzte der König mit einer großzügigen Geste.
«Danke, Eure Hoheit», murmelten die jungen Eltern, während sie sich in gebückter Haltung rückwärts entfernten. Die Diener ließen das nächste Paar vortreten. Auch dieses war jung, und das Kind, ein Winzling mit dunklen Haaren, lutschte an seinem Daumen und schlief friedlich.
«Er heißt Janosh, Eure Hoheit», sagte die Mutter und überreichte ihn der Königin.
Die Königin hielt ihn eine Weile im Arm und reichte ihn ihrem Gemahl weiter.
«Janosh», wiederholte der König und sah sich den kleinen Knirps eingehend an. Schließlich, nach einem prüfenden Blickkontakt mit der Königin, reichte er ihn dem Vater zurück. Der Kleine nuckelte weiter an seinem Daumen.
«Habt Dank für euer Vertrauen», sagte die Königin. «Geht in Frieden und lasst euren Sohn beim Ausgang von den Propheten segnen. Aus eurem Janosh wird bestimmt einmal ein großartiger Mann werden.»
Die Eltern des kleinen Janosh lächelten stolz und zogen sich in ehrfürchtiger Haltung zurück, während bereits das dritte Ehepaar vor dem König und der Königin niederkniete, um ihnen sein Kind zu weihen. Wieder nahmen es sowohl König wie auch Königin in den Arm, wieder betrachteten sie es abwägend, und wieder gaben sie es den Eltern zurück. Und so verstrich Minute um Minute und Stunde um Stunde. Die Schlange mit den wartenden Eltern schien kein Ende zu nehmen. Gegen Mittag hatten sich der König und die Königin bereits über dreihundert neugeborene Knaben angesehen, doch da war keiner unter ihnen, von dem sie den Eindruck hatten, es wäre der richtige, kein Einziger.
«Woher werden wir wissen, welches Kind wir wählen sollen?», hatte der König seine Gemahlin am Abend zuvor gefragt, als sie durch den Rosengarten ihres Palastes geschlendert waren. Die Königin war daraufhin stehen geblieben und hatte ihm mit ihrer zarten Stimme geantwortet:
«Wenn wir ihn sehen, werden wir es wissen, mein Liebster. Wir werden wissen, dass er es ist.»
Der Nachmittag verstrich, und noch immer war kein Baby zum Thronfolger auserkoren worden. Der Abend kam, und nur noch ein Dutzend Leute standen in der Reihe. Der König und die Königin waren müde. Sie hatten aufgehört zu zählen, wie viele Neugeborene sie in den Armen gehalten hatten. Das letzte Kind wurde ihnen gereicht. Es war genauso süß wie alle anderen vor ihm. Aber wieder schüttelte die Königin den Kopf.
«Er ist es nicht», meinte sie erschöpft.
«Meine Liebste», sagte der König und neigte sich zu ihr hinüber. «Es sind keine Kinder mehr da, aus denen wir wählen könnten.»
Die Königin seufzte. «Wir werden ihn finden, mein Gemahl. Ich weiß es. Habt Geduld. Gott wird ihn zu uns bringen. Das spüre ich.»
Die Sterne funkelten von einem klaren Himmel, als der König und die Königin an diesem Abend in ihren Palast zurückkehrten. Erschöpft von dem langen Tag legten sie sich schlafen. Doch mitten in der Nacht schreckte die Königin auf und weckte ihren Mann.
«Was ist, meine Liebste?», murmelte der König und rieb sich schlaftrunken die Augen.
«Ich habe von ihm geträumt», flüsterte die Königin aufgeregt. «Ich weiß seinen Namen.»
«Wessen Namen?», erwiderte der König müde.
«Den Namen unseres Sohnes, den Namen des Erben unseres Thrones. Sein Name ist Arlo.»
«Arlo», wiederholte König Kyros, und kaum hatte er den Namen ausgesprochen, da klopfte es an die Tür.
«Eure Hoheit», drang die hektische Stimme eines Dieners durch das schwere Holz. «Eure Hoheit! Bitte wacht auf!»
«Was ist denn los?», brummte der König in Richtung Tür. «Es ist mitten in der Nacht.»
«Entschuldigt die späte Störung, Eure Hoheit», sagte der Diener draußen auf dem Korridor atemlos. «Aber wir haben etwas auf der Türschwelle des Palastes gefunden. Ein Kind!»
«Ein Kind?!», rief die Königin begeistert. Eilends sprang sie aus dem Bett und warf sich ihren seidenen Morgenmantel um die Schultern. Ihr Gemahl setzte sich mit zerzaustem Haar auf die Bettkante, und die Königin half ihm beim Aufstehen.
«Tretet ein!», ordnete der König an, worauf die beiden Flügeltüren des Schlafgemachs aufflogen und ein junger Diener, völlig außer Puste, eintrat und sich fast bis zum Boden verneigte.
«Wo ist es?», fragte die Königin ungeduldig.
«Der Nachtpförtner hat es gefunden. Es wird jeden Moment hier sein, Eure Hoheit.»
«Warum haben die Eltern es nicht zum Tempel gebracht?», wunderte sich der König und band gähnend den Gürtel seines Morgenmantels zu.
«Wir wissen nicht, wer seine Eltern sind, Eure Hoheit», sagte der Diener und verbeugte sich erneut.
«Was wollt Ihr damit sagen?», fragte die Königin.
«Nun, das Kind lag offenbar einfach da. In einem geflochtenen Korb. Der Pförtner weiß nicht, wer es hergebracht hat. Er hat niemanden gesehen.»
«Merkwürdig», brummte der König und versuchte sein widerspenstiges Haar mit den Händen zu glätten.
In diesem Augenblick stürmten mehrere Diener und Mägde herbei und blieben in gebeugter Haltung vor dem Schlafgemach stehen. Eine Magd hielt ein Bündel in ihren Armen. Es war ein Kind, in Windeln gewickelt. Die Königin eilte mit klopfendem Herzen auf die Magd zu, nahm das Baby entgegen und drückte es an ihre Brust. Es war ein entzückender kleiner Junge, und er sah die Königin mit großen blauen Augen erstaunt an. Dann begann er freudig zu quietschen und zu strampeln und streckte seine kleinen patschigen Händchen nach Königin Keyla aus. Diese küsste zärtlich seine Fingerchen. Ihr wurde ganz warm ums Herz.
«Arlo», murmelte sie, worauf der Kleine ihr ein bezauberndes Lächeln schenkte. Sie küsste ihn sanft auf die Stirn und legte den Jungen dann in des Königs Arme. «Er ist es», sagte sie, zu ihrem Gemahl gewandt, der den Knaben genauso fasziniert anstarrte wie er ihn. «Wir haben ihn gefunden.»
«Nicht wir haben ihn gefunden», verbesserte der König, und seine alten Augen glänzten, «sondern er uns. Arlo. Zukünftiger König von Shaíria.» Er sah auf zu den Dienern. «Geht! Verkündet im ganzen Land, dass der Himmel uns heute Nacht einen Sohn geschenkt hat! Alle Welt soll sich mit uns freuen und seinen Namen erfahren, den Namen des Thronerben Shaírias: Arlo.»
Noch ahnte niemand, welch große Aufgabe dieser kleine Findelprinz einst würde erfüllen müssen. Und noch ahnte niemand, welch bedeutende Rolle ein weiterer Prinz in der Geschichte Shaírias spielen würde; ein Prinz, der nur vier Jahre später im königlichen Palast geboren wurde – und das, obwohl alle geglaubt hatten, die Königin wäre unfruchtbar. Und so kam es, dass Prinz Arlo einen kleinen Bruder bekam.
Sein Name war Drakar.
2
Dreizehn Jahre nach Drakars Geburt.
«Arlo!»
Der dreizehnjährige Drakar stürmte durch den Palastgarten und blieb vor einer steinernen Bank stehen, auf der sein siebzehnjähriger Bruder saß und in ein dickes Buch vertieft war. Prinz Drakar trug eine braune Tunika, mit einer Kordel zusammengehalten, darunter weite Beinkleider und hohe Wildlederstiefel. Drakar war ein mittelgroßer, schlaksiger Junge mit einem bleichen, kantigen Gesicht und einer hohen Stirn. Sein schwarzes Haar war stets zerzaust, und seine kleinen schwarzen Augen saßen tief und schienen ständig auf der Suche nach etwas Aufregendem zu sein.
«Komm mit! Ich muss dir etwas zeigen!»
Arlo blätterte eine Seite um und las seelenruhig weiter. Er war groß und schlank und hatte im Gegensatz zu seinem Bruder eher weiche Gesichtszüge. Er hatte schulterlanges braunes Haar und blaue Augen von der Farbe eines Bergsees. Der Prinz trug eine dunkelblaue Tunika aus Samt mit goldbestickter Borte.
«Nicht jetzt, Drakar», sagte er, ohne aufzusehen. «Ich bin am Lesen.»
«Ach komm, Bruderherz. Du bist doch immer am Lesen.»
Drakar knuffte Arlo in den Arm und versuchte ihn von der Bank wegzuzerren. «Wie oft hast du das Wort schon durchgelesen? Fünfmal? Zehnmal?»
Arlo klappte das Buch der Prophetie zu und sah seinen jüngeren Bruder von der Seite an. «Im letzten oder in diesem Monat?»
Drakar verdrehte die Augen. «Siehst du, das ist es, wovon ich spreche. Genau das. Du sitzt hier den ganzen Tag und sinnst über dem Wort nach und merkst gar nicht, wie das Leben an dir vorbeizieht. Ich sag dir: Eines Tages wirst du als einsamer Greis aufwachen und all das Schöne und Spannende in dieser Welt verpasst haben. Wetten? Ich meine, es gibt doch noch andere Dinge im Leben als dieses Buch.»
Arlo fuhr mit den Fingern über den abgegriffenen Ledereinband. «Aber nichts ist so faszinierend», murmelte er wie zu sich selbst.
Drakar pflückte zwei Äpfel von einem Baum, reichte seinem Bruder einen davon, rieb den andern Apfel an seinem Hemd glänzend und biss herzhaft hinein.
«Was ist es denn, das dich so daran fasziniert, Brüderchen? Was ist es?»
«Es sind Worte, gefüllt mit Geist und Leben», antwortete Arlo und drehte den Apfel zwischen den Fingern. «Ein Apfel vermag deinen Hunger nur für kurze Zeit zu stillen. Das Wort aber kann deinen Hunger für immer stillen.»
Drakar zog den Mund schief. «Du bist ein Träumer. Ich werde dich wohl nie ganz verstehen, Brüderchen», sagte er zwischen zwei Bissen. Dann packte er Arlo ungeduldig an der Tunika. «Komm jetzt! Ich hab was, das du unbedingt sehen musst!»
«Eine neue Erfindung?»
«Du wirst staunen, Bruderherz», sagte Drakar und riss seine kleinen Augen bedeutungsvoll auf, «du wirst staunen.»
«Wie letztes Mal, als du Mutters Abendkleid in Brand gesteckt hast?», lachte Arlo, packte das Buch der Prophetie in eine Ledertasche und hängte sie sich schräg über die Schulter.
«Das war ein unglückliches Versehen», rechtfertigte sich Drakar mit erhobenem Zeigefinger. «Das Eisen war zu heiß geworden. Ich hab nur nicht die richtige Temperatur hingekriegt. Beim nächsten Mal funktioniert’s, ich sag’s dir. Durch Hitze und Druck kann man Kleider glätten.»
«Ja, oder verbrennen», ergänzte Arlo, «zudem: Wer will denn schon seine Kleider glätten?»
Darauf gab ihm Drakar keine Antwort. Er war bereits davongeeilt.
«Wo gehen wir hin?», rief Arlo seinem übermütigen Bruder nach.
«Keine Sorge, bis zum Abendessen sind wir wieder da!», rief Drakar vergnügt zurück. «Dann kannst du deine Nase wieder in dein geliebtes Buch stecken und weiterträumen.»
Sie durchquerten das Schloss und kamen zu den Stallungen. Ein Stallbursche war dabei, die Boxen auszumisten. Als er die beiden Prinzen kommen sah, nahm er die Mütze vom Kopf und verneigte sich.
«Sattelt unsere Pferde!», befahl ihm Drakar. «Mein Bruder und ich reiten aus.»
Der Stallbursche verschwand eilends, um dem Wunsch des Prinzen zu entsprechen.
«Was hast du diesmal ausgeheckt?», fragte Arlo neugierig und verfütterte seinen Apfel einem Pferd. Drakar warf das Kerngehäuse seines Apfels auf den Boden und zog Arlo am Ärmel hinter sich her.
«Ich zeig’s dir.» Er führte ihn zu einer leeren Pferdebox. In deren Mitte stand ein relativ großer, unförmiger Gegenstand, der mit einem weißen Tuch zugedeckt war. Drakar trat feierlich daneben.
«Unsere Gesellschaft ist in vielen Bereichen sehr fortschrittlich. Wir wissen, wie man Schwingungen einfängt, um über weite Entfernungen miteinander zu kommunizieren, oder wie man Schallwellen auf Hörscheiben speichert. Wir haben Techniken entwickelt, um die Zeit zu messen, die Sterne zu erforschen oder Bilder mit chemischen Dämpfen auf Papier festzuhalten. Doch eines ist uns bisher nicht gelungen.» Er machte eine Pause, um die Bedeutung seiner Worte noch mehr herauszustreichen, und wölbte stolz seine Brust.
«Mein lieber Bruder. Hiermit präsentiere ich dir meine neuste Erfindung. Eine Erfindung, die die Welt revolutionieren wird: das Lichtrad!»
Mit einer ruckartigen Bewegung riss Drakar das Tuch von dem Gegenstand, und zum Vorschein kam ein eigenartiges Gefährt auf drei Rädern. Zwischen zwei großen Wagenrädern war eine Art Liegesitz angebracht, und ein drittes, kleineres Rad befand sich sechs Fuß weiter vorne, als wäre es bereits vorausgeeilt. Es war an einer Holzlatte befestigt und ebenfalls mit dem Sitz verbunden und konnte mit einer handlichen Lenkung gesteuert werden. Hinter dem Sitz steckte eine lange Bambusstange, an deren Ende zwei dünne Stäbe festgebunden waren, die sich fast berührten. Mehrere Drähte gingen davon weg und endeten in einem unübersichtlichen Wirrwarr an der Achse der Räder.
«Wow», machte Arlo und musterte das seltsame Dreirad eingehend. «Eine Minikutsche.»
«Keine Minikutsche, Arlo. Das hier ist ein Lichtrad. Es erzeugt Licht. Künstliches Licht.»
«Künstliches Licht?»
«So ist es.» Drakar glühte vor Begeisterung. «Wenn die Räder sich schnell genug drehen, entsteht zwischen diesen beiden Stäben ein Lichtbogen, und sie beginnen zu glühen.»
Arlo war sich nicht sicher, was er davon halten sollte. «Und das funktioniert wirklich?»
«Natürlich tut es das.»
«Ich meine, ohne dass das ganze Teil dabei in Flammen aufgeht?»
Drakar verschränkte beleidigt die Arme. «Du traust mir aber auch gar nichts zu. Ich hab wochenlang daran herumgetüftelt. Und du wirst mein Zeuge sein, dass meine Theorie stimmt.»
«Theorie? Heißt das, du hast das Ding hier …»
«Lichtrad, wenn ich bitten darf.»
«Ich meine, du hast das Lichtrad noch nicht getestet?»
«Nein. Aber das tun wir jetzt. Und ich weiß auch schon den perfekten Ort, wo ich die nötige Beschleunigung erreichen kann: am Mohnberg.»
Arlo sah seinen Bruder entsetzt an. «Du willst damit den Mohnberg hinunterfahren? Bist du verrückt geworden? Du wirst dir alle Knochen brechen!»
Drakar grinste abenteuerlustig. «Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, Bruderherz. Keine Sorge, bevor ich in den Fluss stürze, bremse ich selbstverständlich ab.»
«Ja. Selbstverständlich», nickte Arlo und warf einen skeptischen Blick auf die Erfindung seines Bruders. «Und was ist, wenn die Bremsen versagen?»
Drakar winkte ab. «Du klingst wie Mutter. Seit Vaters Tod ist sie noch sensibler geworden.»
«Sie hat Angst, du könntest dich irgendwann ernsthaft verletzen bei deinen gefährlichen Experimenten.»
«Ich weiß, ich weiß. Es wäre ihr lieber, ich wäre so wie du.»
«Das hat sie nie gesagt.»
«Nein, gesagt nicht, aber gedacht.»
«Jede Mutter würde sich Sorgen machen, wenn ihr Sohn sich mit zwei Bettlaken Flügel bastelt und aus dem Turmfenster springt. Damals hast du dir nur den Knöchel verstaucht. Aber genauso gut hättest du dir das Rückgrat brechen können.»
«Hab ich aber nicht.»
«Nein, hast du nicht. Aber deine Erfindungen werden von Mal zu Mal größer, und dein Leichtsinn auch.»
Drakar lächelte spitzbübisch. «Ist ja rührend, wie du dich um mich sorgst, Brüderchen. Aber ich bin kein Baby mehr. Ich kann ganz gut auf mich selbst aufpassen. Es wird schon nichts passieren.»
Der Stallbursche kam mit den gesattelten Pferden, und Drakar spannte sein Pferd vor das Lichtrad wie vor eine Kutsche und schwang sich in den Sattel. «Auf geht’s! Heute schreiben wir Geschichte, mein Bruder, du wirst sehen!»
3
Sie ritten los, ließen die Stadt Vardja hinter sich und lenkten die Pferde durch eine traumhafte Landschaft Richtung Mohnberg. Es war ein wunderschöner Sommertag. Die Sonne strahlte von einem wolkenlosen Himmel. Schmetterlinge in allen Farben und Größen tanzten durch die Luft. Es roch nach wilden Rosen und Flieder.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!