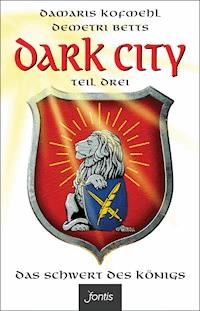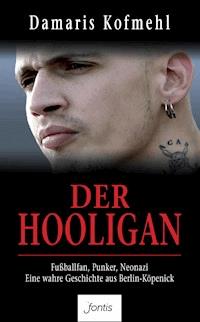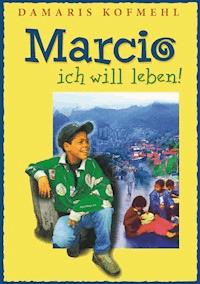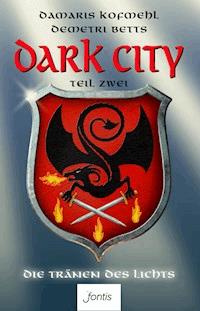11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Robert ist ein Bad Cop und korrupt bis ins Mark. Er arbeitet als junger Polizist in New Orleans und missbraucht seine Dienstmarke für seine eigenen Zwecke. Als eines seiner Opfer ihn ans Messer liefert und ihm dreissig Jahre Gefängnis bevorstehen, kriegt Robert Panik. Er flieht, entschlossen, bis zum Ende seines Lebens unterzutauchen. In den Wäldern Kanadas lernt er zu jagen und zu töten, um zu überleben. 22 Jahre lebt er im Exil, mal als Schläger, mal als Dopingdealer, aber meistens als einsamer Wolf im Wald. Er wird zu einem Experten der Wildnis, einem modernen Robinson Crusoe und entfremdet sich immer mehr von der zivilisierten Welt. Bis Gott eingreift... Top-Autorin Damaris Kofmehl erzählt wieder eine packende Biografie mit viel Action und Tiefgang.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ich widme dieses Buch meiner geliebten Schwester Mirjam Kofmehl.
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
TU DAS RICHTIGE!
EINMAL EIN GAUNER, IMMER EIN GAUNER
EIN ROOKIE IN NEW ORLEANS
BAD COP
DIE ÜBERSCHRITTENE LINIE
DIE FALLE
EIN RISKANTER PLAN
AUF DER FLUCHT
AB IN DEN WALD
DER GATINEAU-PARK
DIE JAGD
LEBEN IN DER WILDNIS
ÜBERLEBENSKÜNSTLER
DER WILDE
DER WINTERMANTEL
PATER GEORGE CLEMENTS
DIE GREAT SMOKY MOUNTAINS
SPIKEY
DER STREIT
DER VOLLSTRECKER
WOLFSMENSCH AUF WANDERSCHAFT
DER DOPINGDEALER
CHRISTY
EIN UNERWARTETER BESUCHER
DIE BÜCHSE
DAS URTEIL
WIE ES WEITERGING
VORWORT
In den meisten meiner True-Life-Thriller geht es um Gangster, Bankräuber, Drogendealer, Flugzeugentführer, Mörder und Terroristen. Diesmal nicht. Ich dachte mir, ich drehe den Spieß um und schreibe zur Abwechslung über einen Vertreter des Gesetzes. Ich recherchierte im Internet nach einer passenden Geschichte und stieß auf die unfassbare Story von Robert Leon Davis, eines korrupten Cops, der wegen eines Verbrechens zweiundzwanzig Jahre vor der Justiz floh und sich auf seiner Flucht unter anderem jahrelang in den Wäldern Kanadas und der USA versteckte.
Im April 2015 hatte ich das große Privileg, Robert persönlich in New Orleans kennenzulernen und seine Erlebnisse aus erster Hand zu erfahren. Ich bin stets auf der Suche nach einer außergewöhnlichen Geschichte, nach einer Geschichte, die ich so noch nie gehört habe und die mir den Atem verschlägt. Nun, Roberts Geschichte hat mir definitiv den Atem verschlagen, und ich hoffe, dir, lieber Leser, wird es genauso gehen.
In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Lesen.
Damaris Kofmehl
1.
TU DAS RICHTIGE!
New Orleans, Louisiana. 1970.
»Heute Nacht rauben wir den Lebensmittelladen aus! Heute Nacht, sobald Großmutter schläft.«
Meine drei jüngeren Brüder standen in ihren Pyjamas neben mir im Badezimmer und sahen mich entgeistert an.
»Bist du sicher, dass wir das tun sollen?«, flüsterte Kenth, den Mund voller Zahnpasta.
»Natürlich bin ich das!«, antwortete ich überzeugt und spuckte ins Waschbecken. »Es ist doch so: Großmutter müht sich tagtäglich ab, um uns irgendwie über die Runden zu bringen. Gestern hat sie selbst kaum was gegessen, damit keiner von uns leer ausgeht. So kann es nicht weitergehen.«
»Großmutter würde das niemals gutheißen«, wandte Kwame ein. »Du kennst doch ihren Spruch.«
»Tu das Richtige«, zitierten wir ihn alle wie aus einem Munde. Und obwohl Großmutter nicht anwesend war, fühlte es sich dennoch so an, als stünde sie direkt hinter uns. Für einen Moment kamen sogar mir Zweifel. Aber dann reckte ich mein Kinn und rechtfertigte meinen Plan entschlossen: »Ich werde tun, was nötig ist. Ihr wollt doch essen, nicht wahr?« Meine Brüder nickten. »Dann haben wir keine Wahl. Also, seid ihr dabei, oder seid ihr zu feige dafür?«
Meine Brüder warfen einander bedenkliche Blicke zu. Tony war der Erste, der einwilligte.
»Ich bin dabei«, sagte er kühl und ließ seine Knöchel knacken.
»Also gut«, gab sich Kenth einen Ruck. »Tun wir’s.«
»Meinetwegen«, schloss sich Kwame an. »Wann ziehen wir los?«
»Sobald wir sicher sind, dass Großmutter schläft«, sagte ich. »Ich denke, so gegen Mitternacht. Haltet euch bereit.«
Gesagt, getan. Wir lösten unsere kleine Geheimversammlung im Badezimmer auf und gingen auf unser Zimmer. Unsere fünf jüngeren Brüder und Schwestern, die ihren Raum uns gegenüber hatten, schliefen bereits tief und fest.
Wir waren neun Geschwister. Ich war fünfzehn Jahre alt und der Älteste. Nach mir kamen meine Brüder Tony, Kenth, Kwame, Keith und Jack. Und dann kamen meine Schwestern Valerie, Vivian und Thecla. Seit wir denken konnten, lebten wir bei Großmutter. Wenn wir sie fragten, warum wir nicht wie alle andern Kinder bei unseren Eltern aufwuchsen, sagte sie immer:
»Darüber zerbrecht euch nicht den Kopf. Ihr seid meine Kinder. Ich sorge für euch. Alles andere ist unwichtig.«
Ich hätte schon gerne gewusst, warum ausgerechnet wir keine richtige Familie sein durften, wie es im Fernsehen immer gezeigt wurde. Meinen Vater hatte ich nie kennengelernt. Meine Mutter hatte ich genau achtmal in meinem Leben getroffen, immer dann, wenn sie ein neues Geschwisterchen bei Großmutter ablieferte. Ich hatte keinerlei Gefühle für sie. Sie war eine vollkommen Fremde für mich. Sie war eine sehr hübsche Afroamerikanerin, sehr intelligent, und sie wusste über ziemlich viel Bescheid, so kam es mir vor. Bei einer unserer raren Begegnungen fragte ich sie nach meinem Vater. Sie erzählte mir, er wäre ein Waisenjunge aus Texas gewesen und hätte in der amerikanischen Luftwaffe gedient. Ich fragte sie, warum er uns nicht einmal besuchen komme. Sie sagte, er hätte sich aus dem Staub gemacht und sie wüsste nicht, wo er wäre. Ich hasste ihn dafür. Wie konnte er neun Kinder in die Welt setzen und uns dann einfach verlassen? Auf meine Mutter hegte ich keinen Groll, auch wenn ich nicht verstand, warum sie uns nicht zu sich nahm. Aber auf meinen Vater war ich stinksauer. Ein feiger Hund war er. Jawohl, das war er. Und hätte ich ihn jemals getroffen, hätte ich ihn meine ganze Verachtung spüren lassen.
Großmutter kam in unser Zimmer. Ich und Tony teilten das Stockbett beim Fenster, Kenth und Kwame das neben dem Kleiderschrank. Wie jeden Abend blieb Großmutter zwischen den Stockbetten stehen, ließ ihren Blick über uns Jungs schweifen und sagte:
»Lasst uns dem Herrn für diesen Tag danken.«
Dann wartete sie, bis jeder von uns die Hände gefaltet und die Augen geschlossen hatte, und sprach ein kurzes Nachtgebet. Großmutter war eine tiefgläubige Frau. Sie erzog uns im christlichen Glauben und lehrte uns beten und so zu leben, wie es Gott gefiel. Sonntags, bei jedem Wetter, ob es stürmte oder die Sonne schien, zog sie ihre schicksten Kleider an, stülpte ihre weißen Handschuhe über, setzte den großen, eleganten Hut auf, klemmte ihre dicke und vom Lesen zerfledderte Bibel unter den Arm und marschierte mit uns neun geschniegelten und gestriegelten Kindern zur Kirche. Keiner von uns hätte es jemals gewagt, nicht mitzugehen. Großmutter war eine kleine, stämmige Frau, und ihre Autorität war unantastbar. Was sie sagte, war Gesetz, und wehe dem, der dagegen verstieß. Sie war nie gemein oder ungerecht zu uns – auch wenn wir den Teppichklopfer viel zu oft auf unsern Hintern zu spüren bekamen. Großmutter hatte ihre Methoden. Doch wir wussten, dass sie es immer gut mit uns meinte. Sie versuchte ganz einfach, uns neunköpfige Kinderschar, so gut es ihr möglich war, auf das harte Leben vorzubereiten, mit viel Liebe und einer guten Portion Disziplin.
Kaum hatte Großmutter das Licht ausgemacht und unser Zimmer verlassen, plagte mich das schlechte Gewissen. Natürlich wusste ich, dass es nicht in Ordnung war, einen Laden auszurauben. Aber es war auch nicht in Ordnung, länger zuzusehen, wie Großmutter sich um unseretwillen abkämpfte. Ganz ehrlich, es war mir ein Rätsel, wie sie es überhaupt schaffte, uns durchzubringen. Jeden Monat erhielt sie von der Sozialhilfe einen Scheck über dreihundert Dollar. Und davon überlebten wir. Irgendwie. Meine Geschwister und ich halfen mit, so gut wir konnten. Wir suchten kleine Jobs in der Nachbarschaft, strichen Zäune, mähten Rasen, verteilten Zeitungen, putzten Autos und taten alles, um ein paar Dollar dazuzuverdienen. Es reichte trotzdem hinten und vorne nicht aus. Und damit war jetzt endgültig Schluss! Irgendjemand musste etwas tun. Und ich war schließlich der älteste von uns Kindern. Damit hatte ich auch die größte Verantwortung.
Wir lagen mucksmäuschenstill unter unseren bunt karierten Steppdecken und lauschten den uns wohlvertrauten Geräuschen der Nacht. Aus der Stube im Erdgeschoss erklang leise Gospelmusik. Großmutter war also noch wach, sah vermutlich die unbezahlten Rechnungen durch und fragte sich seufzend, wie sie die bloß begleichen sollte. Von draußen hörte ich den allabendlichen Zoff unserer Nachbarn, die sich anschrien, dass die Fetzen flogen. Ein paar Hunde bellten, und irgendwo in der Ferne ertönte das Martinshorn eines Krankenwagens. Wahrscheinlich war wieder mal jemand niedergestochen oder angeschossen worden. Nichts Außergewöhnliches in Hollygrove, dem Getto von New Orleans, in dem wir lebten. Es war ein Viertel, in welchem ausschließlich Schwarze wohnten. Die Gegend war sehr gefährlich und eine Brutstätte der Kriminalität. Eine Woche in Hollygrove genügte, um jeden anständigen Jungen in einen Gauner zu verwandeln. Und ich lebte doch schon mein ganzes Leben hier. Mit zunehmendem Alter rutschte hier fast jeder auf die schiefe Bahn, und ich war keine Ausnahme.
Meine erste Armbanduhr klaute ich mit zwölf. Ich war immer mit derselben Klicke unterwegs. Nach der Schule streiften wir gemeinsam durch die Straßen und klauten alles, was nicht niet- und nagelfest war. Wir rempelten Passanten an, und bevor sie realisierten, was geschah, hatten wir ihnen ihre Brieftasche oder ihren Schmuck abgenommen. Ich hatte nie ein schlechtes Gewissen dabei. Aber heute Nacht würde ich definitiv eine moralische Grenze überschreiten. Möglicherweise würde ich dafür in der Hölle schmoren. Ziemlich sicher sogar. Egal, sagte ich mir. Wir ziehen das jetzt durch.
»Ich glaube, sie schläft«, flüsterte Tony von oben und riss mich aus meiner Gedankenwelt.
»Na dann los«, flüsterte ich und warf die Bettdecke zurück.
Es war kurz vor Mitternacht, genau wie vermutet. Tony, Kenth, Kwame und ich schlüpften in unsere Kleider und schlichen auf Zehenspitzen aus dem Zimmer. Leise huschten wir hinunter ins Erdgeschoss. Die alte Treppe knarrte verräterisch, aber Großmutter wachte zum Glück nicht davon auf. Der Mond schien auf die Veranda, als wir das Haus verließen. Es war eine sternenklare Nacht. Wir trabten die Straße entlang bis zum Lebensmittelgeschäft an der Ecke. Die Straßenlaterne flimmerte, weit und breit war keiner zu sehen. Eigentlich war Mr Burns, dem der alte Laden gehörte, kein schlechter Mensch und hatte es nicht verdient, von uns ausgeraubt zu werden. Aber darauf konnten wir jetzt keine Rücksicht nehmen. Wir schlichen uns hinter das Geschäft. Neben einer der Mülltonnen fand Tony eine Metallstange, mit der ich die Hintertür ohne großen Kraftaufwand aufbrach.
»Das war ja leicht«, kicherte ich.
Wir gingen in den Laden und schwärmten aus. Jeder schnappte sich einen leeren Kartoffelsack und stopfte ihn mit allerlei Lebensmitteln voll: getrocknete Bohnen, Reis, Brotlaibe, Süßkartoffeln, Nudeln und tonnenweise Sodas. Das Adrenalin schoss mir durch die Adern. Ich hatte Schiss, in flagranti erwischt zu werden, und gleichzeitig lachte ich innerlich über Mr Burns’ Dummheit, den Laden nicht mit einer Alarmanlage gesichert zu haben. In nur wenigen Minuten plünderten wir den Laden, bevor ich zum Abmarsch blies.
»Gute Arbeit«, lobte ich meine Brüder wie ein Einsatzleiter seine Truppe. »Nichts wie weg hier!«
Wir warfen uns die vollen Säcke über die Schulter und rannten nach Hause zurück, wo wir die Beute hastig versteckten. Dann schlüpften wir in unsere Pyjamas und legten uns in unsere Betten, als wäre nichts geschehen. Natürlich war ich viel zu aufgedreht zum Schlafen. Das Grinsen auf meinem Gesicht wollte nicht mehr weggehen. Ich hatte es getan. Ich hatte tatsächlich einen Laden ausgeraubt! Es war ein irres Erfolgsgefühl, so verdreht es auch war, einen Ladendiebstahl als Erfolg zu bezeichnen. Meine Brüder drehten sich unruhig hin und her und fanden ebenfalls keinen Schlaf. Tja, und gerade als ich halbwegs dabei war, ins Reich der Träume abzudriften, schreckte ich wieder hoch: Draußen heulte eine Polizeisirene auf, dann erklang das quietschende Geräusch von bremsenden Reifen unmittelbar vor unserem Haus, und im selben Moment blinkte unser Zimmer wie eine rotblaue Weihnachtsbeleuchtung auf. Meine Brüder und ich schossen in die Höhe. Ich sah aus dem Fenster. Zwei Polizisten stiegen aus dem Wagen und näherten sich dem Haus mit raschen Schritten. Sie verschwanden aus meinem Blickfeld, als sie die Veranda betraten. Doch das Poltern gegen die Haustür war nicht zu überhören.
»Aufmachen! Polizei!«
Meine Brüder und ich sahen uns mit aufgerissenen Augen an.
»Wir sind geliefert!«, flüsterte Kwame. »Was machen wir jetzt?«
»Cool bleiben«, antwortete ich. »Ganz cool bleiben. Tut so, als würdet ihr schlafen.«
»Polizei!«, bellte einer der Beamten. »Machen Sie die Tür auf!«
»Ich komm ja schon!«, drang Großmutters verschlafene Stimme durch die Dielen zu uns hoch.
Mucksmäuschenstill lagen wir in unseren Betten. Die Haustür wurde geöffnet. Wir hörten, wie die Polizisten sich mit Großmutter unterhielten, konnten aber nichts vom Gespräch verstehen. Mir war auf einmal furchtbar heiß. Wie waren sie dahintergekommen? Was hatte uns verraten? Es hatte uns doch niemand gesehen! Gefolgt war uns auch keiner. Waren da vielleicht Kameras im Laden installiert gewesen? Die Treppe knarrte. Unsere Zimmertür wurde aufgerissen und das Licht angeknipst.
»Aufstehen, Jungs!« Großmutters Stimme klang wenig erfreut.
»Was’n los?«, murmelte Tony verschlafen. Wir spielten die Unschuldigen und blinzelten unter unseren Decken hervor. Großmutter stand in Pantoffeln, Nachthäubchen und Morgenmantel in der Tür, die Fäuste in die Seite gestemmt.
»Ihr wisst ganz genau, was los ist. Runter ins Wohnzimmer! Aber etwas flott!«
»Wieso?«, fragte ich und gähnte theatralisch. »Können wir das nicht morgen klären?«
»Ich sagte: Runter ins Wohnzimmer!«
Wir krochen gehorsam aus unseren Betten. Großmutter wartete wie ein Feldweibel neben der Tür, bis wir an ihr vorbeigewatschelt waren. Ich wagte es nicht, sie anzusehen. Doch ich spürte ihren Blick im Nacken, als ich die Treppe hinunterstieg. Unten im Wohnzimmer wurden wir von der Polizei in Empfang genommen. Und von Ladenbesitzer Mr Burns. Er machte eine finstere Miene und musterte uns unter seinen buschigen Augenbrauen verärgert. Da war mir klar, dass wir in echten Schwierigkeiten steckten.
»Ist es wahr?«, richtete Großmutter das Wort an uns. »Habt ihr Mr Burns’ Laden ausgeraubt?«
Keiner von uns brachte den Mund auf. Wir standen mit hängenden Schultern nebeneinander und knabberten an unseren Lippen herum.
»Ein Nachbar hat euch gesehen, als ihr das Geschäft mit vollen Taschen verlassen habt«, klärte uns einer der Cops auf. »Er hat euch eindeutig erkannt. Leugnen hat also keinen Sinn. Wo habt ihr die Sachen versteckt?«
Wir schwiegen beharrlich.
»Dürfen wir uns im Haus umsehen, Ma’am?«
»Nur zu«, gab ihnen Großmutter die Erlaubnis.
Die Polizisten machten sich auf die Suche und wurden sehr schnell fündig. Das Diebesgut war überall verteilt, in den Schränken, unter unseren Betten, unterm Sofa. Leugnen hatte in der Tat keinen Zweck. Der aufgetürmte Berg von Esswaren zu unseren Füßen wurde immer größer, während wir immer weiter in uns zusammenschrumpften. Es war eine dumme Idee gewesen, einen Laden auszurauben, um unsere Vorräte aufzustocken, eine wirklich dumme. Das sah ich mittlerweile ein, wenn auch etwas spät.
»Was habt ihr euch nur dabei gedacht?«, fragte Großmutter aufgebracht. »Was um alles in der Welt ist in euch gefahren? Hab ich euch nicht stets gelehrt, das Richtige zu tun? Hab ich das nicht?!«
»Doch, Großmutter«, grummelten wir beschämt.
»Warum tut ihr dann so was? Sieh mich an, Robert!« Großmutter stand direkt vor mir. Ich hob zögerlich das Kinn und zwang mich zu einem kurzen Blickkontakt, bevor ich meine Augen rasch abwandte. Meine Schuldgefühle waren viel zu groß, als dass ich Großmutters Blick länger hätte standhalten können.
»Du bist der Älteste. Du solltest deinen jüngeren Brüdern ein Vorbild sein, Robert! Kwame ist erst elf! Ich kann einfach nicht glauben, dass du sie da mit hineingezogen hast.«
Ich presste die Lippen aufeinander und brachte keinen Ton heraus.
»So hab ich euch nicht erzogen, so nicht«, sagte Großmutter, und die Enttäuschung in ihrem Tonfall war fast noch schwerer zu ertragen als meine Gewissensbisse.
»Mr Burns, wie möchten Sie die Sache regeln?«, fragte einer der Beamten den Ladenbesitzer. »Möchten Sie Strafanzeige erstatten?«
Ich schielte ängstlich zu Mr Burns hinüber. Bestimmt würde er uns nicht einfach so davonkommen lassen. Bestimmt wollte er, dass wir so hart wie möglich bestraft werden für unsere Tat. Ich sah uns schon in Handschellen abgeführt werden und die Nacht in einer Zelle verbringen. Aber zu unser aller Überraschung ließ der Mann Gnade walten.
»Ich glaube, die Jungs haben ihre Lektion gelernt. Es reicht mir, wenn ich alle meine Ware zurückerhalte«, sagte er, worauf Großmutter ihm versicherte:
»Ich kümmere mich persönlich darum, Mr Burns. Gleich morgen früh bringen die Kinder eigenhändig alles zurück, was sie gestohlen haben.« Ihr Nachthäubchen wackelte auf ihrem Kopf, als sie mit einem Seitenblick auf uns energisch hinzufügte: »Ich versichere Ihnen, dass so etwas nie wieder vorkommen wird.«
Ich hatte so eine Ahnung, was sie damit andeutete. Wir waren schon für weniger mit dem Teppichklopfer verdroschen worden. Nun, eine Tracht Prügel von Großmutter einzukassieren, war immer noch besser, als ins Gefängnis zu kommen. Eigentlich hatten wir noch einmal Glück gehabt. Die Polizisten fertigten ein Protokoll an, welches Großmutter und Mr Burns unterschrieben. Dann verließen die Cops und Mr Burns das Haus. Ich sah, dass sich draußen trotz später Stunde ein paar Schaulustige angesammelt hatten. Bei dem blinkenden Polizeiauto vor unserer Tür war das kein Wunder. Großmutter musste die ganze Geschichte furchtbar unangenehm sein. Ich wartete darauf, eine weitere Moralpredigt von ihr zu hören, bevor der Teppichklopfer zum Einsatz kam. Doch stattdessen meinte Großmutter nur: »Wir unterhalten uns morgen«, und scheuchte uns mit einer wedelnden Handbewegung zurück auf unser Zimmer. Unnötig zu erwähnen, dass meine Brüder und ich die restliche Nacht kaum ein Auge zubrachten.
Der gefürchtete Morgen kam und damit der Zeitpunkt, die Konsequenzen für unsere Tat zu tragen. Es hatte sich bereits in der ganzen Nachbarschaft herumgesprochen, was wir getan hatten. Es war Samstag. Das bedeutete, dass die meisten zu Hause waren und sich das Leben im Vorgarten oder auf der Straße abspielte. Das wiederum bedeutete, dass alle sehen konnten, wie meine drei Brüder und ich mit dem Diebesgut das Haus verließen, um es seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzubringen. War das vielleicht peinlich. Großmutter dirigierte uns von der Veranda aus mit lauter Stimme die Straße hinunter. Die Nachbarn reckten neugierig ihre Köpfe. Von überall kamen sie aus den Häusern und Hinterhöfen, um der ungewöhnlichen Parade beizuwohnen. Unsere Schulkameraden standen am Straßenrand, lachten sich die Bäuche voll und rissen dumme Witze über unsere Unfähigkeit, einen Laden auszurauben.
Und als wären wir nicht schon genug bestraft gewesen, ließ sich Großmutter noch eine weitere Demütigung für uns einfallen. Kaum waren wir zurück von unserem öffentlichen Strafmarsch, musste sich jeder von uns eines ihrer Kleider anziehen und sich damit auf die Veranda setzen. Mehrere Stunden mussten wir dort sitzen bleiben, gekleidet wie vier alte Damen, und das Gespött der Leute ertragen. Ich schämte mich in Grund und Boden. Lieber hätte ich hundert Hiebe mit dem Teppichklopfer erhalten, als in aller Öffentlichkeit Großmutters Kleid zu tragen.
Ja, Großmutter wusste, wie sie uns unsere Flausen aus dem Kopf treiben konnte. Meine Brüder hatten ihre Lektion jedenfalls gelernt und schworen sich, nie wieder etwas zu stehlen. Auch ich hatte meine Lektion gelernt – und schwor mir, mich nie wieder beim Stehlen erwischen zu lassen.
2.
EINMAL EIN GAUNER, IMMER EIN GAUNER
New Orleans, Louisiana. 1974.
Seit jenem Ladendiebstahl waren vier Jahre vergangen. Ich war jetzt neunzehn Jahre alt, hatte meinen Schulabschluss in der Tasche und fragte mich ernsthaft, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Mir war klar, dass ich nicht ewig bei Großmutter im Getto leben wollte. Hollygrove war kein guter Ort zum Leben. Dieser Ort war es, der mich über die Jahre hinweg in einen Gauner verwandelt hatte. Großmutter hatte natürlich keine Ahnung davon. Wenn ich ihr Woche für Woche Geld zusteckte, um die dreihundert Dollar vom Sozialamt zu strecken, sagte ich ihr nie die Wahrheit. Ich ließ sie im Glauben, dass ich das Geld wie meine Geschwister durch kleine – und selbstverständlich ehrliche! – Gelegenheitsjobs verdient hatte. In Wirklichkeit hatte ich mich in den vergangenen Jahren vom Taschendieb hochgearbeitet und mich auf Autodiebstahl spezialisiert. Ein guter Kumpel von mir hatte mir alles beigebracht, was ich wissen musste. Ich knackte jedes Auto problemlos in wenigen Sekunden, schloss die Kabel kurz und machte mich mit dem geklauten Wagen aus dem Staub, ehe jemand Verdacht schöpfte. Dann zerlegte ich es in einer Werkstatt und verkaufte die Einzelteile. Es war ein sehr lukratives Geschäft. Ich brauchte gerade mal fünf Stunden, um ein Auto zu klauen, komplett auseinanderzuschrauben und zu verticken. Dabei machte ich pro Auto einen Gewinn von mindestens fünfhundert Dollar. Das war eine Menge Kohle im Jahr 1975.
Natürlich war es falsch, was ich da machte. Ich sollte das Richtige tun, so wie Großmutter es uns von klein auf eingetrichtert hatte. Ich sollte etwas aus meinem Leben machen, etwas Edles, Gutes. Aber was? Die Optionen für einen zwanzigjährigen Schwarzen aus dem Getto waren nicht gerade groß. Sehr viele in meinem Alter schlugen eine kriminelle Laufbahn ein. Es war nun mal schwer, in einem Viertel wie Hollygrove gegen den Strom zu schwimmen und sauber zu bleiben. Diejenigen, die das geschafft hatten, konnte man an einer Hand abzählen. Abgesehen von Großmutter kannte ich gerade mal eine Familie, die im wahrsten Sinne des Wortes auf der richtigen Seite des Gesetzes stand: die Franklins. Sie waren alle Cops – die Mutter, der Vater und auch ihre beiden Söhne Jonny und Nathan. Sie waren vor zwei Jahren in das Haus neben uns eingezogen, nachdem unser Nachbar seine Frau bei einem heftigen Streit beinahe zu Tode geprügelt hatte und verhaftet worden war. Ein paar Monate später war das Haus zwangsversteigert worden, und die Franklins waren eingezogen.
Ich freundete mich ziemlich schnell mit Johnny und Nathan an. Die beiden waren in meinem Alter und konnten mich ebenfalls gut leiden. Häufig, wenn sie von der Arbeit kamen, ging ich rüber zu ihnen. Wir setzten uns auf die Veranda, aßen Kekse, tranken Eistee und plauderten bis spät in die Nacht hinein. Selbstverständlich ließ ich sie im Glauben, dass ich einer der wenigen Kerle im Getto wäre, der keine krummen Dinger drehte. Ich wäre auch schön blöd gewesen, einer Cop-Familie unter die Nase zu reiben, dass ich Autos klaute.
Johnny und Nathan waren mit Abstand die aufrichtigsten Jungs, die ich jemals getroffen hatte. Egal, worüber wir sprachen, am Ende landeten wir immer beim selben Thema: wie dieser Welt die Ehrlichkeit und Gerechtigkeit abhandengekommen war. An einem Abend setzten die Burschen aber noch einen drauf.
»Mensch, Robert, macht es dich denn nicht wütend, dass scheinbar jeder, der im Getto geboren ist, irgendwann auf die schiefe Bahn gerät?«, leitete Johnny das Thema ein.
Ich zuckte die Achseln. »Ihr wisst doch, wie das läuft. Die Jugendlichen haben keine Perspektive. Die Schulbildung ist mies, die Jobangebote sind mieser, die Bezahlung am miesesten. Ist nur logisch, dass sie sich früher oder später nach einer Alternative umsehen. Schnelles Geld ist eben verlockend.«
»Du hast der Verlockung doch auch widerstanden.«
»Stimmt«, log ich. »Ich hatte aber auch Großmutter, die mit Adleraugen über uns gewacht hat, damit wir nicht vom rechten Weg abkommen.« Das war ausnahmsweise nicht gelogen.
»Schon klar, dass nicht jeder in einem behüteten Zuhause aufwächst«, meldete sich Nathan zu Wort. »Aber ein schlechtes Zuhause ist keine Entschuldigung dafür, kriminell zu werden. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Jeder weiß, was richtig und was falsch ist. Und jeder wünscht sich eine gerechtere Welt. Trotzdem setzen sich die wenigsten dafür ein.«
»Bist du deswegen Polizist geworden?«, fragte ich.
Nathan nickte und unterstrich seine Aussage mit ausgestreckten Zeigefingern. »Ich sag dir eins, Robert: Ich trage meine Uniform mit Stolz. Jeden Tag kann ich dazu beitragen, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Jeden Tag kann ich dafür sorgen, dass die Straßen ein wenig sicherer werden, dass Menschen Gerechtigkeit widerfährt, dass Verbrechen gesühnt werden. Jeden Tag setze ich mich dafür ein, Menschen zu helfen. Ich meine, wo findet man heutzutage noch wahre Helden?«
Ich lachte. »Jetzt übertreib mal nicht. Cops sind auch nur Menschen. Im echten Leben gibt es keine Superhelden.«
»Oh doch, die gibt es«, rechtfertigte sich Nathan. »Und sie riskieren jeden Tag ihr Leben da draußen.«
»Warum hassen euch dann alle?«, fragte ich. »In Hollygrove gibt es jedenfalls keinen, der Cops mag, keinen einzigen.«
»Na klar mögen sie uns nicht. Weil sie auf der dunklen Seite stehen.«
»Cops stehen genauso auf der dunklen Seite«, warf ich ein. »Vielleicht mit Ausnahme von euch beiden. Aber ihr wisst doch, was man über euch sagt: der einzige Unterschied zwischen einem Gangster und einem Cop ist, dass der Cop neben seiner Waffe noch eine Dienstmarke trägt.«
Diese Bemerkung hätte ich mir besser verkneifen sollen. Johnny und Nathan waren mit Leib und Seele Polizisten. Ein Angriff auf ihre Berufsethik kam einer Kriegserklärung gleich. Dementsprechend musste ich mir nun einen zehnminütigen Vortrag über Moral, Recht und Verantwortung anhören, und dass ich keine Ahnung hätte, welchen Gefahren sie sich Tag für Tag aussetzten, um die Bürger von New Orleans zu schützen. Als sie fertig waren, hob ich abwehrend die Hände.
»Okay, okay. Ich sage ja nicht, dass es stimmt, was man hier über Cops sagt. Aber wenn man wie ich in Hollygrove aufwächst, hört man nur wenig Gutes über euch – ich meine, nicht euch persönlich, aber euch Gesetzeshüter. Alle erzählen bloß, wie korrupt die Bullen sind und wie sie das Gesetz verdrehen. Cops sind das Feindbild Nummer eins in Hollygrove. Deswegen wohnen doch keine Cops hier – außer euch. Was ich offen gesagt nie ganz verstanden habe.«
»Zumindest ist unser Haus das einzige in der Gegend, das noch nie ausgeraubt worden ist«, grinste Nathan.
Ich kicherte und schnappte mir einen Keks. Johnny fügte hinzu: »Das mit der Korruption ist natürlich schon wahr. Es gibt viel zu viele Polizisten, die bestechlich sind. Eine Dienstmarke zu tragen, ist eine ernste Verpflichtung den Menschen dieser Stadt gegenüber. Diese Macht zu missbrauchen, ist inakzeptabel. Ich könnte so was niemals mit meinem Gewissen vereinbaren.«
»Ich auch nicht«, sagte Nathan.
»Es sollte mehr von eurer Sorte geben«, meinte ich knabbernd. »Vielleicht würde sich dann wirklich etwas ändern.«
»Du kannst uns ja dabei helfen«, sagte Johnny.
»Ich? Wie denn?«
»Indem du Polizist wirst.«
Ich hörte auf zu kauen und sah Johnny an, als käme er vom Mond. Dann prustete ich los.
»Ich? Polizist? Bist du irre?«
»Nein, im Ernst«, fuhr Johnny fort und rutschte in seinem Sessel nach vorne. »Du sagst doch selbst immer, du würdest gerne mehr aus deinem Leben machen. Etwas tun, was von Bedeutung ist. Warum also nicht Cop werden? Bist du schon zwanzig?«
»Nächsten Februar.«
»Dann kannst du im Februar einsteigen. Ich glaube, du wärst ein großartiger Cop.«
»Bestimmt«, lachte ich. »Zumindest bei einer Verfolgungsjagd hätten Banditen keine Chance. Ich bin schnell wie der Wind.«
Das war ich wirklich. Wenn es etwas gab, was ich als Dieb gelernt hatte, dann war es, sehr schnell zu rennen.
»Siehst du?«, sagte Johnny. »Du bist sportlich, du bist clever, du nimmst keine Drogen, du stiehlst nicht …«
Ich lachte noch mehr, während Johnny fortfuhr: »Und du hast eine gute Beobachtungsgabe. Das ist sehr nützlich bei der Polizei.«
Ich war tatsächlich ein guter Beobachter. War ich schon immer gewesen. Ich liebte es, Menschen zu beobachten und Schlüsse daraus zu ziehen: Wer sie waren, in welchen Kreisen sie verkehrten, womit sie ihr Geld verdienten und ob sie ein Geheimnis verbargen. Ich war gut darin, Menschen anhand ihrer Körpersprache, ihrer Kleidung und ihres Auftretens einzuschätzen. Jedes Detail fiel mir auf. Gingen sie gebückt oder aufrecht? Trugen sie polierte Lackschuhe oder abgenutzte Stiefel? Mieden sie den Blickkontakt? Gab es irgendwelche Ungereimtheiten? Trugen sie zum Beispiel eine teure Armbanduhr am Handgelenk, aber ein billiges Jackett dazu? Ich hatte ein Auge für Dinge, die nicht zusammenpassten. Betrüger konnte ich aus der Menge herausfiltern, ohne auch nur einmal mit ihnen gesprochen zu haben. Ich wusste auf einen Blick, ob jemand gefährlich oder harmlos war, vertrauenswürdig oder hinterlistig. Mir machte keiner so schnell etwas vor. Johnny und Nathan hatten recht: So etwas konnte bei Befragungen oder der Suche nach einem Verdächtigen durchaus hilfreich sein.
»Ich wette, du kämst Verbrechern schneller auf die Spur als so mancher erfahrene Cop«, sagte Johnny, und Nathan ergänzte eifrig:
»Vielleicht würden wir mit deiner Hilfe endlich mal diesen berüchtigten Autodieb schnappen, der in Hollygrove sein Unwesen treibt.«
Ich spitzte die Ohren. »Was für ein Autodieb?«
»Na, dieser Typ, der in der Gegend ständig Autos klaut«, antwortete Nathan. »Obwohl ich ja eher vermute, dass es eine ganze Bande ist. Sind echt viele Autos, die verschwinden.«
»Ach, ist ja übel«, log ich und schüttelte gespielt betroffen den Kopf. »Habt ihr irgendeinen Verdacht, wer dahintersteckt?«
»Nein. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte«, schüttelte Johnny den Kopf.
»Du weißt auch nichts, oder?«, fragte Nathan.
»Ich? Nö«, leugnete ich und musste mich zusammenreißen, um nicht loszubrüllen. »Vielleicht lebt er ja mitten unter uns. Vielleicht begegnen wir ihm jeden Tag, ohne es zu wissen?«
»Schon möglich«, sagte Nathan. »Aber irgendwann finden wir ihn. Irgendwann macht er einen Fehler. Ist nur eine Frage der Zeit.«
»Siehst du, und genau deswegen musst du Polizist werden«, schlug Johnny den Bogen zurück zum Beginn des Gesprächs. »Um Kerle wie ihn hinter Gitter zu bringen. Um etwas zu verändern, um den Leuten zu zeigen, dass sich Verbrechen nicht lohnt und am Ende die Gerechtigkeit siegt! Denk drüber nach, Robert. Du könntest echt etwas bewirken.«
Ich grinste. »Wenn du das sagst.«
»Ich meine es ernst«, sagte Johnny und sah mich dabei direkt an. »Du willst etwas Nobles aus deinem Leben machen? Dann rede nicht nur davon, sondern tu es. Bewirb dich an der Polizeischule. Wir brauchen Leute wie dich.«
Seine Worte hallten in meinem Kopf wider, als ich an diesem Abend nach Hause ging. Ich und Polizist. Es war einfach zu absurd. Vor allem, wenn man bedachte, wie ich mein Geld verdiente. Die Brüder hatten ja keine Ahnung, dass ich der mysteriöse Autodieb war, den sie so gerne geschnappt hätten. Sie hatten ja keine Ahnung, dass meine Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit immer nur solange währte, wie ich mit ihnen auf der Veranda saß. Brach der nächste Tag an, verwandelte ich mich zurück in den Gauner, der ich eigentlich war.
In den nächsten Wochen und Monaten redeten Nathan und Johnny jeden Abend unermüdlich auf mich ein. Ich wusste nicht, was sie in mir sahen: Doch sie glaubten wirklich, ich hätte das Zeug zu einem hervorragenden Polizisten. Und je länger sie davon sprachen, desto mehr sprang ihre Begeisterung auf mich über. Warum eigentlich nicht, überlegte ich eines Abends. Ja, ich war ein Gangster. Aber war das wirklich alles? Steckte nicht noch mehr in mir? Konnte ich nicht wenigstens versuchen, mein Leben umzukrempeln und etwas aus mir zu machen? Diesen edlen Kern, an den meine Großmutter und offenbar auch Nathan und Johnny glaubten, wieder aus mir hervorzuholen? Vielleicht sollte ich mich einfach bewerben. Was hatte ich schon zu verlieren? Wenn ich die Tests nicht bestand, konnte ich ja weiterhin Autos klauen.
Eines Abends nahm ich all meinen Mut zusammen und erzählte Großmutter von meinem Plan. Sie begann hysterisch zu lachen. Sie lachte so stark, dass ihr die Tränen kamen. Nachdem sie sich endlich wieder beruhigt hatte, sah sie mich an und meinte:
»Bitte entschuldige. Aber auf diese Berufswahl wäre ich im Leben nicht gekommen. Hast du dir das denn gut überlegt?«
»Ich denke schon«, erwiderte ich. »Nathan und Johnny sind auch der Meinung, ich sollte es probieren. Wer nichts wagt, gewinnt nichts.«
»Da hast du natürlich recht, Robert«, stimmte mir Großmutter zu und fasste mich am Arm. »Wenn es wirklich dein Wunsch ist, Polizist zu werden, dann werde ich dich selbstverständlich dabei unterstützen.«
»Danke, Großmutter.«
»Was sind denn die Voraussetzungen?«
»Ich muss mindestens zwanzig Jahre alt sein, brauche einen Highschool-Abschluss und einen Führerschein.«
»Das ist alles?«
»Ja. Und natürlich muss ich verschiedene Prüfungen bestehen, um überhaupt an die Polizeischule zu kommen.«
»Die bestehst du bestimmt«, versicherte Großmutter. »Du bist ein intelligenter Bursche. Du schaffst das.«
Ich war mir da nicht ganz so sicher. Vor allem vor dem psychologischen Test graute mir, denn laut Nathan und Johnny war dieser Test einzig und allein dazu da, die Spreu vom Weizen zu trennen, damit keine Drogenabhängige, Kriminelle oder irgendwelche Schwachköpfe in den Polizeidienst eintraten. Doch da musste ich wohl oder übel durch. Nathan und Johnny halfen mir, das Anmeldeformular auszufüllen, und ein paar Wochen später fanden die Prüfungen statt.
Die erste Prüfung war eine schriftliche, die das Allgemeinwissen der Bewerber testete. Ein Klacks. Am Tag darauf fand der Fitnesstest statt, der ebenfalls kein Problem für mich war. Ich liebte Sport. Im Hundert-Meter-Sprint ließ ich alle Mitbewerber weit hinter mir zurück. Ich stellte mir einfach vor, ich hätte eine Handtasche geklaut und müsste um mein Leben laufen. Der Polizeibeamte, der mich prüfte, war beeindruckt.
Als dritte und letzte Prüfung stand der psychologische Test an. Noch nie war ich in meinem Leben so nervös gewesen. Als mein Name aufgerufen wurde, betrat ich ein schlichtes Zimmer, das einem Verhörraum glich. Ein Polizeipsychologe mit schwarz umrandeter Brille saß an einem Tisch, bewaffnet mit einem Fragebogen und einem Stift. Er bat mich, am anderen Tischende Platz zu nehmen. Kaum hatte ich mich gesetzt, begann er unverzüglich mit der Befragung. Ich war auf raffinierte Fangfragen gefasst, die mich ins Schwitzen bringen und als Kleinganove und Dieb entlarven würden. Aber die Fragen, die ich beantworten musste, waren zu meiner Überraschung völlig harmlos. Manche waren regelrecht bescheuert. Der Psychologe fragte mich allen Ernstes:
»Haben Sie je etwas gestohlen?«
Ich sah ihn an, als wäre er nicht bei Trost. Welcher Idiot würde auf so eine Frage auch mit »Ja« antworten? Natürlich sagte ich, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, »Nein«. Im Lügen war ich schließlich mindestens so gut wie im Rennen. In meiner verdrehten Art zu denken war ich sogar davon überzeugt, die volle Wahrheit zu sagen. Ich redete mir ein, ich hätte sogar einen Lügendetektortest bestehen können. Aus »Haben Sie je etwas gestohlen?« wurde in meiner freien Interpretation nämlich eher so etwas wie: »Haben Sie in genau diesem Moment vor, etwas zu stehlen?« Und das konnte ich aus voller Überzeugung verneinen. Mein letzter Autodiebstahl lag noch keine fünf Stunden zurück, aber danach hatte er ja nicht gefragt. Ich war in diesem Augenblick ein absolut unbescholtener Bürger und hegte keinerlei kriminelle Absichten – zumindest nicht, seitdem der Psychologe mich ins Kreuzverhör genommen hatte. Ich hatte eine makellos reine Weste.
Eigentlich hatte ich die Prüfungen nur gemacht, um zu sehen, wie weit ich käme. Ich glaubte nicht daran, dass ich sie wirklich bestehen würde. Doch ich bestand sie! Ich erhielt ein offizielles Schreiben, welches mir mitteilte, dass ich mich für die Polizeischule von New Orleans qualifiziert hätte und mich für den nächsten Studiengang einschreiben dürfte. Damit hätte ich nicht die Bohne gerechnet. Alle beglückwünschten mich: meine Geschwister, meine Großmutter und natürlich Nathan und Johnny. Sie freuten sich noch mehr als ich selbst.
»Mann, Robert!«, rief Nathan und umarmte mich stürmisch. »Gratuliere! Jetzt noch sechsundzwanzig Wochen Polizeischule, und du bist einer von uns!«
»Ich bin so stolz auf dich«, sagte Großmutter. »Wann beginnt die Schule?«
»In einem Monat«, antwortete ich und kaute verlegen auf meiner Unterlippe herum. »Denkst du, ich tu das Richtige, Großmutter?«
Großmutter gab mir einen Klaps und sah mich streng an. »Robert, sei nicht dumm. Das ist deine Gelegenheit, das Getto zu verlassen und auf eigenen Füßen zu stehen. Nutze sie! Und hör endlich auf, an dir zu zweifeln, mein Junge!«
»Aber was, wenn ich der Aufgabe nicht gewachsen bin?«
»Du bist jeder Aufgabe gewachsen. Mit Fleiß und Gott im Herzen gibt es nichts, was du nicht erreichen kannst. Du wirst ein ganz hervorragender Polizist, Robert, glaub mir.«
Wenn ich ehrlich war, beschämte es mich, wie viel Hoffnung alle in mich setzten. Sie hielten mich für einen guten Menschen. Doch eben das war ich nicht. Ich war ein Dieb und ein Schwindler. Ich konnte Nathan und Johnny nicht das Wasser reichen. Jemand wie ich sollte nicht Polizist werden.
In den nächsten Wochen focht ich einen inneren Kampf mit mir aus. Ich begann sogar – nach strikter Anweisung meiner Großmutter – jeden Tag in der Bibel zu lesen und Gott zu fragen, was er von der Sache hielt. Sollte ich es tatsächlich wagen? Sollte ich die Chance packen? Hatte ich diese Chance überhaupt verdient? Konnte jemand wie ich rehabilitiert werden? Oder war es so, wie alle sagten: Einmal ein Gauner, immer ein Gauner? Ich sehnte mich ja nach einem Ausweg aus meinem Ganovenleben. Ich wünschte mir, ich könnte von der dunklen auf die helle Seite wechseln. Es fühlte sich edel an, Polizist zu werden, ganz anders, als wenn ich Autos klaute. Tatsache war doch, dass ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich ein Auto aufbrach. Es lag nicht einmal daran, dass Großmutters Haus voller Bibelsprüche, Kreuze, Jesus- und Engelfiguren war. Ich wusste auch so, dass es falsch war, was ich tat. Ich hatte nur nie eine Alternative gesehen. Bis jetzt.
Je länger ich darüber nachdachte, desto mehr kam ich zum Schluss, dass ich die Chance ergreifen sollte. Entgegen jeder Logik hatte ich die Prüfungen bestanden. Die Tür zur Polizeiakademie stand mir offen. Warum also nicht eintreten? Eine Chance wie diese würde ich wahrscheinlich kein zweites Mal bekommen. Egal, wie unehrenhaft ich mich bis jetzt durchs Leben gemausert hatte: Vielleicht war dieser Berufswechsel genau das, was ich brauchte, um noch mal ganz von vorne anzufangen.
Also gut, sagte ich mir schließlich. Ich tu’s. Ich werde Polizist. Ich werde mein Leben umkrempeln. Ich kann das. Ich kann alles erreichen, was ich will.
Einmal ein Gauner, immer ein Gauner? Von wegen. Ich würde der Welt und vor allem mir selbst beweisen, dass jeder sich ändern kann.
Sogar ich.
3.
EIN ROOKIE IN NEW ORLEANS
New Orleans, Louisiana. 1975.
Im Mai 1975 trat ich in die Polizeiakademie von New Orleans ein. Schon am ersten Trainingstag wurde jedem Rekrut eine Polizeiuniform ausgehändigt. Ich hatte sie zu tragen, sobald ich morgens das Haus verließ, bis zu dem Moment, wenn ich abends wieder nach Hause kam. Das war nicht ganz unproblematisch. Wie ein Lauffeuer sprach es sich in Hollygrove herum, dass ich die Seiten gewechselt hatte. Schlagartig wurde ich zum Außenseiter. Alle meine Freunde distanzierten sich von mir. Jeder Drogendealer im Viertel hatte auf einmal Angst davor, von mir verpfiffen zu werden.
Mir wurde bald klar, dass es Zeit war, Hollygrove zu verlassen. Also suchte ich mir eine kleine Wohnung außerhalb des Gettos, in einem weniger kriminellen Stadtteil. Alle meine Geschwister halfen mir beim Umzug. Thecla, meine jüngste Schwester – sie war inzwischen acht Jahre alt – fand es überhaupt nicht lustig, dass ich auszog. Bei der letzten Kiste, die sie die schmale Treppe hochtrug und in meiner Wohnung abstellte, sah sie mich mit gequältem Blick an und fragte:
»Bist du ganz sicher, dass du nicht bei uns bleiben willst? Mit wem soll ich denn jetzt Fußball spielen?«
Ich schmunzelte. Thecla hing lieber mit Jungs herum als mit Mädchen. Sie war sehr sportlich und burschikos. Und sie war total vernarrt in mich, ihren ältesten, großen Bruder.
»Tony kann doch mit dir Fußball spielen«, schlug ich vor.
Thecla rümpfte die Nase. »Tony spielt den Ball viel zu hart.«
»Dann nimm Kenth.«
Meine kleine Schwester verdrehte die Augen. »Jimmy Hendrix? Echt jetzt?«
»Und Kwame? Kwame spielt doch ganz ordentlich Fußball.«
»Du bist aber der Einzige, mit dem es Spaß macht«, sagte Thecla, fasste meine beiden Hände und sah mich mit ihren großen Rehaugen flehend an. »Bitte bitte bitte. Zieh nicht aus! Ohne dich wird es total ätzend sein.«
»Ich wohne doch nur eine halbe Stunde weit weg. Wann immer ich frei habe, komme ich euch besuchen.«
»Und dann spielen wir Fußball?«
»Großes Ehrenwort.«
»Na gut.« Meine Schwester hielt mir ihren Zeigefinger unter die Nase. »Aber wehe, du hältst dein Versprechen nicht. Dann kriegst du es mit mir zu tun! Verstanden?«
»Klipp und klar«, grinste ich und schloss Thecla in meine Arme. »Ich werde dich auch vermissen.«
Ich verabschiedete mich von allen und gab jedem meiner Geschwister einen brüderlichen Rat mit auf den Weg. Auch wenn ich nicht ihr Vater war, empfand ich es trotzdem als meine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass alles seinen geregelten Lauf nahm und jeder seinen Teil dazu beitrug, die Familie zusammenzuhalten. Meinem schweigsamen Bruder Tony sagte ich:
»Du bist jetzt der Mann im Haus. Unterstütze Großmutter so gut du kannst.« Kenth und Kwame ermahnte ich dazu, immer ehrlich zu bleiben und die Finger von Drogen zu lassen. Keith, dem Mädchenschwarm in unserer Familie, zwinkerte ich zu:
»Brich nicht zu viele Herzen, Bruderherz.«
Jack trug ich auf, er solle in der Schule besser aufpassen. Die kampflustige Valerie hielt ich an, sich nicht ständig provozieren zu lassen und wenn möglich nicht alles mit Fausthieben zu lösen. Und Vivian übertrug ich die Aufgabe, die andern dazu anzuhalten, nicht alles rumliegen zu lassen und ihre Zimmer aufzuräumen.
Zuletzt stand ich Großmutter gegenüber. Es kam mir vor, als wäre sie über die Jahre hinweg noch kleiner und gebückter geworden. Doch die innere Kraft, die aus ihr herausstrahlte, war ungebrochen. Ich hatte einen tiefen Respekt für diese Frau. Ohne sich auch nur ein einziges Mal zu beklagen, hatte sie uns neun Kinder großgezogen. Sie liebte uns, als wären wir ihre eigenen Kinder. Sie glaubte an uns und sah stets das Gute in uns. Auch in mir. Mit Tränen und Stolz in den Augen blickte sie zu mir hoch.
»Du bist so schnell erwachsen geworden, Robert. Ich habe immer gewusst, dass du es im Leben zu etwas bringen wirst. Jetzt bist du zwanzig Jahre alt, stehst auf deinen eigenen Füßen, hast deine eigene Wohnung und trittst in den Polizeidienst ein. Ich könnte mir nichts Besseres für dich vorstellen.«
»Das verdanke ich zum größten Teil dir, Großmutter. Danke für alles.«
Ich umarmte sie. Sie klopfte mit ihrer runzligen Hand auf meine Brust und flüsterte: »Und denk dran, mein Junge: Tu stets das Richtige.«
»Das werde ich, Großmutter. Das werde ich.«
Sie löste sich aus meiner Umarmung und wischte sich über die feuchten Augen.
»Jetzt geh und rette die Welt, mein Champion!«
Die Ausbildung an der Polizeischule machte mir großen Spaß. Es war ein tolles Gefühl, endlich ein Ziel vor Augen zu haben. Ich liebte die Herausforderung und gab in jedem Fach mein Allerbestes. Wenn ich schon Polizist wurde, dann wollte ich der Beste sein. Mit weniger gab ich mich nicht zufrieden.
Unsere Lehrer waren leidenschaftliche Cops, genau wie Nathan und Johnny. Außerdem waren sie lebenserfahren und wussten, wovon sie sprachen. Ihr Ziel war es, uns so gut wie irgend möglich auf die unterschiedlichsten Situationen auf der Straße vorzubereiten. Wir hatten Unterricht im Klassenzimmer und paukten dort das Verfassungsrecht, die Bürgerrechte, die staatlichen Gesetze und die örtlichen Verordnungen. Dazu gab es natürlich auch viel Praxis. Wir erhielten Schießunterricht, Kurse in Selbstverteidigung und Erster Hilfe. Wir lernten, wie man den Verkehr regelt, wie man einen Notruf entgegennimmt, Zeugen befragt, sich bei einem Unfall verhält und Personen festnimmt. Bei folgenden Situationen wurde uns eingeschärft, stets einen Vorgesetzten zu Hilfe zu rufen: Im Falle einer Schießerei, wenn der Verdächtige eine Waffe besaß, bei jedem Verkehrsunfall mit lebensgefährlichen Verletzten, wenn Dienstwagen in den Unfall verwickelt waren sowie bei Festnahmen, bei denen der Verdächtige sich der Verhaftung widersetzte. Was unsere Berufsethik anbelangte, wurde von uns erwartet, stets pünktlich zum Dienst zu erscheinen, während des Dienstes keinen Alkohol zu trinken, uns Zivilisten gegenüber höflich und anständig zu benehmen, jedem, der danach fragte, unseren Namen und die Nummer unserer Dienstmarke anzugeben und von niemandem Geld, Geschenke oder irgendeine Entschädigung für die erbrachten Leistungen anzunehmen.
Am meisten liebte ich die körperlichen Aktivitäten. Unser Sporttrainer drillte uns wie Soldaten im Laufen und Klettern. Als Polizisten mussten wir fit sein, um Kriminelle zu jagen. Ich fand es toll. Und ich war gut. So gut, dass ich die Polizeiakademie Mitte November mit einer Ehrenauszeichnung in körperlicher Fitness abschloss. Dies war unter Rekruten eine besonders begehrte Auszeichnung, denn es bedeutete, dass man gute Chancen hatte, später einmal in eine Spezialeinheit hineinzukommen, wie zum Beispiel das SWAT-Team.
Ende des Jahres war ich also offiziell ein Cop. Zwar noch ein Rookie, ein blutiger Anfänger, aber trotzdem ein Cop. Und ich brannte darauf, mein Wissen und mein Talent in die Tat umzusetzen. Ich wurde einem der schlimmsten Stadtteile New Orleans’ zugeteilt, dem fünften Distrikt. Die Leute hier lebten nicht in Gettos, sondern in Super-Gettos. Gegen den fünften Distrikt war Hollygrove ein Kinderspielplatz. Mein Vorgesetzter dachte sich wohl, das wäre genau das richtige Einsatzgebiet für einen preisgekrönten Rekruten wie mich. Mir spielte es ehrlich gesagt keine Rolle, wo ich patrouillierte. Hauptsache, es ging endlich los!
Am Morgen meines ersten Arbeitstages als New Orleaner Cop stand ich früher auf als sonst, um ja nicht zu spät zu kommen. Ich zog meine schwarze und gebügelte Polizeiuniform mit Polizeimütze an, band mir den Hüftgürtel mit meiner Dienstwaffe um und betrachtete mich selbstverliebt in meinem großen Wandschrankspiegel. Meine frisch polierten Schuhe glänzten, meine nagelneue Dienstmarke ebenso. Mann, sah ich scharf aus! Ich übte verschiedene Posen, aufrecht stehend mit gerecktem Kinn, dann locker lässig und schließlich breitbeinig, die Hand griffbereit an der Waffe, der drohenden Gefahr ins Auge blickend. Oh ja, ich war so bereit für diesen Job, wie man es nur sein konnte.
Ich fuhr zur Wache und meldete mich zum Dienst. Es hieß, ich solle warten, mein Partner käme sofort. Ich setzte mich und beobachtete das geschäftige Kommen und Gehen im Eingangsbereich. Mal stürmten Cops eilends an mir vorbei nach draußen, vermutlich, da sie zu einem Einsatz gerufen wurden. Dann wieder schlenderten andere in aller Gemütlichkeit zur Tür herein, plauderten und lachten und schlürften ihren Kaffee. Ständig wurden seltsame Gestalten in Handschellen aufs Revier gebracht. Einige liefen geduckt und sagten kein Wort. Andere fluchten und schimpften und mussten von den begleitenden Cops scharf zurechtgewiesen werden. Für mich als geübter Beobachter war es ein Leichtes, herauszufinden, welche der Beamten alteingesessen und welche noch sehr unerfahren waren. Man erkannte es – abgesehen vom Alter – an ihrer Art zu gehen, daran, wie locker sie sich mit ihren Kollegen unterhielten, und vor allem daran, wie selbstsicher sie auftraten.
»Robert Leon Davis?«
Ich drehte mich um. Ein großer, weißer Beamter um die fünfzig stand vor mir. Er war kräftig gebaut, hatte einen Millimeterhaarschnitt, eine auffällige Narbe über der Nase und strahlte eine Autorität aus, die ziemlich einschüchternd auf mich wirkte.
»Äh ja, Sir?«
»Du bist mir zugeteilt worden, Rookie. Mein Name ist Dean. Dean Morgan.« Der Mann streckte mir seine Pranke entgegen. Ich stand auf und schüttelte sie.
»Sehr erfreut, Sir.«
»Nicht Sir, nenn mich Dean. Schließlich sind wir von jetzt an Partner. Bereit für deinen ersten Tag, Partner?«
»Ich denke schon, ja.«
»Gut. Dann wollen wir mal sehen, was du auf der Akademie gelernt hast.«
Ich folgte meinem Partner nach draußen zu seinem Dienstwagen. Ich nahm auf dem Beifahrersitz Platz, Dean hinter dem Steuer. Er griff nach dem Funkgerät und streckte es mir hin.
»Unser Dienstwagen hat die Nummer zwei-fünf-zwei. Willst du?«
»Äh … ja, gerne«, sagte ich überrascht. Wir hatten an der Schule sämtliche Polizeicodes auswendig lernen müssen. Der Code 207 stand zum Beispiel für Entführung. 211 bedeutete Diebstahl. 245 war der Code für einen Überfall mit einer tödlichen Waffe. Den Code, den die Polizei früher in meinem Fall schon oft verwendet hatte, war 503: Autodiebstahl. Ich kramte in meinem Gedächtnis nach dem Code, der bedeutete, dass wir dienstbereit waren. Dann drückte ich den Sprechknopf und sagte so selbstsicher wie möglich:
»252. Wir sind 10-8.« Es war ein unglaublich gutes Gefühl, die Codesprache endlich selbst anzuwenden.
»Copy, 252. Gute Schicht«, antwortete der Planungsleiter.
»Danke. Ende«, sagte ich und hängte das Funkgerät zurück.
»Und? Bereit, für Recht und Ordnung zu sorgen?«, fragte mich Dean. Ich ließ den Sicherheitsgurt einklicken.
»Oh ja, das bin ich!«
Wir fuhren los. Ich war aufgeregt und spielte in Gedanken alle möglichen Szenarien durch, die uns passieren könnten. Ich sah mich eine Tür eintreten, »NOPD!« schreien und einen völlig überraschten Drogendealer mit meiner Waffe in Schach halten, während mein Partner sein Haus nach Drogen durchsuchte. Ich sah mich mit gezückter Pistole in ein Geschäft stürmen, das gerade überfallen wurde. Ich stellte mir ein paar coole Schießereien in irgendeiner verlassenen Lagerhalle vor und wilde Verfolgungsjagden durch die Straßen von New Orleans. Und ich sah, wie ich einem seit Jahren flüchtigen Verbrecher Handschellen anlegte und ihn zu unserem Wagen eskortierte, während ich die Presse mit der Hand abschirmte. Die Kriminellen sollten sich besser in Acht nehmen. Denn hier kam Robert Leon Davis, um sie zu jagen, zu verhaften und für den Rest ihres Lebens hinter Gitter zu bringen.
Die ersten Stunden auf Streife waren allerdings enttäuschend ereignislos. Es gab keinen Überfall, keine Verfolgungsjagd mit Blaulicht, keine Festnahme, rein gar nichts. Nicht mal einen Verkehrsunfall.
»Tagsüber ist es relativ ruhig«, erklärte mir Dean. »Aber nachts ist hier die Hölle los.«
»Genau wie in Hollygrove«, sagte ich. »Ich bin dort aufgewachsen.«
»Dann kennst du dich ja bestens aus mit dem Abschaum der Gesellschaft«, meinte Dean. »Aber eins lass dir gesagt sein, Rookie: Wenn du glaubst, du hättest schon alles gesehen, nur, weil du im Getto aufgewachsen bist, täuschst du dich gewaltig. Hier wirst du mit Situationen konfrontiert, bei denen dich das nackte Grauen packt. Du wirst nicht glauben, wozu Menschen fähig sind.«
Ich wusste nicht genau, was ich darauf antworten sollte, und stellte Dean stattdessen eine Frage. »Wie lange bist du schon Polizist?«
»Fünfundzwanzig Jahre«, sagte Dean. »Nächstes Jahr werde ich pensioniert. Meine Frau kann es kaum erwarten. Ist nicht leicht, mit einem Cop verheiratet zu sein. Jeden Tag hat sie Angst, dass mir bei einem Einsatz etwas zustößt und ich abends nicht mehr nach Hause komme.«
»Hast du auch Angst davor?«
Dean lachte. Es war ein bitteres Lachen. »Wir Cops können uns keine Angst leisten, Robert. Ich habe gelernt, sie auszublenden. Gewisse Dinge musst du bei diesem Job einfach ignorieren, sonst fressen sie dich innerlich auf. Es gibt Polizisten, die Selbstmord begehen, weil sie nicht mehr damit klarkommen, was sie Tag für Tag beim Streifendienst erleben.«
»Wirklich?«
»Der Preis, diese Uniform zu tragen, ist hoch. Für einige zu hoch. Täglich wird von uns erwartet, übermenschlich stark und tapfer zu sein, Leistungen zu erbringen, die eigentlich für Helden bestimmt sind. Da bricht schon mal einer zusammen, wenn er dem psychischen Druck nicht mehr standhält.« Er sah mich von der Seite an und klopfte mir aufmunternd auf die Schulter.
»Keine Bange, du wirst schon keiner von denen sein, die hinschmeißen. Ich will nur, dass du weißt, was auf dich zukommt. Die Realität ist anders als das, was sie dir in der Polizeischule beibringen. Das wirst du noch früh genug lernen.«
Ich nickte, auch wenn ich der Meinung war, dass unsere Lehrer uns durchaus gut ausgebildet hatten. Ich wusste sehr wohl, worauf ich mich eingelassen hatte und dass es kein Zuckerschlecken sein würde.
Wir drehten bereits unsere dritte Runde, als ein Funkspruch reinkam.
»252, copy?«
Dean nahm das Funkgerät in die Hand.
»Hier spricht 252. Wir hören.«
»Wir haben einen möglichen 216 an der Douglass Street 173. Ein anonymer Anruf. Ihr seid am nächsten dran. Könnt ihr übernehmen?«
»10-4. Sind unterwegs.«
Dean hängte das Funkgerät zurück und schaltete die Sirene ein. Er gab Gas. Die Douglass Street war direkt am Mississippi, wir waren nur zwei Blocks davon entfernt. Mein Herz schlug automatisch schneller. Jetzt wurde es ernst. Meine anfängliche Abenteuerlust wandelte sich in große Unsicherheit. 216 war nicht gerade der Code, den ich mir für meinen ersten Einsatz ausgesucht hätte. Ich hatte keine Ahnung, was uns erwarten würde. Mit quietschenden Reifen hielten wir vor der genannten Adresse. Links von uns floss der gewaltige Mississippi. Ein Flugzeugträger der Marine lag ein paar Hundert Meter weit von uns entfernt vor Anker. Ein paar Verladeschiffe mit schweren Containern schipperten den Fluss hinauf. Möwen segelten durch die Luft. Im Hintergrund war die Silhouette der Hochhäuser von New Orleans zu sehen. Rechts von uns befanden sich ein paar heruntergekommene Wohnblocks sowie mehrere leer stehende Hafengebäude. Der Ort war ungemütlich und wirkte ausgestorben. Und dort, ganz allein, vor einem der Lagerhallen, neben einem Müllberg von rostigen Metallteilen, stand ein kleines, schwarzes Mädchen, vielleicht elf, zwölf Jahre alt, mit zerschlissener Schuluniform und verstörtem Gesicht. Sie rührte sich nicht von der Stelle und stand eindeutig unter Schock. Ganz verkrampft hatte sie ihre Arme um den Bauch geschlungen und wartete, bis wir bei ihr waren. Ich hielt mich etwas zurück und überließ Dean das Reden.
»Alles in Ordnung?«
Das Mädchen nickte.
»Ich bin Officer Dean«, stellte er sich dem Kind vor. »Und das ist mein Partner, Officer Robert. Wie ist dein Name?«
»M- Maggy«, stotterte das Mädchen. Ihre Stimme zitterte. Ich sah, dass sie auch sonst am ganzen Körper zitterte.
»Wie alt bist du?«
»Elf.«
Mich schauerte, als sie ihr Alter nannte. Sie war so alt wie meine Schwester Valerie.
»Willst du uns erzählen, was passiert ist, Maggy?«
Sie nickte. Stockend berichtete sie, wie sie auf dem Weg von der Schule von einem Mann angefallen und in das verlassene Hafengebäude gezerrt worden sei. Dort hätte er sie vergewaltigt. Es fiel ihr schwer, darüber zu sprechen. Die Tränen rollten ihr über die Wangen. In ihren Augen spiegelte sich immer noch die Panik über das schändliche Verbrechen, das ihr angetan worden war.
»Kannst du uns zeigen, wo es passiert ist?«
Maggy führte uns in das leere Gebäude hinter ihr und zeigte uns die Stelle. Ich sah ihr an, wie unwohl ihr dabei war. Sie tat mir furchtbar leid. Ich hätte sie am liebsten in den Arm genommen und getröstet. Beim Gedanken daran, meiner kleinen Schwester wäre dasselbe passiert, wurde mir speiübel. Wie konnte jemand ein wehrloses Kind vergewaltigen? Wie konnte jemand so etwas Schreckliches tun?
»Maggy, ich weiß, das ist nicht leicht für dich. Aber kannst du uns den Mann beschreiben?«, fragte Dean weiter.
Er zeigte sich verständnisvoll, blieb jedoch sehr sachlich und ruhig. Es war mir ein Rätsel, wie er das zustande brachte. In mir drin brodelte es vor Zorn. Maggy beschrieb den Mann, so gut es ihr möglich war, während sich Dean Notizen machte.
»Robert«, sagte er, mir zugewandt. »Verständige unseren Vorgesetzten über die Sachlage und fordere ein kriminaltechnisches Team zur Untersuchung des Tatorts an.«
Ich drückte die Sprechtaste am Funkgerät an meiner Schulter und gab alle nötigen Informationen durch.
»Wissen deine Eltern, dass du hier bist?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Gibst du uns ihre Telefonnummer, damit wir sie anrufen können?«
Sie gab sie uns, und Dean verständigte die Eltern über die Zentrale. Wir blieben so lange bei Maggy, bis ihre Eltern eintrafen, um sie abzuholen. Sie waren bereits informiert, stürmten auf ihre Tochter zu und nahmen sie in den Arm. Jetzt brachen bei dem Mädchen alle Dämme. Es schluchzte laut und herzzerreißend. Ich fragte mich, ob es sich je von diesem Trauma erholen würde. Wenig später waren auch die Kriminaltechniker und Captain Logan Baker, unser Vorgesetzter, vor Ort. Dean setzte sie über alles Nötige in Kenntnis. Dann bedeutete er mir, ihn zum Dienstwagen zurückzubegleiten.
»Wir sind soweit fertig. Den Rest übernehmen die Kollegen. Es fehlt nur noch das Tatort-Protokoll.«
Wir setzten uns ins Auto, und mein Partner reichte mir das Klemmbrett mit dem eingespannten Formular. »Ich will, dass du den Bericht schreibst.«
Ich holte einen Stift aus meiner Brusttasche und wollte zu schreiben beginnen, als meine Hand unkontrolliert zu zittern begann. Ich setzte den Stift erneut an, doch mein Gekritzel erinnerte mehr an die Aufzeichnungen eines Seismografen als an Worte. Ich konnte nichts dagegen tun. Es kam mir vor, als hätte nicht nur das Mädchen einen Schock erlitten, sondern auch ich.
»Hey, Rookie«, sagte Dean. »Sieh mich an.« Ich sah ihn an, beschämt darüber, dass ich nicht mal in der Lage war, einen simplen Rapport zu verfassen.
»Du darfst dich da nicht emotional mit hineinziehen lassen, oder du hältst keine Woche durch. Das Mädchen wurde vergewaltigt. Ja, das ist schlimm. Und nein, daran können wir nichts mehr ändern. Das Einzige, was wir tun können, ist zu versuchen, den Täter zu schnappen und ihn für immer wegzusperren. Das ist unser Job, Robert. Also bleib fokussiert. Wahre die Distanz zum Opfer.«
»Wie denn?«, fragte ich aufgewühlt. »Wie schaffst du das?«
»Wir haben keine andere Wahl.«
»Macht dich das nicht fertig? Ein Kind derart leiden zu sehen?«
»Du bist nicht für ihr Leid verantwortlich.«
»Darf ich denn gar kein Mitgefühl zeigen?«
»Es ist eine schmale Gratwanderung zwischen Anteilnahme und Abgrenzung, Robert. Du musst lernen, einen kühlen Kopf zu bewahren, zu deinem eigenen Schutz. Mache die Schmerzen des Opfers nicht zu deinen. Mitleid, Wut, Trauer und Entsetzen hindern dich daran, objektiv zu bleiben. Doch genau das musst du sein. Du bist ein Cop, Robert, kein Seelenklempner. Und jetzt schreib ganz sachlich und unbefangen, was sich hier abgespielt hat.«
»Okay«, sagte ich und atmete tief durch. »Sachlich und unbefangen.«
Ich versuchte, meine Gefühle auszublenden, was mir nicht gerade leichtfiel. Mit krakeliger Schrift schrieb ich den Tatort-Bericht. Dean las ihn sich durch und wirkte zufrieden.
»Na also, geht doch.« Er nickte mir anerkennend zu, warf den Rapport auf das Armaturenbrett und rieb sich die Hände. »So. Zeit fürs Mittagessen. Ich hab einen Bärenhunger. Du auch?« Er drehte den Zündschlüssel und startete den Motor. »Welcher Schnellimbiss soll’s denn sein? Hast du mehr Lust auf einen Burger mit Pommes oder auf knusprige Hähnchenschenkel? Oder stehst du mehr auf Chinesisch?«
Ich traute meinen Ohren nicht. Wie um alles in der Welt konnte er nach einem derartigen Einsatz einfach so zur Tagesordnung übergehen und von Essen reden? Ein Mädchen war vergewaltigt worden! Ein elfjähriges Kind! Ich brachte das Bild nicht aus dem Kopf heraus, ihre zerrissenen Kleider, die Verzweiflung in ihren Augen, ihr Schluchzen. Und Dean fragte mich allen Ernstes, ob ich Burger oder Hähnchenschenkel essen wollte? Unnötig zu erwähnen, dass ich beim Mittagessen keinen Bissen herunterbrachte. Mein Partner putzte zwei Doppel-Burger weg und schwärmte von der Chilisoße, während ich meine Pommes nicht einmal anrührte. Immerzu musste ich an dieses Mädchen denken. Ich konnte nicht einfach so abschalten wie mein Partner. Ich konnte und ich wollte es nicht. Ich wollte nicht ein Cop werden, den die Vergewaltigung eines Kindes kalt lässt. Dean war kein gefühlloser Mensch. Wahrscheinlich hatte er nur einfach schon zu viel gesehen, um für das Elend, dem er täglich begegnete, nicht abzustumpfen. Und ich? Würde ich auch so werden? War das die einzige Möglichkeit, mit der Realität klarzukommen?