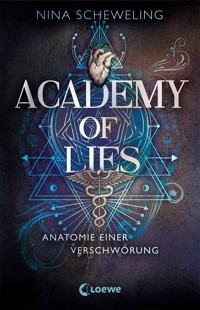
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Academy of Lies
- Sprache: Deutsch
Geheimnisse haben schreckliche Nebenwirkungen … Quinn wird sterben. Denn ihr Spenderherz hält nicht mehr lange durch. Um den Tod besser zu verstehen, studiert sie Medizin an einer Eliteuniversität. Doch da wird der Rektor getötet, kurz darauf stirbt eine Studentin – und niemand anderes als ihr Bruder gerät unter Verdacht. Quinn muss herausfinden, was wirklich passiert ist. Und dabei kommt sie einem Geheimnis auf die Spur, das nicht nur ihre eigene Welt auf den Kopf stellen könnte … Der fesselnde Auftakt einer atmosphärischen Medizinthriller-Reihe In Academy of Lies – Anatomie einer Verschwörung entführt uns Nina Scheweling an eine atmosphärische Eliteuniversitätvoller dunkler Machenschaften und Geheimnisse. Dark Academia trifft auf einen fesselnden Thriller rund um Medizin und bewegende Themen wie Tod, Verlust, Trauer und Familie – mit einer zarten Liebesgeschichte als Nebenhandlung (Slow Burn x Enemies-to-Lovers) und einer außergewöhnlichen Protagonistin, die einen durch ihren Sarkasmus und ihre abweisende Art nicht nur zum Lachen bringt, sondern auch tief berührt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
INHALT
Prolog
Kapitel 1 – Mein Name ist …
Kapitel 2 – Das Haus meiner …
Kapitel 3 – Als ich am …
Kapitel 4 – »Quinn Schreiber?« Die …
Kapitel 5 – Am nächsten Morgen …
Kapitel 6 – Ich sehe an …
Kapitel 7 – Mein Vorhaben, noch …
Kapitel 8 – Vor dem Eingang …
Kapitel 9 – Der Gang hinter …
Kapitel 10 – Als ich die …
Kapitel 11 – Plötzlich ist das …
Kapitel 12 – Als ich aufwache, …
Kapitel 13 – Am Sonntag regnet …
Kapitel 14 – Als ich die …
Kapitel 15 – Ich vergesse, mir …
Kapitel 16 – Die Reihen der …
Kapitel 17 – Ich merke erst, …
Kapitel 18 – Weil Mira die …
Kapitel 19 – Ich drücke auf …
Kapitel 20 – Es ist später …
Kapitel 21 – Mira sitzt mit …
Kapitel 22 – Der Schmerz kommt …
Kapitel 23 – Leonas findet einen …
Kapitel 24 – »Quinn!«, ruft Mira …
Kapitel 25 – Als ich am …
Kapitel 26 – »Hier?«, fragt Leonas …
Kapitel 27 – Das ist also …
Kapitel 28 – Nach zwei Wochen …
Content Note
Liebe Leser*innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr auf der letzten Seite eine Content Note.
Achtung: Diese enthält Spoiler für die gesamte Geschichte!
Wir wünschen euch das bestmögliche Lesevergnügen.
»Der Tod kommt nur einmal, und doch macht er sich in allen Augenblicken des Lebens fühlbar. Es ist herber, ihn zu fürchten, als ihn zu erleiden.«
PROLOG
Der Schuss zerreißt die Stille. Er dauert nur den Bruchteil einer Sekunde, aber das Geräusch scheint kein Ende zu nehmen. Es dehnt sich aus, hallt über den Innenhof der Akademie, wird von den weiß getünchten Wänden zurückgeworfen, dringt durch Fenster und Mauerritzen in die leeren Hörsäle, die Büros, die Bibliothek. Ein Schwarm Tauben flattert auf, und das Pfeifen ihres Flügelschlags mischt sich in das leiser werdende Echo des Knalls. Dann fügt sich die Stille wieder zusammen und legt sich wie eine schalldichte Decke über das ehemalige Kloster, als wäre überhaupt nichts geschehen. Zurück bleibt nur eine dumpfe Ahnung, die zwischen den altehrwürdigen Gebäuden umherwabert.
Er hat noch nie in seinem Leben eine Waffe abgefeuert. Die pure Gewalt, die in diesem Schuss steckt, erschreckt ihn, und gleichzeitig findet er sie angemessen für die Macht, die diese Handlung verkörpert. Die Macht, zu verletzen; zu töten; Leben zu verändern. Das Blut beginnt, unter dem schlaffen Körper hervorzuquellen, und je länger er daraufstarrt, desto weniger weiß er, ob er wirklich das Richtige getan hat. Er muss hier weg, bevor ihn jemand sieht. Er geht rasch davon, ohne sich noch einmal umzudrehen, und bemerkt kaum, dass er am ganzen Körper zittert.
Mein Name ist Quinn Schreiber, ich bin achtzehn Jahre alt, und wenn alles seinen normalen Gang geht, werde ich bald sterben.
In meiner Kindheit habe ich mir mein Herz immer wie das rote Plüschherz vorgestellt, das ich einmal im Schaufenster eines Kaufhauses gesehen hatte. Später, als mein Herz anfing, mühsamer zu schlagen, kam es mir vor wie ein Stein, hart und tonnenschwer, der mich langsam, aber sicher in die Tiefe zog. Heute weiß ich es besser.
Das Herz ist eine Ansammlung von Zellen: ein Muskelschlauch, der am zweiundzwanzigsten Tag der Schwangerschaft anfängt zu schlagen; der sich ausdehnt, teilt, sich umbaut in ein komplexes System aus Vorhöfen und Herzkammern, Klappen, Knoten, Venen und Arterien, bis es irgendwann so groß ist wie die Faust seines Besitzers und so viel wiegt wie drei Tafeln Schokolade.
Es ist ein Muskel, der unablässig Blut durch unseren Körper pumpt: fünf Liter in der Minute, siebentausend am Tag, zweihundert Millionen im Leben.
Es hat seine eigene Schaltzentrale, die unseren Puls steuert: sechzig bis achtzig Schläge in der Minute, hunderttausend am Tag, drei Milliarden im Leben, ohne Pause. Es beschleunigt den Rhythmus, wenn wir rennen, fährt ihn runter, wenn wir schlafen, lässt ihn stolpern, wenn irgendetwas defekt ist.
Es ist ein Verstärker, der uns Gefühle spüren lässt, selbst wenn wir sie nicht wahrhaben wollen: Liebe, Freude, Nervosität, Wut, Angst.
Es ist eine gut geölte Maschine, die uns am Leben erhält – wenn alles glattläuft. Bei mir tat es das nicht. Mein Herz existiert nicht mehr. Es war kaputt, deswegen hat man es ausgebaut und weggeworfen.
Mit sechs hatte ich eine Herzmuskelentzündung, die die Ärzte nicht in den Griff kriegten. Mein Herz wurde immer schwächer, bis es schließlich ganz aufgab. Mit acht habe ich ein neues bekommen. Im Schnitt halten implantierte Organe etwa zehn Jahre durch, meins ist also ab sofort überfällig. Und meine Kombination aus seltener Blutgruppe und negativem Rhesusfaktor führt dazu, dass die Chance auf ein weiteres Spenderherz bei circa null liegt.
Ich könnte mir ein Kunstherz einsetzen lassen, eine Pumpe, die durch ein Kabel mit einem Akku außerhalb des Körpers verbunden ist. Dann wäre ich an eine Batterie angeschlossen wie irgendein Haushaltsgerät. Natürlich verstehe ich, dass das für einige der letzte Ausweg ist. Aber für mich ist es unvorstellbar. Und so finde ich mich seit einem Jahrzehnt mit meinem Tod ab. Wir alle sterben irgendwann. Die einen früher, die anderen später. So einfach ist das.
Vielleicht ist das der Grund, warum ich so gern allein bin. Warum ich mich abschotte von der Welt, den Menschen aus dem Weg gehe und genau das Gegenteil von dem mache, was alle von mir erwarten. Auch – oder erst recht – heute.
Ich komme aus der Lücke zwischen zwei Regalen hervor, in der ich mich versteckt habe, und laufe bis zur verlassenen Ausleihtheke mit ihrer aufwendigen Wandvertäfelung im Hintergrund. Ich sollte nicht hier sein – zumindest nicht um diese Zeit. Die Bibliothek schließt samstags um 18Uhr, und jetzt ist es 18.47Uhr. Es ist gar nicht so schwer, sich irgendwo einschließen zu lassen, besonders an Orten, an denen niemand damit rechnet. Wenn es keine Überwachungskameras gibt, kein Sicherheitspersonal, nur eine studentische Hilfskraft, die am Ende der Öffnungszeiten einen halbherzigen Kontrollgang macht. Als sie kurz nach sechs die Eingangstür hinter sich zuzog und das elektronische Schloss verriegelte, hat sie mich ein- und die Welt ausgesperrt und die Bibliothek zu meinem ganz persönlichen Rückzugsort gemacht. Einem Ort, der die Geschichte des alten Klosters atmet, das hier einmal untergebracht war. Einem Ort mit dunklen Holzregalen, kleinen Schirmlampen an den Lesetischen und Wandmalereien an den hohen Decken. Einem Ort, an dem die Flachbildschirme, die zur Recherche bereitstehen, wie Fremdkörper wirken.
Ich drehe mich langsam um mich selbst und nehme die Stille in mich auf, die Einsamkeit, die Energie des Tages, die noch in der Luft hängt, bevor sie im Laufe der Nacht zwischen den Büchern versickern wird. Dann schlendere ich ziellos an den Regalen entlang, fahre mit dem Finger über die Buchrücken der Fachliteratur, ohne einen bestimmten Titel wahrzunehmen, und atme den Geruch nach Papier, nach altem Holz und Staub ein. Ich bin nicht hier, um etwas Besonderes zu tun. Ich verfolge keinen Plan. Ich bin hier, weil alle anderen es nicht sind. Anstatt mit den restlichen Erstsemestern noch vor der Einführungswoche in Kneipen und auf Partys nach Anschluss zu suchen, bin ich, wo niemand ist. Sogar mein Handy habe ich ausgeschaltet. Ich habe keine Lust auf oberflächliche Glückwunsch-Nachrichten. Heute ist mein Geburtstag. Aber ich feiere lieber allein.
Ein Knall zerfetzt die Luft und zerstört meinen Frieden. Ich zucke zusammen, und sofort beginnt mein Herz, heftig zu klopfen, setzt seinen eigenen Willen durch, ganz egal, wie sehr ich versuche, es unter Kontrolle zu halten. Tauben flattern erschrocken am Fenster vorbei in den Himmel, und die Schallwellen des Knalls hallen in der Bibliothek wider, als suchten sie jemanden, dem sie eine Botschaft überreichen könnten.
Was in aller Welt war das? Ich gehe zu einem der Fenster, die auf den Innenhof hinausführen. Auf den ersten Blick scheint er verlassen zu sein. Doch dann erkenne ich die offen stehende Eingangstür des Rektorats, das gegenüber der Bibliothek liegt, und einen dunklen Umriss auf der Steintreppe davor. Plötzlich verstehe ich es – verstehe, was den Knall verursacht hat, verstehe, warum mein Herz so aufgeregt ist und immer schneller schlägt, während alles andere in mir erstarrt. Der Umriss auf der Treppe ist ein Mann, und unter seinem reglosen Körper sickert Blut hervor, das die Stufen in ein dunkles, glänzendes Rot taucht.
Ich sollte wegrennen. Vielleicht ist der Täter noch da, sucht weitere Opfer oder will sichergehen, dass es keine Zeugen gibt. Aber ich kann mich nicht bewegen, kann nur hinausschauen auf den Hof, das Kopfsteinpflaster, die herbstlichen Platanen, die Fenster der Gebäude, die den Innenhof umranden und in deren schwarzen Scheiben sich der Himmel spiegelt. Niemand ist zu sehen, weder Passanten, die sich zufällig in den Innenhof verirrt haben, noch jemand, der wie ein Mörder wirkt. Die einzige Bewegung, die ich ausmachen kann, ist die des vertrockneten Laubs, das auf dem Boden umhertanzt, und die des Bluts, das in einem kleinen Rinnsal von der obersten Stufe hinabläuft.
Da kommt ein Hund in den Innenhof gelaufen. Er schnüffelt über den Boden, bleibt schließlich vor der Treppe stehen und fängt aufgeregt an zu bellen. Eine Frau tritt durch den Durchgang, ruft nach ihm, streng, aber vergeblich. Dann sieht sie, was den Hund so durcheinanderbringt. Sie schreit auf, zerrt ihn von der Treppe weg, wühlt in ihrer Tasche nach ihrem Handy.
Eine Viertelstunde später wimmelt der Innenhof von Menschen – Polizisten, Gerichtsmedizinern und einer Handvoll Schaulustiger, die von Männern und Frauen in Uniform aber rasch wieder vertrieben werden. Ich stehe immer noch am Fenster und beobachte alles, verborgen von den Schatten, die zwischen den Regalen hervorkriechen und die Bibliothek in Zwielicht hüllen. Solange ich die Lampen nicht anmache, sieht mich niemand; im Gegensatz zu den Polizisten, die erst das Erdgeschoss und dann die oberen Stockwerke des Rektorats durchstreifen. Durch die Fenster erkenne ich, wie sie von einem Raum in den nächsten gehen, das Licht anschalten, sich umsehen, auf der Suche nach dem Täter oder weiteren Opfern. Aber sie scheinen nichts zu finden. Als sie dem Einsatzleiter im Innenhof Bericht erstatten, dreht dieser sich nachdenklich im Kreis, lässt seinen Blick über die Fassade gleiten, entlang der verschlossenen Türen und der Scheiben, die das Blaulicht der Einsatzwagen reflektieren. Ich zucke zurück, aus Angst, dass er mich entdeckt, doch er wendet sich schon wieder ab und schüttelt den Kopf. Die Beamten zerstreuen sich. Offenbar gehen sie nicht davon aus, dass der Mörder noch vor Ort ist.
Ein leichter Regen setzt ein und droht die Spuren der Tat wegzuwaschen. Hastig wird ein Zelt über der Treppe errichtet, das den Toten vor dem Wasser schützt. Scheinwerfer werden aufgestellt, um die Dämmerung zu vertreiben. Ein Auto fährt in den Hof, ein Zivilfahrzeug diesmal. Ein Mann und eine Frau steigen aus, gehen auf den Eingang zu und werden kurz darauf von dem Zelt verschluckt.
Ich frage mich, wer der Tote ist. Nur jemand, der zur falschen Zeit am falschen Ort war? Ein Spaziergänger vielleicht? Oder ein Tourist, der in irgendeinem Reiseführer von der Renovierung der alten Klosteranlage gelesen hat, die zu einer der modernsten privaten Hochschulen des Landes umgebaut wurde? Allerdings sah es so aus, als wäre das Opfer aus der Tür des Rektorats gekommen. Dabei ist das Rektorat am Wochenende eigentlich nicht besetzt. Wer könnte heute trotzdem dort gewesen sein? Der Einzige, der mir einfällt, ist Johann Sailer, der neue Rektor der Wilhelm-Schreiber-Akademie. Er ist erst seit dem Sommer im Amt und womöglich noch motiviert genug, um auch am Wochenende zu arbeiten. Aber warum sollte ihn irgendjemand erschießen?
Ich lasse den Blick über den Innenhof schweifen. Eine Frau in einem weißen Plastikanzug – offensichtlich von der Spurensicherung – fotografiert den Tatort aus jedem erdenklichen Winkel. Ein weiterer Beamter sucht den Boden ab, zögert an einer Stelle kurz und stellt ein kleines Metallschild mit einer Nummer daneben. Die meisten anderen Polizisten stehen herum, schweigend, rauchend, den Kopf tief in ihren Jacken vergraben, um sich vor dem immer stärker werdenden Regen zu schützen.
Und dann sehe ich ihn. Einen Mann, vielleicht zwei, drei Jahre älter als ich, hochgewachsen und schlank. Er trägt einen langen dunklen Mantel, und wenn ihn eines der Blaulichter streift, kann ich sogar von hier aus erkennen, wie Regentropfen in seinen ebenso dunklen Haaren glänzen. Er ist keiner von den Polizisten, das spüre ich instinktiv. Er muss sich irgendwie an der Absperrung, die am Eingang des Innenhofs errichtet wurde, vorbeigeschlichen haben. Jetzt steht er versteckt in einer Ecke, den Blick unverwandt auf das weiße Zelt gerichtet, als könnte er durch die nassen Plastikplanen hindurch ins Innere spähen. Niemand beachtet ihn, was erstaunlich ist angesichts der Anzahl der Polizisten, die sich im Innenhof aufhalten. Tatsächlich scheine ich die Einzige zu sein, die ihn überhaupt wahrnimmt, fast so, als wäre er ein Geist. Was macht er hier?
Als hätte der Mann meine Frage gehört, hebt er den Kopf und schaut zu den Fenstern der Bibliothek. Ich weiche einen Schritt zurück und verschmelze mit der Dunkelheit. Er kann mich nicht gesehen haben. Ich weiß, dass er mich nicht gesehen hat. Warum fühlt es sich dann so an, als hätte sein Blick den unsichtbaren Bann gebrochen, der über der Bibliothek lag und mich von der Außenwelt und allem, was dort draußen vor sich geht, abgeschirmt hat?
Mein Herz fängt erneut an zu rasen, schneller und schneller, aber ich ignoriere es, dieses verräterische, aufdringliche Ding, das nicht mal mein eigenes ist. Langsam trete ich vor, bis ich wieder auf den Innenhof hinaussehen kann. Der Mann hat sich abgewandt, schaut nun einem weiteren Auto entgegen, das auf den Hof fährt; ein Leichenwagen, von dessen poliertem schwarzem Lack der Regen abperlt. Zwei Männer steigen aus und verschwinden im Zelt. Kurz darauf tragen sie einen schlichten grauen Sarg zum Auto und verladen ihn im Kofferraum.
Die Party ist vorbei. Es wird Zeit zu gehen. Ohne einen letzten Blick auf das Treiben im Innenhof oder den seltsamen Mann zu werfen, drehe ich mich um und gehe Richtung Ausgang. Es sind Fluchttüren, die sich von innen immer öffnen lassen. Ich drücke die Klinke hinunter und verlasse die Bibliothek so selbstverständlich, als wäre es nicht schon zwei Stunden nach Schließzeit. Dann wende ich mich nach links; zu den Türen, die aus dem Akademie-Gebäude zur Straße führen. Auch sie gehen problemlos auf, und niemand beachtet mich, während ich mir die Kapuze überziehe und in den Regen verschwinde.
Als ich kurz darauf den Flur des Wohnheims betrete, schallt mir durch die Tür meiner Zweier-WG spanischer Pop entgegen. Die Wohngemeinschaften in dem ehemaligen Nonnenkloster sind Pflicht für alle Erstsemester, die an der Schreiber studieren. Angeblich sollen sie den Zusammenhalt untereinander stärken, die Bindung zur Akademie, was weiß ich. Zum Glück ist es nur für die ersten zwei Semester. Danach werden wir wieder vor die Tür gesetzt, um Platz für die neuen Studierenden zu machen. Die WG ist nichts Besonderes – ein kleiner Wohnraum, ein Bad, zwei winzige Zimmer, in die nicht viel mehr als ein Bett und ein Schreibtisch hineinpassen.
Sobald ich die Tür aufschließe, wird die Musik fast unerträglich laut. Mira, meine Mitbewohnerin, tanzt in Leggins und Crop Top im Wohnzimmer herum und pappt mit Heftzwecken bunte Sarongs an die Wände.
Als sie mich bemerkt, strahlt sie mich an. »Hey!«, ruft sie und läuft zu ihrem Handy, um die Musik leiser zu stellen. »Da bist du ja. Ich wollte dich eigentlich fragen, was du von ein bisschen mehr Farbe hältst, aber da du so lange weg warst, dachte ich mir, ich mach einfach mal.« Sie deutet auf die Tücher an den Wänden und strahlt immer noch übers ganze Gesicht. »Und, was sagst du? Sieht doch gleich viel freundlicher aus, oder? Ich hab Dutzende von den Dingern gekauft, als ich auf Bali war, weil ich sie alle so schön fand. Jetzt habe ich endlich Verwendung dafür.«
»Hm.« Ihre gute Laune deutet darauf hin, dass sich die Nachricht über den Mord noch nicht herumgesprochen hat. Ich ringe mir ein Lächeln ab und gehe an ihr vorbei in mein Zimmer. Ich kann ihre andauernde Fröhlichkeit sonst schon kaum ertragen und nach allem, was in den letzten Stunden geschehen ist, noch weniger. Ich kenne Mira erst seit ein paar Tagen und habe trotzdem schon unzählige Male das Schicksal verflucht, das uns zusammen in eine WG gesteckt hat. Noch nie bin ich einem Menschen begegnet, der durchgehend derart gut drauf ist. Ich versuche, ihr so oft wie möglich aus dem Weg zu gehen, was in dem begrenzten Raum, der uns zur Verfügung steht, nicht ganz einfach ist. Zum Glück habe ich einen Plan B.
Ohne mir Schuhe oder Jacke auszuziehen, stopfe ich ein paar Sachen in meine Tasche, kontrolliere, ob ich meine Medikamente dabeihabe, und trete zurück ins Wohnzimmer.
»Du willst schon wieder weg?«, fragt Mira, und ihre notorische Euphorie bekommt einen leichten Knacks. »Es ist Quiz-Night im Pub. Wir könnten zusammen hingehen.«
»Nein danke«, sage ich knapp.
»Schade. Aber ich kann dir ja erzählen, wie es war.« Sie deutet auf meine vollgepackte Tasche. »Schläfst du wieder in der Villa?«
»Mhm.«
»Okay.« Ich kann ihre Enttäuschung förmlich spüren, auch wenn Mira sich alle Mühe gibt, sie sich nicht anmerken zu lassen. »Sehen wir uns Montag zur Einführungsvorlesung?«
»Klar. Bis dann.«
Ich ziehe die Tür hinter mir zu, und kurz darauf schallt wieder die spanische Popmusik durch den Gang. Anscheinend hat sie den Dämpfer bereits überwunden. Gut so. Ich bin ziemlich talentiert darin, Menschen vor den Kopf zu stoßen, die in meiner Nähe sind. Besser, sie gewöhnt sich so schnell wie möglich daran.
Das Haus meiner Großeltern ist eines der ältesten in der Straße, in der sich eine Jugendstilvilla an die andere reiht. Mit einer beinahe arroganten Eleganz erhebt sich das Gebäude vor mir in den dunklen Himmel, und ich könnte schwören, dass sich die Klinke des schmiedeeisernen Tors an der Straße jedes Mal etwas schwerer öffnen lässt – fast könnte man meinen, es wäre unter der Würde des alten Kastens, mich hineinzulassen.
Heute klemmt sie besonders, als wolle das Haus mich und die Bilder, die mir durch den Kopf schwirren, von sich fernhalten. Das Blaulicht, das sich in den Fenstern der Akademie spiegelt; das Blut, das an der Treppe hinabläuft; der schmucklose Sarg, der aus dem Zelt getragen wird. Wenn ich mich konzentriere, kann ich immer noch das Echo des alles erschütternden Schusses hören, der irgendwo tief in mir drin widerhallt. Ich wäre beinahe Zeugin eines Mordes geworden, muss den Täter nur um wenige Sekunden verpasst haben. Vielleicht wäre ich sogar selbst zum Opfer geworden, wenn ich bloß einen Augenblick eher am Fenster gestanden und der Mörder mich gesehen hätte. Mein Brustkorb zieht sich zusammen, und ich schiebe den Gedanken rasch beiseite, genauso wie die Bilder, die immer wieder vor meinem inneren Auge aufflackern wie ein schlecht geschnittener Film.
Schließlich gibt die Klinke des Tores doch nach, und ich gehe die kiesbedeckte Auffahrt entlang auf die Haustür zu, deren überdachter Eingang von zwei steinernen Säulen gesäumt wird. Als ich den Schlüssel heraushole, raschelt es in einem der Sträucher an der Hauswand. Ein leises Maunzen ertönt, dann schiebt sich eine Katze unter den Zweigen hervor. Ihr schwarzes Fell hebt sich kaum von der Dunkelheit ab. Sie ist klein und struppig und lungert schon seit ein paar Tagen hier herum. Ich weiß nicht, wem sie gehört oder was sie ausgerechnet hier will, und ich ignoriere sie genauso hartnäckig, wie sie immer wieder vor der Tür auftaucht. Vorsichtig kommt sie näher, wobei ihr Maunzen wie eine Bitte klingt. Als ich hineingehen und die Katze mir folgen will, schiebe ich sie mit dem Fuß zurück und schließe die Tür hinter mir.
Stille umfängt mich, und ich atme auf. Das ist so viel besser als das Wohnheim, auch wenn die Villa fast eine Dreiviertelstunde Fußweg von der Akademie entfernt ist und ich ziemlich aus der Puste bin. Ich hänge meine Jacke an die Garderobe und gehe, ohne das Licht anzuschalten, durch die Eingangshalle in die Küche. Zwar habe ich keinen Appetit, aber mein Magen grummelt, also mache ich mich lustlos auf die Suche nach etwas Essbarem. Der Kühlschrank ist leer bis auf einen Rest Milch, der noch ganz passabel riecht, doch im Schrank finde ich eine angefangene Packung Kekse. Sie sind nicht mehr frisch, aber es wird gehen. Damit setze ich mich an den kleinen Küchentisch, esse die weichen Kekse und schaue aus dem Fenster.
Der verwilderte Garten, den meine Oma immer so geliebt hat, liegt in der Finsternis, trotzdem bilde ich mir ein, den Birnbaum ausmachen zu können, der sich eine Spur dunkler gegen den Rest des Gartens abzeichnet. Sofort steigen Erinnerungen in mir auf, an die Sommertage, an denen Flo und ich darin herumgeklettert sind und gewettet haben, wer die höchste Birne pflückt.
Jetzt ist meine Großmutter im Heim. Sie erkennt schon seit Jahren niemanden mehr, nicht einmal sich selbst. Ihr Verstand ist wie ein Sieb, in das man Erlebnisse und Erinnerungen hineinschüttet, die durch sämtliche Löcher wieder nach draußen rieseln. Sie könnte nichts mit dem Birnbaum anfangen, nichts mit den Sommertagen und erst recht nichts mit Flo oder mir. Sogar wenn ich ihr ein Foto zeigen würde, wie sie selbst vor dem Baum steht, lachend, die Schürze voller Birnen, wüsste sie nicht, wen sie sieht. Mein Großvater war der letzte Mensch, der sie halbwegs im Leben verankert hat, und er ist Anfang des Jahres an einem Schlaganfall gestorben. Seitdem steht die Villa leer. Es stört also niemanden, wenn ich mich hier verkrieche.
Die Klingel an der Haustür ertönt, ein tiefer, melodischer Gong. Seufzend schaue ich auf die Wanduhr, deren Ziffernblatt in der unbeleuchteten Küche kaum zu lesen ist. Kurz nach neun. Natürlich lässt Florin es nicht auf sich beruhen, dass er mich den ganzen Tag nicht erreichen konnte. Vielleicht hätte ich mein Handy doch anlassen sollen, dann wäre die Sache mit einem Anruf erledigt gewesen. Eigentlich ist die Gesellschaft meines Bruders die einzige, die ich ertrage. Aber nicht heute, nicht an diesem Tag, der immer mit so viel Bedeutung aufgeladen wird, mit so viel Freude, so viel »Glück und Gesundheit«, die er mir wünschen will, obwohl er es eigentlich besser wissen müsste. Und schon gar nicht nach dem, was vorhin in der Akademie passiert ist.
Ich stehe auf, schleiche in die Eingangshalle und lausche auf Geräusche vor der Tür. Wenn ich ganz still bin, geht er vielleicht wieder.
»Mach auf, Q!«, ruft eine Stimme. »Ich weiß, dass du da bist. Hier sind nasse Fußspuren vor der Tür.«
Ich ergebe mich meinem Schicksal, öffne die Tür und schaue meinen Bruder fragend an. »Muss das sein?«
»Ja, muss es!« Er zieht mich in eine etwas ungelenke Umarmung, weil er in einer Hand etwas balanciert. »Happy Birthday, Kleines!« Er drückt mich so fest, dass ich fast keine Luft mehr kriege.
Nachdem er mich endlich losgelassen hat, starre ich ungläubig auf den Teller in seiner Hand. »Ist das Kuchen?!«
»Ist es.« Er schiebt mich zur Seite und geht ins Haus.
Kurz darauf flammt der Kronleuchter an der Decke auf. Geblendet halte ich die Hand vor die Augen, deswegen höre ich nur, wie Florin leise seufzt und auf dem Weg in die Küche sämtliche Lichtschalter betätigt, die er finden kann. Obwohl ich sein Gesicht nicht sehe, kann ich mir seine missbilligende Miene lebhaft vorstellen.
In der Tür zum Salon bleibt er stehen und lässt seinen Blick durch den Raum schweifen. »Ich fasse es nicht«, sagt er und deutet auf die vielen weißen Tücher, die das Zimmer beinahe steril wirken lassen. »Du beschließt, lieber in dem alten Kasten zu schlafen als im Wohnheim, hast aber nicht mal die Möbel aufgedeckt?« Er dreht sich zu mir um, und in seinem Gesicht lese ich alles, was ich befürchtet habe: Missbilligung, Unverständnis, Sorge. Und noch etwas, das ich nicht ganz einordnen kann.
»Ich habe nicht vor, hier irgendwelche Teegesellschaften abzuhalten«, entgegne ich schulterzuckend. »Mein altes Zimmer oben reicht mir völlig.«
»Es müssen ja nicht gleich Teegesellschaften sein. Aber ein paar Freunde vielleicht?«
»Die einzige Person, die ich hier außer dir kenne, ist meine Mitbewohnerin.«
»Und? Ist sie nicht nett?«
»Doch, ist sie. Nett und aufgedreht und aggressiv fröhlich. Keine Ahnung, wie ich es mit ihr länger als zehn Minuten in einem Raum aushalten soll.«
»Es ist dein Geburtstag, Q«, sagt Flo und klingt dabei ungewöhnlich gereizt, als würde er langsam die Geduld mit mir verlieren. »Für die meisten ist das ein Grund zu feiern. Aber du sitzt hier im Dunkeln, als wärst du schon tot.«
Die Worte bleiben zwischen uns hängen, lösen sich nicht auf wie all die anderen, werden immer größer und schwerer, bis sie drohen zu zerplatzen. Flos Augen weiten sich, als ihm bewusst wird, was er gesagt hat.
»Das wollte ich nicht«, wispert er.
»Schon gut.« Ich nehme es ihm nicht übel – schließlich hat er recht. Trotzdem wallt Ärger in mir auf. Flo benimmt sich immer wie der typische große Bruder, der seine Schwester vor Enttäuschungen bewahren will. Als sollte das Schicksal fortan nur noch schöne Dinge für mich bereithalten. Aber so ist das Leben nicht. Ich brauche niemanden, der auf mich aufpasst. Ich komme damit klar, dass ich sterbe. Warum zum Teufel tun es die anderen dann nicht auch?
Ich schlucke meinen Ärger hinunter und wechsle das Thema, um die Sache nicht noch weiter ausdiskutieren zu müssen. »Was ist jetzt mit dem Kuchen?«, frage ich und deute auf den Teller in seiner Hand. »Ist der nur zum Angucken oder auch zum Essen?«
»Was denkst du? Irgendjemand muss ja dafür sorgen, dass du überhaupt was isst.«
»Wenn du dir solche Gedanken um mich machst, warum kommst du dann erst jetzt?«
»Ich hatte noch was zu erledigen«, murmelt er, bevor er in die Küche geht.
Ich folge ihm und sehe dabei zu, wie er von irgendwoher eine Kerze hervorzaubert, sie auf den Kuchen steckt und dann die Schubladen nach einem Feuerzeug durchsucht. Als er eines gefunden hat, braucht er mehrere Anläufe, um es anzubekommen. Wieder fällt mir der seltsame Ausdruck in seinem Gesicht auf. Er wirkt merkwürdig blass. Ob er schon von dem Mord gehört hat? Sofort merke ich, dass ich nicht mit ihm darüber reden möchte, obwohl ich ihm sonst nie etwas verschweige.
»Ist alles in Ordnung?«, frage ich ihn trotzdem.
»Jaja, alles gut.« Dann hält er mir den Kuchen mit der brennenden Kerze entgegen. »Für die bezauberndste, sanftmütigste achtzehnjährige Schwester der Welt. Wünsch dir was.«
Ich schließe die Augen, puste die Kerze aus und sehe ihn danach erwartungsvoll an.
»Was ist?«, fragt er.
»Ich hab mir gewünscht, dass du dich in Luft auflöst. Hat offenbar nicht funktioniert.«
Flo ringt sich zu einem Lächeln durch. »So einfach wirst du mich nicht los.«
Wir setzen uns an den Küchentisch, wo mein Bruder zwei große Stücke Kuchen zurechtschneidet. Es ist Zimtkuchen, und als mir der würzig-süße Geruch in die Nase steigt, werden sofort Kindheitserinnerungen in mir wach. An kalte Herbstnachmittage draußen auf der Schaukel im Garten. An den ofenwarmen Kuchen, mit dem Oma dafür sorgte, dass ich auch von innen warm wurde, wie sie immer sagte. An Opa, der kaum sein Arbeitszimmer verließ, aber für Süßes eine Ausnahme machte. Ärgerlich dränge ich die Bilder zurück. Sie verfälschen die Vergangenheit. Sie gaukeln mir vor, dass früher alles gut war. Warum erinnert man sich eigentlich nie an die Angst, an die Unsicherheit, die Verzweiflung, die Schmerzen, die Tränen? Warum vergisst man all das Schlechte?
Ich beiße ein Stück von dem Kuchen ab. Er schmeckt fantastisch. »Hast du den gebacken?«, frage ich erstaunt.
»So weit geht meine Liebe zu dir dann doch nicht.« Flo zögert einen Moment, dann seufzt er. »Mama hat mich angerufen. Sie möchte dir gratulieren, kann dich aber nicht erreichen.«
Noch ein Grund, warum heute mein Handy aus ist. Weil ich keine Lust auf Small Talk mit meiner Mutter habe, den sie zwischen eine Verhandlung mit einem Außenhandelsvertreter und Tee mit einer Botschafterin quetscht. Sie hatte noch nie wirklich Zeit für uns, aber nach dem Tod meines Vaters hat sie sich nur noch auf ihre Karriere konzentriert und Flo und mich auf ein Internat geschickt. Sie war so beschäftigt, dass wir selbst in den Ferien meist nicht nach Hause konnten. Sogar die Teilnahme an meiner Abschlussfeier musste sie absagen, weil irgendein internationaler diplomatischer Eklat Vorrang hatte. Das letzte Mal habe ich sie vor einem halben Jahr gesehen, auf der Beerdigung meines Großvaters.
»Ich will nicht mit ihr reden«, brumme ich.
»Ach, Q«, seufzt Flo. »Sie will doch nur –«
»Ich mein’s ernst. Auf oberflächliche Geburtstagsanrufe kann ich verzichten.«
»Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass sie nicht damit klarkommt, dass ihre eigene Tochter todkrank ist?«, fragt Flo sanft. »Dass das nichts mit mangelndem Interesse oder fehlender Liebe zu tun hat, sondern mit Verdrängung?«
»Vor manchen Dingen kann man nicht wegrennen«, erwidere ich wütender, als ich sein will. »Sie soll sich endlich damit auseinandersetzen, anstatt so zu tun, als wäre nichts!«
»Sagt die Richtige.«
»Ich setze mich damit auseinander. Jeden verdammten Tag. Und im Gegensatz zu allen anderen habe ich mich damit abgefunden.«
Flo wirft mir einen unergründlichen Blick zu, aber er kennt mich gut genug, um das Thema fallen zu lassen.
Er war zwei Klassen über mir auf dem Internat und ist nach seinem Schulabschluss hierhergezogen, um Medizin zu studieren. Vielleicht klingt es ein bisschen einfallslos, dass ich es ihm nun nachmache, aber die Gründe, warum wir diesen Entschluss gefasst haben, sind so weit voneinander entfernt wie die Erde vom Mond. Flo ist einer von den Guten. Ein Weltverbesserer. Er studiert Medizin, weil er anderen Menschen helfen will.
Aber ich bin nicht wie er. Mich interessiert nicht, was mit anderen Menschen geschieht – ob ihre Knochen richtig zusammenwachsen, ob sie eine schwere Infektion überstehen. Ich studiere Medizin, weil ich verstehen möchte, wie der menschliche Körper funktioniert. Wenn ich schon sterbe, will ich wenigstens wissen, wie genau. Alles andere ist mir egal.
Flo schiebt den Teller mit seinem Kuchen unmerklich ein Stück von sich. Mir fällt auf, dass er überhaupt nichts gegessen hat.
»Erzähl mal, was du heute gemacht hast«, sagt er. »Es ist schließlich dein Geburtstag.«
Ich hätte fast einen Mord beobachtet.
Aber das spreche ich nicht laut aus. Ich möchte immer noch nicht darüber reden. Zumal Flo irgendetwas beschäftigt, da will ich ihn nicht auch noch damit behelligen, dass ich Beinahe-Zeugin eines Verbrechens geworden wäre. Sein Großer-Bruder-Beschützerinstinkt würde nur unnötig heißlaufen. Und von dem Mord wird er so oder so erfahren – vermutlich steht er morgen in allen Zeitungen. »Ich war ein bisschen unterwegs«, antworte ich ausweichend.
»Okay.« Er bohrt nicht nach. »Bist du schon aufgeregt wegen Montag?«, fragt er stattdessen.
»Wegen der Einführungsvorlesung?« Ich schnaube. »Als ob.«
»Du wirst dich wohl oder übel unter Leute begeben müssen«, gibt er zu bedenken, und endlich blitzt ein bisschen was von dem Schalk in seinem Blick auf, den ich schon den ganzen Abend vermisse. »Unter ziemlich viele. Vielleicht sind sogar ein oder zwei darunter, die du sympathisch findest.«
Ich verdrehe die Augen. »Keine Sorge, das werde ich schon irgendwie verhindern.«
Flo bleibt nicht lang. Er ist schweigsam und mit den Gedanken woanders, und mir geht es genauso. Sobald er weg ist, lösche ich das Licht in allen Räumen und gehe in den ersten Stock. Bevor wir aufs Internat geschickt wurden, haben Flo und ich praktisch unsere gesamte Freizeit zusammen verbracht. Entweder mussten wir nach der Schule zu unserem Vater in die Firma, wo es uns so langweilig wurde, dass wir auf der Suche nach Ablenkung durch das Industriegebiet streunten und uns schließlich in einem stillgelegten Militärkrankenhaus in der Nähe eine geheime Bude einrichteten. Oder wir kamen hierher in die Villa, und das so oft, dass unsere Großeltern uns eigene Zimmer gegeben haben.
Meins ist am Ende des Flurs. Ich öffne die Tür und taste mich vor. Meine Augen haben sich wieder an die Dunkelheit gewöhnt, trotzdem treten die Umrisse der Möbel nur schwach gegen das Schwarz des Raumes hervor. Ich lege mich auf das Bett und starre an die Decke. In Gedanken wandere ich zurück in die Bibliothek, spüre die ledernen Buchrücken unter meinen Fingern, rieche das alte Holz und Papier, höre den Schuss, der die Stille zerreißt, der im Bruchteil einer Sekunde ein Leben auslöscht. Hat der Tote seinen Mörder gesehen? Hat er noch etwas gesagt? Hat er um sein Leben gefleht oder versucht zu entkommen? Oder ist alles so schnell gegangen, dass er tot war, bevor er begreifen konnte, was passierte?
Das Krümmen eines Fingers hat ausgereicht, damit das Geschoss aus dem Mündungskanal fuhr und in den Körper eindrang, Arterien zerfetzte, Organe zerschlug. So schnell kann das Leben vorbei sein. Wer auch immer der Tote war, er hat nicht gewusst, dass er sterben würde. Ich weiß es schon mein halbes Leben lang. Und ich habe keine Ahnung, welche Variante besser ist.
Regen prasselt gegen das Fenster. Ich knipse die Nachttischlampe an, und der gelbe Kreis, den sie in die Dunkelheit wirft, fällt auf mein Tagebuch. Es ist noch ganz neu. Ich greife danach, schlage die erste Seite auf und schreibe »Tod durch Verbluten« in die oberste Zeile. Es gibt so viele Arten zu sterben. Zeit, den Dingen auf den Grund zu gehen.
Tod durch Verbluten
Blut fällt kaum ins Gewicht. Es macht nur etwa fünf bis acht Prozent der gesamten Körpermasse aus, bei einem achtzig Kilo schweren Menschen sind das zwischen fünf und sechs Liter. Es fließt mit einer Geschwindigkeit von vier Kilometern pro Stunde; das sind 1,1Meter pro Sekunde. Auf diese Weise braucht es etwa eine Minute, um einmal den gesamten Blutkreislauf zu durchlaufen. Wäre irgendwo ein riesengroßes Loch in unserem Körper, würden wir also innerhalb von einer Minute komplett ausbluten. Zerfetzte Blutgefäße im Brustkorb oder Bauchraum wie bei Sailer lassen das Blut nicht ganz so schnell austreten. Aber schnell genug.
Blut ist im Grunde nichts anderes als ein riesiges Transportunternehmen: Es befördert Abwehrzellen und Botenstoffe durch den Körper, versorgt die Zellen mit Nährstoffen und Sauerstoff und nimmt die Abfallprodukte wieder mit. Es stellt sicher, dass die Zellen alles bekommen, was sie benötigen – denn sie sind es, die uns durch ihre Arbeit und ihre Interaktion untereinander am Leben erhalten. Wir haben etwa dreißig Billionen davon: Muskelzellen, Nervenzellen, Blutzellen, Hautzellen, Fettzellen, mehr als zweihundert verschiedene Zelltypen. Eigentlich ist unser Körper nichts anderes als ein hochkomplexes Zusammenspiel zwischen ihnen allen. Sterben die Zellen, sterben wir.
Damit das nicht passiert, brauchen sie Energie, um zu funktionieren. Der Körper gewinnt diese Energie aus Glukose und Sauerstoff. Glukose kann in Form von Glykogen gespeichert werden; Sauerstoff nicht. Fließt kein Blut mehr, bekommt der Körper keinen neuen Sauerstoff. Und bekommen die Zellen keinen Sauerstoff, bricht das ganze Konstrukt innerhalb weniger Minuten zusammen. Die energieintensiven Prozesse leiden als Erste unter dem Sauerstoffmangel. Das Gehirn benötigt am meisten Energie – fehlt der Sauerstoff, wird man innerhalb von Sekunden bewusstlos. Aber auch die Muskelaktivität, die für das Herz und die Atmung zuständig sind, kann nicht weiter ausgeführt werden – es kommt zum Atem- und Herzstillstand.
Verliert der Körper Blut, hat er Möglichkeiten, sich selbst zu helfen. Geringer Blutverlust ist kaum von Bedeutung. Zwanzig bis fünfundzwanzig Prozent kann der Körper kompensieren: Er zieht Wasser aus den Zellen, um das Volumen des Bluts zu erhöhen, und er verengt die unwichtigen Gefäße von Armen, Beinen und dem Magen-Darm-Trakt, damit die Aktivität von Herz und Hirn so lange wie möglich aufrechterhalten werden kann. Ab einem Verlust von dreißig Prozent – besonders dann, wenn er plötzlich geschieht – ist eine Kompensation kaum noch möglich. Ob am Ende das Herz als Erstes aufgibt oder das Hirn, ist schwer zu sagen.
Ohne Blut kein Sauerstoff. Ohne Sauerstoff keine Energie. Ohne Energie kein Leben.
Als ich am Montagmorgen die Akademie erreiche, sehe ich sofort, dass sich der Mord inzwischen herumgesprochen hat. Ein Übertragungswagen parkt an der Straße, und ein Stück daneben steht eine Moderatorin, die dem andauernden Regen trotzt, in eine Kamera spricht und dabei auf den Durchgang zum Innenhof deutet. Obwohl ich genauso gut außen um die Anlage herumgehen könnte, um zu meinem Gebäude zu gelangen, merke ich, wie es mich ebenfalls in die Richtung zieht. Ich laufe durch den Bogengang, vorbei an den Studierenden, die in Gruppen zusammenstehen und aufgeregt tuscheln, und betrete den Innenhof. Schon der Anblick des Platzes lässt erahnen, was hier vor zwei Tagen geschehen ist: Die gepflegten Rasenflächen sind aufgeweicht und von den schweren Schuhen der Einsatzkräfte zertrampelt, und auf der Treppe vor dem Rektoratseingang liegen bereits die ersten Blumen und brennen Kerzen.
Ich habe gestern kurz gegoogelt und einige knappe Pressemitteilungen gefunden, die mir meine Vermutung bestätigt haben: Der Tote war Johann Sailer, der neue Rektor der Akademie. Weitere Details über ein mögliches Motiv oder einen Tatverdächtigen wurden nicht erwähnt, und ich habe auch nicht weiter nachgeforscht. Je mehr ich darüber gelesen habe, desto mehr drängten sich die Bilder von Samstag in mein Bewusstsein. So kitschig ich die Blumen und Kerzen auf der Treppe auch finde, hoffe ich, dass der Anblick die Erinnerung überschreibt, wie das Blut unter dem Toten hervorquoll.
Ich stehe ein wenig abseits und schaue mich um. Von hier draußen sieht alles ganz anders aus. Beengter. Unübersichtlicher. Der Mörder muss gewusst haben, dass sein Opfer im Rektorat sein würde, muss irgendwo hier auf der Lauer gelegen haben, um dann blitzschnell zuzuschlagen. Mein Blick wandert zu den Fenstern der Gebäude um mich herum, schweift über das Rektorat, die Büros an der Stirnseite, zur Bibliothek gegenüber. Hier und da sehe ich Gesichter hinter den Glasscheiben, und mit einem Mal fühle ich mich unangenehm beobachtet. Der Kerl im dunklen Mantel fällt mir wieder ein, wie er sich umsah, so wie ich es jetzt tue. Als mir bewusst wird, dass ich an derselben Stelle stehe wie er am Samstag, läuft es mir kalt den Rücken hinunter.
Reiß dich zusammen, ermahne ich mich. Dann drehe ich mich um und gehe.
Als ich das Hauptgebäude der Akademie betrete, empfängt mich sofort diese eigentümliche Atmosphäre, die ich schon in der Bibliothek wahrgenommen habe und die so typisch ist für alte Gebäude – als hätten in den Wänden und Deckenbalken die Geister der Vergangenheit überdauert. Die Klosteranlage ist im zwölften Jahrhundert erbaut worden. Schon damals wurden hier junge Mönche zu Ärzten ausgebildet und auch noch lange, nachdem die Universitäten die Vorrangstellung in der medizinischen Forschung erobert hatten. Doch irgendwann wurde das Kloster aufgegeben und stand viele Jahre leer, bis ein Investor es kaufte, umbaute und schließlich die Wilhelm-Schreiber-Akademie darin einzog, eine private Hochschule für Medizin. Trotz aller Modernisierungen hat man darauf geachtet, den Charakter der alten Klosteranlage zu erhalten. Moderne Wissenschaften in historischem Gewand, sozusagen.
Während ich auf der Suche nach meinem Hörsaal den Flur entlanggehe, betrachte ich die glänzenden Steinfußböden, Wandmalereien und stuckverzierten Decken. Ich mache mir nicht viel aus Architektur, aber ich spüre, dass dieser Ort eine Geschichte hat. Vor Dingen, die Jahrhunderte überdauern, sollte jeder Ehrfurcht haben. Sie schaffen damit etwas, zu dem wir Menschen nicht in der Lage sind.
Um mich herum herrscht reger Betrieb, vermutlich nicht verwunderlich am ersten Tag des Semesters. Studierende eilen durch die Korridore zu ihren Vorlesungen oder Seminaren. Einige blockieren den Aufgang zur Treppe, während sie einander von ihren Praktika erzählen, die sie in den Ferien gemacht haben. Ich schiebe mich an ihnen vorbei, gehe nach oben und steuere die breite Doppeltür an, die in das Auditorium führt, in dem heute Morgen die Einführungsveranstaltung für die Erstsemester stattfindet.
Ich betrete den Raum und sehe mich überrascht um. Schon zu Klosterzeiten muss dies ein alter Anatomie-Hörsaal gewesen sein, in dem vor den Augen der Studierenden Leichen seziert wurden – was ziemlich fortschrittlich war für einen Klosterbetrieb, hatte die Kirche doch genau das lange Zeit verboten. Die im Halbkreis angeordneten Sitzreihen aus dunklem Holz verlaufen steil bis nach unten zu einer Art Bühne, auf der sich anstatt eines Seziertisches inzwischen ein Stehpult mit Mikrofon befindet. In den Raum müssen an die einhundert Personen passen – weit mehr, als es Erstsemester gibt. An der Schreiber werden nicht viele aufgenommen, daher sind noch etliche Plätze frei. Ich sehe Mira, die mir fröhlich zuwinkt, aber ich erwidere die Geste nur knapp und setze mich in die letzte Reihe, die ich fast ganz für mich allein habe.
Die meisten Erstsemester scheinen sich bereits zu kennen oder zumindest keine Zeit zu verlieren, neue Freundschaften zu schließen. Das Summen leiser, aufgeregter Gespräche erfüllt den Raum. Ich kann mir denken, worum es geht. Ich erkenne es an dem sensationslustigen Ausdruck in den Gesichtern, an dem fassungslosen Kopfschütteln, an dem dramatischen Unterton, der in den Gesprächen mitschwingt.
»Hey«, sagt plötzlich eine Stimme. Ein Student in Jeans und Karohemd deutet auf den Platz neben mir. »Ist hier noch frei?« Er lächelt verlegen, was zwei tiefe Grübchen in seine Wangen gräbt.
Ich ziehe bloß eine Augenbraue hoch und wende demonstrativ den Blick ab.
»Uh, okay. Das werte ich mal als ein Ja.« Er gleitet auf den Sitz und stellt seine Tasche neben sich auf den Boden. »Ich bin Benedikt. Aber alle nennen mich Ben. Und du?«
»Quinn«, brumme ich in der Hoffnung, dass er mich endlich in Ruhe lässt.
Einen Augenblick lang schweigt er, und ich glaube schon, dass er es kapiert hat. Hat er nicht. »Ist das auch dein erster Tag?«
»Das hier ist die Einführungsveranstaltung für neue Studierende. Es wäre ziemlich dämlich, wenn irgendjemand zweimal daran teilnähme, meinst du nicht auch?«
Ben verzieht das Gesicht. »Schon gut. Ich wollte nur nett sein.«
Unwillkürlich steigt das schlechte Gewissen in mir auf, doch ich kämpfe es sofort nieder. Ich bin hier, um zu lernen, nicht, um neue Freunde zu finden.
Ein Mann mit grauen Haaren und einem tadellos sitzenden Nadelstreifenanzug tritt aus einer Seitentür neben der Bühne und geht vor bis zum Stehpult. Die Gespräche im Saal verstummen. Die meisten Studierenden haben Laptops dabei, um mitzuschreiben, vor anderen liegen Notizblock und Kugelschreiber auf dem Tisch. Ben nestelt ebenfalls in seiner Tasche herum und fördert einen Collegeblock zutage. »Shit«, murmelt er und kramt noch eine Weile weiter, dann beugt er sich zu einer Studentin, die in der Reihe vor uns sitzt, und tippt ihr auf die Schulter. »Hast du zufällig einen Stift, den du mir leihen kannst? Ich hab meinen vergessen.«
Sie schüttelt den Kopf, und auch ihre Nachbarin hat keinen. Ich seufze genervt, ziehe einen Kugelschreiber aus meiner Tasche und halte ihn Ben wortlos hin.
Er starrt auf den Stift, als hätte er Angst, dass ich ihn damit ersteche. Dann entspannen sich seine Gesichtszüge. »Danke«, wispert er und nimmt ihn entgegen. »Kriegst du nachher zurück.«
Der Dozent drückt ein paar Knöpfe am Stehpult, woraufhin die Lichter über den Sitzreihen gedimmt werden und nur noch er und die Bühne hell erleuchtet sind. »Guten Morgen.« Seine tiefe Stimme dringt aus den Lautsprechern, die überall an den Wänden angebracht sind, und füllt den kompletten Saal. »Mein Name ist Professor Weber, ich bin stellvertretender Rektor der Wilhelm-Schreiber-Akademie und der Fachbereichsleiter Humanmedizin.« Er räuspert sich. »Bevor ich zur eigentlichen Vorlesung komme, habe ich die unangenehme Aufgabe, Ihnen mitzuteilen, dass sich vor zwei Tagen hier auf dem Campus ein Todesfall ereignet hat. Dr.Johann Sailer, neuer Rektor unserer Akademie, ist erschossen worden.«
Lautes Gemurmel bricht aus, und der Professor wartet, bis sich die größte Aufregung gelegt hat, bevor er fortfährt. »Unmittelbare Gefahr besteht nicht mehr – die Polizei geht davon aus, dass der Mord persönlich motiviert war. Sie tut alles, was in ihrer Macht steht, um den Täter so schnell wie möglich zu fassen. Das Rektorat bleibt diese Woche geschlossen. Der Tatort ist heute Morgen freigegeben worden, trotzdem möchten wir Sie bitten, den nötigen Respekt zu wahren und keine Fotos oder Videos davon aufzunehmen.« Er fährt über sein Jackett und streicht ein paar Falten glatt, die niemand außer ihm sieht. Fast scheint es, als wäre er verlegen. »Einige Kollegen lassen heute ihre Veranstaltungen ausfallen, und selbstverständlich steht es auch Ihnen frei zu gehen. Ich werde meine Vorlesung trotzdem halten. Denn so herzlos es klingen mag: Das Leben muss weitergehen.«
The show must go on. Ich verziehe das Gesicht. Willkommen in meinem Leben.
Weber verstummt und lässt den Blick über die Reihen schweifen. Die meisten Studierenden sehen betreten auf den Tisch vor sich. Es ist so still, dass man jedes Scharren der Füße auf dem Boden hört. Aber niemand verlässt den Saal. Weber nickt, dann greift er zu seinen Unterlagen und schlägt die erste Seite seines Skripts auf. »Nun gut. Fangen wir an.« Er räuspert sich erneut. »Ich begrüße Sie zu Ihrem ersten Tag an der Wilhelm-Schreiber-Akademie für Medizin. Sie alle sind nicht zufällig hier, sondern haben sich bewusst für diese Hochschule entschieden. Sie wissen, welche außergewöhnliche Ausbildung Ihnen hier geboten wird, und Sie wollen zu den Besten gehören. Die Wilhelm-Schreiber-Akademie ist keine normale Universität. Hier wird viel von Ihnen verlangt, mehr als an jeder anderen Hochschule, aber dafür werden Ihnen am Ende Ihres Studiums alle Türen offenstehen.«
Ich muss mich zusammenreißen, um nicht mit den Augen zu rollen. Ja, die Schreiber ist keine normale Uni, sondern eine private Hochschule, die ihre eigenen Regeln schreibt. Man muss einen höllisch schweren Aufnahmetest bestehen und sich außerdem die horrenden Studiengebühren leisten können, was dazu führt, das die meisten hier aus äußert wohlhabenden Familien kommen. Dieses elitäre Trara interessiert mich nicht, dafür aber die Geschwindigkeit, mit der man hier studiert: Die Ferien sind kürzer, die Anforderungen höher. Perfekt für jemanden, der nicht mehr so viel Zeit hat.
»Die moderne Medizin und das Wissen der Ärzte haben einen langen Weg hinter sich«, fährt Weber fort. »Über Jahrhunderte galt der Aderlass als anerkanntes Mittel, um schlechtes Blut loszuwerden und die Körpersäfte in Einklang zu bringen. Bei Verdauungsbeschwerden wurden Holzstäbe durch die Bauchdecke bis in den Darm gestoßen; bei Magenproblemen galten Wickel aus gewalztem Wirsing als beste Behandlungsmethode; während der Geburt wurden Frauen aufgeschnitten, ohne dass man es für nötig hielt, sie anschließend wieder zuzunähen. Raten Sie mal, wie viele den Eingriff überlebt haben.«
Die meisten Studierenden schnauben amüsiert auf.
»Ja, lachen Sie ruhig«, meint Weber. »Sie haben recht – über diese Behandlungsmethoden können wir heute nur noch den Kopf schütteln. Aber die Menschen damals wussten es nicht besser. Sie wussten nichts über Viren und Bakterien, über den Kreislauf des Blutes, die Vernetzung unserer Nervenzellen oder die Zusammensetzung unserer Knochen.
Doch wir haben dazugelernt. Im Laufe der Jahrhunderte haben wir die Narkose erfunden, Arzneien und Impfstoffe entwickelt, das menschliche Genom entschlüsselt. Heute benutzen wir Medizin, die auf Gentechnik basiert, auf pharmazeutisch-chemischen Erkenntnissen, auf computerbasierter Forschung. Wir führen minimalinvasive Operationen durch, können mithilfe von bildgebenden Verfahren in das Innere des Körpers sehen, ohne ihn aufschneiden zu müssen, entwickeln molekulargesteuerte Therapien, die auf der DNA des einzelnen Patienten beruhen. Die Zukunft klopft bereits an die Tür, und sie hält noch ganz andere Möglichkeiten bereit. Möglichkeiten, die Menschen vor zweitausend Jahren für pure Hexerei gehalten hätten: Nanoroboter, die Krebszellen bekämpfen, Gehirnimplantate, die eine Verbindung zu Exoskeletten herstellen, oder künstliche Organe aus 3D-Druckern. Und das sind nur einige Beispiele, die in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommen.
Allerdings gibt es Krankheiten, die wir – noch – nicht heilen können. Zudem entwickeln sich ständig neue, die uns vor noch größere Herausforderungen stellen. Vielleicht stößt irgendwann jemand auf den Heiligen Gral, durch den sich alle ungelösten Probleme der Medizin beheben lassen. Vielleicht müssen wir aber auch akzeptieren, dass uns immer Grenzen gesetzt sein werden. Wir können keine Wunder vollbringen. Aber wir können versuchen, die Grenzen des Machbaren Stück für Stück zu erweitern.
Die meisten von Ihnen werden sich nach dem Abschluss ihres Studiums um gebrochene Knochen oder verrenkte Gliedmaßen kümmern, um Infektionskrankheiten oder Herzbeschwerden. Einige werden in die Forschung gehen und dazu beizutragen, dass wir die Leiden der Menschen in Zukunft immer gezielter bekämpfen. Egal, für welche Richtung Sie sich entscheiden, es liegt noch ein weiter Weg vor Ihnen. Er wird nicht einfach werden. Aber wenn Sie ihn konsequent weitergehen und dabei alle Hürden nehmen, dann sind Sie in ein paar Jahren dort, wo Sie sein wollen.«
Während Weber nun auf die einzelnen Berufsfelder eingeht, die uns das Studium der Medizin eröffnet, lässt meine Aufmerksamkeit nach. Ich beobachte meine Kommilitonen in den Sitzen vor mir. Ein Großteil schreibt jedes Wort mit; auch Ben hat schon zwei Seiten seines Collegeblocks vollgekritzelt.
Als er meinen Blick bemerkt, sieht er erst zu mir, dann auf den leeren Tisch vor mir. »Oh Gott, war das dein einziger Stift? Wenn du willst, kopiere ich dir meine Notizen nachher.«
Ich schnaube. »Warum notierst du dir das alles? Hast du vergessen, warum du Medizin studierst?«
»Weißt du es denn?«
Weil ich todkrank bin.
Weil ich sterben werde.
Weil ich den Tod verstehen will.
Alles gute Antworten, aber keine davon wird er bekommen. »Ja«, sage ich nur, dann wende ich mich ab und sehe wieder nach unten zur Bühne. Allerdings haben Bens Worte einen Nerv in mir getroffen. Unwillkürlich frage ich mich, was in aller Welt ich hier eigentlich mache. Ich höre mir etwas über berufliche Perspektiven von einem Studium an, das mindestens sechs Jahre dauert! So viel Zeit habe ich nicht. Wenn ich Pech habe, bleibt mir nicht mal mehr eins. Ich überlege, einfach aufzustehen und zu gehen. Vielleicht sollte ich mich besser in die Bibliothek setzen und mich auf eigene Faust mit den Fachbüchern vertraut machen.
Mein Handy vibriert zweimal kurz in meiner Tasche. Ich hole es heraus und öffne die Nachricht. Sie ist von Flo.
FloHey, Q, Mittagessen muss heute ausfallen. Sry
Enttäuschung macht sich in mir breit. Ich hatte mich gefreut, Flo heute zu sehen.
QuinnWieso?
Es dauert eine Weile, bis er antwortet.
FloFühl mich nicht so gut.
QuinnOkay. Morgen?
FloIch meld mich noch mal.
Ich warte, dass Flo noch etwas hinzufügt. Er ist der einzige Mensch, bei dem ich mich nicht verstellen muss. Der einzige, der mich wirklich kennt, der weiß, was mit mir los ist, der mir verzeiht, wenn ich bissig oder abweisend bin oder in einem Tief stecke, aus dem ich nur mit bitterbösem Zynismus wieder herauskomme. Ich habe ihn vermisst, als er mit der Schule fertig war und hierhergezogen ist, daher hatte ich mich gefreut, jetzt wieder mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Doch stattdessen hält er mich auf Distanz.
Als keine Antwort mehr kommt, stecke ich das Handy wieder weg. Dann lehne ich mich seufzend zurück und lasse den Vortrag von Weber über mich ergehen. Ich sollte dem Ganzen eine Chance geben. Wenigstens in der ersten Woche.
Drei Stunden später trinke ich den letzten Schluck meines Kaffees, der mein geplatztes Mittagessen mit Flo ersetzt hat, werfe den leeren Becher in einen Mülleimer und betrete die Bibliothek. Die Atmosphäre fühlt sich heute anders an, lebendiger, auch wenn kaum ein Wort gesprochen wird. Hinter der Ausleihtheke sortiert ein Bibliothekar zurückgegebene Bücher; in den Gängen sind vereinzelt Studierende auf der Suche nach der richtigen Fachliteratur, und auch einige der Lesetische sind besetzt. Ich ziehe mich ein wenig abseits in eine Nische zurück, hole das über tausend Seiten dicke Physiologie-Lehrbuch aus der Tasche und lege es vor mich auf den Tisch. Es ist Teil der Leseliste für Erstsemester, also habe ich es vorhin in einer Buchhandlung in der Nähe besorgt. Ich schlage es auf und will mich gerade in das erste Kapitel vertiefen, als jemand an meinen Tisch tritt.
»Ähm, hey.«
Ich schaue hoch. Es ist Ben. »Was willst du?«, brumme ich unwirsch.
Er lächelt unsicher und hält mir meinen Stift entgegen. »Du bist nach der Vorlesung einfach gegangen. Dabei willst du den hier bestimmt wiederhaben. Ich hab auch in Terminologie nach dir Ausschau gehalten, dich aber nicht gesehen. Na ja, aber jetzt hat’s ja zufällig geklappt.«
Zerknirscht wegen meiner ruppigen Reaktion, nehme ich den Stift entgegen. Ich bin wirklich unschlagbar darin, Leute abzuweisen, bevor ich überhaupt weiß, was sie von mir wollen. »Sorry … und danke.«
»Klar, kein Ding.« Ben sieht erleichtert aus. Vermutlich hat er damit gerechnet, dass ich ihn doch noch erdolche.
Ich wende mich wieder dem Buch zu, aber anstatt zu gehen, bleibt er weiter unschlüssig neben mir stehen.
»Das ist ein ziemlich teurer Stift«, sagt er schließlich.
Ich sehe auf. »Stimmt.«
»Mit Gravur.«
»Mhm.«
»Da steht Wilhelm Schreiber drauf.«
Oh nein. Bitte nicht. »Und?«, frage ich unwirsch.
»Er war jahrelang Rektor der Akademie. Nach ihm wurde sie benannt.«
»Worauf willst du hinaus?«
»Hast du ihn gekannt?«
»Warum interessiert dich das?«
Ben zuckt mit den Schultern. »Ich weiß nicht … immerhin ist er einer der berühmtesten Mediziner der letzten Jahre.«
Ich komme wohl nicht drum herum. »Er war mein Großvater.«
»Wow. Das ist echt abgefahren.« Ben wirkt ehrlich beeindruckt. Ich kenne die Reaktion schon und wundere mich dennoch jedes Mal darüber, schließlich kann ich nichts dafür, mit wem ich verwandt bin. Verlegen fährt er sich mit der Hand durch die Haare. »Ist das nicht total krass mit dem Mord?«, fragt er dann. »Echt gruselig, so sein Studium zu beginnen.«
Ich kapier es nicht. Seit er sich heute Morgen neben mich gesetzt hat, verhalte ich mich ihm gegenüber ablehnend. Aber er geht einfach nicht. »Du hast mir den Stift zurückgegeben«, sage ich. »Warum bist du immer noch hier?«
»Ich wollte nur … Ich kenn hier niemanden und …«
»Versuch nicht, dich mit mir anzufreunden.«
»Warum nicht?«
»Lass es einfach.«
»Okay.« Er ringt sich ein Lächeln ab, vermutlich, um zu überspielen, wie sehr ich ihn verletzt habe. »Vielleicht … sieht man sich ja noch mal irgendwann.«
Er geht zurück zu seinem Platz und beugt sich über die Unterlagen, die dort aufgeschlagen liegen. Wieder regt sich das schlechte Gewissen in mir. Er wollte nur nett sein – aber gerade deshalb sollte er sich von mir fernhalten. Ich betrachte ihn verstohlen: blonde Haare, blaue Augen, sportlich und mit einem Karohemd, das so aus der Mode ist, dass es schon wieder cool wirkt. Im Grunde tue ich ihm einen Gefallen, wenn ich so schroff zu ihm bin. Er wird garantiert kein Problem haben, andere Freunde zu finden. Mit mir verschwendet er nur seine Zeit.
»Quinn Schreiber?« Die Sprechstundenhilfe sieht sich suchend im Wartezimmer um, in dem fast ausschließlich alte Leute sitzen.
Ich stehe auf und folge ihr. Doch anstatt in ein Labor zu gehen, in dem normalerweise Blut abgenommen wird, führt sie mich in das Sprechzimmer.
»Nehmen Sie Platz. Dr.Brinkwarth ist gleich bei Ihnen.«
»Eigentlich komme ich nur zum Blutabnehmen«, sage ich.
»Sie sind zum ersten Mal hier«, erwidert die Frau. »Da möchte Dr.Brinkwarth Sie gerne persönlich sprechen.« Sie ruft meine Akte auf dem Computer auf, die mein alter Hausarzt geschickt hat, lächelt mir noch einmal zu und geht wieder.





























