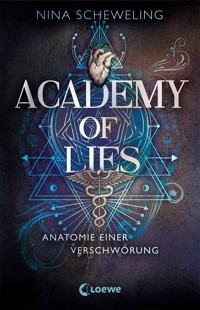14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Willst du den Full Dive erleben? Auch, wenn du das Spiel vielleicht nie wieder verlassen kannst? Ein moderner Near Future Thriller über ein Videospiel auf Leben und Tod Jess ist zwar leidenschaftlicher Gamer, aber längst nicht so gut wie sein großer Bruder Jaxon. Als Jaxon verhaftet wird, schleust sich Jess an seiner Stelle bei einem Test für ein Videospiel mit neuartiger Technologie ein. Jess interessiert eigentlich nur das Preisgeld, das seine Familie dringend braucht. Doch schon bald stellen er und seine Mitspielerin Rumi fest, dass es bei diesem angeblichen Spiel um Gedankenkontrolle geht – und dass finstere Mächte an dem verborgenen Algorithmus interessiert sind. Und was noch schlimmer ist: Wenn Jess und Rumi den Algorithmus nicht finden, werden sie das Spiel nie wieder verlassen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Nina Scheweling
Full Dive
Glaubst du wirklich, es ist nur ein Spiel?
Über dieses Buch
Jess ist zwar leidenschaftlicher Gamer, aber längst nicht so gut wie sein großer Bruder Jaxon, ein Aktivist und Hacker. Als Jaxon wegen seiner Tätigkeiten verhaftet wird, schleust sich Jess an seiner Stelle bei einem Test für ein Videospiel mit neuartiger Technologie ein. Jess interessiert eigentlich nur das Preisgeld, das seine Familie dringend braucht. Doch schon bald stellen er und seine Mitspielerin Rumi fest, dass es bei diesem angeblichen Spiel tatsächlich um Gedankenkontrolle geht – und dass finstere Mächte an dem Algorithmus interessiert sind, der in diesem Spiel verborgen ist. Und was noch schlimmer ist: Wenn Jess und Rumi den Algorithmus nicht finden, werden sie das Spiel nie wieder verlassen ...
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de/kinderbuch-jugendbuch
Biografie
Nina Scheweling war während ihres Studiums der Anglistik, Germanistik und Neueren Geschichte als Literaturübersetzerin tätig. Nach ihrem Abschluss entdeckte sie ihre Liebe fürs Kinderbuch und arbeitet seitdem als freie Übersetzerin, Lektorin und Autorin in der Nähe von Freiburg.
Inhalt
Teil 1 Aufbruch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Teil 2 Schöne neue Welt
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Teil 3 Das Spiel beginnt
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Teil 4 Drachenjagd
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
Teil 5 Wer nicht kämpft …
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
Teil 1Aufbruch
1
Irgendwo über ihm raschelte es. Jess sah nach oben, doch in der Dunkelheit, in der sich die Decke verlor, konnte er nichts erkennen. Sein Herzschlag hallte dumpf in seinen Ohren wider. Worauf hatte er sich bloß eingelassen?
Noch ein Geräusch, dieses Mal hinter ihm. Waren das Schritte? Hektisch riss er den Kopf herum. Der Schwindel ließ kurz seine Sicht verschwimmen. Jess biss die Zähne zusammen und drängte das schwammige Gefühl in seinem Kopf zurück. Die Lagerhalle hinter ihm wirkte verlassen, doch in Wahrheit konnten sie überall sein: zwischen den riesigen Metallfässern, den stapelhohen Paletten, den Rohren, aus denen zischend Dampf entwich. Jess fluchte lautlos. Sie durften ihn nicht erwischen. Er besaß den Schlüssel nach draußen. Wenn er es nicht bis zur Tür am Ende der Halle schaffte, war es aus.
Ein metallisches Klappern erklang, hektische Rufe, Schüsse. Erschrocken sah Jess zu dem Steg, der oberhalb von ihm an der Wand entlanglief. Eine junge Frau in einem ledernen Kampfanzug rannte Richtung Ausgang. Yara. Sie hatte sich für den riskanteren, aber schnelleren Weg entschieden, vorbei an den zwei Söldnern, die auf Höhe der Leiter patrouillierten. Jess war den beiden vorsichtshalber aus dem Weg gegangen, huschte seitdem mühsam von einer Deckung zur nächsten und versuchte, so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu erregen. Denn die Söldner waren nicht die Einzigen, die in den Schatten lauerten.
Wieder polterte es auf dem Steg. Eine massige Gestalt stürmte hinter Yara her, eine Waffe im Anschlag, die beinahe so groß war wie Jess selbst. Entsetzt stellte er fest, dass sie viel zu wenig Vorsprung hatte – ihr Verfolger war in der perfekten Schussposition. Er musste etwas tun, Yara warnen, den Gegner ablenken, irgendwas. Stattdessen kauerte er wie festgefroren hinter der Kiste, unfähig, sich zu rühren.
Ein Schuss peitschte durch die Halle. Jess erkannte das Mündungsfeuer der Waffe, den grellgrünen Strahl, der direkt auf Yaras Rücken zuschoss. Sie warf sich nach vorn, wich in einer eleganten Vorwärtsrolle aus, und noch bevor sie wieder auf den Füßen stand, hatte sie ihre eigene Waffe gezogen und feuerte eine Salve ab, die den Söldner mitten in die Brust traf und seinen massigen Körper nach hinten warf. Die Energieleiste über seinem Kopf wechselte von rot zu schwarz, und in Jess’ Blickfeld blinkte kurz die Nachricht Enemy down auf. Irgendwo in der Dunkelheit des Stegs musste noch der zweite Söldner sein, aber nun hatte Yara genug Vorsprung, um den Ausgang zu erreichen und von hier zu verschwinden.
Sofern Jess bis dahin die Tür aufgeschlossen hatte.
In dem Moment entdeckte Yara ihn hinter der Kiste. «Was hockst du denn da rum?», rief sie genervt. Ihre Stimme klang verzerrt und blechern in Jess’ Ohren. Der Unfall mit der Cola hatte dem Headset offenbar mehr zugesetzt als gedacht. «Beeil dich, sonst schaffen wir es wieder nicht.»
«Ich will nur sichergehen, dass –»
«Sichergehen.» Yara seufzte. «Dafür spielen wir das falsche Spiel, Jess. Beweg deinen Arsch!»
Sie steckte ihre Waffe zurück in den Waffengürtel und lief weiter. Nur Sekunden später tauchte auch der zweite Söldner auf, sprang über den leblosen Körper seines Kollegen, als bemerke er ihn gar nicht, und rannte Yara nach.
Jess schloss die Augen und atmete durch. Es war nur ein Spiel, sagte er sich wieder und wieder. Nur ein Spiel.
Vorsichtig spähte er um die Kiste herum in den Gang, an dessen Ende der Ausgang lag. Er schien verlassen zu sein, doch Jess wusste, dass der erste Eindruck meist trog. In jedem Spalt konnte jemand lauern, jeder Schatten konnte zum Leben erwachen, alles hier in dieser Halle war darauf ausgerichtet, ihn zu töten. Rasch kauerte Jess sich wieder hinter die Kiste. Sein Herz schlug bis zum Hals, und sein Körper war so vollgepumpt mit Adrenalin, dass er anfing zu zittern. Er konnte das nicht. Das war einfach nicht sein Ding. Warum zum Teufel hatte er bloß mitgemacht?
Hör auf mit dem Gejammer, schalt er sich. In Wahrheit hast du bloß Angst. Angst vor einem Spiel … So was Bescheuertes!
Beweg deinen Arsch.
Jess drückte den Joystick seines Controllers nach vorn. Seine Spielfigur setzte sich in Bewegung und bog um die Kiste in den Gang. Ein Schatten huschte in eine Lücke zwischen zwei Fässern. Er hörte ein Scharren, dann ein Trippeln. Diese verdammte Dunkelheit! Er konnte so gut wie nichts erkennen.
Sein Herz schlug so schnell, dass er das Gefühl hatte, es würde gleich explodieren. Ihm fiel der Nachtsicht-Modus wieder ein. Hektisch drückte er eine Tastenkombination, doch anstatt seine Umgebung schemenhaft aufleuchten zu sehen, erkannte er nur noch verschwommenes Grau-Braun. Den Zoom. Er hatte aus Versehen den Zoom eingeschaltet. Wieder ein Trippeln, näher diesmal. Rasch schaltete Jess das Fernglas wieder aus. Warum konnte er sich diese verfluchten Tasten nicht merken?
Er hörte das Fauchen erst, als es schon zu spät war. Sein Körper blinkte auf, und die Energieleiste unten in seinem Sichtfeld begann zu schrumpfen. Jess drehte sich um und sah in die toten Augen eines Zombies, der sich von hinten auf ihn gestürzt hatte. Hektisch wählte Jess eine Waffe aus seinem Inventar, irgendeine, Hauptsache, er bekam das Ding abgeschüttelt, bevor seine Energie endgültig verbraucht war. Unbeholfen schlug er auf den Zombie ein, bis er endlich von ihm abließ und ein paar Schritte zurücktaumelte. Aus seinem Maul troff Blut – sein Blut, nahm Jess an, und war heilfroh, dass er die Schmerzen seiner Spielfigur nicht wirklich empfand. Die rote Energieleiste über dem Kopf des Untoten war geschrumpft, Jess musste ihn also getroffen haben. Noch zwei, drei Treffer, und er wäre endgültig erledigt.
Der Zombie fixierte Jess mit starrem, lauerndem Blick. Dann stieß er ein gurgelndes Fauchen aus und sprang auf ihn zu. Jess drehte sich um – und rannte los.
Ich verdammter Idiot!Warum habe ich ihn nicht ausgeschaltet? Jess hätte sich am liebsten geohrfeigt. Aber nun war es zu spät. Seine Deckung war aufgeflogen. Er konnte förmlich spüren, wie sämtliche Gegner bei dem Gepolter seiner Schritte aufhorchten. Er hatte nur noch eine Chance: Er musste den Ausgang erreichen, bevor sie ihn erreichten. Er rannte den Gang entlang auf die Tür zu, die sich als schemenhaftes Rechteck am Ende der Halle abzeichnete. Daneben erkannte er die Umrisse von Yaras Spielfigur.
«Hey, Mann, was machst du denn?», drang ihre blecherne Stimme aus dem Headset.
«Wenn ich schnell genug an der Tür bin, dann …»
Die beiden Zombies kamen wie aus dem Nichts. Aus einem Gang zwischen aufgestapelten Fässern sprangen sie ihm in den Weg, die Mäuler zu einem triumphierenden Grinsen verzogen.
Jess stoppte abrupt ab, sah sich verzweifelt nach einem Ausweg um. Doch es gab keinen. Nur wenige Meter hinter ihm tauchten vier massige Gestalten auf, Söldner wie der, der Yara verfolgt hatte. Und über ihm in der Luft hörte er das Rauschen von Flügeln, die den Gargoyles gehören mussten, die an der Decke der riesigen Lagerhalle lebten. Die Umgebung begann zu ruckeln, wurde unscharf und verpixelt. Jess stöhnte auf. Das schaffte auch nur er – so viele Gegner auf einmal anzulocken, dass der Prozessor nicht mehr hinterherkam. Gegen diese Übermacht hatte er keine Chance. Er schloss die Augen und biss sich so fest auf die Lippen, dass er Blut schmeckte. Das war’s. Jesper Adams hatte wie immer versagt.
«Kämpf, verdammt noch mal!», rief Yara. «Gib nicht einfach auf. Noch bist du nicht tot!»
Jess öffnete die Augen und sah, wie Yara auf ihn zustürmte und bereits die ersten zwei Gegner ausgeschaltet hatte. Hastig griff er nach seiner Waffe, doch es war zu spät. Der giftgrüne Strahl eines Ziellasers war direkt auf sein Herz gerichtet. Bevor er reagieren konnte, sah er die Mündung der Waffe aufblitzen. Der Schuss knallte wie ein Peitschenschlag durch die Halle. Sein Körper blinkte wieder auf, seine Energieleiste leerte sich mit einem Schlag. Dann wurde alles schwarz.
Das rote Game Over waberte und pulsierte anklagend vor seinen Augen. Nachdem der deprimierende Jingle verstummt war, der den Tod seiner Spielfigur tragisch untermalte, blieb Jess noch für einen Moment sitzen und lauschte dem Geräusch seines eigenen Atems. Er hatte es mal wieder verbockt.
Seufzend zog er die VR-Brille ab und brauchte zwei, drei Sekunden, um sich zu orientieren – wie immer, wenn er aus einem Spiel kam. Anstatt in der düsteren, riesigen Lagerhalle voller Zombies und Söldner befand er sich auf dem Boden in Yaras abgedunkeltem Zimmer zwischen Umzugskartons und auseinandergebauten Möbeln. Seine beste Freundin saß neben ihm und funkelte ihn genervt an.
«Warum hast du den Typen denn nicht die Rübe abgehauen?», fragte sie. «Das kann doch nicht so schwer sein.»
«Für dich vielleicht», erwiderte Jess und rieb sich über die Druckstellen, die die Brille auf seiner Stirn hinterlassen hatte. «Du weißt genau, wie nervös ich bei diesem Zombie-Shooter-Mist immer werde.»
Yara verdrehte die Augen. «Mein Fehler. Ich gebe einfach die Hoffnung nicht auf, dass etwas von deinem großen Bruder auf dich abfärbt.» Sie seufzte. «Was würde ich dafür geben, einmal zusammen mit dem berühmten Prometheus zu spielen.»
Jess schnaubte. «Mit Jaxon? Vergiss es. Der gibt sich doch nicht mit Gelegenheitsspielern wie uns ab.»
«Ich hab gesehen, dass er vor ein paar Tagen den Online-Highscore von Zombie Empire geknackt hat. Du dagegen» – sie betrachtete Jess kopfschüttelnd, bevor sich ihr Gesicht zu einem Grinsen verzog – «bist der schlechteste Spieler, den ich je erlebt habe.»
Jess lächelte gequält. Ja, das war er vermutlich wirklich. Er hatte nichts gegen Videospiele, er spielte selbst manchmal, wenn seine Mutter es nicht mitbekam, aber meist nur Strategie- oder Aufbauspiele. Bei den Ego-Shootern oder Actionspielen, vor allem in der Virtual Reality, hatte er meist zu viel Angst vor den Fights und versuchte, ihnen bestmöglich aus dem Weg zu gehen. Doch als Yara sich – sozusagen als Abschiedsgeschenk – einen Level eines angesagten Multiplayer-Games gewünscht hatte, hatte er schlecht Nein sagen können.
Es klopfte, und Yaras Vater steckte den Kopf zur Tür herein. «Hi, Jess», sagte er, und dann zu Yara: «Wir müssen noch den Keller durchgehen, um zu wissen, was mit soll und was nicht.»
Yara verdrehte die Augen. «Ich hasse packen», murrte sie.
Ihr Vater zuckte mit den Schultern. «Ich kann auch allein aussortieren. Aber dann darfst du dich hinterher nicht beschweren.»
«Schon gut, ich komm ja.»
Yaras Vater lächelte Jess zu, dann schloss er die Tür hinter sich. Für eine Weile saßen sie unschlüssig nebeneinander, und zum ersten Mal, seit Jess denken konnte, wussten sie beide nicht, was sie sagen sollten. Yara und er waren schon seit dem Kindergarten beste Freunde, hatten alles miteinander geteilt und waren immer füreinander da gewesen. Bis Yara ihm vor ein paar Wochen mitgeteilt hatte, dass ihre Mutter einen neuen Job angenommen hatte, fast 800 Kilometer entfernt, also gefühlt am anderen Ende der Welt. Yara war stinksauer gewesen – in zwei Jahren waren sie mit der Schule fertig, so lange hätten sie mit dem Umzug doch noch warten können. Stattdessen fand er bereits in zwei Tagen statt, und Jess hatte sofort einen Kloß im Hals, wenn er daran dachte.
«Ich sollte langsam los», sagte er schließlich und stand auf.
Yara erhob sich ebenfalls. «Also, wenn du mal quatschen willst oder so …», druckste sie herum. Ihr schien die ganze Situation ebenso schwerzufallen wie ihm. «Du kannst mich immer anrufen.»
Jess nickte bloß. Dann ging er hinaus in den Flur, in dem sich ähnlich viele Umzugskartons stapelten wie in Yaras Zimmer. An der Wohnungstür blieb er noch mal stehen, ohne recht zu wissen, was er nun machen sollte. Abschiede waren scheiße.
«Ach, verdammt», platzte es plötzlich aus ihm heraus. «Ich will einfach nicht, dass du gehst. Wenn du weg bist, hab ich hier überhaupt niemanden mehr. Außerhalb meiner verkorksten Familie, meine ich.»
«Dann wird es vielleicht Zeit, dass du mal aus deinem Schneckenhaus rauskommst», erwiderte Yara und boxte ihm spielerisch gegen die Schulter. «Wenn du immer nur mit gesenktem Blick durch die Gegend läufst und dich am liebsten unsichtbar machen würdest, sobald mehr als drei Leute im Raum sind, dann wird nie jemand feststellen, dass du in Wahrheit ein echt cooler Typ bist.»
Jess lächelte verlegen. «Und wie genau hast du das rausgefunden?»
«Weißt du noch, als mir beim Kindergartenausflug das Eis runtergefallen ist?»
«Klar. Du hast total geweint.»
«Und dann hast du mir deins gegeben. Wie kann man so jemanden nicht nett finden?»
«Wenn ich dir jetzt sage, dass ich Erdbeereis noch nie besonders mochte, ändert das dann deine Einschätzung?»
Yara schüttelte den Kopf. «Kein bisschen. Du hast ein goldenes Herz, Jesper Adams. Lass dir von niemandem was anderes einreden!» Sie sah ihn ernst an. «Nur an einer Sache musst du echt arbeiten: Sag Jaxon, er soll dir endlich vernünftiges Gameplay beibringen. Unfassbar, dass ihr miteinander verwandt seid.»
Jess grinste. «Ich fürchte, da ist nichts mehr zu machen.» Da er nicht wusste, was er noch sagen sollte, öffnete er die Tür.
Yara seufzte ergeben. «Wir bleiben in Kontakt, ja?»
«Klar.» Jess schlug gegen die Faust, die Yara ihm entgegenstreckte, dann wandte er sich um und lief so lässig wie möglich die Treppen nach unten ins Erdgeschoss.
Als er hörte, wie die Wohnungstür über ihm ins Schloss fiel, biss er sich auf die Lippe, die vom Spiel vorhin nur notdürftig verheilt war. Sofort spürte er wieder das Blut im Mund. Der Schmerz und der metallische Geschmack vertrieben die Tränen, die er nur mühsam hatte zurückhalten können. In letzter Zeit spürte er, wie er immer mehr den Halt verlor. Yaras Umzug war nur ein weiteres Brett, das ihm unter den Füßen weggezogen wurde. Und er fürchtete sich vor dem Zeitpunkt, wenn es keine Bretter mehr gab, auf denen er stehen konnte.
2
Jess trat in die Pedale, schlängelte sich durch den Feierabendverkehr und bog schließlich auf den Weg zur Hochhaussiedlung ein – anonyme, schmucklose Plattenbauten, umgeben von tristen Grünflächen. Seine Mutter, sein älterer Bruder Jaxon und er waren vor einem halben Jahr hierhergezogen, weil sie sich ihre alte Wohnung nicht mehr hatten leisten können, nachdem ihr Vater einfach abgehauen war. Er hatte von Abstand gesprochen, den er unbedingt brauchte, von Träumen, die er sich nicht erfüllen konnte, wenn er nebenher noch eine Familie finanzieren musste. Jaxon und Jess hatten zum Geburtstag eine Karte mit einer schmalzigen Nachricht und einem Geschenk-Gutschein bekommen; aber ansonsten hatten sie kein Wort mehr von ihm gehört, geschweige denn Geld für den Unterhalt gesehen.
Jess verließ den aufgeplatzten Fußgängerweg und fuhr quer über den kargen Rasen. So konnte er den Weg zu seinem Hochhaus abkürzen, das am anderen Ende der Siedlung lag, und den Glasscherben entgehen, die immer wieder auf dem Weg verstreut lagen. Ein Stück vor ihm standen zwei große Betonklötze auf der Grünfläche, in denen sich Lüftungsanlagen befanden. Als er um die Ecke bog, um auf dem Trampelpfad dahinter bis zu «seinem» Hochhaus zu fahren, blieb er ruckartig stehen und zerrte sein Fahrrad wieder in den Schutz der Betonmauern.
Vor einer Bank, halb verborgen von einigen zerrupften Büschen, stand eine Gruppe von vier oder fünf Jungs. Er wusste nicht, wie sie hießen, aber er kannte sie vom Sehen. Sie waren ein bisschen älter als er, wohnten ebenfalls in der Siedlung und hatten irgendwann beschlossen, dass sie hier das Sagen hatten. Diesen Anspruch setzten sie mit allen Mitteln durch, zur Not auch mit Gewalt. So erpressten sie sich Geld, Gefälligkeiten oder auch nur Schweigen, falls man ihnen zufällig bei einem ihrer Deals in die Quere gekommen war.
Jess wollte gerade sein Fahrrad umdrehen und wieder zurück zum Hauptweg fahren, um ihnen so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen, als er das Wimmern hörte.
Vorsichtig lugte er um die Ecke der Lüftungsanlage. Zwischen den Typen saß ein kleiner Junge auf der Bank und weinte. Jess runzelte die Stirn. Er kannte den Jungen. Es war Luca, der Sohn von Herrn Bernardi, der den Kiosk an der Ecke zur Straße betrieb. Einer der Jungs hatte seinen Arm um Luca gelegt, doch es sah nicht so aus, als wolle er ihn trösten – eher, als wäre er kurz davor, ihn in den Schwitzkasten zu nehmen. Irgendjemand sagte etwas, das Jess nicht verstand. Die anderen lachten hämisch, während Luca immer heftiger schluchzte und ihm die Tränen die Wangen hinunterliefen.
In Jess brodelte es. Der Junge war höchstens sechs und konnte keiner Fliege was zuleide tun! Er biss sich auf die Lippe. Alles in ihm schrie danach, so schnell wie möglich zu verschwinden, bevor die Typen ihn entdeckten. Er war kein Schlägertyp. Er konnte es nicht mit denen aufnehmen, ganz egal, wie selbstsicher er sich gab. Sie erkannten sofort, wenn sie jemand Schwächeren vor sich hatten. Wenn er jetzt hinter dieser Betonwand hervortrat und sie zur Rede stellte, würde das übel für ihn ausgehen. Andererseits konnte er Luca auch nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Wer wusste denn, was die Typen noch alles mit ihm vorhatten?
Wieder sagte einer der Jungs etwas, das wie «Heulsuse» klang, und ein anderer trat mit seinem schweren Stiefel direkt neben Luca gegen die Bank, sodass der Junge noch mehr aufwimmerte und in sich zusammensackte. Verzweifelt sah Jess sich um, aber es war weit und breit niemand zu sehen, den er um Hilfe bitten konnte.
Plötzlich hatte er eine Idee. Hastig zog er sein Handy aus der Hosentasche, öffnete Youtube und gab «Martinshorn» in die Suchleiste ein. Dann klickte er auf den erstbesten Clip und stellte sein Handy auf volle Lautstärke. Die Sirene eines Streifenwagens erklang, die sich dem Filmenden langsam näherte und somit immer lauter wurde.
Es funktionierte. Die Jungs schreckten auf, sahen sich irritiert um, und obwohl sie keine Polizei entdecken konnten, schienen sie das Risiko nicht eingehen zu wollen. Nacheinander liefen sie davon, weg von der Straße und damit auch weg von Jess. Der Typ, der Luca den Arm umgelegt hatte, verpasste ihm eine Kopfnuss, dann sprang er auf und folgte den anderen. Kurz darauf waren sie zwischen zwei der hochaufragenden Plattenbauten verschwunden.
Jess steckte sein Handy wieder ein und trat langsam hinter dem Betonklotz hervor. Luca saß in sich zusammengesunken auf der Bank und schluchzte. Jess setzte sich stumm neben ihn und wartete, bis der Junge sich ein wenig beruhigt hatte.
«Alles in Ordnung?», fragte er dann und schüttelte sofort den Kopf über seine dumme Frage. Natürlich war nichts in Ordnung.
Doch Luca nickte tapfer und wischte sich mit dem Ärmel durchs Gesicht.
«Haben sie dir wehgetan?»
«Ein bisschen. Aber es geht schon wieder.»
«Mistkerle.»
«Papa sagt immer, dass ich mich wehren soll, wenn jemand gemein zu mir ist.»
«Das sagt mein großer Bruder auch immer.»
Luca schniefte und sah betrübt zu Boden. «Ist aber gar nicht so leicht.»
«Finde ich auch», erwiderte Jess mehr zu sich selbst als zu dem Jungen.
Nach einer Weile sah Luca ihn aus den Augenwinkeln an. «Hast du das gemacht? Mit der Sirene?» Als Jess nickte, lächelte er schwach. «Geschieht denen recht.»
«Hoffentlich kriegen sie nie raus, dass ich es war.»
«Von mir erfahren sie nichts.»
Jess lächelte und stand auf. «Komm. Ich bring dich nach Hause.»
Er hob Luca auf seinen Fahrradsattel und schob ihn über das Gras zurück auf den Weg. Die Familie Bernardi wohnte in dem Hochhaus neben dem von Jess. Der Kiosk an der Ecke war eine Institution und verkaufte von Süßigkeiten über frische Brötchen, warme Suppe, ofenfrische Teilchen, Zeitschriften, Rätselhefte, Kleinkram, Tabakwaren und Hygieneartikel so ziemlich alles, was man sich denken konnte. Manchmal war der Andrang so groß, dass Herr Bernardi gar nicht hinterherkam. Er war ein herzlicher, großzügiger Mensch, der einem auch mal 10 Cent erließ, wenn man nicht genug Geld dabeihatte. Jeder mochte ihn. Umso schlimmer fand Jess, dass es diese fiesen Typen nun auf seinen Sohn abgesehen hatten. Wenn Herr Bernardi das erfuhr, würde eine Welt zusammenbrechen. Oder er würde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um es den Typen heimzuzahlen.
Als sie am Eingang des Hochhauses angekommen waren, hob Jess Luca vom Sattel und hielt ihm die Faust hin. «Mach’s gut, Kumpel. Und lass dich nicht unterkriegen.»
Luca wischte sich noch einmal mit dem Ärmel durchs Gesicht, dann grinste er und tippte seine Faust gegen die von Jess. «Geht klar. Danke, Jess.» Er drehte sich um und verschwand hüpfend im dunklen Flur. Zum Glück schien er den größten Schreck bereits verwunden zu haben.
Jess fuhr die wenigen Meter bis zum benachbarten Hochhaus, dem letzten in der langen Reihe von Plattenbauten. Dort stellte er sein Fahrrad in den verbogenen Ständer vor dem Eingang und betrat den Flur. Irgendjemand hatte mal wieder den Aufzug geschrottet, also machte er sich zu Fuß auf den Weg nach oben. Graffiti zierte die Wände; es stank nach Urin. Im Flur im achten Stock war schon seit Wochen die Beleuchtung ausgefallen, sodass er im Halbdunkel nach dem Schlüsselloch tasten musste. Als sich die Wohnungstür öffnete, atmete er innerlich auf. So klein ihre Wohnung auch war, sie kam ihm immer vor wie eine rettende Oase in einer Wüste aus versifften Treppen und anonymen Fluren.
Die Wohnung war leer. Seine Mutter würde erst in einer Stunde nach Hause kommen, und Jaxon trieb sich wie üblich bei seinen Freunden herum. Sie spielten Videospiele, meist in der VR, und Jaxon war so gut darin, dass er in der Gamer-Szene unter dem Namen xxPrometheusxx so etwas wie eine Berühmtheit war. Er schaffte es inzwischen sogar, Geld damit zu verdienen, auch wenn Jess vermutete, dass die Einnahmen nicht nur von Youtube und Twitch stammten und nicht zwingend etwas mit dem Knacken von Highscores zu tun hatten. Jaxon war nicht nur leidenschaftlicher Gamer, er besaß auch die äußerst passable Fähigkeit, sich in fremde Computer zu hacken. Als ihre Mutter Wind davon bekommen hatte, hatte sie sämtliche Konsolen und Computer aus der Wohnung verbannt und damit gedroht, ihren eigenen Sohn bei der Polizei zu melden. Seitdem trafen Jaxon und seine Freunde sich irgendwo außerhalb, und Jess bekam ihn kaum noch zu Gesicht. Dass er überhaupt mit ihnen zusammen zu Abend aß, war eines der wenigen Zugeständnisse, die er ihrer Mutter gegenüber gemacht hatte.
Jess betrat das winzige Zimmer, das er sich mit seinem Bruder teilte, legte sich auf sein Bett und holte sein Mathebuch raus. Am Montag schrieben sie Klausur, die letzte vor den Sommerferien in drei Wochen. Als sich nach einer Stunde der Schlüssel in der Wohnungstür drehte, schwirrte ihm der Kopf vor lauter Zahlen. Genervt schlug er das Buch wieder zu und trat in den Flur.
«Hey, mein Schatz», begrüßte seine Mutter ihn müde und streifte sich die Schuhe von den Füßen. «Wie war dein Tag?»
«Okay», sagte Jess nur. Er würde unter keinen Umständen erzählen, was auf dem Nachhauseweg vorgefallen war. Seine Mutter hatte schon genug Sorgen, da wollte er ihr nicht noch schwarz auf weiß präsentieren, wie mies die Wohngegend war, in der sie lebten. Als seine Mutter ihm im Vorbeigehen einen Kuss auf die Stirn gab und er die dunklen Ringe unter ihren Augen sah, erschrak Jess. Seine Mutter war Verkäuferin in einem Klamottenladen, und nachdem sein Vater abgehauen war, schob sie ununterbrochen Extraschichten, damit sie halbwegs über die Runden kamen. Trotzdem reichte das Geld hinten und vorne nicht, und auch wenn sie versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, wusste Jess, wie sehr sie die ständigen Überstunden und die Geldsorgen auszehrten. Heute jedoch schien es besonders schlimm zu sein. Sie benahm sich komisch, wich seinem Blick aus, und Jess bildete sich ein, dass ihre Augen geschwollen waren. Hatte sie geweint?
«Es gibt Nudeln mit Tomatensoße», sagte sie, während sie in die kleine Küche ging. «Mehr ist heute nicht drin.»
Jess folgte ihr. «Alles okay, Mama?»
Seine Mutter stellte mechanisch zwei Töpfe auf den Herd und machte den Wasserkocher an. «Ist Jaxon zu Hause?», fragte sie statt einer Antwort.
«Noch nicht.»
«Hm.»
«Mama?», hakte Jess nach.
«Wir sprechen später darüber, ja?», erwiderte sie, immer noch, ohne ihn anzusehen.
Jess wusste, dass jede Diskussion zwecklos war. Er ging ins Wohnzimmer, setzte sich auf die abgewetzte Couch und schaltete den Fernseher an, ohne wirklich wahrzunehmen, welche Sendung gerade lief. Irgendetwas musste vorgefallen sein. Seine Mutter weinte nie. Elaine Adams war klein und zierlich. Sie wirkte sanft, aber wenn man sie reizte, entfachte das einen Orkan, vor dem man schleunigst in Deckung gehen sollte. Bei der Vorstellung, dass sie geweint hatte, bildete sich ein harter Klumpen in Jess’ Magen.
Kurz darauf kam auch Jaxon nach Hause. Er sah aus wie eine zwei Jahre ältere Version von Jess: die gleichen dunkelbraunen Haare, nur länger. Die gleiche schlanke Figur, nur breitere Schultern. Die gleichen dunklen Augen, nur angriffslustiger. Er verschwand wortlos in ihrem Zimmer, und erst, als ihre Mutter zum Essen rief, kam er wieder heraus.
Schweigend saßen sie um den kleinen Tisch im Wohnzimmer und drehten ihre Spaghetti auf. Im Fernseher lief eine Sondersendung über die neu gegründete gesamteuropäische Armee, die heute mit viel Pomp und geladenen Gästen offiziell eingesetzt worden war. Eigentlich interessierte Jess das Thema nicht, aber es war einfacher, der Nachrichtensprecherin zuzuhören als der erdrückenden Stille am Tisch.
«Erster Sprecher bei dem feierlichen Akt war Piedro Canto, der Pressesprecher des Außenministeriums, der einen Überblick über die aktuelle Weltlage gab», sagte die Moderatorin gerade.«Im letzten Jahr sei die Zahl der gewaltsamen Konflikte erneut angestiegen. Auch die Härte der Auseinandersetzungen nehme stetig zu, und damit auch die Zahl der Opfer und Flüchtlinge. Canto begrüßte die Einsetzung der Europäischen Armee als geeignetes Mittel, um den auch für Europa immer bedrohlicher werdenden Krisen zu begegnen. Im Anschluss an Cantos Rede wurde Drei-Sterne-General William Rogers, der sich in den vergangenen Jahren als strategischer Berater der NATO einen Namen gemacht hatte, offiziell in sein Amt als leitender General eingeführt. Rogers versprach bei seiner Antrittsrede, sämtliche Ressourcen zu nutzen, um die Europäische Armee zur effizientesten und modernsten Angriffstruppe der Welt zu machen.»
Ein Mann an einem Rednerpult wurde eingeblendet, in einer über und über mit Orden behangenen, dunkelblauen Uniform. Sein Gesicht war von Falten durchzogen, sein Mund umspielte ein unerbittlicher Zug. Doch am auffälligsten waren die stechend grauen Augen, die jeden zu durchbohren schienen, der ihrem Blick begegnete.
«Wir leben in einem Zeitalter des Krieges», donnerte Rogers ins Mikrofon. Seine Stimme schallte von unzähligen Lautsprechern über die anwesende Menge und schien selbst hier in ihrem schäbigen Wohnzimmer widerzuhallen. «Antidemokratische Regimes erheben sich gegen liberale Demokratien, und sie werden unaufhaltsam stärker. Weil sie rücksichtsloser sind. Weil sie härter kämpfen. Und weil sie Erfolg damit haben. Die Weltordnung, wie wir sie kennen, ist in Gefahr. Sie wird untergehen, wenn wir nicht alles daransetzen, den Aufstieg der Autokraten und Diktatoren zu unterbinden.»
«Zu unterbinden.» Ihre Mutter schüttelte traurig den Kopf. «Indem er eine Armee auf die Beine stellt, die noch stärker ist als die der anderen. Irgendwann schlagen sich alle nur noch die Köpfe ein, bis es nichts mehr gibt, wofür sie kämpfen könnten.»
Die Moderatorin der Sendung wurde eingeblendet. «In seinerflammenden Rede erörterte Rogers, wie er sich die künftige Europäische Armee unter seiner Führung vorstellt. Neben den üblichen Boden- und Lufteinheiten treibt Rogers vor allem den Aufbau einer Sondereinheit voran, die eine vollkommen neue Art der Kriegsführung ausüben wird.»
Das Bild wechselte wieder zu General Rogers, der nun neben einem Soldaten in einem schwarzen Kampfanzug und mit einer merkwürdigen, krallenartigen Kopfbedeckung stand. In den unerbittlichen Zug um seinen Mund mischte sich eine Spur von Stolz. «Wir leben im 21. Jahrhundert. Kriege werden nicht mehr mit Schwertern oder Pfeil und Bogen geführt. Wir haben gewaltige technische Möglichkeiten – und wir wären dumm, wenn wir sie nicht nutzen würden.» Er blickte nun direkt in die Kamera, und seine grauen Augen schienen bis zu ihnen ins Wohnzimmer zu sehen. «Andere Länder sind längst dabei, den viel beschworenen Supersoldaten zu erschaffen. Wenn wir aus ethischen oder moralischen Bedenken zögern, werden wir unaufhaltsam in Rückstand geraten, und die Europäische Armee wird nicht in der Lage sein, Europa zu beschützen. Denn in unserer Welt gibt es nur ein unumstößliches Gesetz, nach dem sich alle richten: das Recht des Stärkeren.»
Ihre Mutter griff zur Fernbedienung, doch Jaxon sagte: «Lass an. Ich will das sehen.»
Hinter der Sprecherin wurde das Bild des Helms eingeblendet, den der Soldat auf dem Kopf getragen hatte. Stirnrunzelnd las Jess die dazugehörige Bildunterschrift. «Sondereinheit des Militärs wird mit Datenhelmen ausgestattet», stand dort. «… wurde unter dem Vorsitz führender Neurochirurgen ein neuartiges BCI in Form eines Datenhelms vorgestellt», fuhr die Sprecherin fort. «BCIs, eine Abkürzung für Brain-Computer-Interface oder Gehirn-Computer-Schnittstelle, wurden ursprünglich für medizinische Zwecke entwickelt. Elektroden wandeln die vom Gehirn ausgesendeten elektromagnetischen Impulse in digitale Informationen um, die daraufhin von Computern verarbeitet werden können. Verbesserte Elektroden ermöglichen es inzwischen, mithilfe der Gehirnströme hochkomplexe Befehle an Computer zu senden.
Laut General Rogers können die Soldaten der Sondereinheit allein durch die ‹Kraft ihrer Gedanken› untereinander kommunizieren, Drohnen steuern oder Waffen bedienen.»
Auf dem Fernsehschirm war eine aufgebrachte Menschenmenge zu sehen. «Während Rogers’ offizieller Amtseinführung kam es vor dem Hauptsitz der EU in Brüssel zu Protesten. Aktivisten kritisierten die zunehmende Digitalisierung menschlicher …»
Das Bild erlosch. Ihre Mutter legte die Fernbedienung neben ihren Teller, von dem sie kaum etwas gegessen hatte. Dann seufzte sie und sah auf einen Punkt irgendwo zwischen Jess und Jaxon an der Wand.
«Ich muss euch was sagen. Im Geschäft mussten sie Personal abbauen. Ich habe meinen Job verloren.»
Plötzlich schien die Zeit stillzustehen. Niemand sagte ein Wort, und die Stille, die sich zwischen ihnen ausbreitete, war so bleischwer, dass Jess das Blut in seinen Ohren rauschen hörte. Er senkte den Blick, fixierte die abgewetzte Tischplatte und wünschte sich so weit weg, wie es nur ging.
«Und ich bin mit der Miete zwei Monate in Rückstand», fuhr Elaine schließlich fort. «Wenn ich nicht schnell was Neues finde, müssen wir hier raus.»
Das Rauschen in seinen Ohren wurde lauter. Dabei war er nicht mal wirklich überrascht. Er ahnte schon lange, dass sie pleite waren. Er hatte es nur nicht wahrhaben wollen. Geld, dachte er bitter. Es geht immer nur um das verdammte Geld.
«Vielleicht solltest du von Papa endlich mal Unterhalt einfordern», sagte Jaxon bissig.
«Das steht nicht zur Diskussion, Jaxon», erwiderte Elaine kopfschüttelnd.
«Wieso nicht? Weil du zu stolz bist, ihm hinterherzurennen? Stattdessen nimmst du lieber in Kauf, dass wir bald auf der Straße sitzen.»
«Wir werden nicht auf der Straße sitzen», entgegnete Elaine müde.
«Ach ja? Und wo sollen wir hin?», fragte Jaxon. Alles an seiner Stimme war ein einziger Vorwurf. «Wir leben doch schon jetzt in einer Bruchbude. Wird schwierig, da noch was Billigeres zu finden.»
Ihre Mutter schloss die Augen und presste die Lippen aufeinander. Doch anstatt wütend zu werden, atmete sie nur tief durch. «Es tut mir leid.»
Sie legte ihre Hand auf die von Jess, und er spürte, wie sie zitterte. Er wollte seine Hand wegziehen, wollte seine Mutter nicht so hilflos erleben, aber sein Körper war wie erstarrt, als hätte er verlernt, wie man Arme und Beine bewegt.
«Ich weiß, wie gerne du studieren würdest, Jess», sagte sie sanft. «Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das finanzieren soll. Momentan ist das einfach nicht drin. Du musst dir so schnell wie möglich einen Ausbildungsplatz suchen.»
Jaxon schüttelte den Kopf. «Mama, das kann nicht dein Ernst …»
«Und du», unterbrach Elaine ihn, und ihre Stimme klang nun deutlich härter, «suchst dir gefälligst einen vernünftigen Job.»
«Ich habe einen Job.»
«Computer spielen? Dass ich nicht lache. Und wenn dir langweilig ist, hackst du dich irgendwo ein. Glaubst du, ich wüsste nicht, was du mit deinen Freunden treibst?» Ihre Augen begannen zu funkeln, und Jess spürte, wie sich der typische Orkan zusammenbraute. Fast war er dankbar dafür, denn alles war besser, als seine Mutter so niedergeschlagen zu erleben.
«Guck dir doch an, wohin dieser ganze digitale Mist führt. Jetzt tragen Soldaten schon Datenhelme, um damit Maschinen und Waffen zu steuern. Das ist doch total absurd.»
«Wenigstens verdiene ich mit dem ‹digitalen Mist› Geld», entgegnete Jaxon kühl. «Was dir in deiner analogen Welt offenbar nicht gelingt.»
Ihre Mutter sog scharf die Luft ein. Ihre mühsam aufrechterhaltene Ruhe brach in sich zusammen, und sie starrte Jaxon wutentbrannt an. «Verstehe. Wenn das der Weg ist, den du gehen willst, bitte schön. Nur kann ich es bei dem ganzen Scheiß gerade nicht gebrauchen, dass mein Sohn mit einem Bein im Knast steht. Entweder, du verdienst dein Geld auf legale Weise, oder du fliegst raus.»
Jaxon sah Elaine ungläubig an. Einen Moment lang glaubte Jess, dass er sie an den Schultern packen und schütteln würde. Doch zu seiner Überraschung begann Jaxon zu lachen. Das Geräusch klang so verächtlich und falsch, dass Jess seinen Bruder beinahe angeschrien hätte, damit aufzuhören. Doch die Worte steckten in seiner Kehle fest.
Jaxon stand so ruckartig auf, dass sein Stuhl nach hinten umkippte. «Ich halte diesen ganzen armseligen Scheiß sowieso nicht mehr aus. Zum Glück bin ich bald hier weg!» Ohne sich noch einmal umzusehen, ging er zur Wohnungstür und knallte sie hinter sich zu.
Ihre Mutter sammelte wortlos die Teller ein und verschwand in der Küche. Jess blieb wie festgefroren am Tisch sitzen. Wieder hörte er das Blut in seinen Ohren. Das Rauschen vermischte sich mit Jaxons Worten, und mitten in diesem Durcheinander formte sich plötzlich ein Gedanke, der ruckartig ein weiteres Brett unter seinen Füßen fortzog.
Erst war sein Vater gegangen, dann Yara. Und jetzt wollte ihn auch sein Bruder verlassen.
3
Jess tippte auf sein Handy. 2 Uhr 14. Seufzend legte er das Telefon wieder zurück. Seit Stunden lag er schon wach, starrte an die Decke und versuchte, seine Gedanken zu sortieren. Immer wieder sah er das gequälte Gesicht seiner Mutter vor sich, die alles tat, um ihre Familie zusammenzuhalten, und trotzdem scheiterte. Ihm fiel auf, dass er keine Ahnung hatte, wann er sie das letzte Mal hatte lachen sehen, und der Gedanke brach ihm fast das Herz.
Er sah zum leeren Bett seines Bruders. Jaxon war seit seinem Abgang beim Abendessen noch nicht wieder zurückgekommen. Was hatte er damit gemeint, dass er bald hier weg sei? Wo wollte er hin? Und warum? Ich halte diesen armseligen Scheiß sowieso nicht mehr aus, hatte er gesagt. Ging er, weil sie kein Geld mehr hatten? War es das, was ihn aus dem Haus trieb? Hatte seine Mutter recht, und Jaxon war auf die schiefe Bahn geraten, weil er dort bessere Chancen sah, schnell an viel Geld zu kommen?
Rastlos drehte Jess sich um und starrte an die Wand. Seine ganze Welt brach auseinander, und er konnte nichts anderes tun, als hilflos dabei zuzuschauen. Seine Mutter hatte ihren Job verloren. Sie würden vermutlich bald auf der Straße sitzen. Papa hatte sie verlassen. Yara ging weg. Und Jaxon schien auch keinen großen Wert mehr auf sie zu legen.
Sein Verhältnis zu seinem Bruder war in letzter Zeit nicht ganz einfach gewesen – Jaxon nahm ihn nicht ernst, behandelte ihn immer, als wäre er zwölf und nicht sechzehn, und winkte grundsätzlich ab, wenn Jess ihn auf seine Freunde ansprach. Aber er war seine Familie, er gehörte zu seinem Leben dazu, und wenn er jetzt auch noch ging, dann hatte Jess bald alles verloren, was sein Leben bisher zusammengehalten hatte.
Das Geräusch der Wohnungstür riss ihn aus seinen Gedanken. Schritte erklangen im Flur, dann das gedämpfte Rauschen von Wasser im Bad. Als Jaxon schließlich ins Zimmer schlich und ins Bett kroch, stellte Jess sich schlafend. Er hatte keine Lust, mit seinem Bruder zu reden. Eigentlich hätte er erleichtert sein sollen, dass Jaxon wieder da war. Stattdessen merkte er, wie Wut in ihm aufstieg. Weil Jaxon ihn alleinließ. Weil er achtzehn war und tun und lassen konnte, was er wollte. Und weil er den Mut hatte, es auch zu tun.
«Jess?», wisperte Jaxon. «Hey, Jess. Ich weiß, dass du nicht schläfst.»
Widerwillig drehte Jess sich zu ihm um. Es war so dunkel im Zimmer, dass er seinen Bruder nur als undeutlichen Umriss vor der Wand erkennen konnte. «Was ist?»
«Tut mir leid wegen heute Abend», begann Jaxon. «Ich … hab’s vielleicht ein bisschen übertrieben.»
«Du hättest Mama nicht so angehen sollen.»
«Ich weiß.»
«Sie will doch nur das Richtige tun.»
Jaxon schnaubte leise. «Ja. Schon klar.»
«Im Ernst, Jax. Hast du dich mal in ihre Situation versetzt? Seit Papa weg ist, ist sie für alles alleine verantwortlich. Sie hat es schon schwer genug.»
«Eben. Sie reißt sich den Arsch auf, schuftet sich zu Tode, und es kommt nichts dabei raus. Ich hab die Möglichkeit, Geld zu verdienen, und sie droht, mich rauszuwerfen.»
«Ich will nicht, dass du gehst», sagte Jess leise.
Jaxon schwieg eine Weile, dann erwiderte er: «Ist erst mal nur für ein paar Wochen. Dann sehen wir weiter. Und wer weiß – vielleicht hat sich das mit dem Geld ja danach von selbst erledigt.» Ohne näher darauf einzugehen, zog Jaxon die Bettdecke hoch und drehte sich zur Wand.
Jess’ Herz fing an zu pochen. Jaxons Äußerung schien seine schlimmsten Befürchtungen zu bestätigen. «Wie meinst du das?», fragte er.
«Kann ich nicht sagen. Gute Nacht, Kleiner.»
Jess lauschte Jaxons Atemzügen, die schon bald regelmäßiger und tiefer wurden. Doch in seinem Kopf drehte sich noch immer alles. So würde er unmöglich einschlafen können.
«Jax?»
«Hm?», brummte sein Bruder unwirsch.
«Bitte sag mir, was du vorhast.»
«Vergiss es einfach.»
«Wie soll ich das einfach vergessen? Ich mach mir Sorgen um dich, Jaxon! Was hast du vor?»
Seufzend drehte Jaxon sich wieder zu ihm um. «Ich kann noch nicht darüber reden.»
«Hat es was mit deinen Freunden zu tun? Plant ihr irgendeinen bescheuerten Hack? Oder illegales Bitcoin Mining oder so einen Kram?»
«Ach Quatsch. Du denkst zu viel nach. Und jetzt lass mich schlafen. Ich bin müde.»
«Ich will dich nicht auch noch verlieren, Jax. Nicht wegen einer dämlichen Computersache.»
«Wirst du nicht. Versprochen.»
Kurz darauf verriet leises Schnarchen, dass Jaxon eingeschlafen war. Verärgert zog Jess die Decke bis zur Nasenspitze hoch. Jaxons halbgare Antwort hatte ihn nur noch mehr aufgewühlt. Das Karussell in seinem Kopf setzte sich wieder in Bewegung, und er war beinahe erleichtert, als die Müdigkeit endlich den Kampf gegen seine rotierenden Gedanken gewann und er in einen unruhigen Schlaf fiel.
Der nächste Tag war ein Samstag. Beim Frühstück teilte Jaxon ihnen mit, dass er zum Abendessen nicht nach Hause kommen würde, weil er vorhatte, sich ausgiebig mit «digitalem Mist» zu beschäftigen. Ihre Mutter nahm es mit versteinertem Gesicht zur Kenntnis. Doch Jess ging das Gespräch der vergangenen Nacht nicht aus dem Kopf, und er beschloss, sich nicht länger hinhalten zu lassen. Wenn Jaxon nicht mit der Sprache herausrückte, würde er eben selbst herausfinden, was er mit seinen Andeutungen gemeint hatte. Er erzählte seiner Mutter, dass er Yara beim Packen helfen würde, und ließ sich von ihr das Versprechen abnehmen, dass wenigstens er zum Abendessen nach Hause kam. Kurz nachdem Jaxon die Wohnung verlassen hatte, machte auch er sich auf den Weg und schlich ihm so unauffällig wie möglich hinterher, das schäbige Treppenhaus hinunter, aus dem Hochhaus hinaus und durch die trostlosen Grünflächen der Plattenbausiedlung hindurch Richtung Innenstadt.
Jess achtete darauf, genügend Abstand zu halten, falls sein Bruder sich spontan umsehen sollte. Doch je öfter er in eine Nebenstraße oder eine schmale Gasse einbog, desto verwirrter wurde Jess. Er war davon ausgegangen, dass sein Bruder sich mit seinen Freunden traf, und soweit er wusste, befand sich ihr Quartier in einer alten Garage am anderen Ende der Stadt. Jaxon hingegen arbeitete sich im Zickzackkurs in Gegenden vor, in denen Jess noch nie gewesen war. Der Asphalt auf den Straßen war aufgeplatzt, die Häuser wirkten heruntergekommen und wie ausgestorben. Passanten waren kaum noch unterwegs, und Jess musste immer mehr Abstand halten, damit Jaxon ihn nicht zufällig bemerkte. Doch sein Bruder sah sich nicht ein einziges Mal um. Auch dann nicht, als er sich seitlich durch die Absperrung einer stillgelegten U-Bahn-Station schob und die Treppen hinablief.
Jess duckte sich hinter ein Geländer und spähte vorsichtig nach unten. Der Eingang zur Station war ebenfalls mit einem Gitter versperrt, doch auch hier gab es einen Spalt, durch den Jaxon in diesem Moment hindurchschlüpfte. Jess wartete ein paar Sekunden, dann folgte er ihm.
Sein Bruder war offenbar nicht der Einzige, der von der Öffnung in der Absperrung wusste. Auf dem Boden lagen Schlafsäcke, Plastiktüten und leere Flaschen herum; Obdachlose schienen den Bahnhof als Nachtlager zu benutzen, doch im Moment war weit und breit nichts von ihnen zu sehen. Ein übler Geruch hatte sich in den Gängen festgesetzt, nach Urin, Schweiß und verbrauchter Luft. Das fahle Licht der Notbeleuchtung unterstrich die deprimierende Szenerie.
Jaxon hatte bereits das Ende der Halle erreicht. Er war nur noch als dunkler Schatten zu erkennen, und beinahe hätte Jess verpasst, wie er die Treppe zu einem der Bahnsteige hinablief. Er beeilte sich, Jaxon zu folgen. Obwohl er so leise wie möglich auftrat, hallten seine Schritte von den gefliesten Wänden wider. Kurzerhand streifte er sich die Schuhe von den Füßen und folgte seinem Bruder auf Socken. Doch als er den Bahnsteig erreichte, war er leer. Verwirrt blickte Jess sich um. Wohin war Jaxon verschwunden?
Vorsichtig schlich Jess den Bahnsteig entlang. Auch hier glomm die Notbeleuchtung, doch kam kaum gegen die Dunkelheit an, die aus den U-Bahn-Schächten sickerte. Falls Jaxon noch irgendwo hier unten war, hatte das Zwielicht ihn erfolgreich verschluckt.
Ein Geräusch am Ende des Bahnsteigs ließ ihn aufhorchen. Es klang wie das Knirschen von Kies, und als Jess die Augen zusammenkniff, erkannte er eine Gestalt, die auf den Schienen in Richtung Tunnelöffnung lief. Kurz darauf war sie mit dem undurchdringlichen Schwarz dahinter verschmolzen. Jess huschte bis zum Ende des Bahnsteigs und kletterte ins Gleisbett hinab. Die groben Kiesel schmerzten unter seinen Füßen. Rasch zog er seine Schuhe wieder an und folgte Jaxon in die Dunkelheit.
Die Luft im Tunnel war abgestanden und warm. Als fünfzig Meter vor ihm ein Lichtschein aufglomm, presste Jess sich erschrocken gegen die Tunnelwand. Doch es war nur Jaxon, der die Taschenlampe an seinem Handy aktiviert hatte und sie auf den Boden vor sich richtete. Jess wagte nicht, sein Handylicht ebenfalls anzuschalten; Jaxon würde ihn sofort bemerken, falls er sich umdrehte. Er musste sich notgedrungen im Dunkeln vortasten und sich am Verlauf der Schienen orientieren.
Bald darauf hatte Jess jegliches Zeitgefühl verloren. Es konnten nicht mehr als zwei oder drei Minuten vergangen sein, aber in der vollkommenen Finsternis kamen sie ihm wie eine Ewigkeit vor. Die Notbeleuchtung des Bahnsteigs, die noch eine Zeit lang hinter ihm das Ende des Tunnels markiert hatte, war längst nicht mehr zu sehen. Jess versuchte, nicht darüber nachzudenken, was alles in der Dunkelheit um ihn herum lauern könnte. Er fühlte sich unangenehm an den Zombie-Shooter erinnert, den er mit Yara gespielt hatte. Wenn sein Bruder nicht gewesen wäre, hätten ihn keine zehn Pferde in diesen Tunnel gekriegt. Was zum Teufel wollte Jaxon bloß hier?
Das Licht vor ihm erlosch. Erschrocken blieb Jess stehen. Hatte Jaxon ihn bemerkt? Dann erschien plötzlich der Umriss einer Tür in der Tunnelwand. Jaxon trat hindurch und schloss die Tür hinter sich. Das Rechteck verschwand, und der Tunnel versank wieder in Dunkelheit.
Langsam tastete Jess sich an der Wand entlang in die Richtung, in der sich die Tür befinden musste. Schon bald spürte er Metall unter den Fingern, und nach kurzem Suchen fand er auch eine Klinke. Er hatte keine Ahnung, was ihn auf der anderen Seite erwartete, und er spürte, wie ihm das Herz bis zum Hals klopfte. Aber er war nicht so weit gekommen, um jetzt einen Rückzieher zu machen.
Vorsichtig öffnete er die Tür und spähte hindurch. Vor ihm erstreckte sich ein nüchterner Gang aus Betonwänden – ein Notausgang vielleicht oder der Zugang zu einem Wartungsbereich. Auch hier glomm eine schwache Notbeleuchtung. Jess lauschte, doch von Jaxon war weder etwas zu hören noch zu sehen. Also schlüpfte er durch die Tür und folgte dem Gang um eine Ecke und ein paar Stufen hinauf, bis er vor einer weiteren Tür stand. Doch als er den Griff hinunterdrückte, war die Tür verschlossen. Stirnrunzelnd sah er sich um. Jaxon war vor zwei Minuten in genau diesem Gang verschwunden. Hatte er irgendwo eine Tür übersehen? Oder eine Abzweigung? Eher zufällig fiel sein Blick auf einen kleinen Kasten über dem Türrahmen, und als er das rote Lämpchen darin sah, erstarrte er.
Eine Überwachungskamera. Und er blickte genau hinein.
Jess verfluchte sich für seine Dummheit und wandte das Gesicht ab. Wer auch immer am anderen Ende der Kamera saß, wusste nun, wie er aussah. Und ganz egal, was das hier unten war – in stillgelegten U-Bahn-Tunneln herumzulaufen, würde garantiert Ärger geben! Er wollte sich gerade umdrehen und den Gang zurücklaufen, als die Tür mit einem leisen Klicken aufsprang. Jess zuckte zusammen und machte sich darauf gefasst, dass jemand herauskommen und ihn zur Rede stellen würde. Doch nichts geschah.
Vorsichtig öffnete er die Tür einen Spalt. Dahinter befand sich eine Art Vorraum, dessen Wände wie in einer Umkleide mit Bänken und alten Metallspinden gesäumt waren. Gegenüber der Tür war ein Durchgang, der in einen weiteren, deutlich größeren Raum führte. Und was er dort erblickte, war so ziemlich das Letzte, was er in einem Wartungsbereich eines U-Bahn-Tunnels erwartet hätte.
4
Jess huschte in den Vorraum und duckte sich hinter einen Spind. Von dort aus konnte er das Geschehen im Hauptraum beobachten – auch wenn er erst einmal verdauen musste, was er da sah. Der Raum ähnelte einer Studenten-WG: Auf dem Boden lagen ausgelatschte Teppiche; Stehlampen und Lichterketten verbreiteten eine Art Wohnzimmeratmosphäre; in einer Ecke stand sogar eine alte Couch. Doch am auffälligsten waren die riesigen Bildschirme auf den wild zusammengewürfelten Tischen und die dicken Kabelstränge auf dem Boden, die alle auf einen Punkt an der Wand zuliefen, wo sie mit mehreren Routern, Funkverstärkern, externen Firewalls und anderen Zusatzgeräten verbunden waren. Offensichtlich hatten Jaxon und seine Freunde ihren Treffpunkt hier herunterverlegt. Und obwohl Jess kein Experte war, sah das alles für ihn nach mehr aus als das Spielen von Videospielen und ein paar gelegentlichen Hacks.
Auf die Schnelle zählte er fünf Personen, alle etwa in Jaxons Alter. Eine Frau schlief ausgestreckt auf der Couch; ein Junge mit Kopfhörern saß vor einem riesigen Bildschirm und spielte irgendeinen Ego-Shooter. Die anderen standen um einen der Monitore herum. Jaxon war auch dabei; er hatte den Arm um eine Frau mit lilafarbenen Haaren gelegt. Da sie ihm den Rücken zugewandt hatten, wagte Jess es, ein wenig näher heranzugehen. Auf dem Bildschirm schien ein Video zu laufen, doch Jess konnte das Bild nicht erkennen. Er hörte nur, wie jemand schrie. Dann war die Aufnahme zu Ende.
«Das ist alles, was ich letzte Nacht runterladen konnte, bevor sie entdeckt haben, dass jemand in ihren Daten rumspukt», sagte der Mann am Monitor. «Ich hab noch mehrmals probiert, mich wieder ins System zu hacken, aber es ist zu gut gesichert. Und nach gestern sind sie hellhörig geworden. Wenn wir nicht aufpassen, können sie uns bis zu unserem Standort zurückverfolgen.»
«Obwohl wir die IP-Adressen verschleiert haben?»
«Ja. Da sitzen schließlich keine Anfänger am anderen Ende. Die Sache wird langsam zu groß für uns.»
«Finde ich auch. Besonders nach dem, was wir hier gesehen haben», sagte das Mädchen mit den lila Haaren und deutete auf den Monitor. Jess reckte den Hals, konnte auf dem Standbild aber nur einen kahlen Raum erkennen und einen Mann in einem grauen Overall. «Dieses Video ist irgendwie … gruselig. Wir sollten die Finger davon lassen.»
«Wie wäre es, wenn wir mit dem Material an die Öffentlichkeit gehen?», schlug der Mann vor. «Anonym natürlich. So wie bei Wikileaks.»
«Und dann?», fragte Jaxon.
«Das Video, die Mitschriften, das Material, das wir von Erik bekommen haben … das muss doch einen riesigen Aufschrei geben. Wenn die Leute kapieren, was da abgeht, verhindern wir vielleicht, dass der Algorithmus in die falschen Hände gerät.»
Jaxon schüttelte den Kopf. «Habt ihr eine Ahnung, wie viel dieser Algorithmus wert ist? Wir reden hier von Millionen. Wenn wir ihn als Erstes in die Finger kriegen, verkaufen wir ihn. Das ist die Chance, richtig Kohle zu machen.»
«Du willst ihn stehlen?»
«Warum denn nicht? Ja, es ist riskant. Aber dafür springt auch ordentlich was dabei raus. Ich habe keine Lust mehr, kleine Brötchen zu backen. Nicht, wenn wir einen so großen Fisch an der Angel haben. Wir müssen eben vorsichtig sein!»
«Du spinnst doch», warf die Frau ein. «Das schaffen wir nie.»
Jaxon hob mahnend den Finger. «Du kennst ja meinen Leitspruch: Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.»
«Erik ist deswegen gestorben.»
«Das war ein Unfall.»
«Das ist die offizielle Version. Aber überleg doch mal, was …»
«Jax, was hockst du denn hier hinten rum?»
Jess fuhr herum. Ein rothaariger Mann Anfang zwanzig war durch die Tür in den Vorraum gekommen und sah ihn mit einem schiefen Grinsen an. Jess hätte sich ohrfeigen können. Er war so auf die Unterhaltung konzentriert gewesen, dass er ihn nicht bemerkt hatte.
Fieberhaft suchte er nach einem Ausweg. Solange der Mann ihn für seinen Bruder hielt, hatte er vielleicht noch eine Chance. Doch die Gruppe um Jaxon war längst auf sie aufmerksam geworden. Als sein Bruder sich umdrehte und in ihre Richtung blickte, runzelte der Rothaarige die Stirn.
«Was zum …?» Verdutzt sah er zwischen Jess und Jaxon hin und her. Dann wandelte sich seine Verwirrung in Ärger. Er packte Jess am Kragen und presste ihn so fest gegen die Wand, dass ihm die Luft wegblieb. «Verdammte Scheiße! Was hast du hier zu suchen?»
«Das würde ich auch gern wissen.» Jaxon löste sich von der Gruppe und kam auf sie zu. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, kochte er vor Wut.
«Scheiße, Mann, der sieht genauso aus wie du», sagte der Rothaarige. «Kennst du ihn?»
«Mein Bruder», erwiderte Jaxon knapp.
«Ist er mit dir hier?»
«Nein.»
«Wie ist er dann hier reingekommen?»
«Gute Frage», knurrte Jaxon und sah Jess fragend an.
«Ich … die Tür ist einfach aufgegangen», stammelte Jess.
«Zac!», rief Jaxon in Richtung des Jungen, der immer noch in den Ego-Shooter vertieft war. Als er nicht reagierte, zog Jaxon seinen Schlüsselbund aus der Tasche und warf ihn neben dem Jungen auf den Tisch. «Hey, Zac!»
Der Junge drehte sich um, und als er sah, dass ihn alle anstarrten, riss er sich erschrocken den Kopfhörer ab. «Was ist?»
«Hast du meinen Bruder reingelassen?», fragte Jaxon und deutete auf Jess.
Erst jetzt bemerkte Jess den zweiten Bildschirm auf Zacs Tisch, auf dem der Bereich vor der Tür zu sehen war. Offenbar wurden die Bilder der Überwachungskamera dorthin übertragen.
Zac sah verdutzt von Jaxon zu Jess. «Ich hab gedacht, das wärst du», sagte er schließlich.
«Und dass ich kurz vorher schon mal durch die Tür gegangen bin, hast du verdrängt, oder was?»
Zac zuckte mit den Schultern. «Ich bin gerade ins letzte Level aufgestiegen. Außerdem sieht er genauso aus wie du. Ich dachte, vielleicht hast du was vergessen oder so.»
Jaxon seufzte resigniert. «Lass ihn los, Kev. Ich kümmer mich um ihn.»
Der Rothaarige warf Jess einen zweifelnden Blick zu. «Was ist, wenn er rumerzählt, was er hier gesehen hat?»
«Wird er nicht.»
Kev ließ ihn los. Doch Jess blieb keine Zeit, um durchzuatmen. Sofort packte Jaxon ihn am Kragen und zog ihn in eine Ecke des Vorraums, wo die anderen ihn nicht sehen konnten.
«Was hast du hier zu suchen?», zischte er. «Bist du mir etwa gefolgt?»
Jess wich seinem Blick aus und nickte.
«Verdammt noch mal! Was soll das?»
«Ich hab mir Sorgen gemacht», verteidigte sich Jess. «Du bist in letzter Zeit so komisch. Ich wollte wissen, was los ist.»
«Das gibt dir noch lange nicht das Recht, mir hinterherzuspionieren!»
«Du weichst mir immer aus, ganz egal, wie oft ich dich frage», entgegnete Jess trotzig. «Anders finde ich es ja nicht raus.»
«Ich sage dir nicht, was ich mache, weil es dich nichts angeht. Schon mal darüber nachgedacht?»
«Natürlich geht es mich was an. Du bist mein Bruder!»
Jaxon wollte etwas erwidern, wurde jedoch von der Frau mit den lilafarbenen Haaren unterbrochen, die zu ihnen trat und Jaxon eine Hand auf die Schulter legte.
«Noch fünf Minuten, Jax. Du solltest dich langsam fertig machen.» Dann musterte sie Jess kurz und streckte ihm schließlich eine Hand entgegen. «Ich bin Mia.»
«Jess. Jaxons Bruder.»
Mia lächelte. «Das ist nicht zu übersehen.»
«Was ist in fünf Minuten?», fragte Jess.
«Ich hab einen Termin», brummte Jaxon. Dann fügte er resigniert hinzu: «Wenn du schon mal da bist, kannst du genauso gut zuhören. Früher oder später hättest du es sowieso erfahren.»
Jess folgte den beiden in den Hauptraum. Die anderen hatten sich an ihre Computer zurückgezogen, beobachteten sie aber mit neugierigen Blicken. Als sie an dem Arbeitsplatz vorbeikamen, an dem vorhin das Video gelaufen war, sagte der Mann: «Ich hab die Daten übertragen, Jax.»
«Danke, Karl.» Jaxon ging zu dem einzigen noch freien Computer und setzte sich. Es schien sein angestammter Platz zu sein, was Jess an den Unmengen verbeulter Energydrink-Dosen erkannte, die zerknautscht in einem Mülleimer darunter lagen. Jaxon holte den Computer aus dem Ruhemodus, und während er darauf wartete, dass sich die Systeme aufbauten, nahm er eine kleine Plastikfigur von der Tischplatte und warf Mia einen vielsagenden Blick zu. «Willst du sie haben?»
Mia schüttelte den Kopf. «Behalt sie. Vielleicht bringt es ja Glück.»
Jaxon ließ die Figur in seine Hosentasche gleiten und klickte ein Icon auf dem Desktop an, woraufhin sich ein Videocall-Programm öffnete.
«Was macht ihr hier eigentlich genau?», fragte Jess. «Und seit wann trefft ihr euch in einem verlassenen U-Bahn-Schacht? Das war doch bestimmt ein Riesenaufwand, das ganze Zeug hier runterzuschaffen. Was ist aus eurem Garagentreffpunkt geworden?»
«Hier sind wir sicherer», erwiderte Jaxon ausweichend.
«Vor wem?»
«Das geht dich nichts an.»
«Aber …»
Sein Bruder schnitt ihm mit einem drohenden Blick das Wort ab. «Wenn du weiterfragst, werfe ich dich eigenhändig raus, klar?»
Zu Jess’ Erstaunen kam Mia ihm zu Hilfe. «Warum erzählst du es ihm nicht?»
«Weil ich nicht will, dass er in die Sache mit reingezogen wird. Je weniger er weiß, desto besser.»
Jess wollte protestieren, doch der wütende Blick seines Bruders ließ ihn verstummen. Jaxon klickte in die Kameraeinstellungen des Programms und wählte einen anderen Hintergrund aus, sodass der Kellerraum verschwand und sein Gesicht stattdessen vor einer mit Graffiti besprühten Betonwand zu sehen war.
Mia sah auf ihre Uhr. «Noch zwei Minuten.»
«Okay. Dann geh ich jetzt rein.»
«Wo rein?», fragte Jess.
Mia verdrehte die Augen. «Jetzt sag’s ihm schon.»
Jaxon seufzte. «Eine Spielefirma hat mich gefragt, ob ich als einer von zehn Teilnehmern an einem Testlauf für ein neues Spiel mitmachen will. Für das erste TVR-Adventure-Game der Spielegeschichte.»
«TVR?», fragte Jess. Den Ausdruck hatte er noch nie gehört.
«True Virtual Reality», erklärte Jaxon ungeduldig. «Die perfekte virtuelle Realität, der Full Dive, die vollständige Immersion, ganz ohne VR-Brille, Bodysuit und das ganze Zeug.»
«Und wie soll das gehen?», fragte Jess skeptisch.
Jaxon grinste. «Kannst du dir das nicht denken? Nach allem, was gerade durch die Nachrichten geht?»
Jess stutzte. «Du meinst doch nicht etwa … mit so einem Datenhelm?»
Jaxons Grinsen wurde breiter. «Doch, genau das meine ich.»
5
Fassungslos starrte Jess seinen Bruder an. In seinem Kopf explodierten so viele Fragen, dass er gar nicht wusste, welche er zuerst stellen sollte. «Reden wir hier von dem gleichen Ding, mit dem das Militär seine Soldaten ausstattet?»
«So was in der Art», erwiderte Jaxon. «Der Termin fängt gleich an. Danach reden wir in Ruhe, okay?»
Er warf Mia einen letzten Blick zu, und Jess glaubte, ein nervöses Flackern darin zu erkennen. Dann klickte er auf den runden Button in der Mitte des Bildschirms. Der Videocall baute sich auf und zeigte das Bild eines Mannes und einer Frau. Sie saßen nebeneinander an einem riesigen Tisch aus Chrom und Glas und schienen Jaxon bereits zu erwarten.
Jess sah, dass auch Kev, Karl und die anderen neugierig von ihren Plätzen herübersahen. Selbst Zac hatte seine Kopfhörer abgenommen, um zuhören zu können. Mia beugte sich zu Jess und legte einen Finger auf die Lippen. «Man kann uns nicht sehen», wisperte sie lautlos. «Aber wir müssen leise sein, sonst hört man uns über Jax’ Mikro.»
«Jaxon, wie schön, Sie wiederzusehen», begrüßte ihn die Frau.
«Danke», erwiderte Jaxon knapp.
«Mein Name ist Lilian Margulies, zuständige Projektleiterin bei cy.corp. Mich kennen Sie ja bereits von unserem ersten Call.» Sie deutete auf den Mann, der neben ihr saß und Jaxon ausdruckslos musterte. «Außerdem ist heute Lucius Wagner mit dabei, der Inhaber von cy.corp.»
Mia sog leise die Luft zwischen den Zähnen ein. «Wow. Das hohe Tier höchstpersönlich», flüsterte sie.
«Hallo», sagte Jaxon. Falls er über Wagners Anwesenheit genauso überrascht war wie Mia, ließ er es sich nicht anmerken.
«Freut mich, Sie kennenzulernen», erwiderte Wagner. «Wenn Sie nichts dagegen haben, würden wir gleich zum Geschäftlichen kommen.»
Jaxon nickte, und Margulies übernahm wieder das Wort. «Sie hatten eine Woche Zeit, über alles nachzudenken. Wir sind gespannt zu hören, wie Sie sich entschieden haben.»
Ohne zu zögern, antwortete Jaxon: «Ich bin dabei.»
Margulies nickte zufrieden, und Wagners Lippen umspielte ein beinahe triumphierendes Lächeln. «Das freut uns sehr. Die Erfahrung eines Spielers Ihres Formats ist von unschätzbarem Wert für uns.»