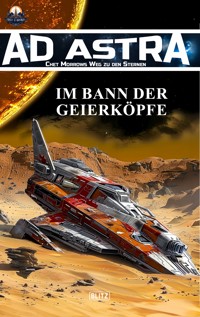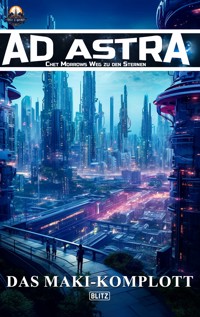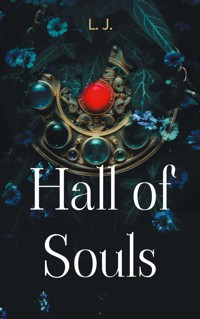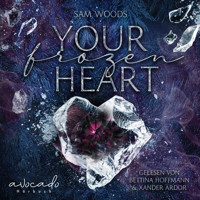Ad Astra – Chet Morrows Weg zu den Sternen, Neue Abenteuer 07: Hölle auf Eden E-Book
Melanie Brosowski
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Ad Astra – Chet Morrows Weg zu den Sternen, Neue Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Auf dem Planeten des Alpha-Centauri-Systems, den die Menschen Eden getauft haben, bricht die Hölle aus: Aus ungeklärter Ursache werden die Siedler attackiert von der heimischen Fauna, dabei gibt es mehrere Opfer. Es bleibt schließlich nur eine Möglichkeit: das Lager wird komplett geräumt. Alle dort lebenden Menschen und Sodoraner werden auf den zweiten bewohnbaren Planeten des Systems gebracht, in die Nähe von Neu-Rom. Ein Problem bleibt das anhaltende Misstrauen gegenüber den Außerirdischen. Schließlich macht eine der Sodoranerinnen eine folgenschwere Entdeckung: Es geht um die Verschleppung der Vorfahren der Römer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In dieser Reihe bisher erschienen
e601 Thomas T. C. Franke Ad Astra 01: Franke Schatten über dem Mars
e602 Thomas T. C. Franke Ad Astra 02: Die Kometenfalle
e603 A.N. O’Murtagh Ad Astra 03: Söldner der Galaxis
e604 Melanie Brosowski Ad Astra 04: Gestrandet in der weissen Hölle
e605 Thomas T. C. Franke Ad Astra 05: Jagt den Milan!
e606 Melanie Brosowski Ad Astra 06: Das Maki-Komplott
e607 Melanie Brosowski & Margret Schwekendiek Ad Astra 07: Hölle auf Eden
e608 Thomas T. C. Franke Ad Astra 08: Entscheidung auf Ceres
HÖLLE AUF EDEN
AD ASTRA – CHET MORROWS WEG ZU DEN STERNEN, NEUE ABENTEUER
BUCH 7
MELANIE BROSOWSKI
MARGRET SCHWEKENDIEK
Copyright © 2024 Blitz Verlag, eine Marke der Silberscore Beteiligungs GmbH, Mühlsteig 10, A-6633 Biberwier
In Zusammenarbeit mit
Heinz Mohlberg Verlag GmbH, Pfarrer-Evers-Ring 13, 50126 Bergheim
Redaktion: Danny Winter
Titelbild: Mario Heyer unter Verwendung der KI Software Midjourney
Umschlaggestaltung: Mario Heyer
Logo: Mario Heyer
Satz: Gero Reimer
Alle Rechte vorbehalten
Die Printausgabe des Buches ist 2013 im Mohlberg-Verlag erschienen.
ISBN: 978-3-942079-99-0
www.Blitz-Verlag.de
ISBN: 978
e607 vom 10.08.2024
INHALT
Rätselhafte Attacken
Verstärkung für die Siedler
Neue Hoffnung, neue Siedlung
Zurück im Leben
Ein Fund mit Nachwirkungen
Diebstähle und ein Überfall
Auf dem Planeten der Makis
Handfeste Schwierigkeiten
Epilog
Melanie Brosowski
Margret Schwekendiek
RÄTSELHAFTE ATTACKEN
Eden. Vanora Vaughan wiederholte den Namen leise, raunte ihn in die Dunkelheit der schwülwarmen Nacht. „Eden …“ Es war ein seltsamer Klang. Sie fragte sich, ob dieser Planet wohl nach dem Garten Eden benannt wurde, jenem sagenumwobenen Paradies der christlichen Religion der Menschen. Ihr Vater hatte ihr davon erzählt. So, wie er ihr Vieles über die Menschen und auch über ihre einstige Heimat Sodor erzählt hatte, damit Sodor nicht in Vergessenheit geriet. Bei dem Gedanken an ihn überkam Vanora eine große Traurigkeit. Es waren jetzt mehrere Monate her, seit er in ihren Armen gestorben war. Zu schwer war die Last auf seinen Schultern geworden, zu groß die Sorge. Sein krankes Herz hatte schließlich eines Nachts aufgehört hatte zu schlagen. Sie hatte nichts dagegen tun können, nur seine Hand halten. Nun lag die Verantwortung für die überlebenden Sodoraner, die einst ihrem Vater Randal Nascone gefolgt waren, in ihren Händen. An Caydens statt, der sie zur Frau genommen hatte, führte sie die kleine Gruppe von Frauen und Kindern an, die nun hier lebten, auf diesem Planeten. Ja, in einem gewissen Sinne war Eden wirklich ein Paradies für sie.
Es gab genug zu essen, damit sie satt wurden, niemand musste frieren und auch die medizinische Versorgung war gewährleistet. Dennoch, sie fühlte sich hier fremder als auf der Erde. Vanora seufzte und drückte ihren Sohn Emrys an sich. Er war ein gutes Stück gewachsen, seit sie die Erde verlassen hatten. Die Kinder der Sodoraner entwickelten sich schneller als die der Menschen, er konnte schon laufen, eigentlich hätte er auch bereits sprechen sollen, doch aus unerklärlichen Gründen blieb er stumm. Und was seine geistigen Fähigkeiten betraf …
Sie konnte bereits spüren, wie mächtig und stark diese künftig sein würden.
Das war gut. Es würde ihn beschützen. Und gleichzeitig war es seine größte Schwäche. Diese Fähigkeiten, sie würden ihn bei den Menschen zu einem Aussätzigen machen, die Terraner würden sich vor ihm fürchten. Der Grat, auf dem sie wanderten, war schmal und der Abgrund, in den sie fallen konnten, war tief. Ihre Gedanken wanderten zu Cayden Vaughan.
Chet Morrow, der Commander der Horizont, hatte ihr in einer Botschaft berichtet, was geschehen war. Sie hatte die Angst in seinen Augen gesehen, nicht wissend, wovor er sich fürchtete. Davor, einen Freund zu verlieren? Vor ihrer Reaktion? Vor den Folgen, den dieser Anschlag haben mochte? Es stand lange schlecht um Cay, Chet Morrow hatte ihr keine falschen Hoffnungen gemacht. Eine Lüge hätte sie schnell durchschaut. Diese hätte das dünne Band der Freundschaft, das Menschen und die Sodoraner mittlerweile verband, durchschnitten. Sie hatte das Einzige getan, was Cayden vielleicht retten konnte: Sie hatte Zula Makombe, der Ärztin der Horizont, alles erzählt, was sie über die Unterschiede zwischen sodoranischer und menschlicher Biologie wusste, zumindest hatte es geholfen, denn Cayden hatte es zuvor geschafft, sich vor jeglicher medizinischen Untersuchung zu drücken, typisch für ihn.
Seit der Botschaft des Commanders hatte sie nichts mehr von der Horizont gehört. Das mochte ein gutes Zeichen sein, aber es blieb ihr derzeit nichts übrig als zu warten. Sie schief wenig in den Nächten, oft lag sie stundenlang wach und betrachtete Emrys, wie er atmete, wie sich sein Brustkorb hob und senkte. Ihr Blick strich über seine ebenmäßigen Gesichtszüge, die denen seines Vaters so sehr ähnelten. Oh, wie vermisste sie ihn! Wie oft sehnte sie sich in den langen, einsamen Nächten nach seinen Armen, die sie hielten, nach seiner Stimme, seinen Berührungen. Eine Zeitlang hatte sie gedacht, sie würde seinen Verlust niemals verwinden, aber dann war Cayden gekommen … Und jetzt … jetzt sollte sie ihn auch noch verlieren?
Nein, das kann nicht sein. Das darf einfach nicht sein!
Cay hatte es nicht verdient zu sterben, nicht auf diese Art, nicht nach all dem, was er für die Menschen und für sie getan hatte. Eine Träne rann ihre Wange hinab. Als ob Emrys ihre Sorgen spüren konnte, begann er, sich unruhig zu bewegen, sie begann, leise zu singen.
Schlafe, mein schöner Engel! An der Grenze zwischen Tag und Nacht, werd´ ich bei dir sein.
Folge dir, in deinem Traum, Welten auseinander. Schlafe, mein schöner Engel, schlaf ein.
Das alte irdische Lied beruhigte den Jungen. Er schlief fest, auch Vanora fand einige Stunden Ruhe, bis der leise Piepton einer eingehenden Nachricht sie weckte. Sie drehte sich auf den Rücken und hielt die Augen geschlossen.
Hab ich es geträumt?
Das Piepen wiederholte sich. Ihr Herz begann schneller zu schlagen. Sie wollte nicht aufstehen. Sie wollte nicht wissen, was die Nachricht beinhaltete, denn sie hatte in der letzten Nacht von schwarzen Vögeln geträumt, die über das Land zogen. Dann hatte sich der Schwarm auf einen kahlen Baum niedergelassen … Ihre Rechte krallte sich in das Bettlaken, als könnte es ihr Halt geben. Sie wusste, egal wie lange sie liegen blieb, irgendwann musste sie sich der Realität stellen. Sie konnte nicht davor weglaufen. Mit einem Seufzen wandte sie sich um und blickte direkt in Emrys Augen. Er hatte die Augen seines Vaters; ebenso schwarz und unergründlich, selbst für sie. Ein seltsames Lächeln lag in seinen Zügen, als gäbe es nichts Schreckliches auf dieser Welt.
„Oh, Emrys!“ Versonnen strich sie ihm durch das Haar. Geh! schien sein Blick zu sagen und für einen winzigen Augenblick hatte sie das Gefühl seine Stimme in ihrem Kopf zu hören. Sie seufzte, dann schälte sie sich aus der Decke, legte sich ihr Tuch um die Schultern und hinüber zu der kleinen Computerkonsole. Fluoreszierende Falter umschwirrten sie und schienen dabei einen komplizierten Tanz aufzuführen, ehe sie durch das Fenster, durch welches silbriges Mondlicht fiel, entschwanden. Der Ruf eines Vogels durchbrach die Dunkelheit und ließ sie zusammenzucken, zögernd streckte sie die Hand aus. Was, wenn es eine Nachricht von Chet Morrow war? Wenn er ihr mitteilte, dass Cayden tot war? Dann würde sie allein sein, wieder einmal. Trotz der Wärme begann sie in ihrem dünnen Nachthemd zu frieren.
Ihre Hand zitterte, die zwei Armreife, Zeichen ihrer Ehe, klimperten leise, als sie die Nachricht annahm. Die Armreife versteckte sie; auch Chet Morrow hatte sie damals nicht gesehen, sondern nur die grüne Kette, die ihr Vater ihr einst geschenkt hatte. Ihr Vater hatte Recht gehabt. Sie würden sich anpassen müssen, um zu überleben. Auf alten Traditionen zu beharren, würde nichts bringen. Ja, sie war eine Frau und bereits zum zweiten Mal eine Bindung eingegangen. Aber was besagte das schon? Hier, unter den Menschen? Der sodoranischen Tradition folgend hätte sie warten müssen, bis sich jemand ihrer erbarmte und sie zur Frau nahm.
Auf so etwas würde keine Terranerin kommen!
Vanora war froh, dass sie sich nicht einem anderen Mann untergeordnet hatte. Entschlossen öffnete sie die Datei, auf dem Schirm erschienen die Worte der Nachricht. Sie war kurz, aber es war eine gute Nachricht! Cayden ist aufgewacht, es geht ihm gut. C. Morrow
Vanoras schloss die Augen. Er lebt! Sie schrieb nur ein Wort zurück: Danke. Sie hatte keine Ahnung, wie lange es dauern würde, bis die Botschaft ihren Adressaten erreichte. Alles, was sie wusste: Sie würde mit Hilfe des Transmitters reisen, bis zum Mars oder bis zur Erde. Und von dort aus würde sie weitergeleitet werden an das Schiff.
Sie stand auf, ging ins Bad, duschte kurz, machte sich und ihrem Sohn etwas zu essen, es war jetzt Frühstückszeit. Sie ging hinüber in die Baracke zu den anderen Frauen. Seit ihrer Ankunft hier arbeiteten sie gemeinsam an etwas, was ihr Vater das große Erbe genannt hatte. Alles, was sie über Sodor und die Geschichte des Planeten wussten, schrieben sie auf, damit es nicht in Vergessenheit geriet. Erinnerungen, von Generation zu Generation weitergegeben. Geschichten, Legenden. Das war alles, was ihnen geblieben war. Alles, was sie hinterlassen würden.
Es kam Vanora so wenig vor. So wenig für ein Volk, das einmal aus mehr als zehn Milliarden Individuen bestanden hatte. Den Erzählungen nach musste Sodor ein wunderschöner Planet gewesen sein, der Erde sehr ähnlich. Mit großen Landmassen, mit Meeren, Flüssen, Seen. Der Boden war überwiegend schwarz, so schwarz, dass der aufgewirbelte Staub manchmal für Tage die Sonne verdeckte …
Dieses einzigartige Werk jedoch, an dem sie arbeiteten, war nicht nur für sie und für ihre Kinder bestimmt. Es war genauso für all die Menschen gedacht, die ihnen nicht feindselig gesinnt waren, für diejenigen, die Interesse an ihrer Geschichte und Kultur hatten. Ja, es war Erbe und Geschenk in einem. Und wertvoll. Was machte ein Volk aus? Waren es die Überlieferungen? Nein. Vanora schüttelte in Gedanken den Kopf. Es sind die Taten. Doch von welchen Taten sollte Emrys eines Tages erzählen können?
* * *
„Pass auf, dass du nicht runterfällst“, mahnte Honkie. Adara Smith, die junge Frau und Soldatin, die ihr Herz für den eigenwilligen Mann entdeckt hatte, ließ ein kurzes Lachen hören. „Wahrscheinlich bin ich mehr Felswände hinauf und hinunter geklettert als du“, versetzte sie gut gelaunt und hielt nach einem weiteren Vorsprung Ausschau, an dem sie Halt finden konnte. Die beiden jungen Leute betätigten sich auf Eden als Forscher, wie fast alle Siedler. Schließlich handelte es sich um einen Planeten, über den nicht viel mehr bekannt war, als dass er ideale Lebensbedingungen für Menschen bot. Mit der einheimischen Fauna und Flora hatte es allerdings zuletzt einige unliebsame Überraschungen gegeben. Um sich vor künftigen Problemen zu schützen, mussten die neuen Bewohner des Planeten also so viel wie möglich über ihre Umwelt erfahren. Honkie und Adara hatten sich vorgenommen, die Höhlen im Steilhang, auf dem die Siedlung der Menschen hier auf Eden gegründet worden war, näher in Augenschein zu nehmen. Man hatte immer wieder mal Bewegungen großer und kleiner Tiere beobachtet. Niemand konnte sagen, ob es sich um harmlose Lebewesen oder womöglich gefährliche Tiere handelte, so wie die Gorgons, die alles fraßen, was ihnen zwischen die Zähne geriet, selbst die eigenen Artgenossen.
Der Bergbauingenieur der Stellar Mining Company hatte den Fehler gemacht, die Tiere zu unterschätzen, diesen Leichtsinn hätte er fast mit dem Leben bezahlt. Die Gefahren waren nur einer der Gründe, warum niemand allein auf die Suche gehen durfte. Aber Adara und Honkie steckten ohnehin dauernd zusammen, seit sie ihre Gefühle füreinander entdeckt hatten. Dabei waren die beiden von Natur aus grundverschieden. Auf der einen Seite die junge Soldatin, die durch eine harte Schule gegangen war. Sie entdeckte an sich völlig neue Emotionen, war damit nicht unzufrieden. Auf der anderen Seite Honkie, ein schüchterner junger Mann, der als blinder Passagier auf die Reise zu den Sternen gegangen war. Nach anfänglichem Ärger der Besatzung über den ungewollten Passagier hatte sich Honkies Anwesenheit an Bord als äußerst hilfreich herausgestellt. Er besaß die Fähigkeit, fremde Sprachen innerhalb kürzester Zeit zu erfassen und leicht Kontakt zu anderen Lebewesen aufzubauen. Auf den ersten Blick wirkte er jedoch weltfremd und chaotisch. Aber Gegensätze zogen sich nun einmal an. Die beiden waren inzwischen ein Paar, und jeder der Siedler akzeptierte diese Tatsache.
Honkie hatte schon länger vorgehabt, die Höhlen zu untersuchen. Jetzt bot sich die Gelegenheit, um es zusammen mit seiner Freundin zu versuchen. Aber zunächst mussten sie den Steilhang heil hinunterkommen. Honkie übte sich in ungewohnter Ritterlichkeit. Die Felsen waren scharfkantig und mit Moos bewachsen, immer wieder lösten sich kleine Steine. Es war schwierig und nicht ungefährlich. Adara und Honkie bewegten sich jedoch sehr sicher und erreichten schließlich wieder festen Boden. In einiger Entfernung mündete ein noch unbenannter Fluss in den Ozean. Hier am Strand schwappten die Wellen unruhig an die Felsen. „Da, schau!“, rief Adara und deutete auf ein ganzes Rudel Tiere, die wie flugunfähige Vögel wirkten. Die Tiere watschelten hastig aus einer Höhle heraus, drängten sich, gaben kreischende Laute von sich, dann stürzten sie sich gemeinschaftlich ins Wasser. Honkie lachte. „Die nehmen ein Gesellschaftsbad. Aber vielleicht haben sie auch alle gemeinsam Hunger bekommen und wollen Fische fangen.“ Adara schüttelte den Kopf. „Nein, meiner Meinung nach benehmen sich die Tiere merkwürdig. Ein solcher Massenauflauf deutet im Allgemeinen auf eine Gefahr für alle hin.“
„Woher willst du das wissen? Wir haben doch keine Ahnung, was für diese Tiere normal ist“, widersprach er.
„Wir werden ja sehen.“ Sie hatte rechtzeitig reagiert, die kleine Vid-Kamera des Armbandcomps nahm das Verhalten der Tiere auf. Und sie betrachtete eben kurz die scharfen Bilder, auf denen Einzelheiten zu erkennen waren. „Schade, dass wir nicht mal eben ein Tier fangen können, um noch bessere Nahaufnahmen zu machen und einen Chip einzusetzen“, bemerkte sie enttäuscht.
„Das wird früher oder später bestimmt ... ooaah!“ Honkie ruderte wild mit den Armen, der Boden schien sich aufzubäumen, Grollen und mahlende Geräusche klangen wie verzweifeltes Stöhnen aus dem Untergrund. Die beiden Menschen klammerten sich aneinander, um nicht zu stürzen. So plötzlich, wie das Getöse losgegangen war, so schlagartig kehrte wieder Ruhe ein.
„Seismische Aktivitäten?“ Honkie klang ungläubig. „Aber das kann doch gar nicht sein.“
„Warum nicht?“, gab sie zurück. „Hat es hier noch nie gegeben. Seismische Aktivitäten sind für den Planeten nicht mehr aktuell, unsere Wissenschaftler sagen, dafür sei er viel zu alt.“ Wider Willen musste Adara lachen. „Das heißt gar nichts. Der Untergrund der meisten Planeten bewegt sich ständig. Dabei verschieben sich die Platten. Das passiert auch dann, wenn man es mit einem alten Planeten zu tun hat, bei dem man glaubt, er wäre zur Ruhe gekommen.“
„Wie du meinst“, gab er nach. So verhielt er sich immer dann, wenn sich jemand als klüger erwies. Der Junge zog sich sofort in sein Schneckenhaus zurück. Gegenüber Adara sollte das eigentlich nicht nötig sein, aber diese Verhaltensweise steckte tief in ihm drin, Adara spürte das natürlich. „Oh, es tut mir leid, wenn ich geklungen habe wie eine Lehrerin. Komm, lass uns jetzt in die Höhle gehen. Bin gespannt, was wir finden. Ob diese Laufvögel dort brüten?“
Honkie nahm seiner Freundin nichts übel. Er packte sie bei der Hand, schritt forsch voran und zog sie hinter sich her. „Himmel, das riecht aber streng“, schnaufte Adara, als sie beide gut 30 Meter in der Höhle zurückgelegt hatten. „Oah! Hast recht, stinkt bestialisch“, stimmte er zu. Mit einer LED-Lampe leuchteten sie die Wand ab und staunten. In die harten Felswände hatten die Tiere Nischen geschlagen, auf welche Weise war ihnen noch nicht klar. Aber klar war: Hier lebte der Nachwuchs der Vögel. Als das Licht auf das erste Tier traf, kreischte es laut, die anderen Jungtiere, von denen es hier eine stattliche Anzahl gab, fielen zur Gesellschaft mit ein. Entsetzt hielten sich die beiden Menschen die Ohren zu.
„Raus hier!“, brüllte Honkie. In diesem Augenblick kehrten die erwachsenen Tiere zurück, griffen die Menschen ohne Vorwarnung an. Obwohl sie keinen Meter groß waren, schienen die Vögel keine Angst vor den unbekannten Lebewesen zu haben. Der erste wuchtige Schnabelhieb traf Adara, sie schrie auf. „Verdammt!“ Sie schaute auf den Schnabel des Tieres. Ohne Zweifel. Damit hatten die Vögel die Taschen in das harte Gestein geschlagen. Honkie und Adara wichen zurück. Und ...
„Oh, Mist!“ Honkies Taschenlampe zeigte um sie herum nur diese Vögel, die sie nun von allen Seiten attackierten. Er kämpfte mit der Panik.
Ich muss stark sein. Für Adara. Muss sie beschützen.
Die junge Soldatin hingegen wusste, dass sie aufgrund ihrer Ausbildung und auch der seelischen Stärke für sie beide verantwortlich war. Adara griff an die Hüfte, zog den Nadler, stellte ihn auf geringe Leistung, sie wollte die Vögel nur vertreiben, nicht töten. Adara bekam einen weiteren Schnabelhieb auf den Oberschenkel.
„Aua, verdammt noch eins!“ Honkie trat und schlug um sich, es reichte nicht, von allen Seiten zuckten die Schnäbel, hackten auf sie ein. Adara schoss, drehte sich ... und stürzte zu Boden. Neben ihr lag Honkie.
Das erste Beben war auf dem Rest des Planeten kaum registriert worden, das Epizentrum lag sehr weit draußen im Ozean, das neue Beben war buchstäblich umwerfend. Der Boden schien aufzustöhnen, der ekelhafte Gestank nach faulen Eiern, offenkundig Schwefeldioxid, mischte sich mit dem Geruch in der Höhle. Adara und Honkie mussten sich übergeben, die Laufvögel waren völlig verwirrt, das Gekreische steigerte sich zum wilden Crescendo, die Tiere rannten kopflos durcheinander.
Wenigstens lassen sie von uns ab. Adara schnappte verzweifelt nach Luft, rappelte sich hoch. Fasste nach Honkies Arm, zerrte ihn mit sich. Raus hier, nur raus, war ihr einziger Gedanke. Ein Grollen, das von überall her zu kommen schien, ließ beide innehalten. Die Luft war mit Elektrizität aufgeladen, angefüllt mit dem entsetzlichen Gestank und nun auch dicht und schwer von Staub. Honkie hustete, Adara schnappte erneut nach Luft. Dann brach über ihnen die Decke ein, ihr wurde schwarz vor Augen.
* * *
Das Erste, was Adara bewusstwurde, als sie wieder klar war, war der Schmerz. Als sie versuchte sich zu bewegen, brachen die letzten Augenblicke vor dem Beben über sie herein. „Honkie!“ Die junge Frau röchelte, wollte trotz der mörderischen Schmerzen den Kopf heben. „Ich bin hier“, kam die Stimme des jungen Mannes aus der Dunkelheit. Die Taschenlampe war unter Schutt und Felsen begraben worden, als die Decke herabgestürzt war.
„Bist du verletzt?“, wollte sie wissen und setzte sich mit einem Ruck auf. Sie bereute es im nächsten Augenblick, als sie eine neue Schmerzwelle traf, sie blieb aber stur bei ihrem Vorhaben. Ein wenig links von sich entdeckte sie nun den Lichtschein, die Lampe lag unter Schutt und Staub. Mit zitternden Fingern griff sie danach, zerrte die Lampe hervor. Im Lichtkegel sah sie die Verwüstung. Viele Laufvögel hatten den Einsturz nicht überlebt, die blutigen Kadaver lagen überall um sie herum. Einige Jungtiere in den Nisttaschen hatten überlebt und kreischten weiter. Die Tonlage hatten sich aber geändert.
Adara mühte sich, Geräusche ebenso wie den Gestank in den Hintergrund ihres Denkens zu verschieben. „Wo bist du?“, fragte sie und ließ wieder den Strahl der Lampe wandern.
„Hier“, gab Honkie zurück, seine Stimme klang unglaublich ruhig, und gerade das beunruhigte Adara. Sie folgte der Stimme, dann hielt sie erschrocken den Atem an. Im Lichtstrahl sah sie den jungen Mann, ein Felsbrocken lag auf ihm, nur sein Kopf und seine Arme, die seltsam verdreht wirkten, waren für sie sichtbar. Sie schluckte. „Was machst du nur für Sachen? Hat dir niemand beigebracht, dass man sich nicht mit Steinen zudecken soll?“, fragte sie gespielt munter, Honkie ging nicht auf ihren lockeren Ton ein. Ihm schien der Ernst der Lage durchaus bewusst. Seine Angst zeigte er aber nicht. „Es … ist zu spät“, gab er zurück. Adara krabbelte vorsichtig näher, bemüht, keine Hindernisse anzustoßen, die Honkie unter Umständen noch mehr verletzten.
„Wo tut es dir weh?“, fragte sie. „Sind deine Beine auch verschüttet, oder kannst du sie bewegen?“
„Weiß nicht“, erklärte der Junge, es klang fast fröhlich. „Ich spüre nichts, gar nichts.“
Ein heißer Stich durchzuckte Adara, jetzt sah sie den Grund für die Bewegungsunfähigkeit des jungen Mannes.
Seine Wirbelsäule. Sie muss verletzt sein.
Das erklärte, warum er keine Schmerzen empfand. Bis vor wenigen Jahren hätte eine solche Verletzung ein endloses Dahinvegetieren im Krankenbett bedeutet, angeschlossen an zahlreiche Maschinen und Monitore. In letzter Zeit hatte die Medizin jedoch einen Quantensprung gemacht, es bestand Aussichten auf Heilung falls … Ja, falls es ihr gelang, Honkie zu befreien oder rechtzeitig Hilfe zu holen. Sie schluckte erneut, beugte sich vor und gab ihm vorsichtig einen Kuss. Dann versuchte sie, den Felsbrocken zur Seite zu wälzen. Vergeblich, es gelang ihr nicht, den Stein auch nur einen Millimeter zu bewegen.
„Lass gut sein, es hat keinen Zweck“, sagte Honkie, der den Bemühungen ruhig zugesehen hatte. „Es tut mir leid, Adara, ich habe wirklich gedacht, wir beide könnten zusammen …“
„Nein!“ Adara wollte es nicht akzeptieren, dass Honkie hier vor ihren Augen starb. „Mach dir keine Sorgen um mich“, fuhr er fort. „Ich hab keine Angst, im Gegenteil, ich bin neugierig. Wird ... auch nicht mehr lange dauern, das spüre ich. Versprich mir, dass du ab und zu an mich denkst.“ Er wirkte so ungeheuer vernünftig und gefasst, Adara musste mit den Tränen kämpfen. Eine Soldatin, die weint? schalt sie sich selbst und war dennoch hilflos. Honkie hatte erkannt, dass es keine Rettung für ihn gab. Nun musste seine Freundin dies ebenfalls akzeptieren.
„Du musst gehen“, mahnte er. „Schnell! Es kann sein, dass mehr Beben auftreten. Ich spüre den Grund unter mir arbeiten.“ Es war unlogisch, was er da sagte. Er konnte kaum noch den eigenen Körper spüren, geschweige denn den Boden unter sich. Trotzdem mochte er Recht haben. Außerdem hatte Adara gerade festgestellt, dass ein stetiger Blutstrom aus seinem Körper anhielt, im Licht der Lampe sah sein Gesicht aus wie eine bleiche Maske.
Er hat recht. Er wird nicht mehr lange leben.
Sie kämpfte um ihre Beherrschung. Selbst, wenn sie jetzt sofort einen Weg aus der Höhle fand, würde die Zeit nicht ausreichen, um rechtzeitig Hilfe zu holen. Sie wollte bleiben, um Honkie das Sterben leichter zu machen. Er wirkt so gefasst.
Sie nahm seine Arme und legte sie auf die Brust, er lächelte sie an, dann … war es vorbei. Honkie atmete nicht mehr, Adara begann zu schluchzen. Dann schlug sie in hilfloser Verzweiflung gegen die Felswände, der Schmerz bracht sie schnell zur Vernunft. Sie musste so schnell wie möglich einen Weg nach draußen finden, raus aus dem Schutt und Gestein.
* * *
„Na los, Männer, keine Müdigkeit vorschützen!“, brüllte Giorgio Thoeni und musterte die neue Gruppe der römischen Legionäre, die hier im Lager die Ausbildung erhielten. Sie sollten demnächst als Söldner für die Makis dienen. Wann immer das auch sein mochte, nach den jüngsten unerfreulichen Erfahrungen. Aber immerhin: Die grundsätzlichen Vereinbarungen zwischen den Menschen und Makis galten weiter. Deswegen gab es hier ja auch den Transmitter, der sie mit dem Mars verband. Giorgio wartete, bis die Männer in Formation angetreten waren. Die neue Gruppe bestand ausschließlich aus Römern, die so etwas wie eine Grundausbildung der Legion mitgemacht hatten. Alle waren körperlich in bester Verfassung, trotzdem konnte ihre Fitness gesteigert werden. Wichtiger aber: Hier bekamen sie die Ausbildung an den modernen Waffen, vor allem den Nadlern, überdies mussten die Söldner die für sie fremde englische Sprache lernen, das Allgemeinwissen musste aufgestockt werden und Grundregeln der Strategie – die dank der modernen Technik etwa mit Drohnen so ganz anders aussah, als sie es von ihrer Heimat Neu-Rom her kannten. Alles in allem handelte es sich um ein erhebliches Pensum.
Der ehemalige Rauminfanterist und Adjutant von General Antoli Onkel Tolja Anduri war nach einer schweren Verletzung ausgemustert worden. Er hatte lange befürchtet, den Rest seines Lebens nutzlos auf dem Mars verbringen zu müssen. Dann waren die Makis gekommen, mit ihnen die Idee, Römer zu rekrutieren als Söldner, und Giorgios Wissen um Technik und Ausbildung war unschätzbar wertvoll. Er musste nicht mit den Soldaten konkurrieren. Die Neuankömmlinge lernten aber schnell, dass dieser Krüppel zum einen noch eine Menge konnte, auch im Schwertkampf. Zum anderen besaß er die Erfahrung in der Ausbildung, wusste, wie weit er die Männer antreiben durfte, um ihre Stärken und Schwächen zu erkennen.
An Thoenis Seite war seither Svetlana Bachmann. Auch die Amazone hatte einige Schicksalsschläge einstecken müssen. Zuletzt hatte sie ein Schädeltrauma bei einer Dyna-Landung auf einer Rettungsmission erlitten. In Zeiten vor der Katastrophe wäre das ein klarer Fall von Innendienst bis zur Genesung gewesen. Doch die Überlebenden brauchten jeden verfügbaren Spezialisten. So hatte auch Svetlana ihre Nische gefunden: Bei der Ausbildung der Römer.
Heute war wieder einer der Hindernisläufe dran. Nicht einfach nur über Stock und Stein. Dazu kamen Tümpel, Matsch, Gruben, in die man hineinsprang. Und aus denen man nur herauskam, wenn die Gruppe zusammenarbeitete. Dazu kamen Hängeleitern und Stämme einheimischer Bäume, die man aufgebockt hatte, und über die nun die Römer balancieren mussten. Ein Fehltritt und man fiel weich nur knapp einen Meter tief auf die Erde. Nur, dass man dann wieder zurück an den Anfang musste. Die derzeit 24 Rekruten rannten, sprangen, kletterten und robbten. Sie trugen die neue Skylon-Montur, für die Übungen wollte niemand mehr die wertvollen Anzüge benutzen, denn für sie gab es derzeit kaum Ersatz. Auch etwas, was die Menschen mit dem Kometen-Einschlag verloren hatten.
Die Rucksäcke der Soldaten waren aus ganz anderem Material, aus Leder, echt römisch. Sie nutzten eben das, was verfügbar war. Gut 20 Kilo Ausrüstung trug jeder Soldat damit auf dem Rücken und an der Hüfte. Vielleicht war es unnötig, die moderne Kampfweise unterschied sich sehr von den Einsätzen, die die Römer bisher kannten. Aber Giorgio und die Amazone ließen die Römer gewähren, unterstützten sie darin, ihre Rucksäcke mitzuschleppen. So viel sie auch trennen mochte, Giorgio und die Römer glaubten, ein Kämpfer sei erst komplett, wenn er in jeder Lage und bei jeder Belastung standhalten konnte. Der Ausbilder sah die Erschöpfung in den Gesichtern der Männer, aber auch den Willen durchzuhalten. Klagen hatte der Südtiroler nicht gehört, allenfalls die eine oder andere Verwünschung, wenn einer der Männer an einem Hindernis abrutschte und einen neuen Anlauf brauchte.
So weit, so gut. Zumindest herrscht bei denen eine gute Kameradschaft.
Eine Besonderheit dieser Gruppe war die Tatsache, dass jeder der Söldner sein Kurzschwert links am Gürtel trug und es auf keinen Fall ablegen wollte.
„Er wird sich mit seinem Gladius noch selbst den Bauch aufschlitzen“, schimpfte Giorgio, während er beobachtete, wie sich der junge Drusus in den Dreck warf, um unter einem künstlichen Hindernis hindurchzukriechen. Der Rekrut, der nur etwas mehr als 16 Jahre alt war und kaum die Grundausbildung auf Neu-Rom hinter sich gebracht hatte, fiel ihm nicht zum ersten Mal auf. Der Junge war hochintelligent, begriff den Lehrstoff in erstaunlich kurzer Zeit und lernte die fremde Sprache schneller als die anderen. Was jedoch die praktische Ausbildung betraf, war Drusus eine wandelnde Katastrophe, er stolperte über die eigenen Füße, verhedderte sich gerne in seiner Ausrüstung, oder verletzte sich fast selbst.
„Drusus!“ Thoeni brüllte erneut, der junge Mann mit den krausen Haaren und dem ansteckenden Lachen hob ruckartig den Kopf, schlug dabei gegen die Querstrebe, unter der er gerade durchrobben sollte. Giorgio schüttelte den Kopf. Lord, der kleine Ötzlan, kam in sein Blickfeld. Das Wesen mit dem blauen Pelz hatte bis jetzt still auf der Schulter des Mannes gesessen. „Der Junge ist eine Gefahr. Für die gesamte Bevölkerung und für sich selbst“, seufzte Giorgio und sah zu, wie Drusus den Versuch unternahm, sich aus dem flachen Hindernis am Boden herauszuwinden. Dabei blieb er zunächst mit dem Gladius hängen, dann verhakte sich der Rucksack. Schließlich trat Drusus einem nachfolgenden Kameraden ins Gesicht, aus Versehen natürlich. „Du hast keine Ahnung, was wirklich eine Gefahr für die Bevölkerung ist“, erklärte Lord mit schriller Stimme. Das einheimische Wesen war trotz seiner Winzigkeit intelligent, auch bei dieser eigentlich unmöglichen Entwicklung hatten wohl die Großen ihre Hände im Spiel gehabt. Zumal Lord noch andere Fähigkeiten aufwies. Giorgio reagierte jetzt auf das Wesen. „Wie meinst du das?“
„Hier liegt Gefahr ... in der Luft. Ich kann es nicht anders ausdrücken.“
„Das ist keine hilfreiche Bemerkung“, rügte der Mensch. „Wenn du es nicht genauer ausdrücken kannst, wäre es besser zu schweigen, bevor du die Pferde scheu machst.“
„F… ä ... h ... d ...“ Lord dehnte das Wort. „Was ist das eigentlich? Wozu dient es? Wie intelligent sind sie? Besitzen die eine Kultur?“
„Lord“, unterbrach Georgio scharf. „Was soll das dumme Gerede? Sag mir lieber was über diese Gefahr, anstatt über Pferde zu reden.“
„Du hast angefangen! Hast gesagt, dass Pferde scheu werden.“
„Salve, Magister!“, rief Drusus nun, dem es gelungen war, den Hindernissen auf dem Marterpfad zu entkommen, nahezu unbeschadet. „Lord, das spielt jetzt keine Rolle, es ist nur eine Redensart.“ Giorgio nickte Drusus zu. „Ihr Menschen seid wirklich seltsam“, schrillte der Kleine. Der römische Söldner wunderte sich nicht mehr über das sprechende Tier. Lord wurde ebenso akzeptiert, wie andere Veränderungen, mit denen die Römer hier fertigwerden mussten.
„Salve, Drusus“, erwiderte der Südtiroler nun den Gruß höflich, während er die Gestalt des Jungen musterte.
Hoffnungslos, aus Drusus wird niemals ein Kämpfer.
Das war vermutlich auch der Grund, warum die Römer ihn vor Abschluss der Grundausbildung zu den Menschen geschickt hatten. „Properate!“, rief er zu den anderen Söldnern gegenüber, von denen einige nun doch neugierig herüberblickten. Beeilt euch, bedeutete das. Drusus sprach mittlerweile verständliches Englisch, Giorgio wollte ihn daher mit anderen Aufgaben betrauen. Der Junge gehörte nicht an die Front, doch er könnte als Dolmetscher dienen oder sich in der Verwaltung nützlich machen. Keine Armee, auch keine Truppe von Söldnern blieb von Bürokratie verschont. Sie schien universell vorhanden zu sein. Giorgio griff vorsichtig nach Drusus‘ Schwert. „Die Waffe ist zu gefährlich für dich“, erklärte er. Trauer zeigte sich auf dem Gesicht des Jungen, er setzte an, um sich zu verteidigen und den Ausbilder davon abzuhalten, ihn womöglich wieder nach Neu-Rom zurückzuschicken. Ein dumpfes Grollen unter seinen Füßen ließ Giorgio einhalten.
Was zum Henker? Alles schien zu schwanken, Halt suchend ruderten die Männer mit den Armen, stürzten, oder setzten sich schnell hin. „Erdbeben!“, brüllte Thoeni, dann stürzte auch er zu Boden, wenigstens nicht auf sein verletztes Bein. Er erwartete, dass sich jeden Augenblick der Erdboden auftat, aber es geschah nicht. Plötzlich war es wieder ruhig, nur die Blätter der Bäume rauschten.
Die Söldner standen wie erstarrt, einige waren mitten im Sprung erwischt worden, andere hatten sich zu Boden geworfen. Drusus kniete besorgt neben Giorgio. „Ist dir was passiert?“, fragte er und warf prüfende Blicke auf die Beine des älteren Mannes, denn er wusste um dessen Verletzungen.
„Nein, ich glaube nicht.“ Giorgio tastete seine Gliedmaßen ab und grinste schließlich. „Das war zum Glück kein heftiges Beben, ich glaube, der Planet hat nur etwas Bauchgrummeln. So, jemand verletzt von euch? Nein? Wer hat denn gesagt, dass ihr eine Pause einlegen dürft? Properate, Herrschaften, auf die Beine und vorwärts! Dann habt ihr es bald geschafft.“ Er ließ sich von Drusus beim Aufstehen helfen. Seine Blicke gelitten prüfend durch die Gegend in die Richtung, in der sich die kleine Siedlung befand. Hoffentlich war dort alles in Ordnung. Eden entpuppte sich immer mehr als Paradies mit Fehlern.
* * *
In der Siedlung herrschte emsiges Treiben. Trotz der technischen Hilfsmittel, die zur Verfügung standen, gab es unendlich viel zu tun. Als Mediziner hatte sich Orlando Legget mit Feuereifer daran gemacht, Fauna und Flora Edens zu untersuchen, um die Möglichkeiten neuer Arzneien zu erforschen. Die meisten Siedler waren damit beschäftigt, die landwirtschaftliche Produktion voranzutreiben. Ackerbau und Viehzucht waren überlebenswichtig und die Grundlage für eine dauerhafte Besiedlung. Außerdem wurden die ersten Getreidelieferungen dringend auf dem Mars erwartet. Seit Kurzem befanden sich Sodoranerinnen in der kleinen Ortschaft, einige hatten auch kleine Kinder dabei, wie Vanora Vaughan. Wie die Terraner hatte sie den Nachnamen ihres Partners angenommen. Vanora war froh, nicht mehr untätig rumsitzen zu müssen, so wie auf der Erde. Als jetzt der Boden bebte, befand sie sich gerade mit anderen Siedlern beim Ausbau eines neuen Bungalows, der in Zukunft als Kindergarten und Schule genutzt werden sollte.
„Beben sind nichts Besonderes“, erklärte Raiko Musume, die aus Japan stammte und sich deshalb mit Erdbeben auskannte.
„Vielleicht in ihrer Heimat“, bemerkte Vanora. „Aber ich empfinde ein solches Beben als höchst unangenehm und gefährlich. Was, wenn die Wände des Gebäudes einstürzen und jemanden verletzen oder gar erschlagen?“
„Sie haben natürlich recht. Entschuldigung“, sagte Raiko. „Es hat bei den großen Beben auf der Erde, auch in meiner Heimat, oft viele Tote gegeben. Aber das war früher, dann waren unsere Bauten ...“ Sie schwieg, erinnerte sich wohl an Japan, an die Insel, die bei der Katastrophe von schwersten Fluten getroffen worden war. Raiko riss sich zusammen. „Eigentlich gibt es hier auf Eden überhaupt keine seismischen Aktivitäten, seit wir gelandet sind. Hoffentlich bleibt das eine Ausnahme.“
Aus der Richtung des Ausbildungslagers sahen die Siedler nun eine Gestalt, die in ihre Richtung lief. Es war Svetlana Bachmann, die sich Sorgen gemacht hatte, ob hier auch alles in Ordnung war. Die Söldner waren alle unverletzt, sie hoffte, dass es auch an den anderen Plätzen allen gut ging. „Alle okay?“, rief die stets gut gelaunte Frau. „Hat es Schäden bei euch gegeben? Braucht ihr Hilfe?“
Aus einem der Gebäude kam Orlando Legget, er lächelte die Amazone an. „Es hat uns ein bisschen erschreckt, aber wir lassen uns doch nicht von einem so kleinen Schubs aus der Ruhe bringen. Da haben wir schon andere Stürme überstanden.“
„Bei uns ist auch alles in Ordnung, aber ich finde es trotzdem seltsam, dass die Erde bebt.“
„Jeder Planet kann davon betroffen sein. Wir sollten das nicht überbewerten. Wie steht es mit der Ausbildung? Machen die Leute Fortschritte?“ Orlando machte sich keine weiteren Gedanken darüber, dass der alte Planet eigentlich längst zur Ruhe gekommen sein sollte. „Und wie“, bekräftigte Svetlana. „Ich finde es erstaunlich, zu welchen Leistungen die Römer fähig sind. Irdische Soldaten hätten längst gemeutert.“
„Und was würden Sie mit Meuterern tun?“, fragte Orlando interessiert.
„Hm, lassen Sie mich überlegen“, erwiderte sie gespielt ernsthaft. „Wie war das gleich: Teeren, federn, vierteilen? Da hätten wir einiges zur Auswahl.“ Legget lachte leise, Vanora stand steif da, blickte die Amazone entsetzt an. „Sie würden die Männer auf grausame Weise bestrafen und töten?“ Sie war mit dem schwarzen Humor der Menschen nicht wirklich vertraut. Die Amazone beeilte sich, zu erklären, dass es sich nicht um ein ernsthaftes Vorhaben handelte.
„Sie treiben Scherze mit dem Tod?“
„Könnte man so sagen. Ja, das hat bei uns eine lange Tradition. Meist dient es dazu, die eigenen Ängste vor dem Tod zu bekämpfen.“
„Ich werde darüber nachdenken“, erklärte Vanora. „Wie ich gehört habe, hängen ihre religiösen Bräuche eng damit zusammen.“