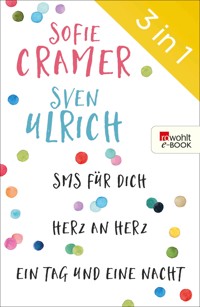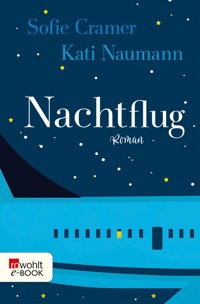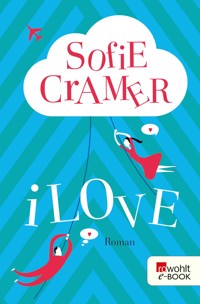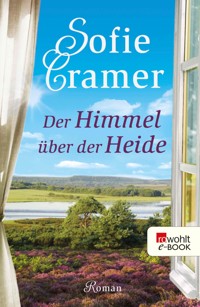9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Liebe, größer als das Meer. Kurz vor Maries Hochzeit stirbt unerwartet ihre geliebte Oma Anneliese. Die junge Frau ist wie gelähmt vor Trauer, die Feier wird verschoben. Im Nachlass findet Marie ein Bündel alter Briefe. Wunderschöne Liebesbriefe, von einem Paul Hansen aus Amrum. Neugierig nimmt sie Kontakt zu dem Fremden auf und erhält prompt eine Antwort. Zwischen Hamburg und der Nordseeinsel entspinnt sich ein reger Briefwechsel. Doch nach und nach kommen Marie die Briefe immer rätselhafter vor. Sie beschließt, selbst nach Amrum zu reisen – und erlebt eine Überraschung. Auf den Spuren ihrer Großmutter und einer schicksalhaften Liebe entdeckt sie ein Geheimnis, das auch ihr Leben für immer verändern wird …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Sofie Cramer
All deine Zeilen
Roman
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Für Stefan, den Mann,
den ich immer wieder heiraten würde
Marie
Das wird die schönste Hochzeitstorte, die das Alte Land je gesehen hat!»
Immer und immer wieder hallte dieser alberne Satz in Maries Kopf nach. Dabei war es schon etliche Monate her, dass ihre Großmutter Anneliese ihn mit der für sie typischen Selbstironie ausgesprochen hatte. Gleich nachdem Marie ihr erzählt hatte, dass Maximilian Bergmann ihr einen Antrag gemacht hatte. Statt sie zu beglückwünschen, stellte ihre Oma eine Bedingung.
Wenn sie schon nicht besonders angetan war von ihrem zukünftigen Schwiegerenkel und noch viel weniger von der «pseudoadeligen Sippe», in die Marie einheiraten würde, so bestand sie darauf, wenigstens die Hochzeitstorte beisteuern zu dürfen.
Marie erinnerte sich noch sehr genau, wie sie innerlich zusammengezuckt war, aber ihre Bedenken zu überspielen versucht hatte. Sie hatte nämlich an ihre baldige Schwiegermutter Constanze denken müssen und daran, dass diese gerne alles an sich riss. Sie würde sicher wenig begeistert sein, wenn sie erfuhr, dass ausgerechnet bei einem der Höhepunkte der Feier – dem Anschneiden der Hochzeitstorte gegen Mitternacht, gleich nach dem großen Feuerwerk – Oma Anneliese und deren Backkünste im Mittelpunkt stehen würden.
Doch jetzt erschienen Marie all diese Animositäten schrecklich banal. Heute war der Tag, an dem ihre über alles geliebte Oma für immer die Augen geschlossen hatte. Trotz ihres mit 86 Jahren hohen Alters hatte es keine Anzeichen für ein labiles Herz gegeben. Und doch war es stehengeblieben, ausgerechnet heute, am Tag von Maries Verlobungsfeier.
Paul
Das Telefon klingelte. Paul blickte auf. Er musste eine ganze Weile auf das linierte, noch immer unbeschriebene Blatt vor ihm auf dem Schreibtisch gestarrt haben. Seine Augen brannten, und sein Genick schmerzte. Sosehr er sich auch bemühte, kein einziges Wort fand den Weg aufs Papier.
Nach dem zehnten Klingeln verstummte das Telefon endlich. Paul machte sich nicht einmal die Mühe, auf dem Display nachzusehen, wer angerufen hatte. Seine Tochter Leonie würde eher auf seinem Handy anrufen, trotzdem verspürte er den Anflug eines schlechten Gewissens. Unwillkürlich drängte sich ihm die Frage auf, ob er ein guter Vater war.
Vor gar nicht allzu langer Zeit, als sie noch eine richtige Familie gewesen waren, hatte sich Paul diese Frage nie gestellt. Doch heute verfolgte sie ihn wie lästiger Zigarettenrauch, den man nach einer Party nicht loswird.
Paul erhob sich mit einem Stöhnen, um sich aus der Küche den dritten Becher Kaffee des Tages zu holen. Dort stand noch immer das Frühstück von heute Morgen. Inken hatte es gehasst, wenn er die Milch nicht sofort dahin zurückbeförderte, wo sie hingehörte, nämlich in den Kühlschrank. Dass sie nun schon seit ein paar Stunden nutzlos auf dem Küchentresen gestanden hatte, war jetzt sogar ihm unangenehm. Er goss einen großen Schluck in seinen Kaffee und bemerkte, dass sie flockte. Angewidert schüttete er den Inhalt der Tasse in den Ausguss des Waschbeckens, wo sich das dreckige Geschirr von gestern und vorgestern stapelte.
Als er eine neue Packung Milch aus dem Kühlschrank nehmen wollte, musste er feststellen, dass keine mehr da war.
«Idiot!», zischte er.
Wenn Leonie morgen erneut Appetit auf ihre labberigen Cornflakes hatte, brauchte sie frische Milch. Nun musste er also noch einkaufen gehen, obwohl er ausgerechnet heute niemandem hatte begegnen wollen auf dieser kleinen Insel. Auf Amrum kannte jeder jeden, zumindest vom Sehen.
Ob er Leonie bitten sollte? Vielleicht konnte sie nach der Schule kurz beim Supermarkt vorbeigehen und …
Aber nein! Paul schüttelte den Kopf. Heute musste er so gut funktionieren, wie er konnte, und stark sein für seine Tochter. Schließlich hatte nicht nur er genau vor einem Jahr seine Frau, sondern Leonie auch ihre Mama für immer verloren.
Marie
Marie schreckte hoch und blickte auf die Uhr. Es war bereits früher Abend. Sie lag schon seit Stunden auf dem Bett im Gästezimmer des riesigen Hauses ihrer Schwiegereltern und vermochte nicht zu sagen, ob sie geschlafen oder bloß wie gelähmt ihren Gedanken nachgehangen hatte.
Ein Klopfen holte sie zurück in die brutale Realität. Obwohl sie nicht antwortete, öffnete sich die Tür, und Marie hoffte, dass es nicht ihre Schwiegermutter in spe war.
Vergeblich. Mit betretenem Gesichtsausdruck trat Constanze zu Marie ans Bett und sagte: «Wir essen in zehn Minuten. Wenn du dich noch frisch machen möchtest …?»
Was wie eine Frage formuliert war, kam eher einem Befehl gleich. Doch Marie war außer Stande, ihm zu gehorchen, und schwieg.
Mit hochgezogenen Augenbrauen wartete Constanze auf eine Reaktion, doch Marie blieb reglos im Kingsize-Bett liegen und blickte mit ihren verweinten Augen in Richtung Fenster, von wo aus man einen imposanten Blick auf den Elbstrand von Blankenese hatte. Der Frühling stand vor der Tür, die Dämmerung war noch nicht in Sicht.
Dennoch bekam Marie Angst vor der Dunkelheit der ersten Nacht und noch mehr vor dem Aufwachen am nächsten Morgen, an dem sich der Verlust ihrer Oma sicher noch schlimmer anfühlen würde. Denn so viel wusste Marie noch. Mit Trauer kannte sie sich aus. Als sie neun Jahre alt gewesen war, hatte sie ihre Mutter Vera verloren. Obwohl ihr Unfalltod für alle ein monströser Schreck gewesen war, der Marie bis in die Grundfesten ihres Herzens erschüttert hatte, konnte sie sich noch gut daran erinnern, dass es ihr in den ersten Wochen danach mit jedem Tag noch schlechter ergangen war. Und das, obwohl sie stets dachte, es konnte gar nicht mehr schlimmer kommen. Immer mehr Erinnerungen an ihre Mutter und Gedanken an all die Anlässe, an denen sie ihr fehlen würde, waren ihr im Kopf herumgespukt. Das nächste Weihnachtsfest, der nächste Geburtstag, die nächste Erkältung. Alles, auch den quälenden Schulalltag, hatte sie von da an allein mit ihrem Vater durchstehen müssen. Und fast auf den Tag genau, 25 Jahre später, war das Gefühl des Schmerzes und der Ohnmacht wieder da. Maries Oma war für immer aus ihrem Leben verschwunden, die Frau, die stets versucht hatte, den Verlust ihrer Mutter so gut es ging aufzufangen.
Constanze ließ sich von Maries Schweigen nicht beeindrucken. «Du solltest eine Kleinigkeit essen! Das wird dir guttun. Und bevor wir all die Köstlichkeiten wegwerfen …»
Marie ließ diese Bemerkung seltsam unberührt. Sie hatte sie zwar gehört, aber die Worte kamen nicht wirklich bei ihr an. Beinahe erschrocken über ihre eigene Stimme, hörte sie sich plötzlich fragen: «Wo ist Max?»
«Maximilian hat sich um das Nötigste gekümmert. Ein freundlicher Herr vom Bestattungsunternehmen war bereits hier.»
«Das heißt, sie ist nicht mehr da», flüsterte Marie.
Constanze überging diese Äußerung und beugte sich hinunter, um die Tagesdecke aufzuheben, die Marie einfach auf den flauschigen Teppichboden geschleudert hatte. Constanze schlug die Decke aus weißem Kaschmir aus, legte sie sauber gefaltet ans Fußende und sagte: «Maximilian wartet unten auf dich.»
Dann setzte sie sich aufs Bett, seufzte einmal tief und strich Marie eine ihrer dunkelblonden Strähnen aus dem Gesicht. Irritiert blickte sie auf. Es war ungewohnt, ihrer Schwiegermutter, oder genauer gesagt, ihrer zukünftigen Schwiegermutter, so nahe zu sein. Zwar begrüßten sie sich stets mit einer kleinen Umarmung und zwei angedeuteten Küssen auf die rechte und linke Wange. Doch diese Geste fühlte sich anders an. Vertrauter, als es ihrem Verhältnis entsprach.
Es war wohl Constanzes Art, ihr Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen, dachte Marie. Sie ärgerte sich insgeheim, dass sie sich gegenüber Max nicht hatte durchsetzen können, nachdem Dr. Martin, ein befreundeter Arzt aus der Nachbarschaft, den Tod Annelieses bestätigt hatte. Eigentlich wollte Marie auf der Stelle nach Hause, in ihre gemeinsame Wohnung in der Hamburger Innenstadt, fahren. Doch Max hatte gemeint, sie solle sich erst mal nach oben zurückziehen und sich ausruhen.
Und nun musste Marie sich mit ihm und seinen Eltern an den Tisch setzen, obwohl ihr weder nach Essen noch nach Reden zumute war.
«Ich komme in zwei Minuten nach», versprach sie leise.
Constanze nickte zufrieden und verließ das Zimmer.
Marie atmete tief ein und hielt die Luft an. Constanzes schweres Parfüm hing im Raum. Ein Duft, der den Druck in ihrem Kopf noch verstärkte. Marie schloss ihre verquollenen, grünblauen Augen, weil sich ihr unendlich viele Fragen aufdrängten, auf die sie keine befriedigende Antwort fand.
Wie konnte das sein? Wie konnte ihre Oma einfach so gehen, ganz plötzlich, an diesem so besonderen Tag? Sie war das einzige Mitglied ihrer weit verstreuten Familie gewesen, das an der Verlobungsfeier hatte teilnehmen sollen. Ihr Vater war wie so oft im Ausland auf Geschäftsreise unterwegs und ihren Tanten, Onkeln und Cousinen hatte sie nicht zumuten wollen, gleich zwei Mal, zur Verlobungsfeier und zur Hochzeit, aus dem ganzen Land anreisen zu müssen. Schließlich sollte der große Tag schon Ende Juni, in zwölf Wochen, stattfinden. Dabei hatte Marie eigentlich keinen großen Wert auf eine Verlobungsfeier gelegt. Und auch Max war anfangs nicht begeistert gewesen, als seine Eltern anboten, eine solche ausrichten zu wollen. Marie hatte den Verdacht, Constanze und Konrad Bergmann ging es bloß darum, ihrem Ruf alle Ehre zu machen und den Erwartungen ihres Umfeldes Genüge zu tun, eine standesgemäße Feier auszurichten, wie es sich für eine Juristenfamilie gehörte, die schon in dritter Generation eine stadtbekannte Kanzlei betrieb.
Umso wichtiger war Marie die Anwesenheit ihrer Oma gewesen, als emotionale Unterstützung. Doch dann war alles anders gekommen. Maries Augen füllten sich erneut mit Tränen.
Sie hatte sich schon immer bestens mit Anneliese verstanden. Das bedeutete nicht, dass sie nicht auch gestritten hatten. Im Gegenteil. Ihre Oma war eine sehr geradlinige und ehrliche Frau gewesen, die nur schwer mit ihrer Meinung hinterm Berg halten konnte. Selten war sie einverstanden mit der Auswahl ihrer Freunde. Und auch als Marie Anneliese und Max miteinander bekannt gemacht hatte, war ihr sofort klar gewesen, dass ihre Oma kaum ein gutes Haar an ihm lassen würde.
Plötzlich musste Marie schmunzeln. Anneliese war zwar keine Zynikerin gewesen, hatte aber stets einen Sinn für subtilen Humor gehabt. Im Grunde genommen passte ein solcher Abgang zu ihr. Vielleicht wollte sie ein Zeichen setzen, dachte Marie und schüttelte den Kopf über diesen absurden Gedanken. Doch die heutigen Ereignisse waren tatsächlich nach dem perfekten Timing eines Drehbuchs abgelaufen. Max’ Vater hatte sich bereits erhoben, um die Gäste an der langen Tafel – seine große Familie und eben jene wichtigen Kollegen und Freunde aus dem Lionsclub – zu begrüßen. Nur der Platz der Großmutter der Braut war leer geblieben. Konrad hatte seine Ungeduld nicht verbergen können. Er bat Max, nach Anneliese zu suchen. Beim Empfang in der großen Eingangshalle der Villa war sie noch sehr präsent gewesen und hatte jeden Gast mit kräftigem Händedruck und leichtem Argwohn begrüßt. Danach aber war sie plötzlich unauffindbar gewesen.
Also gab Constanze ihrem Mann mit einem Blick zu verstehen, dass sie nicht länger warten sollten. Das hatte Marie genauestens beobachtet und war augenblicklich aufgesprungen, um selbst nach ihrer Oma zu sehen. Marie nahm an, dass sie auf die Toilette gegangen war, um vor dem Essen noch einmal den Lippenstift neu aufzutragen, der so wundervoll zu dem eleganten, bordeauxfarbenen Kostüm passte, das sie eigens zusammen für diesen Tag ausgesucht hatten. Doch wie sich herausstellte, war Anneliese gar nicht so weit gekommen. Marie fand sie im Kaminzimmer, in sich zusammengesunken auf einem der großen, schwarzen Ledersessel.
Dann war alles ganz schnell gegangen. Marie hatte um Hilfe gerufen, in Panik, weil sie kein Lebenszeichen hatte feststellen können. Obwohl Annelieses Gesicht ganz warm gewesen war und weich, wie immer, hatte Dr. Martin kurz darauf bestätigt, was alle längst befürchtet hatten. Anneliese war tot, vermutlich einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall erlegen.
Marie seufzte tief und blickte sich noch einmal um, ehe sie aus dem Bett stieg. Sie mochte diesen leblosen Raum mit seiner lindgrünen Tapete nicht. Überhaupt war die Atmosphäre hier im Haus meist unterkühlt. Ob es an der endlosen Anzahl an Räumen lag oder an der Einrichtung mit all den antiken Möbeln und den schweren Teppichen, konnte sie nicht sagen. Sie wusste nur, dass sie sich hier nie richtig wohlgefühlt hatte.
Marie schaute nun an sich hinunter, strich ihre dunkelblaue Seidenbluse glatt und fuhr sich durchs halblange Haar, um es wenigstens notdürftig zu richten. Da sie das Zimmer so ordentlich wie möglich hinterlassen wollte, schüttelte sie die Bettdecke auf, zog die Tagesdecke sorgfältig wieder darüber und strich sie glatt. Dann raffte sie eilig sämtliche benutzte Taschentücher zusammen, die glücklicherweise auf der Seite des Bodens lagen, die Constanze nicht hatte sehen können. Sie atmete noch einmal tief durch und ging schließlich auf wackeligen Beinen nach unten.
Paul
Als Paul auf den Tante-Emma-Laden am Ortsausgang von Norddorf zuging, der eigentlich «Tante-Hilda-Laden» hätte heißen müssen, weil Hilda Lindholm dort seit Jahrzehnten Lebensmittel und Souvenirs verkaufte, traf er auf eine große Gruppe älterer Herrschaften. Dass es sich um Touristen handeln musste, war nicht schwer zu erkennen: Sie stellten allesamt ihre Leihfahrräder vor dem Eingang ab, und einige von ihnen waren mit Rucksäcken und Kameras ausgestattet. Paul war erleichtert. Vermutlich hatte Hilda mit dem Andrang alle Hände voll zu tun und somit keine Chance, ihn in eines dieser Gespräche zu verwickeln, die er so unerträglich fand. Wie eine Spinne lauerte Hilda ihren Kunden auf, wobei ihr Einheimische natürlich die willkommeneren Opfer waren, wussten sie doch oft Neuigkeiten oder Inseltratsch zu berichten, den sie nur allzu gerne weitertrug.
Eigentlich wäre Paul lieber in seinen alten Volvo gestiegen, um im Nachbarort einen Großeinkauf zu machen. Doch dann hätte er noch mehr Zeit vertrödelt. Als selbständiger Bau-Ingenieur arbeitete er zurzeit für einen landwirtschaftlichen Betrieb auf dem Festland, und ihm brannte ein Entwurf unter den Nägeln, den er schon vor einer Woche hätte fertig stellen müssen.
Also musste er in den sauren Apfel beißen und bei Hilda das Nötigste besorgen. Nicht nur die Milch war ausgegangen, auch der Mirácoli-Vorrat war bedenklich geschrumpft. Und natürlich konnte es nicht schaden, wenn Leonie auch mal wieder frisches Obst mit zur Schule nahm.
Als Paul den Laden betrat, war Hilda tatsächlich mit der langen Schlange an der Kasse beschäftigt, sodass sie zunächst nicht auf ihn aufmerksam wurde. Nach kurzem Überlegen deponierte Paul ein paar Konserven, die obligatorischen Nudeln und ein bisschen Grünzeug im Einkaufskorb. Doch als er die Kasse erreichte, musste er feststellen, dass der Rentnertrupp genauso schnell wieder verschwunden war, wie er gekommen war.
Außer ihm selbst war nur noch ein älteres Paar im Laden, das vor der Frischetheke miteinander tuschelte.
«Dich habe ich ja eine Ewigkeit nicht gesehen!», rief Hilda hocherfreut durch den ganzen Laden, und das, obwohl Paul direkt vor ihr stand. Sie musterte ihn über den Rand ihrer altmodischen Brille, deren neongelbe Kette so gar nicht mit ihrer dunkelrot gemusterten Bluse harmonierte.
«Hallo, Hilda!», grüßte er knapp und warf einen flüchtigen Blick auf seine Uhr, in der Hoffnung, sie würde diese Geste richtig zu deuten wissen.
«Jetzt ist es schon ein Jahr her, was?», sagte Hilda mit einem unüberhörbaren Seufzer.
Wie er das hasste!
Ja, seine Frau Inken war gestorben, und das viel zu früh. Doch es war ihm ganz und gar nicht recht, dass er seitdem als größter emotionaler Pflegefall der Insel galt und die Leute offenbar sehr genau beobachteten, wie er sich als alleinerziehender Vater schlug.
«Wie geht es Leonie?», fragte Hilda auch sogleich und tippte die Preise in ihre antiquierte Ladenkasse.
Paul seufzte. Für einen kurzen Moment überkam ihn die Versuchung, einfach mal die Klappe zu halten. Einfach nichts zu sagen. So tun, als wäre seine Stimme weg oder als sei er über Nacht taub, stumm oder unsichtbar geworden. Eilig stopfte er seine Einkäufe in einen alten, an den Henkeln zerschlissenen Stoffbeutel. Doch Hilda ließ nicht locker.
«Ich habe sie gestern mit dem Lütten von Monika gesehen. Süß, wie die beiden zusammen spielen», plauderte sie weiter drauflos.
Nun hielt Paul die Luft an und presste seine Lippen zusammen. Wieder einmal unternahm die Alte einen derart plumpen Versuch, ihn mit ihrer Nichte zu verkuppeln. Monika und ihr nervtötender Sohn Robin, der seine schrille Stimme von seiner Großtante geerbt hatte, wohnten in derselben Straße wie Leonie und er. Robins Vater hatte die Familie vor ein paar Jahren verlassen und war eines Tages einfach von der Insel verschwunden.
Eine durchaus verlockende Vorstellung, wie Paul fand, als er nun in Hildas neugieriges Gesicht blickte und am liebsten ebenfalls davongelaufen wäre.
«Was macht das?», fragte Paul, um die Sache etwas zu beschleunigen.
Doch Hilda stieß nur die Hände in ihre ausladenden Hüften.
«Du siehst nicht besonders gut aus, mein Junge! Wann warst du denn das letzte Mal aus?»
Paul stöhnte auf.
«Glaub mir, das ist das Letzte, woran ich momentan denke! Du weißt doch, wenn man selbständig ist, hat man eigentlich nie Feierabend und kaum Freizeit», bemühte er sich um eine höfliche Antwort.
Hilda nahm die Brille von der Nase und musterte ihn eindringlich. Paul hielt ihr einen Zwanziger hin.
Hilda schüttelte stumm den Kopf und gab ein paar Münzen Wechselgeld heraus.
Aus dem Augenwinkel sah Paul, wie sich das ältere Pärchen von der Frischetheke näherte. Das war die Gelegenheit zu entkommen.
«Einen schönen Tag noch!»
«Schick Leonie vorbei! Sie darf sich was Süßes abholen», rief Hilda ihm hinterher. Paul nickte und lächelte sie durchaus dankbar an, ehe er zügig aus dem Laden verschwand.
Als er endlich ins Freie trat, richtete sich sein Blick gen Himmel, wo keine einzige Wolke zu sehen war. Seltsam, dachte er. Schon letztes Jahr war der Tag ungewöhnlich sommerlich gewesen für Anfang April. Das Wetter passte zu Inken und ihrem Gemüt. Wenigstens ein Gedanke, den er aufschreiben konnte. Sie hatte es ihm immer wieder gepredigt, auch noch, als längst klar war, dass ihr zarter Körper keine Chance gegen die Metastasen haben würde: «Du musst dir alles von der Seele schreiben!»
Inken war nie müde geworden, Paul daran zu erinnern, wie wichtig es war, seinen Schmerz zu verarbeiten.
Auch wenn er insgeheim wusste, dass sie recht gehabt hatte, war es ihm unmöglich, etwas Sinnvolles zu Papier zu bringen. Mit Zahlen und Bauzeichnungen kannte er sich aus. Aber Buchstaben und Worte waren seiner Frau vorbehalten gewesen. Als Lehrerin für Deutsch und Englisch hatte sie nicht nur Schüler zum freien Dichten ermuntert. Auch sie selbst hatte es geliebt, Gedichte zu schreiben, für die Paul sich eigentlich nie besonders interessiert hatte.
Heute bereute er, Inken nie gesagt zu haben, wie sehr er sie für ihre Gabe bewunderte. Doch fiel es ihm noch immer unendlich schwer, in der Sammlung zu blättern, die sie Leonie hinterlassen hatte.
«Vielleicht freut Leonie sich darüber. Aber gib ihr die Gedichte erst, wenn sie sie auch versteht!», hatte sie eines Tages zu ihm gesagt, mit stets bemüht heiterer Stimme. Doch Paul wusste sehr genau, dass Inken der Gedanke, ihre Tochter nicht aufwachsen sehen zu dürfen, längst das Herz gebrochen hatte.
Marie
Die Tage bis zu Annelieses Trauerfeier waren wie im Rausch vergangen. Während Marie tagsüber viel geschlafen und sich ansonsten mit Trash-TV am Nachmittag über Wasser gehalten hatte, lag sie in den quälenden Nächten stets lange wach und starrte in die Dunkelheit. Irgendwann an diesem sehr frühen Morgen der Beerdigung musste sie aber doch eingeschlafen sein. Denn Max’ Wecker hatte sie aus einem tiefen Traum gerissen.
Marie konnte sich nicht an Einzelheiten erinnern. Aber das Gefühl, mit dem sie aufgewacht war, beherrschte sie jetzt am Frühstückstisch noch immer. Es war zwar voller Traurigkeit, aber eher melancholisch als schmerzhaft. Jedenfalls nicht so schmerzhaft wie der Kummer, mit dem sie sich in den letzten Tagen aus dem Bett gequält hatte.
«Komm, Schatz, wenigstens eine Hälfte!», befahl Max und hielt ihr einen Korb mit Brötchen hin, die er nach seiner morgendlichen Joggingrunde um die Alster besorgt hatte.
Maries Magen war nur noch ein schmerzender Klumpen. Und sie konnte sich heute noch weniger vorstellen, einen Bissen zu probieren, als an den vergangenen Tagen.
Die Trauerfeier sollte am Nachmittag stattfinden, mit Beisetzung auf dem Ohlsdorfer Friedhof und anschließendem Kaffeetrinken im Café Lehmann, dem Stammlokal ihrer Oma. Sicher hatte Max recht. Sie musste etwas essen, wenn sie den Tag überstehen wollte.
Bestimmt hatte sie inzwischen ein paar Kilos verloren. Unter anderen Umständen hätte Marie sich darüber gefreut. Schließlich wollte sie in ihrem Designerbrautkleid eine gute Figur machen. Doch all das war ihr jetzt ziemlich gleichgültig. Sie umklammerte den heißen Kaffeebecher, den Max ihr reichte, fest mit beiden Händen und blickte nachdenklich aus dem Fenster. Erst als er seinen Stuhl geräuschvoll über die Marmorfliesen schob, um sich direkt vor ihr zu platzieren, sah Marie auf.
«Ich weiß, du hast sehr an ihr gehangen. Aber wenn man dich so sieht, könnte man meinen, es ist das Schlimmste, was passieren kann, dass eine 90-Jährige stirbt.»
Seine Augen funkelten wie immer gut gelaunt, als er sein markantes Kinn auf die Hände stützte und sie musterte.
«Mitte achtzig!», empörte sich Marie, winkte aber sogleich ab.
«Ich weiß ja, dass dir nicht viel an ihr lag.»
Marie bemühte sich mit einem gequälten Lächeln darum, ihre spitzen Worte etwas zu entschärfen. Es gab nämlich eigentlich gar keinen Grund, auf Max herumzuhacken. Wenn sie ihm eines nicht vorwerfen konnte, dann, dass er sich nicht gut genug um sie kümmerte. Er hatte seinen Vater gebeten, sie bis auf weiteres von ihren Aufgaben in der Kanzlei zu entbinden, und zudem alle Formalitäten rund um die Beisetzung geregelt. Dafür war Marie ihm unendlich dankbar, auch wenn sie nur stumm und staunend danebensitzen konnte, wenn Max am Telefon professionell und emotionslos über Dinge sprach, die sie selbst zutiefst erschütterten: ob es ein normales Begräbnis oder eine Urnenbeisetzung geben sollte, welche Kleidung und Schuhe Anneliese tragen, aus welchem Holz der Sarg beschaffen sein sollte, welche Gäste zur Trauerfeier eingeladen werden würden und ob es eine testamentarische Verfügung darüber gab, wie das Ganze vonstattengehen sollte.
Obwohl ihre Großmutter nie ein Problem damit gehabt hatte, über den Tod zu sprechen, hatte sie keinerlei Wünsche geäußert oder Vorkehrungen getroffen. Das Einzige, worauf Marie sich mit Gewissheit berufen konnte, war ihre Vorliebe für warmen Apfelkuchen mit einer fein-säuerlichen Apfelsorte, den sie gern mit einer Prise Zimt in der Sahne aß.
Auch wenn es Marie, im Vergleich zur Tragweite der Entscheidungen, die den Rest der Beisetzung betrafen, etwas lächerlich erschien, hatte sie darauf bestanden, wenigstens den anschließenden Empfang zu organisieren. Marie war persönlich bei Frau Lehmann, der Inhaberin des Cafés, erschienen, um ihr vom Tod der Großmutter zu berichten. Wie erwartet, war auch diese zutiefst betroffen und vergoss ein paar Tränchen, derer sie sich nicht schämte, auch nicht, als sie das Gespräch kurz unterbrechen musste, um die Bestellung neu eingetroffener Gäste entgegenzunehmen.
Jeden Sonntagnachmittag hatte sich Anneliese mit ihren beiden Freundinnen Gertrud Biermann und Lotte Schwarz in ihrem Stammcafé getroffen, und das seit über 15 Jahren. Und so war es für Frau Lehmann eine Selbstverständlichkeit, für die Trauergemeinde eine Feier auszurichten, die ihrer Oma würdig war – inklusive Kuchen mit Äpfeln aus dem Alten Land, die Anneliese für unübertrefflich gehalten hatte. Schließlich war sie dort, vor den Toren Hamburgs, aufgewachsen und bis zuletzt jedes Frühjahr mit ihren Freundinnen mit der Fähre über die Elbe zur Apfelblüte gefahren.
Das war auch der Grund, warum sie dafür plädiert hatte, dass Marie und Max ihre Hochzeit dort feiern sollten, in einem alten Landgasthof. Doch da hatte Anneliese die Rechnung ohne Constanze gemacht, die ein Sternelokal auf dem Blankeneser Süllberg für die einzig adäquate Location hielt und diese Entscheidung auch nicht zur Diskussion stellte.
Marie blickte Max traurig an. «Aber ich habe doch jetzt niemanden mehr», flüsterte sie nachdenklich und nahm einen Schluck Kaffee.
«Und was ist mit mir, dem Mann deiner Träume?!», beschwerte er sich mit gespielter Empörung. Er lächelte verschmitzt, was Marie augenblicklich erleichterte. Denn was sie gesagt hatte, war tatsächlich etwas gedankenlos gewesen. Natürlich war Max für sie da. In den vergangenen Tagen, in denen sie sich kaum verlorener hätte fühlen können, war er ihr so nah gewesen wie niemals zuvor. Und er war auch sonst immer an ihrer Seite gewesen, zum Beispiel, als sie vor lauter Prüfungsangst vor dem ersten Staatsexamen über der Kloschüssel gehangen hatte. Er war es gewesen, der mitten in der Nacht Tabletten zur Beruhigung organisiert hatte. Er war bei ihr gewesen, als ihr Mischlingshund Socke von einem Auto angefahren und wenige Stunden später eingeschläfert werden musste. Und als ihr Vater das Elternhaus verkauft hatte, ohne sie vorher darüber zu informieren.
Doch obwohl Max nun schon seit über fünf Jahren an ihrer Seite und – von mal mehr, mal weniger nervigen Macken abgesehen – tatsächlich ein Mann fürs Leben, nein, der Mann fürs Leben war, konnte er ihre Oma natürlich nicht ersetzen.
Anneliese war stets die Erste gewesen, die Marie anrief, wenn es etwas wirklich Wichtiges zu berichten gab. Etwas, das eben nur Frauen verstanden. Außerdem war ihre Oma eine gute Shoppingbegleiterin gewesen. Ihre Direktheit war zwar nicht immer ganz einfach zu ertragen gewesen, etwa wenn sie kleine Fettröllchen an Maries Taille anmahnte, die sich bei der Anprobe eines Pullis abzeichneten, weil die Angorawolle auftrug.
Marie musste schlucken. Unweigerlich musste sie wieder daran denken, dass sie eigentlich nächste Woche mit Anneliese zur Anprobe ihres Brautkleides hatte gehen wollen. Natürlich war ihre Oma auch dabei gewesen, als sie es gemeinsam mit ihrer Freundin Anika ausgesucht hatte. Die drei hatten sich die Zeit in dem einladenden Brautmodensalon mit Prosecco und Erdbeeren versüßt. Wie gut, dass die Verkäuferin sich überaus freundlich bereit erklärt hatte, ein paar Fotos von der Braut, der Braut-Oma und der Trauzeugin zu machen. Das mussten die letzten Schnappschüsse von Anneliese sein, schoss es Marie in den Sinn. Wie elektrisiert sprang sie auf und rannte in den Flur.
«Du solltest wirklich was frühstücken!», rief Max ihr hinterher.
Doch Marie ignorierte seinen Kommentar, lief ans andere Ende der großen Wohnung zum Arbeitszimmer, wo die Digitalkamera im aufgeklappten Sekretär lag. Sie schnappte sich das Gerät und eilte mit klopfendem Herzen zurück in die Küche. Dort setzte sie sich wieder an den quadratischen Glastisch und schaltete die Kamera ungeduldig ein. Sie starrte auf das Display und klickte sich aufgewühlt durch die Bilder.
Und sogleich wurde Marie warm ums Herz, als sie schließlich in die so vertrauten haselnussbraunen Augen ihrer Oma sah, die von etlichen Lachfältchen umgeben waren. Trotz ihrer fast schneeweißen Haare, die sie kurz geschnitten und stets gut frisiert trug, hatte sie immer eine tolle, fast jugendliche Ausstrahlung gehabt.
«Dein schöner Mund kann ja doch noch lächeln», sagte Max mit sanfter Stimme und rückte etwas näher an Marie heran.
«Was hast du da?», fragte er und deutete auf die Kamera.
«Das sind die letzten Bilder von ihr», antwortete Marie, ohne ihren Blick abzuwenden. Sie betrachtete einen der Schnappschüsse etwas genauer, weil Anneliese darauf sehr vergnügt aussah. Wahrscheinlich hatte sie gerade einen ihrer lockeren Sprüche losgelassen. Denn auch Anika und sie selbst lachten auf dem Bild herzhaft. Leider konnte sich Marie nicht mehr erinnern, warum. Sie wusste nur, wie beschwingt sie gewesen waren, als sie sich alle überraschend schnell auf ein Kleid geeinigt hatten. Auch die Verkäuferin, die altersmäßig etwa zwischen ihrer Oma und ihr gelegen haben dürfte, war ganz und gar hingerissen gewesen von ihrer Wahl.
«Guck mal, typisch Anneliese, was?»
Marie schob Max die Kamera rüber.
Doch der schreckte plötzlich zurück.
«Das darf ich doch gar nicht sehen!», beschwerte er sich eilig und wendete sich ab.
Marie blickte ihn verwirrt an.
«Es bringt doch Unglück, wenn der Mann das Kleid vor der Hochzeit sieht!», erklärte er, und Marie konnte nicht einschätzen, ob er es ernst meinte oder wieder einmal versuchte, mit einem Scherz eine Situation zu überspielen, die ihm unangenehm war.
Denn darin war er Weltmeister! Natürlich konnte auch er traurig sein, etwa wenn der HSV wieder einmal ein Heimspiel gegen Werder Bremen verlor. Aber bei zwischenmenschlichen Angelegenheiten konnte Max sämtliche Emotionen wie auf Knopfdruck ausschalten, was ihm in seinem Beruf als Anwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht sehr zugutekam.
«Seit wann hast du denn romantische Anwandlungen?», fragte Marie und sah Max verwundert an. Beinahe freute sie sich über seine Worte. Denn bislang war er das «Projekt Hochzeit» genauso nüchtern angegangen wie eine Verhandlung vor Gericht. Bei der Bestellung des Aufgebotes und Zusammenstellung sämtlicher Urkunden und Verträge mit Dienstleistern blühte er regelrecht auf, wohingegen er nur allzu gerne auf seine Mutter verwies, wenn Marie ihn bei der Auswahl von Einladungskarten, Blumenschmuck oder Musik um Hilfe bat.
«Ich bin total romantisch!», protestierte er nun mit einem Grinsen.
«Seit wann das denn, bitte schön?»
Marie verkreuzte ihre Arme und war gespannt auf Max’ Antwort. Wenn es einen Menschen gab, der sich schwertat mit Romantik, dann er.
«Bislang hast du es geschafft, noch jedes Happy End zu zerstören!»
«Was hat denn Romantik mit deinen Kitsch-Filmen zu tun?», konterte Max und griff nach seinem Käsebrötchen.
«Schon vergessen, was du für einen Antrag bekommen hast?», nuschelte er, nachdem er beherzt abgebissen hatte.
Der Antrag! Der war in der Tat romantisch gewesen, sah man davon ab, welche Vorgeschichte Max’ Heldentat hatte.
«Wenn dein Vater nicht gewesen wäre, würde ich immer noch darauf warten», entgegnete Marie und erhob sich, um sich Max’ Brötchen zu schnappen. Ehe er protestieren konnte, biss sie einen kleinen Happen ab.
«Das wirst du mir noch vorhalten, wenn wir alt und grau sind!», sagte Max und wandte sich wieder dem Sportteil seiner Zeitung zu. Marie wollte noch etwas einwenden. Etwa, dass sie sehr wohl einen Grund hatte, ihm Vorhaltungen wegen des Heiratsantrags zu machen. Diesen hatte er zwar durchaus stilvoll eingefädelt, während eines Essens bei ihrem Stammitaliener zwei Straßen weiter. Doch den wahren Grund für den Zeitpunkt ihrer Verlobung erfuhr Marie erst einen Tag später. Wie sich herausstellte, hatte kurz zuvor ein Vater-Sohn-Gespräch stattgefunden, in dem Konrad Bergmann seinem Sprössling in Aussicht gestellt hatte, ihm die Wirtschaftskanzlei zu überschreiben, sobald er den Grundstein für eine eigene Familie legen würde.
Zunächst hatte Marie sich wahnsinnig über die Überraschung mit Ring und Rose gefreut. Doch als sie beide Max’ Eltern tags darauf von der Neuigkeit berichteten, sprach Constanze einen vermeintlich wohlwollenden Toast aus, in dem sie die wahren Gründe für das Timing ihres Sohnes offenbarte.
Marie hätte es eigentlich wissen müssen. Schließlich hatte Max es bis dahin nicht besonders eilig gehabt mit dem Heiraten. Und wann immer Marie eine Andeutung in diese Richtung unternahm, weil sie sich sehr gewünscht hatte, noch vor ihrem 35. Geburtstag zu heiraten, hatte er sie mit einer flapsigen Bemerkung vertröstet.
Natürlich unternahm Max alles, um Marie davon zu überzeugen, dass er auch ohne das ausgelobte Geschenk seines Vaters um ihre Hand angehalten hätte. Und auch wenn Marie ihm vertraute und der Fauxpas schnell verziehen war, hinterließ er doch einen unangenehmen Beigeschmack. Der romantische Antrag hatte etwas von seinem Zauber verloren.
Doch heute, dem Tag der Beerdigung ihrer Oma, erschien ihr all das unwichtig.
Müde betrachtete sie Max’ attraktives Gesicht im Profil. Die Stoppeln auf seinem noch unrasierten Kinn waren viel dunkler als seine blonden Haare, die er in seiner Freizeit meistens unter einer Baseballkappe verbarg. Aber auch im Anzug machte er eine tolle Figur. Irgendwie empfand sie es als tröstlich, dass sie an einen Mann geraten war, der mit beiden Beinen fest auf dem Boden stand und stets auf alles eine Antwort wusste.
Marie stellte ihren Kaffee ab und beschloss, duschen zu gehen. Das war längst überfällig und würde ihr sicher guttun.
Paul
Das sind die Falschen!», schimpfte Leonie und schaute ihren Vater vorwurfsvoll aus ihren großen blauen Augen an.
«Wieso? Das ist Mirácoli!»
Paul schüttelte seufzend den Kopf und ließ die dampfenden Nudeln in einem Sieb abtropfen, ehe er sie auf zwei Suppenteller verteilte.
Leonie setzte sich an ihren Platz auf der Eckbank am Küchentisch und stützte enttäuscht ihr Kinn in die Hand.
«Das sind aber keine Spaghetti!»
«Nimm die Ellenbogen vom Tisch!», ermahnte Paul seine Tochter. Jetzt dämmerte ihm, wo das Problem lag.
«Du magst keine Makkaroni?»
Mit Bedauern blickte er auf die Nudeln vor Leonies Nase.
«Schmecken Nudeln denn nicht alle gleich?», fragte er schließlich zerknirscht.
Leonies enttäuschter Blick traf ihn mitten ins Herz.
«Spaghetti bringen viel mehr Spaß!», antwortete Leonie mit einer Ernsthaftigkeit, der Paul nichts entgegensetzen konnte.
Er nahm den Topf mit der Tomatensoße vom Herd, ließ sich auf seinen Stuhl gegenüber von Leonie fallen und hielt inne.
Nach kurzem Überlegen sprang er auf und sagte: «Komm, du kleiner, schimpfender Rohrspatz! Wie gehen aus. Heute darfst du alles essen, was du willst!»
Als Paul sich spät am Abend auf seiner Seite des Bettes ausstreckte, seufzte er tief. Er hatte diese lang gefürchtete Woche um Inkens Todestag mehr oder weniger erfolgreich hinter sich gebracht. Lediglich als Leonie und er am Grab standen, hatten ihm die Worte gefehlt. Es gab einfach nichts Tröstliches zu sagen, was nicht banal geklungen oder alles nur noch schlimmer gemacht hätte.
Und so hatte seine Tochter bitterliche Tränen in die Taschentücher geweint, die Paul in einem lichten Moment als nur sehr selten vorausschauender Vater in seiner Hosentasche mit auf die Radtour genommen hatte. Erst als sie in dem touristischen Örtchen Nebel im Inselcafé eine riesige Portion Spaghetti-Eis bestellt hatten, hellte sich Leonies Miene für einen Moment auf. Und als die Inhaberin Frau Petersen ihr dazu eine heiße Tasse Schokolade spendierte, konnte Leonie schon wieder das niedliche Lächeln hervorzaubern, das Paul jedes Mal bis ins Mark traf, weil sie ihrer Mutter dann so unfassbar ähnlich sah.
Alles in allem konnte Paul zufrieden mit sich sein. Zwar hatte er seine Schwiegermutter nicht zurückgerufen. Und das, obwohl sie schon zwei Mal auf den Anrufbeantworter gesprochen hatte, um sich zu beschweren, dass sie nicht alle drei gemeinsam auf den Friedhof gegangen waren. Doch jetzt war er müde und schüttelte jeden beißenden Gedanken an Christa beiseite. Er konnte es ihr sowieso nicht recht machen. Zumindest gab sie ihm immer das Gefühl, dass er alles falsch machte, als Vater und früher auch als Ehemann. Dabei war er es gewesen, der es geschafft hatte, Inken auf der Insel zu halten. Und das war durchaus eine Herausforderung gewesen.
Ihr cholerischer Vater und ihre dominante Mutter hatten sie schon zu Teenagerzeiten aus dem Haus getrieben, bis sie eines Tages auf der Hochzeit gemeinsamer Schulfreunde Paul traf und nur eineinhalb Jahre später von Kiel nach Amrum zurückkehrte. Alles hatte sich gefügt, nachdem sie eine Anstellung als Lehrerin gefunden hatte und zu Paul, in sein Elternhaus, gezogen war. Und doch hatte Inken immer Fernweh gehabt. Regelmäßig musste sie sich etwas Abstand vom Inselleben gönnen – etwa mit einer Shoppingtour in Hamburg oder Besuchen bei Freundinnen, die es unvorstellbar fanden, so abgeschieden vom Rest der Welt zu versauern.
Obwohl Paul diese Sehnsucht auszubrechen genauso gut kannte, hatte es immer wieder Streit deswegen gegeben. Während die Rastlosigkeit, die Inken umtrieb, in ihr den Wunsch verstärkte, sich auf dem Festland ein neues Leben aufzubauen, lastete Pauls Verantwortungsgefühl für seinen Vater immer schwerer auf seinen Schultern. Der war inzwischen an Demenz erkrankt und in ein Pflegeheim in Wittdün gezogen. Er hatte die Insel nie verlassen wollen, und er wollte auch seine letzte Ruhe dort finden. Paul konnte es nicht übers Herz bringen, ihm den Rücken zu kehren, so wie es seine Mutter vor vielen Jahren getan hatte.
Morgen Vormittag stand der obligatorische Wochenendbesuch bei seinem Vater an. Vorher würde er Christa zurückrufen, vielleicht konnte sie sich währenddessen um Leonie kümmern.
Paul rieb sich die brennenden Augen und atmete schwer durch. Wie viele Jahre würde ihn das Datum des Todestages und der Beerdigung wohl verfolgen? Wie lange würde es dauern, bis er nicht mehr zurückblicken und ständig in Gedanken zurückverfolgen würde, was genau sich zur Stunde ereignet hatte an jenem Frühlingstag, als Inken frühmorgens in seinen Armen eingeschlafen war? Oder wie sich diese lähmenden Tage danach angefühlt hatten und erst recht die Nächte in den Wochen nach der Beisetzung, als für alle anderen der Alltag zurückgekehrt war, nur für ihn nicht?
Reglos blickte Paul zur anderen Seite des Metallbettes, die mit einer ganzen Schar Teddys und Puppen übersät war, weil Leonie jedes Mal einen neuen Mitbewohner anschleppte, wann immer sie zu ihm unter die Decke kroch. Am liebsten hätte er das breite Ehebett gegen ein kleineres ausgetauscht, um sich nicht so verloren vorzukommen. Doch dann wären die Kuscheleinheiten mit seiner Tochter samstag- und sonntagmorgens womöglich ausgefallen. Leonie war mit ihren sieben Jahren längst kein Fliegengewicht mehr, das genügend Platz auf Papas Bauch fand und ruhig vor sich hin schlummerte wie in ihren ersten Lebensmonaten. Wenn Leonie bei Paul im Bett schlief, wühlte sie sich meist von einem Ende zum anderen und wachte mit weit von sich gestreckten Armen und Beinen und ohne Decke auf.
Paul richtete sich auf und sah sich im Schlafzimmer um. Es war seltsam. Denn obwohl dies der Raum war, an dem er die größte Nähe zu seiner Frau fühlte, konnte er es hier am besten aushalten. Alle anderen Zimmer, die Küche, das Bad, das Wohnzimmer mit dem Kachelofen, die Terrasse und vor allem Leonies Zimmer beherbergten Erinnerungen, die Paul immer wieder vollkommen aus der Fassung brachten. Etwa, wenn er Inkens Lieblingsbecher im Schrank entdeckte, aus weißer Emaille, der mit seinen hellgrünen Punkten die unbeschwerte Lebensfreude versprühte, die Paul längst verloren hatte. Oder aber, wenn er Inkens flauschigen Bademantel im Bad hängen sah. Dann hatte er automatisch die Momente vor Augen, in denen sie sich frisch geduscht an ihn kuschelte, um ihn vom Schreibtisch wegzulocken. Auch die blau-weiß gestreifte Schürze, die hinter der Küchentür hing, löste in Paul einen geradezu unerträglichen Schmerz aus, weil sie ihm vor Augen führte, wie sehr er die Zeit des Tages vermisste, in der Inken das Essen für die Familie zubereitete, was ihm stets das Gefühl gegeben hatte, umsorgt und geliebt zu werden. Ein Gefühl, das durch nichts zu ersetzen war.
Hier im Schlafzimmer war Inken auf ganz andere Art und Weise präsent. Trotz einiger Souvenirs aus der Vergangenheit, wie etwa dem Familienfoto auf seinem Nachttisch, fühlte er hier eine Nähe, die ihm guttat. Womöglich war das die Atmosphäre des Raumes, dachte Paul. Es war die gleiche wie in Inkens Arbeitszimmer im ersten Stock des geräumigen Friesenhauses. Doch lauerten dort so viele Erinnerungsstücke, die es ihm wiederum sehr schwer machten, öfter mal hineinzugehen. Vielleicht würde er es eines Tages übers Herz bringen, sich von allem Ballast zu trennen.
Paul griff nach seinem Kissen, schüttelte es auf und vergrub seinen schweren Kopf darin. Er würde auch in dieser Nacht nicht leicht in den Schlaf finden. Besonders in dieser Nacht nicht. Stattdessen starrte er an die weiße Holzdecke und ertappte sich bei dem Gedanken daran, dass vieles in seinem Leben einfacher wäre, hätten Inken und er kein Kind bekommen. Vielleicht hätte er dann den Mut gehabt, seinen Vater im Stich zu lassen, um irgendwo neu anzufangen. In Norwegen wurde ja immer qualifiziertes Fachpersonal gesucht. Dort wäre es sicher einfacher, nach vorne zu schauen, dachte er. Schließlich wurde er hier tagtäglich mit quälenden Erinnerungen konfrontiert, nicht nur im Haus, sondern auch im Ort und überhaupt auf der ganzen Insel. Erst recht beim Anblick seiner Tochter, die ihrer Mutter immer ähnlicher wurde.
Aber Amrum war nicht nur seine, sondern auch Leonies Heimat. Und auch wenn es Paul innerlich zu zerreißen drohte, wann immer er seine Tochter beobachtete, wie sie leise mit ihrer Mami sprach und sie anflehte, doch zurückzukommen und sie nie wieder allein zu lassen, war ihm andererseits bewusst, dass Leonie der einzige Grund war, warum er überhaupt noch aufstand an jedem neuen Morgen.
Sie war alles, was er noch hatte.
Marie
Na, endlich!», zischte Marie, als das Taxi mit ihrem Vater vor der kleinen Kapelle hielt, in der die Beerdigung stattfinden sollte. Als Rainer Wiedmann seine Tochter entdeckte, breitete sich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus. Marie ging ihm schnellen Schrittes entgegen und freute sich, dass er sie zur Begrüßung inniger umarmte als sonst.
«Ich hatte schon Angst, du schaffst es nicht rechtzeitig», nuschelte Marie in seine Schulter. Sie bemerkte sein neues, herberes Aftershave und wunderte sich im selben Moment darüber, dass ihr etwas so Banales auffiel. Wahrscheinlich hätte Rainer für diesen aufdringlichen Duft von Anneliese direkt eine Rüge bekommen. Sein dunkler Anzug dagegen saß wie immer tadellos. Als Geschäftsführer einer international aufgestellten Großreederei gehörten Schlips und Kragen für ihn zum Alltag. Marie konnte sich gar nicht erinnern, wann sie ihren Vater zuletzt in Freizeitkleidung gesehen hatte. Vielleicht war es am Weihnachtsmorgen gewesen, als sie Rainer in seinem Apartment in der Hafencity zum Gänseessen bei Anneliese abgeholt hatte.
Er und seine Schwiegermutter waren sich nie grün gewesen und hatten bei vielen Begegnungen ihre Meinungsverschiedenheiten ausgefochten. Vor gar nicht allzu langer Zeit, nach einem üppigen Grünkohlessen bei ihrer Oma und ein paar Gläschen von Annelieses Lieblingsobstler, hatte Marie ihr entlockt, dass sie damals ganz und gar nicht mit der Partnerwahl ihrer Tochter einverstanden gewesen war. Doch bevor Marie die Gründe für Annelieses Vorbehalte hatte erfahren können, hatte diese abgewinkt und Maries Fragen im Keim erstickt.
«Wie geht es dir?», fragte Rainer und blickte seine Tochter warmherzig an.
Marie zuckte mit den Schultern und versuchte ein Lächeln. Eigentlich brauchte sie gar nicht zu antworten. Ihr Vater wusste auch ohne große Worte, wie es in ihr aussah. Obwohl sie nie wirklich darüber gesprochen hatten, war auch Rainer bewusst, wie viel Anneliese Marie bedeutet hatte, vor allem seit Veras Tod. Natürlich konnte eine Oma keine Mutter ersetzen. Aber als alleinerziehender Vater hatte Rainer immer auf Annelieses Unterstützung zählen können und war ihr trotz aller Animositäten sehr dankbar dafür.
Während sie gemeinsam auf die Kapelle zugingen, dachte Marie daran, was für ein aufopferungsvoller Mensch Anneliese gewesen war.
Bereits wenige Tage nach Veras tödlichem Unfall, bei dem ein LKW-Fahrer sie übersehen und ihren Wagen von der Straße abgedrängt hatte, hatte Anneliese ihren Mann Heinrich dazu überredet, das Haus im Alten Land zu verkaufen und in die Stadt zu ziehen, um immer in der Nähe ihrer Enkelin sein zu können.
Erst Jahre später, als Heinrich längst altersschwach geworden war, erwähnte Anneliese Marie gegenüber, was sie wegen des Umzugs ins nördliche Hamburg auszustehen hatte. Nicht etwa, weil sie das beschauliche Landleben vermisste – für Marie hatte sie das alte, reetgedeckte Bauernhaus mit Obstgarten gerne aufgegeben –, sondern weil Heinrich ihr wegen dieses Schritts regelmäßig Vorhaltungen machte. Er konnte sich nur schwer umstellen. Alle wussten, dass er ein vergrämter Stinkstiefel war, auch wenn es nie jemand laut ausgesprochen hatte. Nichts konnte man ihm recht machen. Und als er vor gut zehn Jahren nach einer Magenoperation nicht mehr aus der Narkose aufgewacht war, war Marie nicht einmal besonders betroffen gewesen.
Anneliese war nie müde geworden zu betonen, dass ihr Mann kein leichtes Schicksal gehabt hatte. Im Krieg war er an der Ostfront schwer verwundet worden und erst im Herbst 1946 aus der Gefangenschaft nach Hamburg zurückgekehrt.
Dennoch war es für Marie ein tröstlicher Gedanke, dass ihre Oma, die sich stets für ihre Lieben aufgeopfert hatte, die letzten Jahre als Witwe so gut es ging genossen hatte. Sie hatte sich einen schönen Lebensabend so sehr verdient, nachdem sie ihre Tochter verloren, Marie mit großgezogen und jahrelang die Nörgeleien ihres Mannes ertragen hatte. Und all das, ohne sich jemals darüber zu beklagen. Dafür war sie viel zu stolz gewesen. Und viel stärker, als es ihre zierliche Figur vermuten ließ. Sie war wirklich stets erhobenen Hauptes durchs Leben gegangen.
Wenige Augenblicke später saß Marie in der ersten Reihe der kleinen Kapelle und sah mit von Tränen verschleiertem Blick auf die vielen wunderschönen Blumengebinde. Sie war zwar unendlich traurig, aber auch stolz und dankbar, als Pastor Melchert in seiner Rede für Anneliese so persönliche Worte fand.
Marie musterte den dunklen Sarg, der mit weißen Lilien geschmückt war, die Anneliese ebenso wie Mohnblumen und apricotfarbene Rosen sehr gemocht hatte. Diese hatte Marie auch für den Kranz ausgewählt, den eine große weiße Schleife zierte. Auf der linken Seite stand In Liebe und Dankbarkeit und auf dem rechten Band Deine Marie geschrieben. Diese Geste war ihr so wichtig gewesen, dass sie nicht zugelassen hatte, sich auch sie von Constanze aus der Hand nehmen zu lassen. Zwar hatte Marie nur mit halbem Ohr mitbekommen, wie Max am Telefon darüber mit seiner Mutter gesprochen hatte. Doch hatte sie schnell begriffen, dass ihre Schwiegermutter es lieber gesehen hätte, wenn Max und Marie wie in der Zeitungsanzeige gemeinsam ihre Trauer bekundet hätten. Während Max diese Sache gänzlich egal war, bestand Constanze darauf, im Gegenzug wenigstens einen eigenen Kranz beizusteuern, der mit Familie Bergmann beschriftet und fast doppelt so groß war wie der von Marie.
Dabei hatte es Max’ Vater nicht einmal geschafft, seine Frau zur Trauerfeier zu begleiten. Seine Termine waren angeblich unaufschiebbar und das, obwohl Rainer bei dieser traurigen Gelegenheit eigentlich die zukünftigen Schwiegereltern seiner Tochter hätte kennenlernen sollen.
Umso aufgesetzter erschien Marie Constanzes Begrüßung, als sie direkt nach der Beisetzung auf ihren Vater zutänzelte.
«Sie müssen Herr Wiedmann sein. Die Ähnlichkeit zu Ihrer hübschen Tochter ist frappierend!», flötete sie ihn an.
«Freut mich», antwortete Rainer knapp und reichte ihr die Hand.
Wie immer gab Constanze eine überaus attraktive Erscheinung ab. Sogar in einem schlichten, schwarzen Kostüm sah sie umwerfend aus und war bis ins letzte Detail perfekt zurechtgemacht. Ihren kinnlangen, blonden Pagenkopf zierte ein kleiner, anthrazitfarbener Hut, der das vollkommene Bild abrundete.
Und dann gesellte sich auch schon Maries Onkel Johann mit seiner merkwürdigen Frau und den beiden noch seltsameren Cousinen zu ihnen, zu denen Marie nie einen rechten Draht entwickelt hatte. Aber sie war gut genug erzogen worden, ihre Familie mit Max und seiner Mutter offiziell miteinander bekannt zu machen. Marie fand es seltsam, dass ihre Cousinen nur mit ihren Handys beschäftigt waren, während ihr Onkel sich krampfhaft bemühte, ein Gespräch über das Hamburger Wetter zu beginnen. Der Nieselregen verwandelte sich allmählich in richtigen Regen. Und somit lösten sich die Grüppchen auf dem Parkplatz auch schon auf und verteilten sich auf die Autos. Etwa die Hälfte der gut fünfzig Leute, die zum Trauergottesdienst gekommen war, folgte Maries Familie in Annelieses Stammcafé.
Dort wurden sie herzlich von Frau Lehmann begrüßt. Obwohl der Gastraum mit seinen Holzverkleidungen längst in die Jahre gekommen war und eine Modernisierung vertragen konnte, war es ein Platz zum Wohlfühlen. Frau Lehmann hatte eine lange Tafel für die Gäste vorbereitet und diese liebevoll mit blassblauem Geschirr und weißen Servietten sowie kleinen Liliensträußen eingedeckt. Auch drei Platten Apfelkuchen standen bereit, was Marie einen schmerzhaften Stich versetzte und trotzdem beruhigend wirkte.
«Mein Mädchen, wir werden unsere Anneliese vermissen», hörte Marie eine leise Stimme dicht hinter sich.
Sie drehte sich um und blickte in die glasigen Augen von Frau Biermann. Mit ihren rötlich gefärbten, hochgesteckten Haaren sah sie gepflegt aus wie immer. Doch ihr schwarzes Kostüm war schon in die Jahre gekommen und etwas zu weit für ihre inzwischen sehr zarte Statur. Ohne ein weiteres Wort schloss sie Marie in ihre dünnen Arme.
Auch Frau Schwarz, die ebenfalls einen kleinen dunklen Hut trug, kam auf sie zu. Sie war etwas zurückhaltender und drückte Marie nur kurz fest am Arm. Aber ihre dunklen, von tiefen Falten umrandeten Augen blickten sie warm an, als sie tief seufzte und sagte: «Das war eine sehr schöne Ansprache von Pastor Melchert.»
Frau Biermann pflichtete ihr bei, und Marie lud sie beide ein, doch neben ihr Platz zu nehmen. Sie mochte die alten Damen sehr und hörte nur allzu gern Anekdoten über vergangene Zeiten. Doch heute konnte Marie dem Gespräch kaum folgen. Alles rauschte wie in einem Film an ihr vorbei. Ab und an sah sie zu ihrem Vater und Constanze rüber. Es machte sie etwas nervös, dass sie eine Zeitlang nur aus der Ferne beobachten konnte, wie ihre Schwiegermutter sich in Rainers Gegenwart gebärdete. Während sie und Max in eine Unterhaltung mit Annelieses Vermieterin Frau Schöneborn verwickelt waren, sah Marie aus dem Augenwinkel, dass Constanze munter auf ihren Vater einredete und dabei scheinbar vertraulich ihre Hand auf seinem Arm ablegte.
Nur mit halbem Ohr hörte Marie, dass Max und Frau Schöneborn über Annelieses Wohnung sprachen.
«Melden Sie sich jederzeit, wenn Sie einen zweiten Schlüssel brauchen», erklärte Frau Schöneborn.
«Danke, das wird nicht nötig sein! Die Kündigung lassen wir Ihnen in den nächsten Tagen zukommen», sagte Max.
An die Auflösung der Wohnung, die lange Jahre ein Ort der Geborgenheit und Zuflucht für sie gewesen war, mochte Marie noch gar nicht denken. Obwohl sie eigentlich froh darüber war, dass Max dorthin gefahren war, um Annelieses Garderobe für ihre letzte Reise zu holen, und auch darüber, dass er sich um sämtliche Formalien kümmerte, stieß es ihr im selben Moment sauer auf. Denn selbst an einem Tag wie diesem konnte er offenbar an nichts anderes denken als an Einschreiben und Kündigungsfristen.
Umso dankbarer war Marie, als Frau Schöneborns Ehemann nach etwa einer Stunde darauf drängte, die Runde am Ende der Tafel allmählich aufzulösen. Marie und Max verabschiedeten die ausnahmslos älteren Leute und gingen zum anderen Ende des Tisches, wo sich Constanze und Rainer noch immer angeregt unterhielten.
«Man könnte meinen, ihr seid alte Bekannte, so wie ihr drauflosplaudert», sagte Marie mit einem Schmunzeln, als sie an den Tisch trat. Sie konnte am Gesichtsausdruck ihres Vaters ablesen, dass er sich nicht besonders wohl fühlte. Sogleich nutzte er die Gelegenheit, um sich zu erheben und demonstrativ auf die Uhr zu sehen.
«Sag nicht, du willst schon gehen?!», entfuhr es Marie.
«Von wollen kann keine Rede sein. Aber ich muss zu einer Telefonkonferenz mit Rotterdam, die meinetwegen extra verschoben wurde», erklärte Rainer. Als er die Enttäuschung in Maries Augen sah, griff er nach ihrer Hand.
«Lass uns am Wochenende was essen gehen!», schlug er vor. Doch Marie winkte ab. Es war schon zu oft etwas dazwischengekommen, wenn sie beide verabredet gewesen waren.
«Das können wir ja spontan sehen», entgegnete sie, bemüht, nicht erneut in Tränen auszubrechen. Am liebsten hätte sie sich in die Arme ihres Vaters geworfen und nie mehr losgelassen. Warum nur kam sie sich auf einmal so klein vor?
Rainer reichte Max und Constanze zum Abschied die Hand.
«Es hat mich gefreut», sagte er mit seinem einstudierten Lächeln. Marie gab ihm mit einem verschmitzten Blick zu verstehen, dass sie ihn durchschaute. Seine Worte mochten höflich klingen, kamen aber keineswegs von Herzen.
«Wir sehen uns auf der Hochzeit», freute sich Constanze in einem Singsang, der an Maries Nerven zerrte. Sie hielt Rainers Hand fest und tätschelte sie mit ihrer anderen, als sie ergänzte: «Das wird ein wunderbarer Tag werden.»
Marie hielt für einen Moment die Luft an. Schon bald würden sie alle eine große Familie sein. Was ein Anlass zur Freude sein sollte, fühlte sich plötzlich beklemmend an. Eigentlich hatte Marie gar keinen handfesten Grund, sich über ihre Schwiegermutter zu beschweren. Trotzdem empfand sie die Begegnungen und Gespräche mit ihr meist als belastend. Und wann immer sie versuchte, mit Max darüber zu sprechen, winkte er ab und bat darum, sie sollten die Frauenthemen unter sich ausmachen. Dabei ging es gar nicht immer nur um Blumenschmuck für die Hochzeitsfeier oder die Gestaltung der Einladungskarten. Schon vor der Planung ihres großen Tages hatte Marie sich von Constanze häufig gemaßregelt oder bevormundet gefühlt. Immer hatte sie zu allem eine Meinung, die sie auch unmittelbar vorbringen musste.
Marie sah ihrem Vater so lange nach, bis er sich an der langen Tafel entlang zur Tür geschlängelt hatte und das Café verließ.
«Was haltet ihr zwei Hübschen davon, wenn ich euch jetzt zum Essen einlade?», fragte Constanze und breitete mit einer großen Geste ihre Arme aus.
Maries Blick fiel auf das unbenutzte Gedeck, das an Constanzes Platz stand. Sie hatte keinen Bissen gegessen.
«Ich sollte besser bis zum Schluss bleiben», entgegnete Marie schließlich und deutete auf die letzten Gäste. Sie bemühte sich um einen freundlichen Ton.
Constanze winkte ab.
«Meinst du nicht, die Runde löst sich gleich ohnehin auf?», fragte sie nun und griff bereits nach ihrer schwarzen Schlangenlederhandtasche.
Marie sah Max hilfesuchend an. Doch der zuckte nur ungerührt mit den Schultern und sagte: «Ich könnte einen Happen vertragen. Und du solltest auch endlich mal was Richtiges essen!»
Marie sah hinüber zu Frau Schwarz und Frau Biermann, die in eine Unterhaltung mit Frau Lehmann vertieft waren.
«Wir können auch schon vorgehen, und du kommst nach, Marie!», schlug Constanze vor, die langsam ungeduldig wurde. Marie seufzte. Wenn sie Max später darauf ansprechen würde, würde er abstreiten, dass seine Mutter sich durchgesetzt hatte, das wusste sie.
«Okay. Ihr geht zu Enrico, nehme ich an?», fragte Marie mit monotoner Stimme.