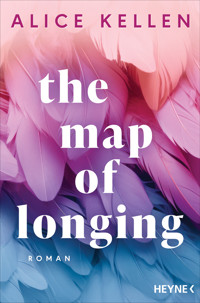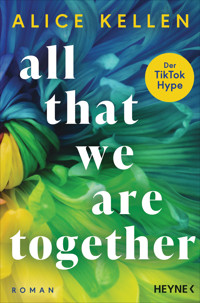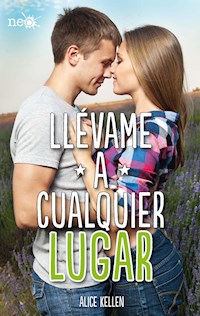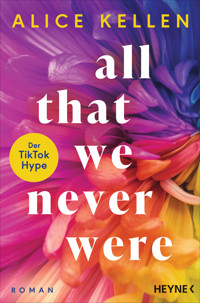
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Let-It-Be-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Eine Liebe, für die du alles riskieren musst. Eine Liebe, die für immer ist. Wenn du darum kämpfst.
Leah Jones liebte ihr Leben. Doch seit dem plötzlichen Verlust ihrer Eltern kommt sie morgens kaum aus dem Bett. Ihr Bruder ist ihr einziger Halt, bis er aus beruflichen Gründen wegzieht und Leah das Gefühl hat, vollkommen allein zu sein. Da beschließt Axel Nguyen, der beste Freund ihres Bruders, sie bei sich aufzunehmen. Er ist fest entschlossen, die Mauern einzureißen, die sie um sich herum errichtet hat. Womit er nicht rechnet, ist, dass er bald mehr als Freundschaft für Leah empfindet. Die Anziehung zwischen ihnen wird immer größer, doch um ihr ein besseres Leben zu ermöglichen, ist Axel bereit, alles zu tun. Selbst wenn es bedeutet, Leah erneut das Herz zu brechen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Ähnliche
Das Buch
Leah Jones liebte ihr Leben. Doch seit dem plötzlichen Verlust ihrer Eltern kommt sie morgens kaum aus dem Bett. Ihr Bruder ist ihr einziger Halt, bis er aus beruflichen Gründen wegzieht und Leah das Gefühl hat, vollkommen allein zu sein. Da beschließt Axel Nguyen, der beste Freund ihres Bruders, sie bei sich aufzunehmen. Er ist fest entschlossen, die Mauern einzureißen, die sie um sich herum errichtet hat. Womit er nicht rechnet, ist, dass er bald mehr als Freundschaft für Leah empfindet. Die Anziehung zwischen ihnen wird immer größer, doch um ihr ein besseres Leben zu ermöglichen, ist Axel bereit, alles zu tun. Selbst wenn es bedeutet, Leah erneut das Herz zu brechen.
Die Autorin
Alice Kellen ist eine internationale Bestsellerautorin. Sie schreibt Geschichten mit universellen, übergreifenden Themen wie Liebe, Freundschaft, Unsicherheiten, Verlust und der Sehnsucht nach einer besseren Zukunft. Sie lebt mit ihrer Familie in Valencia, Spanien.
ALICE KELLEN
all that we never were
ROMAN
Band 1 der Let-It-Be-Reihe
Aus dem Spanischen von Sybille Martin
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe TODOLOQUENUNCAFUIMOS erschien erstmals 2019 bei Editorial Planeta, Spanien.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2019 by Alice Kellen
Copyright © 2024 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Anja Rüdiger
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design nach dem Originalcoverdesign von Stephanie Gafron / Sourcebooks; Cover photo © loveischiangrai/Getty Images
Das nachfolgende Zitat stammt aus: rupi kaur: milk and honey. milch und honig. © 2017 LAGO, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH, München.
(https://www.lago-verlag.de) All rights reserved. Mit freundlicher Genehmigung des Verlages.
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-31754-6V003
www.heyne.de
Für Neïra, Abril und Saray,danke, dass ihr da seid …und für alles andere
Jede Revolution beginnt
und endet mit seinen Lippen
Rupi Kaur: milk and honey – milch und honig
Anmerkung der Autorin
In allen meinen Romanen werden die vielen Szenen, die ich zu Papier bringe, von Musik begleitet. Musik ist Inspiration. In diesem Fall ist sie jedoch noch mehr. Eine Hülle für gewisse Momente, ein Faden, der ein wenig an den Figuren zieht. Deshalb habe ich diesem Roman eine Liste der Songs beigefügt, die ich beim Schreiben gehört habe, und ich möchte euch empfehlen, beim Lesen zumindest in die wichtigsten hineinzuhören, und zwar genau in dem Moment, wenn sie in der Geschichte auftauchen. Yellow Submarine in Kapitel 24, Let It Be in Kapitel 48 und The Night We Met in Kapitel 76.
Prolog
»In einer Sekunde kann sich alles verändern.« Diesen Satz habe ich in meinem Leben oft gehört, habe ihn mir aber nie auf der Zunge zergehen lassen, um die Bedeutung dieser Worte, die du für die eigenen hältst, richtig zu schmecken. Den bitteren Beigeschmack aller »Und wenn …«-Sätze, der sich erst bemerkbar macht, wenn etwas Schlimmes passiert und du dich fragst, ob du es hättest verhindern können, denn der Schritt vom Alleshaben zum Nichtshaben dauert manchmal nur eine Sekunde. Nur eine. Wie damals, als der Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet. Oder wie jetzt, als er fand, dass es nichts gebe, wofür es sich zu kämpfen lohne, und die schwarzgrauen Linien wieder alle Farben verschlangen, die mich vor ein paar Monaten umgeben hatten.
Denn in dieser Sekunde bog er nach rechts ab.
Ich wollte ihm folgen, doch der Weg war versperrt.
Und ich begriff, dass ich nur nach links fahren konnte.
Januar (Sommer)
1 Axel
Ich lag auf dem Surfboard und ließ mich vom Meer sanft hin und her wiegen. An diesem Tag wirkte das kristallklare Wasser wie ein riesiger Swimmingpool. Es gab keine Wellen, weder Wind noch Geräusche. Ich hörte meinen ruhigen Atem und das Plätschern, wenn ich die Arme ins Wasser tauchte, bis ich nur noch still dalag, den Blick auf den Horizont gerichtet.
Ich könnte behaupten, darauf gewartet zu haben, dass das Wetter sich änderte, um eine gute Welle zu erwischen, aber ich wusste genau, dass es an diesem Tag keine geben würde. Oder dass ich mir wie so oft einfach die Zeit vertrieb. Doch ich erinnere mich genau daran, dass ich meinen Gedanken nachhing. Ja, Gedanken über mein Leben mit dem Gefühl, alle Ziele erreicht und mir jeden Wunsch erfüllt zu haben. Ich bin glücklich, sagte ich mir. Und ich glaube, es war der Tonfall, der in meinem Kopf widerhallte, die darin enthaltene leise Frage, die mich plötzlich die Stirn runzeln ließ, ohne den Blick von der gekräuselten Wasseroberfläche abzuwenden. Bin ich glücklich?, fragte ich mich. Dieser aufflackernde Zweifel in meinem Kopf, der plötzlich meine Aufmerksamkeit beanspruchte, gefiel mir überhaupt nicht.
Ich schloss die Augen und tauchte ins Meer ein.
Wenig später ging ich mit dem Board unterm Arm barfuß über den Sand und den mit Unkraut bewachsenen Weg zurück nach Hause. Ich musste die Tür kräftig aufstoßen, weil sie wegen der Feuchtigkeit klemmte, und stellte das Surfboard auf die Veranda hinterm Haus. Dann legte ich ein Handtuch auf den Stuhl und setzte mich in Badehose an den Schreibtisch, der im Wohnzimmer stand und auf dem immer Chaos herrschte. Zumindest für jeden anderen Menschen. Für mich war es die perfekte Ordnung. Zettel voller Notizen, Blätter mit aussortierten Entwürfen und andere mit sinnlosen Kritzeleien. Rechts davon lagen die Kugelschreiber, Bleistifte, Buntstifte sowie mein Kalender mit etlichen Streichungen und Abgabeterminen, und auf der anderen Seite stand mein Computer.
Ich ging die Aufträge durch und beantwortete ein paar E-Mails, um dann an meinem aktuellen Projekt weiterzuarbeiten, einem Flyer für Touristen über die Gold Coast. Es war bisher nur ein grober Entwurf, die Illustration eines Strandes mit Wellen in geschwungenen Linien, auf denen undeutlich ein paar Schatten surften. Genau die Art Auftrag, die ich am liebsten mochte: einfach, schnell gemacht und gut bezahlt. Nichts mit »Improvisiere einfach« oder »Wir werden deine Vorschläge berücksichtigen«, sondern schlicht die Vorgabe: »Zeichne einen verdammten Strand.«
Nach einer Weile machte ich mir ein Sandwich mit dem wenigen, was noch im Kühlschrank war, und schenkte mir einen zweiten Kaffee ein, schwarz und kalt. Als ich gerade einen Schluck trinken wollte, klingelte es. Ich mochte keine Überraschungsbesuche, weshalb ich die Tasse stirnrunzelnd wieder abstellte.
Hätte ich in dem Moment gewusst, was dieses Klingeln mit sich bringen würde, hätte ich die Tür nicht geöffnet. Aber machen wir uns nichts vor. Ich wäre niemals einfach so davongekommen. Es wäre trotzdem geschehen. Früher oder später. Was soll’s? Von Anfang an hatte ich das Gefühl, mit einem voll geladenen Revolver russisches Roulette zu spielen. Es war unvermeidlich, dass mich eine Kugel mitten ins Herz treffen würde.
Ich wusste sofort, dass es sich nicht um einen Höflichkeitsbesuch handelte. Also trat ich zur Seite und ließ Oliver stumm und mit ernstem Gesicht eintreten. Ich folgte ihm in die Küche und fragte, was passiert sei. Er öffnete den Schrank mit den Getränken und griff zu einer Flasche Brandy.
»Keine schlechte Wahl für einen Dienstagmorgen«, sagte ich.
»Ich habe ein beschissenes Problem.«
Ich wartete schweigend, noch immer in der Badehose vom morgendlichen Surfen. Oliver trug lange Hosen und ein weißes Hemd, was ich niemals anziehen würde, wie ich mir geschworen hatte.
»Ich weiß nicht, was ich tun soll. Die ganze Zeit denke ich darüber nach, welche Möglichkeiten mir bleiben, aber ich habe sie alle verworfen und glaube … Ich glaube, ich brauche deine Hilfe.«
Das machte mich hellhörig, vor allem, weil Oliver sonst nie um einen Gefallen bat, nicht einmal mich, seinen besten Freund, seit der Zeit, als wir noch nicht mal Fahrrad fahren konnten. Er hatte es auch im schlimmsten Moment seines Lebens nicht getan und jegliche Hilfe von mir abgelehnt, ich weiß nicht, ob aus Stolz oder weil es ihm lästig war oder weil er sich selbst beweisen wollte, dass er mit jeder Situation fertigwird, so schwer sie auch sein mochte.
Vielleicht habe ich deshalb nicht gezögert.
»Du weißt, dass ich alles für dich tun würde.«
Oliver trank seinen Brandy aus, stellte das Glas in die Spüle und stützte sich auf die Arbeitsplatte.
»Ich muss nach Sydney. Befristet.«
»Verdammte Scheiße!« Ich konnte es nicht fassen.
»Drei Wochen im Monat, ein Jahr lang. Ich soll die Eröffnung der neuen Filiale übernehmen und so lange bleiben, bis alles läuft. Ich würde dieses Angebot gern ablehnen, aber sie zahlen mir das Doppelte, Axel. Und ich brauche das Geld. Für sie. Für alles.«
Er fuhr sich nervös durchs Haar.
»Ein Jahr ist ja nicht so lang«, sagte ich.
»Ich kann sie nicht mitnehmen. Ich kann nicht.«
»Und was bedeutet das?«
Ehrlich gesagt, wusste ich ganz genau, was dieses »Ich kann sie nicht mitnehmen« bedeutete. Und ich sparte mir weitere Fragen, weil ich wusste, dass ich nicht ablehnen konnte, weil sie die beiden Menschen in meinem Leben waren, die ich am meisten liebte. Meine Familie. Nicht die biologische, damit war ich gut versorgt, sondern die Wahlverwandtschaft.
»Ich weiß, dass das, worum ich dich bitte, ein Opfer für dich sein wird.« Ja, das war es. »Aber es ist die einzige Lösung. Ich kann sie nicht mit nach Sydney nehmen, weil gerade das neue Schuljahr beginnt und sie das letzte schon verloren hat. Ich kann sie jetzt auch nicht aus ihrem vertrauten Umfeld herausreißen, ihr seid die Einzigen, die uns geblieben sind, die Veränderung wäre zu groß. Sie allein zu lassen, geht auch nicht, sie hat Angst und Albträume, es geht ihr nicht gut. Ich will, dass Leah wieder sie selbst wird, bevor sie nächstes Jahr mit dem Studium beginnt.«
Ich rieb meinen Nacken, und nun war es an mir, zur Brandyflasche zu greifen. Er brannte in der Kehle.
»Wann fliegst du?«, fragte ich.
»In zwei Wochen.«
»Verdammt, Oliver.«
2 Axel
Ich war gerade sieben Jahre alt geworden, als mein Vater seinen Job verlor und wir in die Künstlerstadt Byron Bay zogen. Bisher hatten wir in Melbourne gelebt, in der dritten Etage eines Mietshauses. Als wir in unser neues Haus einzogen, hatte ich das Gefühl, ewige Ferien zu haben. In Byron Bay sah man die Leute auf der Straße oder im Supermarkt oft barfuß laufen, alle waren entspannt, keiner war unter Zeitdruck. Ich glaube, ich habe mich in die Stadt verliebt, noch bevor ich die Autotür öffnete und sie einem finster dreinblickenden Jungen ans Bein schlug, der von nun an mein Nachbar sein sollte.
Oliver hatte zerzaustes Haar, trug lässige Klamotten und wirkte verwildert. Georgia, meine Mutter, erzählt bei Familientreffen, wenn sie ein Glas Wein zu viel getrunken hat, gern, dass sie ihn sich am liebsten sofort geschnappt und in ein Schaumbad gesetzt hätte. Sie fasste ihn gerade am Arm, als glücklicherweise die Jones aus dem Haus kamen und sie ihn sofort wieder losließ. Mr. Jones ging in seinem Kittel voller Farbkleckse lächelnd auf sie zu und streckte ihr die Hand hin. Und Mrs. Jones umarmte sie einfach zur Begrüßung, woraufhin meine Mutter zur Salzsäule erstarrte. Mein Vater, mein Bruder und ich mussten lachen angesichts der Fassungslosigkeit in ihrem Gesicht.
»Ihr seid bestimmt die neuen Nachbarn«, sagte Olivers Mutter.
»Ja, wir sind gerade eingetroffen«, erwiderte mein Vater.
Das Geplänkel zog sich noch etwas hin, aber Oliver schien nicht sonderlich an der Begrüßung interessiert zu sein, denn er holte mit gelangweiltem Gesicht eine Zwille und einen Stein aus der Hosentasche und richtete sie auf mich und meinen Bruder Justin. Er traf beim ersten Mal. Ich lächelte, weil ich wusste, dass wir uns gut verstehen würden.
3 Leah
Here Comes The Sun, Here Comes The Sun, diese Melodie ging mir in Endlosschleife durch den Kopf, dabei gab es keine Spur von der Sonne in den schwarzen Linien, die ich zu Papier brachte. Nur Dunkelheit und gerade, harte Striche. Ich spürte, wie mein Herz schneller schlug, dumpfer, unregelmäßiger. Herzrasen. Ich zerknüllte das Blatt und warf es weg, legte mich aufs Bett, drückte meine Hand auf die Brust und versuchte zu atmen … zu atmen …
4 Axel
Ich stieg aus dem Wagen und ging die Treppe zur Wohnung meiner Eltern hinauf. Pünktlichkeit war nicht mein Ding, weshalb ich jeden Sonntag als Letzter beim Familienessen eintraf. Meine Mutter strich mir zur Begrüßung das Haar glatt und fragte mich, ob dieser Leberfleck auf meiner Schulter letzte Woche auch schon da gewesen sei. Mein Vater verdrehte die Augen, als er das hörte, und umarmte mich. Im Wohnzimmer stürzten sich meine Neffen auf meine Beine, bis Justin mit Schokolade lockte.
»Bestichst du sie immer noch?«, fragte ich.
»Das ist das Einzige, was funktioniert«, erwiderte er resigniert.
Die Zwillinge kicherten, und ich musste mich zusammenreißen, um nicht mitzulachen. Sie waren kleine Teufel. Zwei reizende Teufelchen, die den lieben langen Tag riefen: »Onkel Axel, nimm mich hoch!«, »Onkel Axel, lass mich runter!«, »Onkel Axel, kaufst du mir das?«, »Onkel Axel, erschieß dich!«, solche Sachen eben. Sie waren der Grund dafür, dass mein großer Bruder langsam eine Glatze bekam (obwohl er nie zugeben würde, dass er Produkte gegen Haarausfall benutzte), und auch dafür, dass seine Frau Emily, mit der er seit der Schule zusammen war, resigniert nur noch Leggings trug und stoisch lächelte, wenn einer ihrer Sprösslinge sich auf ihr erbrach oder ihre Kleidung mit einem Filzstift versaute.
Ich begrüßte Oliver mit einem angedeuteten Kopfnicken und ging zu Leah, die am gedeckten Tisch saß und auf das Efeumuster des Geschirrs starrte. Als ich mich zu ihr setzte und sie freundlich mit dem Ellbogen anstupste, blickte sie auf. Mehr nicht. Nicht wie früher mit diesem Lächeln, das den ganzen Raum zum Leuchten brachte. Bevor ich etwas sagen konnte, kam mein Vater mit dem gefüllten Huhn und stellte es auf den Tisch. Empört schaute ich mich um, aber schon drückte mir meine Mutter eine Schüssel mit sautiertem Gemüse in die Hand. Ich lächelte sie dankbar an.
Wir aßen und plauderten über dies und das, über das Café der Familie, die Surf-Saison, die letzte ansteckende Krankheit, die meine Mutter entdeckt hatte. Das einzige Thema, das nicht zur Sprache kam, hing düster über der Tischgesellschaft, sosehr wir es auch zu ignorieren versuchten. Als wir beim Nachtisch angekommen waren, räusperte sich mein Vater lautstark, und ich wusste, dass er es leid war, so zu tun, als wäre nichts.
»Oliver, mein Junge, hast du dir das auch gut überlegt?«
Alle sahen ihn an. Alle außer seiner Schwester.
Leah starrte auf ihren Käsekuchen.
»Die Entscheidung ist gefallen. Die Zeit wird schnell vergehen.«
Meine Mutter erhob sich mit theatralischer Miene und drückte sich die Serviette auf den Mund. Es folgte ein Aufschluchzen, und sie lief in die Küche. Als mein Vater ihr folgen wollte, schüttelte ich den Kopf und ging selbst, um sie zu beruhigen. Seufzend lehnte ich mich an die Arbeitsplatte.
»Mama, tu das nicht, das können sie jetzt nicht gebrauchen.«
»Ich kann nicht anders, mein Junge. Diese Situation ist unerträglich. Was soll denn noch alles passieren? Es war ein schreckliches Jahr, ganz schrecklich.«
Ich hätte jeden Blödsinn sagen können, wie »So schlimm ist es auch wieder nicht« oder »Alles wird gut«, aber ich hatte nicht den Mut dazu, weil ich wusste, dass es nicht stimmte, dass nichts mehr wie früher sein würde. Unser Leben hatte sich verändert, seit Olivers und Leahs Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren. Es war jetzt ein anderes Leben mit zwei Abwesenden, die unweigerlich immer präsent waren wie eine eiternde Wunde, die sich nicht schließen wollte.
Seit dem Tag unseres Umzugs nach Byron Bay waren wir eine große Familie gewesen. Wir. Sie. Alle zusammen. Trotz aller Unterschiede, wie zum Beispiel, dass die Jones nur im Heute lebten und meine Mutter sich ständig Sorgen um die Zukunft machte. Oder dass die einen Künstler und gewohnt waren, in der Natur zu leben, und die anderen nur das Stadtleben von Melbourne kannten. Trotz der Jas und Neins, die immer bei ein und derselben Frage auftauchten, der konträren Meinungen und Debatten bis spät in die Nacht, wenn wir im Garten zu Abend aßen.
Wir waren unzertrennlich gewesen.
Und jetzt war alles zerstört.
Meine Mutter trocknete sich die Tränen.
»Wie kann er von dir verlangen, dich um Leah zu kümmern? Wir hätten nach anderen Lösungen suchen können, zum Beispiel, das Wohnzimmer zu streichen und in zwei Zimmer zu unterteilen oder ein Schlafsofa zu kaufen. Ich weiß, dass das nicht bequem ist und sie ihren eigenen Raum braucht, aber du kannst doch nicht mal ein Haustier versorgen, selbst wenn du es wolltest.«
Einigermaßen empört hob ich eine Augenbraue.
»Aber ich habe ein Haustier.«
Meine Mutter schaute mich überrascht an.
»Ach ja? Und wie heißt es?«
»Es hat noch keinen Namen.«
Eigentlich war es nicht »mein Haustier«, ich neige nicht dazu, Lebewesen als Besitz anzusehen, aber gelegentlich kam eine schmächtige dreifarbige Katze auf meine Veranda und verlangte Futter. Ich gab ihr meine Essensreste. Manchmal kam sie drei- oder viermal in der Woche, dann wieder tauchte sie tagelang gar nicht auf.
»Das wird ein Desaster.«
»Mama, ich bin fast dreißig, verdammt, ich kann für sie sorgen. Das ist das Vernünftigste. Ihr arbeitet den ganzen Tag im Café, und die restliche Zeit müsst ihr euch um die Zwillinge kümmern. Und sie soll nicht ein Jahr lang im Wohnzimmer schlafen.«
»Was werdet ihr essen?«, beharrte sie.
»Essen, verdammt noch mal.«
»Dieses Mundwerk, mein Junge.«
Ich verließ das Haus, nahm die zerknitterte Zigarettenschachtel aus dem Handschuhfach und ging ein paar Straßen weiter. Auf der Bordsteinkante sitzend, zündete ich mir eine Zigarette an und starrte in die Bäume, deren Äste sich im Wind wiegten. Das war nicht die Gegend, in der wir aufgewachsen waren, das Viertel, in dem unsere Familien zu einer Familie wurden. Diese Häuser waren verkauft worden, und meine Eltern waren in eine kleine Zweizimmerwohnung im Zentrum von Byron Bay gezogen, in der Nähe des Cafés, das sie vor zwanzig Jahren eröffnet hatten, als wir uns hier niederließen. Es gab keinen Grund mehr, am Stadtrand zu leben, denn Justin und ich waren ausgezogen, sie hatten ihre Nachbarn verloren, und Oliver hatte Leah zu sich in das Apartment geholt, das er nach unserer Rückkehr gemietet hatte.
»Ich dachte, du rauchst nicht mehr.«
Mit zusammengekniffenen Augen sah ich zu Oliver hoch und blies den Rauch aus, als er sich neben mich setzte.
»Tue ich auch nicht. Zwei Zigaretten am Tag ist kein Rauchen. Zumindest nicht wie bei anderen Rauchern.«
Er lächelte, nahm sich eine aus der Packung und zündete sie an.
»Ich habe dich ganz schön in die Bredouille gebracht, oder?«
Vermutlich konnte man die Tatsache, sich plötzlich um eine Neunzehnjährige kümmern zu müssen, die dem kleinen Mädchen von früher in nichts mehr ähnelte, wirklich eine Bredouille nennen. Aber dann musste ich daran denken, was Oliver alles für mich getan hatte. Er hatte mir nicht nur das Fahrradfahren beigebracht, sondern während unseres Studiums in Brisbane auch einen Nasenbeinbruch kassiert, als er meinetwegen in eine Schlägerei verwickelt wurde. Ich seufzte und drückte die Zigarette aus.
»Wir werden schon miteinander klarkommen.«
»Leah kann mit dem Fahrrad in die Schule fahren, und die restliche Zeit verbringt sie üblicherweise in ihrem Zimmer. Es ist mir nicht gelungen, sie herauszulocken, das weißt du ja. Alles wird so bleiben, wie es ist. Und es gibt ein paar Regeln, die erkläre ich dir später. Ich komme jeden Monat und …«
»Keine Sorge, das klingt nicht sehr kompliziert.«
Das war es auch nicht für mich, nicht in dem Sinne, wie es für ihn gewesen war. Ich musste mich nur daran gewöhnen, mit jemandem zusammenzuleben, was ich seit Jahren nicht mehr getan hatte, und alles unter Kontrolle behalten. Zumindest meine Routine. Der Rest würde sich schon ergeben. Nach dem Unfall hatte sich Oliver verpflichtet gefühlt, das sorglose Leben aufzugeben, das wir geführt hatten, um sich um seine Schwester zu kümmern und einen Job anzunehmen, den er nicht mochte, der aber gut bezahlt wurde und Stabilität bot.
Mein Freund holte tief Luft und sah mich an.
»Du wirst dich um sie kümmern, ja?«
»Klar doch«, versicherte ich ihm.
»Gut, denn Leah ist die Einzige, die mir geblieben ist.«
Ich nickte, und mein Blick sagte ihm, dass er ganz beruhigt sein konnte, dass ich alles tun würde, damit es Leah gut ging, und mir wurde klar, dass ich wahrscheinlich der Mensch war, dem Oliver am meisten vertraute.
5 Axel
Lächelnd hob Oliver sein Glas.
»Auf die Freundschaft!«, rief er aus.
Ich stieß mit ihm an und trank einen Schluck von dem Cocktail, der uns gerade serviert worden war. Es war der letzte Samstag vor Olivers Abreise nach Sydney, und ich hatte darauf gedrängt, noch einmal zusammen etwas trinken zu gehen. Wie üblich waren wir im Cavvanbah gelandet, einer Bar unter freiem Himmel nah am Strand. Der Name stammte von den australischen Ureinwohnern, die an diesem Ort gelebt hatten, und bedeutete Treffpunkt, was das Lebensgefühl von Byron Bay ganz gut beschrieb. Die Bar bestand nur aus einer Theke, hinter der die Getränke zubereitet wurden, und ein paar Tischen im typischen Inselblau, das ausgezeichnet zu dem Strohdach, den Palmen und den am Dach befestigten Schaukeln passte, die den Gästen am Tresen als Sitze dienten.
»Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich tatsächlich weggehe.«
Ich gab ihm einen Stoß mit dem Ellenbogen, und er lachte freudlos.
»Ist doch nur ein Jahr, und du kommst ja jeden Monat.«
»Und Leah … Verdammt, Leah!«
»Ich kümmere mich um sie«, wiederholte ich, denn diesen Satz hatte ich seit dem Tag, an dem ich zugesagt hatte, mich um sie zu kümmern, schon mehrfach gesagt. »Das haben wir doch immer so gemacht, oder nicht? Sich über Wasser halten, nicht aufgeben, darauf kommt es an.«
Er rieb sich übers Gesicht und seufzte.
»Wäre es doch nur so einfach.«
»Das hat sich nicht verändert. Hey, amüsier dich ein bisschen.« Ich leerte mein Glas und stand auf. »Ich hole uns noch zwei; noch mal das Gleiche?«
Oliver nickte, und ich grüßte auf dem Weg zur Theke ein paar Bekannte, denn in einem so kleinen Ort kennt jeder jeden, zumindest vom Sehen. Ich stützte mich auf den Tresen und grinste, worauf Madison, die den Gästen neben mir gerade ihre Drinks hinstellte, eine Grimasse zog.
»Noch einen? Willst du dich betrinken?«
»Ich weiß nicht. Kommt darauf an. Würdest du es ausnutzen?«
Madison verkniff sich ein Lächeln und mixte die Cocktails.
»Möchtest du das denn?«
»Weißt du doch, mit dir immer.«
Sie schob die Gläser über den Tresen und sah mir in die Augen.
»Sehen wir uns später, oder hast du andere Pläne?«
»Ich werde da sein, wenn du hier Schluss machst.«
Oliver und ich verbrachten den Abend mit Cocktails und Erinnerungen. Wie damals, als wir seinen Vater angerufen hatten, weil wir betrunken am Strand lagen, und er, anstatt uns einfach nach Hause zu bringen, erst mal ein Bild von uns Schnapsleichen in seinem Skizzenbuch festgehalten hatte. Anschließend hatte er die Zeichnung fotokopiert und bei uns und den Jones im Wohnzimmer aufgehängt, zur Erinnerung daran, was für Idioten wir mal waren. Douglas Jones hatte einen ganz speziellen Humor. Ein anderes Mal waren wir in Brisbane in Schwierigkeiten geraten, weil wir Gras geraucht hatten und ich kopflos und kichernd den Schlüssel des gemieteten Apartments ins Meer geworfen hatte. Oliver wollte ihn suchen und stürzte sich, bekifft wie er war, angezogen ins Wasser, während ich am Ufer stand und mich vor Lachen ausgeschüttet hatte.
Zu jener Zeit hatten wir uns gegenseitig versprochen, immer so zu leben wie in Byron Bay, wo wir aufgewachsen waren und wo alles einfach und entspannt war, eben ein Surfer- und Hippie-Paradies.
Ich sah Oliver an und verkniff mir einen Seufzer, bevor ich mein Glas leerte.
»Ich gehe jetzt, ich möchte sie nicht so lange allein lassen«, sagte er.
»Okay.« Ich musste lachen, als er beim Aufstehen schwankte, worauf er mir den Stinkefinger zeigte und ein paar Geldscheine auf den Tisch legte. »Wir reden morgen.«
»Das tun wir«, antwortete ich.
Anschließend saß ich noch ein Weilchen mit ein paar Freunden zusammen. Gavin erzählte uns von seiner neuen Freundin, einer Touristin, die zwei Monate zuvor nach Byron Bay gekommen war und jetzt auf unbestimmte Zeit bleiben wollte. Jake beschrieb uns drei- oder viermal das Design seines neuen Surfboards. Tom beschränkte sich aufs Trinken und Zuhören. Ich ließ mich ablenken, bis sich das Lokal im Morgengrauen leerte. Als der letzte Gast verschwunden war, ging ich um die Theke herum, öffnete die Hintertür und trat ein.
»Ich weiß gar nicht, warum ich so geduldig bin.«
Madison lächelte, ließ die Jalousie herunter und kam mit einem sinnlichen Lächeln auf den Lippen zu mir. Sie griff nach meinem Hosenbund und zog mich an sich, bis unsere Lippen sich berührten.
»Weil ich dich angemessen dafür entschädige«, schnurrte sie.
»Hilf mir ein bisschen auf die Sprünge.«
Ich zog ihr das Top aus. Sie trug keinen BH.
Madison rieb sich an mir, knöpfte meine Hose auf und ging langsam auf die Knie. Als mich ihr Mund aufnahm, schloss ich die Augen und stützte mich an der Wand ab. Dann vergrub ich die Finger in ihrem Haar, damit sie sich schneller bewegte. Kurz bevor ich kam, trat ich einen Schritt zurück, streifte mir ein Präservativ über und drang in sie ein. Ich stieß zu, und als sie meinen Namen stöhnte, erregte mich das noch mehr. Ich genoss diesen Moment, die Lust, den Sex, das Verlangen. Nur das. Einfach perfekt.
Februar (Sommer)
6 Leah
Ich starrte auf meine gefalteten Hände, als das Auto über den nicht asphaltierten Weg holperte und die Abendröte alles in ein orangefarbenes Licht tauchte. Ich wollte es nicht sehen, ich wollte keine Farben, nichts, was Erinnerungen und Träume wachrief, die ich hinter mir gelassen hatte.
»Mach es Axel nicht so schwer, er tut uns einen großen Gefallen, das ist dir doch klar, oder, Leah? Iss und lass es dir gut gehen, ja? Sag mir, dass du das tun wirst.«
»Ich werde es versuchen«, antwortete ich.
Er redete weiter, bis wir vor dem von Palmen und wild wuchernden Büschen umgebenen Haus anhielten. Ich war höchsten zweimal bei ihm gewesen, und alles kam mir anders vor. Ich war anders. Im letzten Jahr war er gelegentlich in unserem Apartment aufgetaucht. Ich schloss die Augen, als mir plötzlich der Gedanke durch den Kopf ging, dass ich Schmetterlinge im Bauch und einen Kloß im Hals gehabt hätte, wenn ich früher mit ihm unter einem Dach gewohnt hätte. In diesem Augenblick hingegen spürte ich gar nichts. Eine Folge des Unfalls, die Spuren, die er in mir hinterlassen hatte, eine immense, verheerende Leere, auf die ich unmöglich bauen konnte, denn sie hatte keinen Boden, auf dem das möglich gewesen wäre. Ich spürte schlicht und einfach nichts mehr. Ich wollte es auch nicht. Es war besser, in der Lethargie als im Schmerz zu leben. Manchmal gab es Regungen, ganz unverhofft, als wollte sich etwas in mir öffnen, aber ich kämpfte dagegen an und konnte es bezwingen. Es war, wie einen Pizzateig voller Löcher und Ausbuchtungen vor mir zu haben, kurz bevor ich ihn kräftig ausrollte.
»Bist du bereit?« Mein Bruder sah mich an.
»Ich denke, ja«, sagte ich achselzuckend.
7 Axel
Ich hatte das Bedürfnis, die Zeit zurückzudrehen, um meinem früheren Ich zu sagen, dass es ein Idiot war, weil es geglaubt hatte, dass »es nicht so kompliziert« sein würde. Denn es war von der ersten Minute an verdammt kompliziert, als Leah einen Fuß in mein Haus setzte und sich nur mäßig interessiert umschaute. Allerdings gab es auch nicht viel zu sehen: Die Wände waren nackt, kein Bild weit und breit, der Boden bestand aus Holz, genau wie fast alle meine Möbel in verschiedenen Farben und Stilen, die Küche war mit einem Tresen vom Wohnzimmer abgetrennt, und die gesamte Einrichtung hatte, laut meiner Mutter, den Charme einer Cocktailbar mit Inselflair.
Als Oliver in letzter Minute zum Flughafen fuhr, begann ich mich unbehaglich zu fühlen. Sie schien es nicht zu merken, denn sie folgte mir schweigend, als ich ihr das Gästezimmer zeigte.
»Das ist jetzt dein Zimmer. Du kannst es dir neu einrichten oder …« Ich verstummte und fügte dann hinzu: »Oder was auch immer Mädchen in deinem Alter tun«, weil sie nicht mehr das fröhliche Mädchen war, das zusammen mit ihren Freundinnen in Badeklamotten und dem Surfboard unterm Arm durch Byron Bay lief. Leah hatte sich von allem abgewandt, als wäre die Erinnerung daran eine ungewollte Brücke zur Vergangenheit.
»Brauchst du noch was?«
Sie sah mich mit ihren großen blauen Augen an und schüttelte den Kopf, dann legte sie ihren Koffer aufs Bett und öffnete ihn.
»Was auch immer, ich bin auf der Veranda.«
Ich ließ sie allein und atmete tief durch.
Es würde nicht einfach werden, nein. Denn in meinem Chaos hatte ich eine feste Routine. Ich stand vor dem Morgengrauen auf, trank eine Tasse Kaffee und ging surfen oder baden, wenn es keine Wellen gab, dann machte ich mir Frühstück und setzte mich an den Schreibtisch, um die anstehende Arbeit zu erledigen. Manchmal zog ich etwas vor oder auch nicht, ich arbeitete nie sehr organisiert, es sei denn, ein Abgabetermin rückte näher. Später folgte die zweite und letzte Tasse Kaffee des Tages, wobei ich normalerweise aus dem Fenster schaute. Obwohl ich ganz gut kochen konnte, tat ich es nur selten, wohl aus Faulheit. Nachmittags ging es dann ganz ähnlich weiter: arbeiten, surfen, gemütliche Stunden auf der Veranda, im Frieden mit mir. Dann folgten eine Tasse Tee, die Abendzigarette und vor dem Zubettgehen las ich ein wenig oder hörte Musik.
Am Tag von Leahs Einzug sah ich keinen Grund, meinen Tagesablauf zu ändern. Ich arbeitete den ganzen Nachmittag an einem neuen Auftrag, konzentrierte mich auf das Bild, skizzierte und korrigierte Linien und Striche, bis ich das perfekte Ergebnis erzielt hatte.
Als ich den Stift weglegte und aufstand, fiel mir auf, dass sie kein einziges Mal ihr Zimmer verlassen hatte. Die Tür war nur angelehnt. Ich klopfte und drückte sie vorsichtig auf.
Leah lag auf dem Bett, das lange blonde Haar wirr auf dem Kopfkissen verteilt, und hörte Musik. Sie wandte den Blick von der Decke ab und nahm die Kopfhörer runter, während sie sich aufrichtete.
»Entschuldige, ich habe dich nicht gehört.«
»Was hörst du denn?«
Sie schien zu zögern.
»Die Beatles.«
Es folgte ein angespanntes Schweigen.
Ich würde behaupten, dass alle Menschen, die die Jones gekannt hatten, wussten, dass die Beatles ihre Lieblingsband gewesen waren. Ich konnte mich an lange Abende in ihrem Haus erinnern, an denen wir zu ihren Songs getanzt und die Texte aus vollem Hals mitgesungen hatten. Als ich Jahre später Douglas Jones in seinem Atelier oder im Garten hinter dem Haus, während er malte, Gesellschaft geleistet hatte, hatte ich ihn mal gefragt, warum er bei der Arbeit immer Musik hörte. Darauf hatte er geantwortet, sie sei seine Inspiration, nichts komme aus einem selbst, nicht einmal die Grundidee, aber sehr wohl, was man daraus machte. Er erklärte mir, dass die Noten den Weg aufzeigten und die Stimmen ihm jeden Strich diktierten. Damals imitierte ich alles, was Douglas tat, bewunderte ihn für seine Gemälde und seine Gabe, immer zu lächeln. Deshalb beschloss ich, in seine Fußstapfen zu treten und meine eigene Inspiration zu suchen, eine, die mir unter die Haut ging, die ich aber nie fand, weshalb ich auf halbem Weg unvermittelt eine Abzweigung nahm und Illustrator wurde.
»Hast du Lust, zum Meer zu gehen?«, fragte ich sie.
»Surfen?«, fragte Leah gedehnt. »Nein.«
»Okay. Ich bin bald zurück.«
Unruhig machte ich mich auf den Weg zum Ozean, als mein Blick an dem orangefarbenen Fahrrad hängen blieb, das am Verandageländer lehnte. Oliver hatte es dort hingestellt, es war nur ein Gegenstand, aber eben einer, der mir klarmachte, dass es eine Veränderung gab, die ich noch nicht verinnerlicht hatte.
Ich wartete, wartete und wartete, bis die perfekte Welle kam. Dann beugte ich den Rücken und stieg, die Füße fest auf dem Board, an der Wellenwand auf und wieder ab, holte Schwung und machte eine Drehung, bevor die Welle brach und ich im Wasser landete.
Als ich zurückkam, war die Tür des Gästezimmers geschlossen. Ich klopfte nicht. Stattdessen duschte ich ausgiebig und machte mich in der Küche an die Vorbereitung des Abendessens. Ich hatte am Vortag eingekauft, was ich nicht oft zu tun pflegte, zumindest nicht in dem Ausmaß, aber ich wollte eine gewisse Auswahl im Kühlschrank haben, denn ich wusste nur, dass Leah Erdbeerlutscher mochte, weil sie als Kind immer einen im Mund hatte und hinterher noch ewig auf dem Plastikstiel herumkaute. Und den Käsekuchen meiner Mutter, was keine große Überraschung war, weil alle fanden, dass er der beste der Welt war.
Während ich verschiedene Gemüse in Streifen schnitt, wurde mir klar, dass ich Leah nicht so gut kannte, wie ich geglaubt hatte. Vielleicht hatte ich sie nie richtig kennengelernt. Nicht wirklich. Sie kam auf die Welt, als Oliver und ich zehn Jahre alt waren und niemand mehr mit Nachwuchs gerechnet hatte. Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als ich sie zum ersten Mal sah: Sie hatte rosige Pausbacken, ihre kleinen Finger klammerten sich an alles, was sie finden konnten, und ihr Haar war so hell, dass es aussah, als hätte sie eine Glatze. Rose hatte uns eingebläut, dass wir uns von jetzt anständig benehmen und uns um die Kleine kümmern müssten. Aber Leah weinte oder schlief den ganzen Tag, und wir verbrachten den Nachmittag lieber am Strand, gingen auf Insektenjagd oder spielten.
Als wir zum Studium nach Brisbane gingen, war Leah gerade mal acht Jahre alt. Bei unserer Rückkehr nach etlichen Praktika und befristeten Jobs war sie fast fünfzehn, und obwohl wir oft zu Besuch in Byron Bay gewesen waren, hatte ich den Eindruck, als wäre sie schlagartig gewachsen, als wäre sie abends als Mädchen ins Bett gegangen und am nächsten Morgen als Frau wieder aufgewacht. Sie war groß und schlank wie eine Ähre, fast ohne Rundungen. In meiner Abwesenheit hatte sie sich ein Beispiel an ihrem Vater genommen und zu malen begonnen. Als ich eines Tages im Garten ihre Staffelei mit einem Bild entdeckte, ließ ich die zarten Linien, die Pinselstriche in ihrer Farbenvielfalt, die regelrecht zu vibrieren schienen, auf mich wirken. Die Haare an meinen Armen richteten sich auf. Ich wusste, dieses Bild konnte nicht von Douglas stammen, denn es war irgendwie anders, irgendwie … Ich konnte es nicht erklären.
Dann stand sie in der Hintertür.
»Hast du das gemalt?« Ich zeigte auf das Bild.
»Ja.« Sie sah mich argwöhnisch an. »Es ist schlecht.«
»Es ist perfekt. Es ist … anders.«
Ich drehte den Kopf, um es aus einer anderen Perspektive zu betrachten, nahm alles in mich auf, das pulsierende Leben und das bunte Durcheinander. Sie hatte die Landschaft hinter dem Haus gemalt: die gebogenen Äste, die ovalen Blätter und die dicken Stämme, aber es war keine reale Abbildung, es war eine Überzeichnung, als hätte sie sämtliche Elemente in ihrem Kopf verquirlt und hinterher neu interpretiert.
Leah errötete und verschränkte die Arme vor der Brust, als sie vor dem Bild stehen blieb. Ihr engelsgleiches, niedliches Gesicht wirkte streng, als sie mit vorwurfsvollem Blick sagte:
»Verarschen kann ich mich selber.«
»Nein, verdammt, warum glaubst du das?«
»Weil mein Vater mich gebeten hat, die zu malen.« Sie zeigte auf die Bäume. »Aber ich habe das da gemalt, was ihnen in nichts ähnelt. Anfangs war es gut, aber dann …«
»Dann hast du deine eigene Version gemalt.«
»Findest du?«
Ich nickte und lächelte.
»Mach weiter so.«
Wenn ich in den folgenden Monaten meine Eltern oder die Jones besuchte, verbrachte ich immer ein wenig Zeit mit ihr und warf einen Blick auf ihre neuesten Arbeiten. Leah war sie selbst, es gab nichts Vergleichbares, keinerlei Einflüsse, ihre Pinselstriche zeigten ihren eigenen Stil, und ich hätte sie an jedem anderen Ort wiedererkannt. Ihre Malerei war Licht, und es gab etwas, das mich anzog, als würden ihre Bilder mich festhalten, damit ich sie immer weiter ansah, sie entdeckte.
8 Leah
Als Axel mich zum Essen rief, stand ich seufzend auf. Er hatte Gemüse-Tacos zubereitet, die dampfend auf dem Tisch vor dem Sofa standen, einem Surfboard mit vier Holzbeinen. Abgesehen von seinem Schreibtisch voller Krempel war es der einzige Tisch im Haus, daneben stand eine alte Musiktruhe mit Plattenspieler. Der ganze Raum spiegelte sein Wesen wider, mit all den Möbeln, die trotz ihres unterschiedlichen Stils zusammenpassten und eine Ordnung in der Unordnung schafften, ein Abbild von innerer Ruhe in den kleinen Dingen.
Ich beneidete ihn. Seine Art zu leben, sorglos und entspannt, den Blick immer nach vorn gerichtet, ohne innezuhalten und zurückzublicken, immer mit dem Fokus auf dem Hier und Jetzt.
Ich setzte mich aufs Sofa und aß schweigend.
»Morgen fährst du also mit dem Rad zur Schule.«
Ich nickte.
»Oder soll ich dich fahren?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Okay, wie du willst.« Axel seufzte. »Magst du einen Tee?«
Ich hob den Kopf und sah ihn an.
»Tee? Jetzt?«
»Ich trinke abends immer Tee.«
»Der enthält Teein«, sagte ich leise.
»Davon merke ich nichts.«
Axel brachte die Teller in die Küche, ich folgte ihm mit dem Blick. Sein Haar war dunkelblond wie reifer Weizen oder der Sand am Meer bei Sonnenuntergang. Irritiert wandte ich mich sofort wieder ab, verbannte alle Farben, begrub sie.
Kurz darauf rief Axel, mit einer Tasse Tee und der Zigarettenpackung in den Händen:
»Kommst du mit raus auf die Veranda?«
»Nein, ich gehe ins Bett. Gute Nacht.«
»Gute Nacht, Leah. Schlaf gut.«
Ich schlüpfte unter die Bettdecke, obwohl es nicht kalt war, und verbarg den Kopf unter dem Kissen. Dunkelheit. Nur Dunkelheit. In Axels Haus hörte man weder vorbeifahrende Autos noch Stimmen, nur Stille und meine Gedanken, die in meinem Kopf gedämpft zu schreien und zu rasen schienen. Als die Angst in mir aufstieg, die mir die Brust zuschnürte und mich kaum atmen ließ, drückte ich ganz fest die Augen zu und klammerte mich im Wunsch, alles möge verschwinden, an die Bettdecke. Alles.
Am nächsten Morgen traf ich ihn in der Küche an.
Er trug eine nasse rote Badehose und machte sich gerade einen Toast. Und er lächelte mich an. Für dieses Lächeln, mit diesem perfekten Lippenschwung und diesen leuchtenden Augen, hasste ich ihn. Ich wich seinem Blick aus und nahm die Milch aus dem Kühlschrank.
»Hast du gut geschlafen?«, fragte er.
»Ja«, log ich. Ich hatte wieder Albträume gehabt.
»Willst du wirklich nicht, dass ich dich fahre?«
»Wirklich nicht, aber danke.«
Ich wollte nur weg, weg von ihm, und fuhr ohne innezuhalten zur Schule, wo ich das Rad an das blaue Geländer anschloss. Mit gesenktem Blick betrat ich grußlos das Gebäude. Früher war das einer meiner Lieblingsmomente des Tages gewesen: vor dem Unterricht meine Freundinnen zu treffen, den letzten Klatsch auszutauschen und gemeinsam ins Klassenzimmer zu gehen. Aber das konnte ich nicht mehr. Ich hatte es versucht, mich wirklich bemüht, aber da war eine Barriere zwischen ihnen und mir, etwas, das vorher nicht da gewesen war.
Als ich mit gesenktem Kopf an Blair vorbeieilte, wünschte ich, sie würde nicht hier arbeiten. Ich glaube, ich trug das Haar absichtlich so lang, um nicht wahrgenommen zu werden, und weil ich vermeiden wollte, dass alle den Ausdruck in meinen Augen lesen konnten. Hätte ich eine Superkraft wählen können, hätte ich mich dafür entschieden, unsichtbar zu sein. Dann hätte ich den anfangs bedauernden Blicken entgehen können, und auch den späteren, die mir zu sagen schienen, dass ich komisch war, dass sie mich nicht verstanden, dass ich mich nicht genug anstrengte, um wieder an die Oberfläche zu kommen und zu atmen.
Ich saß den ganzen Vormittag auf meinem Platz und malte auf eine Ecke des Mathematikbuchs Spiralen. Ich war ausschließlich auf die geschwungenen Linien und die sanfte Bewegung des Kugelschreibers konzentriert. Als der Unterricht zu Ende war, fiel mir auf, dass ich von dem, was die Lehrerin gesagt hatte, fast nichts mitbekommen hatte. Ich steckte gerade meine Bücher in den Rucksack, als Blair unsicher auf mich zukam. Fast alle anderen waren bereits gegangen. Eingeschüchtert schaute ich sie an und wünschte, weglaufen zu können.
»Können wir kurz reden?«
»Ich … muss jetzt gehen …«
»Es dauert nicht lange.«
»Okay.«
Blair atmete tief durch.
»Ich habe erfahren, dass dein Bruder eine Zeit lang in Sydney arbeiten wird, und wollte dir sagen, dass ich immer für dich da bin, was auch immer du brauchst. Denn eigentlich war ich nie weg.«
Mein Herz klopfte schneller.
Wie sehr wünschte ich mir, dass alles wieder so sein würde wie früher, aber es ging nicht. Sobald ich die Augen schloss, sah ich, wie der Wagen sich überschlug und überschlug, die verschwommene grüne Furche, was bedeutete, dass wir von der Fahrbahn abgekommen waren, ein Lied, das jäh zu Ende war, ein eingefrorener Schrei. Und dann … dann waren sie tot. Meine Eltern. Ich konnte es nicht vergessen, die Bilder waren immer da, als wäre der Unfall gestern geschehen und nicht vor fast einem Jahr. Ich konnte nicht mit Blair durch die Straßen gehen und lächeln, wenn wir einer Gruppe Surf-Touristen begegneten, oder über Zukunftspläne reden, denn ich wollte nur … nichts tun, und das Einzige, woran ich denken konnte, war an sie, aber niemand konnte mich verstehen. Zu diesem Schluss war ich nach mehreren Sitzungen beim Psychologen gelangt, zu dem Oliver mich geschickt hatte.
»Es muss nicht wie früher sein, Leah.«
»Das geht auch nicht«, presste ich hervor.
»Aber anders, neu. Hast du das früher beim Malen nicht auch getan? Du hast dir ein reales Objekt ausgesucht und es neu interpretiert.« Sie schluckte unsicher. »Kannst du das nicht auch mit unserer Freundschaft so machen? Wir müssen auch über nichts reden, wenn du nicht willst.«
Ich nickte, bevor sie den Satz beendet hatte, womit ich mich ihr einen winzigen Spalt öffnete. Blair lächelte erleichtert, und wir verließen gemeinsam die Schule. Als ich auf mein Fahrrad stieg und in die entgegengesetzte Richtung davonfuhr, winkte sie mir nach.
9 Axel
Die Tür zu Leahs Zimmer war noch immer geschlossen.
Sie wohnte inzwischen seit drei Wochen bei mir, und wenn sie von der Schule kam, aß sie schweigend, was ich zubereitet hatte, ohne Protest oder Einwände, und zog sich anschließend in diese vier Wände zurück. Ich ging nur selten zu ihr ins Zimmer, und jedes Mal hörte sie entweder über Kopfhörer Musik oder zeichnete mit einem feinen Bleistift irgendwelche geometrischen Figuren, sinnlose Kritzeleien.
Wahrscheinlich war der längste Satz, den ich von ihr gehört hatte, der am ersten Abend, als sie darauf hingewiesen hatte, dass Tee Teein enthält. Danach nichts mehr. Gäbe es nicht eine zweite Zahnbürste in meinem Badezimmer und würde ich nicht regelmäßig einkaufen gehen, würde ich ihre Anwesenheit kaum bemerken. Leah kam nur aus ihrem Zimmer, um zu essen und zur Schule zu gehen.
Wie zu erwarten gewesen war, hatte meine Mutter schon zwei Fresspakete vorbeigebracht, obwohl ich regelmäßig im Café vorbeischaute, um meinen Eltern zu sagen, dass alles gut lief, um Kuchen zu essen und Zeit mit meinem Bruder Justin zu verbringen, der das Geschäft übernehmen sollte, wenn meine Eltern irgendwann endlich in den Ruhestand gehen sollten.
»Wie läuft’s bei euch?«, hatte er mich gefragt.
»Vermutlich gut. Oder auch nicht, was weiß ich?«
»Es ist eine schwierige Situation. Hab Geduld. Und mach keine Dummheiten.«
»Welche Dummheiten?«
»Du weißt schon, irgendeinen Blödsinn, der dir plötzlich einfällt.«
Ich lachte und trank eilig meinen Kaffee. Mein Verhältnis zu Justin war nie besonders freundschaftlich gewesen. Wir waren nicht diese Art Brüder, die zusammen abhängen und sich besaufen oder sonst wie Zeit miteinander verbringen. Wir hatten kaum etwas gemein, und ohne unsere Blutsverwandtschaft wären wir wahrscheinlich zwei Unbekannte, die nur gelegentlich ein paar Worte miteinander wechseln.
Justin war ernsthaft und ein wenig verklemmt, vernünftig und verantwortungsbewusst. Als kleiner Junge hatte ich oft den Eindruck, dass er unserem Leben in Melbourne nachtrauerte, als hätte man ihn dort herausgerissen und an eine Stelle verpflanzt, die ihm nicht behagte. Bei mir war es genau umgekehrt. Dieses Stück Küste war perfekt für mich, wie für mich geschaffen: die Freiheit, das Barfußgehen, das Surfen und das Meer, das entspannte Leben in dieser Hippie-Atmosphäre. Alles.
Nachdem ich mich von meinem Bruder verabschiedet hatte, lief ich eine Weile durch die Straßen von Byron Bay und kaufte unterwegs etwas Bio-Obst. Und ich rief Oliver an. Wir hatten zwar am Vortag schon kurz telefoniert, aber er hatte gleich wieder auflegen müssen, weil er sonst zu spät zu einem Meeting gekommen wäre.
»Wie läuft’s bei euch?«, fragte er.
»Ich habe da ein paar Fragen.«
»Ich bin ganz Ohr«, antwortete er.
»Leah verbringt den ganzen Tag in ihrem Zimmer.«
»Habe ich dir doch gesagt. Sie braucht ihren Rückzugsort.«
»Kann ich das ändern?«
Schweigen am anderen Ende.
»Wie meinst du das, Axel?«
»Hast du nie von ihr verlangt, damit aufzuhören, sich derartig einzukapseln?«
»Nein, so funktioniert das nicht, der Psychologe meinte …«
»Muss ich diese Vorgaben befolgen?«, hakte ich nach.
»Ja«, sagte er. »Es ist eine Frage der Zeit. Es ging ihr richtig schlecht.«
Ich unterdrückte den Impuls, ihm zu widersprechen, und biss mir auf die Zunge. Dann erzählte er mir von seiner Arbeit in der neuen Filiale, die er in drei Wochen auf die Beine gestellt hatte. Mit etwas Glück würde er seinen Aufenthalt in Sydney um ein paar Monate verkürzen können. Allerdings wollte ich mich nicht zu sehr auf das Gefühl der Erleichterung verlassen, das ich in diesem Moment verspürte.
Es war an einem Samstag. Leah hatte den ganzen Vormittag in ihrem Zimmer verbracht, und ich verlor allmählich die Geduld, obwohl Oliver sie am kommenden Montag abholen würde, sodass ich dann eine Woche lang wieder ein normales Leben führen konnte. Nicht dass ich Leah nicht verstanden hätte, natürlich verstand ich ihren Schmerz, aber das änderte nichts, auch nicht die Gegenwart. Der Psychologe, zu dem Oliver sie mehrmals geschleppt hatte, war der Meinung, dass sie die Trauerphasen nicht richtig durchlebte, dass sie in der ersten Phase festhing, dem Nicht-wahrhaben-Wollen. Doch ich hatte da meine Zweifel, und vielleicht war es das, was mich an ihre Tür klopfen ließ.
Leah schaute auf und nahm die Kopfhörer ab.
»Es gibt gute Wellen, hol dein Surfboard.«
Sie blinzelte irritiert. Und mir wurde klar, dass die Vorschläge, die man ihr bisher gemacht hatte, immer als Fragen formuliert gewesen waren. Vorschläge, die Leah grundsätzlich abgelehnt hatte. Bei mir hingegen handelte es sich nicht um eine Frage.
»Ich habe keine Lust, aber danke.«
»Du brauchst dich nicht zu bedanken, beweg deinen Hintern.«
Alarmiert schaute sie mich an. Ich sah, wie sich ihre Brust hektisch hob und senkte, als wäre sie nach den Tagen der Ruhe auf einen derartigen Überfall nicht gefasst gewesen. Er war auch nicht geplant, denn ich hatte meinem besten Freund versprochen, nichts dergleichen zu tun, vertraute aber mehr meinem Instinkt. Dem Impuls, sie aus diesem Zimmer zu locken, dem Drang, sie von diesem Ort wegzubringen. Angespannt setzte sich Leah auf.
»Ich möchte nicht, Axel.«
»Ich warte draußen auf dich.«
Ich legte mich in die Hängematte auf der Veranda, in der ich abends las oder mit geschlossenen Augen Musik hörte. Und wartete. Zehn Minuten. Fünfzehn. Zwanzig. Fünfundzwanzig. Nach einer halben Stunde tauchte sie auf, die Stirn missmutig gerunzelt, das Haar zum Pferdeschwanz gebunden und mit einem Gesichtsausdruck, der besagte, dass sie gar nichts verstand.
»Warum willst du, dass ich mitkomme?«
»Warum willst du hierbleiben?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete sie leise.
»Ich auch nicht. Also los.«
Stumm folgte sie mir den kurzen Weg zum Strand entlang. Der weiße Sand lag heiß in der Mittagssonne, und sie zog ihr Kleid aus, unter dem sie einen Bikini trug. Ich wusste nicht, warum, aber ich schaute abrupt weg und hielt ihr ein Board hin.
»Das ist aber kurz«, beklagte sie sich.
»Genau richtig. So ist es schön agil.«
»Aber langsamer«, erwiderte sie.
Ich lächelte, nicht wegen ihrer Antwort, sondern weil wir zum ersten Mal in diesen endlosen drei Wochen eine Art Gespräch führten. Ich ging ins Wasser, und sie folgte mir ohne Murren.
Obwohl Byron Bay als Mekka für Surf-Touristen gilt, sind die Wellen üblicherweise nicht sehr hoch. Doch an diesem Tag stellte sich das seltene Phänomen ein, das »Die berühmte Welle von Byron Bay« genannt wird.
Und diese Gelegenheit ließ ich mir nie entgehen.
Wir gingen ins tiefere Wasser. Dort saßen wir stumm auf unseren Surfboards und warteten auf den richtigen Moment. Als ich Leah ein Zeichen gab und mich in Bewegung setzte, reagierte sie sofort und folgte mir, weil ich eine gute Welle, die zunehmende Energie im ruhigen Wasser, immer spürte.
»Sie kommt«, flüsterte ich.
Die Zeit nutzend, paddelte ich weiter hinaus und stellte mich aufs Board, dann glitt ich an der Welle hoch und umrundete sie, wobei ich für einen Move das Tempo erhöhte. Ich wusste, dass Leah mir folgte. Ich spürte sie hinter mir, wie sie sich an der Wellenwand ihren Weg bahnte.
Glücklich drehte ich mich um.
Eine Sekunde später war sie nicht mehr da.
10 Leah
Das Wasser schlug über mir zusammen, und ich schloss die Augen.
Danach gab es keine Farben mehr, und ich fühlte mich vor diesen Erinnerungen gerettet, die mich manchmal überfielen, Erinnerungen an das Leben, das ich nicht mehr hatte, an die Dinge, die ich mir einmal gewünscht hatte und die mir jetzt nicht mehr wichtig waren. Denn es war nicht gerecht, dass das Leben wie gewohnt weiterging, immer weiter, als hätte sich nichts geändert, obwohl sich alles geändert hatte. Ich fühlte mich so fern von meinem früheren Leben, von mir selbst, dass ich oft das Gefühl hatte, an diesem Tag auch gestorben zu sein.
Schlagartig öffnete ich die Augen.
Das Wasser wirbelte um mich herum. Ich versank. Aber da war kein Schmerz. Da war nichts. Nur der Geschmack von Salzwasser in meinem Mund. Nur Ruhe.
Dann spürte ich, wie seine Hände mich packten und an sich drückten, seine Kraft und seinen Schwung, als wir zusammen aufstiegen. Als wir die Wasseroberfläche durchbrachen, blendete mich die Sonne. Übelkeit stieg in mir auf. Ich musste husten. Axel strich mir mit den Fingern über die Wange, und seine Augen, in einem so dunklen Blau, dass sie fast schwarz waren, verschwammen über mir.
»Verdammt, Leah, Schatz. Alles in Ordnung?«
Aufgewühlt sah ich ihn an. Ich spürte … ich spürte etwas …
Nein, nichts war in Ordnung. Nicht, wenn ich wieder etwas für ihn empfand.
11 Axel
Panik. Sie so plötzlich aus den Augen zu verlieren, hatte reine Panik in mir ausgelöst. Als wir nach Hause gingen, schlug mir das Herz noch immer bis zum Hals, und ich musste ständig daran denken, wie sie unterging, wie das schäumende Meer über ihr zusammenschlug, wie zerbrechlich sie gewirkt hatte. Ich wollte sie fragen, warum sie nicht versucht hatte, wieder nach oben zu kommen, aber ich hatte Angst, das Schweigen zu brechen. Oder vielleicht fürchtete ich in Wahrheit nur ihre Antwort.
Während sie duschte, starrte ich durchs Küchenfenster nach draußen und überlegte, ob ich Oliver anrufen sollte. Als Leah hereinkam und mich beschämt und nervös anblickte, musste ich mich zusammenreißen, um hart zu bleiben.
»Wie fühlst du dich?«
»Gut, mir war nur ein wenig schwindlig.«
»Als du ins Wasser gefallen bist?«