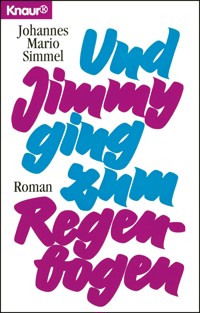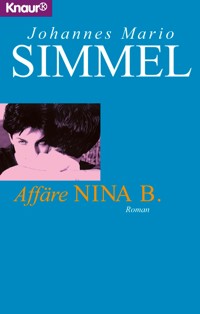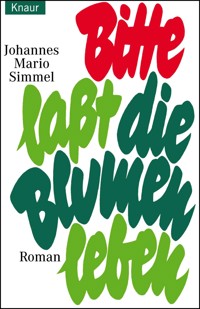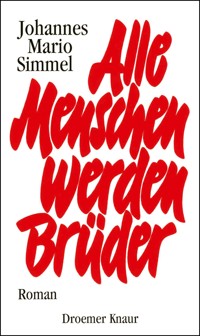
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein ehemals gefeierter Autor sitzt in Untersuchungshaft und erzählt seine tragische Lebensgeschichte, die unweigerlich mit der jüngsten Vergangenheit und Gegenwart unseres Landes verbunden ist. »Ich weiß, dass sich Abgründe auftun werden, wenn Sie zu erzählen beginnen. Aber Sie müssen erzählen, denn ich muß die Wahrheit kennen, die ganze Wahrheit.« Das sagt Staatsanwalt Paradin zu Richard Mark, dem ehemals gefeierten Romanautor. Richard Mark, einst ein erfolgreicher Romanautor, befindet sich in Untersuchungshaft. Staatsanwalt Paradin fordert ihn auf, die ganze Wahrheit zu erzählen, auch wenn sich dabei Abgründe auftun werden. Und so berichtet Richard Mark von seiner großen Liebe Lillian Lombard, von seinem Bruder Werner, der ihn ermorden lassen will und den er selbst ans Messer liefert, und von all den Menschen, die untrennbar mit seinem Schicksal verwoben sind. In Alle Menschen werden Brüder lässt Johannes Mario Simmel nicht nur das Leben des Richard Mark lebendig werden, sondern konfrontiert uns schonungslos mit der Vergangenheit und Gegenwart unseres Volkes und Landes. Ein anspruchsvoller Roman über Liebe, Verrat, Mord und die unbarmherzigen Verstrickungen des Lebens, der unter die Haut geht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1174
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Johannes Mario Simmel
Alle Menschen werden Brüder
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»Ich weiß, daß sich Abgründe auftun werden, wenn Sie zu erzählen beginnen. Aber Sie müssen erzählen, denn ich muß die Wahrheit kennen, die ganze Wahrheit.« Das sagt Staatsanwalt Paradin zu Richard Mark, dem ehemals gefeierten Romanautor, der jetzt in Untersuchungshaft sitzt. Und Richard Mark erzählt: Von Lillian Lombard, seiner großen Liebe; von seinem Bruder Werner, der ihn ermorden lassen will und den er selbst ans Messer liefert; von allen Menschen, die unlösbar mit seinem tragischen Schicksal verbunden sind. Es ist nicht nur das Leben des Richard Mark, das Johannes Mario Simmel lebendig werden läßt. Es ist die jüngste Vergangenheit und die Gegenwart unseres Volkes, unseres Landes, mit der der Autor uns schonungslos konfrontiert.
Inhaltsübersicht
Vorbemerkung
Motto
Erster Satz
Mein Bruder fragte seinen [...]
Ihre Frau wurde am [...]
Zweiter Satz
Mein Bruder sah mich [...]
Am 12. Februar 1946 fuhr [...]
Dritter Satz
Mein Bruder sagte: »Ich [...]
Eben war Wachtmeister Stalling [...]
Vierter Satz
Mein Bruder sagte: »Du [...]
Ich kam durch unseren [...]
Dieses Buch ist ein Roman, aber der Roman beruht auf tatsächlichen Ereignissen. Es handelt sich um sehr viele Ereignisse, in die sehr viele Personen verwickelt waren und verwickelt sind. Wer einen Roman schreibt, der darf sehr viele Ereignisse zu einigen typischen verdichten, und das gleiche gilt für die Personen. Infolgedessen sind alle Ereignisse, Personen, Namen, Orte, Daten und Institutionen die in diesem Buch Erwähnung finden – ausgenommen zeitgeschichtliche oder historisch bekannte –, von mir erfunden.
J. M. S.
Das Wesen des Menschen will, daß es keinen menschlichen Konflikt gibt, der sich nur in einem Individuum abspielt und auf ein Individuum beschränkt bleiben könnte. Wir hängen offenbar so allgemeinschaftlich zusammen, daß, was Einem geschieht, auf irgendeine Art auch im Andern geschieht … Das Wort Kains: »Soll ich meines Bruders Hüter sein?« ist nicht nur die Vorbereitung auf das Gebot der Nächstenliebe – es ist die Feststellung der Tatsache, ich bin der Bruder meines Bruders und ich bin also auf Gedeih und Verderb mit ihm verbunden.
Viktor Freiherr von Weizsäcker, 1886–1957
Erster Satz
Allegro ma non troppo, un poco maestoso
Mein Bruder fragte seinen Mörder, wie dieser den Mord zu begehen gedenke.
»Auf die ehrwürdige Weise«, antwortete der Inder. »Mit einem malaiischen Kris. Das ist am sichersten und geht am schnellsten. Ein einziger Schnitt genügt. Genügte noch jedesmal.«
»Gut«, sagte mein Bruder. Sie sprachen Englisch miteinander.
»Ich hatte es natürlich stets mit Menschen zu tun, die im Bett lagen oder schliefen.«
»Natürlich«, sagte mein Bruder Werner.
»Das ist die Voraussetzung«, sagte sein Mörder. »Tiefer Schlaf. So tief wie möglich. Betrunkene machen es mir leicht. Sich auch.«
»Ich werde Whisky nehmen«, versprach mein Bruder.
»Whisky ist gut«, sagte sein Mörder. Er sah viel älter aus, als er tatsächlich war: hohlwangig und ausgezehrt. Die schwarzen Augen trugen einen verzückten Ausdruck, die Zähne hatten beinahe ihre Farbe, und wenn der Inder ausspuckte, war sein Speichel rot. Er spuckte häufig aus, denn er kaute Betel. Betel macht die Zähne schwarz und den Speichel rot. Der körperliche Verfall und die beständige Glückseligkeit des Mörders waren zum kleineren Teil Folgen dieser Betelkauerei, zum größeren die eines gewiß langjährigen und gewiß enormen Konsums von Haschisch. Ein Rauschgifthändler in Kairos Altstadt hatte meinen Bruder Werner mit seinem Mörder zusammengebracht. Das war gestern gewesen, und die beiden hatten sich grundsätzlich geeinigt. Heute trafen sie einander noch einmal bei dem alten Nilometer an der äußersten Südspitze der Flußinsel Roda – um dreiundzwanzig Uhr am Mittwoch, dem 14. Dezember 1966. Es war geradezu unglaublich warm für Dezember und für eine Gegend mit im allgemeinen extremen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht. Die beiden Männer trugen nur leichte Mäntel.
Heiter und verträumt – er sprach stets verträumt und heiter – sagte der Inder: »Ideal wären natürlich Whisky und Schlafpulver. Es gibt sehr starke.«
»Wo bekomme ich die?« fragte Werner. Er war achtundvierzig, ich fünf Jahre jünger, aber trotz dieses Altersunterschiedes sahen wir einander außerordentlich ähnlich. Wir waren beide groß und recht kräftig, wir hatten beide braunes Haar und braune Augen, hohe Stirnen, schmale Nasen, volle Lippen, breite Unterkiefer.
»Ich gebe Ihnen gern die Schachtel hier«, sagte meines Bruders Mörder. »Das Pulver liegt in kleinen Umschlägen darin. Es löst sich rasch und ist vollkommen geschmacklos. Und es beginnt schon nach zehn Minuten zu wirken … mächtig.«
»Fein.«
»Es sind zehn Kuverts in der Schachtel. Nehmen Sie den Inhalt von drei Umschlägen für eine Flasche Whisky. Wir wollen ganz sichergehen.«
»Ganz sicher«, bestätigte mein Bruder ernst.
Schwarzblau war der Himmel in dieser Nacht. Die Sterne leuchteten, als sei es noch August. Das Licht des Mondes war gespenstisch grün. Grün sah der Strom, grün sah ganz Kairo aus. Grün waren die hohen Segel der Falluka-Boote im Alten Hafen links vor der Inselspitze, grün die Sphinx und die Pyramiden von Giza zur Rechten, drüben in der Wüste. Das alte Nilometer, vor dem mein Bruder und sein Mörder standen, war umgeben von einem großen Garten. Rosen, Nelken und Oleander dufteten hier. Tagsüber kamen viele Touristen her, nachts war der Garten gewöhnlich verlassen. Kleine Scheinwerfer, unter den Büschen installiert, beleuchteten ihn romantisch goldgelb für Betrachter aus der Ferne. Heute hatten sich indessen leichte Bodennebel gebildet, und so war der grüne Mond stärker. Die Farbe des Lichtes entsprach etwa jener, die entsteht, wenn man Wasser in Pernod gießt.
Der Garten, in dem Fächerpalmen und Akazien am Rand der Kieswege wuchsen, war flach angelegt und sehr übersichtlich. Stand man vorn bei dem Nilometer, erblickte man jedes Liebespaar, jede Polizeistreife, jeden einsamen Spaziergänger schon von weitem – auch nachts. Dafür sorgten dann die vielen kleinen Scheinwerfer, heute dazu noch das Mondlicht. Wollte man selbst nicht gesehen werden, hatte man ausgiebig Zeit, die Stufen zur Kaimauer hinunterzueilen, die fünf Schritte vom Nilometer entfernt lag und sehr viele Nischen und Einlässe zu unterirdischen Kanälen besaß. Diese dienten dazu, die Insel, insbesondere ihre Spitze, zu schützen, wenn der Nil Hochwasser führte. Dann verhinderten die Gänge und Kanäle eine Überschwemmung oder gar Vernichtung von Roda: Heranbrausende Fluten wurden abgelenkt, geschwächt und verließen zuletzt friedlich und kraftlos die mannshohen Röhren, die unter einem weiten Teil von Roda verlegt waren und erst bei stillen, geschützten Buchten wieder ins Freie mündeten. Führte der Nil kein Hochwasser, gab es hier viele Möglichkeiten, sich zu verstecken oder zu flüchten. Das war der Grund, warum der Inder den schmalen Streifen zwischen Nilometer und Kaimauer für geschäftliche Besprechungen bevorzugte. Ein guter Platz, um über Mord zu reden, dachte ich. Ich stand in einer Nische der Kaimauer, fünf Meter tiefer als mein Bruder und sein Mörder. Es war wirklich eine unwahrscheinlich warme Nacht. Ich trug auch nur einen leichten Regenmantel.
Natürlich hatte der Inder, als er kam, zunächst nachgesehen, ob sich hier unten jemand verberge. Mein Bruder hatte ihm dabei geholfen. Der Mörder besaß eine starke Taschenlampe. Ich war schon eine halbe Stunde vor den beiden dagewesen. Sie hörten mich nicht, als ich aus der Nische, in der ich gewartet hatte, in das Innere des Kanalisationsnetzes hinein verschwand und mich in einer Druckkammer verbarg. Ich trug Slipper mit Gummisohlen. Sie stiegen beruhigt wieder nach oben, und ich kehrte lautlos in meine Nische zurück. Leise klatschten die Wellen gegen den Beton der Mauer. Kein Windhauch regte sich. Ich verstand jedes Wort, das über mir gesprochen wurde.
Mein Bruder fragte seinen Mörder hastig: »Also wann?«
Der Inder lachte. Er lachte häufig. Auch das hing mit dem Haschisch und dem Betelkauen zusammen.
»Sie haben es ja mächtig eilig«, sagte der Inder.
Mein Bruder hatte es in der Tat mächtig eilig, ich wußte es. Ich allerdings hatte es noch eiliger als er. Aber das wußte er nicht.
Dieses Nilometer war mehr als elfhundert Jahre alt. Irgendwann zu Beginn des achten Jahrhunderts hatte es Kalif Soliman erbauen lassen, damit der Wasserstand des Stromes jederzeit abgelesen werden konnte. Ich bin nicht etwa so außerordentlich gebildet, ich war nur schon zweimal in Kairo gewesen und kannte mich deshalb einigermaßen aus, das ist alles. Zudem gab es Reiseführer. Ich hatte bereits vor Jahren die Kanäle und Schutzgänge unter der Insel Roda besichtigt und wußte noch, welche die besten waren. Was dieses Nilometer anging: Nach der Höhe des Wasserstandes wurden lange Zeit die Steuern errechnet, die ein jeder, der Land besaß oder bebaute, zu entrichten hatte, denn dieser Strom war (und ist) die Lebensader Ägyptens. Sein Wasser bestimmte (und bestimmt) die Erträge der Landwirtschaft und das Ausmaß der Überschwemmungen, fette Jahre und magere. Ein Tiefstand von sieben Ellen gab Anlaß zu Panik, bei einem Stand von fünfzehn Ellen wurden die Bewässerungskanäle durchstochen, und man feierte das große Glück mit großen Festen, meist gegen die Mitte des August.
Das Nilometer – längst nicht mehr in Betrieb, längst benützte man moderne Pegel – bestand aus einem sehr großen rechteckigen Brunnen, in dessen Mitte sich eine achteckige Säule mit altarabischen Maßen befand. An den Brunnenwänden standen kufische Schriftzeichen. Die Wand zum Strom hin hatte man höher gebaut als die drei anderen Wände. An ihrer Innenseite waren mehr Schriftzeichen. An ihrer Außenseite lehnten mein Bruder und sein Mörder. Von Zeit zu Zeit spie der Inder roten Betelsaft aus, entweder in den Brunnen hinab oder über die Kaimauer. Dann klatschte mir Speichel vor die Füße.
»Also wann?« fragte mein Bruder, bebend vor Ungeduld.
»Heute nicht mehr«, sagte sein Mörder. »Ich muß noch Vorbereitungen treffen.«
»Morgen?« Werners Stimme drängte.
»Morgen nacht, ja.«
»Um wieviel Uhr?« Werner stotterte leicht vor Aufregung. »Ich muß … muß … auch noch ein paar Vorbereitungen treffen, muß ich ja dann …«
Der Mörder sagte: »Pünktlich um ein Uhr nachts werde ich dasein. Das ist spät genug und doch nicht zu spät. Um zehn Uhr werden Sie mit dem Abendessen fertig sein. Um elf Uhr fangen Sie mit dem Whisky an. Dann kann ich Sie zwei Stunden später auf das beste bedienen.«
»Wie kommen Sie ins Hotel? Und wieder hinaus?«
»Das ist für Sie doch wirklich uninteressant«, meinte der glückliche Inder und lachte wieder einmal.
»Ich möchte es trotzdem wissen«, sagte mein Bruder, seltsam aggressiv.
Ich möchte es auch wissen, dachte ich in meiner Nische.
»Wollen Sie es mir nicht sagen?«
»Aber ja doch.« Der Inder spie über die Kaimauer. Direkt vor meine Schuhe. »Ich komme durch die Tiefgarage Ihres Hotels.«
Er meinte das Hotel ›Imperial‹.
Das Hotel ›Imperial‹ steht an der Nile Corniche, auf der rechten Flußseite, etwa zweihundert Meter oberhalb der Semiramis-Brücke, die zu der nördlichsten und größten Nilinsel im Stadtbereich hinüberführt, nach Gezireh. Das ist die vornehmste und eleganteste Gegend Kairos. Vor dem ›Imperial‹ wachsen an den Rändern der Prachtstraße, die sehr an die Croisette in Cannes erinnert, viele große Palmen, Jacarandas, Flamboyants, Johannisbrot-, Lebbach- und Lotosbäume. Hatte man sein Zimmer an der Vorderseite des ›Imperial‹, dann erblickte man diese Bäume und die Corniche und die Anlegestelle für die großen, glasgedeckten Ausflugsmotorboote vor dem nahen ›Shepheard’s‹ und auch ganz Gezireh: oben im Norden die Luxusvillen und Parks der Reichen, in der Mitte den Gezireh-Sporting-Club mit seinem Schwimmbad, den Golf-, Tennis-, Polo-, Kricket- und Hockeyplätzen, die Pferderennbahn, und im Süden, etwa in Höhe des ›Imperial‹, den phantastischen Andalusischen Garten, das Amerikanische Hospital und einen sehr schönen kleinen Palast. Dieser Palast hatte einmal dem fetten Faruk gehört, der hier seine in der Welt wohl einmalige Monstersammlung pornographischer Filme, Bücher, Fotos, Gegenstände und Kunstwerke aufbewahrt und seine komplizierten Partouzen veranstaltet hatte.
In einer Nische der Kaimauer der Insel Roda stehend, fünf Meter unter meinem Bruder und seinem Mörder, dachte ich in jener warmen Nacht des 14. Dezember: Wenn dieser Inder in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag um ein Uhr wirklich kommt und alles glatt geht, kann ich um halb zwei bei Lillian sein, drüben auf Gezireh, neben Faruks Palast. Sie wird dasein, das ist gewiß.
War der Mörder pünktlich, bediente er meinen Bruder wirklich bestens, kam ich mit allem, was ich dann zu erledigen hatte, zeitlich sehr gut zurecht. Natürlich konnte es dabei noch unendlich viele Komplikationen geben; aber an die wollte ich nicht denken. Mein Plan war festgelegt: der letzte, der mir noch verblieb.
»Wieso durch die Tiefgarage?« fragte mein Bruder. Der Duft einer Zigarette kam zu mir. Werner rauchte stets, wenn er erregt war. Es hatte mich schon gewundert, bis jetzt nur den Geruch des Wassers und, flüchtig, ungewiß, den der Rosen, Nelken und Akazien wahrzunehmen.
»In der Tiefgarage kenne ich mich aus«, sagte der Inder. Er rauchte gewiß nicht. Nicht wenn er Betel kaute. Der war auch nicht aufgeregt.
»Die Einfahrt und die Ausfahrt der Garage sind auch nachts bewacht!« Mein Bruder redete jetzt schnell. »Und es arbeiten Mechaniker da unten und Leute, die Wagen waschen. Ich habe es gesehen!«
»Von der Garage führt eine Wendeltreppe hinauf zur ebenen Erde«, sagte der Inder verträumt. »Zu ebener Erde gibt es einen kleinen Lift.« Das stimmte. Der Lift war für Hotelgäste bestimmt, die ihre Wagen in die Garage gefahren hatten und nicht noch einmal auf die Straße hinausgehen wollten, um in das Innere des ›Imperial‹ zu gelangen. »Und neben dem kleinen Lift gibt es eine Tür, die ins Freie führt.«
»Ja«, sagte mein Bruder. »Eine Stahltür. Nachts ist sie verschlossen.«
»Morgen nacht wird sie nicht verschlossen sein«, sagte der Inder kichernd. »Ich kenne einen der Wagenwäscher.«
»Ich bin beruhigt«, sagte mein Bruder.
Ich auch, dachte ich.
»Die Appartementnummer …« begann Werner, doch der Inder unterbrach ihn ungeduldig: »907. Und wie das Appartement aussieht, haben Sie mir aufgezeichnet. Noch etwas?«
»Nein. Das wäre dann wohl alles«, murmelte mein Bruder unsicher.
»Bis auf dreitausend Pfund«, sagte sein Mörder, und nun lachte er, als würde er gekitzelt.
Werner lachte mit. Er hatte verschiedene Arten zu lachen, ich kannte sie alle. Jetzt lachte er aus Angst, nur kurz, danach wurde es still. Es duftete auf einmal nach Zigarettenrauch, und ich hatte plötzlich selber Angst. Mein Bruder, dachte ich, wird sich zuletzt doch nicht noch alles überlegen? Was, wenn er seinen Mörder nicht mehr will? Wenn er ihn nicht bezahlt? Dann bleibt Werner am Leben. Dann ist mein letzter Plan mißlungen. Dann …
»Verzeihen Sie«, sagte mein Bruder dort oben bei dem Nilometer. »Das habe ich total vergessen. Selbstverständlich muß man vorher zahlen bei einer solchen Sache.«
»Wo ist das Geld, lieber Freund?« Die Stimme des Inders klang herrisch.
»Hier«, sagte mein Bruder.
»Danke, lieber Freund«, sagte sein Mörder.
»Aber …«
»Was aber?«
»Aber Sie werden nun auch ganz bestimmt … ich meine, wenn Sie das Geld haben, könnten Sie ja auch einfach verschwinden. Ich hätte nichts in der Hand gegen Sie. Oder soll ich etwa zur Polizei gehen und sagen: Gentlemen, mein Mörder hat mich sitzenlassen?«
Das belustigte den Inder wieder enorm. Er lachte glucksend. Etwas Glühendes flog über mich hinweg, auf das Wasser hinaus – meines Bruders Zigarette. Er zündete sofort eine neue an.
»Ich werde kommen«, sagte der Mörder. »Ich gebe Ihnen mein Wort darauf. Mehr kann ich nicht tun. Ich erklärte Ihnen gestern, daß ich immer das ganze Honorar im voraus verlange, weil man nie weiß, was passiert, wenn man seine Arbeit geleistet hat. Sie waren einverstanden.«
»Ich … ich bin es noch immer«, stammelte mein Bruder.
»Geschäfte wie dieses«, erklärte sein Mörder, »müssen ganz einfach auf Vertrauen beruhen. Legen Sie den Koffer hierher. Öffnen Sie ihn. Das sind also dreitausend Pfund?«
»Ja.«
»In Noten, wie ich sie verlangt habe?«
»Ja.«
Der Inder hatte das Geld in lauter Scheinen zu einem ägyptischen Pfund verlangt. Die Scheine durften nicht neu sein, und nicht zwei von ihnen durften fortlaufende Seriennummern aufweisen. Es war für meinen Bruder und seine Freunde ein hübsches Stück Arbeit gewesen, so kurzfristig dreitausend derartiger Pfundnoten zu bekommen. Ohne die Hilfe eines Bankiers hätten sie es nicht geschafft. Im Dezember 1966 entsprach ein ägyptisches Pfund nach amtlichem Kurs 9,26 DM. Mein Bruder honorierte seinen Mörder also mit rund 28000 DM.
»Ich habe die Noten nach den Serienbuchstaben geordnet«, sagte Werner.
»Das bemerke ich. Ich will davon absehen, jetzt und hier alle Nummern zu überprüfen.«
»Jetzt und hier? Das könnten Sie doch niemals!«
»Aber gewiß könnte ich es«, sagte der Inder. »Es würde eine oder eineinhalb Stunden dauern, länger nicht. Ich werde die Banknoten später untersuchen. Wenn falsche dabei sind …«
»Alle sind echt! Alle!« rief mein Bruder hastig.
Hoffentlich, dachte ich, hoffentlich.
»… dann dürfen Sie natürlich nicht mit mir rechnen.«
»Ich habe genauestens aufgepaßt!« rief mein Bruder.
Verflucht, dachte ich, hoffentlich hast du das wirklich, du Hund.
Der Inder sagte: »Sie gehen jetzt. Ich bleibe noch zehn Minuten.«
»Auf Wiedersehen«, stammelte Werner. Seine Stimme zitterte. Er war sehr aufgeregt. Ich auch.
»Wir werden uns wohl niemals wiedersehen, mein Freund«, sagte der Inder und kicherte.
Mein Bruder ging wortlos über einen Kiesweg davon.
Sein Mörder folgte ihm genau zehn Minuten später mit dem Diplomatenkoffer, in dem dreitausend ägyptische Pfund lagen.
Nach weiteren zehn Minuten folgte ich dem Mörder. Die Nebel über den Rasenflächen und Blumenbeeten waren gestiegen, auch über dem Strom erhoben sie sich bereits. Es war, als ginge man bis zu den Knien in fluoreszierender grüner Watte. Niemand begegnete mir, nicht auf der Insel, nicht auf der El-Malik-es-Salih-Brücke.
Bis zum Festland waren es knapp zwei Kilometer, doch mir kam es vor, als seien es zwanzig, und ich fühlte mich auf einmal grauenhaft, einfach grauenhaft, bis ich dachte, daß mein Bruder in rund fünfundzwanzig Stunden tot sein würde, wenn nur alles gutging.
Du darfst nicht daran denken, daß noch etwas passiert und er am Leben bleibt, sagte ich zu mir, durch den Nebel hastend, du mußt ganz fest daran glauben, daß alles gut, gut, gutgehen und dein Bruder morgen nacht schon tot, tot, tot sein wird. Also dachte ich ganz fest daran, und nach einer Weile fühlte ich mich gar nicht mehr grauenhaft, sondern großartig, einfach großartig.
Als Jungen hatten mein Bruder und ich durch Jahre eine Kinderfrau. Unsere Eltern waren geschieden, Vater schuldig, also lebten wir bei Mutter, und Mutter, Redakteurin einer Morgenzeitung – damals noch ein ungewöhnlicher Frauenberuf –, kam stets spät nach Hause. Mein Bruder, älter und robuster als ich, hätte diese Kinderfrau wohl entbehren können. Ich aber brauchte und liebte sie sehr. Sie stammte aus Oberschlesien und hieß Sophie Kaczmarek. Wenn ich nachts aus einem schlimmen Traum erwachte und vor Furcht schrie, ja, immer wenn ich laut weinte vor Furcht, auch tags, sehr oft war das, kam die Sophie gelaufen, um mich zu trösten. Sie wiegte mich auf ihren spitzen Knien und strich mit harten Händen über mein Haar und sagte in ihrem harten Deutsch: »Denk an was Schönes. Denk an Engel.«
So dachte ich dann stets an Engel, und immer schwand meine Furcht nach kurzer Zeit.
Das fiel mir ein, als ich nun durch den Nebel eilte, und ich hörte die Stimme der Sophie: »Muß man nur an was Schönes denken, schon hat man kein’ Angst mehr.«
Das Schönste, woran ich in jener Dezembernacht denken konnte, war, daß mein Bruder in fünfundzwanzig Stunden ermordet sein würde.
Eine Minute nach ein Uhr nachts am 16. Dezember 1966 öffneten sich ganz langsam und fast geräuschlos die beiden Eingangstüren zum Appartement 907 im neunten Stock des Hotels ›Imperial‹. Dieses Appartement lag an der Vorderseite des Hauses, an der Nile Corniche. Die schweren Leinenvorhänge waren zugezogen, im Salon und im Schlafzimmer. Hinter dem Schlafzimmer lag das Badezimmer. Hier stand ich, im toten Winkel der offenen Tür, gegenüber einem großen Spiegel, der sich oberhalb des Waschbeckens und neben der Wanne befand. Der Spiegel blieb zunächst noch dunkel.
Ich hörte, wie die äußere Tür des Appartements vorsichtig geschlossen wurde. Dann hörte ich ein hohes Kichern, und ich dachte: Mein guter Bruder Werner hat wirklich jede einzelne Banknote genau geprüft, und sein Mörder ist äußerst pünktlich. Daß die innere Appartementtür – die äußere besaß gar kein Schloß – unversperrt sein würde, hatte der Inder mit meinem Bruder verabredet. Nun kam er aus dem Vorraum in den Salon, geschmeidig und schnell. Die Tür vom Schlafzimmer zum Salon stand auch offen, also konnte ich im Badezimmerspiegel das Aufblitzen der starken Taschenlampe und gleich darauf den Mörder sehen. Er trug einen schwarzen, hochgeknöpften Mantel. Mit der Taschenlampe leuchtete er den Salon ab, und da es auch dort Spiegel gab, die Licht reflektierten, sah ich den Inder in dem Badezimmerspiegel sehr deutlich. Sein Gesicht war weiß, seine Kiefer mahlten, und seine Augen funkelten vor irrer Glückseligkeit. Offenbar arbeitet er am besten, wenn er sehr high ist, dachte ich, und als ich sah, daß er richtig herumtänzelte, drückte ich auf alle Fälle den Sicherungshebel der automatischen 38er Police Special herunter, die ich in der linken Hand hielt. (Ich bin Linkshänder.) Ein zwanzig Zentimeter langer Schalldämpfer war auf die Pistole gesteckt. Ich hatte von Anfang an erwartet, daß ich keine Waffe würde benützen müssen, aber ich war nie ganz sicher gewesen, darum hatte ich die 38er im Laufe des vergangenen Tages bei einem Hehler in einer schmutzigen Gasse, nahe der Ibn-Tulûn-Moschee, erworben, den Schalldämpfer dazu und außerdem sechs Rahmen Munition. Einer steckte in der Pistole, die anderen in meinen Jackentaschen. Ich hatte die Pistole und den Schalldämpfer im Keller des Hehlers ausprobiert. Eine ungeschickt geöffnete Champagnerflasche macht mehr Lärm. Als ich – im Badezimmerspiegel – nun das kleine Ballett des Inders sah, der im Salon mit seiner Taschenlampe alles ableuchtete, fühlte sich die 38er in meiner linken Hand ganz außerordentlich erfreulich an. Man konnte schließlich nie wissen, ob so ein Süchtiger nicht plötzlich durchdrehte, und was er tat, wenn er plötzlich durchdrehte, konnte man erst recht nicht wissen, und unmöglich war es auch nicht, daß mein Bruder, der nebenan im Bett lag, bis oben voll mit Whisky und darin aufgelöstem Schlafpulver, nicht doch erwachte, und man konnte nicht wissen, ob der Mörder sich vielleicht zuerst noch im ganzen Appartement umsehen würde, also auch im Badezimmer und hier hinter der Tür. Man konnte immer noch sehr viele Dinge nicht wissen. Das einzige, was feststand, war, daß ich vor Tagesanbruch Ägypten verlassen haben mußte.
Im Spiegel erschien jetzt die moderne Sitzgarnitur des Salons, die der Mörder mit seiner Taschenlampe prüfte. Zwischen den bequemen Lehnstühlen wurde einer dieser praktischen runden Tische sichtbar, deren Platte sich drehen läßt. Der Tisch trug Aschenbecher, Zigarettenpackungen, Gläser, mehrere Whisky- und Sodawasserflaschen und einen großen silbernen Thermosbehälter, der Eiswürfel enthielt. Es sah ziemlich wüst aus auf diesem Tisch. Asche war verstreut, ein Glas und eine Flasche waren umgeworfen. Ich sah, wie der Mörder sich über all das neigte, und hörte, wie er all das kichernd betrachtete. Er war beneidenswert glücklich.
Nachdem er das Chaos genossen hatte, kam er tänzelnd auf die Schlafzimmertür zu. Da er das elektrische Licht nirgends angeknipst hatte, benötigte er dauernd die Taschenlampe, deren Schein mittanzte. Größer und größer wurde die Gestalt im Badezimmerspiegel. Der Inder mußte den Plan, den mein Bruder ihm von diesem Appartement aufgezeichnet hatte, gut im Kopf haben, denn er leuchtete sofort zum Bett. Dadurch konnte ich es, wenn ich mich auf die Zehenspitzen stellte, auch erkennen. Mein Bruder lag auf dem Rücken, sein Anzug über einem Stuhl, ebenso seine Wäsche. Er trug einen gelben Pyjama. Ich selbst hatte Werner entkleidet und ihm den Pyjama angezogen.
Dem Mörder schien zu gefallen, was er sah. Er kicherte wieder. Dann griff er in seinen Mantel, wobei ich zum erstenmal sah, daß er schwarze Zwirnhandschuhe trug. Im nächsten Augenblick hielt der Mörder die schlangenförmig gekrümmte Klinge eines Kris in der Hand. Er hängte die Taschenlampe an einen Mantelknopf, riß schnell, um sich vor Verunreinigung zu schützen, die Bettdecke hoch, dann zog er die Klinge durch den Hals meines Bruders, vom rechten Ohr bis zum linken. Seitlich und schräg schoß nach allen Seiten Blut aus der Wunde und befleckte die Wände, das Bett und die Bettdecke, die der Inder nun fallen ließ, während er herzlich lachte. Er wischte den Kris an der Decke ab, eilte beschwingt in den Salon, und sofort danach hörte ich, wie sich die beiden Eingangstüren hinter ihm leise schlossen. Ich sah auf meine Uhr. Es war 1 Uhr 09.
Nun trat ich aus dem Badezimmer. Da die Stores alle geschlossen waren, konnte ich ruhig das elektrische Licht im Schlafzimmer anknipsen. Ich knipste es an und rasch wieder aus. Meines Bruders Bett war mittlerweile ein roter Strumpf geworden, von den Wänden floß das Blut in Mengen herab, und von Bett und Wänden sickerte es bereits in den Teppich. Werners Gesicht war sehr weiß und sah sehr zufrieden aus. Es hatte wirklich ein einziger Schnitt genügt. Der Inder war 28000 DM wert gewesen.
Ich ging durch das Schlafzimmer in den Salon und schaltete hier das Licht des großen Deckenlüsters ein. Aus dem Vorraum holte ich meinen dicken blauen Kamelhaarmantel und zog ihn an. Ich versuchte, die 38er einzustecken, aber mit dem Schalldämpfer daran war sie zu lang, also zog ich ihn ab und steckte ihn in die linke Hosentasche. Die Pistole kam in einen Schulterhalfter, den ich umgeschnallt über dem Hemd, unter der Jacke, trug.
Nun ging ich zum Tisch. Hier standen zwei Flaschen Johnnie Walker Black Label. Die eine war noch voll, in der anderen fehlte etwas. Ich öffnete die angebrochene Whiskyflasche und holte aus der Brusttasche meines Anzugs die schmale Schachtel mit den Schlafpulvern, die der Inder in der Nacht zuvor Werner gegeben hatte. Zehn kleine Kuverts waren ursprünglich darin gewesen. Ich überlegte, wie viele Kuverts ich noch öffnen sollte, um ihren Inhalt in die Flasche zu schütten. Drei Portionen hatte mein Bruder bereits hineinrieseln lassen. Die Wirkung hatte ich mit ansehen können, nachdem er ein Glas von diesem Whisky getrunken hatte. So etwas mußte jetzt noch einmal passieren. Ich wollte mein Opfer keinesfalls vergiften, doch sollte die Sache beim zweitenmal schneller gehen. Die Zeit drängte. Mein Flugzeug, eine Boeing 720 B der Lufthansa, die aus Tokio kam, landete um 3 Uhr 45 auf dem Internationalen Flughafen von Kairo bei Neu-Heliopolis. Sie flog erst um 4 Uhr 40 weiter, aber bis nach Neu-Heliopolis, das nördlich von Kairo liegt, sind es fünfundzwanzig Kilometer, und ich hatte noch viel zu erledigen. Die Maschine mußte ich unbedingt erreichen. Ich hatte sie im Lufthansabüro in der Rue Talaat Harb 9 gewählt und einen Platz in ihr gebucht, nachdem ich genau wußte, wann der Mörder kommen wollte. Ab Rom war ich zum Weiterflug nach Zürich mit einer anderen Lufthansa-Maschine vorgemerkt, die um 6 Uhr 30 römischer Zeit startete. Ich besaß viel Geld auf dem Konto einer Schweizer Bank. Um dieses Geld nach Buenos Aires zu transferieren, war es notwendig, daß ich selbst in der Bank erschien, die mein Vermögen verwaltete, denn der größte Teil des Geldes war langfristig angelegt worden. Bei einer plötzlichen Kündigung hatte ich persönlich verschiedene Dokumente zu unterzeichnen. Eine Swiss-Air-Maschine nach Buenos Aires verließ Zürich um 12 Uhr 15 Ortszeit vom Flughafen Kloten aus. Diese Interkontinental-Maschinen waren höchst selten voll ausgebucht. Hier mußte ich ein Risiko eingehen. Ich konnte erst in Zürich einen Platz belegen. Ich besaß Visa für Ägypten und Argentinien und zwei internationale Seuchenpässe, und ich war gegen die verschiedensten Krankheiten geimpft worden. Bei politischen Delikten, wie sie in meinem Fall zur Debatte standen, lieferten weder Argentinien noch Ägypten aus.
Nur diese Lufthansa-Boeing 720 B verließ Kairo aber so früh, daß sie noch für mich in Frage kam, denn ich mußte damit rechnen, daß der Mord an meinem Bruder in den Morgenstunden, spätestens aber gegen halb zehn Uhr, entdeckt wurde. Um neun Uhr ließ sich mein Bruder täglich wecken. Meldete er sich nicht, würde man nachsehen, ob ihm etwas zugestoßen sei. Die erste Maschine, die nach jener Lufthansa-Boeing vom Flughafen Kairo aus Ägypten verließ, war eine Caravelle der Air France. Sie startete um 11 Uhr 30, viel zu spät.
Ich war schon dabei, ein weiteres Kuvert zu öffnen, da überlegte ich, daß ich ja keine Ahnung hatte, was für ein Pulver das war und ob jemand überhaupt noch einmal zu sich kommen würde, wenn er auch nur die ganze mit drei Pulvern versetzte Flasche austrank. Kam er nicht mehr zu sich, weil niemand in der Nähe war, der ihm helfen konnte, dann – nein!
Nein. Nein. Nein. – Das ging nicht.
Das durfte ich nicht riskieren. Ich mußte noch einen Menschen schnell und tief betäuben, daran war nichts zu ändern, doch ich durfte nicht seinen Tod verursachen. Mit Whisky und diesen mir unbekannten Pulvern konnte das aber ganz leicht geschehen. Also waren Pulver ausgeschlossen. Ich überlegte kurz, dann war mir eine andere Möglichkeit eingefallen. Ich stellte die Flasche, aus der mein Bruder getrunken hatte, wieder auf den Tisch, steckte die Schachtel mit den Pulvern ein und nahm die frische Johnnie-Walker-Flasche, von der ich den Stanniolverschluß abzog, damit ich den Korken später leicht herausbekam.
Die noch nicht angebrochene, schmale und viereckige Whiskyflasche verwahrte ich in der rechten Tasche des blauen Kamelhaarmantels. Dann verließ ich das Appartement. Der Schlüssel steckte im Schloß der inneren Eingangstür – schwer, mit einem großen Messinganhänger. Ich zog ihn heraus, sperrte von draußen ab, schloß auch die zweite Tür und steckte den Schlüssel in die linke Manteltasche. Der Lift zur Tiefgarage befand sich auf der Rückseite des Gebäudes. Es war ein weiter Weg. Ich fluchte leise vor mich hin. Die großen Aufzüge, die in die Haupthalle führten, wollte ich nicht benützen. Es hätte alles verderben können, wenn mich jetzt noch ein Portier oder ein Hausangestellter sah. Bei dem Garagenlift durfte ich ziemlich sicher sein, von niemandem gesehen zu werden, und auch wenn jener Wagenwäscher, der dem Mörder die Stahltür zur Straße gefälligerweise geöffnet hatte, den Schlüssel in der Zwischenzeit wieder zurückgedreht haben sollte – ich konnte ihn noch einmal drehen und die Tür noch einmal öffnen. Nur die hellerleuchteten Gänge, die ich nun entlanggehen mußte, waren so gottverflucht lang. Es war eben ein gottverflucht großes Hotel. Immerhin hatte bisher alles gut funktioniert, dachte ich, mich in Bewegung setzend, es würde auch weiterhin nichts passieren. Ich dachte das, weil ich mich nach dem Tod meines Bruders so sehr erlöst fühlte, doch ich hätte es nicht denken sollen, schon aus Aberglauben nicht. Kaum war ich losgewandert, da passierte natürlich prompt etwas.
Ich hörte auf einmal Lachen, Stimmen und Musik. In einem der Appartements, die vor mir lagen, fand anscheinend eine Party statt. Der Lärm war gedämpft, aber deutlich. Plötzlich war er laut. Fünf Meter vor mir hatte sich eine Tür geöffnet, und ein junges Mädchen in einem silbernen Cocktailkleid taumelte heraus. Die Tür fiel hinter ihr zu. Das Mädchen war groß, fast so groß wie ich, es hatte leuchtendrotes Haar, das über die Schultern herabfiel, und violette Augen. Es war ein sehr schönes Mädchen. Und es war, schien mir, ein sehr betrunkenes. Die Nacht des Whiskys, dachte ich. Whiskygefüllt mein toter Bruder. Whisky in meiner Manteltasche. Whiskygefüllt dieses sehr schöne Mädchen – sie mußte voll Whisky sein, denn ich roch kaum etwas, als sie mir nun in die Arme taumelte, nur ein wenig Whisky. Man kann Unmengen Scotch trinken und doch nur sehr wenig nach Alkohol riechen. Alle Säufer wissen das. Whisky ist der einzige Stoff, bei dem man nicht gleich zehn Meter gegen den Wind duftet. Dieses sehr schöne Mädchen duftete nach Parfüm, Jugend und heißer Haut. Und nur sehr wenig nach Whisky, so ungeheuer betrunken sie sich auch betrug.
Mein dicker blauer Kamelhaarmantel besaß keine Knöpfe, nur einen breiten Gürtel, den man binden konnte. Der Mantel war noch nicht geschlossen. Das sehr schöne Mädchen ließ sich gegen mich fallen und schlang die langen Arme heftig um meine Brust. Ihre Hände schlugen mit Wucht auf meinen Rücken. Synchron dazu steckte sie mir die Zunge in den Hals, daß ich beinahe erstickte, und preßte ihren Unterleib gegen meinen. Das sehr schöne Mädchen mit dem flammendroten Haar zog die Zunge zurück und sagte kräftig lallend folgendes in englischer Sprache: »Jetzt habe ich dich endlich wieder. Jetzt kommst du mir nicht mehr davon. Jetzt machst du’s mir. Du hast’s versprochen. Du hast gesagt, du machst es mir. Los, los, nun mach schon!«
Ich hatte dieses Mädchen noch nie im Leben getroffen und keine Ahnung, wer sie war. Eine Nutte nicht, das sah man. Reich, das sah man auch, wenn man ihren Schmuck betrachtete. Und betrunken. Allmächtiger, war dieses Mädchen betrunken!
»Also machst du’s mir, oder machst du’s mir nicht?« fragte sie laut und wild und rieb immer weiter ihren Unterleib gegen meinen. Aus dem Appartement, in dem gefeiert wurde, ertönte jetzt die Stimme Louis Armstrongs: »… oh, how I long to be in that number, when the saints go marching in …«
Das war absolut lebensgefährlich. Ich mußte hier weg. Das sehr schöne Mädchen nahm meine Hände und preßte sie sich gegen die Brüste. Die Warzen waren groß und hart wie Haselnüsse.
»Also?«
»Ja doch«, sagte ich schnell, »ja doch, Sweetie, klar mach ich es dir, na was denn!«
In ihre Augen trat sanfter Wahnsinn. Sie hielt mich für irgendwen, der versprochen hatte, es ihr zu besorgen, vielleicht war es auch gar niemand, und die junge Dame nur einfach sinnlos voll und hinüber; aber das alles war ohne Bedeutung. Ich mußte hier weg.
»Komm«, sagte ich.
»Wohin?« Sie rührte sich nicht. Wenn aus diesem Appartement noch jemand trat …
»In mein Zimmer.«
»Willst mich nur ’reinlegen und wieder verschwinden. Mich legst du nicht zweimal ’rein!« Damit packte sie die schmalen Revers meines Mantels, und mit der Kraft ihrer Trunkenheit zerrte sie so heftig an ihnen, daß der rechte Aufschlag knirschend riß. Das Revers hing nun herab. Ich hätte diesen Rotkopf gerne geschlagen, aber das ging nicht.
»Bist du verrückt?« zischte ich zornig.
»Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Ich kauf dir einen neuen Mantel, wenn du’s mir gemacht hast.«
»Hier auf dem Gang, ja?«
»Hier auf dem Gang. Jawohl. Du willst nicht? Soll ich schreien?« Sie öffnete den Mund, aber diesmal steckte ich meine Zunge hinein und drückte sie an mich. Sie begann zu stöhnen, machte sich plötzlich etwas von mir los und griff an meine Hose.
»Oh«, sagte sie und wurde so weiß im Gesicht, wie mein Bruder jetzt war, »o Gott. Oh, Darling, Darling, Darling! Ist er das?«
»Ja«, sagte ich und hoffte inbrünstig, sie möge der Sache nicht genauer nachgehen und herausfinden, daß es der Schalldämpfer der 38er war, der sie so begeisterte.
»O barmherziger Vater im Himmel«, sagte der Rotkopf. »O Maria, Mutter Gottes, und ist das auch die Wahrheit? Das ist er wirklich?«
»Ja«, sagte ich und fühlte, wie mir der Schweiß ausbrach.
»Ich werde ohnmächtig«, sagte der Rotkopf. Wenn du das bloß würdest, dachte ich. »Ich werde ganz bestimmt und sofort ohnmächtig, sofern du es mir nicht so schnell wie möglich machst.«
Sie sagte wahrhaftig ›provided‹.
»Dann komm endlich«, sagte ich und riß sie brutal fort. Sie taumelte hinter mir her. 1 Uhr 24 zeigte eine Uhr im Gang. Ich rannte mit dem Rotkopf, dessen Hand ich eisern festhielt, los. Sie folgte mir taumelnd und schlingernd. Sie war groß und schwer, und ich mußte dauernd achtgeben, daß sie mich nicht umschmiß. Wenn uns jetzt jemand sah, konnte ich auch auf betrunken spielen, dachte ich. Es sah uns niemand. Wir erreichten den Gang auf der Rückseite des Hotels. Wir erreichten den Tiefgaragenlift. Der Aufzug war unten. Vermutlich hatte er zuletzt den Mörder befördert. Ich drückte auf eine Taste. Der Aufzug kam herauf.
»Wo bringst du mich hin?« fragte das sehr schöne Mädchen. Es lehnte an der Wand und rang nach Luft.
»Na, in mein Zimmer.«
Der Aufzug erschien. Ich öffnete die Lifttür, stieß den Rotkopf vor mir her, die Tür fiel hinter uns zu, und ich preßte einen Finger auf den Knopf für den vierten Stock. Sie sah es.
»Vierter Stock wohnst du?«
»Ja.« Der Aufzug glitt abwärts.
»Zeig ihn mir.«
»Gleich.«
»Ich will ihn sofort sehen!«
»Wir sind sofort bei mir.«
»Aber …« Der Lift hielt im vierten Stock. Ich öffnete die Tür, stieß das sehr schöne Mädchen auf den Gang hinaus, wo es still umfiel, riß die Tür zu und drückte auf den Knopf für die Tiefgarage. Der Aufzug sank weiter. Ich lauschte, aber ich hörte nichts mehr von dem sehr schönen Mädchen, nicht das geringste. Fein, dachte ich. Weh getan hat sie sich gewiß nicht. Vielleicht schläft sie da oben auf dem Gang, bis die Schuhputzer kommen, vielleicht findet sie früher jemand. Aber etwas Vernünftiges aus ihr herausbekommen wird keiner. Noch lange nicht. Dieses sehr schöne Mädchen war wirklich viel zu betrunken.
1 Uhr 27 zeigte meine Armbanduhr.
Der Aufzug hielt. Ich griff auf alle Fälle mit der linken Hand nach dem Kolben der 38er, bevor ich die Tür öffnete. Niemand war zu sehen. Unter mir hörte ich Männerstimmen, Gehämmer und das Geräusch von spritzendem Wasser. Mit einem Sprung war ich bei der Stahltür. Der Schlüssel steckte.
Diese Nacht war kühl in Kairo.
Tief und schnell segelten die schwarzen Wolken über den Himmel, es roch nach Regen, und es war unangenehm böig. Ich trat auf den Midan el-Tahrir hinaus, den Platz hinter dem Hotel, steckte zwei Finger in den Mund und hielt sie dann, aneinandergelegt, gegen Osten in die Luft. Wo Osten war, wußte ich. Die Innenseite der beiden Finger wurde eiskalt. Das beruhigte mich. Also hatte meine Maschine, die von Osten kam, Rückenwind und würde pünktlich sein. Hoffentlich.
1 Uhr 31.
Der Midan el-Tahrir ist ein Ungetüm von einem Platz. Zehn Avenuen münden in ihn, rundum stehen verschiedene Ministerien, die Amerikanische Universität und, an der Nordseite des ›Befreiungsplatzes‹, das berühmte Ägyptische Museum. Im Zentrum erhebt sich das Befreiungsmonument, der ›Tahrir‹.
Ich ging, an der Hotelmauer entlang, schnell auf das Museum zu. Hier standen sehr viele Neonlichtpeitschen, die ihr starkes, helles Licht auf die Gebäude und die gepflegten Anlagen des Midan el-Tahrir warfen. In Riesenbeeten wuchsen viele bunte Blumen, und edle Sykomoren, Tamarisken und Palmen bogen sich in dem kurzen, stoßenden Wind und ließen ihr Laub, ihre Fächer und ihre Wedel rauschen.
Es waren noch Menschen und Autos unterwegs, wenn auch nicht sehr viele. Unterwegs waren, in Rudeln, nur die kleinen Jungen, die man rund um jedes internationale Hotel in Kairo praktisch zu jeder Tages- und Nachtstunde antrifft. Sie wollen alle dasselbe, und sie müssen gute Geschäfte machen, sonst würden sie nicht so ausdauernd herumlungern.
Schon kam einer dieser Kerle auf mich zugerannt. Der kleine Araber war höchstens zwölf Jahre alt, hatte das Gesicht eines zynischen Vierzigers und böse taxierende Augen. Er feixte, als er in grausigem Englisch fragte, ob er mich zu seiner Schwester führen solle. Sie sei erst zehn Jahre alt und noch Jungfrau. Der Junge hatte mich aus dem Hotel kommen sehen. An der Rückseite gab es eine Bar, die ich eben passierte und vor der auch ein paar Jungen lauerten. Sie lauern überall, sie wissen genau, früher oder später werden sie ein Opfer abschleppen.
Ich stieß den kleinen Kerl weg, der versuchte, mich am Weitergehen zu hindern, und beschimpfte ihn mit den wenigen arabischen Worten, die ich kannte. Er ließ sich ruhig puffen und stoßen und blieb getreu an meiner Seite. Jetzt fragte er mich, in einem ganz grausigen Französisch, ob er mich zu seinen beiden Schwestern führen solle. Die seien Zwillinge und erst zehn Jahre alt und noch Jungfrauen. Ich schlug nach ihm, aber er wich geschickt aus und verfolgte mich weiter. Ich hatte nun das Ägyptische Museum erreicht, bog nach links und kam durch eine schmale Seitenstraße auf die Nile Corniche – direkt vor die Semiramis-Brücke, die zu der Insel Gezireh hinüberführt, wo ich jetzt hin mußte. Hier war es besonders hell. Die Fassade des ›Imperial‹ wurde angestrahlt, und alle Lichter der Corniche brannten. Ich überquerte den Damm und sah Damen in Nerzmänteln und Stolen und Herren in Abendkleidung beim Hoteleingang. Autos fuhren vor und ab, und Jungen lungerten natürlich in der Nähe. Nicht einmal die Polizei richtete etwas gegen sie aus.
Mein Freund begleitete mich immer noch brav. Ich war jetzt schon auf der Brücke mit ihren vielen Kandelabern, und der kleine Araber fragte mich, in beinahe einwandfreiem Deutsch, ob ich Interesse an seinem elfjährigen Bruder hätte. Ich trat nach ihm, und wieder wich er geschickt aus und versicherte in gutem Deutsch, wenn ich wollte, stünde auch er mir zur Verfügung. Mit Deutschen schien er am häufigsten ins Geschäft zu kommen, aber mich hielt er offenbar für keinen Deutschen.
Ich hatte jetzt genug. Ich sah, daß ich mit Stoßen und Fluchen nicht weiterkam, also zog ich den Jungen an einem Ohr zu mir empor, bis er jaulte, und als ich eben zu sprechen beginnen wollte, kam ein großer amerikanischer Wagen von der Insel herüber und bremste direkt neben mir.
Ein Mann steckte den Schädel aus dem Fenster an seiner Seite. Er hatte fröhliche Augen und sehr kurzgeschnittenes hellblondes Haar, eine typische amerikanische Igelfrisur.
»Got yourself into trouble with that little son-of-a-bitch, Mister?« fragte er freundlich. Ich stand unter einer Kandelaberlampe der Brücke, es war auch hier hell, und ich sah den jungen Amerikaner sehr genau. Er mich auch. Ich sagte zuerst englisch und danach deutsch, damit der Knabe mich auch verstand, daß ich belästigt worden sei und den Jungen nun zur Polizei bringen würde. Der Amerikaner am Steuer des Chevrolets griff hinter sich und öffnete grinsend den zweiten Wagenschlag.
»Okay, Mister. Get that little bastard in there. I’ll glady help you bring him to the cops.«
Das genügte.
Der Junge riß sich los und rannte, so schnell er konnte, zur Corniche zurück.
»Thanks«, sagte ich zu dem Amerikaner.
Wir sahen uns lächelnd an. Dann bemerkte er etwas.
»He! Was ist mit Ihrem Mantel passiert?«
»Wieso?«
»Na, das Revers! Hat die kleine Kröte das getan?«
Ich sah meinen Kamelhaarmantel an. Der Aufschlag, den das sehr schöne, sehr betrunkene Mädchen im ›Imperial‹ ein wenig zu fest gepackt hatte, hing trist herab. Ich hatte das schon völlig vergessen gehabt.
»Die kleine Kröte, ja«, sagte ich eilig auf englisch.
»Na, so können Sie aber nicht herumlaufen, Mister!«
»Aber ja doch.«
»Aber nein doch!« Der Amerikaner hatte schon das Handschuhfach des Chevrolets geöffnet. Er suchte. »Da liegt immer ein Haufen Zeug … warten Sie mal, wir versuchen es damit.« Er öffnete den Schlag und trat vor mich hin.
»Wirklich …«, begann ich noch einmal, aber es hatte keinen Sinn.
»Moment, Moment, gleich haben wir das«, sagte der junge Amerikaner. Er hielt ein etwa fünf Zentimenter langes Drahtstück in der Hand, das er in dem Wagenfach gefunden hatte. Entwaffnend grinsend, bohrte er den Draht von der Innenseite durch den Reversstoff und befestigte ihn tatsächlich mit ein paar vorsichtigen Stichen. Wir standen uns sehr dicht gegenüber. Amerikaner sind wahrhaftig die hilfsbereitesten Menschen von der Welt, dachte ich. Zur Hölle mit allen hilfsbereiten Menschen. Mach. Mach schon! Der Amerikaner, der so groß wie ich war, bog das Drahtstück am oberen und unteren Ende in den Stoff, damit ich mich nicht verletzen konnte, sah mich zufrieden an und sagte etwas Komisches, worüber er sehr lachen mußte. Ich lachte pflichtschuldig mit. Ich habe keine Ahnung mehr, was er sagte. Ich bedankte mich wieder.
»Don’t mention it. Can I give you a lift?«
»You are driving in the other direction.«
»So what? I can turn around.« Das fehlte noch.
»I’d really rather walk. Thanks again.«
»That’s all right«, sagte er, kletterte in seinen Chevy und fuhr weiter zur Corniche. Dort bog er nach rechts. Ich sah den Wagen am Portal des ›Imperial‹ vorübergleiten, dann verschwand er.
Ich ging nun schnell.
In der Mitte der Brücke – sie ist dreihundertfünfzig Meter lang, und der Ostwind fauchte dort kräftig – warf ich den Appartementschlüssel und die Schachtel mit den Schlafpulvern in den Nil. Auf der Insel angekommen, blieb ich beim Eingang des Andalusischen Gartens kurz stehen, um zu horchen. Niemand folgte mir. Der Garten lag rechts. Ich wandte mich nach links und hastete eine romantisch erleuchtete Palmenallee hinab, auf den Palast des Exmonarchen Faruk zu.
1 Uhr 52.
Jetzt lief ich, wobei ich darauf achtete, daß mir die Whiskyflasche nicht aus dem Mantel fiel. Von der Straße zweigten vor dem Lustschloß an der Inselspitze eine Menge Wege in Wäldchen und Buschwerk hinein ab. Auf der Allee brannten die romantischen Laternen. In den Seitenwegen war es finster. Ich wußte, in welchem Seitenweg Lillian wartete – er lag in unmittelbarer Nähe des Palastes. Ich wußte auch, daß ich nicht in diesen Weg laufen durfte, weil ich dann von vorn an den Wagen herangekommen wäre, der da parkte. Also bog ich einen Pfad früher nach rechts ab und machte einen kleinen Bogen durch Gebüsch und Unterholz zu dem anderen Weg hinüber. Dort sah ich, unbeleuchtet, einen schwarzen Mercedes stehen. Ich holte die 38er aus der Halfter, wickelte ein Taschentuch um ihren Griff und steckte den Schalldämpfer wieder auf. Dann schlich ich mich von hinten – ich trug wieder die Slipper mit den Gummisohlen – an den Mercedes heran. Der Wind machte hier in den Ästen und dem Laub und den Palmenwedeln eine Menge Lärm, und das war gut so.
Bevor ich den Wagen erreichte, ging ich in die Knie und bewegte mich nun so, auf allen vieren, weiter zu dem linken vorderen Wagenschlag. Dann hob ich sehr langsam und vorsichtig den Kopf, bis ich Lillian erblickte. Sie saß auf dem rechten Vordersitz und sah starr auf die Allee hinaus. Sie wartete – genau nach Verabredung. Lillian trug einen Leopardenmantel. Ihre langen Haare waren schwarz wie ihre Augen mit den langen Wimpern, die Backenknochen traten vor, der Mund war breit, die Lippen waren voll und sinnlich, und ich dachte, daß ich in meinem ganzen Leben nur eine einzige Frau wirklich geliebt hatte und immer weiterlieben würde, und das war sie, war Lillian, die da saß und wartete. Ich glaube, ich habe sie nie so sehr geliebt wie in dem Augenblick, da ich hochfuhr und den Schlag aufriß. Mit einem unterdrückten Schrei wandte Lillian den Kopf. Sie konnte in der Dunkelheit nicht viel sehen, nur eben, daß ich hinter das Steuer glitt. Sie sagte atemlos: »Gott sei Dank, Liebster. Es ist also alles gutgegangen. Ich hatte schon …«
Weiter kam sie nicht, denn da schlug ich ihr bereits den umwickelten Kolben der 38er auf den Schädel. Nicht zu hart, aber doch ziemlich hart, denn ich konnte jetzt weder Geschrei noch einen Kampf, noch ihre Fingernägel in meinem Gesicht brauchen. Der erste Schlag warf sie nach vorn. Sie stöhnte laut. Ich riß sie an den Haaren hoch und schlug noch einmal zu, diesmal mit der Faust gegen ihr Kinn. Die 38er hatte ich auf das Armaturenbrett gelegt. Nun warf ich mich über Lillian und hielt ihr mit der linken Hand den Mund zu. Mit der rechten Hand holte ich die Johnnie-Walker-Flasche hervor und drückte den Kork heraus. Ich preßte Lillians Nasenflügel zwischen Daumen und Zeigefinger meiner linken Hand zusammen, so fest ich nur konnte. Ihr Körper bäumte sich auf, und sie öffnete den Mund. Sie brauchte Luft, um nicht zu ersticken.
Darauf hatte ich gewartet.
Ich stieß ihr den Hals der Whiskyflasche zwischen die Lippen und zog Lillians Kopf an den Haaren weit nach hinten. Nun kniete ich auf ihrem Sitz, zwischen ihren gespreizten Schenkeln, der Leopardenmantel hatte sich geöffnet, das grüne Wollkleid darunter war zerrissen. Sie wand sich, ihre Glieder fuhren hin und her, sie schüttelte wild den Kopf, Glas klirrte gegen ihre Zähne, aber ich hatte die Flasche schon gehoben, und der Whisky floß heraus, floß in Lillians Kehle. Natürlich floß er auch über ihr Kinn und ihre Kleider, sie würgte und spuckte, ich bekam einiges ab, aber dann trank, trank, trank sie verzweifelt in ihrem panischen Schrecken, ihrer wahnsinnigen Gier nach Luft. Als ich fühlte, daß sie plötzlich zusammensackte, zog ich die Flasche schnell zurück. Sie durfte nicht ersticken. Ich beobachtete Lillian scharf, wie sie röchelnd nach Atem rang, Luft, Luft gierig einsog mit aufgerissenem Mund, und dieses verzerrte Gesicht erinnerte mich an das erste Mal, da sie nackt in meinen Armen gelegen hatte, verzerrten Gesichts, nach Luft ringend, mit einem Ausdruck, als würde sie gefoltert, als der Höhepunkt kam. Vor einer Ewigkeit war das gewesen, vor so vielen, vielen Jahren, und dann immer wieder, immer wieder und immer wieder hatte sie ausgesehen, als ob sie entsetzlich litte, wenn sie selig, völlig selig gewesen war …
Nun richtete sie sich etwas auf. Sofort riß ich ihren Kopf wieder zurück und hob die Flasche. Ächzend und würgend begann sie zu husten. Ich preßte ihre Nase zu und steckte ihr den Flaschenhals noch einmal in den Mund, und plötzlich vernahm ich geisterhaft Musik und die heimwehkranke Stimme von Doris Day: »When I hear that serenade in Blue …«
Das war unser Lied gewesen, vom ersten Tag an, und es war unser Lied geblieben bis heute, und ich dachte, daß ich jetzt nicht den Verstand verlieren durfte über allem, was geschah, doch die Stimme von Doris Day, Geigen und Schlagzeug klangen weiter und weiter in meinen Ohren, ich konnte nichts dagegen tun.
When I hear that serenade in Blue, I’m somewhere in another world alone with you. Lillian wehrte sich, aber viel weniger als das erste Mal, und wieder ließ ich sie Whisky trinken, trinken, trinken. Sharing all the joys we used to know – many moons ago. Ich hatte Angst, daß die Flasche nicht ausreichen würde. Sie reichte aus. Lillian sank plötzlich nach rechts gegen das Wagenfenster. When I hear that serenade in Blue. Ich glitt auf den Sitz hinter dem Steuer zurück, ließ die leere Flasche fallen und packte die 38er wieder am Lauf. Lillians Augen waren offen, aber so verdreht, daß ich fast nur das Weiße sah. Sie lallte. Ihr Make-up war verschmiert, ihr Haar stand wirr vom Kopf, der Mantel war besudelt, das zerrissene Wollkleid darunter feucht am Hals. Just like the theme of some forgotten melody, in the album of my memory. Doris Days Stimme in meinen Ohren, die Geigen, das Schlagzeug, eine Trompete voller Wehmut. Ich war nicht verrückt. Ich war nicht verrückt. Ich hörte das Lied nur, weil ich Lillian liebte, sie, sie, nur sie, sagte ich zu mir und schlug ihr den Pistolengriff gegen das Kinn, und danach war sie weg. Sie sackte zusammen und rührte sich nicht mehr. Ich hatte keine andere Wahl gehabt ohne die Schlafmittel. Aus dieser Bewußtlosigkeit würde sie nach Stunden, wenn der große Whiskykonsum mit seiner narkotisierenden Wirkung nachgelassen hatte, von selber wieder erwachen, ohne fremde Hilfe. Sie war eine ordentliche Trinkerin. Es stand nicht zu befürchten, daß sie einer Alkoholvergiftung erlag. Nein, keine Schlafmittel. Diese Methode war die einzig sichere gewesen – für sie und für mich. It seems like only yesterday, a small café, a crowded floor, and as we danced the night away, I heard you say: Forever more …
Ich legte ein Ohr an Lillians linke Brust und fühlte ihren Puls. In Ordnung. Ich überlegte, ob ich den Sitz zurückklappen und sie liegend transportieren sollte, damit es noch ungefährlicher für sie blieb; aber dann sah ich, daß der Fond voller Gepäck war. Das hatte ich vergessen. Es war sehr viel Gepäck in dem Mercedes, auch im Kofferraum. Ich konnte den Sitz nicht zurückklappen. So legte ich einen Sicherheitsgurt um Lillian und schnallte sie fest, damit sie nicht nach vorn fallen konnte, und dann wartete ich eine Viertelstunde, um zu sehen, ob sie nicht doch noch einmal zu sich kam. Und ich hörte Gesang und Musik in dieser Viertelstunde, und ich dachte an Vergangenheit, so viel Vergangenheit.
And then song became a sigh, forever more became good-bye. Keine Schlafmittel, Lillian. Du wirst erwachen. Ich habe dich nicht getötet. Es heißt, daß die Menschen stets töten, was sie lieben. Ich nicht, Lillian, ich nicht. So tell me darling, is there still a spark? Oh, only lonely ashes of the flame we knew. Verlorene Asche nur der Flamme, die wir kannten. Should I go an wishing in the dank? Serenade in Blue …
Lillian kam nicht mehr zu sich. Der Alkohol tat nun schon seine Wirkung. Es war 2 Uhr 17, als ich den Motor startete, die Scheinwerfer aufflammen ließ und losfuhr. Wenn Polizei uns anhielt, konnte jedermann sofort sehen, daß Lillian nur betrunken war. Ich würde sagen, ich brächte sie heim. Ihr Kopf schwankte hin und her, während ich die Palmenallee zurück zur Semiramis-Brücke fuhr. Nur betrunken. Betrunken nur, meine Lillian. Der Wagen stank nach Whisky. Es war ein Leihwagen. Sie hatte ihn gemietet. And as we danced the night away, I heard you say: Forever more …
»Meine Damen und Herren, im Namen unseres Kapitäns und seiner Besatzung heiße ich Sie an Bord unserer Boeing 720 B herzlich willkommen. Wir reisen in einer Höhe von dreißigtausend Fuß mit einer Geschwindigkeit von neunhundert Stundenkilometern. Um fünf Uhr fünfundvierzig Ortszeit werden wir auf dem Leonardo-da-Vinci-Flughafen von Rom landen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug …«
Die Stimme der Stewardeß erklang noch einmal in italienischer und in englischer Sprache über die Bordlautsprecher, dann erschien sie selbst, ein braunhaariges, rehäugiges Mädchen. Sie kam aus dem Cockpit der Maschine. In Kairo hatte die gesamte Crew gewechselt. Die Stewardeß war noch sehr jung und sehr ausgeruht und sehr eifrig, und sie trug eine Passagierliste bei sich.
Ich flog erster Klasse. Diese befand sich vorn, die Touristenklasse, fast dreimal so groß, hinten; dazwischen war ein Trennvorhang. Erster Klasse reisten nur vier Passagiere: zwei ältere Japanerinnen in kostbaren Kimonos, ein weißhaariger Negerpriester und ich. Ich war in Kairo als einziger neuer Passagier der ersten Klasse an Bord gekommen. Die junge Stewardeß trat mit ihrer Liste zu mir, offenbar wollte sie alle neuen Passagiere begrüßen. In der Touristenklasse gab es eine. Menge. Hier vorn war es sehr bequem, man hatte viel Platz. Die japanischen Damen sahen sehr müde aus, der weißhaarige Negerpriester las in seinem Brevier. Wir hatten die schwarzen Wolken steil durchstoßen und flogen nun über ihnen.
Die Stewardeß hatte mich erreicht, sie neigte sich lächelnd vor: »Herr Peter Horneck, nicht wahr?«
»Erraten!«
»Oh, das war nicht schwer. Sie sind der einzige Deutsche, der in Kairo an Bord kam, wissen Sie. Sie sind doch Deutscher?«
»Ja.«
»Kann ich etwas für Sie tun, Herr Horneck?« Die Stewardeß roch frisch nach Seife und Parfüm. »Kaffee? Tee? Milch?«
»Später vielleicht.«
»Darf ich Ihnen etwas zu lesen bringen?«
»Vielen Dank«, sagte ich und wies auf die Zeitung, die ich über eine dunkelblaue Reisetasche gelegt hatte. Die Tasche stand auf dem leeren Sitz neben mir. »Ich habe zu lesen.«
Sie nickte mir lächelnd zu und ging dann nach hinten in die Touristenklasse, wo eine Kollegin und ein Steward sich aufhielten, und ich nahm die Ausgabe der ›Stuttgarter Allgemeinen Zeitung‹ vom vergangenen Mittwoch und entfaltete sie, denn diese Zeitung war mein Erkennungszeichen, und ich mußte nur warten, bis der Mann von der internationalen Nachrichtenagentur ›American Press Service‹ kam und mich ansprach. So hatte ich das vor zwei Tagen mit den Leuten vom Kairoer Büro des ›American Press Service‹ verabredet – telefonisch aus einer öffentlichen Fernsprechzelle, denn es wäre lebensgefährlich gewesen, jemanden von APS zu treffen oder das Büro aufzusuchen oder von einem Hotel aus anzurufen. Von einer Zelle aus zu rufen war nicht gefährlich. In der Telefonzentrale des APS-Büros Kairo gab es einen kleinen Apparat, der Gespräche für jeden Dritten, der die Leitungen anzapfte, unverständlich zerhackte.
Ich hatte mit einer Dame gesprochen. Sie hatte mir gesagt, daß ich die ›Stuttgarter Allgemeine Zeitung‹ kaufen und als Erkennungszeichen aufheben solle. Es gab die großen deutschen Blätter am Zeitungsstand des ›Imperial‹, und so hatte ich also eine SAZ gekauft.
»Das Material darf uns natürlich nicht auf ägyptischem Hoheitsgebiet übergeben werden«, sagte die Frauenstimme bei meinem Telefonat mit dem Büro von APS.
»Natürlich nicht.«
»Das geht erst, wenn Sie aus Ägypten draußen sind.«
»Im Flugzeug?«
»Im Flugzeug. Unser Mann fliegt mit. Selbstverständlich müssen Sie uns rechtzeitig noch einmal anrufen und mitteilen, welche Maschine Sie nehmen. Unser Mann wird als sein Erkennungszeichen Ihre Partitur der Neunten Symphonie von Beethoven bei sich tragen.«
»Meine Partitur?«
»Die Sie von illustrer Seite zum Geschenk erhielten, ja.«
»Aber … aber wie kommen Sie zu der?« frage ich verblüfft. »Ich habe sie doch …«
»… bei Ihrem Freund Boris Minski in Frankfurt gelassen, ja.«
»Und?«
»Und Ihr Freund Minski gab sie Homer Barlow, als er erfuhr, in welcher Lage Sie sich befinden, und Barlow schickte sie uns. Sie kennen Ihre Partitur doch gut. Barlow meinte, wenn unser Mann sie als Erkennungszeichen trägt, werden Sie ihm unbedingt vertrauen.«
Boris Minski und Homer Barlow …
Es hatte mich mit heißer Freude erfüllt, ihre Namen zu hören. Ich bin nicht allein – das war mein erster Gedanke gewesen. Nicht allein.
Seit diesem Anruf hatte ich wieder Mut gefaßt und beschlossen zu kämpfen. Ich hatte gekämpft. Erfolgreich. Ich war ganz sicher, daß ich meine Partitur sofort wiedererkennen würde: ein kostbares, seltenes Stück – ein Exemplar der Erstausgabe von 1824, in Leder gebunden, mit einem Titelblatt, auf dem das Werk Seiner Majestät König Friedrich Wilhelm III. von Preußen zugeeignet war. Ich würde leicht feststellen können, ob es sich auch ganz bestimmt um jenes Exemplar handelte, das ich bei Boris Minski zurückgelassen hatte, denn in diesem Exemplar war dem Drucker ein Unglück widerfahren. Das Chorfinale des Vierten Satzes, dessen Text der Schillerschen ›Ode an die Freude‹ entlehnt war, lautete im ersten Absatz, soweit von Beethoven benutzt:
Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium!
Wir betreten feuertrunken
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt.
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.
Nun, in meinem Exemplar, dessen Chortext unter den Noten natürlich noch in altertümlicher Rechtschreibung (Heiligthum, getheilt) stand, war beim Druck ein kleines Malheur passiert: In der zweiten Vokalvariation der Freudenmelodie fehlte die Verszeile ›Alle Menschen werden Brüder‹. Ich wußte, wo sich diese Stelle befand. Es würde alles ganz einfach werden, wenn der Mann von APS kam und sich zu mir setzte. Ganz einfach würde es werden, und wieder sollte ich ein großes Stück weiter sein, fast schon am Ziel, denn dann hatte der Mann von APS die blaue Reisetasche und ihren Inhalt, und was niemand erfahren hätte um ein Haar, würde dann die ganze Welt erfahren, und das bedeutete, daß ich einmal, einmal! Sieger war und nicht mein Bruder. Mit seinem Tod allein hatte ich noch nicht gesiegt. Erst wenn die Nachrichtenagentur APS melden und beweisen konnte, was geschehen war, stand fest, daß einmal mein gottverfluchter Bruder einen Bruderkampf verloren hatte – und nicht ich. Aber noch kam der Mann von APS nicht. Noch mußte ich warten. Die japanischen Damen schliefen, Köpfe aneinandergelehnt, der Negerpriester mit dem weißen Haar las lautlos die Lippen bewegend in seinem Brevier. Ich stützte die Ellbogen auf die Armlehnen meines Sitzes und begann in der SAZ zu lesen.
KIESINGER VERKÜNDET EIN PROGRAMM DER WIRTSCHAFTSBELEBUNG UND STABILITÄT.
Die Regierungserklärung des neuen deutschen Kanzlers. Wir hatten eine neue Regierung, ein Koalitionskabinett gebildet, von CDU, CSU und SPD. Als die Geschichte, die ich hier niederschreibe, begann – wenn eine Geschichte überhaupt jemals beginnt, was ich bezweifle –, besser gesagt also, als diese Geschichte in ihr akutes Stadium getreten war, da hatten wir noch keine neue Regierung in der Bundesrepublik gehabt, aber eben Landtagswahlen in Bayern.
Die NPD, die ›Nationaldemokratische Partei Deutschlands‹, hatte bei jenen Wahlen spielend die Fünf-Prozent-Klausel übersprungen und war gleich mit fünfzehn Sitzen in den Landtag eingezogen. In Hessen saß sie schon darin. Ich dachte an jene Nacht, da ich mit Boris Minski über diese Wahlen gesprochen hatte. Im ›Strip‹ war das gewesen, jenem Frankfurter Nachtklub, der uns beiden gehörte. Während der ersten Morgenstunden des 22. November 1966, eines Dienstags, hatten wir da debattiert.
Am 22. November!
Erst vor so kurzer Zeit, so kurzer Zeit. Was über meinen Bruder, Lillian, Minski, mich, über uns alle hereingebrochen war, hatte sich also in vierundzwanzig Tagen abgespielt – und ich erinnerte mich genau daran, o ja, genau an alles und an jene Nacht ganz besonders klar, an den Moment, da der Anruf kam, an mein Entsetzen und den Schmerz, der mich durchzuckt hatte, in dem Büro unseres Klubs, den Telefonhörer am Ohr. Damals war in Sekunden meine ganze Vergangenheit auferstanden: meine und die anderer Menschen, geliebter, gehaßter, die Vergangenheit von Freunden und Feinden. Damals, in jenen ersten Morgenstunden des 22. November hatte der Schneeball zu rollen begonnen, aus dem in unfaßbarer Eile eine Lawine geworden war, die Unheil, so viel Unheil angerichtet hatte.
Drei Wochen und drei Tage: Und mir schien, als liege mein ganzes Leben zwischen diesem 22. November und heute, diesem 16. Dezember. In einem bestimmten Sinn war das auch so. Denn was nun folgen sollte, würde ein neues Leben sein, wenn ich Glück hatte, völlig verschieden von meinem bisherigen. Alles Bisherige war tot, nichts davon würde, sollte, durfte ich mit mir nehmen. Allzuviel und allzu Schreckliches war geschehen, in so kurzer Zeit, drei Wochen und drei Tagen.
KIESINGER SCHILDERT GEGENWÄRTIGE FINANZLAGE IN DÜSTEREN FARBEN – STEUERERHÖHUNGEN UNVERMEIDLICH – DAS DEUTSCHE VOLK WIRD OPFER BRINGEN MÜSSEN …
Ich las ein Stück des Leitartikels.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: