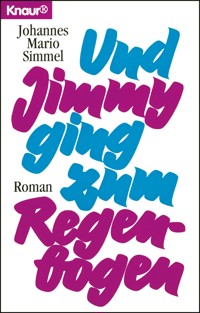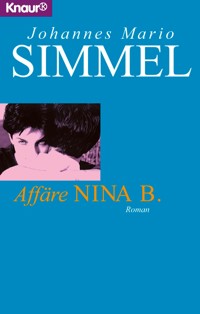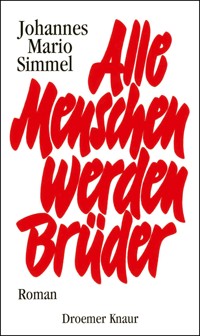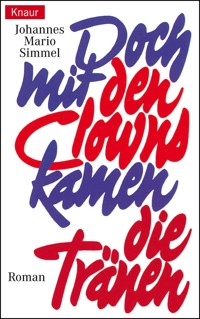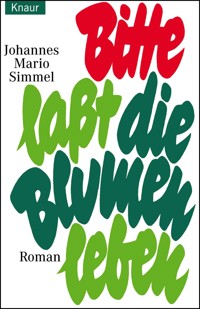6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Niemand ist eine Insel" – diese Worte spricht Sylvia Moran, die schönste Frau und größte Schauspielerin des internationalen Films, bei einer grandiosen Wohltätigkeits-Gala in Monte Carlo. Wenige Jahre später, zur gleichen Zeit, da diese Frau mit ihrem neuesten Film einen Triumpf ohnegleichen erlebt, wird sie wegen Mordes angeklagt. Ihr Motiv stellt Staatsanwalt, Richter und Verteidiger vor ein Rätsel, und das umso mehr, als Sylvia Moran auf ihrer Selbstbezichtigung beharrt. Wie es zu dem Mord gekommen ist, lässt Johannes Mario Simmel den "ständigen Begleiter" des Stars, Philip Kaven, in einer Beichte erzählen, die jeden, der sie liest, von der ersten bis zur letzten Zeile in atemloser Spannung hält.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1161
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Johannes Mario Simmel
Niemand ist eine Insel
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»Niemand ist eine Insel« – diese Worte spricht Sylvia Moran, die schönste Frau und größte Schauspielerin des internationalen Films, bei einer grandiosen Wohltätigkeits-Gala in Monte Carlo. Wenige Jahre später, zur gleichen Zeit, da diese Frau mit ihrem neuesten Film einen Triumpf ohnegleichen erlebt, wird sie wegen Mordes angeklagt. Ihr Motiv stellt Staatsanwalt, Richter und Verteidiger vor ein Rätsel, und das umso mehr, als Sylvia Moran auf ihrer Selbstbezichtigung beharrt. Wie es zu dem Mord gekommen ist, lässt Johannes Mario Simmel den »ständigen Begleiter« des Stars, Philip Kaven, in einer Beichte erzählen, die jeden, der sie liest, von der ersten bis zur letzten Zeile in atemloser Spannung hält.
Inhaltsübersicht
Vorbemerkung
Motto
Aktenzeichen: 5 Js 422/73
Symptom
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
Diagnose
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
Therapie
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
Der Autor erklärt, daß ihn der in allen Ländern der Erde seit vielen Jahren von Experten und Laien, von kirchlichen und staatlichen Stellen und von sämtlichen Massenmedien mit größter Leidenschaft geführte Kampf um die Lösung eines weltweiten Problems angeregt hat, diesen Roman zu schreiben. Gerade jenes Problem zeigt die Hilflosigkeit des Menschen bei der Bewältigung seiner Situation und die Blindheit gegenüber Gefahren, denen er sich aussetzt.
Der Autor erklärt, daß dennoch alle Geschehnisse und alle Personen dieses Romans völlig frei erfunden sind – mit Ausnahme einiger Personen und Ereignisse der Zeitgeschichte. Hier wurden manchmal Namen, Orte und Daten verändert.
Absolut der Wahrheit entsprechend dagegen ist die Schilderung sämtlicher Milieus, Einrichtungen, Untersuchungs-, Behandlungs- und Arbeitsmethoden. Hier wurden Fachleute zu Rate gezogen, oder der Autor war mit den Usancen der Filmindustrie aus eigener Erfahrung hinlänglich vertraut.
Der geschilderten ›Sonderschule Heroldsheid‹, die es nicht gibt, diente die ›Sonderschule Garatshausen‹ am Starnberger See in Bayern als Vorbild. Es versteht sich von selbst, daß kein Kind und kein Erwachsener – in welchem Zusammenhang sie auch mit der ›Sonderschule Garatshausen‹ stehen mögen – direkt oder verschlüsselt einer Person des Romans auch nur mit einer einzigen, noch so geringen psychischen oder physischen Eigenart entsprechen.
Es ist ein unerträglicher, ja verbrecherischer Hochmut, wenn ein Mensch über die Existenz eines anderen Menschen sagt, sie sei sinnvoll oder sie sei sinnlos. Niemals können wir verwirrten, ohnmächtigen Wesen, die wir auf dieser Erde herumkriechen, das entscheiden. Und niemals werden wir wissen können, welche Bedeutung ein menschliches Leben haben kann, welche unerhörte Bedeutung sogar – oder gerade! – in seiner tiefsten Erbärmlichkeit.
Aktenzeichen: 5 Js 422/73
I. Anklageschrift
in der Strafsache
gegen
MANKOW Susanne, genannt MORAN Sylvia geb. am 25. Mai 1935 in Berlin, ledige Filmschauspielerin, deutsche Staatsangehörige
wohnhaft:
705 Mandeville Canyon
Beverly Hills, im Staate California, U. S.A.
Eltern:
MANKOW Erich, verstorben
MANKOW Olga, geb. Oster, verstorben
zur Zeit in Untersuchungshaft in Nürnberg
Die Staatsanwaltschaft legt der Angeschuldigten auf Grund der durchgeführten Ermittlungen folgenden Sachverhalt zur Last:
Die Angeschuldigte verabredete mit dem ihr seit Jahren bekannten Romero RETTLAND, Filmschauspieler, geb. am 9. August 1912 in Myrtle Creek, im Staate Oregon, U.S.A., der sie um eine Unterredung gebeten hatte, für den 8. Oktober 1973, 17 Uhr, in Nürnberg, Hotel »Zum Weißen Rad«, eine Zusammenkunft.
Die Angeschuldigte schweigt sich über den Grund dieses Zusammentreffens und die mit Rettland dort geführten Gespräche aus. Aus der Tatsache des als Stundenhotel bekannten Treffpunkts und des weiteren Umstandes, daß die Angeschuldigte dort für die Umwelt nicht erkennbar mit dunkelgetönter Brille und einer Perücke aufgetreten ist, ergibt sich, daß das Zusammentreffen einen höchst privaten intimen Zweck hatte.
Die Ermittlungen haben ergeben, daß Rettland 1961 zusammen mit der damals weithin unbekannten Angeschuldigten, die noch den Namen Mankow trug, für einen Film engagiert worden ist, der in Berlin gedreht wurde, und daß Rettland immer wieder behauptet hat, der Vater der nunmehr elfjährigen Tochter BARBARA (»Babs«) der Angeschuldigten zu sein, die, nach Zeugen- und Presseberichten, sich in einem Internat bei Norristown, etwa vierzig Kilometer nordöstlich von Philadelphia, im Staate Philadelphia, U.S.A., befindet. Da die Angeschuldigte offizielle Atteste vorgelegt hat, die eine Vaterschaft Rettlands ausschließen, sich jedoch beharrlich weigert, über irgendwelche Beziehungen zu diesem und über den Inhalt der Unterredung mit diesem am 8. Oktober 1973 Auskunft zu erteilen, muß unterstellt werden, daß die Angeschuldigte das Tatmotiv verschweigt.
Aus den Beweistatsachen ergibt sich:
Die Angeschuldigte führte eine Pistole Marke Walther, Modell TPH, Kaliber 6.35 mm bei sich. Aus dieser wurde ein Schuß abgegeben. Der Schuß tötete Rettland. Die Angeschuldigte wurde im Zimmer 39 des Hotels »Zum Weißen Rad« angetroffen und hatte die Pistole in der Hand. Daraus ergibt sich, daß sie selber den Schuß abgegeben hat. Das im Leichnam vorgefundene Projektil ist nach dem Gutachten des ballistischen Sachverständigen aus der Schußwaffe abgefeuert worden. Nach gerichtsärztlicher Feststellung trat der Tod des Rettland sofort ein.
Rettland hatte keine Waffe bei sich, auch kein einziges Personaldokument. Seine Identität mußte erkennungsdienstlich festgestellt werden. In seinen Anzugtaschen fanden sich nur ein Ring mit drei Schlüsseln, 85 Dollar und 30 Cents, sowie zwei Traveller-Schecks zu je 100 Dollar.
Das Zimmer, in dem die Tat geschehen ist, war von der Angeschuldigten bestellt worden.
Aus diesen Tatsachen ergibt sich, daß Rettland arg- und wehrlos gewesen ist.
Die Angeschuldigte wird daher beschuldigt, den Schauspieler Romero Rettland heimtückisch unter Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers getötet zu haben und somit strafbar zu sein eines Verbrechens des Mordes gemäß § 211 StGB.
5 Js 422/73
Anlage zur Anklageschrift vom 20. Dez. 1973
in der Strafsache
gegen
MANKOW Susanne, genannt MORAN Sylvia
1.) Zeugen:
a) Josef KUNZINGER, Portier im Hotel »Zum Weißen Rad«, Nürnberg, Bl. 4 d.A.
b) Elfie KRAKE, gewerbsmäßige Prostituierte, Nürnberg, Bl. 7 d.A.
c) Joe GINTZBURGER, Präsident der amerikanischen Filmgesellschaft Seven Stars, Hollywood, Bl. 47 d.A.
d) Rod BRACKEN, Agent der Angeschuldigten, Hollywood, Bl. 15 d.A.
e) Dr. Ruth REINHARDT, Oberärztin am Sophien-Krankenhaus, Nürnberg, Bl. 35 d.A.
f) Philip KAVEN, ohne Beruf, zur Zeit in Untersuchungshaft, Bl. 8 d.A.
g) Wigbert SONDERSEN, Hauptkommissar, Nürnberg, Bl. 10 d.A.
h) Dr. Elliot KASSNER, Chefarzt der Psychiatrischen Abteilung des Santa Monica Hospitals, Beverly Hills, Bl. 62 d.A.
i) Dr. Robert SIGRAND, Oberarzt am Hopital Sainte-Bernadette, Paris, Bl. 51 d.A.
j) Dr. Clemens HOLLOWAY, Leiter des Internats von Norristown, Bl. 72 d.A.
k) Alexandre DROUANT, Leitender Kommissar der Sicherheitspolizei von Monte-Carlo, Bl. 81 d.A.
l) Julio DA CAVA, Filmregisseur, Madrid, Bl. 93 d.A.
m) Carlo MARONE, Filmverleiher, Rom, Bl. 97 d.A.
n) Frédéric GERARD, Chefsprecher und Animateur, RADIO und TELE MONTECARLO, Bl. 76 d.A.
o) Bob CUMMINGS, Aufnahmeleiter der SYRAN-PRODUCTIONS, Hollywood, Bl. 100 d.A.
p) Carmen CRUZEIRO, Fremdsprachensekretärin, Madrid, Bl. 87 d.A.
q) Gerhard VOGEL, Polizeihauptwachtmeister, Nürnberg, Bl. 13 d.A.
2.) Sachverständige:
a) Dr. Walter LANGENHORST, für Ballistik, Berlin, Bl. 96 d.A.
b) Prof. Dr. med. Hans PRINNER, Gerichtsmedizinisches Institut, Nürnberg, Bl. 41 d.A.
c) Prof. Dr. med. Wilhelm ESCHENBACH, Psychiatrische Universitätsklinik Erlangen, Bl. 107 d.A.
3.) Asservate:
a) Pistole Marke Walther, Modell TPH, Kaliber 6.35 mm,
b) eine dunkelgetönte Brille,
c) eine blonde Perücke,
d) ein aufklappbares goldenes Medaillon, enthaltend ein Farbfoto der Tochter der Angeschuldigten.
4.) Augenschein.
Zur Aburteilung ist nach § 80 des Gerichtsverfassungsgesetzes, §§ 7, 9 der Strafprozeßordnung
das Schwurgericht beim Landgericht Nürnberg-Fürth zuständig.
Verteidiger:
Rechtsanwalt Dr. Otto NIELSEN, Nürnberg, Loblerstr. 126 a
Ich erhebe die öffentliche Klage und beantrage,
a) die Anklage zur Hauptverhandlung vor dem Schwurgericht Nürnberg-Fürth zuzulassen,
b) Termin zur Hauptverhandlung anzuberaumen,
c) die Fortdauer der Untersuchungshaft anzuordnen, weil die Haftgründe fortbestehen.
Haftprüfungstermin nach § 117 Abs. 5 StPO: –––––
Ablauf der in § 121 Abs. 2 StPO bezeichneten Frist 8. Apr. 1974
Nächster Haftprüfungstermin im Sinne des § 122 Abs. 4 StPO: 8. April 1974
d) –––––
Als Beweismittel bezeichne ich.
Zeugen: siehe Anlage
Sachverständige: siehe Anlage
Urkunden: siehe Anlage
Sonstige Beweismittel: siehe Anlage
II. Mit den Akten
an den Herrn Vorsitzenden der
Strafkammer des Landgerichts
Nürnberg-Fürth
Nürnberg, den 20. Dezember 1973
Staatsanwaltschaft
bei dem Landgericht Nürnberg-Fürth
Ober-Staatsanwalt
Symptom
SABINA: Wir sind alle miteinander so schlecht, wie wir nur sein können.
Aus: Wir sind noch einmal davongekommen
von THORNTON WILDER
1
Guten Tag. Sie werden gebeten, vor das Milchglasfenster im linken Torpfeiler zu treten. Achten Sie darauf, daß Ihr Gesicht direkt vor dem Fenster ist und daß Sie einen Abstand vom Glas halten, der etwa zehn Zentimeter beträgt! Danke.« Die metallene, tiefe Frauenstimme, die aus den Sprechschlitzen einer Chromtafel – und sicherlich vom Band – kam, wenn man an diesem Parktor auf die Klingel drückte, schwieg. Strom rauschte in der offenen Verbindung. Ich kannte das Theater schon, ich war schon einmal hier gewesen, nachts zuvor.
Also hin zu dem überdachten kleinen Milchglasquadrat im linken Torpfeiler. Ich mußte mich ein wenig bücken, denn ich bin 1,82 Meter groß. Schön den richtigen Abstand halten. Es war eiskalt, es regnete in Strömen an diesem Abend des 24. November 1971, einem Mittwoch, und dazu tobte ein widerwärtiger, fauchender Sturm über Paris.
Der Regen troff mir vom Mantel, rann mir in den Kragen, drang durch die Schuhsohlen. Ich schluckte schon, seit ich in Paris und in diesem Dreckwetter war, vorsorglich Antigrippemittel, denn das fehlte noch, daß ich jetzt krank wurde. Am liebsten wäre ich total besoffen gewesen, so mies fühlte ich mich, so degoutiert war ich. Aber von Saufen konnte keine Rede sein. Ich brauchte jetzt einen glasklaren, zu eiskalten Überlegungen fähigen Kopf. Denn wenn nun noch etwas passierte …
Über mir flammte grelles Licht auf. Ich kannte auch das schon. Jeder, der hierher kam und das Recht besaß, einzutreten, kannte es. Sie sagten es ihm vorher, wie sie es mir gesagt hatten. In der schloßartigen alten Villa hinter dem Park, die ich in der Finsternis nicht sehen konnte, hatten sie eine kleine, hausinterne Fernsehanlage. Der Bulle, der gerade Wache schob (sie lösten einander in Abständen von acht Stunden ab, rund um die Uhr, das hatten sie mir auch gesagt), besaß in seinem Zimmer (das sie mir allerdings nicht gezeigt, von dem sie nur erzählt hatten) einen Fernsehschirm. Auf ihm sah er nun mein Gesicht. Jeder, der hierher kam und wiederkommen durfte, wurde sofort fotografiert. Vor dem diensttuenden Bullen lagen vermutlich Alben mit all diesen Fotos. Die neuesten lagen vielleicht vor ihm auf einem Tisch. Sicherlich suchte er jetzt nach meinem, dem, das dem Gesicht auf seinem Fernsehschirm glich. Die metallene Frauenstimme: »Nennen Sie nun Ihren Namen. Langsam und deutlich, bitte.«
Dies Solo kam zuerst auf Französisch, aber die Aufforderungen wurden deutsch, englisch und italienisch wiederholt.
»Now pronounce your name. Slowly and clearly, please …«
»Adesso dica il suo nome, per favore. Lentamente e chiaramente, per favore …«
Immer dieselbe Frauenstimme. Eine gebildete Dame.
Der Regen rann mir vom Haar in die Augen, ich hatte den Hut abgenommen. Ich sagte: »Philip Kaven.«
Die Stimme: »And your number, please.«
»Ed il suo numero, per favore.«
Französisch das Ganze zuerst.
Ich sagte diesmal französisch, zur Abwechslung: »Treize.«
Dreizehn, das war die Nummer, die sie mir gegeben hatten in der vergangenen Nacht, als ich zum ersten Mal hier gewesen war. Da hatten uns Angestellte des Etablissements abgeholt in einem großen amerikanischen Straßenkreuzer. Sie sprachen kein Wort während der ganzen langen Fahrt vom Flughafen Orly bis hierher, zwei Riesenkerle. Aber auch einer von ihnen hatte aussteigen und vor dieses Milchglasfenster treten müssen, ehe das Tor sich öffnete. Bevor ich dann später ging, sagten sie mir, daß meine Kennzahl 13 sei.
»Vergessen Sie das nicht, Monsieur Kaven. Dreizehn. Ohne die Kennzahl kommen Sie nicht durch das Tor …«
Eine vornehme Bude war das vielleicht. Die vornehmste. Und natürlich die teuerste. An den Gitterstäben rund um den Park konnte kein Mensch hochklettern, oben waren noch Spitzen und ein wohl elektrisch geladener Draht. Und überall Alarmanlagen, hatten sie mir erklärt. Praktisch war dies Gebäude mitsamt Park etwa so gesichert wie der Haupttresor der Bank of England.
Nur zwei Laternen brannten hier draußen in der kurzen Rue Cavé, direkt am Rande des Bois de Boulogne. Kein Aas zu sehen. Einsamer ging es nicht. Was die wohl am Tage machten, wenn es hell war und nicht regnete, und wenn es hier Passanten gab und Verkehr? Genau dasselbe sicherlich, dachte ich. Viel Verkehr wird es hier wohl kaum geben. Und die wenigen Passanten in dieser Straße mit ihren fünf schloßartigen Villen, die kannten das sicherlich schon, wenn sie es sahen und hörten. Wenn sie es nicht kannten, mußten sie sich wundern, da konnte man ihnen nicht helfen.
»Merci«, sagte die so verführerisch klingende Frauenstimme vom Band – gewiß war sie daraufhin ausgesucht worden. Sie sagte auch noch in den drei anderen Sprachen danke. Dann schaltete das Band sich ab, das grelle Licht erlosch. Die beiden Torflügel glitten über Schienen summend auseinander. Ich trat auf den Kiesweg des Parks. Sofort schlossen sich die Flügel wieder hinter mir. Imponiert Ihnen, wie? Mir imponierte es auch.
Keine Lampen im Park. Nur auf der Erde, manchmal halb von irgendwelchem Ziergesträuch verdeckt, liefen zu beiden Seiten des Kieswegs kleine Lichtpfeile, welche die Richtung zeigten. Sie leuchteten honiggelb. Es gab jede Art und jede Menge von Bäumen in diesem Park, Ahorn, Rotbuchen, Fichten, Kiefern, Linden, Trauerweiden, sogar eine Palme! Aber die schien erledigt zu sein. Es gab jede Menge und Art von Büschen und Hecken. Es gab keine Wiese, dies war ein sehr dichter, völlig zugewachsener Park. Der Wind orgelte in den Baumkronen. Ich hatte nun wieder meinen Hut auf und folgte den Pfeilen. Blick auf die Leuchtziffern der Armbanduhr. 18 Uhr 36. Um 16 Uhr hatte ich das Hotel LE MONDE verlassen. Natürlich nicht in Sylvias Rolls, natürlich nicht in meinem Maserati Ghibli. Natürlich auch nicht in einem Taxi von dem Stand vor dem Hotel. Ich war zu einem Stand auf den Champs Élyées vorgegangen, hatte mich in eine Droschke fallen lassen und dem Chauffeur gesagt, wohin er fahren sollte, zuerst selbstverständlich in die falsche Richtung: »Place de la Concorde, bitte.«
»In Ordnung, ’sieur.«
Der Chauffeur war losgefahren wie ein Verrückter. Sind Sie schon einmal mit einem Taxi durch Paris gefahren? In der Stoßzeit? Mit einem französischen Chauffeur? Ja? Dann werden Sie mit mir fühlen. Nein, noch nie? Dann haben Sie keine Ahnung davon, wie das Leben sein kann. Keinen blassen Schimmer haben Sie. Sie sollten etwas gegen diese Bildungslücke tun. Natürlich nur, wenn Sie gute Nerven haben. Sehr gute Nerven. Falls diese Voraussetzung zutrifft, müssen Sie es tun! Es fehlt sonst einfach etwas in Ihrem Dasein. Und Sie werden niemals wirklich französisches Französisch kennenlernen.
»Crevez, salopard!«
»Ta gueule, crapule!«
»Idiot, foutez le camp!«
»Bougre de con!«
»Gueule-de-merde!«
»Mon Dieu, quel con!«
»En foire!«
Und so weiter, unablässig. Und alles natürlich, ohne jemals die herabhängende Gauloise aus dem Mundwinkel zu nehmen. Dazu unablässig Fastzusammenstöße. Bremsen auf kreischenden Pneus. Anfahren mit einem Ruck, der Sie in den Fond zurückwirft. Fahrmanöver Ihres Chauffeurs, bei denen Sie zuletzt nur noch beten möchten. Sagen Sie ihm bloß nicht, er solle vorsichtiger fahren. Er tut es gewiß nicht. Er wird Ihnen nur vorschlagen, sich doch selber ans Steuer zu setzen und seinen gottverfluchten Kübel zu lenken oder, viel wahrscheinlicher, Ihre Frau Mama aufs Kreuz zu legen.
Ich hatte das schon so oft erlebt, daß ich es kaum mehr wahrnahm. Außerdem war ich beschäftigt. Ich sah dauernd durch das Rückfenster, durch die Seitenfenster. Folgte mir einer von den Kerlen? Folgten mir mehrere? Wenn ja, mußte ich ganz sicher sein, daß ich sie abschüttelte. Bisher war es mir gelungen. Auch gestern in Zürich, nach der Pressekonferenz im DOLDER. Ich war heute früh erst um halb zwei Uhr morgens ins LE MONDE gekommen. Da war die erste Panne allerdings schon passiert gewesen.
Clarissa, das Kindermädchen, und Bracken hatten auf mich gewartet, Bracken leicht betrunken. Sie hatten in dem strahlend erleuchteten Salon des Appartements gewartet, in dem Sylvia seit Jahren mit mir wohnte, wenn wir in Paris waren. Ein kleiner, kahler Mann mit dicken Brillengläsern und unendlich traurigem, unendlich gütigem Gesicht war auch noch dagewesen. Diesen Mann kannte ich.
»Herr Doktor Lévy! Was machen Sie hier?«
Er hatte mir gesagt, was er hier machte.
Das war heute um halb zwei Uhr früh gewesen.
Nun, am Abend desselben Tages, saß ich in Taxis. Aus dem ersten war ich an der Place de la Concorde ausgestiegen und hatte das Taxi gewechselt. Ich war auf dem linken Seineufer den Quai d’Orsay und anschließend den Quai Branly in Richtung Westen entlanggefahren und über den Pont de Jéna zurück auf das andere Ufer. Neues Taxi. Der Chauffeur hatte noch amüsanter geflucht als sein Kollege, er mußte Umwege machen, um über die Place du Trocadéro die Avenue Poincaré zu erreichen und nach Norden hinaufzufahren. Neues Taxi bei der Kreuzung Avenue Foch. Nun durch den Bois de Boulogne und dann zur Porte de Madrid. Ich war praktisch in einem großen Kreis gefahren, und ich war beruhigt: Niemand folgte mir. Durch den scheußlichen Regen, gegen den widerlichen Sturm gestemmt, war ich nun zu Fuß gegangen. Es ist ein kurzer Weg bis zum Boulevard Richard Wallace. Keine Menschenseele hier. Aber so viel Regen, daß ich schon nach zwei Minuten beschmutzte Schuhe und durchweichte Hosenbeine hatte und einen von Nässe dunkel gewordenen Regenmantel. Als ich dann endlich den Boulevard Richard Wallace hochging, war ich bereits total verdreckt. Mein Mantel, pelzgefüttert, glänzte. Von meinem Hut troff Wasser. Immer wieder rutschte ich aus. Ich fluchte ärger als alle Taxichauffeure, mit denen ich gefahren war, zusammen. Dann kam endlich die Rue Cavé. Dann stand ich vor dem hohen Schmiedeeisentor und klingelte.
Und dann erklang, in vier Sprachen, die metallen-erotische Frauenstimme aus der Sprechanlage: »Guten Tag, Sie werden gebeten, vor das Milchglasfenster im linken Torpfeiler zu treten …«
2
Jetzt hatte ich den Park hinter mir. Ein Herrensitz, erbaut etwa um 1880, 1890. Das ist die Zeit, in der ich mir immer wünsche, gelebt zu haben. Pferdedroschken und Gaslicht. Oscar Wilde, der ja für sein ›Bildnis des Dorian Gray‹ auch von mir einige Anregungen hätte empfangen können. Welch eine Zeit! Wenn damals Lichter erloschen, dann war dies nicht die Folge einer Energiekrise, und wenn damals Vorhänge fielen, dann waren sie aus diskreter Seide und nicht aus Eisen …
Eine breite Steintreppe also hoch. Rechts und links auf dem Steingeländer Putten. Grell wie ein Fotoblitz flammte noch einmal Licht über mir auf. Dann öffnete sich die große Pforte des Eingangs wie von Geisterhand. Elektronisch, alles elektronisch hier. Ich trat ein. Ich wußte ja, was mich erwartete. Aber heute nacht noch war es ein Schock für mich gewesen: Das, was außen aussah wie ein verwunschenes Schlößchen des Fin de siècle, war innen eine ultramoderne Klinik.
Alles weiß, Stahl und Chrom. Gänge. Türen mit Aufschriften: LABOR I – EKG – ANAESTHESIE – LABOR II – CHEFARZT – OP I – RÖNTGEN – OP II – INTERN – OP III. Über den drei Operationssaaltüren Rotlicht. Ausgeschaltet jetzt. Hier auf den Gängen, die ich schon einmal entlanggegangen war, roch es dezent nach Klinik, äußerst dezent. Und ich begegnete keinem einzigen Menschen, ich hörte kein einziges Geräusch. Bei meinem ersten Besuch war das genauso gewesen. Hier gab es anscheinend überhaupt keine Menschen! Auch das war vorbildlich organisiert.
Dann hatte ich die beiden Lifts erreicht. Einer war groß – für Krankentransporte –, der andere ein normaler Personenlift. Wie gesagt, ich kannte mich aus. Ich trat in den Personenlift und drückte auf den Knopf für den dritten Stock. Summend glitt der Aufzug hoch. Ich blickte in den kleinen Spiegel der Kabine. Ich sah mein Gesicht. Naß. Regen und Schweiß, Ringe der Erschöpfung unter den Augen. (Die zweite Nacht, in der ich kaum zwei Stunden Schlaf gefunden hatte.) Ich nahm den Hut ab. Wasser tropfte.
Dritter Stock. Sehr gedämpftes Licht auf einem langen Gang. An den Türen standen nur große Zahlen, nichts sonst. Hier war ich noch nicht gewesen, aber ich wußte, wohin ich zu gehen hatte.
Zimmer 11
Da mußte ich hinein, ich wußte es, weil sie es mir am Nachmittag gesagt hatten, als ich aus dem LE MONDE hier angerufen hatte. Ich öffnete die Tür. Ein finsterer Vorraum. Ich fand keinen Lichtschalter. Leider hatte ich die Tür hinter mir geschlossen und fand nun auch nicht zu ihr zurück. Ich fand die gottverfluchte Tür einfach nicht mehr – Sie werden das kennen. Ich tastete die Wände ab, und mir war heiß vor Wut und Schwäche.
Da – eine Tür! Da – eine Klinke! Ich drückte sie nieder. Die Tür öffnete sich. Ich erwartete den Gang wiederzusehen. Irrtum. Ich hatte eine zweite Tür geöffnet. Sie führte in ein großes Zimmer. Ich entdeckte auch hier keinen Schalter, aber ich sah ein wenig, denn über dem Fußboden, in die Mauer eingelassen, gab es hier hinter dickem gelbem Glas eine eingeschaltete elektrische Birne. In ihrem Schein erkannte ich ein Krankenbett, mitten im Zimmer. Ich erkannte es, weil es weiß war. Draußen heulte der Sturm, Regen peitschte gegen die Fensterscheiben. Ich ging auf das Bett zu und fiel dabei fast über einen Stuhl. Dann sah ich die Bescherung.
Vollkommen mit dicken weißen Bandagen umwickelt der Kopf. Nur Nase und Mund waren frei. Verbände auch über den Augen. Kam mir riesig, fürchterlich vor, dieses weiße Ding. Ich sah nur dieses weiße Ding, diese mächtige Kugel. Alles andere verbarg eine Decke. Hier roch es nun allerdings kräftig nach Krankenhaus. Ich kann den Geruch nicht ertragen. Mir wurde übel.
»Sylvia!« Nichts.
»Sylvia!« Viel lauter. Wieder nichts.
Dreimal noch ihren Namen, zuletzt schrie ich.
Keine Reaktion.
Die war weg. Konnte tot sein, so weg war die.
Ich griff unter die Decke und suchte eine ihrer Hände. Eiskalt. Ich drückte und zwickte die Hand. Nichts. Dann bemerkte ich, daß dort, wo unter dieser Kugel Sylvias Ohren sein mußten, und hinten, im Nacken, aus dem Verband dünne Plastikschläuche herausliefen, bis zum Boden hinab. Sie hingen in ein Glasgefäß. Da ich kaum etwas sehen konnte, kauerte ich mich nieder. In dem Glas war Blut, nicht sehr viel, aber doch. Ich richtete mich wieder auf. Nun rann mir der Schweiß über den Körper. Ich zog den durchtränkten Mantel aus und warf ihn, mit dem Hut, einfach hinter mich, öffnete die Jacke, zog die Krawatte herab, riß den obersten Hemdknopf auf. Starrte diese gräßliche weiße Kugel an, die den Kopf von Sylvia barg. Von Sylvia, die reglos dalag. Das beunruhigte mich doch schon mächtig. Wenn da etwas passiert war? Ein Mann muß schließlich auch an sich denken, nicht wahr
3
Also gut, alle Frauen sind verrückt nach mir.
Also schön, ich bin so einer von den Kerlen, von denen alle Frauen träumen. Also raus damit: Ich war ein Playboy.
Hier, in diesem Untersuchungsgefängnis, ist einfach alles vorzüglich. Die heimeligen Zellen. Die Matratzen der Betten. Die psychologische Behandlung. Die sanitären Anlagen. Die medizinische und – auf Wunsch – seelsorgerische Betreuung. Das Essen. Das einfühlsam-höfliche Verhalten aller Insassen und ihrer Betreuer, angefangen von den Herren Wärtern bis hin zum Herrn Direktor. Die Möglichkeit, mancherlei Sport zu treiben. Die Bibliothek. Da gibt es nicht allein gesammelte Werke von Klassikern vieler Länder, nicht bloß nahezu alle Bücher; Fiction und Nonfiction, die – konversationsmäßig natürlich nur, versteht sich – gerade in jedermanns Munde sind. Es gibt auch die modernsten Nachschlagewerke. Beispielsweise die vierte, neu bearbeitete Auflage des BROCKHAUS © F. A. Brockhaus, Wiesbaden 1971. In Band 4 (NEV bis SID) steht da auf Seite 201, mittlere Spalte, Mitte: ›Playboy [pl'eiboi, engl.], der -s/-s, eleganter, weltgewandter, meist vermögender Müßiggänger; Frauenheld‹.
Sie haben nachgelesen, mein Herr Richter? Dann bitte ich Sie, dem kleinen Wort ›meist‹ besondere Beachtung zu schenken. Wer immer hier Redakteur gewesen ist – ich schüttle ihm im Geist die Hand –, wenn auch (aber ich bitte inständig, dies nicht als Mäkelei, Beckmesserei oder gar Rüge aufzufassen), wenn auch, so dankbar ich bereits für das ›meist‹ bin, das ideale Wort ›manchmal‹ gewesen wäre.
Playboy – das sagt man so. Sie, mein Herr Richter, sagen es, wenn Sie es sagen, abfällig, ach, warum es leugnen? Etwas Feines ist das ja wirklich nicht. Nur, je nun, sehen Sie den BROCKHAUS: ›meist‹. Es gibt also Nuancen, nicht wahr? Und wie groß sind die doch! Ein Playboy ist in der Tat nicht immer ›vermögend‹, wollte sich doch die geneigte Öffentlichkeit endlich diesen Umstand als Tatsache zu eigen machen. Ich beispielsweise bin absolut unvermögend. Sie wiegen den Kopf, mein Herr Richter, ach ja, doch, doch, ich fühle es, Sie zweifeln. Sie gedenken meines Bruders und der uns vom Vater vererbten so bekannten Kabelwerke. Das Drama, über das zu berichten Sie mich ermuntern, hat – und Sie wissen, daß ich hier wahrlich nicht übertreibe – weltweit Sensation verursacht. Der Name meiner Familie wurde in sämtlichen Massenmedien millionenfach erwähnt. Mein armer, braver Bruder Karl-Ludwig. Wie gern hätte ich ihm das alles erspart. Doch lag das denn jemals in meiner Macht? Nein, wirklich nicht. Das alles lag und liegt noch immer jenseits der mächtigsten der Mächte.
Ach, aber wenn Sie nun glauben, es sei eine feine Sache, auch nur ein solcher Playboy zu sein wie ich, nämlich ein absolut unvermögender, dann täuschen Sie sich gewaltig. Eine Scheiß-Sache ist das. Eine verfluchte, rauchende Scheiße ist dieser Job, diese Existenz, wie Sie es nennen wollen, und ich bitte um Vergebung für die argen Worte, die mir eben entflohen sind. Ich fürchte sehr, es werden mir bald noch viel ärgere entfliehen, nein, nicht entfliehen: sich einfach nicht vermeiden lassen. Ich wünschte sehr, ich wäre kein Playboy gewesen. Allein, was soll ich machen? Ich war einer. Und was für einer. Wissen Sie, mein Herr Richter, manchmal, nein, ziemlich oft, da hätte ich mir liebend gern stundenlang in die Fresse geschlagen für das, was ich tat, für meinen feinen Charakter. Tja, aber dann dachte ich eben stets sofort wieder an die Sorglosigkeit, das schöne Leben …
Ganz unter uns: Es war ja einst auch nicht eben das Schlechteste, von Greta Garbo geliebt zu werden, nicht wahr? Und Sie werden mir zustimmen, mein Herr Richter, wenn ich sage, daß die Dame, die mich liebt, größer ist als die Garbo. Sie ist, und sicherlich pflichten Sie mir auch hier sogleich bei, in dieser Industrie die Größte, die es jemals gab.
Die Größte: Sylvia Moran.
Natürlich, und noch bevor Sie es denken, sage ich es selber, natürlich leben wir in einer Zeit, in der man den Begriff des Ganz Großen Weiblichen Stars kaum noch kennt. Es gibt nur einige wenige dieser Ganz Großen – die Taylor, die Cardinale, die Loren, die Streisand, die Schneider, Liza Minelli, Tochter der Garland, und einige andere, nicht wahr, nun, da der internationale Film immer mehr männliche Stars benötigt, weil die Sujets immer maskuliner werden, nun, da Weltproduktionen mit einer großen Schauspielerin im Mittelpunkt so rar geworden sind.
Was ist hier eigentlich los? Erlischt das Interesse an Weiblichkeit? Haben die Männer, bewußt oder unbewußt, bereits beschlossen, generell keinen Gefallen mehr am anderen Geschlecht zu bezeigen, sind sie übereingekommen, auch diese Sache unter sich abzumachen? Woher das plötzliche (nur scheinbare?) Desinteresse an dem, was zu allen Zeiten immer noch am meisten interessierte? Wird unsere Erde kalt, impotent, homosexuell, lesbisch? Wenn ja, warum? Wird man in Zukunft mit schweren Strafen belegt werden dafür, daß man – ein Fossil! – normal ist?
Die Filmindustrie bildet nicht Zeitgefühle, sie läuft ihnen nach, paßt sich ihnen an. Die Filmindustrie handelt richtig, aber sie weiß nicht, warum. George Orwells ›1984‹ ist nahe herangerückt. Sagen Sie mir doch, mein Herr Richter, woher es kommt, dieses offenkundige Unbehagen an allem Weiblichen, dieses offenkundige Hochjubeln alles Männlichen, je brutaler, je lieber. Gewiß, schöne Zeiten für viele Herren – aber Sie geben doch zu, daß das gerade für jemanden wie mich deprimierende Ausblicke sind, nicht wahr? Kastrationsangst, Oedipus-Komplex, Inzest-Tabu, Verdrängungsgewinn, Regression, Symptomverdrängung, Triebgefahr, Objektliebe, Introjektion, Substitution, Besetzung, Gegenbesetzung und so weiter und so weiter helfen uns hier auch nicht weiter. Lange her, daß Sigmund Freud sich da ausgetobt hat. Heute? Auf den Misthaufen mit ihm! Sie transit gloria mundi. Ist allerdings noch nicht ganz vergangen, der Ruhm der Frauen. Noch gibt es, bei immer mehr internationalen Filmen mit Männern als Helden, die vor Kraft kaum laufen können, ja, ja, doch, doch, noch gibt es Weltproduktionen mit einem weiblichen Star, und von den wenigen Großen, die ich erwähnte, ist Sylvia Moran die Größte – nicht nur im Rahmen dieser desolaten Entwicklung (wahrlich, in finstern Zeiten leben wir, mein Herr Richter!), nein, nicht nur im Rahmen dieser elenden Epoche, sondern rückblickend bis zum Anfang der Kinematographie – sie ist die Größte.
Und nun hilft nichts mehr. Gleich zu Beginn muß ich indiskret werden, bald werde ich viel Schlimmeres werden müssen in meinem Geständnis: Diese Größte hat mich vielleicht mit Beschlag belegt. Mein lieber Mann! Für immer und ewig, mit Haut und Haaren. Sie hatte mich. Ich war ›her meat‹, ihr Fleisch war ich. Das dachte sie. Ich hätte ja gern etwas anderes gedacht, aber ich kam aus diesem Teufelskreis einfach nicht mehr heraus. Nun ja, und so machte ich eben immer weiter. Nur damit Sie sich gleich darüber im klaren sind, daß ich nicht die Absicht habe, dem, was ich tat, ein ethisches Mäntelchen umzuhängen. Darüber bin ich lange hinaus. Ich spiele keinem mehr den Heldenhelden vor, der ich nie war. Ein Stück Dreck bin ich. Ein obermieser Schuft ist es, der Ihnen hier seine Geschichte erzählt, ein richtiges Charakterschwein. Mit Namen Philip Kaven.
Unter diesem Namen kennt mich (und ich bin alles andere als stolz darauf!) die ganze Welt. Unter dem Namen Philip Kaven und als Sylvia Morans ständigen Begleiter. Siebenundzwanzig Jahre war ich alt, als ich sie kennenlernte, sie war damals dreiunddreißig, fünf Jahre ist das nun schon wieder her. Nächste Woche feiere ich hier, in dieser komfortablen Zelle, meinen zweiunddreißigsten Geburtstag, und Sylvia ist jetzt achtunddreißig, diese, nein, da gibt es wirklich keinerlei Diskussion, das ist die Meinung aller, diese Göttlichste der internationalen Filmindustrie, und dabei natürlich auch Maßloseste, Unersättlichste, Verrückteste – was soll’s? Jetzt schreiben wir November 1973. Seit 1968 lebte ich von ihr, von ihr allein. Vorher ging es dem Playboy Philip Kaven beschissen, und wenn ich beschissen sage, drücke ich mich noch geradezu verboten euphemistisch aus, mein Herr Richter. Ich erinnere an die Definition des Wortes ›Playboy‹ im BROCKHAUS und an das Wörtchen ›meist‹.
Ja, fünf Jahre lebte ich ausschließlich von Sylvia Moran, es kommt jetzt doch alles heraus, leid tut es mir für Bruder Karl-Ludwig, den braven Kerl, und für die Kabelwerke; alles aber hat sich eben von Grund auf geändert, nachdem nun auch noch dieser Mann erschossen worden ist. Ich lebte von Sylvia Moran. And not too knapp. Die Maßanzüge, die Seidenhemden, die Platinarmbanduhren, meine ganze Garderobe, der Maserati Ghibli (der kostete 130000 Francs – Neue! –, und ich brachte ihn wirklich immer spielend leicht auf 290!) – dies und so viel mehr hatte ich von ihr. Sie kaufte und bezahlte alles für mich. Weil sie – fern, ach so fern liegt es, mich jetzt und hier damit noch zu rühmen –, weil sie so wahnsinnig nach mir war. Ich habe stets alles getan, um sie zufriedenzustellen. Ich war für sie da bei Tag und bei Nacht, immer. Ich erfüllte jeden ihrer Aufträge, jeden ihrer Wünsche, und sie hatte stets eine Menge Wünsche, darauf können Sie sich verlassen, mein Herr Richter. Eifersüchtig war sie natürlich auch. Wie eine Verrückte. Das mit der Eifersucht war damals, als das, was nun bis hin zum Mord geführt hat, gerade seinen Anfang nahm, so schlimm geworden, daß ich selber immer häufiger das Gefühl hatte, unmittelbar vor dem Verrücktwerden zu stehen.
Mit Sylvia Moran habe ich in den letzten fünf Jahren so viele Länder und Städte auf allen fünf Kontinenten gesehen, so viel Zeit in Luxushotels verbracht, bin ich mit ihr in Transatlantik-Maschinen so vieler Luftlinien von Drehort zu Drehort gehetzt, daß meine Erinnerung hier partiell versagt. Hingegen hat etwas anderes mir Eindrücke und Erfahrungen vermittelt in diesen fünf Jahren, die ich niemals vergessen werde, die eingegraben sind in meinem Gehirn für alle Zeit: Ich habe Männer und Frauen kennengelernt, von deren Existenz ich nichts geahnt hatte, zuvor, von deren Existenz ganz wenige ahnen, Männer und Frauen, namenlos, keine Fanfare wird für sie geblasen wie für die bluttriefenden Monstren von Menschenverführern und Menschenvernichtern, keine Auszeichnung gibt es für sie, nicht die kleinste, nichts, nur Aufopferung, Entbehrung, Arbeit bis zum Zusammenbruch, immer neue Enttäuschung, immer neue Verzweiflung, aber auch immer neue Hoffnung und immer neuen Mut, die aus niemals versiegenden Quellen gespeist werden, Männer und Frauen so jenseits meiner und, ja auch Ihrer Erfahrung, mein Herr Richter, daß ich, als ich diese Menschen kennenlernte, zuerst wähnte, auf einem anderen Planeten gelandet zu sein – je nun, und das war ich ja auch wirklich, einem anderen, sehr kleinen und schönen Planeten, der sich auf unserem so großen, so schrecklichen befindet.
»Und die einen sind im Dunkeln, und die andern sind im Licht. Doch man siehet die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.« Brecht, mein Herr Richter. Ja nun, auch dem genialen Brecht widerspreche ich, bei aller Verehrung. Ich, ein Nichts. Ich widerspreche, weil ich es einfach besser weiß, weil ich sie gesehen habe, die im Dunkeln! Mehr: Die im Lichte zu sehen, lohnt – fast – nicht, mein Herr Richter, das weiß ich heute, nach allem, was ich erlebt habe auf diesem anderen seltsamen und wunderbaren Planeten. Nein, für einen wie mich lohnt es nur noch, über die im Dunkeln zu berichten, wenn sie schon nicht gesehen werden wollen.
Die Begegnung mit diesen Menschen war das Erschütterndste, das ich jemals erlebt habe, und niemals, niemals kann ich hier auch nur die kleinste Kleinigkeit vergessen. Ich habe die Verpflichtung, das Gute, das ich weiß, und das, paradoxer-, unheimlicher-, pervertierterweise aus dem bösesten Bösen, dem ärgsten Argen, dem schlimmsten Schlimmen entstanden ist, das ihm überhaupt seine Entstehung verdankt, zu berichten als etwas den Menschen Mitteilbares, das ihren Geist berühren wird, berühren muß in einem Ausmaß, welches ich gar nicht übersehen kann – zu berichten, auf diesen Seiten Ihnen allein, mein Herr Richter, und später dann, bei der Verhandlung, vielen, so vielen wie möglich. Ja, dazu bin ich auserkoren – von wem, mein Herr Richter? –, ausgerechnet ich, der denkbar Unwürdigste. Und so habe ich beschlossen, was Sie beruhigen wird: Ich werde niemals lügen. Nicht irgendwelcher Skrupel wegen, ach, ich und Skrupel! Nein, nein, so verhält sich das: Nach dem, was ich mit jenen im Dunkeln, den Namenlosen, Schwachen und, durch Integrität und unendliche Humanität doch zuletzt, Sie werden es sehen, Stärksten der Starken, erlebt habe, kann ich nicht mehr lügen. Ich kann es einfach nicht! Ich könnte natürlich schweigen. Aber ich muß reden, Zeugnis ablegen, und dies mit der Wahrheit, der Wahrheit und mit nichts als der Wahrheit. Abstoßend, mein Herr Richter, nicht wahr, in welcher Frechheit ich selbst jetzt noch darauf beharre, mir Luxus zu leisten – den Luxus der Wahrheit …
4
Ja nun, um fortzufahren in diesem Sinne: Sylvia gab mir einfach alles. Fast alles. Ihr Scheckbuch oder eine Bankvollmacht gab sie mir nie. Das nicht, nein. Überhaupt nie cash. Nur Taschengeld, kein üppiges. Sie war sofort davon überzeugt gewesen, daß ich sie sonst betrügen oder mit ihrem Vermögen verschwinden würde oder beides. Diese Frau, mein Herr Richter, hat einen unglaublich feinen Instinkt. Na ja, und dann war da eben auch noch Babs, ihre Tochter. Ich war nicht der Vater, aber ich wurde von Babs mit Beschlag belegt wie drei Väter!
Fast elf Jahre ist das Mädchen jetzt alt. Sechs Jahre war es alt, als ich es zum ersten Mal sah. Babs liebte mich vom Moment unserer Begegnung an. Hing an mir. Eine Klette ist nichts dagegen. Für mich war Babs vom ersten Moment an zum Kotzen. Ich konnte sie nicht ausstehen. Ich konnte Kinder überhaupt nicht ausstehen. Ich haßte – wenn das nicht schon ein viel zu starker Ausdruck ist für einen so uninteressanten Dreck –, ich haßte Kinder, alle. Aber da war Babs nun einmal, und da war ich, pleite hoch drei.
Und nun?
Nun riß ich mich eben am Riemen.
Sie sind schockiert, mein Herr Richter?
Sie haben, wie alle Menschen, viele Jahre lang ganz anderes gehört, gesehen, gelesen über dieses tränentreibende Dreiecksverhältnis Sylvia Moran-Babs-Philip Kaven, über dieses Märchen aus ›Tausendundeiner Nacht‹, über diese Liebesverbindung des Jahrhunderts, der letzte Eskimo weiß hier Bescheid. Und mit diesen vorangegangenen Sätzen hätte ich, genau wie Sie, mein Herr Richter, alle Menschen der Erde geschockt bis zu jenem letzten Eskimo.
Was Sie, was die ganze Welt seit vielen Jahren glaubt, seit vielen Jahren vorgesetzt bekommt, ist dies: Sylvia Moran, die Göttliche, hat eine Tochter, ohne verheiratet zu sein. Sie weigerte sich stets, und stets mit Erfolg, den Namen des Vaters zu nennen. Sie wissen, mein Herr Richter, welch Fressen die internationale Regenbogenpresse da seit Jahren hat. Babs: das Wunschkind, das Kind der Liebe. Hinreißend niedlich anzusehen schon als Baby, immer hübscher geworden mit den Jahren. THE WORLD’S GREATEST LITTLE SUNSHINE-GIRL – DER WELT GRÖSSTES KLEINES SONNENSCHEIN-MÄDCHEN, so wurde, so wird sie genannt. Ausgedacht hat dieses Design sich Rod Bracken, Sylvias Agent. Bestimmt hat er sich auch die ›Kind der Liebe‹- Masche und das Geheimnis um den Vater ausgedacht. Vielleicht ist er der Vater. Möglich wär’s. Ach, das ist jetzt egal.
Das geht aber noch weiter!
Sylvia Moran hat vor fünf Jahren die Liebe ihres Lebens gefunden. (Mich.) Wir sind füreinander geschaffen. (Für Formulierung und Text verantwortlich: Rod Bracken.) Sylvia ist eine emanzipierte, eine wirklich in jeder Beziehung zur Freiheit gelangte Frau. Sylvia Moran hat gleich damals – und seither ein paar Millionen Mal – diese Weisheit zum besten gegeben: »Ich liebe Phil. Und er liebt mich. Wir werden niemals heiraten. Gerade weil wir einander so lieben, weil dies eine so perfekte Liebe ist, werden wir niemals heiraten. Denn die Heirat ist, auch bei der perfektesten Verbindung, sehr bald der Tod der Liebe.« (Dafür verantwortlich: Sylvia Moran. Das ist wirklich ihre Ansicht.)
Wahrscheinlich, wenn ich mich so umsehe, ist was dran an ihrer Ansicht. Abgesehen natürlich davon, daß sie einen Vogel hat wie wir alle. Ich, ich hätte sie natürlich geheiratet. Bedenken Sie, mein Herr Richter, man wird älter, man ist nicht mehr taufrisch, man denkt an die Zukunft, das Alter, nicht wahr, Sicherheit, Sicherheit über alles, über alles in der Welt! Aber nix. Sylvia war der Meinung – siehe oben. Na, damit es wenigstens so weiterging, war ich natürlich auch der Meinung. Da ich nie eigene Überzeugungen hatte, wehrte ich mich auch niemals dagegen, die Überzeugungen anderer Menschen als eigene zu verkünden.
Also, wir sind das Traum-Paar des zwanzigsten Jahrhunderts, Sylvia und ich, wahrlich moderne Menschen, bewundernswert, wie wir unsere Liebe bewahren, indem wir auf den verdammten Ring am Finger und die verfluchten Unterschriften auf dem Papier und das ›Bis daß der Tod euch scheidet‹ pfeifen. Toll, wie? Und noch toller als diese Liebe zu zweit – die Liebe zu dritt! Wie liebten wir beide Babs, besonders ich!
Sie verstehen: Andauernd unterwegs, andauernd vor Kameras und Mikrofonen, im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit mußte ich, und wenn es mir noch so schwerfiel, mich unablässig perfekt verstellen und so tun, als ob ich diese kleine Kröte Babs genauso liebte wie sie mich. Waren doch ständig Reporter und Fotografen und das Fernsehen und die Wochenschauen und die Kerls vom Funk da, nicht wahr. Denn das bildete den infernalischsten und deshalb natürlich größten Publicity-stunt dieses Schweins Rod Bracken: Immer, Sie wissen es, waren Babs und ich bei Sylvia, wo sie auch hinflog, hinfuhr, um zu drehen, immer, immer wir drei! Und immer neue Storys über die wunderbare Liebe, die uns drei verband.
Wie oft, mein Herr Richter, dachte ich in den letzten fünf Jahren: Babs bringe ich um. Und die Mutter dazu. Schlau. Ganz schlau, natürlich. Das perfekte Verbrechen. Um wieder frei zu sein. Frei! Natürlich reine Hysterie von mir. Erstens bin ich für so etwas viel zu feige. Und dann, ich bitte Sie, mein Herr Richter, bedenken Sie, wenn einer, wie ich es war, einen Goldfisch an der Angel hat wie diese Frau, dann bringt er sie nicht um, dann bringt er niemanden um, nicht wahr. Was denn? Dann schwört er, daß er diese Frau liebt! Und ihre kleine Tochter auch! Den Schwur, den einer, wie ich es war, da nicht schwört, den Schwur gibt es nicht.
Verzeihen Sie, mein Herr Richter.
Ich weiß, was Sie brauchen, sind nicht meine Seelenblähungen. Was Sie brauchen, ist die Wahrheit über all jene Ereignisse, die diesem Mann zuletzt eine stählerne Kugel im Herzen beschert haben.
Die Wahrheit, ach …
Die Wahrheit ist nicht schön. Die Wahrheit ist schrecklich. Mir scheint, das ist die Wahrheit immer. Bevor ich diese Wahrheit nun also berichte – und sie wird schlimm sein, abstoßend, grausig, Ihren Schauder erregend –, mußte ich erst das, was Sie eben gelesen haben, loswerden, ich wäre sonst erstickt daran …
Ja nun, und so hat alles begonnen. Am stürmischen, regnerischen Abend des 24. November 1971, einem Mittwoch, in Paris. Als ich, um Verfolger abzuschütteln, kreuz und quer durch die Stadt fuhr, hinaus zu jenem so sehr gesicherten Haus in der Rue Cavé, ganz nahe dem Bois de Boulogne. Als ich dann vor dem Bett in Zimmer 11 im dritten Stock stand und die Bescherung sah. Vollkommen mit dicken weißen Bandagen umwickelt der Kopf. Nur Nase und Mund frei. Plastikschläuche, die aus dem Verband herausliefen, bis zum Boden hinab, in ein Glasgefäß, welches das langsam tropfende Blut sammelte. Als ich auf mein Rufen keine Antwort bekam von Sylvia, die reglos dalag. Fast völlig finster war es in dem Zimmer. Draußen heulte der Sturm, Regen peitschte gegen die Scheiben.
»Sylvia!« Sehr laut.
Keine Reaktion.
Die war weg.
Konnte tot sein, so weg war die.
Das beunruhigte mich schon sehr. Wenn da etwas passiert war? Ein Mann muß schließlich auch an sich denken, nicht wahr …
5
Also tastete ich mich hinaus, die Tür zum Krankenzimmer ließ ich offen, so fiel etwas Licht in den Vorraum, und ich fand die zweite Tür. Dann war ich auf dem schummerigen Gang. Hinunter zu einem Schwesternzimmer. Vor der Tür ein Vorhang, ich mußte ihn zur Seite streifen. Helles Licht! An einem Schreibtisch, umgeben von Medikamentengaben in kleinen Schälchen, über sich Regale mit Klinikpackungen, neben sich Sterilisationsapparate für Injektionsnadeln, saß, in Weiß, eine junge Nonne mit großer Hornbrille. Nanu! Eine Nonne – hier? Mit gleicher Wahrscheinlichkeit konnte man annehmen, solch geistliche Dame dort anzutreffen, wo luxuriös gekratzt wurde. Wahrhaftig, eine Nonne. Langer weißer Kittel, kein Mantel, bewahre, und dieses Ding auf dem Kopf, ich weiß nicht, wie es heißt. Sie wissen es, mein Herr Richter.
»Bon soir, chère sœur …« Hoffentlich war das richtig.
Schien richtig zu sein.
Sie sah auf. So etwas von hübsch! Und geistliche Schwester. Welch ein Jammer. Welche Verschleuderung süßer Sachen. Als ob man’s zum Rausschmeißen hätte! Ich wurde ganz traurig. Hübsch? Eine Schönheit! Rein und tugendhaft. Wenn ich’s mir aussuchen durfte, lagen mir ja mehr die Giftigen. Aber auch bei den Reinen, Tugendhaften dachte ich immer sofort daran. Mein Webfehler: Mir konnten Sie vorführen, was Sie wollten, Weiße, Schwarze, Gelbe, Sanfte, Reine, Giftige, Nutten, Jungfrauen, Hausfrauen, alles, was bloß weiblich ist: Ich dachte garantiert immer sofort daran.
»Guten Abend, Monsieur …« Sie sah mich fragend an.
»Dreizehn«, sagte ich.
»Oh, Dreizehn.« Sie blickte auf einen Zimmerbelegplan. »Sie müssen entschuldigen, ich habe Sie nicht sofort erkannt.«
»Wir haben einander ja auch noch nie gesehen, Schwester.«
»Ich arbeite sonst auch nie hier, in dieser Abteilung, Monsieur.« Sie stand auf. »Hier sind heute zwei weltliche Schwestern ausgefallen. Ich vertrete sie. Ich heiße Hélène.«
»Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Schwester Hélène.«
»Ich arbeite sonst unten im Erdgeschoß. Auch plastische Chirurgie natürlich. Aber Verletzungen, Verbrennungen, Entstellungen nach einem Unfall … bei all diesen armen Menschen. Niemals hier, nein.«
»Natürlich nicht, das kann ich mir denken.«
»Danke für Ihr Verständnis, Monsieur … Ich bin Gegnerin dieser … dieser Schönheitsplastik-Chirurgie … Ich weiß, das steht mir nicht zu … Doch der Allmächtige hat uns Gesicht und Gestalt gegeben nach Seinem Wohlgefallen, in Seiner unergründlichen Weisheit, und …«
»Und hier wird ihm ins Handwerk gepfuscht, ich verstehe sehr wohl.«
»Kann ich etwas für Sie tun, Monsieur?«
»Madame Elf … ich war eben bei ihr. Sie bewegt sich nicht. Sie liegt da wie tot …«
»O nein, Monsieur, nein, mit Madame ist alles in Ordnung! Ich habe nur gehört, daß man sie im OP überhaupt nicht ruhig bekam. Madame fühlte immer noch etwas. Also sehr viel Anästhesie. Und als Madame aufwachte, war sie wieder unruhig und litt. Nun, vor einer Stunde ordnete Professor Delamare an, daß sie eine Spritze bekam.«
»Womit?«
»Domopan. Fünf Kubikzentimeter. Jetzt ist sie natürlich ruhig.«
»Domopan?«
»Ja, Monsieur.« Auf Hélènes Brust baumelte, an einer dünnen Kette, ein schwarzes Holzkreuz. Plötzlich war ich sentimental. (Die Sentimentalität der Wölfe.) Es mußte, dachte ich, eine angenehme Sache sein, an Gott zu glauben, in sich ruhend und auf Ihn vertrauend, in Frieden lebend, seine Pflicht tuend, still und bescheiden, aller Laster, allen Übels frei, glücklich und leicht, von Tag zu Tag. Ja, sicher, eine angenehme Sache. »Sehen Sie, das war eine sehr anstrengende Operation für Madame – totales Gesichtslifting, Halslifting, dazu die Augenlider. Und alles auf einmal!«
»Na ja, aber gleich Domopan …«
»Ich sagte Ihnen doch, Madame ist sehr unruhig gewesen.« Ich sah, wie sich das Holzkreuz auf ihrer gewiß schönen, jungen Brust hob und senkte. Ich sah schnell weg. »Seien Sie wirklich ohne Sorge. Sie sind es nicht, wie?«
»Nein.«
»Ich sehe es.« Was für eine sanfte, gute Stimme. Also stellte ich mir etwas vor. Wie gesagt, wenn ich einer Frau gegenüberstand – jeder fremden, überall in der Welt, gleich, in welcher Situation –, ich mußte mir immer etwas vorstellen. Man kann leiden unter diesem Tick, glauben Sie das, mein Herr Richter! »Professor Delamare ist nicht mehr hier. Ich will Sie aber gerne mit seiner Wohnung verbinden.«
»Tun Sie das bitte, Schwester.«
Sie ging langsam, mit so viel Würde, so viel Grazie zum Schreibtisch und wählte. Dann hatte ich Professor Max Delamare am Apparat.
»Erfreut, Ihre Stimme zu hören, Monsieur!« Professor Delamare, dem diese Klinik hier draußen in Neuilly gehörte, war einer der drei besten plastischen Chirurgen der Welt. Bei ihm ließen sich Kaiserinnen, Königinnen, Schauspielerinnen und Sängerinnen, die ersten Damen der ersten Gesellschaft restaurieren (was da eben so anfiel, da gab es nichts, das Delamare nicht wieder in Ordnung brachte, Brüste, Beine, Bäuche, Popos, Hüften, Hälse, Nasen, Ohren, Lider, ganze Gesichter, einfach alles!), zu ihm kamen weltbekannte Rennfahrer, die man, gerade noch lebend, aus ihren brennenden Kisten gezogen hatte, kamen Milliardäre, denen böse Menschen die Kiefer oder sonst etwas beschädigt hatten, Maurer, die vom Gerüst gefallen waren, in einen Trog Mit ungelöschtem Kalk auch noch, oder etwa Sekretärinnen mit einer Stinknase – etwas sehr Peinliches, das Opfer ist völlig unschuldig, it just happens. Solche Menschen behandelte Delamare umsonst. Der Mann hatte ein Gewissen. Wenn er den Reichen schon Unsummen abnahm, so operierte er die Armen, ohne etwas zu verlangen. Auch so einer, wie ich nie sein werde, dachte ich. Mit Samtstimme beruhigte er mich: »Drei Stunden und vierzehn Minuten haben wir operiert, Monsieur. Wie gut, daß wir die Voruntersuchungen so gründlich gemacht haben, lieber Freund. Alles ist tadellos verlaufen, mein Wort darauf. Phantastisch gelungen, alles.«
»Wir haben aber doch vereinbart, daß ich abends herkomme, um mit Madame zu sprechen. Sie wissen, wie sehr sie es sich gewünscht hat …«
»Ich weiß. Aber glauben Sie mir, das Domopan war unbedingt nötig. Madame mußte unter allen Umständen ruhiggestellt werden. Natürlich, Monsieur, hat es wahrscheinlich nun keinen Sinn … sie schläft sehr tief …«
»Soll ich warten?«
»Das kann vielleicht stundenlang dauern, Monsieur. Natürlich dürfen Sie, wenn Sie wollen, auch die ganze Nacht in der Klinik verbringen. Schwester Hélène wird Ihnen ein freies Zimmer geben. Aber eigentlich bin ich dagegen.«
»Warum?«
»Die erste Zeit ist immer die schlimmste. Mir wäre es angenehmer, wenn Sie erst morgen abend wiederkämen …«
Worauf ich wohlige Wärme verspürte. Na, dann aber nichts wie weg! Brief für Sylvia? Unnötig. Den konnte sie mit ihren verbundenen Augen doch nicht lesen.
»Ich verstehe, Herr Professor. Ich werde also morgen abend vorbeischauen.«
»Tun Sie das, Monsieur. Gute Nacht.«
»Gute Nacht, Herr Professor. Und vielen, vielen Dank.«
»Ich bitte Sie! Es ist mir eine unendliche Ehre gewesen«, sagte er, und ich dachte, daß ich gespannt auf seine Rechnung war.
»Beruhigt, Monsieur?« Bebrilltes Engelsgesicht Hélène sah mich lächelnd an, als ich den Hörer in die Gabel gelegt hatte.
»Ja, gewiß. Ich werde also gehen. Ach, tun Sie mir einen Gefallen …«
»Gerne, Monsieur.«
»… und sagen Sie Madame, wenn sie aufwacht …«
»Ja, Monsieur?«
Seriös jetzt, Kaven! Ernst und mit Inbrust!
»… daß ich hier war, daß ich sie über alles liebe und daß ich morgen abend wiederkomme.«
»Das will ich ausrichten. Und ich will für Sie beide beten.«
»Was wollen Sie tun?«
»Beten«, sagte sie still. »Man liest es in der Zeitung, man glaubt es nicht. Nun ist man Augenzeuge …«
»Wovon?«
»Von einer so großen Liebe«, sagte Schwester Hélène. »Gott will, daß wir einander lieben. Ich werde beten, daß Er Sie beschützt.«
»Ja«, sagte ich, »bitte, liebe Schwester Hélène.«
»… und daß Er Ihnen noch viele schöne Jahre schenkt und alles Unheil von Ihnen abwendet«, sagte sie, und da war ein Leuchten in ihren Augen. Bei allem, was dann passiert ist, bis zu dieser Stunde, mein Herr Richter, muß ich immer daran denken, daß diese Schwester Hélène für unseren Frieden beten wollte und dafür, daß Gott uns noch viele schöne Jahre schenkte und alles Unheil von uns abwandte.
6
Ich gab Schwester Hélène die Hand und ging den Gang hinunter zum Lift. Nur weg hier jetzt, und schnell. Dann schaffte ich es noch ganz leicht zu Suzy. Und bei Suzy konnte ich mir dann in aller Ruhe, ohne Hast und ohne Hetze, ein paar schöne Stunden machen.
Sehen Sie, mein Herr Richter, ich sagte, Sylvia sei rasend eifersüchtig gewesen. War sie auch. Aber man kann so eifersüchtig sein, wie man will, und dem Partner doch niemals etwas nachweisen, wenn der Partner es nur geschickt genug anfängt. Ich hatte in den Städten, in die wir gekommen waren, immer noch Mädchen oder junge Frauen gefunden, zu denen ich flüchtete, wenn ich den Streß – lachen Sie bitte nicht, das ist genau das richtige Wort! –, wenn ich den Streß einfach nicht mehr aushielt, wenn Sylvia einfach allzu meschugge wurde. Ich meine: Selbst einer wie ich ist ja nicht eben darauf aus, ist ja nicht gerade besessen von dem Gedanken, sich nun unbedingt einen Herzinfarkt zu holen in seinem Beruf, nicht wahr.
Und so, um fit zu bleiben, um alles ertragen zu können – eigentlich geschah das Ganze für Sylvia, zu ihrem Guten, denn nur so konnte ich ihr dann, ausgeglichen und abgeklärt, in schwierigen und gefährlichen Situationen zur Seite stehen –, war es mir natürlich trotz allem immer wieder gelungen, fremdzugehen, eine süße Kleine aufzureißen, wo immer wir waren.
Ich will Ihnen keine Tips geben, mein Herr Richter, vielleicht sind Sie glücklich verheiratet, ich weiß es nicht, ich muß das nur erklären: In einer Lage wie der meinen ist es natürlich von fundamentaler Wichtigkeit, ist es überhaupt die conditio sine qua non, daß solch eine Kleine dann nicht etwa auf so hübsche Ideen kommt wie etwa die, Sie zu erpressen oder ihre Erlebnisse mit Ihnen einer Illustrierten zu verkaufen oder auch nur vor Freundinnen damit anzugeben. Wie verhindert man das? Ganz einfach verhindert man das. Man nimmt sich nur diejenigen von den süßen Kleinen, die entweder gut verheiratet sind, wenn’s geht mit einem reichen Mann, oder solche, die mit einem reichen Mann verlobt sind und vor der Heirat stehen. Das ist schon alles. Wenn Sie so vorgehen, können Sie ruhig schlafen. Allein. Und mit der Dame. Da passiert garantiert nichts. Ich habe nie anders als ruhig geschlafen.
Hier in Paris hatte ich vor einem Jahr etwas mit einer Kosmetikerin angefangen. Tolle Nummer, meine Suzy. Offiziell verlobt mit dem noch minderjährigen Sohn eines Grafen, der mehrere große Textilfabriken in Roubaix, Nordfrankreich, besessen hatte. Papa und Mama tot. Der zarte Knabe Alleinerbe, Millionär. Testamentarisch hatte Papa bestimmt, daß er im Augenblick seiner Volljährigkeit die Fabriken, zwei oder drei Schlösser, Weinberge, Ländereien, Wälder, was halt so zusammenkam, direkt erhalten sollte. Dann sollte er auch tun und lassen können, was er wollte. Bis zu dem Moment gab es Vormünder, Anwälte, Treuhänder für ihn. Suzy hatte dem Knaben seine Nägelchen manikürt an dem Tag, an dem ich – von einer ihrer Angestellten – die meinen maniküren ließ in ihrem Salon. Ob man will oder nicht – und ich wollte! –, beim Friseur und in einem Kosmetiksalon hören Sie jedes Wort, das in Ihrer Nähe gesprochen wird. Na, um es kurz zu machen, als meine Hände bildschön waren, wußte ich über alles Bescheid. Und Suzy wußte natürlich, wer ich war – mein bildhübsches Gesicht sehen Sie jeden Tag (jetzt natürlich erst recht!) auf Kupfertiefdruckpapier, Rotationspapier, Postkarten, im Fernsehen, im Kino. Das Maniküren fand am Nachmittag statt. Das andere dann am Abend. (Sylvia hatte Nachtaufnahmen.)
Wann immer ich jedenfalls in Paris war, schaffte ich es, Suzy zu treffen. In ihrer Wohnung. Dann trieben wir es, daß uns beiden zuletzt immer die Knie schlackerten. Dazu die meinige! Zu anstrengend, finden Sie? Wissen Sie, mein Herr Richter, in dieser Beziehung – und sollte es die einzige sein! – stelle ich, in aller Bescheidenheit gesagt, so etwas wie eine besonders wohlgelungene Schöpfung der Natur dar.
Ach ja, noch etwas.
Ich sagte meinen Kleinen immer sofort, daß ich Sylvia niemals verlassen und etwa sie ehelichen konnte. Und daß eine solche Heirat ja Wahnsinn gewesen wäre, denn ich besaß überhaupt kein Geld, nicht einmal so viel, um ihnen mehr als ein paar Blumen oder eine Bonbonniere zu schenken. Seltsam, alle meine Kleinen haben das immer sofort akzeptiert. Sie haben gewußt, daß ich die Wahrheit sagte, wenn ich sagte: Auf mich könnt ihr nicht bauen. Und trotzdem! Wie die Verrückten, mein Herr Richter, wie die Verrückten! Seltsam, welchen Glanz die Ruhmessonne Sylvias auch auf mich warf.
Dieser Suzy hatte ich schon von Zürich aus – Hauptpostamt natürlich, nicht Hotel, ich bin kein Trottel! – mein Eintreffen telefonisch avisiert. Sie war selig gewesen, besonders als ich ihr sagte, ich würde diesmal zwei, drei Monate Zeit haben. Da hatte sie zu weinen begonnen. Ich mußte diesmal wirklich so lange in Paris bleiben, denn Sylvia konnte Professor Delamares Klinik ja erst verlassen, wenn ihr Gesicht völlig abgeschwollen, alle Fäden gezogen und keine Spuren des Liftings mehr zu sehen waren, nicht wahr. Ja, also da weinte Suzy vor Glück …
Ich war den Gang sehr schnell hinabgegangen. Nun drückte ich auf den Knopf, der den Lift heraufholte. Ich freute mich auf Suzy. Ich sah sie vor mir, nackt. Sie hat den aufregendsten …
»Monsieur! Monsieur!«
Ich drehte mich um.
Schwester Hélène kam mir nachgeeilt.
»Was gibt es, Schwester?«
»Madame hat eben geläutet …« Hélène rückte an ihrer Brille. Das Kreuz auf ihrer Brust hob und senkte sich hastig, sie war sehr schnell gelaufen. »Madame ist aufgewacht … Sie hat gefragt, ob Sie da sind, da waren, Monsieur …«
»Und?«
»Natürlich habe ich ja gesagt.«
Trampel, frommer.
»Natürlich, Schwester.«
»Ich sagte, Sie seien gerade weggegangen …« Der Lift kam summend an und hielt. »… aber ich wollte sehen, ob ich Sie noch erreichen konnte.«
»Sehr freundlich von Ihnen, liebe Schwester Hélène.« Ich hoffte, daß das, was ich produzierte, ein Lächeln war. Jemand mußte irgendwo auf einen anderen Aufzugknopf gedrückt haben. Die erleuchtete Kabine hinter der Milchglastür verschwand. Mit ihr meine Munterkeit.
»Nun habe ich Sie zum Glück noch erreicht!« Hélène strahlte. »Ja«, sagte ich. »Zum Glück!«
»Madame will Sie unbedingt sprechen! Bitte, kommen Sie!« Sie eilte schon voraus.
Scheiße.
Sehen Sie, was da immer noch alles dazwischenkommen konnte? Haben Sie jetzt eine erste kleine Vorstellung von dem Leben, das ich geführt habe?
Ja?
Wissen Sie, was? Ich könnte Ihnen ruhig ein wenig leid tun.
7
Wölfchen …«
»Ja, mein Hexlein.«
»Gib mir … Hand …«
Sylvia tastete mit ihrer Rechten über die Bettdecke, im Krankenzimmer brannte jetzt das Licht einer Stehlampe, aber sie konnte ja nichts sehen. Mit ihrem Verband war sie blind. Das Licht machte alles nur noch gräßlicher. Der weißbandagierte Kopf schien zu wachsen wie eine entfesselte Seifenblase, ein Luftballon mit zuviel Luft. Ich dachte mit Schaudern: Das geht nicht gut, das muß ja platzen, in tausend Stückchen fliegt die weiße Kugel mit Sylvias Kopf darin durchs Zimmer!
»Du sollst mir … Hand geben!« Jetzt sprach sie französisch. Die ersten Sätze hatten wir deutsch gewechselt. Das ging von nun an so weiter in drei Sprachen, Englisch kam auch noch dazu. Domopan eben. Sylvia war zu sich gekommen, aber nur für Augenblicke, ansonsten meilenweit davon entfernt, wirklich klar zu sein. Bei ihr gingen Sprachen, Zeiten, Situationen durcheinander.
»Hier ist doch meine Hand!« (Französisch.) Ich hatte sie Sylvia gegeben. Die ihre war nun plötzlich sehr heiß und sehr feucht. Über den blauen Lippen des freigelassenen Mundes flatterten lustig ein paar Fäden des Verbandes, sobald Sylvia sprach – mit einer völlig fremden Stimme übrigens, ich hätte sie niemals erkannt, wenn man mir nicht gesagt hätte, daß meine Dame in Zimmer 11 lag. Die war vielleicht noch voll. Oder, dachte ich, hat Schwester Hélène etwas verwechselt, und da liegt eine andere vor mir? Unsinn! Woher sollte eine andere meinen Kosenamen wissen? Nein, nein, das war sie schon, das war schon Sylvia Moran, geliebt von der Welt. Ich sah, wie ein bißchen Blut in die Plastikschläuche sickerte, die dort, wo Sylvias Ohren sein mußten, aus dem Kugelverband kamen, plup, plup, plup, Blut, Luftbläschen, Blut, und wie das Zeug dann seinen Weg nahm durch die dünnen Schläuche tief hinab in das Gefäß unter dem Bett, plop, plop, plop.
»Es … war … furchtbar … Wölfchen …«
»Mein armes Hexlein«, sagte ich und atmete dabei so flach wie möglich, denn nun, da sie sprach, erschien mir der Hospitalgeruch hundertmal intensiver. Hoch mein Magen. Runter mein Magen. Die Liebe ist eine Himmelsmacht.
Wölfchen – so nannte sie mich. Hexlein – so nannte ich sie, beide Namen hatte Sylvia für uns ausgesucht. Sie fand das süß. Weil Liebende sich doch Kosenamen geben. Sagte sie. Verliebte Damen hatten mir ganz andere Namen gegeben und ich, desgleichen verliebt, auch jenen Damen ganz andere. Indessen: Folgsam natürlich war ich sogleich auf Sylvia eingegangen.