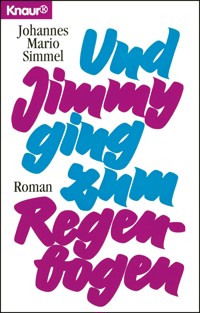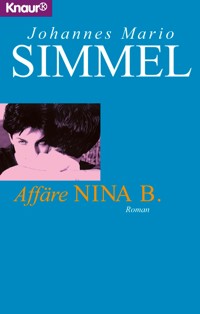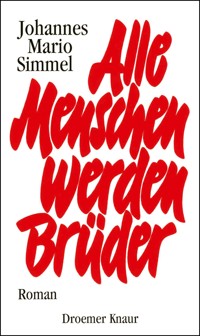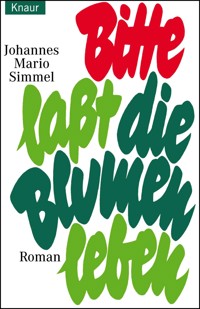6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Wie in Zweiundzwanzig Zentimeter Zärtlichkeit« so sagt Johannes Mario Simmel, »liegen in Die Erde bleibt noch lange jung vor dem Leser viele - natürlich sehr persönliche - Momentaufnahmen aus vergangenen Zeiten, so wie ich, der Reporter, sie gesehen und festgehalten habe. Es sind Geschichten, bei denen es um Recht und Unrecht, Hunger und Überfluß, Krieg und Frieden geht, um lustige und traurige, empörende und das Herz erhebende Ereignisse, um Revolutionen, um Menschen, die Menschen töten, und um Menschen, die Menschen helfen, um mächtige Politiker und um kranke Kinder, die beinahe elendiglich verreckt wären. Ganz gewiß sind alle diese Storys nicht weltbewegend. Aber ich denke mir immer: In den kleinen Geschichten der kleinen Leute spiegelt sich der Geist der Zeiten klarer wider als in den großen Geschichten der heroischen Helden-Helden. Und darüber sind wir sicherlich alle einig: Die heroischen Helden-Helden-Geschichten waren doch immer die schlimmsten. Gott schenke uns Frieden.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Johannes Mario Simmel
Die Erde bleibt noch lange jung
und andere Geschichten aus fünfunddreißig Jahren
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Liebe Leserin, lieber Leser!
Als 1979 mein Geschichtenband ›Zweiundzwanzig Zentimeter Zärtlichkeit‹ erschien, war ich trotz aller Bestseller-Ehren (und -Schmähungen), die mir seit rund zwei Jahrzehnten zuteil geworden sind, doch etwas skeptisch: Wird, so überlegte ich, meine ›Gemeinde‹ – und ich bin sehr stolz darauf, daß ich, wie mir der tägliche Posteingang beweist, wirklich eine ›Gemeinde‹ habe! – die kleinen Geschichten aus einem Dritteljahrhundert ebenso gerne lesen wie meine dicken Romane? Ich hatte mächtig kalte Füße, kann ich Ihnen flüstern.
Zu meiner großen Überraschung und noch größeren Freude ist dann das Buch ›Zweiundzwanzig Zentimeter Zärtlichkeit‹ ebenfalls ein Bestseller geworden, und alle meine Befürchtungen waren umsonst gewesen. Sie, liebe Leser, haben jenen ersten Geschichtenband begeistert aufgenommen. Dafür danke ich Ihnen sehr herzlich!
Was geschehen ist, gibt mir den Mut, hier nun eine weitere Auswahl von Geschichten aus fünfunddreißig Jahren mit dem Titel ›Die Erde bleibt noch lange jung‹ folgen zu lassen. In die große Kiste voll aberhundert Storys, die ich als Reporter geschrieben habe, bin ich nochmals hinabgetaucht. Und bin wiederum fündig geworden. Wie im ersten Band meiner Geschichten geht es auch im zweiten um Recht und Unrecht, Hunger und Überfluß, Krieg und Frieden, um lustige und traurige, empörende und das Herz erhebende Ereignisse, um Revolutionen, um Menschen, die Menschen töten, und um Menschen, die Menschen helfen, um mächtige Politiker und um kranke Kinder, die beinahe elendiglich verreckt wären. Und weil ich doch fünfzehn Jahre lang Reporter einer großen Illustrierten und daselbst ›das Mädchen für alles‹ gewesen bin, gibt’s auch Muttertags- und Weihnachtsgeschichten sowie solche zu ähnlich erbaulichen Anlässen zu lesen.
Wiederum, wie beim ersten Band, liegen hier viele – natürlich sehr persönliche – Momentaufnahmen aus den vergangenen Jahren vor Ihnen, so, wie ich, der Reporter, sie gesehen und festgehalten habe. Es würde mich sehr glücklich machen, wenn sich aus den vielen Einzelaufnahmen so etwas wie ein Bild der Zeit, in der wir gelebt haben und leben, zusammenfügte.
Ganz gewiß sind alle diese Geschichten nicht weltbewegend gewesen. Aber ich denke mir immer: In den kleinen Geschichten der kleinen Leute spiegelt sich der Geist der Zeiten klarer wider als in den großen Geschichten der heroischen Helden-Helden. Und darüber sind wir sicherlich alle einig: Die heroischen Helden-Helden-Geschichten waren doch immer die schlimmsten. Gott schenke uns Frieden.
Im Januar 1981
J. M. S.
Woran ich glaube
Geschrieben 1946, im Trümmer-Wien. Heute, 1981, glaube ich noch immer daran. Trotz allem …
Dies ist eine nachdenkliche Geschichte.
Sie hat den großen Vorteil, wahr zu sein, obwohl es Mitteleuropäern vielleicht schwerfallen wird, sie zu glauben. Das liegt jedoch nicht an der Mentalität der Geschichte, sondern an der Mentalität der Mitteleuropäer. Die Geschichte ereignete sich in Amerika. Da sie eine Lehre hat, die auch uns angeht, soll sie hier erzählt werden.
Edward J. Thompson war ein intelligenter Mensch. Er lebte in einer kleinen Stadt des amerikanischen Mittelwestens und war Herausgeber und Redakteur einer Tageszeitung. Die Auflage des Blattes entsprach der Einwohnerzahl – sie war sehr bescheiden. Das Organ hieß: ›The Daily Trumpet‹ – ›Die tägliche Posaune‹.
Daneben gab es noch eine zweite Zeitung. Sie wurde herausgegeben von Kenneth Williams und nannte sich ›Town News‹ – ›Stadtnachrichten‹. Die ›Town News‹ und die ›Daily Trumpet‹ lagen in einem schweren Konkurrenzkampf. Edward J. Thompson war, wir sagten es schon, ein intelligenter Mensch. Aber auch Kenneth Williams war kein Idiot. Thompson hatte mehr Ehrgeiz, das war der ganze Unterschied. Sein Ehrgeiz bestärkte ihn in der Ansicht, daß seine Zeitung (obwohl sie bei weitem die jüngere war) die interessanteren Nachrichten und Geschichten brachte und daß sie deshalb auch mit der Zeit die Leser der ›Town News‹ gewinnen würde. Weil er dieser Ansicht war (und weil er genügend Intelligenz und fachliches Können besaß), zog er aus dieser Überzeugung eine Kraft und eine Stärke, eine Kühnheit und eine Originalität, die ›The Daily Trumpet‹ tatsächlich von Monat zu Monat beliebter werden ließ und ihre Auflagezahl weiter und weiter emportrieb.
Kenneth Williams besaß die geringere Spannkraft. Er war schon länger Journalist, und er hatte wenig Ehrgeiz. Aber schreiben konnte er ebenso gut wie sein Kollege von der ›Trumpet‹! Die Leitartikel, in denen die beiden sich, um in einen nördlichen Dialekt zu verfallen, ›Saures gaben‹, waren eine Freude und Quelle der Heiterkeit für alle Bürger der kleinen Stadt.
Die Leute lachten über die witzigen Hiebe, welche die beiden Chefredakteure einander beibrachten. Sie achteten Thompson und Williams für die Freimütigkeit und den Mut, mit denen sie ihre Ansichten vertraten. Und daneben achteten sie auch sich selbst und ihr Land, in dem diese Übung der freien Meinungsäußerung sozusagen zum Hausgebrauch gehört.
Edward J. Thompson jedoch war ehrgeizig. Sein Traum war es, zwei Zeitungen zu besitzen. Den ›Town News‹ ging es bald hundeelend, Kenneth Williams machte Schulden und konnte nur noch schwer seinen Verpflichtungen nachkommen. Und eines Tages erklärte er sich bereit, seine Zeitung zu verkaufen. Es fiel ihm sehr schwer, aber er war kein Idiot und wußte, was er tun mußte, wenn er nicht unverantwortlich handeln wollte.
Edward J. Thompson kaufte die ›Town News‹ und machte Williams den Vorschlag, als stellvertretender Chefredakteur des zweiten Blattes bei ihm einzutreten. Dies lehnte Williams ab mit der Begründung, daß er nicht die Absicht habe, plötzlich seine Meinungen und Ansichten zu ändern und so zu schreiben, wie Thompson es von ihm mit Recht verlangen könne, wenn er ihn mit seinem Geld bezahle. Es gehe ihm, sagte er, gegen den Strich. Er werde schon nicht verhungern. Schließlich könne er immer noch Fernlastfahrer werden.
Edward J. Thompson zuckte die Achseln und engagierte einen Herrn, der eine Leidenschaft dafür besaß, anderen Herren nach dem Munde zu reden. Dieser Herr übernahm die Leitung der neuen ›Town News‹. Er war so sehr bemüht, seinem Chef und Brotherrn wohlgefällig zu sein, daß nun Tag für Tag in den beiden Blättern praktisch dasselbe stand. Und da geschah das Unerwartete:
Edward J. Thompson, der eine weitere Erhöhung der Auflage erwartet hatte, erlebte eine böse Überraschung. Denn die Auflage stieg nicht. Im Gegenteil. Sie fiel. Und sie fiel beträchtlich. Nicht nur bei den neuen ›Town News‹. Sondern auch bei der ›Daily Trumpet‹. Warum? Weil die Leser plötzlich fanden, daß ihnen die beiden Blätter nicht mehr gefielen. Daß sie beide dasselbe sagten. Daß sie langweilig und unaufrichtig, frömmelnd und humorlos geworden waren – daß man sie nicht mehr kaufen konnte, weil sie keine Meinung mehr hatten.
Thompson dachte kurz, aber angestrengt nach. Er wußte, daß es das Fehlen jeder Gegnerschaft, der Mangel an fairer Opposition war, die ihm und seinen Zeitungen schadete. Er hatte zwar mit Kenneth Williams, aber nicht mit seiner Leserschaft gerechnet. Er mußte zugeben: Die beiden Zeitungen waren schlechter. Er merkte es selbst, wenn er seine Artikel schrieb: Sie schienen ihm dumm und einfallslos, bloßes Gewäsch und Getratsch. Thompson hatte plötzlich brennende Sehnsucht nach seinem klugen, mutigen und lustigen Feind. Und weil er ein intelligenter Mensch war, der sich nicht scheute, einen Fehler einzugestehen, tat er das einzig Richtige. Er besuchte Kenneth Williams und wiederholte seinen Vorschlag.
»Arbeiten Sie mit mir«, sagte er.
Williams erwiderte etwas Undruckbares.
»Sie mißverstehen mich«, sagte Thompson. »Ich will nicht, daß Sie in meinem Sinne schreiben. Im Gegenteil! Wenn ich Sie einmal dabei erwische, werfe ich Sie hinaus …«
»Wie denn soll ich schreiben?«
»So wie früher, als Sie noch Chef der ›Town News‹ waren.«
»Gegen Sie?«
»Ja«, sagte Thompson. »Gegen mich. Nur unter dieser Bedingung engagiere ich Sie. Nur unter dieser Bedingung können wir zusammenarbeiten. Als Gegner. Und als Verbündete in unserem gemeinsamen Kampf.«
»In welchem Kampf?«
»Im Kampf um die Freiheit der Presse, die Freiheit des Gedankens und im Kampf gegen die Verdummung der Massen. Wollen Sie mit mir gehen?«
»Jawohl«, sagte Kenneth Williams. Und dann warf er seine Chesterfield fort, beleckte seinen Bleistift und verfaßte einen Leitartikel gegen Edward J. Thompson, von dem man nur sagen kann, daß er sich gewaschen hatte.
Damit ist unsere Geschichte zu Ende. Ohne Zweifel stieg die Auflage der beiden Zeitungen wieder, nachdem Kenneth Williams an die Stelle des Herrn getreten war, der eine Leidenschaft dafür besaß, anderen Herren nach dem Munde zu reden. Ohne Zweifel wurden die beiden Zeitungen wieder besser, so gut, wie sie am Anfang gewesen waren. Ich glaube sogar, daß sie noch besser wurden. Denn nun wußten die beiden Leute, die sie führten, worum es ging. Nun zogen sie am selben Strick. Nun waren sie auf dem rechten Weg.
Wir leben nicht in Amerika. Wir leben in einem ganz anderen Land, unter ganz anderen Umständen, und wir haben ganz andere Zeitungen. Aber wir haben im Grunde doch alle dieselben Sorgen und dieselben Probleme. Nicht die kleinen Sorgen und Probleme, über die wir sprechen. Sondern die ganz großen, über die wir schweigen und an die wir nur nachts denken, wenn wir nicht schlafen können: die Sorge um den Frieden und das Glück unserer Kinder zum Beispiel, das Problem der Gleichberechtigung aller Menschen und die Freiheit von Furcht und Not. Was wir brauchen, sind Männer wie Edward J. Thompson und Kenneth Williams. Das ist es, woran ich glaube.
Ich will den Hamlet spielen
Warum soll ich, der Bücherschreiber, nicht Theater spielen, wenn ich dazu den Drang verspüre – so wie es die Schauspieler (und andere Nicht-Bücherschreiber) unwiderstehlich zum Buchmachen drängt? Das habe ich mich anläßlich der Buchmesse 1978 gefragt.
Ich will den Hamlet spielen. Und das werde ich auch. Am Schillertheater in Berlin. Barlog hat’s mir versprochen. Die Proben beginnen zur gleichen Zeit wie die Buchmesse in Frankfurt – am 10. Oktober. Früher war ich zu jener Zeit immer dort. Jetzt brauche ich nicht mehr hinzufahren. Das kommt, weil so viele Schauspieler Schriftsteller geworden sind. Hat mich doch mächtig beeindruckt, zu sehen, wie schnell und mit welcher Wucht dieser Wandel gekommen ist. Nicht nur Schauspieler übrigens haben zur Feder gegriffen – auch Generäle, Zuhälter, Politiker, Showmaster, Callgirls, Kaiserliche und Königliche Hoheiten, Balletteusen, Bergsteiger, Mediziner, Scharfrichter, Gastronomen, Musiker, Boxer, Fernseh-Nachrichtensprecher, Maler und Rennfahrer. Und die Fußballer!
Frankfurt im Herbst – ein völlig neues Messe-Gefühl! War ja aber auch schon wirklich an der Zeit. Ewig die gleichen Typen, ewig Schreiber, die Bücher geschrieben hatten. Fad. Jetzt ist es endlich wieder eine Hetz!
Die oben erwähnten Herrschaften haben an ihr literarisches Talent geglaubt, einen starken inneren Drang empfunden, konnten die Tinte nicht mehr halten, und bums hatten sie etwas Schriftliches unter sich gelassen. Die Herren Verleger haben vor Begeisterung geschluchzt. Gott sei Dank – endlich andere, bessere, schönere, klügere und interessantere Autoren!
So ein furchtbarer innerer Drang, so ein Glaube an eine Berufung hat nun aber auch mich ergriffen – nämlich auf die Bühne zu steigen. Gleiches Recht für alle. Ich habe das Bücherschreiben getragen siebenunddreißig Jahr. Ich will es tragen nimmermehr.
Da sehe ich jetzt die Kritiker zittern. Plötzlich denken sie darüber nach, was aus ihnen werden soll, wenn ich keine Bücher mehr schreibe. Blitzartig überkommt sie die Erkenntnis, daß ich ihre Existenzgrundlage gewesen bin. Wovon leben, wenn man den Simmel nicht mehr in der Luft zerreißen, in den Boden stampfen, zur Sau machen kann in Zeitungen, in Magazinen, im Rundfunk, im Fernsehen? Wenn’s keinen Simmel mehr gibt zum Leichenfleddern für Analysen, Magisterarbeiten, Dissertationen? Was sind wir ohne den Simmel, fragen die Kritiker einander bleichen Angesichts.
Gemach, liebe Feinde, gemach.
Nicht verzagen, Simmel fragen!
Der sagt euch: Angst vor Arbeitslosigkeit? Keine Spur! Jetzt könnt ihr euch doch auf alle die neuen Autoren stürzen, die euch die blanke Brust bieten. Kapiert? Na also.
Da kommt schon wieder Farbe zurück in die verzagten bleichen Angesichter. Macht nun also die Bücher der Neuen zur Sau, daß das Herz im Leibe lacht. Schreibt eure Kritiken wie bisher am besten, ohne das Buch gelesen zu haben – das befähigt bekanntlich zu gänzlich unbefangener und objektiver Einschätzung!
Jetzt sehe ich, daß die neuen Autoren das Zittern kriegen. Tja, daran hättet ihr früher denken müssen! Warum zittert ihr eigentlich? Auf der Bühne seid ihr doch auch verrissen worden, daß es nur so geraucht hat, oder?
Nicht verzagen, Simmel fragen. Und der sagt euch: Jeder der grimmigen Herren von der Kritik hat zwei bis elf eigene Romane oder Theaterstücke im Schreibtisch, die mangels Verleger- bzw. Intendanten-Interesse für alle Zeit dort liegenbleiben. Auch Kritiker sind arme Schweine. Seid nett zu ihnen.
Und so erlaube ich mir, liebe Neu-Schriftsteller, aus dem reichen Schatz meiner Erfahrung ein paar wohlgemeinte Ratschläge zu erteilen.
Alsdern:
Es ist von größter Wichtigkeit, präpotent aufzutreten – nicht erst auf der Buchmesse, schon beim Verleger! Ihr seid nicht, was ihr seid, ihr seid auch keine Schriftsteller, ihr seid Dichter, verstanden? Wohl steht es indessen (insbesondere Damen) des weiteren an, sich mystisch, dunkel, scheu (Rehlein!) oder nymphomanisch zu geben. Auch ein Erotomane ist was Feines.
Ein alter Nazi, der sich beknirscht darüber, daß er der Versuchung, unter dem Anstreicher Karriere zu machen, nicht widerstehen konnte, bringt es glatt auf drei dicke internationale Bestseller.
Ihr wollt eure Bücher selbst schreiben? Na schön, bitte. Ich stelle anheim. Müssen tut ihr es nicht. Keinesfalls ist es vonnöten, selber einen einzigen korrekten deutschen Satz schreiben zu können. Ihr bekommt jederzeit einen Ghostwriter.
Jetzt geht es um einen ganz wichtigen Punkt, meine Lieben. Ein Zahnarzt, der immer nur die falschen Zähne zieht, ein Fußballer, der ins eigene Tor schießt, ein Politiker, der ehrlich ist – das dürfte wohl nicht ganz das richtige sein. Generäle sind eine Ausnahme. Die müssen bei uns zuerst Kriege anfangen und dann verlieren. Aber all die anderen Leutchen würde man über kurz oder lang feuern. Und das muß verhindert werden von euch, nun, da ihr Dichter sein wollt.
Es ist gar nicht schwer. Hattet ihr in eurem alten Beruf auch nur einen Namen, den Millionen kennen, oder ein Gesicht, an das sich Hunderttausende gewöhnt haben, dann wird euch der Verleger einen enormen Vorschuß anbieten oder, wenn ihr störrisch seid, aufdrängen. (Zu meinen Zeiten ging das noch anders zu, aber heute …) Und jetzt kommt’s: Ihr nehmt das Geld, und ihr liefert kein Manuskript. Man wird euch durch immer neue Geschenke, gute Worte und neues Geld zu überreden versuchen, doch wenigstens immer mal wieder ein paar Seiten herauszurücken. Dies Spielchen treibt ihr so lange, bis euch der Verleger enttäuscht (heißt: nicht mehr zahlt, sondern droht). Dann liefert ihr ein Teil-Manuskript (in extremen Notfällen auch ein vollständiges Manuskript) ab. Ihr oder der Ghostwriter habt natürlich Käse geschrieben. Tja, aber da liegt das Ding nun.
Lektoriert, redigiert, korrigiert wird das auf keinen Fall, darauf müßt ihr beharren. Ihr kontert jeden Einwand mit den Worten: »Es ist der Wille des Autors.« Da ist so ein Verleger machtlos. Und weil er schon so viel investiert hat, druckt er das Werk. Und gibt eine rauschende Buchpremiere in einem Fünf-Sterne-Hotel. Und das Werk kauft dann natürlich kein Aas. Darum müßt ihr zu Gott dem Allmächtigen flehen: daß kein Aas das Werk kauft. Denn warum? Der Verleger wird – aber ja doch, ich schwöre es euch – kommen und euch einen weiteren enormen Vorschuß auf ein weiteres Buch geben, denn er sieht in der Chance, daß so ein weiteres Buch ein Bestseller wird, die einzige Möglichkeit, das bereits ausgegebene Geld wiederzuerhalten – und vielleicht noch ein Scherflein dazu. Geht auch das zweite Werk in den Eimer, dann könnt ihr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen dritten enormen Vorschuß erwarten, weil, schon rein mathematisch, jeder neue Mißerfolg die Voraussicht erhöht, daß ein weiteres Werk den Buchhändlern aus den Händen gerissen wird.
Beim Roulette kommt ja auch nicht immer nur Rot oder Schwarz. So eine Strähne läuft manchmal lange. Wenn sie eurem Verleger zu lange läuft und er wagt, keine enormen Vorschüsse mehr zu geben, geht es so weiter: Ihr macht den Verleger schlecht, inszeniert einen Skandal (aber gründlich) und wechselt zu einem anderen Verleger. Der muß klarerweise der natürliche Todfeind des ersten sein. Dann fangt ihr wieder an. Es gibt sehr viele Verleger …
Einmal habt ihr oder euer Ghostwriter dann pures Glück, und euer Werk ›geht‹. Na, jetzt seid ihr für alle Zeiten in Sicherheit. Man wird euch niemals mehr ziehen lassen, denn ihr habt doch bewiesen, daß ihr etwas könnt. Wahre Begabung setzt sich allemal durch – besonders im bundesdeutschen Buchwesen. Und wenn es noch so lange dauert. Euer Verleger ist euer bester Freund.
Weiter: Es wird euch nicht bekannt sein, daß es schon in der bisherigen deutschen Literaturlandschaft sogenannte ›Cliquen‹ gab. Das waren die mit Recht so beliebten ›Hochjubel‹-GmbHs auf Gegenseitigkeit. Teilhaber: Autoren.
Im lächerlich kleinen Rest der Welt rund um die Bundesrepublik wäre so etwas nicht möglich, bei uns sehr wohl: Ihr könnt als Autor mit Fug und Recht der Kritiker eures Autoren-Freundes sein. Die Zeitungen sehen es gerne. Da wird euer Werk nicht nur von einem Teilhaber, sondern von drei oder vier Teilhabern besprochen, weil es eben so ungeheuer interessant ist, daß man es von Menschen ganz verschiedener Weltanschauungen und aus ganz verschiedenen Blickwinkeln bewerten lassen muß. Jetzt wißt ihr, wie das mit der Kritik funktioniert, jetzt wißt ihr, wie ihr den Verleger übers Ohr haut. Natürlich müßt ihr darauf achtgeben, daß der Verleger nicht euch reinlegt. (Ratschläge erteilt der Verfasser dieser Zeilen gerne schriftlich und privat. So ein Verleger muß nicht alles erfahren.)
Kommt die hohe, hehre Zeit der Buchmesse.
Einige Hinweise: Ihr wißt natürlich genau, daß – vorausgesetzt, euer Buch hat Erfolg – längst vor dieser heiligen Handlung (der Messe) alle Übersetzungsverträge, Abschlüsse mit Buch-, Film- oder Fernsehgesellschaften längst unterzeichnet, die Bestell-Listen der Vertreter längst voll sind. Blödsinn: Ihr wißt das natürlich nicht! Ihr geratet in Verzückung, ihr verkündet es den Massenmedien, ihr schreit es zum Himmel empor, was sich da bereits vor Monaten ereignet hat: soeben ein Übersetzungsvertrag mit Haiti! Kuba meldet heftiges Interesse an! Euer Agent hat vom Agenten des Agenten des Agenten des Scouts der 30th Century Fox eine Anfrage erhalten!
Erscheint auf keinen Fall wie ein normaler Mensch gekleidet in den heiligen Messehallen. Entweder ihr zieht euch total meschugge und dandy- bzw. damendamendamenhaft an, oder ihr kommt in stinkenden Lumpen, langen Haaren und seit Wochen ungewaschen. Ungewaschen, langen Haares und Lumpen – das ist für männliche Genies vorteilhaft. Für weibliche empfiehlt es sich – egal, ob der Busen gut oder schlecht ist –, aus dem neuen Werk vor großem Auditorium oben ohne vorzulesen.
Es ist unvermeidlich, daß ihr an Protestkundgebungen teilnehmt. Wogegen ihr protestiert, ist gleichgültig. Sogar schädlich, es zu wissen. Wenn ihr es nicht wißt, brüllt es sich auch viel besser. Triezt die Bullen! Steckt Stände in Brand! (Aber achtet darauf, daß das Kräfteverhältnis stets fünfzig zu eins zu euern Gunsten beträgt.) Trefft so viele Verabredungen wie möglich. Ihr werdet eure Partner garantiert nie wiedersehen. Freßt euch von einem kalten Büfett zu einem warmen anderen. Sagt in besoffenem Zustand allen Großkopfeten die Meinung. (Natürlich nicht, ohne dafür gesorgt zu haben, daß ein Kamerateam des ZDF oder der ARD zur Stelle ist.) Geht unbedingt dann zur Messe, wenn kein Buch von euch erschienen ist. Ergriffen schreiben die Kritiker dann: ›Er hat das Werk seines Lebens auch nach siebzehn Jahren noch nicht vollendet.‹ Da ist euch der Preis der Deutschen Kurz- und Kleinindustrie oder sonst was Hochgeistiges sicher. Kollegen aus meiner Vergangenheit bekamen solcherart Jahr um Jahr Preise.
Über Werke anderer sprecht ihr niemals, klar? Sagt, ihr hättet noch keine Zeit zur Lektüre gefunden. Das eigene Ding, wenn es ein Ghostwriter verfaßt hat, solltet ihr eigentlich schon lesen, damit ihr wißt, was ihr geschrieben habt. Ein Muß ist das aber nicht. In die Enge getrieben, bringt das Gespräch geschickt auf mich – und jedermann wird froh sein, daß er endlich etwas Säuisches sagen darf. Ich werd’s ja nicht hören. Die Proben in Berlin fangen zu der Zeit gerade an. Ich will den Hamlet spielen, weil ich einen starken inneren Drang verspüre und an mein Talent glaube.
Barlog glaubt auch.
Die Saat der Zeit
Hierselbst nimmt der Verfasser sich zum 238461sten Male vor, ein guter Mensch zu werden.
Berlin 1978.
Wenn ihr durchschauen könnt die Saat der Zeit und sagen: Dies Korn sproßt und jenes nicht, so sprecht zu mir, der nicht erfleht noch fürchtet Gunst oder Haß von euch!«
Durchschauen könnt die Saat der Zeit …
Wer hat diese Worte gefunden, die so unheimlich aktuell sind? Welcher Politiker sprach so? Welcher Denker? Haben Sie nicht auch das Gefühl: Die Worte muß einer heute formuliert haben, heute, in unserer so entsetzlich wirren, verwirrten und von Gefahren erfüllten Epoche?
»Dies Korn sproßt und jenes nicht …«
Wann sind Sehnsucht, Notwendigkeit, Begierde, solches zu wissen, größer gewesen als in unseren Tagen?
Wann lebenswichtiger?
Wann verzweifelter?
Wann?
Es war im Jahre 1605, daß ein Mann mit Namen William Shakespeare diese Worte schrieb.
In der Tragödie ›Macbeth‹ läßt Shakespeare den Banquo, neben Macbeth Anführer des königlichen Heeres, jene Frage stellen – auf der Heide, im Gewitter, bei den drei Hexen.
1605 verlangte es die Menschen also auch schon nach Antwort auf die Art des sprossenden Korns, sehnten sie sich auch schon nach einem, der durchschauen konnte ›die Saat der Zeit‹. Und ganz gewiß hat es diese Sehnsucht noch viel früher gegeben. Es gab sie schon immer, es gibt sie, solange Menschen leben auf dieser unserer Erde.
Denn solange es Menschen gibt, verstreuen sie Saat, damit diese aufgehe und eine gute Ernte bringe. Und wußten niemals mit Bestimmtheit, von welcher Beschaffenheit das Korn war, das sie da ausstreuten – mit Händen auf den Äckern, mit Worten und Taten im Leben. Sie hofften auf die Güte ihres ›Korns‹ (viele Volksverführer und Diktatoren und große Unglücksbringer taten das nicht!) – doch selbst bei den Hoffenden war das eine hilflose, persönliche Hoffnung, keine konkrete, gewisse.
Und das Korn, das Menschen gesät haben seit Anbeginn mit Taten und Worten, ging auf, immer. Und brachte Glück und Frieden und Freiheit – oder Unglück, Krieg, Verheerung, Unterdrückung, Elend, Chaos.
Dies nun, der September, ist die Zeit des Erntens. Wir sehen die Bauern auf ihren Feldern, wir sehen unsere Welt und ihren Zustand. Wir sehen uns selber in unserer privaten Sphäre, Ehe, Familie, Beruf.
September: Nun ernten wir, was wir gesät haben. Nun können, nein, müssen wir (es gibt keine Lüge mehr und keine Schönfärberei) bekennen: Unser ›Korn‹, die ›Saat der Zeit‹, ist gut gewesen durch gute Absichten und gute Gedanken und klares Denken – oder es ist schlecht gewesen durch elende Absichten und schlechte Gedanken und vernebeltes Denken, schlimmer: durch Eigensucht, Maßlosigkeit, Haß, Verhetzung und Dummheit.
Wie wir es auch drehen und wie wir es auch wenden – der September ist da, die Ernte dessen, was wir gesät haben, ist da, und viele haben sich selbst und andere glücklicher und reicher gemacht, und viele sich selbst und andere unglücklicher und ärmer.
Es lag, dies muß man einräumen, in den schlimmen Fällen gewiß nicht immer an schlimmen Eigenschaften oder Absichten – sehr oft lag es auch an der Dummheit.
Unserer Dummheit.
Die Dummheit ist das größte aller Übel. Nur dumme Menschen vermögen wirklich böse zu sein. Bei klugen Menschen verbietet sich das von selbst. Denn die Klugen wissen, wie furchtbar das Böse sein kann. Die Klugen wissen, was für ein Korn sie säen, und achten darauf, daß es ein gutes ist.
Ach!
Wie schön wäre es, wenn das stimmen würde, was wir eben geschrieben haben!
Indessen: Wie viele edle Absichten haben sich dann, da die Saat aufging, als grauenvolle Irrtümer erwiesen in unserer Welt? Es ist leider nur ein Wunschtraum, daß die Klugen mehr wissen von der ›Saat der Zeit‹, die sie verstreuen – mit derselben Hingabe wie alle anderen auch.
»Schönheit ist häßlich, häßlich schön!« rufen die drei Hexen zu Beginn des Dramas ›Macbeth‹. Wir begehen auch die größten Verbrechen mit den ehrbarsten Vorsätzen. Wir wissen so wenig. Wir wissen fast nichts. Aber wir haben nur diese eine und einzige Welt zum Leben. Und säen und ernten müssen wir Jahr und Jahr, Jahrhundert um Jahrhundert, von der Zeiten Anbeginn bis an der Welt Ende.
September.
Ernte.
Jedes Jahr wieder.
Gib, Gott, daß es, wenn schon vielleicht diesmal nicht, dann im nächsten Jahr und in der Zukunft ein gutes Korn sein wird, welches wir säen. Wir müssen alle Kraft zusammennehmen und alle unsere guten Instinkte und Gedanken. Dann können wir in Hoffnung leben.
In Hoffnung – mehr nicht.
Denn niemals wird es einen geben, der durchschauen kann die ›Saat der Zeit‹.
Aber die Hoffnung bleibt uns.
Und das ist schon so viel.
Liebe Kinder! (I)
In Wien, 1947, schrieb ich diese Geschichte aus Dankbarkeit. Ganz im Gegensatz zu ›Liebe Kinder (II)‹ im Jahre 1980 …
Der Mann, der diese Zeilen schreibt, kennt nicht einmal Eure Namen. Deshalb muß er Euch allen gemeinsam schreiben. Aber Ihr werdet gleich wissen, wer gemeint ist. Gemeint sind jene Buben und Mädel, die ihn am vergangenen Mittwoch eingeladen haben, ihnen aus einem Kinderbuch vorzulesen, das er geschrieben hat. Im Sechzehnten Bezirk, im Hause Schuhmeierplatz 17, in der Kinderbibliothek, die es dort gibt. So, jetzt wißt Ihr, wer gemeint ist, und wir können weiterreden.
Der Mann, der diese Zeilen schreibt, hatte große Angst, als er im Sechsundvierziger saß und zu Euch hinausfuhr. Soviel Angst wie schon seit langem nicht. Mehr Angst, als er vor seinem Abitur gehabt hat. Mehr Angst, als er auf dem Standesamt hatte. Das Standesamt war ein Honiglecken gewesen im Vergleich zu Euch. Das glaubte er wenigstens. Weil er noch nie vor Kindern gelesen hatte. Und deshalb klapperte er so sehr mit den Zähnen, daß der Schaffner ihn besorgt ansah, preßte die Hände gegeneinander, als wollte er beten, und bedauerte heftig, vorher nicht ein wenig Baldrian getrunken zu haben. Zur Beruhigung. Solche Angst hatte er vor Euch!
Draußen regnete es in Strömen. Die Zeitungen erzählten von einem Skorzeny-Skandal in Madrid, von einer Dynamit-Explosion, bei der dreißig Menschen ums Leben gekommen waren, vom militärischen Potential des Westens und vom militärischen Potential der Sowjetunion. Es war ein Tag wie alle anderen. Genauso scheußlich. Dem Mann, der diese Zeilen schreibt, rann der Regen in den Kragen, und er hatte Kopfweh. Es war ihm richtig übel.
Aber als er dann zu Euch kam, ereignete sich ein kleines Wunder. Wegen dieses kleinen Wunders schreibt er diesen Brief. Denn Ihr seid es, die das kleine Wunder vollbracht haben. Wenn Ihr es auch gar nicht wißt.
Ihr habt in einem großen Saal auf ihn gewartet, an langen Tischen. Die Buben rechts, die Mädel links. Und als er hereinkam, da habt Ihr ihn alle angesehen. Und da fiel ihm das Herz mit einem Plumps und endgültig in die Hose. Aber gleich darauf geschah es dann, das Wunder. Denn Ihr habt ihn so freundlich angesehen, so außerordentlich entgegenkommend und einladend, daß sein Herz sich ein Herz faßte und langsam wieder nach oben kletterte. Als es die Leistengegend erreicht hatte, begann ein Herr Klavier zu spielen. Er spielte ein sehr lustiges Stück, und Ihr hörtet ihm kritisch zu. Es schien Euch zu gefallen, was Ihr hörtet, denn als er fertig war, da habt ihr applaudiert. Spontan und mit ernsten Gesichtern. Wie die Damen und Herren bei Monsieur Cortot es tun. Nur vielleicht ein bißchen spontaner. Und mit mehr Ernst.
Und dann kletterte der Mann, den Ihr eingeladen hattet, auf ein hohes Podium und sah Euch an. (Das Herz hatte sich wieder einen Stock tiefer begeben. Vorsichtshalber!) Aber der Mann selber hatte keine Angst mehr. Nur ein besonders feiges Herz. Von diesem abgesehen, fühlte er sich bereits so wohl bei Euch, als hätte er Euch schon jahrelang gekannt. Als ginge er in Eure Klasse. Als hätte er bereits mit Euch aus Blasröhrchen geschossen und versucht, sich in einen Film hineinzuschwindeln, den man erst sehen darf, wenn man achtzehn ist.
Er lächelte Euch zu. Und Ihr lächeltet zurück. Da nahm er sein Herz persönlich in die Hand und steckte es endgültig dorthin, wo es hingehört. Und dann begann er, aus seinem Buch zu lesen.
Zuerst stotterte er dabei ein bißchen, aber Ihr konntet seine Aufregung verstehen und vergabt ihm großmütig. Und dann wurde es immer stiller und stiller, und er glaubte, in einer Kirche zu sein. Er war schon seit sehr langer Zeit in keiner mehr gewesen, aber jetzt glaubte er, in einer zu sein. So feierlich war es.
Das Buch handelte von einem Jungen, der ein sehr schlechtes Zeugnis bekommt und eine kranke Mutter hat. Deshalb beschließt er, nicht nach Hause zu gehen. Sondern hinaus in die weite Welt. Und dabei hat er dann die schlimmen Abenteuer. Denn so etwas kann nicht gutgehen, das versteht sich von selbst.
Es wurde dämmrig in dem großen Saal. Ab und zu kluckerte eine Wasserleitung in der Wand. Oder es fuhr eine Straßenbahn vorüber. Aber sonst rührte sich nichts. Ihr lagt mit dem Oberkörper auf den Tischen und starrtet den Mann da oben an. Wenn die Leute im Buch lachten, dann lachtet Ihr auch. Wenn sie weinten, dann habt Ihr auch geweint. Wenn sie sich aufregen mußten, dann habt auch Ihr Euch aufgeregt. Und wenn sie verfolgt wurden, dann wurdet auch Ihr verfolgt. Und das alles ohne einen Ton, ohne einen Laut. Man konnte es nur sehen in Euren Gesichtern oder wenn Ihr die Bewegung nachgemacht habt, welche die Menschen im Buch gerade machten. Eure Augen hingen an dem Mann, der vorlas, und ließen ihn nicht los. Und sooft er konnte, sah er von seinem Buch auf und zu Euch hin, denn er fühlte, wie er vergnügter und vergnügter wurde, wenn er in Eure jungen Augen blickte. Und er fühlte auch immer deutlicher, eine wie große Ehre ihm zuteil geworden war mit Eurer Einladung und wie glücklich er war, für Euch schreiben zu dürfen. Es war eine der feierlichsten Stunden seines Lebens.
Als er auf die Straße hinaustrat, regnete es noch immer in Strömen. Aber für ihn regnete es süße Bonbons! Seine Übelkeit war verschwunden, sein Kopf kam sich vor wie ein übermütiger Luftballon. Und er hatte keine Angst mehr. Vor Euch nicht. Und vor vielen anderen Dingen auch nicht mehr. Nicht einmal vor den Schlagzeilen der Zeitungen, die noch immer verkauft wurden. Er sah sie noch einmal an, und irgend etwas mit seinen Augen mußte geschehen sein. Denn nun las er als Überschriften: ›Wir sind jung, und das ist schön!‹ Und: ›Solange es Kinder gibt, gibt es Hoffnung‹. Und: ›Internationale Kinderföderation bereitet Weltfrieden vor‹. Ja, das las er! Er ist seitdem sehr glücklich mit seinen komischen Augen. Deshalb schreibt er Euch. Um Euch zu danken und Euch Glück zu wünschen
als Euer Euch sehr ergebener
Johannes Mario Simmel.
Liebe Kinder! (II)
Nach Erscheinen dieses Artikels gab es 1980 in Düsseldorf jede Menge Stunk. Aber nach dem Stunk durften die kranken Kinder sofort – provisorisch – in ein schönes Haus übersiedeln, und mit dem Neubau der Klinik wurde sogleich begonnen. Es war fast wie im Märchen …
Eure Eltern haben mich eingeladen, Euch aus meinen Kinderbüchern vorzulesen. Das habe ich getan. Ich bin mit vielen Büchern und mit Schallplatten, auf denen der Inhalt der Bücher von Schauspielern noch spannender gespielt wird, zu Euch gekommen. Ihr habt Euch sehr gefreut und mächtig geklatscht. Aber ich habe kaum lesen können, mir ist zu sehr zum Heulen gewesen. Und so mußten wir dann, als ich nicht mehr lesen konnte, den Plattenspieler laufen lassen. Eure Väter sind Ärzte, Maurer, Lastkraftwagenfahrer, Rechtsanwälte – Männer aus fast allen Berufen. Doch es ist die gleiche Krankheit, die Ihr alle habt. Diese Krankheit heißt Krebs.
Etwa zweihundertfünfzig seid Ihr, die da in der Kinderkrebsklinik KC 11 der Universität Düsseldorf behandelt werden – fünfzehn immer stationär, der Rest ambulant. Manche von Euch müssen täglich zur Behandlung, andere alle vierzehn Tage, wieder andere alle drei Monate. Dreiunddreißig Prozent haben Leukämie, vier bis fünf Prozent Lymphdrüsen-Entartung, zwanzig Prozent Hirntumore, zwanzig Prozent Neuroblastome, der Rest verteilt sich auf verschiedene Krebsarten. Ihr seid Babys, wenige Monate alt, und Ihr seid junge Damen und Herren, siebzehn, achtzehn Jahre alt. Die Großen unter Euch wissen, was mit ihnen los ist. Die ganz Kleinen wissen es noch nicht. Chirurgie und Chemotherapie stellen die Hauptbehandlungsformen dar. Ihr bekommt Zellteilungs-Gifte in die Venen gespritzt oder in Tablettenform. Diese Medikamente setzen die Abwehrkraft Eurer Körper sehr herab, und so haben viele von Euch ständig eine oder mehrere andere Krankheiten. Es kommt auch häufig vor, daß Euch alle Haare ausfallen. Oder daß Eure kleinen Beine plötzlich gelähmt sind. Es gibt ganz, ganz arme unter Euch, die können nicht mehr sehen und nicht mehr sprechen und dürfen überhaupt nicht angefaßt werden, weil schon leichteste Druckstellen sogleich zu bluten beginnen.
Der Erfolg der Behandlung ist unterschiedlich. Eure Ärzte unterscheiden vier Stadien. In den Stadien I und II liegen die Chancen, daß ihr wieder gesund werdet, zwischen vierzig und neunzig Prozent, in den späteren Stadien III und IV können diese Chancen auf fünf Prozent sinken. Wenn Ihr schon zu groß seid oder noch zu klein, habt Ihr schlechtere Aussichten, mit dem Leben davonzukommen. Am besten ist es, wenn Ihr zwischen vier und sieben Jahre alt seid.
Die Chancen eines Erfolges entsprechen durchaus denen in amerikanischen Kliniken, denn ihr habt sehr, sehr gute Ärzte – vier sind es. Und fünf Schwestern. Die sind prima. Auch die Eltern sind es. Jedoch: Wie Ihr untergebracht seid, wie Ihr leben müßt, wie Eure Eltern, die Ärzte und Schwestern leben müssen, was Ihr zu essen bekommt, das ist einer der größten Skandale, die ich kenne – und ich kenne einen Haufen. Was mit Euch geschieht, ist ein grauenvoller, nicht zu fassender, den Atem verschlagender Skandal.
Es gibt, um nur ein kleines bißchen dieses Skandals aufzuzeigen, in der ganzen Kinderkrebsklinik ein einziges Klosett. In diesem einzigen Klosett befindet sich auch die gesamte Schmutzwäsche – und ein Laboratorium! Jawohl, so ist es, ich habe es gesehen.
Ich habe auch ein Zimmer gesehen, das keimfrei sein sollte. Das Zimmer hatte eine ganz gewöhnliche Tür, oben befand sich ein Fenster. Darunter war ein Schild mit der Aufschrift befestigt: MUNDSCHUTZ- UND KITTELPFLEGE! Einige Kittel hingen neben der Tür auf dem Flur. Ich habe in diesem Zimmer ein schwerkrankes Kind und seine Mutter gesehen. Viele Mütter wachen und schlafen bei ihren Kindern. Von wegen ›keimfrei‹! Jeder tritt natürlich direkt vom Gang in das Zimmer, denn es gibt keine Schleuse. Am Morgen kommt die Putzfrau und macht mit einem dreckigen Fetzen und irgendeiner Lysol-Lauge in diesem Zimmer ›sauber‹. Die Tafel mit der Inschrift ist ein böser Hohn. Das Zimmer hat eine Größe von sieben Komma drei Quadratmetern. Zum Vergleich: Im neuen Düsseldorfer Innenministerium ist das Zimmer eines einfachen Beamten achtzehn, das eines höheren Beamten vierundzwanzig und das eines Gruppenleiters vierunddreißig Quadratmeter groß!
Eure armen Eltern haben einen mächtigen Politiker gebeten, zu Euch in die Kinderkrebsklinik zu kommen, um sich selbst ein Bild von dem Skandal zu machen. Der mächtige Politiker ist nicht gekommen. Ich habe den Brief gelesen, den er am 9. Juni an Eure Eltern schrieb. Er habe deren Sorgen und Nöte nicht vergessen, schrieb der Herr, und dann wörtlich: ›… Ich habe es vielmehr für richtiger gehalten, mich persönlich darum zu kümmern, daß die Unterbringung krebskranker Kinder und ihrer Eltern relativ rasch verbessert werden kann.‹ Relativ rasch!
Daß etwas verbessert wurde, haben weder die Kinder noch die Eltern noch die Ärzte noch die Schwestern bemerkt. Alle Ärzte arbeiten nach wie vor in einem einzigen Zimmer, das so groß – besser gesagt: so klein – ist wie ein Badezimmer. Hier sitzen sie am Mikroskop, schreiben Berichte, telefonieren. Einen großen Dreck haben alle von einer Besserung bemerkt!
Nach der Bauplanung des Ministeriums soll eine neue Kinderklinik überhaupt erst 1995 bezugsfertig sein. Neunzehnhundertfünfundneunzig! In fünfzehn Jahren also. Fünfzehn weitere Jahre sollen, wenn die Behörde siegt, Kinder, Betreuer und Eltern in menschenunwürdigen Verhältnissen leben. Fünfzehn Jahre sollen dreckige Stellen an Türen und Mauern, Löcher und besonders verschmierte Teile an Mauern mit Kinderzeichnungen überklebt werden, sollen Mütter und Kinder sich im Sommer halbtot schwitzen, weil sich, ungünstig angelegt, unter dem ebenerdigen Boden eine Heizung befindet, die das Thermometer, wenn es ohnehin schon fünfunddreißig Grad zeigt, in wahrhaft irrsinnige Höhen treibt. Sollt Ihr Kinder Kartoffeln in jeglicher Form (warm, kalt, als Püree, gesalzen, ungesalzen), Kohl und Kraut jeglicher Art oder Brot mit Meerrettichsauce als Nahrung angeboten bekommen. (Den Eltern ist es ausdrücklich verboten, gute Lebensmittel mitzubringen!)
Fünfzehn Jahre noch sollen frisch operierte Kinder aus der Chirurgie am gleichen Tag wieder in diese Hölle zurückgeschickt werden. Fünfzehn Jahre noch sollen Kinder aus dem Raum Düsseldorf weiter hier hausen müssen, weil die nächste ähnliche Klinik in Münster liegt. (Und auch nicht besser sein soll.) Bis 1995 muß der Skandal weitergehen.
Muß das wirklich so sein?
Vor einiger Zeit war Frau Dr. Mildred Scheel in dieser Stätte des Elends zu Besuch. Sie zeigte sich erschüttert und stellte sofort eine Viertelmillion DM aus dem Fonds der von ihr betreuten Krebshilfe zur Verfügung. Für Umbauarbeiten und für moderne Apparate. Dafür stehen sogar weitere zweihunderttausend DM bereit. Tja, aber das ganze Geld liegt auf Eis! Denn erst dann, wenn mit dem Umbau begonnen wird, dürfen Rechnungen mit dem bereitliegenden Geld bezahlt werden. Vorher nicht. Und mit dem Umbau kann eben nicht begonnen werden, leider, leider. Die Behörden schieben alle Schuld auf die Verwaltung der Universität, diese auf die Abteilung für Kardiologie, deren Leiter ihr Haus nicht verlassen und Euch Kindern Platz machen wollen, und die Kardiologie wiederum schiebt alles auf die Behörden. Und folgt Ihr mir im Rösselsprung, werdet Ihr verrückt, meine Lieben. Übrigens: Die Baubewilligung für den neuen Landtag, der zweihundertfünfzig Millionen DM kosten soll und den eigentlich niemand haben will (außer den Abgeordneten, die sich darin recht behaglich fühlen wollen und sollen), ist natürlich sofort erteilt worden.
Sieben Belegräume hat die Kinderkrebsklinik, dazu wenige Nebenräume. Der schönste Raum ist das Spielzimmer. Da fühlt Ihr Euch am wohlsten, Ihr, glatzköpfig, halbgelähmt, am Tropf hängend …
Neue Räume, die freigemacht wurden, sind unbenützbar bis zum Generalumbau. Und den gibt es nicht, weil – siehe oben. Dafür kostet die Behandlung eines Kindes in diesem Stall pro Tag DM 227,50: Zweihundertsiebenundzwanzig Mark und fünfzig Pfennige! Die Krankenkasse zahlt alles zurück. Schön und groß leuchten im Park die Neubauten der Universität. Viel zu alt stehen die Kliniken da, lächerlich klein, zum Weinen klein. So viele Bomben fielen auf Düsseldorf, so vieles wurde zerstört, die Kliniken, die heute zur Universität gehören, blieben erhalten, leider.
Eure Eltern, liebe, arme Kinder, sind ruhige Menschen mit einer Geduld, die unfaßbar ist. Sie versuchen, sich selbst zu helfen mit einer ›Eltern-Initiative‹, sie veranstalten Basare, sie hoffen und beten, daß alles anders wird. Aber eines Tages – und das bald, denn es eilt! – muß das Hoffen und das Beten aufhören, und, verflucht noch einmal, in der schönen Stadt Düsseldorf, in der so viele reiche Leute und so viele kluge und geistreiche Politiker leben, muß etwas geschehen, muß, muß, muß!
’ne kleene Fanfare für een’ großen Mann
Diese »Kleene Fanfare« ertönte am 10. Juni 1968, als Fritz Bolle sechzig wurde. Jetzt, dreizehn Jahre später, bin ich sehr glücklich über das, was ich damals geschrieben habe. Geändert hat sich nur eines: Wir sagen einander schon lange ›Du‹!
Lieba Herr Simmel, wejen die Kürchn – wissense, die in det Laga Marienfelde – wejen die ha’ick also den zuständijen Rejierungsrat von’ Senat jefracht. Det war’n Ding – der konnte doch beinah noch scheena berlinan als ick! »Kürchn«, sachta, »Kürchn, nee, die jiptz da nich. Die jiptz bloß in Friedland.« Na scheen, ha’ick mir jedacht, mach’n wa ehm ’ne ewangelsche Morgenfeia in’t Radio draus. Hört man ja ooch singen, aus’n Lautsprecha! Vajnüchtet Weitadichtn wünscht Ihn’ Ihr Bolle …
… heute früh habe ich bei meinem Antiquar dieses hübsche Biedermeier-Bildchen »unseres« Bethanien-Krankenhauses aufgestöbert, das jetzt, nach rund 125 Jahren, immer noch genauso aussieht. Nehmen Sie’s als Angebinde …
… vor allem aber, lieber Herr Simmel, ist es nun an der Zeit, daß ich mich bedanke. Die Arbeit an Ihrem Buch war viel mehr als »Arbeit« (einfache oder doppelte Anführungsstriche?) und hat mir reines Vergnügen bereitet. Die Nachmittage, an denen wir an Ihrem Buch gebastelt haben, fehlen mir sehr – nun, ich hoffe, daß wir uns bald schon wegen des neuen Romans zusammensetzen können …
… PS: Da fällt mir gerade noch etwas ein. Bitte, wenn Sie mir schreiben: Bolle ist kein »sehr verehrter!« Ja? …
Alles, was bis hier steht, stammt aus Ihren Briefen an mich, lieber Fritze Bolle. Und zu dem PS, da muß ich, verdammt noch einmal, ganz energisch erwidern: »Doch issa ’n sehr vaehrta, ja doch! In mein’ janzet Leem ha’ick keen’ Mitarbeeta jefunden wie Sie, und ick hab ’ne Menge zusammenjeschmiat und weeß ’n bißken Bescheid, weeß ick. Nee, nee, Bolle, nu sei man stille, janz stille. Det is die wahre Wahrheit!«
Ich möchte ja gern weiterberlinern, aber als Wiener kann ich das nicht alleene, und so muß ich es zu meinem Schmerz bleibenlassen.
Die Briefe, aus denen ich zitiert habe, schrieben Sie mir, als ich LIEB VATERLAND MAGST RUHIG SEIN verbrach. Da kam jeden Samstag so ein Brief: immer komisch, immer voller Informationen, die ich dringend benötigte und nicht herbeischaffen konnte (Sie konnten es, Sie können alles!), immer voll Ermunterung, immer geziert mit jenem Bolle-Männchen, das Sie aus den Buchstaben Ihres Namens gebildet haben – und oft auch mit, hrm-rm, na ja, und oft auch mit anderen Zeichnungen, die Sie unter Zuhilfenahme vieler bunter Filzschreiber angefertigt hatten, weil Sie wußten, daß mir solche Zeichnungen Laune machen, mir altem Ferkel.
Ausgeschlossen, daß es einen Cheflektor gibt, der Ihnen auch nur das Wasser reichen könnte: der so besorgt und hilfsbereit ist, daß er – wie Sie – an den Wochenenden über dem Manuskript seines Autors brütet; der im Urlaub – wie Sie – den Umbruch korrigiert und sich bei 35 Grad im Schatten voller Liebe um jedes Hurenkind kümmert; der immer, immer wieder Auswege aus scheinbar hoffnungslosen Situationen findet; der dem Schriftsteller Mut macht, immer, immer wieder, der ihn schützt und abschirmt; und der – last, not least – so viel mit seinem Autor lacht, wenn sie dann zusammensitzen und das Buch fertig machen.
Und ist die ganze Schinderei, die so ein Roman mit sich bringt, endlich vorüber, dann setzt dieser Bolle sich wahrhaftig hin und schreibt an den Schriftsteller einen Brief wie jenen, aus dem ich zitiert habe, und bedankt sich bei dem Autor für den Spaß der vielen Stunden, die sie gemeinsam am Schreibtisch saßen! Nein, ausgeschlossen, völlig ausgeschlossen, daß es so einen Cheflektor noch einmal gibt!
Und dazu, Fritz Bolle, betätigen Sie sich beständig noch als Seelenarzt, bei dem man seinen Kummer abladen kann, seine Zweifel, seine Befürchtungen, dazu halten Sie bei Buchmessen und ähnlichen Anlässen eine schützende Hand über einen wie mich, den so ein ganz großer Wirbel seekrank macht! Und dazu kümmern Sie sich, jahrein, jahraus, darum, wie es Ihren Autoren überhaupt geht, und helfen ihnen und unterstützen sie, wo Sie nur können – bei Ihrer Arbeitsüberlastung!
Ich weiß: Wenn ich irgend etwas brauche, irgendeine Sorge habe, muß ich nur zum Telefonhörer greifen und Sie anrufen, und schon flutscht es!
Vier dicke Bücher haben wir beide nun schon zustande gebracht, und – verzeihen Sie das folgende, ich weiß, Sie hassen so etwas, aber es muß sein – und ich kann mir einfach nicht vorstellen, daß irgendein anderer so großartig mit mir harmonierte, daß er Ihre Freundlichkeit, Ihren Witz, Ihre Geduld und Ihr phantastisches Arbeitstempo besäße und daß er ein solcher Polyhistor wäre.
Darum muß ich sagen: Auch für mich sind die Nachmittage, an denen wir ein Buch von mir in Ordnung bringen, der schönste Teil der ganzen Schreiberei, und immer, wenn ich ein neues Buch anfange, denke ich schon an die Zeit, wo wir wieder an Ihrem Schreibtisch sitzen werden, lachend, fluchend und schweinigelnd – und wo dann jenes Buch entsteht, das gedruckt wird.
Geheimnisverrat: In meinem neuen Roman werden Sie aus allen diesen Gründen – in veränderter Gestalt natürlich – selber auftauchen und eine wichtige Rolle spielen! Das ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe, Ihnen ein Denkmal zu setzen. Und ein Denkmal verdienen Sie! Wenn man bloß einmal bedenkt, was Sie alles auf den Tisch bekommen: Medizin, Zoologie, Botanik, Kunst- und Kriminalgeschichte, Archäologie, Politik, Religion, Biologie, Mathematik, Kybernetik undundund – und Belletristik! Ich kann es immer noch nicht fassen, daß Sie nie durcheinandergeraten oder nervös werden oder einen Fehler machen. Es ist ein reines Wunder. Wir wissen schon alle, was wir an Ihnen haben!
Das Biedermeier-Bildchen vom Berliner Bethanien-Krankenhaus, das im VATERLAND vorkam, hängt, gerahmt und unter Glas, an meinem Arbeitsplatz. Da steht auch eine geschnitzte Schatulle, in der sammle ich alle Ihre Briefe und Zeichnungen. Und wenn ich einmal deprimiert bin und es nicht weitergehen will, dann sehe ich mir die Briefe und Zeichnungen an und werde wieder fröhlich, denn ich sage mir: Das da, das alles, hat ein Mann gezeichnet oder geschrieben, der es verflucht schwer im Leben hatte, den gewiß oft genug eigene Sorgen plagen, obwohl er nie darüber spricht, ein Mann, der sich sein Gelächter, seinen gesunden Menschenverstand und eine große Herzensgüte bewahrt hat – über jedes Chaos, über alles Unglück hinweg.
So ein Mann möchte ich gern sein! Ihr enormes Wissen möchte ich haben, Ihre ungeheure Arbeitskapazität, die Güte und den Humor und die Unbeschwertheit, mit der Sie auch noch in den kitzligsten Situationen die Dinge immer wieder zurechtschaukeln. (Wenn ich bloß daran denke, unter welchen Umständen manche der Romane entstanden sind! Unter welchen – ich brauche nicht weiterzusprechen, Sie wissen schon, was ich meine!)
Und wenn dann alles wieder einmal glücklich vorüber war, dann grinsten Sie bloß, als wollten Sie, mit Erich Kästner, sagen: »Mich müssen noch viele Schläge treffen, eh mich der Schlag trifft!«
Lieber Fritze Bolle, daß ich Ihnen zu Ihrem Geburtstag alles, alles erdenklich Gute wünsche, versteht sich von selber. Dazu aber wünsche ich mir, daß unsere Verbindung, so wie sie ist, noch lange, lange, lange erhalten bleibt, daß wir zusammen bis in den Abend hinein schuften und dabei lachen, lachen, lachen!
Die Zeit, in der wir leben, ist mies. Ich kann nicht sagen, wie glücklich ich bin, in einer solchen Zeit einen Freund wie Sie gefunden zu haben. Möge der Liebe Gott Sie beschützen und behüten und unsere Freundschaft hegen und pflegen, damit ich noch oft, oft rufen kann: »Freu dich, Fritzchen, so wie ich mich freue – morgen gibt’s zwar nicht Selleriesalat, aber ein neues Ms!«
So, lieba Meesta, det mußte aba mal ausjesprochn werdn. Und da steht et nu. Jeschriem.
Johannes Mario Simmel
Gott segne Sie, Angeklagter
1951: Eine wütende Attacke gegen doppelte »Moral« in der Rechtsprechung.
Von den drei Dingen, auf denen die Welt ruht, nennt ein altes Buch als das erste: die Gerechtigkeit.
Angeklagte, treten Sie vor!
Sie werden beschuldigt, Ihr neugeborenes Kind mittels eines Handtuches vom Leben zum Tode befördert zu haben. Der Tatbestand des wissentlichen und willentlichen Kindesmordes liegt vor. Sie sind geständig. Sie geben an, aus einer unerträglichen Notlage heraus gehandelt zu haben. Es ist dem Gericht bekannt, daß Sie praktisch mittellos sind. Der Vater Ihres Kindes hat Sie im Stich gelassen. Sie waren als Hilfsarbeiterin in einer Metallwarenfabrik beschäftigt. Sie hatten ein Zimmer in Untermiete, das man Ihnen aufkündigte, als Sie vor der Geburt standen. Sie haben Ihr Kind in einer Scheune zur Welt gebracht. Sie haben es daselbst getötet. Sie stehen allein. Sie haben inzwischen auch Ihren Arbeitsplatz verloren. Als man Sie verhaftete, brachen Sie sofort zusammen. Das Gericht nimmt zur Kenntnis, daß Sie Ihr Kind gerne behalten hätten und daß Sie in einem Zustand der Sinnesverwirrung handelten, als Sie es erwürgten. In Anbetracht all dessen verurteilt Sie das Gericht zu Urfahr bei Linz zu sieben Jahren Kerker.
Angeklagter, treten Sie vor!
Das Gericht zu Urfahr bei Linz klagt Sie an wegen eines strafbaren Eingriffes und des Vergehens gegen die Sicherheit des Lebens. Sie sind der Sohn einer alten und mächtigen Bauernfamilie. Sie haben die junge Hausgehilfin Leopoldine Strasser aus Arbing im Mühlviertel verführt. Als sie Ihnen sagte, daß sie ein Kind erwarte, waren Sie im Begriff, eine reiche Fleischerstochter zu heiraten. Das Kind, das unterwegs war, kam Ihnen ungelegen. Sie dachten an Alimente, an peinliche Verpflichtungen. Sie dachten an die reiche Fleischerstochter. Sie brachten die oben erwähnte Leopoldine Strasser so weit, daß diese sich bereit erklärte, sich das Baby nehmen zu lassen. Von Ihnen nehmen zu lassen. Mittels einer Fahrradpumpe. Sie waren der Ansicht, Angeklagter, daß die Sache ganz einfach sei.
Sie war jedoch nicht so einfach. Mittels einer Fahrradpumpe und im Verlauf eines Unternehmens von ungeheuerlicher, von unbegreiflicher Primitivität, welches wir, das Gericht, in seiner Gesamtheit jedoch nur ein ›Vergehen gegen die Sicherheit des Lebens‹ zu nennen belieben, haben Sie Ihre Geliebte, die bereits zweimal erwähnte Leopoldine Strasser, vom Leben zu einem qualvollen Tode befördert. Mit ihr haben Sie ein ungeborenes Wesen getötet, in dessen Adern – im Falle seiner Geburt, die Sie zu verhindern wußten – auch Blut aus Ihrem Körper gekreist wäre auf uralte und geheimnisvolle Weise.
Sie haben die vom Leben zum Tode beförderte Leopoldine Strasser danach mit einer Eisenkette beschwert und sie in Ihrem Auto zur Donau gefahren. Vorher nahmen Sie noch einen kleinen Imbiß ein. Mit einem Schluck Bier. Ihre Frau Mama verlangte Herztropfen, als Sie ihr mitteilten, was geschehen war, und rollte im Bett auf die andere Seite. Dann schlief sie weiter.
Sie aber, Angeklagter, erreichten die große Brücke, welche über die Donau führt, und warfen Ihre mit einer Eisenkette beschwerte tote Geliebte, die bereits viermal namentlich erwähnte Leopoldine Strasser, in den dunklen Strom. Sie hofften, sie werde nicht mehr zum Vorschein kommen. Doch sie kam zum Vorschein. Aber auch das konnte Ihnen nicht viel anhaben, Angeklagter. Ihre Mama bot den Eltern der Ermordeten ein Totenmahl an. Ein Totenmahl für zwei Personen. Sie war sehr großzügig, Ihre liebe Frau Mama.
Sie sind vor dieses Gericht gestellt worden, und die Verhandlung gegen Sie hat sich durch eine bemerkenswerte Kürze ausgezeichnet. Es ist in ihr bemerkenswert wenig von der Art und Weise die Rede gewesen, in welcher Sie, Angeklagter, wissentlich und willentlich einen vorgefaßten Plan zu Ende geführt, in welcher Sie, Angeklagter, bei Gott buchstäblich über Leichen gegangen sind. Selbst Ihre Richter haben es leider versäumt, von der grauenvollen Kälte zu sprechen, mit der Sie gehandelt haben. Es hat den Anschein, als gebe es verschiedenerlei Recht in der Welt, als sei das menschliche Leben billig und teuer zugleich. Aber es hat nur den Anschein.
Wenn Ihre Geliebte, Angeklagter, die nun zum fünften Mal erwähnte Leopoldine Strasser, nämlich selbst und von sich aus dafür gesorgt hätte, daß das lästige Kind Ihrer Liebe niemals geboren würde, und wenn sie bei diesem Unternehmen mehr Glück gehabt hätte, als sie gehabt hat, dann wäre sie heute noch am Leben. Und man könnte sie vor Gericht stellen. Und zu sieben Jahren Kerker verurteilen. Wegen Kindesmordes. Denn Kindesmord ist ein schweres, im Geiste niemals zu verzeihendes Verbrechen, das man unerbittlich ahnden muß, damit niemand auf die Idee kommen möge, diejenige, die dem keimenden Leben zum Eintritt in diese Welt der Freuden und des Gelächters verhilft, habe noch das größte und niemals zu nehmende Recht, jenem Leben ein vorzeitiges Ende zu setzen. Und deshalb muß jedermann begreifen, daß der nun zum sechsten und letzten Mal erwähnten Leopoldine Strasser ein segensreiches und gnadenvolles Ende geworden ist durch Ihre wertvolle Mithilfe, Angeklagter. Denn Sie sind es gewesen, der sie vor Schande und Kerker bewahrt hat. Die Erde werde ihr leicht. Und Gott sei mit Ihnen auf Ihrem weiteren Lebensweg, Angeklagter. Er erleuchte und segne Ihren Erdenwandel und lasse Ihre liebe Mama des Nachts gut schlafen.
Das Gericht zu Urfahr bei Linz verurteilt Sie zu fünfzehn Monaten Kerker.
Von den drei Dingen, auf denen die Welt ruht, nennt ein altes Buch als das erste: die Gerechtigkeit.
Liebes Lämmlein …
Liebe auf den ersten Blick – und das auch noch auf Distanz.
Wien 1947.
Am Gumpendorfergürtel in Wien, dort, wo der 118er nach links abzweigt und die Stadtbahn ihren großen Bogen nach Meidling zieht, liegt ein Rummelplatz. Nicht besonders groß und ohne die Extravaganzen des Praters, aber immerhin ein Rummelplatz. Zu den neuen, dreißigprozentig erhöhten Preissätzen kann man dort allein oder in Gesellschaft Ringelspiel fahren, mit Korken auf Scheiben schießen, in Kähnen schaukeln und aus Papiertüten garantiert reines Fruchteis essen, das garantiert nach nichts schmeckt. Man kann dort Saccharin, ›Marvel‹-Zigaretten und Feuersteine unter der Hand erwerben. Man kann, was gerne gesehen wird, mit jungen Damen anbandeln. Und man kann auch am Zaun stehenbleiben und zuschauen. Eine ganze Menge Leute bleiben am Zaun stehen, aus diesem oder jenem Grund. Beispielsweise der Luftschaukeln wegen. Da jeder Mensch weiß, was es mit einer Luftschaukel für eine Bewandtnis hat, brauchen wir uns darüber nicht zu unterhalten.
Interessanter sind schon weltanschauliche und nationalökonomische Debatten, die man gleichfalls, an den Zaun gelehnt, von diesem brechen kann. Und schließlich ist es immer von Vorteil, sich gesellig zu zeigen. Vielleicht findest du hier ein Mädchen oder einen Mann, der dir fünf Quadratmeter Dachpappe für deine Schrebergartenhütte verkauft. Oder einen preiswerten Bettvorleger. Oder irgend etwas ganz anderes. Der Rummelplatz neben dem Stadtbahnbogen ist ein hochinteressantes Etablissement, das seine Besucher dazu noch durch musikalische Darbietungen erfreut. Ein Grammophon mit Lautsprecher spielt ›Regentropfen, die an mein Fenster klopfen‹, ›Heaven, I am in Heaven‹ und das Lied von dem Wiener, der nicht untergeht. Außerdem Marschmusik, tararabumdiäh. Ein herrlicher Ort. Von dem Krach, dem Lachen und dem Rauch einzelner ›Austria III‹-Zigaretten staatlicher Monopol-Provenienz wird man in kurzer Zeit schon so süß benommen wie von fünf Vierteln Heurigem. Der Effekt ist der gleiche. Aber die Methode scheint ökonomischer.
Das ganze Leben ist ein Ringelspiel. Wir drehen uns im Kreis, fünfzig, siebzig Jahre lang, und dann sterben wir. Auf dem Rummelplatz zahlen wir ein paar Groschen für dieses Vergnügen und glauben daher, Herren der Situation und ungebunden in unseren Entschlüssen zu sein. Als der DG, mit dem ich nach Meidling zu gelangen hoffte, infolge eines völlig unerwarteten Zusammenbruchs des Verbundnetzes in der Mitte des Viadukts gerade über dem Rummelplatz steckenblieb, steckte deshalb auch ein großer Teil der Fahrgäste die Köpfe zu den Fenstern hinaus und fand sein Gefallen an dem Treiben unter uns. Kleine Kinder quietschten vor Entzücken, die Mamas lächelten sinnend, und ein paar junge Männer pfiffen beifällig, wenn die Mädchen in den Luftschaukeln ein Übriges taten, um Beachtung zu finden. Obwohl es die meisten Fahrgäste eilig hatten, regte sich doch keiner über die plötzliche Verkehrsstörung auf. Ich, der ich es gar nicht eilig hatte, fühlte mich außerordentlich wohl. Und dann sah ich das Mädchen in dem blauen Kleid. Da bekam ich vor Aufregung sofort Herzklopfen.
Das Mädchen stand in der Mitte des Platzes, ganz allein, und blickte zu uns herauf. Das heißt, es blickte zu mir