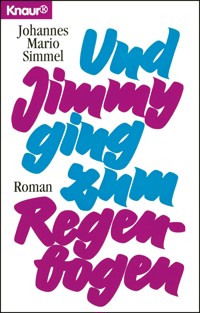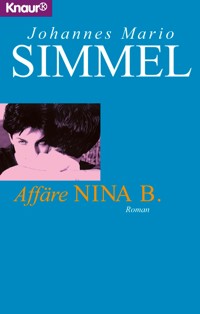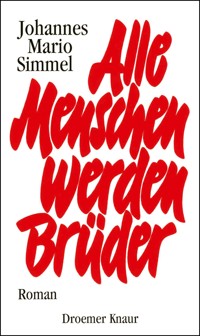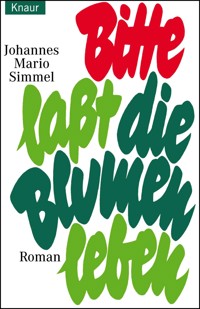6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neuausgabe des legendären Klassiker von einem der erfolgreichsten Autoren Deutschlands Thomas Lieven ist alles, was sich eine Frau wünschen kann: gutaussehend, im besten Alter, charmant und ein begnadeter Koch. Aber der Mann ist noch viel mehr — Geheimagent wider Willen. Seine Abenteuer führen ihn quer durch das Europa des kalten Krieges, durch eine Zeit voller Hass und Fanatismus, Lügen und Verrat. Trotzdem geht er, dessen einzige Schwächen die Frauen und das Kochen sind, unbeirrt und unbesiegt durch jede Gefahr, denn nicht umsonst trägt er eine philosophische Erkenntnis im Herzen: Es muss nicht immer Kaviar sein! »Simmel hat wie kaum ein anderer zeitgenössischer Autor einen fabelhaften Blick für Themen, Probleme, Motive«, Marcel Reich-Ranicki
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 921
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Johannes Mario Simmel
Es muß nicht immer Kaviar sein
Roman
Knaur eBooks
Über dieses Buch
Thomas Lieven ist alles, was sich eine Frau wünschen kann: gutaussehend, im besten Alter, charmant und ein begnadeter Koch. Aber der Mann ist noch viel mehr – Geheimagent wider Willen. Seine Abenteuer führen ihn quer durch das Europa des kalten Krieges, durch eine Zeit voller Hass und Fanatismus, Lügen und Verrat. Trotzdem geht er, dessen einzige Schwächen die Frauen und das Kochen sind, unbeirrt und unbesiegt durch jede Gefahr, denn nicht umsonst trägt er eine philosophische Erkenntnis im Herzen: Es muss nicht immer Kaviar sein!
Inhaltsübersicht
Motto
PROLOG
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
ERSTES BUCH
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
ZWEITES BUCH
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
DRITTES BUCH
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
VIERTES BUCH
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Epilog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Nachwort zu »Es muß nicht immer Kaviar sein«
Verzeichnis der Rezepte
Vorspeisen
Suppen
Hauptgerichte (mit Beilagen)
Nachspeisen
Dieser Roman beruht auf Tatsachenberichten. Die Namen und Personen sind frei erfunden. Eine Namensgleichheit mit lebenden oder verstorbenen Personen wäre rein zufällig.
PROLOG
1
»Wir Deutschen, liebe Kitty, können ein Wirtschaftswunder machen, aber keinen Salat«, sagte Thomas Lieven zu dem schwarzhaarigen Mädchen mit den angenehmen Formen.
»Jawohl, gnädiger Herr«, sagte Kitty. Sie sagte es ein wenig atemlos, denn sie war fürchterlich verliebt in ihren charmanten Arbeitgeber. Und mit verliebten Augen sah sie Thomas Lieven an, der bei ihr in der Küche stand.
Über seinem Smoking – nachtblau, mit schmalem Revers – trug Thomas Lieven eine Küchenschürze. In der Hand hielt er eine Serviette. In der Serviette befanden sich die zarten Blätter von zwei bildschönen Salatköpfen.
Was für ein Mann, dachte das Mädchen Kitty, und ihre Augen glänzten. Kittys Verliebtheit rührte nicht zuletzt daher, daß ihr Arbeitgeber, Herr über eine Villa mit vielen Zimmern, sich so selbstverständlich in ihrem Reich, der Küche, zu bewegen verstand.
»Salat richtig anzurichten ist eine fast schon verlorene Kunst«, sagte Thomas Lieven. »In Mitteldeutschland wird er süß zubereitet und schmeckt wie verdorbener Kuchen, in Süddeutschland sauer wie Kaninchenfutter, und in Norddeutschland benutzen die Hausfrauen sogar Salatöl. O heiliger Lukullus! Türschlösser sollte man behandeln mit diesem Öl, aber nicht Salat!«
»Jawohl, gnädiger Herr«, sagte Kitty, immer noch atemlos. In der Ferne begannen Kirchenglocken zu läuten. Es war 19 Uhr am 11. April 1957.
Der 11. April 1957 schien ein Tag zu sein wie jeder andere. Nicht so für Thomas Lieven! Denn an diesem Tag wähnte er, mit einer wüsten, gesetzesfeindlichen Vergangenheit abschließen zu können. An diesem 11. April 1957 bewohnte Thomas Lieven, kurz vorher 48 Jahre alt geworden, eine gemietete Villa im vornehmsten Teil der Cecilien-Allee zu Düsseldorf. Er besaß ein ansehnliches Guthaben bei der »Rhein-Main-Bank« und einen Luxussportwagen deutscher Fabrikation, der 32000 DM gekostet hatte.
Thomas Lieven war ein außerordentlich guterhaltener Endvierziger. Schlank, groß und braungebrannt, besaß er kluge, leicht melancholische Augen und einen sensiblen Mund im schmalen Gesicht. Das schwarze Haar war kurz geschnitten, grau meliert an den Schläfen.
Thomas Lieven war nicht verheiratet. Seine Nachbarn kannten ihn als stillen, vornehmen Menschen. Sie hielten ihn für einen soliden bundesdeutschen Geschäftsmann, wenngleich sie ein wenig unmutig darüber waren, daß sich so wenig Konkretes über ihn erfahren ließ …
»Meine liebe Kitty«, sagte Thomas Lieven, »Sie sind hübsch, Sie sind jung, zweifellos werden Sie noch eine Menge lernen müssen. Wollen Sie von mir etwas lernen?«
»Mit Freuden«, hauchte Kitty, diesmal sehr atemlos.
»Gut, ich werde Ihnen das Rezept verraten, wie man Kopfsalat schmackhaft macht. Was haben wir bisher getan?«
Kitty knickste. »Vor zwei Stunden haben wir zwei mittelgroße Salatköpfe gewässert, gnädiger Herr. Dann haben wir die harten Stiele entfernt und nur die zarten Blätter ausgesucht …«
»Was haben wir mit den zarten Blättern gemacht?« forschte er weiter.
»Wir haben sie in eine Serviette getan und die Serviette mit den vier Zipfeln zusammengeknotet. Dann haben Sie, gnädiger Herr, die Serviette geschlenkert …«
»Geschleudert, liebe Kitty, geschleudert, um den letzten Tropfen Flüssigkeit herauszuholen. Es ist von größter Wichtigkeit, daß die Blätter vollkommen trocken sind. Doch wollen wir jetzt unsere Aufmerksamkeit der Zubereitung einer Salatsauce zuwenden. Reichen Sie mir bitte eine Glasschüssel und ein Salatbesteck!«
Als Kitty zufällig die lange, schlanke Hand ihres Arbeitgebers berührte, durchlief sie ein süßer Schauder.
Was für ein Mann, dachte sie …
Was für ein Mann – das hatten auch unzählige Menschen gedacht, die Thomas Lieven in den vergangenen Jahren kennenlernten. Von welcher Art diese Menschen waren, mag daraus hervorgehen, was Thomas Lieven liebte und was er haßte.
Thomas Lieven liebte:
schöne Frauen, elegante Kleidung, antike Möbel, schnelle Wagen, gute Bücher, kultiviertes Essen und gesunden Menschenverstand.
Thomas Lieven haßte:
Uniformen, Politiker, Krieg, Unvernunft, Waffengewalt und Lüge, schlechte Manieren und Grobheit.
Es hatte eine Zeit gegeben, da war Thomas Lieven das Urbild eines ordentlichen Bürgers, abhold jeder Intrige, zugeneigt einem Leben voll Sicherheit, Ruhe und Bequemlichkeit. Gerade einen solchen Menschen aber riß ein seltsames Geschick – von dem ausführlich noch zu erzählen sein wird – aus seiner sanften Bahn.
Der ordentliche Bürger Thomas Lieven sah sich gezwungen, in ebenso gewaltigen wie grotesken Aktionen die folgenden Organisationen übers Ohr zu hauen: die deutsche Abwehr und die Gestapo, den britischen »Secret Service«, das französische »Deuxième Bureau«, das amerikanische »Federal Bureau of Investigation« und den sowjetischen Staatssicherheitsdienst.
Der ordentliche Bürger Thomas Lieven sah sich gezwungen, in fünf Kriegs- und zwölf Nachkriegsjahren sechzehn falsche Pässe von neun Ländern zu benutzen.
Im Krieg stiftete Thomas Lieven maßlose Verwirrung sowohl in den deutschen als auch in den alliierten Hauptquartieren. Er fühlte sich keineswegs wohl dabei.
Nach dem Krieg wiederum hatte er – wie wir wohl alle – für kurze Zeit das Gefühl, daß der Wahnsinn, in dem und von dem er gelebt hatte, zu Ende sei.
Irrtum!
Die Herren im Dunkeln ließen Thomas Lieven nicht mehr los. Aber dafür rächte er sich an seinen Peinigern. Er nahm von den Reichen der Besatzungszeit, von den Hyänen der Währungsreform, von den Neureichen des Wirtschaftswunders.
Es gab keinen Eisernen Vorhang für Thomas Lieven. Er handelte und wandelte in Ost und West. Die Behörden zitterten vor ihm.
Abgeordnete verschiedener Landtage und Parlamentarier in Bonn zittern noch heute, denn Thomas Lieven lebt, und er weiß eine Menge über Spielbanken, Baugeschäfte und Aufträge der neuen deutschen Bundeswehr …
Er heißt natürlich nicht Thomas Lieven.
Man wird uns unter den gegebenen Umständen verzeihen, daß wir seinen Namen ebenso geändert haben wie seine Adresse. Aber die Geschichte dieses einstmals friedlichen Bürgers, dessen Leidenschaft auch heute noch das Kochen ist und der wider Willen zu einem der größten Abenteurer unserer Zeit wurde, diese Geschichte ist wahr.
Wir beginnen sie am Abend des 11. April 1957, in jenem historischen Moment, da Thomas Lieven über die Zubereitung von Kopfsalat doziert.
Kehren wir also wieder in die Küche seiner Villa zurück!
»Salat darf nie mit Metall in Berührung kommen«, sagte Thomas Lieven.
Kitty blickte wie hypnotisiert auf die schlanken Hände ihres Arbeitgebers, und sie hörte seinem Vortrag mit immer neuen Schauern zu.
»Zur Sauce«, sagte Thomas Lieven, »nehme man eine Messerspitze Pfeffer, eine Messerspitze Salz, einen Teelöffel scharfen Senf. Dazu ein hartes Ei, kleingeschnitzelt. Viel Petersilie. Noch mehr Schnittlauch. Vier Eßlöffel original italienisches Olivenöl. Kitty, das Öl bitte!«
Errötend reichte Kitty das Gewünschte.
»Vier Löffel davon, wie gesagt. Und nun noch ein Viertelliter Sahne, saure oder süße, das ist eine Geschmacksfrage, ich nehme saure …«
In diesem Augenblick ging die Küchentür auf, und ein Riese trat ein. Er trug schwarz-grau gestreifte Hosen, eine blau-weiß gestreifte Hausjacke, ein weißes Hemd und eine weiße Schleife. Bürstenhaar zierte den Schädel. Wäre ihm eine Glatze eigen gewesen, dann hätte er wie eine zu groß geratene Zweitausgabe von Yul Brynner gewirkt.
»Was gibt es, Bastian?« fragte Thomas Lieven.
Mit einer leicht schleppenden, französisch akzentuierten Stimme erwiderte der Diener: »Herr Direktor Schallenberg ist eingetroffen.«
»Pünktlich auf die Minute«, sagte Thomas. »Mit dem Mann wird sich arbeiten lassen.«
Er band die Schürze ab. »Essen also in zehn Minuten. Bastian wird servieren. Sie, liebes Kind, haben Ausgang.«
Während Thomas Lieven sich im schwarzgekachelten Badezimmer die Hände wusch, bürstete Bastian noch einmal über die Smokingjacke.
»Wie sieht der Herr Direktor denn aus?« fragte Thomas Lieven.
»Das Übliche«, antwortete der Riese. »Fett und solide. Stiernacken und Kugelbauch. Ordentliche Provinz.«
»Klingt nicht unsympathisch.«
»Zwei Schmisse hat er auch.«
»Ich nehme alles zurück.« Thomas schlüpfte in die Smokingjacke. Dabei fiel ihm etwas auf. Mißbilligend sprach er: »Bastian, du bist schon wieder an den Kognak gegangen!«
»Nur ein Schlückchen. Ich war ein bißchen aufgeregt.«
»Laß das! Wenn etwas Menschliches passiert, brauche ich deinen klaren Kopf. Du kannst den Herrn Direktor nicht zusammenschlagen, wenn du blau bist.«
»Den Dicken nehme ich noch im Delirium tremens auf mich!«
»Ruhe! Die Sache mit dem Klingelzeichen ist dir klar?«
Menu • 11. April 1957
Dieses Abendessen brachte 717850 Schweizer Franken ein.
Lady-Curzon-Suppe
Paprikahuhn • Kopfsalat »Clara« • Reis
Gespickte Äpfel mit Weinschaumsauce • Toast mit Käse
Suppe: Lady Curzon war die Frau des englischen Vizekönigs Lord Curzon. Ihr Mann schrieb politische Bücher. Sie verfaßte Kochrezepte. Für ihre Schildkrötensuppe empfiehlt die Lady die Vorderfüße der schmackhaften Tiere. Sie enthalten das beste Fleisch. Zum Würzen nehme man: Dragon und Thymian, Ingwer, Muskat, Nelken sowie Curry. Ein Glas Sherry gehört in die Suppe, in der möglichst noch Schildkröteneier, Würstchen aus den Därmen und eine Farce von den Innereien des Tieres schwimmen sollen. Wem dies jedoch zu umständlich erscheint, der kaufe sich im Laden eine Büchse fertige Schildkrötensuppe, vergesse allerdings nicht, einen kräftigen Schluck Sherry und einen Tassenkopf Sahne hineinzugießen.
Paprikahuhn: Man brate ein zartes Huhn auf die übliche Weise in Butter, lasse es aber nicht zu braun werden, teile es dann je nach Größe in 4 oder 6 Teile und stelle sie warm. – Man lasse eine sehr fein gehackte Zwiebel und einen Teelöffel Paprika in der Bratbutter dünsten, dann mit wenig Wasser oder Fleischbrühe aufkochen, füge reichlich dicke saure Sahne, die mit etwas Maizena verrührt wurde, hinzu, schmecke mit Salz und eventuell noch Paprika ab. Um die rote Farbe zu verstärken, gibt man etwas Tomatenmark in die Sauce, das aber keinesfalls vorschmecken darf. – Man lege die Hühnerstücke in die Sauce, lasse sie einige Minuten darin ziehen.
Reis: Fast immer »klebt« der Reis wie ein Brei. Dabei ist es so einfach, Reis körnig zu machen. Man beachte: Der Reis soll – nachdem er gut gewaschen ist – in beliebiger Menge Wasser 10–15 Minuten kochen. Nun kommt er in ein Sieb und wird darin unter kaltem Wasser gespült. Das ist der Trick, um das klebrige Reismehl zu entfernen! Kurz vor dem Anrichten wärme man den Reis in demselben Sieb über kochendem Wasser, nur durch den Wasserdampf. Erst in der tischfertigen Schüssel kommt dann etwas Butter, Salz oder auch je nach Geschmack Curry, Safran oder Pfeffer darüber.
Gespickte Äpfel mit Weinschaumsauce: Gleichmäßig große, mürbe Äpfel schälen, in einem vanillierten Zuckersirup langsam gar ziehen lassen, ohne daß sie zerfallen, aus der Sauce heben und in einem Sieb abtropfen lassen. In der Zwischenzeit Mandeln abziehen, in Streifen schneiden, auf ein Backblech ausbreiten und im heißen Backofen rösten. Die gut abgetropften Äpfel werden nun mit Likör, Rum oder Kognak getränkt und mit den Mandelstiften gespickt. Man richtet sie auf einer Platte an und reicht dazu die Weinschaumsauce: Zwei Eidotter werden mit 100 Gramm Zucker schaumig gerührt, 20 Gramm Mais- oder Stärkepulver mit einer halben Tasse Wasser glattgerührt, ein viertel Liter Weißwein dazugegeben und zusammen mit der schaumiggerührten Eiermasse unter Rühren auf kleiner Flamme dick gekocht. Die zwei Eiweiß zu steifem Schnee schlagen, unter die Masse ziehen, eventuell mit Rum, Arrak, Kognak usw. abschmecken.
Toast mit Käse: Man bestreiche Weißbrotscheibchen in der Mitte dick mit Butter. Eine Scheibe Käse – nur Emmentaler oder Edamer ist geeignet – wird darauf gelegt. Die Schnittchen werden auf einem Kuchenblech in gut angewärmter Röhre 5 Minuten gebacken, bis sie goldgelb sind. Ganz heiß servieren.
»Wiederhole.«
»Jawohl.«
»Einmal klingeln: Ich bringe den nächsten Gang. Zweimal klingeln: Ich bringe die Fotokopien. Dreimal klingeln: Ich komme mit dem Sandsack.«
»Ich wäre dir dankbar«, sagte Thomas Lieven, an seinen Nägeln feilend, »wenn du das nicht durcheinanderbringen wolltest.«
2
»Ausgezeichnet, die Suppe«, sagte Direktor Schallenberg. Er lehnte sich zurück und betupfte mit der Damastserviette seine schmalen Lippen.
»Lady Curzon«, sagte Thomas und klingelte einmal, indem er auf eine Taste unter der Tischplatte drückte.
»Lady was?«
»Curzon – so heißt die Suppe. Schildkröte mit Sherry und Sahne.«
»Ach so, natürlich!«
Die Flammen der Kerzen, die auf dem Tisch standen, flackerten plötzlich. Geräuschlos war Bastian eingetreten und servierte das Paprikahuhn.
Die Flammen beruhigten sich. Ihr warmes gelbes Licht fiel auf den dunkelblauen Teppich, den breiten altflämischen Tisch, die bequemen Holzstühle mit den Bastlehnen, die große altflämische Anrichte.
Das Hühnchen entzückte Direktor Schallenberg aufs neue. »Delikat, einfach delikat. Wirklich charmant von Ihnen, mich einzuladen, Herr Lieven! Wo Sie mich doch eigentlich nur geschäftlich sprechen wollen …«
»Alles bespricht sich besser bei einem guten Essen, Herr Direktor. Nehmen Sie noch Reis, er steht vor Ihnen.«
»Danke. Nun sagen Sie schon, Herr Lieven, um was für ein Geschäft handelt es sich?«
»Noch etwas Salat?«
»Nein, danke. Schießen Sie doch endlich los!«
»Na schön«, sagte Thomas. »Herr Direktor, Sie haben eine große Papierfabrik.«
»So ist es, ja. Zweihundert Angestellte. Alles aus den Trümmern wieder aufgebaut.«
»Eine stolze Leistung. Zum Wohlsein …« Thomas Lieven hob sein Glas.
»Komme nach.«
»Herr Direktor, wie ich weiß, stellen Sie besonders hochwertiges Wasserzeichenpapier her.«
»Jawohl.«
»Unter anderem liefern Sie das Wasserzeichenpapier für die neuen Aktien, welche die ›Deutschen Stahlunion-Werke‹ gerade auf den Markt bringen.«
»Richtig. Aktien der DESU. Kann Ihnen sagen, diese Scherereien, diese dauernden Kontrollen! Damit meine Leute ja nicht auf die Idee kommen, ein paar Aktien selber zu drucken, hahaha!«
»Hahaha. Herr Direktor, ich möchte bei Ihnen fünfzig Großbogen dieses Wasserzeichenpapiers bestellen.«
»Sie wollen … was?«
»Fünfzig Großbogen bestellen. Als Firmenchef dürfte es Ihnen kaum Schwierigkeiten bereiten, die Kontrollen zu umgehen.«
»Aber um Himmels willen, was wollen Sie denn mit den Bogen?«
»Aktien der DESU-Werke drucken natürlich. Was haben Sie gedacht?«
Direktor Schallenberg legte seine Serviette zusammen, blickte nicht ohne Bedauern auf seinen noch halbvollen Teller und äußerte: »Ich fürchte, ich muß jetzt gehen.«
»Aber keineswegs. Es gibt noch Äpfel in Weinschaumsauce und Toast mit Käse.«
Der Direktor stand auf. »Mein Herr, ich werde vergessen, daß ich jemals hiergewesen bin.«
»Ich bezweifle, daß Sie das jemals vergessen werden«, sagte Thomas und häufte noch etwas Reis auf seinen Teller. »Warum stehen Sie eigentlich, Herr Wehrwirtschaftsführer? Setzen Sie sich doch.«
Schallenbergs Gesicht lief dunkelrot an. Er sagte leise: »Was war das?«
»Sie sollen sich setzen. Ihr Huhn wird kalt.«
»Sagten Sie Wehrwirtschaftsführer?«
»Sagte ich. Das waren Sie doch. Auch wenn Sie diesen Titel 1945 vergaßen. In Ihrem Fragebogen beispielsweise. Wozu auch noch daran erinnern? Damals hatten Sie sich gerade neue Papiere und einen neuen Namen besorgt. Als Wehrwirtschaftsführer hießen Sie Mack.«
»Sie sind ja wahnsinnig!«
»In keiner Weise. Sie waren Wehrwirtschaftsführer im Warthegau. Sie stehen noch immer auf einer Auslieferungsliste der polnischen Regierung. Unter Mack natürlich, nicht unter Schallenberg.«
Direktor Schallenberg sank auf seinen altflämischen Bastsessel, fuhr sich mit der Damastserviette über die Stirn und äußerte kraftlos: »Ich weiß wirklich nicht, warum ich mir das anhöre.«
Thomas Lieven seufzte. »Sehen Sie, Herr Direktor, auch ich habe eine bewegte Vergangenheit hinter mir. Ich will mich von ihr lösen. Darum brauche ich Ihr Papier. Es nachzumachen dauert zu lange. Zuverlässige Drucker dagegen habe ich … Ist Ihnen nicht gut? Nanu … Nehmen Sie einen Schluck Champagner, das belebt … Ja, sehen Sie, Herr Direktor, damals, als der Krieg zu Ende war, hatte ich Zugang zu allen geheimen Dossiers. Zu jener Zeit waren Sie gerade in Miesbach untergetaucht …«
»Lüge!«
»Entschuldigen Sie, ich meinte Rosenheim. Auf dem Lindenhof.«
Diesmal hob Direktor Schallenberg nur schlaff die Hand.
»Ich wußte, daß Sie sich dort versteckten. Hätte Sie verhaften lassen können, in meiner damaligen Position. Ich dachte mir: Was hast du schon davon? Man wird ihn einsperren, man wird ihn ausliefern. Na und ?« Mit Appetit aß Thomas ein Stück Hühnerbein. »Jedoch, sagte ich mir, wenn du ihn hübsch in Ruhe läßt, dann wird der Herr in ein paar Jahren wieder oben schwimmen. Die Sorte geht nicht unter, die schwimmt immer wieder oben …«
»Unverschämtheit!« krächzte es aus dem Bastsessel.
»… und dann kann er dir viel nützlicher sein. Sagte ich mir damals, handelte danach, und siehe, es war wohlgetan.«
Mühsam rappelte sich Schallenberg hoch. »Ich gehe jetzt direkt zur Polizei und erstatte Anzeige.«
»Nebenan steht ein Telefon.« Unter dem Tisch drückte Thomas zweimal auf die Klingeltaste.
Wieder flackerten die Kerzenflammen, als der Diener Bastian geräuschlos eintrat. Er trug ein Silbertablett, darauf lagen mehrere Fotokopien.
»Ich bitte, sich zu bedienen«, sagte Thomas. »Die Kopien zeigen unter anderem Herrn Direktor in Uniform, verschiedene Erlasse des Herrn Direktors aus den Jahren 1941 bis 1944 und eine Empfangsbestätigung des sogenannten NS-Reichsschatzmeisters über den Erhalt von Reichsmark einhunderttausend als Spende für SA und SS.«
Direktor Schallenberg setzte sich wieder.
»Sie können abservieren, Bastian. Der Herr Direktor ist fertig.«
»Sehr wohl, gnädiger Herr.«
Nachdem Bastian verschwunden war, sagte Thomas: »Im übrigen sind Sie mit fünfzigtausend bei der Sache dabei. Genügt Ihnen das?«
»Ich lasse mich doch nicht erpressen!«
»Haben Sie sich nicht auch am letzten Wahlkampf mit hohen Spenden beteiligt, Herr Direktor? Wie heißt doch gleich das deutsche Nachrichtenmagazin, das sich für derlei interessiert?«
»Sie sind komplett wahnsinnig! Sie wollen falsche Aktien drucken? Ins Zuchthaus werden Sie kommen! Und ich mit! Ich bin erledigt, wenn ich Ihnen das Papier gebe!«
»Ich komme nicht ins Zuchthaus. Und Sie sind nur erledigt, wenn Sie mir das Papier nicht geben, Herr Direktor.« Thomas drückte einmal auf den Klingelknopf. »Passen Sie auf, wie gut Ihnen die gespickten Äpfel schmecken werden.«
»Ich esse doch keinen Bissen mehr bei Ihnen, Sie Erpresser!«
»Wann kann ich also mit dem Papier rechnen, Herr Direktor?«
»Niemals!« schrie Schallenberg in maßlosem Zorn. »Niemals bekommen Sie von mir auch nur einen einzigen Bogen!«
3
Es war beinahe Mitternacht. Mit seinem Diener Bastian saß Thomas Lieven vor einem flackernden Kaminfeuer in der großen Bibliothek. Rot und golden, blau, weiß, gelb und grün leuchteten Hunderte von Bücherrücken aus dem Halbdunkel. Ein Plattenspieler lief. Leise erklang das Klavierkonzert Nummer zwei von Rachmaninow.
Thomas Lieven trug immer noch den makellosen Smoking. Bastian hatte den Hemdkragen geöffnet und seine Beine auf einen Stuhl gelegt, allerdings nicht ohne vorher, mit einem Seitenblick auf seinen Herrn, eine Zeitung untergeschoben zu haben.
»Direktor Schallenberg liefert das Papier in einer Woche«, sagte Thomas Lieven. »Wie lange brauchen deine Freunde zum Drucken?«
»Etwa zehn Tage«, antwortete Bastian. Er hob ein bauchiges Schwenkglas mit Kognak zum Mund.
»Dann werde ich am ersten Mai – schönes Datum, Tag der Arbeit – nach Zürich fahren«, sagte Thomas. Er überreichte Bastian eine Aktie und eine Liste. »Hier ist eine Vorlage für den Druck, und auf der Liste stehen die laufenden Nummern, die ich auf den Aktien sehen möchte.«
»Wenn ich bloß wüßte, was du vorhast«, brummte der Igelkopf bewundernd.
Nur wenn Bastian sich absolut allein mit seinem Herrn wußte, benutzte er das vertrauliche »Du«, denn er kannte Thomas seit siebzehn Jahren, und er war früher einmal alles andere als ein Diener gewesen.
Bastian hing an Thomas seit jener Zeit, da er mit ihm im Quartier einer Marseiller Gangsterchefin bekannt geworden war. Außerdem hatte er einige gefährliche Abenteuer mit Thomas bestanden. So etwas bindet.
»Tommy, willst du mir nicht sagen, was du planst?«
»Es handelt sich, lieber Bastian, im Grunde um etwas sehr Legales und Schönes: um die Erwerbung von Vertrauen. Mein Aktienschwindel wird ein eleganter Aktienschwindel sein. Es wird – Holz anfassen – überhaupt niemand merken, daß es ein Schwindel gewesen ist. Alle werden verdienen. Alle werden zufrieden sein.«
Thomas Lieven lächelte verträumt und holte eine goldene Repetieruhr hervor. Sie stammte von seinem Vater. Durch alle Fährnisse des Lebens hatte Thomas diese flache Uhr mit dem Sprungdeckel begleitet, auf tollkühnen Fluchten und Jagden war sie dabeigewesen. Immer wieder war es Thomas Lieven gelungen, sie zu verstecken, zu beschützen oder wiederzuerobern. Er ließ den Deckel aufspringen. Silberhell kündigte ein eingebautes Schlagwerk die Zeit.
Traurig sagte Bastian: »Ich kriege es nicht in meinen Schädel. Eine Aktie ist ein Anteilschein an einem großen Unternehmen. Auf fällige Aktiencoupons erhält man in bestimmten Abständen eine bestimmte Dividende ausbezahlt, einen entsprechenden Teil des Gewinnes, den das Unternehmen erzielt hat.«
»Ja und, mein Kleiner?«
»Himmel noch mal, aber die Coupons deiner gefälschten Aktien kannst du doch bei keiner Bank der Welt vorlegen! Die Nummern, die darauf stehen, stehen doch auch auf den echten Aktien, die irgend jemand besitzt. Der Schwindel muß doch sofort auffliegen.«
Thomas erhob sich. »Coupons werde ich natürlich auch niemals vorlegen.«
»Aber wo ist dann der Trick?«
»Laß dich überraschen«, sagte Thomas, trat zu einem Wandsafe und öffnete das Kombinationsschloß. Eine schwere Stahltüre schwang zur Seite. Im Safe lagen Bargeld, ein paar Goldbarren mit Bleikern (und einer kurzweiligen Geschichte) und drei Schachteln mit gefaßten und ungefaßten Edelsteinen. Im Vordergrund lag ein Häufchen Pässe.
Versonnen sprach Thomas: »Ich werde zur Sicherheit doch lieber unter einem andern Namen in die Schweiz reisen. Laß uns mal sehen, was haben wir denn noch an deutschen Pässen?« Lächelnd las er die Namen: »Mein Gott, wie viele Erinnerungen hängen daran: Jakob Hausér … Peter Scheuner … Ludwig Freiherr von Trendelenburg … Wilfried Ott …«
»Als Trendelenburg hast du die Cadillacs nach Rio verschoben. Den Freiherrn würde ich ein bißchen ausruhen lassen. Auch den Hausér. Den suchen sie immer noch in Frankreich«, sagte Bastian versonnen.
4
»Nehmen Sie Platz, Herr Ott. Womit können wir Ihnen dienen?« fragte der Leiter der Effektenabteilung und ließ die schlichte Visitenkarte »Wilfried Ott, Industrieller, Düsseldorf« sinken. Der Leiter der Effektenabteilung hieß Jules Vermont. Sein Büro lag im ersten Stock der »Schweizer Zentralbank« in Zürich.
Thomas Lieven, der sich gerade Wilfried Ott nannte, fragte: »Sie sind Franzose, Monsieur?«
»Mütterlicherseits.«
»Dann lassen Sie uns französisch sprechen«, schlug Thomas, alias Wilfried, vor, indem er diese Sprache bereits akzentfrei benutzte. Die Sonne ging auf im Gesicht Jules Vermonts.
»Kann ich bei Ihrer Bank wohl ein Nummerndepot eröffnen?«
»Selbstverständlich, Monsieur.«
»Ich habe gerade ein paar neue Aktien der Deutschen Stahlunion erworben. Die möchte ich gerne hier in der Schweiz lassen. Wie gesagt, auf einem Nummerndepot, nicht unter meinem Namen …«
»Ich verstehe. Die böse deutsche Steuer, wie?« Vermont zwinkerte mit einem Auge.
Daß Ausländer Vermögenswerte deponierten, war ihm nichts Neues. Insgesamt 150 Milliarden Franken, die Ausländern gehörten, ruhten 1957 in der Schweiz.
»Damit ich es nicht vergesse«, sagte Thomas Lieven, »lassen Sie doch bitte die Coupons für 1958 und 1959 abschneiden. Da ich nicht weiß, wann ich wieder nach Zürich komme, werde ich diese Coupons bei mir behalten und zur gegebenen Zeit selbst einlösen. Das erspart Ihnen die Arbeit.« Er dachte: Und mir erspart es das Zuchthaus …
Wenig später war alles vorbei. In Thomas Lievens Brusttasche ruhte eine Depotbestätigung der »Schweizer Zentralbank« darüber, daß ein Herr Wilfried Ott, Industrieller aus Düsseldorf in Westdeutschland, neue Aktien der DESU-Werke im Nominalwert von einer Million D-Mark hinterlegt habe.
In seinem Sportwagen, der selbst in Zürich stark beachtet wurde, fuhr er zurück in sein Hotel »Baur au Lac«. Hier liebten ihn die Angestellten alle. In allen Hotels der Welt, die er besuchte, liebten ihn alle Angestellten. Das hing mit seinem sonnigen Wesen, seiner demokratischen Gesinnung und seinen Trinkgeldern zusammen.
Er fuhr mit dem Lift in sein Appartement hinauf. Hier ging er zunächst ins Badezimmer und spülte die abgeschnittenen Coupons für 1958 und 1959 fort, auf daß kein Unfug damit angestiftet werden konnte! Der Salon besaß einen Balkon. Thomas setzte sich unter ein buntes Sonnensegel, blickte zufrieden hinaus zu den kleinen Schiffen, die auf dem glitzernden Wasser des Zürichsees schwammen, und überlegte eine Weile. Dann verfaßte er mit einem goldenen Bleistift auf einem Briefbogen des Hotels diese Annonce:
DEUTSCHER INDUSTRIELLER
sucht gegen hohe Verzinsung und erstklassige Sicherheit zweijährige Beteiligung in der Schweiz. Nur wirklich seriöse Angebote mit Banknachweis finden Berücksichtigung.
Diese Anzeige erschien zwei Tage später an auffallender Stelle im Anzeigenteil der »Neuen Zürcher Zeitung«. Es war eine Chiffre angegeben. In drei Tagen liefen unter dieser Chiffre 46 Briefe ein.
Bei strahlend schönem Wetter auf seinem Balkon sitzend, sortierte Thomas die Angebote gewissenhaft.
Sie ließen sich in vier Gruppen einteilen:
Siebzehn Briefe hatten Immobilienbüros, Antiquitätengeschäfte, Juweliere und Autoverkäufer zum Absender, die zwar kein Geld, dafür ihre Objekte anpriesen. Zehn Briefe stammten von Herren, die zwar kein Geld hatten, jedoch ihre Vermittlung zu anderen Herren anboten, die angeblich über solches verfügten. Elf Briefe, teils mit, teils ohne Fotos, stammten von Damen, die zwar kein Geld, jedoch teils mit, teils ohne Charme sich selbst anboten.
Und acht Briefe schließlich stammten von Menschen, die Geld offerierten.
Die achtunddreißig Briefe der ersten drei Gruppen zerriß Thomas Lieven in viele kleine Stücke.
Von den verbleibenden Offerten erregten zwei wegen ihrer absoluten Gegensätzlichkeit das besondere Interesse Thomas Lievens.
Der eine Brief war mit einer nicht sehr guten Maschine auf nicht sehr gutes Papier geschrieben worden – in nicht sehr gutem Deutsch. Der Absender bot »… gegen eine Verzinsung, wo für mich interessant ist, Beträge bis zu Schweizer Franken 1000000«. Unterzeichnet war die Offerte: »Pierre Muerrli, Häusermakler«.
Der andere Brief war in kleiner, zierlicher Schrift mit der Hand geschrieben. Der gelbliche Bogen aus feinstem Bütten trug in der Mitte des oberen Randes eine kleine goldene Krone mit fünf Zacken.
Der Text lautete:
Château Montenac, 8. Mai 1957
Sehr geehrter Herr!
In Zusammenhang mit Ihrer Annonce in der Neuen Zürcher Zeitung bitte ich – nach telefonischer Anmeldung – um Ihren Besuch.
H. de Couville
Sinnend legte Thomas die so ungleichen Bogen nebeneinander, sinnend betrachtete er sie. Sinnend holte er aus der Westentasche die goldene Repetieruhr und ließ die silberhellen Schläge ertönen – eins, zwei, drei … und noch zwei Schläge: halb vier Uhr.
Pierre Muerrli, überlegte Thomas, war gewiß ein sehr reicher Mann, wenn auch ein sehr geiziger. Er kaufte schlechtes Papier und schrieb auf einer alten Maschine.
Dieser H. de Couville schrieb zwar mit der Hand, aber auf bestes Papier. Ob er ein Graf war? Ein Baron?
Mal sehen …
Das Château Montenac lag in einem mächtigen Park auf dem Südhang des Zürichberges. In Serpentinen führte ein breiter Kiesweg zu dem kleinen, kaisergelb gestrichenen Palais mit den grünen Fensterläden empor. Thomas parkte seinen Wagen vor einer mächtigen Auffahrt.
Ein ungemein hochmütiger Diener stand plötzlich vor ihm: »Monsieur Ott? Ich bitte, mir zu folgen.« Er führte ihn ins Haus, durch mehrere prunkvolle Räume und zuletzt in ein prunkvolles Arbeitszimmer.
Hinter einem zierlichen Schreibtisch erhob sich hier eine schlanke, elegante junge Frau von etwa 28 Jahren. In weichen Wellen fiel ihr kastanienbraunes Haar bis fast auf die Schultern. Hellrosa glänzte der große Mund. Schräggeschnitten waren die braunen Augen, hochgestellt die Backenknochen. Lange, seidige Wimpern besaß die Dame, samtweiche, goldgetönte Haut.
Thomas verspürte einen Stich. Damen mit schrägen Augen und hohen Backenknochen hatten in seinem Leben Verheerungen angerichtet. Dieser Typ, dachte er, beträgt sich immer gleich. Abweisend. Kühl. Überheblich. Aber wenn man ihn dann näher kennenlernt – dann gibt’s kein Halten mehr!
Die junge Dame sah ihn ernst an: »Guten Tag, Herr Ott. Wir haben miteinander telefoniert. Bitte, nehmen Sie Platz.«
Sie setzte sich und kreuzte die Beine. Das Kleid glitt etwas zurück. Auch noch lange, schöne Beine! dachte Thomas.
»Herr Ott, Sie suchen eine Beteiligung. Sie sprachen von erstklassigen Sicherheiten. Darf ich wissen, worum es sich dabei handelt?«
Das geht denn doch ein bißchen weit, dachte Thomas. Kühl sagte er: »Ich denke, damit muß ich Sie nicht belästigen. Wenn Sie freundlicherweise Herrn de Couville sagen möchten, daß ich da bin. Er hat mir geschrieben.«
»Ich habe Ihnen geschrieben. Ich heiße Hélène de Couville. Ich erledige alle Geldgeschäfte für meinen Onkel«, erklärte die junge Dame überkühl. »Also, Herr Ott, was nennen Sie eine erstklassige Sicherheit?«
Thomas neigte lächelnd den Kopf: »Neu aufgelegte Aktien der DESU-Werke, hinterlegt in einem Depot der ›Schweizer Zentralbank‹. Nominalwert: eine Million. Börsenkurs der Altaktien: zwohundertsiebzehn …«
»Welche Verzinsung bieten Sie?«
»Acht Prozent.«
»Und an welche Summe denken Sie?«
Herrgott, diese kühlen Augen, dachte er und sagte: »Siebenhundertfünfzigtausend Schweizer Franken.«
»Bitte?«
Zu seinem Erstaunen sah Thomas Lieven, daß Hélène de Couville plötzlich nervös wurde. Die Zungenspitze glitt über die hellroten Lippen. Die Wimpern flatterten ein wenig. »Ist das nicht eine – hm, etwas hohe Summe, Herr Ott?«
»Wieso bitte? Bei dem Börsenwert der Aktien?«
»Gewiß … ja … aber …« Sie stand auf. »Es tut mir leid, ich glaube, da muß ich doch meinen Onkel holen. Verzeihen Sie, bitte, einen Augenblick.«
Er stand auf. Sie verschwand. Er setzte sich wieder. Er wartete, nach Auskunft seiner alten Repetieruhr, acht Minuten lang. Instinkt, gewonnen in vielen Jahren eines gesetzlosen Lebens, sagte ihm: Hier stimmt etwas nicht! Aber was?
Die Tür ging auf, Hélène kam zurück. Mit ihr erschien ein Mann, groß und hager, mit sonnverbranntem Gesicht und breitem Kiefer, mit kurzen, eisgrauen Haaren und weißem Nylonhemd unter einem Einreiher. Hélène stellte vor: »Baron Jacques de Couville, mein Onkel.«
Die Herren schüttelten einander die Hand. Immer mißtrauischer dachte Thomas: Eine Pfote wie ein Cowboy hat er. Und einen Kiefer, als würde er dauernd Gummi kauen. Und einen Akzent … Wenn das ein Aristokrat französischer Abstammung ist, fresse ich einen Besen!
Er war jetzt entschlossen, kurzen Prozeß zu machen: »Baron, ich fürchte, ich habe Ihre bezaubernde Nichte erschreckt. Lassen Sie uns die ganze Sache vergessen. Es war mir eine Ehre, Sie kennenzulernen.«
»Moment mal, Monsieur Ott, seien Sie doch nicht so entsetzlich hastig. Setzen wir uns.« Auch der Baron war nervös. Er klingelte. »Wir wollen in Ruhe über die Geschichte reden. Bei ein paar Drinks.«
Als der hochmütige Diener die Drinks brachte, erwies sich der Whisky als Bourbon, nicht als Scotch.
Mehr und mehr mißfällt mir dieser Couville, dachte Thomas.
Der Baron nahm das Gespräch wieder auf. Er bekannte, daß er eigentlich nur an eine wesentlich geringere Beteiligung gedacht hätte: »… vielleicht hunderttausend?«
»Baron, wollen wir es doch lassen«, sagte Thomas.
»Oder hundertfünfzigtausend …«
»Wirklich, Baron, wirklich …«
»Vielleicht auch zweihundert …« Es klang fast flehend.
Plötzlich trat der hochmütige Diener ein und meldete, ein Ferngespräch sei da. Daraufhin verschwand der Baron mit seiner Nichte.
Thomas fing allmählich an, sich über diese Aristokratenfamilie zu amüsieren. Als nach beinahe zehn Minuten der Baron allein zurückkam, fahl im Gesicht und furchtbar schwitzend, tat ihm der arme Mann beinahe leid. Aber er verabschiedete sich abrupt.
In der Halle begegnete ihm Hélène. »Sie gehen schon, Monsieur Ott?«
»Ich habe Sie viel zu lange belästigt«, sagte Thomas und küßte ihre Hand. Da roch er ihr Parfüm und den Duft ihrer Haut und sagte: »Sie würden mich glücklich machen, wenn Sie heute abend mit mir dinieren wollten, im ›Baur au Lac‹, oder wo Sie befehlen. Bitte, kommen Sie.«
»Herr Ott«, sagte Hélène, und es klang, als spräche eine Marmorstatue, »ich weiß nicht, wieviel Sie getrunken haben, aber ich führe es darauf zurück. Leben Sie wohl.«
5
So unergiebig sich das Gespräch mit dem Baron de Couville erwies, so glatt ließ sich gleich darauf das Geschäft mit dem Häusermakler Pierre Muerrli abwickeln. Ins Hotel zurückgekehrt, rief Thomas ihn an und erklärte kurz, was er wollte, nämlich gegen Sicherheit durch ein DESU-Aktiendepot die Summe von 750000 Franken.
»Mehr nicht?« fragte Pierre Muerrli in kehligem Schwyzerdütsch.
»Nein, das genügt mir«, sagte Thomas und dachte: Man soll nicht übertreiben.
Der Makler kam ins Hotel, ein rotgesichtiger, vierschrötiger Mensch. Ein Mensch mit Tempo!
Am nächsten Tag bereits wurde bei einem Notar dieser Vertrag aufgesetzt und besiegelt:
»Herr Wilfried Ott, Industrieller aus Düsseldorf, verpflichtet sich, eine Beteiligung von einer Dreiviertelmillion Franken mit acht Prozent zu verzinsen. Die Beteiligung soll spätestens am 9. Mai 1959, Mitternacht, zurückbezahlt werden.
Bis zu diesem Zeitpunkt verpflichtet sich Herr Pierre Muerrli, Häusermakler aus Zürich, das Aktiendepot, das ihm Herr Ott als Sicherheit übereignet hat, unberührt zu lassen.
Sollte jedoch die Beteiligung nicht bis zum vereinbarten Termin zurückbezahlt sein, so darf Herr Muerrli über die Wertpapiere frei verfügen.«
Den Vertrag in der Tasche, fuhren Thomas und Muerrli in die Zentralbank. Die Echtheit des Depotscheins wurde bestätigt.
In Pierre Muerrlis Maklerbüro fand sodann die Übergabe eines Barschecks über 717850 Schweizer Franken statt, die Beteiligung abzüglich aller Spesen sowie der achtprozentigen Verzinsung für zwei Jahre.
717850 Schweizer Franken hatte Thomas sich solcherart sozusagen im Handumdrehen verschafft! Zwei Jahre lang konnte und wollte er nun mit diesem Kapital arbeiten; im Mai 1959, fristgerecht und korrekt, zurückzahlen; die falschen Aktien aus dem Depot holen, zerreißen und im Badezimmer fortspülen. Alle würden dann verdient haben, keiner würde dann geschädigt sein, mehr: Keiner würde jemals merken, was da für ein Ding gedreht worden war. Tja, so einfach funktioniert so etwas, wenn so etwas funktioniert …
Als Thomas Lieven, alias Wilfried Ott, Stunden später die Halle seines Hotels betrat, sah er Hélène de Couville in einem Sessel sitzen.
»Hallo, welche Freude!«
Unendlich langsam blickte Hélène von ihrer Modezeitschrift auf. Unendlich gelangweilt äußerte sie: »Oh, guten Tag.«
Sie trug ein braunes Pepitakleid an diesem kühlen Tag und eine Jacke aus kanadischem Naturnerz. Es gab keinen Mann in der Hotelhalle, der sich nicht immer wieder nach ihr umgeschaut hätte. Thomas sagte: »Sie haben sich ein bißchen verspätet, aber ich bin sehr glücklich, daß Sie doch noch gekommen sind.«
»Herr Ott, nehmen Sie zur Kenntnis: Ich komme nicht zu Ihnen, sondern zu einer Freundin, die hier wohnt.«
Thomas sagte: »Wenn es heute nicht geht, dann vielleicht morgen vormittag zum Apéritif?«
»Morgen verreise ich an die Riviera.«
Thomas schlug die Hände zusammen: »Ist das ein Zufall! Wissen Sie, daß ich morgen auch an die Riviera fahre? Ich hole Sie ab. Sagen wir, um elf?«
»Ich werde selbstverständlich nicht mit Ihnen fahren. Da kommt meine Freundin.« Sie stand auf. »Leben Sie wohl – wenn Sie können.«
Am nächsten Vormittag, sieben Minuten nach elf, fuhr Hélène de Couville in einem kleinen Sportwagen aus dem Parktor des Château Montenac – und an Thomas vorbei.
Er verneigte sich, sie sah zur Seite. Er setzte sich in seinen Wagen und fuhr ihr nach.
Bis Grenoble geschah nichts Berichtenswertes.
Knapp hinter Grenoble blieb Hélènes Wagen stehen. Sie stieg aus. Er hielt neben ihr.
»Etwas mit dem Motor«, sagte sie.
Er untersuchte den Motor, konnte aber keinen Defekt finden.
Hélène war bereits in ein nahe gelegenes Haus gegangen, um nach einem Mechaniker zu telefonieren. Der kam auch bald und erklärte, die Benzinpumpe wäre »völlig im Eimer«; der Wagen müsse abgeschleppt werden, die Reparatur dauere mindestens zwei Tage.
Thomas war davon überzeugt, daß der Mechaniker log, um eine teure Rechnung schreiben zu können, aber er war selig, auf einen Lügner gestoßen zu sein. Er lud Hélène ein, die Reise in seinem Wagen fortzusetzen.
»Sie sind sehr freundlich, Herr Ott«, antwortete sie nach langem Zögern.
Ihr Gepäck wurde umgeladen. Der Lügner bekam von Thomas heimlich ein aristokratisches Trinkgeld.
Die nächsten 100 Kilometer sprach Hélène ein einziges Wort. Als Thomas einmal nieste, sagte sie: »Wohlsein!«
Nach weiteren 100 Kilometern gab sie bekannt, daß sie in Monte Carlo mit ihrem Verlobten verabredet sei.
»Der Arme«, sagte Thomas. »Er wird wenig von Ihnen haben.«
In Monte Carlo brachte er Hélène wunschgemäß in das »Hôtel de Paris«. Hier lag eine Nachricht für sie. Ihr Verlobter war in Paris festgehalten, er konnte nicht kommen.
»Ich nehme sein Appartement«, erklärte Thomas.
»Sehr wohl, Monsieur«, sagte der Rezeptionschef und steckte die 5000-Franc-Note ein.
»Aber wenn mein Verlobter doch noch kommt …«
»Dann soll er sehen, wo er bleibt«, sagte Thomas, zog Hélène beiseite und flüsterte: »Das ist überhaupt kein Mann für Sie. Sehen Sie nicht, daß hier die Vorsehung am Werk ist?«
Da mußte die junge Dame plötzlich lachen.
Sie blieben zwei Tage in Monte Carlo, dann fuhren sie nach Cannes. Hier stiegen sie im »Hôtel Carlton« ab. Thomas machte sich ein paar schöne Tage. Er fuhr mit Hélène nach Nizza, St.Rafael, St.Maxim und St.Tropez. Er schwamm mit ihr im Meer. Er mietete ein Motorboot, fuhr Wasserski mit ihr. Er lag neben ihr am Strand.
Hélène lachte über dieselben Dinge wie er, dieselben Speisen schmeckten ihr, dieselben Bücher liebte sie, dieselben Bilder.
Als sie nach sieben herrlichen Tagen seine Geliebte wurde, stellte er fest, daß sie sich wirklich auf jedem Gebiet verstanden. Und dann geschah es: in der ersten Stunde des achten Tages …
Mit feuchtschimmernden Augen lag Hélène de Couville auf dem Bett ihres Schlafzimmers. Thomas saß neben ihr. Sie rauchten beide. Er streichelte ihr Haar. Verwehte Musik klang in den Raum. Nur eine kleine Lampe brannte.
Hélène seufzte und rekelte sich: »Ach, Will, ich bin so glücklich …« Sie nannte ihn Will. Wilfried erinnerte sie zu sehr an Richard Wagner, meinte sie.
»Auch ich, mein Herz, auch ich.«
»Wirklich?«
Da war er wieder, dieser seltsame, grübelnde Blick in ihren schrägen Augen, den Thomas sich nicht erklären konnte.
»Wirklich, chérie.«
Plötzlich warf sich Hélène herum, so daß er ihren wunderschönen, goldbraun getönten Rücken sah. Mit erschreckender Wildheit schluchzte sie in die Kissen: »Ich habe dich angelogen! Ich bin schlecht – ach, ich bin ja so schlecht!«
Er ließ sie eine Weile schluchzen, dann sagte er dezent: »Wenn es dein Verlobter ist …«
Sie warf sich wieder auf den Rücken und rief: »Quatsch, Verlobter! Ich habe doch überhaupt keinen Verlobten! Oh, Thomas, Thomas!«
Er fühlte, wie eine Hand aus Eis seinen Rücken entlangstrich. »Was hast du eben gesagt?«
»Ich habe überhaupt keinen Verlobten.«
»Nein, das meine ich nicht.« Er würgte ein bißchen. »Hast du eben Thomas gesagt?«
»Ja«, schluchzte sie, und jetzt kullerten dicke Tränen über ihre Wangen zum Hals hinab und auf die Brust. »Ja, natürlich habe ich Thomas gesagt. So heißt du doch, mein geliebter, armer Thomas Lieven … Ach, warum nur mußte ich dich treffen? In meinem ganzen Leben war ich nicht so verliebt …« Neuerliches Aufbäumen, neuer Tränenstrom. »Und gerade dir muß ich das antun, gerade dir!«
»Antun? Was antun?«
»Ich arbeite für den amerikanischen Geheimdienst«, jammerte Hélène verzweifelt.
Thomas merkte nicht, daß die Glut seiner Zigarette immer näher auf seine Fingerspitzen zukroch. Er schwieg lange.
Endlich seufzte er tief auf: »O Gott, fängt das denn schon wieder an?«
Tragisch stieß Hélène hervor: »Ich wollte es dir nicht sagen … Ich dürfte es dir nicht sagen … Die jagen mich davon – aber ich mußte dir die Wahrheit gestehen nach diesem Abend … Ich wäre sonst erstickt …«
»Mal langsam und von vorn«, sagte Thomas, der allmählich seine Fassung wiedergewann. »Du bist also eine amerikanische Agentin.«
»Ja.«
»Und dein Onkel?«
»Ist mein Vorgesetzter, Colonel Herrick.«
»Und das Château Montenac?«
»Gemietet. Unsere Leute in Deutschland meldeten, du würdest einen großen Coup planen. Dann kamst du nach Zürich. Als dein Inserat erschien, bekamen wir Vollmacht, dir eine Beteiligung bis zu hunderttausend Franken anzubieten …«
»Warum denn das?«
»Da war doch irgendein Trick bei deiner Annonce. Wir kannten ihn nicht. Aber wir hätten ihn herausbekommen. Und dann hätten wir dich in der Hand gehabt. Das FBI will dich doch unter allen Umständen anheuern. Sie sind ganz verrückt nach dir!«
Sie weinte jetzt wieder. Thomas trocknete ihr die Tränen.
»Dann hast du 750000 verlangt. Da haben wir ein Blitzgespräch mit Washington angemeldet! Was glaubst du, was die uns erzählt haben! 750000! Ein Irrsinn! haben die gesagt. Das wollten sie nicht riskieren! Und da setzten sie dann mich an …«
»Dich an«, wiederholte er idiotisch.
»… und so unternahm ich diese Reise. Es war alles nur Theater. Der Mechaniker in Grenoble …«
»O Gott, der auch. Und ich Trottel habe ihm noch ein Trinkgeld gegeben!«
»… der Verlobte, alles. Tommy. Und nun – und nun habe ich mich in dich verliebt, und ich weiß, wenn du nicht für uns arbeitest, dann lassen sie dich hochgehen!«
Thomas stand auf.
»Bleib bei mir!«
»Ich komme wieder, Liebling«, sagte er abwesend. »Ich muß mir nur einiges überlegen – in aller Ruhe, wenn du gestattest. Denn das alles, weißt du, ist mir schon einmal passiert …«
Er verließ die Schluchzende und ging durch den Salon in sein Schlafzimmer hinüber. Hier setzte er sich ans Fenster, sah lange in die Nacht hinaus.
Dann griff er nach dem Telefonhörer, wartete, bis sich die Zentrale meldete, und sagte: »Geben Sie mir den Küchenchef … Das ist egal, wecken Sie ihn …«
Nach fünf Minuten klingelte sein Telefon. Thomas nahm ab: »Gaston? Hier spricht Ott. Ich habe gerade einen argen Schicksalsschlag erlitten. Ich brauche etwas Leichtes, Anregendes. Machen Sie mir einen Tomatencocktail und ein paar Sardinencroquetten … Danke.«
Er legte den Hörer auf.
Es gibt also kein Entrinnen, dachte er. 1957 haben sie mich am Wickel, wie sie mich 1939 am Wickel hatten!
Durch die offene Balkontür sah Thomas Lieven hinaus auf die verlassene Corniche d’Or und empor zu den unnahbaren, unbeteiligten Sternen, die über dem Mittelmeer glänzten. Aus der samtigen Dunkelheit schienen sie plötzlich aufzutauchen, die Männer und Frauen seiner Vergangenheit, näher zu kommen, herabzusteigen: faszinierende Schönheiten, eiskalte Agentinnen, mächtige Konzernfürsten, gerissene Kaufleute, skrupellose Mörder, Bandenführer, Schlachtenlenker.
Da kam sein ganzes bisheriges Leben auf ihn zu, dieses wilde, abenteuerliche Leben, das sich nun vollends im Kreis gedreht hatte, seit jenem warmen Tag im Mai 1939, an dem alles begann …
ERSTES BUCH
1. Kapitel
1
Am 24. Mai 1939, zwei Minuten vor 10 Uhr vormittags, hielt ein schwarzes Bentley-Kabriolett vor dem Haus Lombard Street Nr. 122 im Herzen von London.
Ein eleganter junger Herr stieg aus. Seine sonnengebräunte Haut, die saloppe Art, sich zu bewegen, die lustigen Wirbel seines dunklen Haares standen in merkwürdigem Gegensatz zu seiner pedantischen Kleidung. Schwarz-grau gestreifte Hosen mit messerscharfen Bügelfalten trug der Herr, eine zweireihige, kurze schwarze Jacke, eine schwarze Weste mit goldener Uhrkette, ein weißes Hemd mit hohem, steifem Kragen, eine perlgraue Krawatte.
Bevor er die Autotür zuwarf, griff der junge Herr noch einmal in den Wagen. Einen schwarzen, steifen Hut holte er hervor, einen Regenschirm und zwei Zeitungen, die »Times« und die auf rosafarbenem Papier gedruckte »Financial Times«.
So passierte der dreißigjährige Thomas Lieven den Eingang des Gebäudes und eine Tafel aus schwarzem Marmor, die in Goldbuchstaben diese Inschrift trug:
MARLOCK & LIEVEN
Dominion Agency
Thomas Lieven war der jüngste Privatbankier Londons – aber ein erfolgreicher. Solcherlei Blitzkarriere verdankte er seiner Intelligenz, seiner Fähigkeit, seriös zu wirken, und seiner Begabung, nebeneinander zwei vollkommen verschiedene Leben zu führen. Von äußerster Korrektheit war Thomas Lieven an der Börse. Abseits dieser heiligen Hallen aber war er einer der charmantesten Ladykiller. Niemand, am wenigsten die jeweils direkt Betroffenen, ahnte auch nur, daß er in ausgeruhten Perioden spielend bis zu vier Freundinnen gleichzeitig bewältigte, denn er war ebenso rüstig wie verschwiegen.
Thomas Lieven konnte steifer sein als der steifste Gentleman der City – aber einmal die Woche schwang er heimlich im lautesten Club von Soho das Tanzbein, und zweimal die Woche nahm er heimlich Jiu-Jitsu-Unterricht.
Thomas Lieven liebte das Leben, und das Leben schien ihn zu lieben. Alles fiel ihm in den Schoß, wenn er nur geschickt verbarg, wie jung er noch war … Robert E. Marlock, sein Seniorpartner, stand im Schalterraum der Bank, als Thomas Lieven hereinkam und würdevoll die Melone lüpfte.
Marlock war fünfzehn Jahre älter, groß und hager. Auf eine nicht eben sympathische Weise wichen seine wasserhellen Augen jedem, der sie betrachten wollte, aus.
»Hallo«, sagte er und sah gewohnheitsmäßig an Thomas vorbei.
»Guten Morgen, Marlock«, sagte Thomas ernst. »Guten Morgen, meine Herren!«
Die sechs Angestellten hinter ihren Schreibtischen grüßten ernst wie er.
Marlock stand neben einer Metallsäule, die eine gläserne Käseglocke trug. Darunter tickte ein kleiner Messingtelegraf, der auf schmalen, schier endlosen Papierstreifen die neuesten Börsenkurse mitteilte.
Thomas trat neben seinen Partner und sah sich die Notierungen an. Marlocks Hände zitterten ein wenig. Mißtrauischerweise hätte man sagen können, daß es typische Falschspielerhände waren. Doch Mißtrauen wohnte vorerst nicht in Thomas Lievens heiterer Seele. Nervös fragte Marlock: »Wann fliegen Sie nach Brüssel?«
»Heute abend.«
»Höchste Zeit. Sehen Sie mal, wie die Werte rutschen! Folge von dem verfluchten Nazi-Stahlpakt! Schon Zeitungen gelesen, Lieven?«
»Gewiß«, sagte Thomas. Er sagte mit Vorliebe »gewiß«; es klang würdiger als »ja«.
Die Zeitungen hatten am Morgen dieses 24. Mai 1939 den Abschluß eines Bündnisvertrages zwischen Deutschland und Italien gemeldet. Selbiges Bündnis wurde »Stahlpakt« genannt.
Durch den dunklen, altmodischen Schalterraum schritt Thomas in sein dunkles, altmodisches Privatbüro. Der hagere Marlock folgte ihm und ließ sich in einen der Lederfauteuils sinken, die vor dem hohen Schreibtisch standen.
Zunächst besprachen die beiden Herren, welche Papiere Thomas auf dem Kontinent aufkaufen und welche er abstoßen sollte. »Marlock & Lieven« besaßen eine Zweigstelle in Brüssel. Thomas Lieven war zudem noch an einer Privatbank in Paris beteiligt. Nachdem die Herren das Geschäftliche erledigt hatten, brach Robert E. Marlock mit jahrelangen Gewohnheiten: Er sah seinem Juniorpartner offen in die Augen. »Hm, Lieven, ich habe da noch eine ganz private Bitte. Sie erinnern sich gewiß an Lucie …«
Thomas erinnerte sich gut an Lucie. Das schöne blonde Mädchen aus Köln hatte jahrelang als Marlocks Freundin in London gelebt. Dann mußte etwas Schwerwiegendes vorgefallen sein – niemand wußte genau zu sagen, was –, denn von einem Tag zum anderen war Lucie Brenner nach Deutschland zurückgekehrt.
»Scheußlich von mir, Sie damit zu belästigen, Lieven«, klagte Marlock jetzt, dem Jüngeren, mit Anstrengung zwar, aber doch immer noch direkt in die Augen blickend. »Ich dachte bloß, wenn Sie schon in Brüssel sind, könnten Sie vielleicht schnell den Sprung nach Köln hinüber machen und mit Lucie reden.«
»Nach Köln? Warum fahren Sie nicht selber? Sie sind doch ebenfalls Deutscher …«
Marlock sprach: »Ich würde sehr gern nach Deutschland fahren, aber die internationale Lage … Zudem, ich habe Lucie damals sehr verletzt, ich bin ganz ehrlich …« – Marlock sagte gern und oft, daß er ganz ehrlich sei – »… ganz ehrlich, ja. Da war eine andere Frau. Lucie hatte jedes Recht, mich zu verlassen. Sagen Sie ihr, ich bitte sie um Verzeihung. Ich will alles gutmachen. Sie soll zurückkommen …«
In seiner Stimme schwang nun jene Rührung, die in den Stimmen der Politiker schwingt, wenn sie von ihrer Sehnsucht nach Frieden sprechen.
2
Am Morgen des 26. Mai 1939 traf Thomas Lieven in Köln ein. Vom »Dom-Hotel« wehten große Hakenkreuzfahnen. Überall in der Stadt wehten Hakenkreuzfahnen. Der »Stahlpakt« wurde gefeiert. Thomas sah viele Uniformen. Auf den Teppichen der Hotelhalle knallten Stiefel aneinander wie Schüsse.
Im Zimmer stand ein Bild des »Führers« auf dem Schreibtisch. Thomas lehnte seinen Rückflugschein daran. Er nahm ein heißes Bad. Dann kleidete er sich um und rief Lucie Brenner an.
Als der Hörer am andern Ende der Leitung abgehoben wurde, ertönte ein verdächtiges Knacken, das Thomas Lieven jedoch entging. Dem Superagenten von 1940 war im Jahr 1939 die Existenz von Abhörgeräten noch völlig unbekannt.
»Brenner!«
Da war sie wieder, die verrauchte, aufregend heisere Stimme, an die er sich noch so gut erinnerte.
»Fräulein Brenner, hier spricht Lieven. Thomas Lieven. Ich bin gerade in Köln angekommen und …« Er unterbrach sich. Er hatte zwar nicht das neuerliche Knacken in der Leitung, wohl aber ihren unterdrückten Aufschrei wahrgenommen.
Charmant lächelnd fragte er. »War das ein Freudenschrei?«
»O Gott«, hörte er sie sagen.
Knack, machte es wieder.
»Fräulein Brenner, Marlock bat mich, Sie zu besuchen …«
»Der Schuft!«
»Aber nicht doch …«
»Der elende Schuft!«
»Fräulein Brenner, so hören Sie doch! Marlock will Sie durch mich um Verzeihung bitten. Darf ich zu Ihnen kommen?«
»Nein!«
»Aber ich habe ihm versprochen …«
»Verschwinden Sie, Herr Lieven! Mit dem nächsten Zug! Sie wissen ja nicht, was hier los ist!« Knack, machte es in der Leitung, ohne daß Thomas Lieven darauf achtete.
»Nein, nein, Fräulein Brenner, Sie sind es, die nicht weiß, was los ist …«
»Herr Lieven …«
»Bleiben Sie daheim, ich bin in zehn Minuten bei Ihnen!« Er legte auf und zog am Knoten seiner Krawatte. Sportlicher Ehrgeiz hatte ihn gepackt.
Ein Taxi brachte Thomas – selbstverständlich mit steifem Hut und peinlich gerolltem Regenschirm – hinaus nach Lindenthal. Hier wohnte Lucie Brenner im zweiten Stock einer Villa am Beethovenpark.
Er klingelte an der Wohnungstür. Von jenseits erklang dumpfes Geflüster. Mädchenstimme, Männerstimme. Thomas wunderte sich, aber nur ganz wenig. Denn Mißtrauen wohnte vorerst nicht in seiner heiteren Seele.
Die Tür ging auf. Lucie Brenner wurde sichtbar. Sie trug einen Morgenrock und anscheinend wenig darunter. Sie war außerordentlich erregt. Als sie Thomas erkannte, ächzte sie: »Wahnsinniger!«
Danach ging alles sehr schnell.
Zwei Männer wurden hinter Lucie sichtbar. Sie trugen Ledermäntel und sahen aus wie Schlächter. Der eine Schlächter stieß Lucie grob beiseite, der andere Schlächter packte Thomas am Revers.
Vergessen waren Selbstbeherrschung, Ruhe und Zurückhaltung! Mit beiden Händen packte Thomas die Schlächterfaust und drehte sich in einer tänzerisch anmutigen Bewegung. Plötzlich hing der Schlächter höchst verblüfft über Thomas Lievens rechter Hüfte. Eine kleine, ruckartige Verbeugung vollführte unser Freund. Ein Gelenk knackte. Der Schlächter schrie gellend auf, flog sausend durch die Luft und landete krachend auf dem Dielenboden. Hier blieb er schmerzverkrümmt liegen. Mein Jiu-Jitsu-Unterricht macht sich bezahlt, dachte Thomas.
»Und nun zu Ihnen«, sprach er, auf den zweiten Schlächter zutretend.
Die blonde Lucie begann zu kreischen. Der zweite Schlächter wich zurück und stotterte: »N-nicht d-doch, Herr. Machen Sie nicht solche Sachen …« Er holte einen Revolver aus seinem Schulterhalfter hervor. »Ich warne Sie. Seien Sie vernünftig.«
Thomas blieb stehen. Nur ein Idiot kämpft unbewaffnet gegen einen Schlächter mit Revolver.
»Im Namen des Gesetzes«, sagte der ängstliche Schlächter. »Sie sind verhaftet!«
»Verhaftet, von wem?«
»Von der Geheimen Staatspolizei.«
»Junge, Junge«, sagte Thomas Lieven, »wenn ich das im Club erzähle!«
Thomas Lieven liebte seinen Londoner Club, und sein Club liebte ihn. Whiskygläser in der Hand, Pfeifen im Mund, vor dem flackernden Kaminfeuer sitzend, so hörten die Clubmitglieder jeden Donnerstagabend die tollen Geschichten an, die reihum erzählt wurden. Wenn ich diesmal zurückkomme, dachte Thomas, bringe ich eine Geschichte mit, die ist auch nicht schlecht.
Nein, die Geschichte war nicht schlecht, und sie sollte immer besser werden. Allerdings – wann sollte Thomas sie in seinem Club erzählen dürfen, wann seinen Club auch nur wiedersehen? Er war durchaus noch frohen Mutes, als er an diesem Maitag 1939 in einem Büro des »Sonderdezernat D« im Gestapo-Hauptquartier zu Köln saß. Das Ganze ist ja nur ein Mißverständnis, dachte er; in einer halben Stunde bin ich hier raus …
Haffner hieß der Kommissar, der Thomas in Empfang nahm: ein dicker Mann mit schlauen Schweinsaugen. Ein sauberer Mann! Ohne Unterlaß reinigte er seine Fingernägel mit immer neuen Zahnstochern. »Ich höre, Sie haben einen Kameraden zusammengeschlagen«, sagte Haffner böse. »Das wird Ihnen noch verflucht leid tun, Lieven!«
»Immer noch Herr Lieven für Sie! Was wollen Sie von mir? Warum wurde ich verhaftet?«
»Devisenverbrechen«, sagte Haffner. »Habe lange genug auf Sie gewartet.«
»Auf mich?«
»Oder auf Ihren Partner Marlock. Seit diese Lucie Brenner aus London zurückkam, ließ ich sie überwachen. Dachte mir: Einmal taucht einer von euch frechen Hunden wieder auf. Na, und dann hopps!« Haffner schob einen Aktenordner über die Schreibtischplatte. »Am besten, ich zeige Ihnen, was gegen Sie an Material vorliegt. Dann werden Sie die vorlaute Schnauze halten.«
Nun bin ich aber wirklich neugierig, dachte Thomas. Er begann in dem umfangreichen Ordner zu blättern. Nach einer Weile mußte er lachen.
»Was finden Sie komisch?« fragte Haffner.
»Na, hören Sie mal, das ist doch ein tolles Ding!«
Aus den Dokumenten ging hervor, daß die Londoner Privatbank »Marlock & Lieven« dem Dritten Reich vor ein paar Jahren einen argen Streich gespielt hatte, und zwar unter Ausnutzung des Umstandes, daß an der Zürcher Börse deutsche Pfandbriefe auf Grund der politischen Situation seit langem nur noch zu einem Fünftel ihres Nominalwertes gehandelt wurden.
»Marlock & Lieven« – oder wer auch immer unter diesem Firmennamen operierte – hatte im Januar, Februar und März 1936 solche Pfandbriefe in Zürich mit illegal transferierten Reichsmarkbeträgen erworben. Danach war ein Schweizer Staatsbürger als Strohmann beauftragt worden, einige der in Deutschland wertlosen, in der übrigen Welt um so wertvolleren Gemälde der sogenannten »entarteten Kunst« zu kaufen. Die Nazi-Behörden erlaubten die Ausfuhr der Gemälde sehr gern. Erstens wurden sie die »unerwünschte« Kunst los, und zweitens erhielten sie die für ihre Aufrüstung so notwendigen Devisen. Der Schweizer Strohmann mußte nämlich dreißig Prozent der Kaufsumme in Schweizer Franken bezahlen.
Die restlichen siebzig Prozent allerdings – das bemerkten die Nazis erst viel später – bezahlte der Strohmann mit den deutschen Pfandbriefen, die auf diese Weise die Heimat wiedersahen, in der sie ihren normalen Wert besaßen, also den fünffachen dessen, zu dem »Marlock & Lieven« sie in Zürich erworben hatten.
Während Thomas Lieven die Dokumente studierte, dachte er: Ich habe dieses tolle Ding nicht gedreht. Also kann es nur Marlock gewesen sein. Er muß gewußt haben, daß die Deutschen ihn suchen, daß Lucie Brenner überwacht wird, daß man mich verhaften, daß man mir kein Wort glauben wird. Daß er mich damit los ist. Daß er die Bank damit für sich allein hat. O Gott. O lieber Gott im Himmel …
»So«, sagte Kommissar Haffner zufrieden, »jetzt steht die alte Schlabberschnauze endlich still, was?« Er nahm einen neuen Stocher und beschäftigte sich ein bißchen mit seinen Zähnen.
Verflucht, was mache ich bloß, überlegte Thomas. Ein Gedanke kam ihm. Kein sehr guter. Aber es kam kein besserer. »Darf ich mal telefonieren?«
Haffner kniff die Schweinsaugen schmal: »Wen wollen Sie denn sprechen?« Jetzt nichts wie ran, dachte Thomas, es bleibt nur noch die Flucht nach vorn.
»Den Baron von Wiedel.«
»Nie gehört.«
Thomas brüllte plötzlich los: »Seine Exzellenz Bodo Baron von Wiedel, Gesandter zur besonderen Verwendung im Auswärtigen Amt! Noch nie gehört von dem Herrn, was?«
»Ich – ich …«
»Nehmen Sie gefälligst den Zahnstocher aus dem Mund, wenn Sie mit mir reden!«
»Was – was wollen Sie denn von dem Herrn Baron?« stotterte Haffner. Seine Durchschnittskost waren verschüchterte Bürger. Mit Häftlingen, die brüllten und Bonzen kannten, fand er sich noch nicht zurecht.
Thomas tobte weiter: »Der Baron ist mein bester Freund!«
Thomas war dem viel älteren Wiedel 1929 in einer nichtschlagenden Studentenverbindung begegnet. Wiedel hatte Thomas in aristokratische Zirkel eingeführt. Thomas hatte die Wechsel gedeckt, die der Baron zuweilen platzen ließ. So waren sie einander menschlich nähergekommen bis zu dem Tag, an dem Wiedel in die Partei eintrat. Da hatte sich Thomas nach einem gewaltigen Krach von ihm gelöst.
Ob Wiedel ein gutes Gedächtnis hat? überlegte unser Freund nun, während er weiterschrie: »Wenn Sie mir nicht augenblicklich eine Verbindung herstellen, können Sie sich morgen einen anderen Posten suchen!«
Das Telefonfräulein hatte es auszubaden. Kommissar Haffner riß plötzlich den Hörer ans Ohr und brüllte seinerseits: »AA Berlin! Aber ein bißchen dalli, Sie Trampel!«
Phantastisch, absolut phantastisch, dachte Thomas, als er gleich darauf die Stimme seines ehemaligen Bundesbruders vernahm: »Hier von Wiedel …«
»Bodo, hier spricht Lieven! Thomas Lieven, vielleicht erinnerst du dich noch an mich.«
Brüllendes Gelächter klang an sein Ohr: »Thomas! Mensch! Das ist ja eine Überraschung! Damals hast du mir eine weltanschauliche Standpauke gehalten, und heute bist du selber bei der Gestapo!« Vor der Größe dieses Mißverständnisses mußte Thomas die Augen schließen. Die Stimme des Barons lärmte lustig weiter: »Komisch, Ribbentrop oder Schacht sagte mir neulich erst, du hättest eine Bank in England!«
»Habe ich auch. Bodo, hör mal …«
»Ah, Außendienst, verstehe! Tarnung, wie? Ich lache mir ja ’nen Ast! Haste also eingesehen, wie recht ich hatte, damals?«
»Bodo –«
»Wie weit haste es denn schon gebracht? Muß ich Kommissar sagen?«
»Bodo …«
»Kriminalrat?«
»Himmel, hör doch mal zu! Ich arbeite nicht bei der Gestapo! Ich bin von ihr verhaftet worden!«
Danach blieb es eine Weile still in Berlin.
Haffner schmatzte zufrieden, klemmte den zweiten Hörer mit der Schulter ans Ohr und setzte die Säuberung seines linken Daumennagels fort.
»Bodo! Hast du mich nicht verstanden?«
»Doch, doch, leider. Was – was wirft man dir denn vor?«
Thomas sagte, was man ihm vorwarf.
»Tja, mein Alter, das ist aber bös. Ich kann mich da unmöglich einmischen. Wir leben in einem Rechtsstaat. Wenn du wirklich unschuldig bist, wird sich das herausstellen. Alles Gute. Heil Hitler!«
»Ihr bester Freund, was?« grunzte Haffner.
3
Sie nahmen ihm Hosenträger, Krawatte, Schuhsenkel, die Brieftasche und seine geliebte Repetieruhr fort und sperrten ihn in eine Einzelzelle. Hier verbrachte Thomas den Rest des Tages und die Nacht. Fieberhaft arbeiteten seine Gedanken. Es mußte einen Ausweg geben, mußte, mußte. Aber er fand ihn nicht …
Am Morgen des 27. Mai holten sie Thomas Lieven wieder zum Verhör. Als er in Haffners Zimmer kam, sah er, daß neben dem Kommissar ein Major der Wehrmacht stand, ein blasser, sorgenvoller Mensch.
Haffner wirkte verärgert. Er schien eine Auseinandersetzung hinter sich zu haben.
»Das ist der Mann, Herr Major. Befehlsgemäß lasse ich Sie mit ihm allein«, sagte der Gestapo-Mann und verschwand.
Der Offizier schüttelte Thomas die Hand: »Major Loos vom Wehrbezirkskommando Köln. Baron von Wiedel hat mich angerufen. Ich soll mich um Sie kümmern.«
»Kümmern?«
»Na, Sie sind doch völlig unschuldig. Ihr Partner hat Sie reingelegt, das ist mir klar.«
Aufatmend sagte Thomas: »Ich freue mich, daß Sie zu dieser Ansicht gekommen sind, Herr Major. Kann ich also gehen?«
»Wieso gehen? Sie kommen ins Zuchthaus!«
Thomas setzte sich. »Aber ich bin doch unschuldig!«
»Machen Sie das der Gestapo klar, Herr Lieven. Nein, nein, Ihr Partner hat sich schon alles richtig überlegt.«
»Hm«, sagte Thomas. Er sah den Major an. Er dachte: Da kommt doch noch etwas …
Es kam prompt: »Sehen Sie, Herr Lieven, einen Ausweg gibt es natürlich noch für Sie. Sie sind deutscher Staatsbürger. Sie kennen die Welt. Sie sind ein kultivierter Mensch. Sprechen fließend Englisch und Französisch. So etwas wird gesucht in diesen Tagen.«
»Gesucht von wem?«
»Von uns. Von mir. Ich bin Abwehroffizier, Herr Lieven. Ich kann Sie hier nur heraushauen, wenn Sie sich bereit erklären, für die militärische Abwehr zu arbeiten. Im übrigen – wir zahlen gut …«
Major Fritz Loos war der erste Angehörige eines Geheimdienstes, den Thomas Lieven traf. Unzählige andere sollten folgen – Engländer, Franzosen, Polen, Spanier, Amerikaner und Russen.
Achtzehn Jahre nach dieser ersten Begegnung, am 18. Mai 1957, dachte Thomas Lieven in der nächtlichen Stille eines Luxusappartements zu Cannes: Im Grunde waren sich alle diese Leute unendlich ähnlich. Alle wirkten sie traurig, verbittert, enttäuscht. Alle waren sie wohl aus ihrer Bahn geworfen worden. Alle wirkten sie krank. Sie waren alle eher schüchtern und umgaben sich deshalb unablässig mit den lächerlichen Attributen ihrer Macht, ihres Geheimnisses, ihres Schreckens. Sie spielten alle ununterbrochen Theater, sie litten alle an einem tiefen Minderwertigkeitskomplex …
Das alles wußte Thomas Lieven in einer schönen Mainacht des Jahres 1957. Am 27. Mai 1939 wußte er es noch nicht. Da war er einfach entzückt, als der Major Loos ihm den Vorschlag machte, für die Deutsche Abwehr zu arbeiten. Auf diese Weise komme ich erst einmal aus dem Dreck heraus, dachte er und wußte nicht, wie tief er schon mittendrin steckte …
4
Als die Lufthansa-Maschine die niedere Wolkendecke durchbrach, die über London lagerte, gab der Passagier auf Platz Nr. 17 ein seltsames Geräusch von sich.
Die Stewardeß eilte zu ihm. »Geht es Ihnen nicht gut, mein Herr?« fragte sie teilnahmsvoll, dann sah sie, daß Nr. 17 lachte.
»Mir geht es ausgezeichnet«, sagte Thomas Lieven. »Verzeihen Sie, ich mußte nur eben an etwas Komisches denken.«
Er hatte an das enttäuschte Gesicht des Asservatenverwalters im Gestapo-Hauptquartier Köln denken müssen, als dieser ihm seine Sachen zurückgab. Von der goldenen Repetieruhr hatte sich der Mann kaum trennen können.
Thomas nahm das geliebte Stück hervor und strich zärtlich über den zierlichen Deckel. Dabei entdeckte er noch etwas Druckerschwärze unter dem Nagel seines Zeigefingers. Er mußte wieder lachen bei dem Gedanken, daß es seine Fingerabdrücke nun in einer geheimen Kartei gab und sein Foto auf einem Personalbogen. Ein Herr namens John Smythe (mit y und th) würde übermorgen in sein Haus kommen, um den Gasofen im Badezimmer nachzusehen. Diesem Herrn Smythe war unbedingter Gehorsam zu leisten, hatte Major Loos eindringlich hinzugefügt.
Herr Smythe mit y und th wird sich wundern, dachte Thomas. Wenn er wirklich auftauchen sollte, dann werde ich ihn hinausfeuern!
Die Maschine verlor an Höhe. Mit Südwestkurs steuerte sie über die Themse auf den Flughafen Croydon zu.
Thomas verwahrte seine Uhr und rieb kurz die Hände. Er reckte sich wohlig. Aah – wieder in England! In Freiheit! In Sicherheit! Jetzt in den Bentley gesprungen! Ein heißes Bad! Dann einen Whisky! Eine Pfeife! Die Freunde im Club! Das große Erzählen …
Tja, und dann natürlich Marlock.
So groß war Thomas Lievens Glück über diese Heimkehr, daß schon sein halber Zorn verflog. Mußte er sich wirklich von Marlock trennen? Vielleicht gab es eine Erklärung, die man annehmen konnte. Vielleicht hatte Marlock Sorgen. Man mußte ihn auf jeden Fall erst einmal anhören …
Sieben Minuten nach diesen Gedankengängen schritt unser Freund beschwingt über eine herangerollte Treppe aus der Maschine auf den regennassen Platz vor dem vierstöckigen Flughafengebäude herab. Unter seinem Regenschirm marschierte er pfeifend auf die Einwanderungshalle zu. Hier gab es zwischen Seilabsperrungen zwei Korridore. Über dem rechten stand: »British Subjects«, über dem linken: »Foreigners«.
Immer noch pfeifend wandte Thomas sich nach links und trat an das hohe Stehpult des »Immigration Officer« heran.
Der Beamte, ein älterer Mensch mit nikotinverfärbtem Walroßschnurrbart, nahm den deutschen Reisepaß entgegen, den ihm Thomas mit einem freundlichen Lächeln reichte. Er blätterte darin, dann sah er auf. »Ich bedaure, Sie dürfen britischen Boden nicht mehr betreten.«
»Was soll das heißen?«
»Sie wurden heute ausgewiesen, Mr. Lieven. Bitte, folgen Sie mir, es warten zwei Herren auf Sie.« Und er ging schon voran …