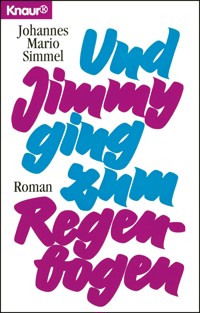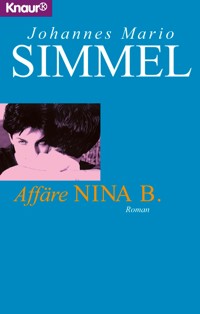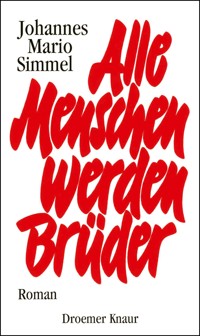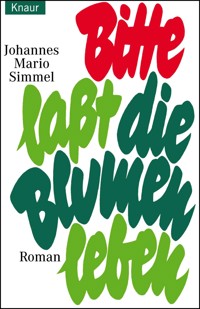6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Doch mit den Clowns kamen die Tränen berichtet über die folgenschweren Experimente von Gen-Forschern mit einem unheimlichen Virus und über die unbarmherzige Jagd nach einer "sanften" Waffe, die im Besitz einer Großmacht der Schlüssel zur Weltherrschaft wäre. Gleichzeitig erzählt es vom kühnen Kampf zweier Liebender - einer deutschen Reporterin und eines polnischen Biochemikers - gegen den skrupellosen Missbrauch der Wissenschaft im Interesse der Mächtigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 800
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Johannes Mario Simmel
Doch mit den Clowns kamen die Tränen
Roman
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Für
L. S., K. K.-E. und A. M.,
wo immer sie jetzt sind,
in Liebe, Verehrung und Dankbarkeit
Wahnsinn bei Individuen ist selten,
aber in Gruppen, Nationen und Epochen ist er die Regel.
Friedrich Nietzsche,
Jenseits von Gut und Böse
Die einzige Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, ist die, es nicht zu spielen.
Aus dem amerikanischen Film Wargames
Nur ein Teil der Personen, der Handlung und der Institutionen in diesem Buch ist frei erfunden, so beispielsweise die französischen Sender PREMIÈRE CHAÎNE und TELE 2, die deutsche Nachrichtenzentrale WELT IM BILD, die gleichnamige Sendung und die »Spezialeinheiten«.
Sehr viele Personen, Ereignisse und Institutionen entsprechen hingegen der Wirklichkeit. Insbesondere drei Menschen, die – äußerlich völlig verändert – zu den Hauptfiguren gehören, haben mein Leben mehr als alle anderen gelenkt und beeinflußt und werden das weiter tun, bis ich sterbe. Die Existenz eines der drei Menschen ermöglichte zwischen einem Mann und einer Frau, beide mit »amputierten« Leben, jene Liebe, von der hier berichtet wird.
Die ungeheuerlichen Experimente, über die ich informiere, wurden von international bekannten Forschern bereits erfolgreich durchgeführt – bis auf jenes grausige letzte. Alle katastrophalen oder grotesken Ergebnisse in diesem Zusammenhang sind Tatsachen.
Mündliche und schriftliche Äußerungen zahlreicher Personen der Zeitgeschichte, Ansichten, Entschlüsse und Pläne gleichermaßen mächtiger wie skrupelloser Männer, die über unser aller Schicksal bestimmen, sowie Szenen aus Fernsehsendungen, Abschnitte aus wissenschaftlichen oder politischen Werken beziehungsweise Aufsätzen, Reden, Artikeln und Zeitungsmeldungen habe ich exakt wiedergegeben und nur manchmal wegen rechtlicher Vorschriften oder dramaturgischer Notwendigkeiten Namen, Orte und Zeiten verändern müssen.
Ähnlichkeiten mit realen Personen und realen Geschehnissen sind also weder zufällig noch unbeabsichtigt, sondern nicht zu vermeiden.
J. M. S.
Prolog
Und nun kommen die Clowns.
Schon während sie in die Manege stolpern, erheben die Kinder ihre Stimmen zu einem einzigen schrillen Schrei des Entzückens. Der Clown in dem gelb-schwarz gewürfelten Kostüm ist sehr groß und sehr dick. Der Clown in dem rot-weiß gewürfelten Kostüm ist sehr klein und sehr dünn, ihre Gesichter sind zu grotesken Masken geschminkt, ihre Schuhe unförmig, die Pluderhosen schlottern an den Beinen. Beide tragen kleine Hütchen.
Ach, Leute, Leute, ist das eine Zirkusvorstellung!
Selig sitzen Jungen und Mädchen mit ihren Vätern und Müttern in dem Riesenzelt. Sie haben gejubelt, als die schwarzen Ponys tanzten, sie haben sich gegruselt, als die Löwen brüllten, und sie waren furchtbar aufgeregt, als die wunderschönen Damen in ihren silbernen Trikots hoch oben an Trapezen durch die Luft sausten.
Und nun die Clowns!
»Komm, wir spielen Wilhelm Tell!« ruft der in dem gelb-schwarzen Kostüm.
»Wir spielen wen?« ruft der in dem rot-weißen. Ihre Stimmen sind sehr laut, und jeder von ihnen wendet sich stets zu »seiner« Hälfte des Zirkusrunds, damit alle alles verstehen.
»Wilhelm Tell! Den, der mit Pfeil und Bogen einen Apfel vom Kopf seines Bübchens geschossen hat! Auf hundert Schritt Entfernung!«
»Au ja! Au ja! Au, prima!« ruft der Kleine. »Auf hundert Schritt Entfernung hat Wilhelm Tell seinem Bübchen mit Pfeil und Bogen einen Apfel vom Kopf geschossen. Ich bin das Bübchen, ja? Bitte, bitte, bitte!«
»Du bist das Bübchen!«
»Wie heißt das Bübchen?«
»Walterli heißt das Bübchen!«
»Das Bübchen heißt Walterli! Das kleine Walterli!« Der dünne Clown hält eine Hand an den Mund und vertraut seine Meinung dem Publikum an: »Der Alte trifft nie!«
Die Kinder lachen.
Ganz vorne, in der ersten Reihe hinter dem Manegenrand, sitzt eine Frau neben einem Jungen. Die Frau trägt einen mattgelben Hosenanzug, der Junge einen Blazer, eine Flanellhose, ein weißes Hemd und eine College-Krawatte. Er ist etwa sieben Jahre alt. Strahlend sieht er die Mutter an.
»Wo ist der Apfel?« fragt der dünne Clown.
»Hier!« Der dicke Clown zieht einen besonders großen, besonders schönen Apfel aus der Hosentasche und nimmt dem dünnen Clown das Hütchen fort. Dann legt er den Apfel auf den Kopf des Kleinen. Sofort rollt der Apfel herunter. Der Dicke hebt ihn auf, legt ihn wieder auf den Kopf des Dünnen und schlägt mit der Faust auf den Apfel. Der Apfel fällt herunter. Der dünne Clown fällt neben ihn.
Der dicke Clown zieht den Dünnen am Hosenboden hoch und stellt ihn vor sich hin. Legt den Apfel auf seine Stirn. Der Apfel fällt herunter. Die Kinder schreien. Die Erwachsenen lachen.
Die junge Frau sieht ihren applaudierenden Sohn voll Liebe an. Sie streicht über sein schwarzes Haar. Auch ihr Haar ist schwarz, sie trägt es als Windstoßfrisur, ganz kurz geschnitten. In dem schmalen Gesicht dominieren große schwarze Augen. Beständig hellwach sind sie, und stets liegt Traurigkeit auf ihrem Grund, auch wenn die junge Frau lacht. Im Weiß des rechten Auges gibt es einen seltsamen Pigmentfleck, ähnlich einem Rußkorn und ebenso schwarz. So klein er ist, verleiht er dem Gesicht besonderen Reiz. Die Haut der Frau erinnert an jene eines Menschen, welcher den größten Teil seines Lebens im Freien verbringt.
»Mein Pierre«, sagt die Mutter. Der Junge hört es nicht, zu sehr lachen alle über den dünnen Clown, der mittlerweile gerufen hat: »Mit einem Apfel geht das nie, Papachen! Wir brauchen etwas anderes!« Er zieht eine Banane aus der Tasche und schmückt mit ihr seinen Kopf.
Jubel der Kinder.
»Laß den Quatsch, Walterli!« ruft der dicke Clown. »Ich werde dir zeigen, wie der Apfel liegen bleibt. Wirf die Banane fort!«
Der dünne Clown wirft die Banane fort.
Der dicke Clown beißt ein großes Stück des Apfels ab und setzt ihn dem dünnen Clown auf den Kopf. Nun bleibt der Apfel liegen. »Siehst du, so einfach ist das, mein Walterli! Jetzt hol ich Pfeil und Bogen.«
»Wo hast du denn Pfeil und Bogen, Papachen?«
»Da drüben in dem Koffer.«
Der dicke Clown ist mit einem mächtigen schwarzen Koffer gekommen, der in der Mitte der Manege steht. Auf ihn geht er nun zu. Sobald er dem Kleinen den Rücken zugewandt hat, nimmt dieser den Apfel vom Kopf und beißt auch ein Stück ab. Er kaut, er schluckt, er reibt sich den Bauch. Mißtrauisch dreht der dicke Clown sich um. Aber der dünne Clown ist schneller gewesen. Der Apfel liegt schon wieder auf seinem weißgeschminkten haarlosen Schädel.
Ach, lachen die Kinder!
Der Mann, der all dies träumt, liegt in einem breiten Bett. Über sein Gesicht zuckt ein Lächeln. Tief und entspannt atmet der Mann, der all dies träumt.
Die Frau mit der Windstoßfrisur und den schwarzen Augen hört einen Mann laut loslachen. Sie dreht sich um. Zwei Reihen hinter ihr sitzt dieser Mann. Er hat ein zerfurchtes Gesicht und eisgraues Haar, obwohl er kaum über fünfundvierzig Jahre alt ist. Der Grauhaarige erkennt die junge Frau und neigt grüßend den Kopf. Auch sie grüßt. Neben dem Mann sitzen seine Frau, zierlich und zart, und zwei kleine Mädchen, Töchter, das weiß die Frau mit dem schwarzen Haar.
Nun kreischen die Kinder, sie ächzen, sie verschlucken sich. Jedesmal, wenn der große Clown zwei Schritte auf den schwarzen Koffer zu macht, beißt der dünne Clown ein neues Stück vom Apfel ab. Und jedesmal, wenn der mißtrauische Dicke sich umdreht, hat der Dünne den Apfel, der immer kleiner wird, bereits auf den Kopf zurückgelegt. Der Dicke kniet vor dem Koffer. Er versucht vergebens, ihn zu öffnen. Währenddessen gelingt es dem Dünnen, den Apfel ganz aufzuessen. Wieder jauchzen die Kinder.
Der dicke Clown ruft: »Walterli!«
»Papachen?«
»Komm her, und hilf mir!«
Der Dünne lüpft seine Hosen, so daß violette Socken und grüne Sockenhalter sichtbar werden, und stolpert zu dem Dicken, der ihn argwöhnisch mustert.
»Wo ist der Apfel?«
Der Dünne zeigt auf seinen Bauch.
Der Dicke ruft: »Na schön! Wie du willst! Dann machen wir es ohne Apfel!«
»Au, fein! Au, fein! Ohne Apfel! Ohne Apfel!«
»Hilf mir!«
Nun rütteln beide an den Schlössern des schwarzen Koffers. Plötzlich fliegt der Deckel auf. Plötzlich stehen die beiden Clowns nebeneinander. Jeder hält eine Maschinenpistole. Sofort schießen sie in jenen Sektor des Zuschauerraums, in dem die junge Frau mit ihrem Sohn und der grauhaarige Mann mit seiner Familie sitzen.
Panik bricht aus. Kinder weinen, Männer brüllen, Frauen schreien. Die Maschinenpistolen feuern ohne Unterlaß. Hier wird ein Kind getroffen, da eine Frau, dort noch ein Kind. Blutend brechen sie zusammen. Der grauhaarige Mann fliegt von der Bank, eine Kugel hat seine Stirn durchschlagen, Blut schießt hervor, Blut, so viel Blut. Seine Frau und die beiden kleinen Mädchen stürzen, blutüberströmt auch sie. Die Clowns feuern noch auf die Gestürzten.
Jetzt toben die Zuschauer. Sie versuchen, ihre Plätze zu verlassen. Die Treppen zwischen den Sektoren sind zu schmal. Männer prügeln sich den Weg frei, schlagen auf Frauen ein, auf Kinder. Viele straucheln. Andere trampeln über sie hinweg. Und Blut, Blut, Blut strömt von den Bänken auf die Stufen hinab in die Manege.
Ein uniformierter Zirkusangestellter rennt mit einer Pistole in der Hand vor. Der dünne Clown sieht ihn kommen. Drei Schüsse, und der Uniformierte bricht zusammen, bleibt auf dem Gesicht liegen. Rot färbt sich der Boden um ihn.
Die junge Frau in dem mattgelben Hosenanzug hat ihren Sohn sofort, als das Morden begann, unter die Bank gestoßen und ist zu ihm gekrochen. Sie handelt mit der Erfahrung und Schnelligkeit eines Soldaten. Auf dem Boden liegend sieht die junge Frau, wie die beiden Clowns, immer noch feuernd, rückwärtsgehend den Manegeneingang erreichen. Wer hier steht, weicht beiseite, wirft sich hin. Die beiden Clowns rennen aus dem Zirkus.
Natürlich wartet ein Fluchtwagen draußen, denkt die junge Frau.
Alle Gänge sind nun verstopft. Hier brüllen Verwundete. Dort schlagen Menschen einander, brutal, sinnlos, außer sich vor Angst. Da liegen Schwerverletzte, Tote. Aus den Lautsprechern dröhnt immer wieder eine Männerstimme. Niemand versteht, was sie sagt.
Unruhig wirft der Schlafende sich hin und her. Schweiß steht in kleinen Tropfen auf seiner Stirn. Er atmet keuchend, wirr ist das eisgraue Haar. In seinem Traum erblickt er ganz deutlich den Mann, der tot in einer Blutlache liegt. Der Träumende sieht sich selbst. – tot! Er sieht seine Frau, seine kleinen Töchter – tot, tot, tot! Die Kinder hängen über einer Bankreihe. Laut stöhnt der Träumende …
Die junge Frau springt auf. Sie zerrt ihren Sohn mit sich. Er taumelt hinter ihr her. Sehr viele Zuschauer sind nun in der Manege. Grauenhaft klingen die Schreie der Verwundeten. Die junge Frau bahnt sich energisch ihren Weg, immer den Sohn an der Hand. Der junge stolpert, knickt ein, wird weitergeschleift. Die junge Frau schlägt um sich. Menschen schlagen zurück.
»He, Sie! Verrückt geworden?«
»Verflucht, na warte mal, du Sau!«
Die junge Frau erreicht den Vorraum mit den Kassen. Daneben stehen drei Telefonzellen. Sie reißt die Tür der ersten auf, zieht ihren Sohn nach, sinkt keuchend gegen eine Glaswand, wählt eine Nummer.
»HAMBURGER ALLGEMEINE«, erklingt eine Mädchenstimme.
»Hier ist Norma Desmond. Den Chefredakteur! Es ist dringend!«
»Einen Moment, Frau Desmond.«
Klick, macht es in der Leitung.
Eine andere Frauenstimme: »Chefredaktion.«
»Norma Desmond. Doktor Hanske, bitte! Schnell!«
»Sofort!«
Klick.
Eine Männerstimme: »Norma?«
Die junge Frau spricht betont deutlich: »Günter! Ich bin im ›Zirkus Mondo‹ auf dem Heiligengeistfeld. Hier gab es einen Terroranschlag. Zwei Clowns schossen mit Maschinenpistolen in den Zuschauerraum.«
»Was?«
»In einen bestimmten Abschnitt, in dem auch ich mit Pierre saß.«
Draußen klingt das Gejaule von Sirenen auf: zwei, drei, vier, nicht mehr zu zählen. Durch den Vorraum rast mit zuckendem Blaulicht ein Polizeiwagen in die Manege, ein zweiter folgt. Menschen springen zur Seite. Norma sieht, daß vor dem Zirkus Ambulanzen halten.
»Polizei trifft ein … Rettungswagen … Ärzte, Sanitäter …«
Sie rennen an Norma vorbei in weißen Mänteln und grauen Uniformen. Immer weiter heulen Sirenen.
»Wie viele Tote? Wie viele Verletzte?« ertönt die Stimme des Chefredakteurs aus dem Hörer.
»Ich kann es nicht sagen. Vielleicht fünfzig! Vielleicht sechzig! Hör zu, Günter: Nach allem, was ich sah, hatten die Clowns einen ganz bestimmten Auftrag. Sie sollten einen ganz bestimmten Mann erschießen. Ihn und seine Familie. Auf ihn eröffneten sie das Feuer. Der Mann ist tot, die Frau, die Kinder.«
»Hast du eine Ahnung, wer der Mann …«
»Ich weiß es!«
»Wer ist es?«
»Professor Martin Gellhorn.«
»Professor Gellhorn?«
Die Kabinentür wird aufgerissen. Norma fährt herum.
Ein großer Mann steht vor ihr. Sein Gesicht ist wachsbleich. Er trägt eine Brille mit ungefaßten Gläsern. Sein Anzug ist zerdrückt. Der Mann keucht.
»Was wollen Sie?« schreit Norma.
Der leichenblasse Mann weicht zurück. »Pardon … Ich habe nicht gesehen, daß jemand …«
Die Tür fällt zu. Der Mann ist verschwunden.
»Norma! Norma!« klingt es aus dem Hörer.
»Ja doch!«
»Was war das?«
»Keine Ahnung. Ein Mann …«
»Hast du Professor Gellhorn gesagt?«
»Ja!«
»Vom Virchow-Krankenhaus?«
»Ja!«
»Der ist doch Wissenschaftler!«
»Mikrobiologe!«
»Mikrobiologe! Wieso erschießen die einen Mikrobiologen?«
»Weiß ich nicht!«
»Bist du ganz sicher, daß es Gellhorn ist?«
»Verflucht, ich habe genug Bilder von ihm gesehen! Absolut sicher bin ich!«
»Aber warum wurde er erschossen?«
»Herrgott, ich weiß es nicht! Schick sofort Fotografen her! Und Reporter! Joe! Franziska! Herbert! Jimmy! Ich bleibe hier! Und Platz, wir brauchen Platz! Was ist der Aufmacher?«
»EG-Konferenz in Brüssel wieder ohne Einigung. Schmeißen wir natürlich raus! Du hast die ganze erste Seite. Und die dritte. Und mehr.«
»Okay, ich melde mich wieder.« Die junge Frau hängt ein. Im nächsten Moment sieht sie, daß ihr kleiner Sohn zusammengesunken ist. Um ihn hat sich eine Blutlache gebildet. Sie steht in der Lache. Nun kniet sie nieder.
»Pierre! Pierre!«
Pierre gibt keine Antwort. Pierre ist tot. Die junge Frau sieht einen Blutfleck auf der linken Brustseite seines Blazers. Das muß das Einschußloch sein. Sie öffnet die Jacke. Blut quillt ihr entgegen, über die Hände, den Anzug, die Schuhe. Norma stöhnt, ringt nach Luft. Er muß gleich zu Beginn getroffen worden sein, denkt sie. Noch bevor ich ihn unter die Bank riß. Ich habe es nicht bemerkt. Ich habe ihn bis hierher geschleppt.
Neue Sirenen heulen auf. Es kommen noch immer Ambulanzen und Polizeiwagen.
Wir sind in Hamburg. Es ist 17 Uhr 54, am Montag, dem 25. August 1986.
Erstes Buch
1
Das war der schlimmste Augenblick von allen: als sie nach dem Begräbnis ihre Wohnung betrat. Ich ertrage es nicht, dachte sie. Wann immer ich nun nach Hause komme, er wird nie mehr dasein. Nie mehr wird er auf mich warten. Nie mehr wird hier sein Lachen zu hören sein. Nie mehr, dachte sie, nirgendwo. Er hat viel gelacht. Wie sein Vater. Der war auch in dieser Wohnung. Und ist auch tot. Und nie mehr und nie mehr werden ihre Stimmen ertönen, und nie mehr und nie mehr und nie mehr werde ich sie wiedersehen. Nirgendwo. Aber diese Wohnung! Diese Wohnung ist das für mich, was für ein Tier seine Höhle ist, in die es zurückkriechen kann, müde oder verwundet oder sehr traurig und hungrig und fast am Ende. Oder zufrieden und vergnügt, weil es gut gejagt hat oder gut geschwommen oder um die Wette gerannt ist mit anderen Tieren. Seit so vielen Jahren schicken sie mich in der Welt herum, dachte sie, und immer wieder kam ich hierher zurück, und immer wieder bin ich glücklich gewesen, so glücklich, wenn ich Pierres Stimme gehört habe oder die seines Vaters. Genauso glücklich war ich auch, wenn ich spät nachts heimkam. Ja, heimkam. Dies hier ist meine Heimat, ich habe keine andere. Und wenn dann einer von den beiden schon schlief, habe ich mich neben sein Bett gekauert und seinem Atem gelauscht, dem Atem des Vaters, dem Atem des Sohnes. Ich habe den Vater verloren, und ich habe den Sohn verloren, ich werde den Vater nie mehr sehen und hören, und nie mehr wird der Junge da sein, wenn ich in diese Wohnung komme, die nun eben auch nie mehr das sein wird, was für ein Tier seine Höhle ist, denn nun ist hier alles noch so sehr vertraut und doch schon so fremd. Man nimmt mir alles. Nie mehr wird irgend etwas sein, wie es früher war. Nie mehr. Das furchtbarste Wort der Welt. Furchtbarer als Hitler.
Sie ging von einem Zimmer in das nächste, und sie fühlte sich leer und ausgebrannt, und sie dachte, wie gut es wäre, wenn sie auch tot sein könnte. Und in ihren dunklen Augen standen Trauer, Zorn und zugleich fast unterwürfige Demut, Bedrängnis und Einsamkeit – die des Todes, die des Lebens.
Ich habe einmal mit Pierres Vater darüber gesprochen, wie wir uns den Tod wünschten, dachte sie. In Beirut war das, im Oktober 1978, ich erinnere mich noch genau daran. Da hatten sie uns nach Beirut geschickt, ihn die AGENCE FRANCE PRESSE. Fast drei Jahre kannten wir einander da schon. Kennengelernt hatten wir uns im Januar 1976, als es die vielen Toten an der Grünen Linie, der Demarkationslinie zwischen Ost- und West-Beirut, gab. Die Christen lebten im Osten, die Moslems im Westen. Und im Januar 1976 verlangten die Moslems an der Grünen Linie Kennkarten, und sehr viele Christen, die sie erwischten, erschossen sie sofort oder verschleppten sie. Ich war damals in West-Beirut, aber ich wollte unbedingt nach Ost-Beirut, und an der Grünen Linie nahmen sie mich fest, und gerade als ich weggeführt werden sollte, um in der nächsten Ruine erschossen zu werden, tauchte Pierre Grimaud auf und brüllte, daß ich Ausländerin sei und Reporterin, und ich weiß noch, wie er immer wieder auf mein T-Shirt zeigte und auch auf seines. Es war grausig heiß in Beirut und grausig schwül, und darum liefen wir alle, wir Reporter, in diesen T-Shirts und in Shorts herum, und auf den T-Shirts stand in arabischer und englischer Sprache: NICHT SCHIESSEN! PRESSE! Und Pierre und zwei Moslems schrien einander an, während andere Moslems in der nächsten Ruine weiterhin Menschen erschossen. So viele Tote gab es damals im Januar 1976 da an der Grünen Linie, das Ganze war von Anfang an mörderisch. Dann schlug Gott sei Dank hundert Meter entfernt eine Rakete ein, und alles schmiß sich zu Boden, und während Trümmer auf uns herabregneten, packte mich dieser Pierre Grimaud – damals wußte ich noch nicht einmal, wie er hieß –, und wir rannten los, geduckt und im Zickzack, und sie schossen hinter uns her. Aber eine zweite Rakete schlug ein zwischen ihnen und uns, und es gab so viel Staub und Rauch, daß wir entkommen konnten, und von diesem Tag an waren wir fast immer zusammen, und wir arbeiteten zusammen, und er half mir, und ich half ihm. 1976 war er neununddreißig, neun Jahre älter als ich, und sie hatten ihn und mich zuvor bereits in viele Kriege geschickt, und jeder war immer wieder davongekommen, weil wir inzwischen ein wenig gelernt hatten zu überleben. Wir wußten eine Menge Tricks, und manche waren sehr gut. Und doch redeten wir vom Tod in dieser Nacht, im Oktober 1978. Natürlich waren wir zwischendurch immer mal wieder getrennt gewesen, weil sie den einen dahin jagten und den anderen dorthin, aber dann trafen wir einander stets wieder in Beirut, wo es immer schlimmer und schlimmer wurde. Im HOTEL COMMODORE waren wir in jener Nacht, im HOTEL COMMODORE in West-Beirut. Wir hatten auch noch ein Zimmer im HOTEL ALEXANDRE in Ost-Beirut. Viele Reporter hatten zwei Zimmer, eins in Ost und eins in West. Es kam darauf an, wo man arbeiten mußte, und manchmal konnte man einfach nicht von der einen Seite auf die andere. Beide Hotels, das COMMODORE und das ALEXANDRE, wurden immer wieder von Bomben getroffen, aber sie wurden immer wieder halbwegs in Ordnung gebracht. Und in dieser Nacht hielten wir einander umklammert, und unsere Körper bewegten sich gemeinsam wie ein Körper, und es war so, wie es immer war, wenn wir es taten, es war so, wie Pierre und ich niemals zuvor gedacht hatten, daß es sein konnte, und nun war es schon fast drei Jahre lang so, und es gab kein Gestern und kein Morgen, es gab nur das Jetzt. Bitte das Jetzt, nur das Jetzt, ja, bitte, laß es immer das Jetzt sein, und laß es noch lange dauern, laß es nicht vorübergehen, wir haben nur einander, jetzt, ja, jetzt, nur jetzt, alles kann vorbei sein nach dem Jetzt, dies ist nicht die Zeit zu leben, dies ist die Zeit zu sterben, nur im Jetzt nicht, nur im Jetzt nicht, oder ja, wenn es sein muß, bitte jetzt, jetzt, jetzt! Dann lagen wir nebeneinander, und mein Kopf ruhte auf seiner Brust, und ich hörte sein Herz schlagen und das Rattern von vielen Maschinengewehren draußen in der Nacht und die dröhnenden Motoren eines Bombers und schwere Explosionen, und Menschen schrien, und wir hörten die Einschläge von Raketen, sie kamen immer näher und wurden immer lauter.
»Noch ein bißchen näher«, sagte ich, »und sie erwischen wieder einmal das gute alte COMMODORE. Und diesmal sind wir drin und können jetzt nicht mehr raus. Hoffentlich erwischt es uns nicht!«
»Ganz bestimmt nicht«, sagte Pierre, und eine Rakete schlug draußen auf der Straße ein, und das Hotel schwankte, und ich sagte: »Wäre schön, wenn sie uns leben ließen. Aber wenn es sein soll, dann erwischt es uns jetzt wenigstens zusammen. Das ist es, was ich mir immer wünsche. Wenn es sein muß, sollen sie es bitte so machen, daß wir zusammen sterben, so, daß nicht einer am Leben bleiben muß.«
Und die nächste Rakete schlug schon weiter entfernt ein, und Pierre küßte mein Haar, und ich küßte seine Stirn, und er sagte: »Na also, gutgegangen. Ich hab’s gewußt. Weil ich vor dir sterben werde, mon chou.«
»Nein, wirst du nicht«, sagte ich.
»Werde ich doch. Ich will zuerst sterben. Unter allen Umständen. Ich bete darum.«
Und draußen tobten die Maschinengewehre.
»Du betest darum, daß du vor mir stirbst?« fragte ich.
»Jeden Abend«, sagte er. »Immer. Gerade jetzt habe ich es auch getan.«
Und ich preßte mich noch fester an ihn und küßte ihn auf den Mund, und draußen schlug, nun schon weit entfernt, noch eine Rakete ein, und ich sagte: »Das kommt nicht in Frage. Ich will zuerst sterben.«
»Nein, mon chou, Gott wird das schon machen. Ich glaube an ihn. Du nicht.«
»Das ist nicht fair«, sagte ich, und ein Panzer fuhr am COMMODORE vorbei, und ich hörte seine Ketten mahlen und begann zu weinen und dachte: Er glaubt an einen lenkenden Gott, keinen persönlichen. Über einen persönlichen Gott könnte ich mit ihm diskutieren und ihn vielleicht umstimmen. Aber wenn er an einen universellen Gott glaubt, habe ich keine Chance, und das ist auch so eine Gemeinheit.
»Ich will nicht unfair sein, mon chou«, sagte Pierre und legte seine Arme um mich. »Ich will nur vor dir sterben, weil ich mir nicht vorstellen kann, übrigzubleiben. Das ist natürlich ganz infam selbstsüchtig!«
»Bitte, bitte, rede nicht so!«
»Ich habe nur so geredet«, sagte er, »weil es doch jeden Tag passieren kann. Dir auch.«
»Es ist gutgegangen, so lange Zeit.«
»Ja, schon zu lange«, sagte er.
»Wir haben den falschen Beruf«, sagte ich.
»Der hat damit nichts zu tun«, sagte er. »Es stirbt immer einer, wenn zwei sich lieben. Egal, was sie machen, wo sie sind. Überall ist der Tod für solche, die sich lieben. Daran muß ich dauernd denken, mon chou.«
»Ich auch«, sagte ich. »Darum will ich immer, daß es jetzt bleibt, es soll kein Morgen geben und kein Später. Das ist idiotisch, ich weiß.«
»Gar nicht idiotisch«, sagte er. »Es wird immer das Jetzt bleiben für uns. Es wird nie eine Vergangenheit geben für uns oder für einen von uns. Weil wir uns lieben. Wenn zwei sich lieben, gibt es keine Vergangenheit, mon petit chou« – wir sprachen Französisch miteinander, er konnte schlecht Deutsch. »Alle Vergangenheit bleibt immer das Jetzt und die Gegenwart, in alle Zukunft hinein.«
»Aber wenn nun einer stirbt«, sagte ich, und ich fühlte sein Herz pochen und auch das meine. Weit weg, im Christenteil der Stadt, schlugen nacheinander drei Raketen ein. »Wenn einer dann tot ist, Pierre?«
»Kein Toter ist tot, solange es einen Menschen gibt, der an ihn denkt, der ihn liebt«, sagte er. »Dann ist der Tote immer da für diesen Menschen. Er wird ihn fühlen, er wird ihn spüren.« Und wieder feuerten Maschinengewehre. »Das Beste von einem, der stirbt, bleibt zurück bei dem Menschen, der ihn liebt. Er ist dann in ihm, der Tote in dem Lebenden. Und so bleiben sie zusammen für alle Zeit.«
»Oh«, sagte ich, »aber warum willst du dann früher sterben als ich? Ich weiß, warum ich früher sterben will: weil ich nicht an das glaube, was du eben gesagt hast. Ich liebe dich sehr dafür, daß du so gesprochen hast, chéri. Aber es ist nicht wahr, und du glaubst auch nicht daran. Gib es zu!«
»Okay«, sagte er. »Ich glaube auch nicht daran. Aber, o Gott, ich würde so gern daran glauben!«
Und es war grausig schwül und heiß, draußen hämmerten die Maschinengewehre, und der Bomber kam wieder und feuerte seine Raketen ab, und das Hotel bebte. Es war so, wie es jede Nacht war in Beirut.
2
Sie schreckte auf aus ihren Gedanken.
Sie saß auf ihrem Bett, jetzt bemerkte sie es erst. Neben dem Bett stand ein kleiner Tisch, und darauf sah sie die zwei Farbfotografien in Silberrahmen. Die eine Zeigte Pierre Grimaud, die andere seinen kleinen Sohn, den sie nach dem Vater benannt hatte. Pierre Grimaud saß auf einem Benzinkanister vor einer Munitionskiste. Auf der Kiste stand eine Reiseschreibmaschine. Grimaud tippte mit zwei Fingern. Er trug nur graugrüne Shorts und eine graugrüne Schildkappe, wie sie Fernfahrer oder Soldaten benützen. Sein Gesicht war so mager wie sein sehniger Oberkörper, und beides war sonnengebräunt. Er hatte in die Kamera geschaut, als Norma ihn fotografierte. Seine Augen waren grau, und da er lachte, bildeten sich viele kleine Fältchen in ihren Winkeln. Er hatte einen großen Mund und große, unregelmäßige Zähne, und er trug eine dünne Goldkette. An ihr hing über seiner Brust ein Glücksbringer: zwei goldgefaßte Brillengläser mit einem vierblättrigen Kleeblatt dazwischen.
Norma griff in den Ausschnitt ihres schwarzen Kleides. Sie zog das Kettchen und den Glücksbringer hervor. Nun trug sie ihn seit langer Zeit. Ich habe ihm das Kettchen geschenkt, dachte sie. Damals, als wir in Beirut waren. Hat ihm kein Glück gebracht.
Sie sah seine Fotografie an und danach die ihres Sohnes. Der Junge saß auf einem Fahrrad. Er trug Bluejeans und ein freihängendes buntes Hemd. Auch er lachte. Wie klein sein Sarg gewesen ist, dachte sie. Jemand im Gerichtsmedizinischen Institut hat ihn ausgewählt. Ein anderer hat alle Formalitäten erledigt und das Grab ausgesucht. Und eine Frau da in der Morgue hat mir gesagt, sie habe Pierre ein besonders schönes Leichenhemd angezogen und einen kleinen Blumenstrauß zwischen die Finger gesteckt. Wie freundlich man doch mit einem Menschen umgeht, wenn er tot ist! Habe ich den Trägern und dem Totengräber auch genug Trinkgeld gegeben? Ich war mit ihnen allein. Und ich bin gleich weggegangen, nachdem sie den kleinen Sarg in die Erde hinabgelassen hatten.
»Kein Toter ist tot, solange …«
Ach, er hat doch gesagt, daß er nicht daran glaubt! Auf einmal ertrug sie den Anblick der Fotografien nicht mehr. Sie öffnete eine Lade des Tisches und legte die Rahmen hinein. Sie hielt es nicht mehr aus in diesem Zimmer und ging in den Wohnraum mit den vielen Büchern und der großen Sitzecke. Eine Couch war so lang wie das ganze Zimmer breit, und die Wand darüber war völlig bedeckt mit unterschiedlichen Bildern, die sie und Pierre Grimaud im Laufe der Jahre zusammengetragen hatten. Die Rahmen berührten einander fast. Da gab es einen Zille, die beiden beinamputierten Soldaten in ihren zerschlissenen Uniformen auf der Bank; drei Originallithographien von Chagall, »Die Liebenden unter dem Lilienstrauß«, »Die Liebenden über Paris« und den »Juden in Grün«, dann den »Geschändeten Minotaurus« von Dürrenmatt, er hockte an einer Mauer des Labyrinths, und auf der Mauer stand ein winziger Mensch und pißte ihn an; naive Malerei von Milinkov – ein hochsommerliches Feld mit hohen Ähren und Bäumen voller Früchte und vielen Paaren, Männern und Frauen, die es miteinander trieben; eine Zeichnung von Horst Janssen, sehr groß, die einen Totenkopf auf einem Tisch zeigte, und Janssen, der in Hamburg lebte, hatte Norma erklärt, dies sei der Tod, und der Tod fraß seine Füße auf, und dazu hatte Janssen sein Gesicht auf das Blatt gezeichnet, das tat er häufig; und neben dem »Tod« hing das Bild eines Kindes in Rot und Weiß, es schlug eine Trommel, und dieser Trommler in Öl stammte von Franz Krüger, dem berühmtesten Porträt- und Militärmaler des biedermeierlichen Berlin, Experten nannten ihn den »Pferde-Krüger«, weil er so viele Pferde gemalt hatte. Es gab noch andere Bilder an der Wand, aber diesen kleinen Trommler liebte Norma am meisten.
Sie ging zu einem alten Klapptisch, auf dem Flaschen und Gläser standen sowie ein Thermosbehälter, und sie goß Whisky in ein großes Glas und warf Eiswürfel hinein. Sie trank einen Schluck, dann öffnete sie die französischen Fenster, die auf eine Terrasse hinausführten, und trat ins Freie. Es war 19 Uhr vorüber, und die Sonne neigte sich im Westen. Die Wohnung lag im obersten Stock eines Appartementhauses am Anfang der Parkstraße im Stadtteil Othmarschen, ganz nahe der Elbchaussee. Norma sah die Elbe, deren Wasser im Licht der untergehenden Sonne blendete. Sie sah auf der anderen Seite des Stroms den Steendiekkanal und den Köhlfleethafen und das Lotsenhaus an der Einfahrt zum Köhlfleethafen, und sie sah das HDW-Werk Finkenwerder und die Bahnanlagen und viele Waggons, alles im Sonnenglast, und sie wußte, hinter den Gleisen lag der Ort, von dem sie kam: der kleine Friedhof bei der alten Kirche. Sie war vom Grab bis zur nächsten Anlegestelle der Motorfähre gegangen und über den Strom zur Anlegestelle Teufelsbrück gekommen, um am Jenischpark vorbei nach Hause zu gehen.
Nun setzte sie sich in einen Liegestuhl und trank das Glas leer und nie mehr, und sie stand wieder auf und ging ins Badezimmer und nie mehr und duschte lange und nie mehr und zog einen Bademantel an und nie mehr und machte einen neuen Drink und ging in das Arbeitszimmer und setzte sich an ihren Schreibtisch und dachte daran, eine Freundin anzurufen, und wählte die halbe Nummer und nie mehr und konnte nicht weiterwählen und ließ den Hörer in die Gabel fallen und nie mehr und hielt es am Schreibtisch nicht aus und nie mehr, und sie trank wieder und nie mehr, und sie trank wieder und trank wieder und setzte sich dann in das Zimmer ihres Sohnes und nie mehr, und sie legte sich auf das Bett und nie mehr, und das Kissen roch noch nach dem Haar ihres Sohnes, und das ertrug sie nicht, und sie lief aus dem Zimmer auf die Terrasse und zurück zu den Bildern der Liebenden und des Trommlers und des Todes und nie mehr und nie mehr und nie mehr.
3
Sie war jetzt 40 Jahre alt und seit 19 Jahren Reporterin. Seit 19 Jahren wurde sie in die Welt geschickt. Zu jedem Krieg – und Kriege gab es unentwegt –, zu jeder Revolution, zu jeder Katastrophe, jedem Aufstand. Zu jedem Sensationsprozeß. Zu jedem stinkenden Fall von Korruption, Waffen- und Drogenhandel oder Wirtschaftsverbrechen. Zu jeder brutalen Besetzung eines kleinen Landes durch ein großes. Es gab auch kaum einen bekannten Politiker, Wissenschaftler, Philosophen, Schriftsteller, Schauspieler, Maler, Regisseur, Komponisten oder Bildhauer, den sie in diesen 19 Jahren nicht interviewt hatte. Ihre Berichte wurden in viele Sprachen übersetzt und in den größten Zeitungen nachgedruckt. Weltweit war sie als eine der besten Journalistinnen ihrer Zeit anerkannt. Obwohl sie Angebote der wichtigsten und berühmtesten Zeitungen und Magazine bekommen hatte und immer weiter bekam, blieb sie der HAMBURGER ALLGEMEINEN treu, die durch ihre Arbeit ein Weltblatt geworden war. Norma Desmond war die HAMBURGER ALLGEMEINE. Sie hatte Preise und Auszeichnungen erhalten. Ihre großen Reportagen und Interviews waren in verschiedenen Sammelbänden erschienen. Der Sohn hatte ein Internat in der Nähe von Hamburg besucht. Wann immer sie konnte, holte sie ihn zu sich in die Wohnung an der Parkstraße, so nahe der Elbe. Natürlich war sie nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl sowohl bei den internationalen Pressekonferenzen in Moskau wie anschließend am Rande des Sperrgebietes um das havarierte Atomkraftwerk gewesen. Nach Hamburg zurückgekommen, hatte sie ihren Jungen während der Sommerferien zu sich geholt. Sie hatten Ausflüge gemacht und waren dann im Zirkus gewesen, am Nachmittag des 24. August …
Und nie mehr. Und nie mehr. Und nie mehr.
Sie ging nun unentwegt in der Wohnung hin und her und auf die Terrasse hinaus. Das Wasser des Stroms glänzte noch immer, und es war noch immer sehr heiß.
Tot. Tot. Tot.
Die Füße schmerzten. Sie ließ sich in einen Lehnstuhl fallen, der vor einer der Bücherwände im Wohnzimmer stand. Mit dunkelgrünem Stoff war er überzogen. Pierre Grimaud hat am liebsten hier gesessen, nachdem sie ihn nach Paris gerufen hatten und mich nach Hamburg, dachte sie. Er ist stets zu mir gekommen. Ich habe ihn am Flughafen abgeholt. Rote Rosen brachte er immer mit. Immer rote Rosen. Immer 31 Stück. Er hat dann abends hier gesessen und ich da drüben auf der großen Couch unter den Bildern, und oft haben wir bis zum Morgengrauen geredet oder Musik gehört, Chopin, die Klavierwerke Schuberts, Gershwin und Rachmaninow. Wenn wir schliefen, hielten wir einander an der Hand. Und niemals war dann einer ohne den andern, nicht eine Minute. Die Sonntagszeitungen holten wir gemeinsam. Und dann flogen wir los, er dahin, ich dorthin, und wir trafen einander stets wieder in Beirut, dem verfluchten Beirut. Das letzte Mal kamen wir im August 1978 dorthin, und wir lebten im HOTEL COMMODORE in West- Beirut, und Anfang Oktober – warum kann ich mich nur nicht an das Datum erinnern? – redeten wir dann vom Tod, vom Tod. Und am 18. Oktober, ein paar Tage später – an dieses Datum kann ich mich erinnern, dieses Datum werde ich niemals vergessen –, waren wir in Ost-Beirut, in unserem anderen Hotel, dem ALEXANDRE, denn amerikanische Kollegen hatten uns erzählt, daß in Ost-Beirut eine große Operation stattfinden solle, und wir fürchteten, nicht mehr über die Grüne Linie zu kommen, wenn die Operation erst einmal angefangen hatte. Wir waren schon am 17. da, und das ALEXANDRE war wieder halbwegs intakt nach dem letzten Bombentreffer. Am 18. umzingelten dann Einheiten der syrischen Armee das Christenviertel und nahmen es unter konzentrierten Raketenbeschuß. Das war das Schlimmste, was ich in meinem Leben durchgemacht habe, es war das absolute Grauen, es war so, daß es keine Wörter dafür gibt, was da geschah. Pierre und ich und ein paar andere Korrespondenten und viele Leute aus der Nachbarschaft des ALEXANDRE rannten in den Keller des Hotels, als die ersten Raketen einschlugen. Der Boden unter uns schwankte nun dauernd, das ganze Hotel schwankte, und die Christen beteten oder fluchten, und der Raketenbeschuß hörte nicht auf, er dauerte eine Stunde, zwei Stunden, sie schleppten Tote und Sterbende in den Hotelkeller, und die Verwundeten schrien, und es gab keinen Arzt und keine Medikamente und kein Wasser und kein Licht, und dann hörten wir Jean-Louis brüllen. Er brüllte so furchtbar, wie ich noch nie einen Menschen brüllen gehört habe, und Pierre und ich stellten eine Kiste unter eine Kellerluke, um auf die Straße hinaussehen zu können oder auf das, was von der Straße übriggeblieben war, und da lag Jean-Louis Cassis, ein Fotoreporter von AGENCE FRANCE PRESSE, neben ein paar Trümmern auf dem Rücken. Sein T-Shirt und seine Shorts hatte der Luftdruck weggerissen, nackt lag er da und preßte die Hände gegen den Bauch, und der Bauch sah aus, als wäre er geplatzt, Darmschlingen quollen heraus, und Jean-Louis versuchte, die Darmschlingen in den Leib zurückzudrücken, und das gelang ihm nicht, und er brüllte und brüllte und brüllte.
Er war Pierres Freund und, ganz klar, er hatte sich ins ALEXANDRE retten wollen, aber er hatte es nicht mehr geschafft. Und da lag er und brüllte und brüllte und brüllte, und er schrie auch dazwischen, er schrie immer das gleiche Wort: »Pierre!«
Und Pierre rannte zum Kelleraufgang, und ich rannte ihm nach und wollte ihn festhalten und rief: »Bleib hier! Du kannst ihm nicht mehr helfen! Er wird gleich tot sein. Pierre, Pierre, bleib hier, ich flehe dich an!« Aber er stieß mich fort und lief auf die Straße hinaus, und ich rannte zu der Luke zurück, und ich sah, wie er sich über seinen Freund neigte, es war so sinnlos, so idiotisch, er konnte doch nichts tun, aber natürlich, Jean-Louis war sein Freund, und dann kam die nächste Rakete, und sie schlug dort ein, wo Pierre und Jean-Louis waren, und als sich der Staub verzogen hatte, gab es da, wo Pierre und Jean-Louis gewesen waren, nur noch einen gewaltigen Trichter. Das war es, dachte sie, und als sie mich dann heim nach Hamburg riefen, brachte ich am 9. Juni 1979 einen Jungen zur Welt und nannte ihn wie seinen Vater.
Sie hielt es nicht mehr aus in dem dunkelgrünen Lehnstuhl und begann wieder in der Wohnung hin und her zu wandern und zündete eine Zigarette an und drückte sie aus und hörte das Tuten eines großen Frachters, der die Elbe hinunter zum Meer fuhr, und dachte: 17 Reporter sind ums Leben gekommen bis heute, und von einem knappen Dutzend, die entführt wurden, hat man nie mehr etwas gehört, und Jerry Levin von NBC haben sie zehn Monate an einen Heizkörper gefesselt.
Es kann schon sein, dachte sie, daß das Größte, was auf dieser Welt entstanden ist, die Religionen gewesen sind – die Religionen pur. Ja, aber sie kamen sofort in die Hände von Ideologen. Und die sind gewiß das Furchtbarste, was es gibt auf dieser Welt. Ideologen machen das Schönste und Beste zum Schlimmsten. Alles, was sie wollen, ist Macht, Macht über Menschen. Macht und den Gewinn daraus natürlich. Ideologen des Christentums haben arme Schweine gelehrt, den Propheten Mohammed und alle, die an ihn glauben, zu hassen, zu verabscheuen, zu morden. Ideologen des Islam haben andere arme Schweine gelehrt, den christlichen Gott und alle, die an ihn glauben, zu hassen, zu verabscheuen, zu morden. Ideologen haben Christen und Moslems die Folter, die Zerstörung, alles, was leiden macht, und das Töten gelehrt. Im Namen Gottes. Andere Ideologen haben andere einst große Ideen zu verbrecherischen Unternehmen gemacht. Politiker und die Rüstungsindustrien danken es ihnen. Ideologen haben Abermillionen Menschen auf dem Gewissen. Aber, dachte sie, es ist Pierre jedenfalls gelungen, früher zu sterben als ich. Er hat ja auch jeden Abend gebetet darum. Man kann sich also, scheint es, verlassen auf so einen Ideologengott. Nein, dachte sie. Kann man nicht. Mein kleiner Sohn hat gewiß nicht gebetet darum. Und er mußte auch sterben. Was haben die Ideologen aus Gott, ganz gleich welchem, aus jeder großen Idee, ganz gleich welcher, gemacht, wenn diese Götter und diese Ideen, an die man Menschen zu glauben erzieht oder zwingt, wenn diese Ideen und diese Götter nun all das erlauben, das Grauen und das bestialische Töten, nicht nur in Beirut, auf der ganzen Welt, den Haß und den Tod, die Qual und das Elend, die Epidemien und den Hunger und das Verrecken der Kinder, und daß Jerry Levin zehn Monate lang an einen Heizkörper gefesselt war? Oh, zum Teufel mit dem, was Menschen heute als Idee – egal welche –, als Gott – egal welchen – noch vorgesetzt wird! Zum Teufel mit Ideen und Gott, wenn ich an den Teufel glauben könnte. Der Mensch hat wenig Glück, dachte sie, und wenn du auch noch liebst, bist du ganz gewiß verdammt und verloren und bald allein, warte es ab, es dauert nicht lange, nur eine kleine Weile, eine so kleine Weile. Dann ist alles vorüber. Nein, dachte sie, nichts ist vorüber. Für die Toten, ja. Nicht für die, die weiterleben müssen. Die Toten haben es gut. Vielleicht auch nicht. Vielleicht haben sie es gar nicht gut, vielleicht haben sie es noch ärger. So klein war der Sarg, so klein. Und nie mehr und nie mehr und nie mehr, dachte sie.
Und als sie das dachte, schrillte die Wohnungsklingel.
4
Ein großer Junge stand draußen.
Er trug schwarze Hosen und eine kurze dunkelblaue Jacke mit silbernen Knöpfen, die am Hals hochgeschlossen war, und auf der linken Brustseite waren golden die Worte HOTEL ATLANTIC eingestickt. Der Junge hatte sein dunkelblaues Käppi abgenommen und grüßte höflich. Er hatte sehr helles Haar und sehr helle Augen.
»Frau Desmond?«
»Ja.«
»Ich soll diesen Brief überbringen, gnädige Frau.« Er gab ihr ein Kuvert.
»Brief? Von wem?« Sie sah die Handschrift auf dem Umschlag. »Oh«, sagte sie plötzlich atemlos, »warte einen Moment!« Aus ihrer Handtasche nahm sie einen Zehnmarkschein und reichte ihn dem Boy. »Hier.«
»Ich danke sehr, gnädige Frau.«
»Wie kommst du zurück ins ATLANTIC?« fragte sie.
»Mit dem Taxi, es wartet.« Er verneigte sich wieder. »Guten Tag, gnädige Frau.«
Sie schloß die Tür und ging ins Wohnzimmer, setzte sich in den dunkelgrünen Lehnstuhl und riß das Kuvert auf. Zwei Blätter Hotelbriefpapier fielen heraus. Sie las die Worte in schräger Handschrift:
Meine liebe, gute Norma,
alle Worte sind eitel in dieser Stunde, das weiß ich wohl. Aber ich stelle mir vor, Du säßest jetzt bei mir zu Hause in Frankfurt in Deiner unbeschreiblichen Trauer. Dann würde ich Chateaubriands »René« aus dem Regal nehmen und Dir den Satz zeigen: »Eine große Seele muß dem Schmerz mehr Raum geben als eine kleine …«
Du hast sie, diese Seele, diese wirklich große, schon ohne den gegenwärtigen, letztlich bereits lebensbedrohenden Schmerz immer gehabt, auch vor dem ersten furchtbaren Verlust, und es wäre besser um diese Welt bestellt, wenn es mehr Menschen wie Dich gäbe.
Nimm das bitte nicht als plumpen Trostversuch. Es gibt keinen Trost, auch die vielbeschworene Zeit heilt nicht die Wunden, sie verdeckt sie nur. Existieren läßt sich allein mit der ständig neu zu erkämpfenden Einsicht, daß wir für den Rest der Zeit, die uns gegeben ist, mit einem amputierten Leben zurechtkommen müssen. Für einen Menschen wie Dich, liebste Norma, gäbe es dann noch einen weiteren Satz, den ich vor einigen Tagen in Pierre Jean Jouves Roman »Die leere Welt« gefunden habe: »Kein großes Leben ohne eine große Verstümmelung.«
Sei nicht bitter, und sage nicht: Was soll mir das helfen? Es gibt, wie gesagt, keinen Trost, aber Hilfe gibt es durch Freunde. Selbst wenn man im Moment durch deren Worte eher noch verzweifelter wird – irgendwann sind die Worte, die Gesten, die Arme, die Hände und Schultern dann doch da in der Erinnerung, fast ein wenig wie eine Kinderwiege, in die man sich fallenlassen möchte. Die Bewegung der Wiege pendelt immer wieder aus, aber zu wissen, Freunde stoßen sie immer wieder an, mit einem Satz, mit einem Lächeln, das kann schon über manche Stunden in sich bodenloser, verzweifelter Tage hinwegtragen.
Liebste Norma, rufe mich im ATLANTIC an, wenn Du willst und kannst. Ich bin immer für Dich da.
Es umarmt Dich Dein alter, allzeit getreuer
Alvin
5
Hotel ATLANTIC, guten Tag!«
»Guten Tag. Bitte Herrn Minister Westen.«
»Einen Moment.«
Dann hörte Norma die ruhige, tiefe Stimme: »Westen.«
»Oh, Alvin! Ich danke dir für den Brief! Ich danke dir so sehr! Ich habe gedacht, du bist in Tokio …«
»Ich war auch in Tokio. Bin vor zwei Stunden angekommen. Über den Pol und Anchorage. Ich habe aus Tokio zweimal angerufen, als ich es erfuhr. Niemand hat sich gemeldet.«
»Ich war sehr viel unterwegs. Es gab so viele Formalitäten zu erledigen. Sieben Tage hat die Polizei die Leichen nicht freigegeben. Erst gestern. Heute nachmittag habe ich meinen Jungen begraben.«
»Arme Norma.«
»Es war sehr schlimm, Alvin. Aber nun kam dein Brief. Und du bist da.«
»Soll ich zu dir kommen«
»Bitte, Alvin, komm!« Ihr fiel etwas ein. »Was willst du essen? Ich weiß nicht, was ich im Hause habe, aber ich kann ganz schnell etwas kochen.«
»Ich habe im Flugzeug gegessen.«
»Und ich kriege keinen Bissen hinunter. Ach, mit dir reden zu können! Aber trinken, Alvin! Ich habe deinen Lieblingswein im Keller, Baron de L, pouilly fumé.«
»Dann wollen wir ein paar Gläschen trinken. Bis gleich! Halbe Stunde wird es dauern.«
»Ich danke dir.«
»Nicht«, sagte er. »Nicht danken. Hol den Wein aus dem Keller, und sieh zu, daß er kalt genug ist!«
»Ja, Alvin, ja.«
»Aber nicht zu kalt.«
»Nein, nicht zu kalt. Und wie ich dir danke, sei ruhig! Ich danke dir so sehr dafür, daß du immer, immer für mich da bist!«
»Na, das bist du doch auch für mich«, sagte Alvin Westen. Er war im April 83 Jahre alt geworden.
Als er dann kam, nahm er sie stumm in die Arme und streichelte sanft ihren Rücken. Beim Eintreten hatte er sie auf beide Wangen und auf die Stirn geküßt. Nun standen sie lange still, und seine Hand strich immer weiter über ihren zitternden Rücken.
Schließlich gingen sie durch die Wohnung. Der Ex-Minister Alvin Westen bedeutete seit langem so etwas wie einen zweiten Vater für Norma, die ihre Eltern früh verloren hatte.
Er war ein großer, schlanker Mann, größer als sie. Sein Haar war weiß und sehr dicht, die Stirn hoch, der Mund groß, die dunklen Augen waren klar. In seinem Gesicht stand, für jedermann erkennbar, alles geschrieben, was diesen Mann auszeichnete: Weisheit, Güte, Mitfühlenkönnen, ungebrochene Kraft, für die Gerechtigkeit und gegen das Unrecht zu kämpfen, niemals ermüdende Neugier nach Wissen, sehr viel Humor, gepaart mit sehr großem Ernst. Er trug einen leichten beigefarbenen Sommeranzug. Norma kannte keinen Mann, der sich besser kleidete als Westen, und keinen, der mehr Charme besaß, mehr Takt, mehr Freundlichkeit.
Im Oktober 1969 war der Sozialdemokrat Alvin Westen Außenminister einer Koalitionsregierung der SPD und der FDP geworden. Norma, die ihn natürlich seit langem als Politiker, aber noch nicht persönlich gekannt hatte, interviewte ihn damals für die HAMBURGER ALLGEMEINE. Das war der Beginn einer tiefen Freundschaft zwischen der leidenschaftlichen Reporterin und dem leidenschaftlichen Kämpfer für Gerechtigkeit gewesen. Seither war Westen, der vor vielen Jahren Frau und Kinder verloren und nie mehr geheiratet hatte, immer mehr Normas »zweiter Vater« geworden. Den Politiker und erstklassigen Wirtschaftsfachmann – er war lange Zeit Bankdirektor gewesen – baten nach seiner vierjährigen Ministerzeit viele ausländische Großunternehmen und Regierungschefs um Rat und Hilfe. Er reiste oft und weit und hielt auch Vorträge. Wann immer Norma keinen Rat wußte, suchte sie Westen auf, wo immer in der Welt er auch sein mochte, und sie erhielt Rat, und der war gut und richtig. Wann immer sie sich traurig oder verzweifelt fühlte, erhielt sie von ihrem »zweiten Vater« Trost. Und wenn Westen bei seinen Reisen durch die Welt auf extremes Unrecht stieß, auf gigantische Fälle von Korruption, Gewalt oder Terror, rief er nach Norma, und sie kam und schrieb dann über Terror, Gewalt, Korruption und Unrecht.
6
Sie saßen auf der Terrasse.
Nun war es Nacht geworden. An der Elbe leuchteten viele Lichter, und Schiffe mit vielen Lichtern glitten lautlos vorüber, hinein in den Hafen, hinaus zum Meer. Es war noch immer sehr warm, und sie saßen mit dem Rücken zur Hauswand. Westen hielt Normas Hand, und von Zeit zu Zeit tranken sie seinen Lieblingswein. Lange sprach keiner von ihnen ein Wort.
Dann, plötzlich, begann Norma zu reden, mühsam suchte sie nach Worten, sah starr auf den lichterglänzenden Strom hinunter.
»Das Furchtbarste ist, daß ich keine Ahnung habe … keine Ahnung, warum es geschehen ist … warum mein Junge sterben mußte … Bei seinem Vater war das anders … Da lag Jean-Louis auf der Straße … Bauch aufgerissen … Gedärme quollen heraus … und er schrie, schrie, schrie … Er schrie nach seinem Freund, er wußte, wir waren im Keller des ALEXANDRE … Natürlich mußte Pierre rausrennen zu ihm … zu helfen versuchen … auch wenn da nicht mehr zu helfen war … Sie sind beide umgekommen, aber ich habe gewußt, warum … wegen ihrer Freundschaft … Pierre hat es tun müssen … das hatte Sinn … Aber jetzt … Warum mußte mein Junge sterben? Warum, Alvin? Warum? Warum? Das macht mich noch verrückt … das ist das Ärgste … das ist …«
Und dann, zum erstenmal seit dem Tod ihres Sohnes, begann Norma zu weinen. Sie weinte so sehr, daß ihr Körper geschüttelt wurde. Der Kopf fiel auf die Platte des kleinen Tisches, auf dem der Wein und die Gläser standen. Sie weinte und weinte und weinte, und er stand auf und streichelte ihr Haar, und sie weinte und weinte, das Gesicht auf der Tischplatte, und wandte den Kopf hin und her, und er strich über ihr Haar, immer wieder, und während Norma noch schluchzte, sprach sie schon wieder, erstickt und stockend.
»Wir waren beide so glücklich … Was haben wir alles zusammen getan … Theater … Kino … in die Heide sind wir gefahren … der Zirkus … Er wollte eigentlich gar nicht in den Zirkus. Ich wollte hin … ich, ich … weil ich Clowns so gerne habe … o Gott, weil ich Clowns so gerne habe … Ist das nicht das Schlimmste? Die Sinnlosigkeit, Alvin, diese entsetzliche Sinnlosigkeit!«
Er sagte, über sie geneigt: »Es gibt keine Sinnlosigkeit im Leben, Norma. Es gibt nichts, das ohne Grund und zufällig geschieht. Vieles sieht sinnlos aus, zunächst, weil wir es nicht verstehen. Aber alles, was geschieht, hat einen Sinn. Alles! Auch das, was nun geschah. Wir kennen den Sinn noch nicht, doch einmal werden wir ihn kennen, bald vielleicht, wenn wir ihn suchen, den Sinn.«
Sie richtete sich auf und sah ihn mit einem von Tränen verheerten Gesicht an. »Was hast du gesagt?«
Na also, dachte er. Na also.
»Ich habe gesagt, nichts ist sinnlos. Alles muß einen Sinn haben. Und man findet ihn, wenn man ihn sucht. Man muß ihn finden.«
»Du meinst …« Sie starrte ihn an.
Gut, dachte er, weiter! Ich kenne sie doch, ich weiß Bescheid über sie.
»Ich meine«, sagte er, »du mußt ihn finden. Es ist keine Minute zu verlieren. Du darfst jetzt nicht völlig verzweifeln. Du mußt deine Arbeit tun, so gut du kannst, solang du kannst, bis zum Umfallen, Norma, es ist der einzige Weg. Tu deine Arbeit! Finde den Sinn! Finde die Wahrheit! Man muß sie finden. Wenn einer das kann, dann bist das du. Du mußt herausbekommen, was hinter all dem Morden für ein Sinn steht. Es ist dein Beruf.«
»Ja«, sagte sie klanglos und starrte ihn an. »Ja, Alvin. Du hast recht. Natürlich.«
Gut, dachte er.
»Wie spät ist es?« fragte sie.
»Zwei Minuten nach elf. Warum?«
»Um elf kommt noch mal die WELT IM BILD. Heute war auch das Begräbnis von Gellhorn und seiner Familie. Sie haben doch alle Leichen erst nach sieben Tagen freigegeben. Komm!« Sie rannte schon in das Wohnzimmer, schaltete den Fernsehapparat ein, ließ sich auf das Sofa fallen und starrte den Schirm an. Westen setzte sich neben sie.
Einen Mann am Rednerpult zeigten die Kameras, dann Zuhörer. Der Mann kämpfte mit Tränen. Über seiner Rede in Englisch lag eine deutsche übersetzerstimme: »… das Wettrüsten ist der absolute Tiefpunkt menschlicher Moral. Wir müssen den Besitz von Atomwaffen gleichsetzen mit Verbrechen gegen die Menschheit.« Starker Beifall. Eine Sprecherstimme kommentierte: »In- äußerster Erregung beendet der amerikanische Vorsitzende der ›Internationalen Vereinigung der Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs‹, Doktor Bernard Lown, die Rede. Sein sowjetischer Kollege Doktor Jewgeni Tschasow, mit dem gemeinsam Lown 1985 den Friedensnobelpreis entgegengenommen hatte, schüttelt ihm die Hand und stellt sich neben ihn.«
Das Bild wechselte, der Nachrichtensprecher erschien.
»Hamburg: Acht Tage nach dem brutalen Terroranschlag im ›Zirkus Mondo‹ hat die Polizei trotz sofort eingeleiteter Großfahndung immer noch keine Spur, die zu den Verantwortlichen für das grauenhafte Blutbad führen könnte. Auch ein Motiv wurde noch nicht gefunden. Nachdem die Untersuchungsbehörden die Leichen der Ermordeten gestern abend freigegeben hatten, fanden heute auf verschiedenen Friedhöfen der Hansestadt die Beisetzungen der Opfer statt. Bei dem Anschlag wurden vierzehn Frauen, neun Männer und fünfzehn Kinder getötet. Neunzehn zum Teil schwer Verletzte liegen noch in Krankenhäusern. Es ist zu befürchten, daß das rätselhafte Verbrechen weitere Todesopfer fordern werde, sagte ein Sprecher der Sonderkommission. Unter schwerster Bewachung durch Polizei, Bundesgrenzschutz, Beamte in Zivil und Männer der Antiterroreinheit GSG 9 wurden heute nachmittag auf einem hermetisch abgeriegelten Teil des Ohlsdorfer Friedhofs die vermutlichen Zielpersonen des Anschlags, der Wissenschaftler Professor Martin Gellhorn, seine Frau und seine beiden Töchter, in einem Familiengrab beigesetzt.«
Das Bild wechselte wieder.
Ein Teil des Friedhofs: Man sieht Panzerspähwagen, sehr viele Uniformierte, Zivilisten und Polizisten, die mit Videokameras arbeiten und jeden Anwesenden und die Zeremonie filmen. Eine Gruppe von Trauergästen. Ein großes geöffnetes Grab. Weitere Männer mit Kameras stehen auf den Dächern der Polizeiwagen, die, Heck an Kühler, den Sektor absperren. Andere Männer auf den Wagendächern halten Maschinenpistolen im Anschlag. Starker Motorenlärm. Über der Begräbnisstätte kreisen Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes. In den offenen Luken erkennt man bewaffnete Uniformierte. Die Sonne scheint auf Tausende von Blumen.
Eine andere Sprecherstimme: »Mittwoch, 3. September 1986, 16 Uhr 30. Von der Aussegnungshalle kommend, fahren Wagen mit den Särgen der Ermordeten an der Begräbnisstätte vor. Hinter ihnen Funkstreifen der Polizei. Niemand durfte den Wagen folgen. Die Trauergäste mußten sich zuvor hier versammeln.«
Westen beobachtete Norma unausgesetzt. Ihr Gesicht war erstarrt. Sie ließ den Blick nicht vom Bildschirm. Ihre Hände waren zu Fäusten geballt.
Das Bild zeigte nun die Wagen mit den Särgen: Männer eines Begräbnisinstituts heben den ersten Sarg ins Freie. Sie sind so gekleidet, wie es seit dem Jahr 1700 in Hamburg bei ihrem Stand Brauch ist: schwarzer Samtrock, weiße, gestärkte Halskrause, schwarze Kniehosen, lange Strümpfe und ein großer Dreispitz auf dem Kopf. Vier von ihnen tragen den ersten Sarg durch das Spalier der Trauergäste zu dem geöffneten Familiengrab. Die Rotoren der Hubschrauber dröhnen. Jetzt sind zwei von ihnen groß im Bild. Eine andere Kamera zeigt wieder die Männer mit den Videokameras und die Uniformierten mit den Schnellfeuerwaffen.
Sprecherstimme: »In diesem Sarg liegt Professor Martin Gellhorn. Der 46jährige Gelehrte, der internationale Berühmtheit erlangt hatte, war Leiter des Instituts für klinische Mikrobiologie und Immunologie am Virchow-Krankenhaus. Er arbeitete zuvor in Amerika, in der Sowjetunion und in Frankreich.«
Bildstörung. Plötzlich sieht man auf dem Schirm nur tanzende schwarze und weiße Punkte. Die Sprecherstimme ertönt weiter: »Vertreter großer Pharmakonzerne und berühmte Kollegen aus Ost und West sind angereist, um ihm die letzte Ehre zu erweisen … Dies ist Professor Herbert Lauterbach, Chefarzt des Virchow-Krankenhauses hier in Hamburg …«
Das Bild war wieder klar: Man sieht einen großen, hageren Mann mit Hakennase und schwarzem Haar in der Nähe des Grabes. Eine Kamera geht nah an den Klinikchef heran. »Wie die nächsten Mitarbeiter des Ermordeten weigert sich auch Professor Lauterbach, genaue Angaben über die Arbeit Professor Gellhorns zu machen.«
Der erste Sarg wird in das große Grab hinabgelassen. Andere Männer bringen bereits den zweiten.
»In diesem Sarg liegt Frau Angelika Gellhorn …«
Die Sargträger schreiten langsam an einer Kamera vorbei. Man sieht nur die zwei vorderen. Sie sind beide mittelgroß und kräftig. Einer, besonders blaß, hat eine Brille mit ungerahmten Gläsern.
»Da!« schrie Norma. »Da ist er wieder!« Sie sprang auf, zeigte auf den Bildschirm.
»Wer? Wer, Norma? Wer ist da wieder?«
»Er war im Zirkus. Er hat …«
»Was? Was hat er? Norma! Wen meinst du?«
Sie setzte sich. »Warte! Später …«
Der Sargträger mit der besonders blassen Gesichtshaut und der ungefaßten Brille ist aus dem Bild verschwunden. Neue Bilder folgen … Die filmenden Kriminalbeamten und Polizisten, die Hubschrauber, die Uniformierten mit den Maschinenpistolen.
Neue Träger, zwei kleine Särge: »… Der Sarg von Professor Gellhorns Tochter Lisa. Sie war fünf Jahre alt … und der Sarg Olivias … sieben Jahre alt …«
Sieben Jahre. Wie Pierre, dachte Norma. Und so kleine Särge. Wie Pierres Sarg …
Eine Kamera erfaßt Männer und Frauen neben dem Grab: »… Die Angehörigen der Opfer …«
Die kleinen Särge werden in die Tiefe gelassen.
»… Und das waren die engsten Mitarbeiter Professor Gellhorns … Der polnische Biochemiker Doktor Jan Barski, sein Vertreter. Er arbeitete seit zwölf Jahren mit Professor Gellhorn …« Ein großer, kräftiger Mann mit kurzgeschnittenem schwarzen Haar und breitflächtigem Gesicht. »… Der japanische Biochemiker Doktor Takahito Sasaki …« Klein, zierlich, Brille. »… Der israelische Molekularbiologe Doktor Eli Kaplan …« Groß, blond, blauäugig. »… Der bundesdeutsche Bakteriologe Doktor Harald Holsten …« Mittelgroß, untersetzt, in seinem Gesicht zuckt ein Nerv. »… Und die englische Genforscherin Doktor Alexandra Gordon …« Groß, hager, das braune Haar streng zurückgenommen Sie weint. »… Hinter diesen engsten Mitarbeitern die Frauen von Doktor Kaplan und Doktor Holsten …«
So geht das weiter. Nun werden Kränze und Blumen herangebracht. Zu beiden Seiten des offenen Grabes legen sie die Träger ab, besonders große Kränze hängen sie auf in die Erde gerammte Gestelle. Eine Kamera gleitet zuletzt über die Schleifen mit den Aufschriften in verschiedenen Sprachen. Die größten Kränze stammen von amerikanischen und sowjetischen Trauernden.
Ein Pfarrer spricht ein Gebet. Kein Wort ist zu verstehen im Lärm der Hubschrauber. Alle Mitglieder der kleinen Trauergemeinde treten nacheinander vor, jeder wirft eine rote Rose in das offene Grab, verneigt sich vor den Angehörigen, tritt zurück …
Währenddessen sagt die Sprecherstimme: »Das Bundeskriminalamt hat INTERPOL um Unterstützung gebeten. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, haben die Freie und Hansestadt Hamburg, die Polizei, das Virchow-Krankenhaus und eine Reihe von internationalen Pharmakonzernen eine Belohnung von insgesamt fünf Millionen Mark ausgesetzt.«
Das Bild der Trauernden wird ausgeblendet. Der Nachrichtensprecher ist wieder zu sehen. »Das war ein Bericht von der Beisetzung Professor Gellhorns und seiner Familie, Opfer des brutalen Terroranschlags im ›Zirkus Mondo‹ am 25. August. Die kurze Bildstörung bitten wir zu entschuldigen. – Südafrika: Bei neuen schweren Zusammenstößen von Schwarzen mit der Armee nördlich der Hauptstadt kamen mindestens sechzig Menschen ums Leben, weit über zweihundert mußten in Krankenhäuser eingeliefert …« Die Stimme bricht ab, der Schirm flimmert schwarz.
Norma hatte den Sender mit der Fernbedienung ausgeschaltet. Es war fast dunkel im Zimmer. Nur eine kleine Schirmlampe brannte auf dem Apparat.
Sofort fragte Westen: »Wer war der Mann, bei dem du aufgeschrien hast?«
»Der Leichenblasse! Im Zirkus waren drei Telefonzellen, weißt du. Bei den Kassen. Ich stand in einer und gab die Nachricht an die Redaktion durch. Da riß dieser leichenblasse Mann mit den ungefaßten Brillengläsern meine Zellentür auf. Er war sehr aufgeregt, entschuldigte sich und verschwand wieder.«
»Und das war heute einer von den Sargträgern?«
»Ja, Alvin, ja! Ich bin absolut sicher.« Plötzlich sprang Norma auf. Ihre Augen blitzten im Licht der kleinen Lampe. »Es gibt nichts Sinnloses auf der Welt, hast du gesagt. Oft sieht es sinnlos aus. Aber es ist nicht sinnlos. Natürlich steht auch hinter diesen Morden ein Sinn. Ich werde ihn herausbekommen, und wenn es das letzte ist, was ich tue.« Sie bemerkte plötzlich, wie sehr sie sich in Erregung geredet hat. Unglücklich sagte sie: »Ach, Alvin!«
Schnell stand er auf und umarmte sie. »Du wirst es herausbekommen, Norma.« Ein glückliches Lächeln lag plötzlich auf seinem Gesicht. So habe ich ihr doch helfen können, dachte er. Laß mich noch eine Weile leben, Tod!
7
Am nächsten Tag war es noch heißer.
Norma fuhr mit ihrem blauen Golf GTI