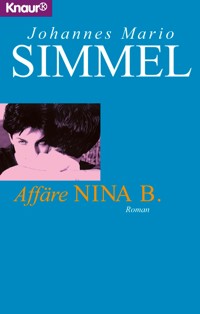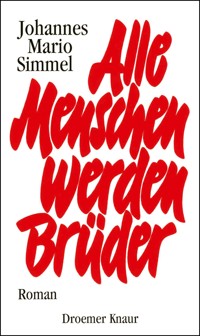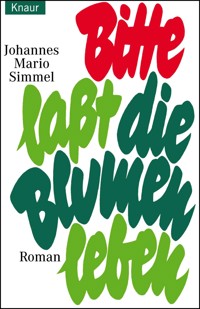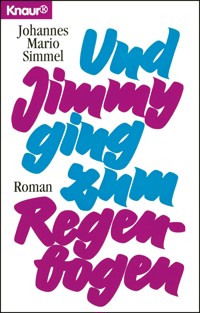
6,99 €
3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mitreißend und herzbewegend zugleich erzählt Johannes Mario Simmel hier eine große Geschichte um Schuld und Sühne. Sie ist viel mehr als ein Roman von hochbrisanter Thematik, atemloser Spannung, harter Realistik und makabrem Humor. Simmel gelingt die Schilderung unvergeßlicher Gestalten, die Deutung ewig menschlicher Tragödien, aber, als Wichtigstes, der Nachweis, daß nichts ohne Sinn und zufällig geschieht, dass jeder von uns hineinverstrickt ist in das magisch geknüfte Webmuster des Lebens und darum verantwortlich selbst noch für den Geringsten unter seinen Mitmenschen. Und Jimmy ging zum Regenbogen von Johannes Mario Simmel: Klassiker als eBook von Droemer Knaur*!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1168
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Johannes Mario Simmel
Und Jimmy ging zum Regenbogen
Roman
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Dieser Roman beruht auf wahren Begebenheiten, die sich zwischen 1934 und 1965 in einer westdeutschen Großstadt zugetragen haben.
Um Unschuldige zu schützen, wurde die Handlung in einen anderen Zeitraum (1938–1969) und in eine andere, weit entfernte Stadt (Wien) verlegt. Es versteht sich deshalb von selbst, daß die im Buch vorkommenden Präsidien, Gerichte, Ämter, Behörden, geheimen oder legalen Verbindungen und alle sonstigen geistlichen oder weltlichen Institutionen zwar ihre richtigen Bezeichnungen tragen, jedoch in keiner Weise jemals mit den tatsächlichen Geschehnissen befaßt gewesen sind. In diesem Zusammenhang stellen ihre Vertreter ausnahmslos reine Produkte der Phantasie des Verfassers dar.
Gesetze, Paragraphen, Erlasse, Schriftsätze, Gutachten, Reden sowie Teile von Sendungen der British Broadcasting Corporation wurden im Wortlaut wiedergegeben.
Die wahren Begebenheiten, Personen und Namen sind in solcher Weise verändert worden, daß niemand sie wiederzuerkennen vermag.
Seinen aufrichtigen Dank spricht der Verfasser all denen aus, die ihm bei der Rekonstruktion jener Begebenheiten geholfen haben.
Dieses Baums Blatt, der von Osten
Meinem Garten anvertraut,
Gibt geheimen Sinn zu kosten,
Wie’s den Wissenden erbaut.
Ist es ein lebendig Wesen,
Das sich in sich selbst getrennt?
Sind es zwei, die sich erlesen,
Daß man sie als eines kennt?
Solche Frage zu erwidern,
Fand ich wohl den rechten Sinn:
Fühlst du nicht an meinen Liedern,
Daß ich eins und doppelt bin?
Goethe: Ginkgo biloba, aus dem ›Westöstlichen Diwan‹.
Vers eins
Das Geheimnis
Dieses Baums Blatt, der von Osten
Meinem Garten anvertraut,
Gibt geheimen Sinn zu kosten,
Wie’s den Wissenden erbaut.
1
Sie wollten unbedingt einen Kopfschuß. Deshalb hatten sie Clairon kommen lassen. Er war Spezialist für Kopfschüsse.
Ich weiß nicht, was Manuel Aranda getan hat, dachte Clairon. Das sagen sie einem ja nie. Ich weiß nur, daß sie Manuel Aranda tot haben wollen, und zwar schnell. Sobald das erledigt ist, darf ich wieder heim zu Janine. Janine war Clairons fünfjährige Tochter. Er liebte sie mehr als alles andere auf der Welt. Vor zwei Jahren war seine Frau gestorben. Er hatte auch seine Frau geliebt, aber nicht so sehr wie Janine. Bei dem kleinen Mädchen war er völlig von Sinnen. Tags zuvor hatte er in einem Spielwarengeschäft einen niedlichen scharlachroten Fuchs mit schwarz-weißer Schnauze gekauft, der eine Schnur besaß. Zog man an ihr, dann ertönte silberhell die Melodie einer kleinen eingebauten Spieluhr: ›Fuchs, du hast die Gans gestohlen!‹
Clairon brachte Janine stets Stofftiere oder Puppen mit, wenn er zurückkam. Sie besaß schon eine ganze Sammlung. Er dachte an das Kind und lächelte.
Sie hatten ihm Manuel Aranda gezeigt, als dieser das Hotel ›Ritz‹ am Kärntner-Ring verließ und in den gemieteten blauen Mercedes stieg; als er das Gerichtsmedizinische Institut in der Sensengasse betrat; auf verschiedenen Straßen; vor dem Sicherheitsbüro der Polizeidirektion in der Berggasse. Sie hatten ihm Fotografien und mit versteckten Kameras aufgenommene farbige 8-Millimeter-Filme gezeigt, denn er sollte in aller Ruhe Wuchs und Gestalt, Kopfform, Gangart, Bewegungen und Eigentümlichkeiten seines Mannes studieren. Die Bilder und die Filme waren mit dem gleichen Flugzeug eingetroffen wie Manuel Aranda. Derartiges Tempo, derartige Hektik und Nervosität hatte Clairon noch bei keiner seiner Missionen erlebt. Jede Stunde, die Manuel Aranda lebte, schien eine tödliche Gefahr darzustellen. Muß eine schlimme Sache sein, dachte Clairon. So verrückt haben sie noch nie gespielt.
Jetzt, im Januar, herrschte mörderische Hitze in Buenos Aires. Die Filme zeigten Manuel Aranda auf den Straßen seiner Heimatstadt stets mit Panama-Hüten. Auf den Straßen Wiens lief er stets mit einer Pelzmütze herum. Gewiß fror er ebenso wie Clairon. Der hatte sich auch eine Pelzmütze gekauft, gleich nach der Ankunft.
Kopfschuß bei bedecktem Kopf also. Mir soll’s recht sein, dachte Clairon. Ich hatte schon andere Kunden mit Mützen. Auch solche mit Hüten oder Kappen, einen sogar mit Stahlhelm. Es klappte noch immer. Man muß ein wenig genauer arbeiten, das ist alles.
Als der blaue Mercedes in die vereiste Allee einbog, benötigte Clairon knappe eineinhalb Sekunden, dann hatte er die vordere Nummerntafel des Wagens im Fadenkreuz. Das Kennzeichen stimmte. Clairon las es bedächtig. Er war ein sehr bedächtiger Mann geworden, seit sie ihn zum Tod verurteilt hatten. Bedächtig und konservativ. Sieben Jahre schon bewohnte er dasselbe Haus in Anfa, einem der eleganten Villenviertel von Casablanca, die westlich des Parc Lyautey liegen und sich bis zum Meer hinunter ausdehnen. Sieben Jahre schon besuchte er die gleichen Restaurants, Friseursalons und immer das gleiche türkische Bad in dem noch von hohen Mauern umgebenen arabischen Altstadtteil Medina; hielt er dem gleichen Schneider, dem gleichen Hemdenmacher und dem gleichen Briefmarkenhändler die Treue; dem gleichen Zahnarzt, der gleichen Kirche und der gleichen Waffe – dem deutschen Modell 98 k, System Mauser, Kaliber 7,9 Millimeter, Patronenlänge 75 Millimeter, Gewehrlänge 1110 Millimeter, Ladestreifen mit fünf Schuß, aufgesetztes Zielfernrohr. Dieses inklusive wog die Waffe nur 4,2 Kilogramm, der Rückstoß war leicht, sanft konnte man fast schon sagen, das Repetieren ging blitzschnell, und Clairon hatte seine 98 k auf eine Entfernung von 150 Metern eingestellt. Der Lauf des Gewehrs ruhte neben dem linken Fuß eines weinenden Engels.
2
Zu diesem Zeitpunkt, um 14 Uhr 43 am 16. Januar 1969, einem Donnerstag, gab es in dem 1874 von der Gemeinde Wien eröffneten Zentralfriedhof auf einer Fläche von 2459508 Quadratmetern 329627 Grabstätten. Clairon hatte die Verwaltung angerufen und sich erkundigt; er wollte wissen, wie groß der Ort war, an dem es geschehen sollte. Eine enorme Zahl von Gräbern hatte man seit der Jahrhundertwende bereits mehrfach wieder aufgelassen und zum zweiten-, dritten- oder viertenmal neu belegt. In einer Stunde würden es 329629 Gräber sein, denn an diesem Nachmittag fanden, wie Clairon einer Informationstafel beim Hauptportal entnehmen konnte, noch zwei Beerdigungen statt, darunter die eines hohen Offiziers des österreichischen Bundesheeres. So hartgefroren war die Erde, daß man beim Ausschachten neuer Grabstätten Preßluftbohrer einsetzte.
Obwohl zum erstenmal hier, wußte Clairon praktisch alles über die phantastische Anlage. Er hatte sich mit Hilfe einer Broschüre und eines Taschenplans des Friedhofs, des geschwätzigen Verkäufers der beiden, nach Hinweisschildern und vor allem durch persönliche Inspektion informiert. Da er seinen eitlen, ins eigene Genie verliebten Auftraggebern stets mißtraute, informierte er sich vor jedem Unternehmen persönlich so genau wie möglich. Früher war Clairon Lehrer (Mathematik und Latein) gewesen. Er besaß ein ausgezeichnetes Gedächtnis für Menschen, Namen und Zahlen.
Daß Manuel Aranda an diesem Nachmittag das Grab besuchen wollte, wußte Clairon schon seit gestern. Um 16 Uhr 55 war da der Lautsprecher des Kurzwellensenders munter geworden, der sich in einem der zahlreichen Hinterzimmer des französischen Reisebüros ›Bon Voyage‹ befand. Das französische Reisebüro befand sich am unteren Ende des Schwarzenbergplatzes.
»J’appelle Olymp … j’appelle Olymp … Ici le numéro onze …«
»Je vous entends, numéro onze. Parlez!«
Also hatte Nummer Elf zu sprechen begonnen, der Funkverkehr lief ausgezeichnet: »Aranda ist in das Hotel zurückgekommen. Er hat Nummer Null gesagt, daß er morgen zum Zentralfriedhof fahren will, und gebeten, ihm den Weg zu erklären.«
Sie hatten sich schnuckelig eingerichtet da in Wien. Sie besaßen ein gutes Hauptquartier hinter dem Reisebüro, eine erstaunliche Anzahl von Agenten und fünf Autos, in die gleichfalls Sender eingebaut worden waren. Alle Sender hatten Zerhacker und Entzerrer, für jeden Dritten war der Sprechverkehr nur unverständliches Gestammel. Der Wagen, den sie Clairon geben wollten, besaß ebenfalls eine solche Anlage.
»Und der Schlüsselbund?« hatte jener, der gerade den Sender der Zentrale bediente, aufgeregt gefragt. Es waren fünf Männer in dem fensterlosen Raum versammelt gewesen, auch der Chef, Jean Mercier, der das Reisebüro leitete, und er, Clairon. Mit Ausnahme von Clairon, der nicht wußte, um welchen Schlüsselbund es ging, hatten alle rechte Nervosität erkennen lassen.
»Der ist im Karton.«
»Idiot! Wo ist der Karton?«
»Na, im Leichenschauhaus natürlich … in diesem Institut meine ich.«
»Seid ihr ganz sicher?«
Der Chef persönlich sprach jetzt ins Mikrophon. Jean Mercier war ein großer Mann mit blassem Gesicht, umschatteten Augen, langen Wimpern und graumeliertem Haar. Er führte die Wiener Zentrale seit fünf Jahren. Sein Hobby waren schöne Frauen, und was Clairon so gehört hatte in der kurzen Zeit, bekam der Fünfundfünfzigjährige immer noch jede, die er wollte.
»Vollkommen sicher. Aranda hat sich bei Nummer Null eben noch darüber beschwert, daß sie den Karton nicht freigegeben haben. Er bekommt ihn nur zusammen mit dem Leichnam, und den Leichnam bekommt er erst morgen um zehn.« Die Männerstimme klang deutlich und klar aus dem Lautsprecher, in dem es leise knisterte. Komplizierter geht es nicht, dachte Clairon. Nummer Null, vermutlich ein Portier, kann nicht von seinem Arbeitsplatz fort. Also muß er alles, was er über Aranda erfährt, einem anderen Mann im Hotel sagen, der sich frei zu bewegen vermag. Wer ist das? Clairon wußte es nicht. Sie machten ein Mysterium aus allem. Dieser zweite Mann jedenfalls durfte nicht wagen, das Reisebüro einfach anzurufen. Er mußte in eine öffentliche Telefonzelle gehen und von dort einen dritten Mann verständigen. Der besaß einen Sender in seiner Wohnung und trat dann mit der Zentrale in Verbindung, die anders zu informieren strengstens verboten war.
»Aranda kann nicht Verdacht geschöpft und Nummer Null belogen haben?«
»Chef! Aranda wurde den ganzen Tag verfolgt. Jede Minute! Er kam ohne Karton aus dem Institut!«
»Und daß er den Schlüsselbund allein mitnahm und in der Tasche hat?«
»Unmöglich!«
»Sie wissen, was davon abhängt! Wenn er jetzt mit dem Schlüssel auftaucht, ist alles verloren.«
»Beruhigen Sie sich endlich, Chef. Bitte! Wir haben uns doch erkundigt! Die arbeiten nach Vorschrift dort. Nicht ein Stück, nicht einen Schnürsenkel hat Aranda mitnehmen dürfen. Schließlich basiert der ganze Plan auf dieser Vorschrift, oder?«
»Ja, das stimmt.« Mercier hatte seine Krawatte herabgezerrt.
»Also! Aranda erhält den Schlüsselbund morgen vormittag, aber danach muß er gleich zur Luftfracht-Expedition, damit die Leiche endlich verschwindet. Das dauert bestimmt bis Mittag, hat er gesagt. Er will ins Hotel zurückkommen, essen und zum Grab fahren.«
»Und wenn er nicht fährt? Dann hat er den Schlüssel! Wenn er dann sagt, los, aufmachen?«
»Nummer Null behauptet, Aranda will wirklich zum Friedhof. An den Schlüsselbund denkt er überhaupt nicht. Den hat er kaum zur Kenntnis genommen. Er weiß doch gar nichts! Nummer Null ist davon überzeugt, daß Aranda den Karton in sein Appartement bringen läßt und gar nicht anschaut. Jedenfalls nicht, bevor er zum Friedhof fährt. Das ist doch das Risiko, mit dem Sie von Anfang an gerechnet haben – die kurze Zeit zwischen dem Punkt, wo Aranda den Schlüsselbund erhält, und dem, wo er liquidiert wird.« Ich möchte wissen, was für Schlüssel das sind, die dieser Aranda hat oder nicht hat, war es Clairon durch den Kopf gegangen. Ach was, ich will es gar nicht wissen! Er war Merciers Blick begegnet. Der hatte gesagt: »Also muß es der Zentralfriedhof sein, klar?«
»Klar.«
»Von ihm darf Ihr Mann nicht zurückkehren.«
Clairon hatte nur genickt, Mercier hatte weiter in das Mikrophon gesprochen.
»Wo ist Aranda jetzt?«
»In seinem Appartement. Zum Friedhof kann er heute nicht mehr. Die lassen ab halb fünf niemanden hinein. Um fünf machen sie zu. Außerdem will er noch zu seiner Botschaft. Er braucht auch von dort Papiere für den Sarg.«
»Hallo, Nummer Drei … Nummer Drei, melden!«
»Hier ist Nummer Drei, Olymp.« Eine andere Männerstimme kam aus dem Lautsprecher.
»Habt ihr zugehört?«
»Ja, Chef.«
»Ihr könnt den Eingang des Hotels gut sehen?«
»Ja.«
»Kaffeehauseingang auch?«
»Auch, Chef.«
Das Hotel besaß ein großes Café.
»Wenn Aranda zur Botschaft fährt, folgt ihr ihm. Danach wohin immer. Und meldet es sofort. Die Arbeit geht weiter rund um die Uhr. In zwei Stunden löst euch Nummer Neun ab …«
Clairon hatte das Reisebüro verlassen und einen Taschenplan und eine Broschüre über den Zentralfriedhof gekauft. Er bewohnte während seines Wiener Aufenthalts jenes Hinterzimmer des ›Bon Voyage‹, in dem sie die Filme vorführten. Der Raum hatte auch kein Fenster, bloß eine Luke, und anstatt eines richtigen Bettes nur eine aufklappbare Armeepritsche. Clairon machte das nichts. Er war abgehärtet. Auf der Pritsche hatte er abends den Friedhofsplan und die Broschüre studiert und danach lange gebetet, wobei er Gott beteuerte, wie sehr er den Mord bereue, den er begehen werde, und innig um ein erfolgreiches Gelingen des Unternehmens bat. Das tat er immer. Er war ein Mörder mitten im Herzen des Christentums. Niemand, so hatte er bei Péguy gelesen, wisse um Dinge des Christentums besser Bescheid als ein Sünder.
Am nächsten Mittag, um zwölf Uhr bereits, war Clairon losgefahren. Er hatte sich über Funk gemeldet.
»Hallo, Olymp, ich bin jetzt am Rennweg, unterwegs zum Friedhof.«
»Sie haben massig Zeit, Nummer Eins. Aranda kam eben ins Hotel. Er hat noch nicht einmal gegessen.«
»Muß mir die Gegend da draußen ansehen«, antwortete Clairon.
Er sah sich die Gegend an, gründlich. Zuerst umkreiste er den riesigen Komplex des Zentralfriedhofs im Süden von Wien. Von der Simmeringer Hauptstraße bog er in den Weichseltalweg ein und fuhr diesen bis zur Station der Aspang-Bahn empor. Hier wandte er sich nach links, folgte den Gleisen der Ostbahn, die in einem mächtigen Bogen an der Rückseite des Friedhofs entlangführen, und kehrte zur Simmeringer Hauptstraße zurück.
Insgesamt, stellte Clairon fest, besitzt der Zentralfriedhof elf Tore. Acht von ihnen kommen allerdings nur kleineren, bewachten Eingängen rund um das Areal gleich. Die drei großen Portale befinden sich an der Vorderfront. Durch das mittlere, größte, gelangt man ins Zentrum der Katholischen Abteilung, die nahe dem Eingang zwei Aussegnungshallen und weiter entfernt eine dritte besitzt. Eine breite Auffahrt führt zur Dr.Karl Lueger-Kirche. Von ihr laufen nach einem geometrisch exakten Plan sternförmig die Hauptalleen mit alten Bäumen auseinander. Clairon bekreuzigte sich, während er an dem geöffneten Riesentor des Gotteshauses vorüberfuhr, dann meldete er sich wieder und gab seinen Standort bekannt.
Die Hauptalleen besitzen in großen Abständen Rondells, aus denen Chauseen in alle Richtungen streben. Am Rand der Rondells und vieler Chausseen stehen weiße kleine Gebäude. Clairon besichtigte zwei von ihnen. Es gibt eine Unmenge Bedürfnisanstalten auf dem Zentralfriedhof. Die Sternbahnen der Alleen und Chausseen werden geschnitten von einem komplizierten Netz quadratisch angelegter Straßen. Große Quadrate sind in kleinere unterteilt, in die ›Gruppen‹, durch welche, wieder in rechten Winkeln zueinander, unzählige Wege laufen. Die Gruppen hatte man stets mit einem Buchstaben und einer Zahl gekennzeichnet, die Unterteilungen desgleichen.
Ein Glück, daß ich mit Ketten fahre, dachte Clairon. Nach den katastrophalen Schneefällen der letzten Tage war es offenbar nur unter größten Anstrengungen gelungen, wenigstens die viele Kilometer langen Hauptalleen und -chausseen zu räumen. Die Nebenstraßen und alle Wege, die in den Gruppen von Abschnitt zu Abschnitt führten, versanken in halbmeterhohem Schnee. Räumpflüge hatten kleine Gebirge der weißen Bedrohung gegen die Ränder der Alleen geschoben, die kaum begehbar und schwierig befahrbar waren, denn die Streukolonnen kamen in ihrer Arbeit nicht nach.
»Olymp ruft Nummer Eins … Olymp ruft Nummer Eins …«
»Hier ist Nummer Eins, Olymp. Kommen Sie!«
»Aranda hat das Restaurant verlassen und ist in das Kaffeehaus hinübergegangen. Er trinkt seinen Kaffee dort. Jetzt Zeitvergleich, bitte, Nummer Eins!«
Clairon sah auf seine Armbanduhr.
»13 Uhr 34.«
»13 Uhr 34, richtig.«
Was für ein elendes Getue, jedesmal von neuem, dachte Clairon. Gott, habe ich das alles satt! Aber was soll ich machen? 1961 war ich bei der OAS, dieser ›Terrororganisation‹, wie man sie nannte. Nun gut, sehr fein ging es nicht zu bei uns. Was ich heute kann, habe ich damals gelernt. Schließlich war es auch nicht sehr fein, wie de Gaulle mit den französischen Siedlern in Algerien umsprang. Sie erwischten mich, als wir ein Kino in die Luft sprengten (ich liebe Kinder, ich hatte keine Ahnung, daß da gerade eine Kindervorstellung lief), und sie verurteilten mich zum Tode und führten mich zum Erschießen. Dann, als ich mit verbundenen Augen an der Wand stand, kam so ein Drecksack und sagte, sie würden mich nicht erschießen, wenn ich von nun an für sie arbeitete. Ich bin kein Held, dazu bin ich nicht blöde genug. Also sagte ich ›einverstanden‹, und seither arbeite ich für sie. Diesmal in Wien.
Die Saubande, dachte Clairon bitter. Wann werde ich sie jemals los? Nie! Nun ist auch meine Frau gestorben. Wenn ich nicht Janine hätte … Der Gedanke an seine kleine Tochter richtete Clairon wieder auf. So schlecht ging es ihm eigentlich gar nicht. Das Kind, das Haus, ein gutes Einkommen. Sie hatten ihn pro forma als Leiter einer französischen Importfirma in Casablanca etabliert.
Seit Clairon auf dem Friedhof umherfuhr, waren ihm kaum zwei Dutzend Menschen und nur vier Autos begegnet. Gott sei Dank.
Unter der weißen Last aus dem Himmel waren schwere Äste, ja ganze Bäume gebrochen. In ungeheuren Mengen lagerte der Schnee auf Hecken, Büschen, Fliedersträuchern und dem Astwerk von Buchen, Ulmen, Trauerweiden, Platanen, Ahorn- und Kastanienbäumen, hohen Fichten und Zypressen, auf allen Gräbern, allen Grabsteinen, Schmiedeeisengittern und Miniaturkapellen. Büsten, allegorische Gestalten und Steinfiguren waren zu grotesken Gebilden geworden. Eine lebensgroße Trauernde aus Sandstein, die an einem Grabrand lehnte, sah aus wie im neunten Monat, ein lockiger Knabenkopf feixte besoffen. Der Schnee war der Herr des Friedhofs, und seine Höflinge waren die Krähen. Unzählig, zu Tausenden, hockten sie dicht nebeneinander in den Kronen der Bäume, groß, plump und scheußlich. Ihr heiseres lautes Geschrei erfüllte die Luft.
Ein Alptraum, ein Nachtmahr in Weiß, unheimlich und unwirklich, beklemmend und öde, ein schreckenerregendes Reich des Todes war der Wiener Zentralfriedhof an diesem 16. Januar. Entfernte Bäume, Wege oder Gräber sah Clairon plötzlich nicht mehr – feiner Eisnebel, der in der Luft hing, ließ sie verschwinden wie ein gespenstischer Zauberer. Dunkel und tief lagerte eine geschlossene, schneegeladene Wolkendecke über der trostlosen Erde. Das Licht war fahl. Clairon trat leicht auf das Gaspedal. Die Katholische Abteilung, die den meisten Raum einnimmt, wird links und rechts flankiert von der Neuen und der Alten Israelitischen Abteilung, deren Synagoge, im Krieg durch Bomben fast gänzlich zerstört, wiederaufgebaut worden war, wie er aus der Broschüre wußte. Östlich des katholischen Teils, zwischen ihn und den neuen israelitischen gebettet, erstreckt sich, vergleichsweise klein, die Evangelische Abteilung.
Die helfen mir nicht, dachte Clairon. Da sind überall hohe Mauern. Wenn es darauf ankommt, muß ich sehen, wie ich im katholischen Teil zu einem der Ausgänge gelange. Zu einem der kleinen Tore der Rückseite am besten. Was für ein Monstrum von einem Friedhof!
»Olymp ruft Nummer Eins … Olymp ruft Nummer Eins …« Clairon meldete sich.
»Es ist jetzt fünf vor zwei. Arandas Wagen haben sie aus der Garage gebracht. Er kommt eben aus dem Hotel.«
»Gut«, sagte Clairon.
Er fuhr durch den Friedhof, auf dem er sich nun gut auskannte, bis vor eine alte große Platane jenes Rondells, das inmitten der Gruppen 56, 57, 58, 59, 71 und 72 liegt. Kein Mensch war hier, weit draußen in der Nähe der Friedhofsrückseite, zu sehen. Clairon rief die Zentrale und teilte mit: »Ich bin jetzt da und gehe auf Posten.«
»Gut, Nummer Eins. Nummer Zwei folgt Aranda. Wenn er wider Erwarten doch nicht zum Friedhof fährt, ruft Nummer Zwei Nummer Zwölf, und Nummer Zwölf fährt dann die Allee herunter, damit Sie informiert sind. Aber Aranda kommt bestimmt.«
»Hoffentlich«, sagte Clairon. Er schaltete den Sender ab, ebenso den Motor. Dann stieg er aus. Achtundvierzig Jahre alt war Clairon, aber er wirkte älter. Er hatte eine römische Nase in dem mageren Gesicht und schmale Lippen. Er trug einen wasserdichten Mantel aus erbsenfarbenem Popeline, der mit dickem Lammfell gefüttert war, die neue schwarze Pelzmütze, ein Wollhalstuch, Skihosen und Pelzstiefel. Die 98 k hielt er unter dem Mantel versteckt, während er nun vorsichtig die freigeräumte Allee zur Gruppe 73 hinabging – ein langes Stück Weg auf spiegelndem Eis. Erst als er sich anschickte, in die verschneite Gruppe 73 einzudringen, holte er zwei Filzlappen aus den Manteltaschen und band sie um die Stiefelsohlen. Danach sprang er über einen Schneewall am Rand der Straße. Aufmerksam betrachtete er die Gruppe 74, die durch eine andere freigeräumte Allee von seinem Abschnitt getrennt lag. Er entdeckte sofort, was er suchte. Sie hatten ihm genügend Fotografien jenes Grabes gezeigt.
Jenes Grab im Abschnitt F 74 stets im Auge behaltend, wählte Clairon nun das geeignetste seiner Gruppe aus – eine leichte Arbeit. Nach einigem Herumwaten war die ideale Position gefunden: Das Grab lag in der Abteilung L 73 und gehörte einer Familie Reitzenstein. Vier Tote ruhten bereits hier unter einem grauen Marmorquader, der fast so hoch wie Clairon war, zwei Männer und zwei Frauen. Clairon las die in den Stein gemeißelten, schwer vergoldeten und teilweise von Schnee verwehten Namen.
Über dem mächtigen Quader lagerte, gleichfalls aus grauem Marmor, ein etwa dreißig Zentimeter hoher Sockel, und auf diesem kniete, mit breit ausladenden Flügeln, ein grauer Marmorengel, welcher weinte. Dieser Engel war so groß wie ein normaler Erwachsener und trug ein wallendes Gewand und langes Haar, das ihm über den Rücken fiel. Die Hände hielt er vor das Gesicht geschlagen. Der Griff einer gesenkten Marmorfackel war an seiner rechten Hüfte befestigt, ihre Krone auf dem Sockel. Eine große Steinflamme loderte aus ihr empor. Die Fackelkrone befand sich an einem Ende des schweren Aufsatzes, der linke Fuß des Engels am andern. Auf der Vorderseite des Sockels waren in Großbuchstaben, gleichfalls schwer vergoldet, diese Worte zu lesen:
EST QUAEDAM FLERE VOLUPTAS
Clairon, vor dem monströsen Grab stehend, übersetzte die Inschrift gewohnheitsmäßig sogleich im richtigen Rhythmus: Irgendwie tut es wohl, sattsam sich auszuweinen.
Kurze Ergriffenheit erfaßte ihn, während er den Text für sich wiederholte und dabei die Drähte an die Lederhandschuhe anschloß. Es waren Spezialhandschuhe, die sich beheizen ließen. Die Drähte liefen unter Clairons Jackenärmeln bis zu zwei Batterien in den inneren Brusttaschen. Seine Finger mußten warm bleiben.
Der Engel trug eine Schneehaube von mindestens vierzig Zentimetern. Ebenso heftig verschneit waren seine Flügel, der Sockel, der Quader, das Grab. Clairon machte es sich hinter ihm bequem. Es war wirklich ein großartiger Platz. Von den Alleen her konnte niemand ihn sehen.
Unter dem Knie des abgewinkelten linken Beines ließ das geschürzte Gewand des Engels eine dreieckige Öffnung entstehen. Den Durchblick mußte Clairon erst säubern, denn natürlich war er zugeschneit. Desgleichen reinigte er ein etwa fünfzehn Zentimeter breites Stück Sockel zwischen der linken großen Zehe des Engels und jener Stelle, an der dessen rechtes Knie die andere Seite der Dreieck-Basis abschloß. Nun besaß Clairon eine Schießscharte für seine 98 k. Er schob den Lauf so ein, daß er als Fixierungspunkt die große Marmorzehe berührte. Die Mündung befand sich genau über dem goldenen u in dem Wort VOLUPTAS.
3
14 Uhr 43.
Ganz langsam bewegte sich der Lauf der 98 k, denn Clairon behielt den näherkommenden blauen Mercedes beharrlich im Fadenkreuz. Es war weit vom Hotel ›Ritz‹ am Ring bis hier heraus, er hatte lange auf Aranda warten müssen. Aber nun kam er wenigstens wirklich. Clairons Hände waren warm, doch sein Körper begann zu erstarren.
Zart hob er die Waffe an. Durch das Zielfernrohr glitt sein Blick von der Nummerntafel des Wagens über den Kühler und die Kühlerhaube bis zur Windschutzscheibe. Ihr Glas spiegelte so stark, daß Clairon überhaupt nichts erkennen konnte.
Der Mercedes fuhr im Schritt, der Glätte wegen zweifellos, und dann suchte Aranda gewiß den richtigen Weg, der von der Allee fort in die Gruppe 74 hinein und zu jenem Grab führte. Die kleinen Schilder hier waren alle im Schnee versunken. Aranda würde es schwer haben, und das war gut so. Der Lauf der 98 k wanderte weiter, Millimeter um Millimeter. Mit der Engelzehe als Drehpunkt ließ er sich leicht führen.
In der Ferne erklang wieder dumpfes Brausen.
Clairon hatte das, was nun kam, schon viele Male erlebt, seit er sich hier aufhielt. Kurz blickte er auf die Armbanduhr.
14 Uhr 45.
Diesmal ist es PAN AMERICAN751 nach Rom, Beirut, Karatschi, Kalkutta und Hongkong, dachte er automatisch. Rollt eben an. Südöstlich, nicht allzuweit entfernt, liegt der internationale Großflughafen Schwechat. Alle startenden Maschinen überqueren den Friedhof. Ihr Lärm macht jedes andere Geräusch unhörbar, also auch das eines Schusses. Die Krähen verstummen, wenn die Flugzeuge über sie hinwegrasen. Daß die Ausflugsschneise derart günstig lag, hatte sogar den hochgradig nervösen und ernsten Chef fröhlicher gestimmt. Im Reisebüro gab es Flugpläne. Clairons bemerkenswertes Gehirn speicherte seit gestern abend Zeiten und Flugziele, Typen und Gesellschaften aller Maschinen, die zwischen 12 und 17 Uhr an diesem Tag starteten und landeten. Das da zum Beispiel war eine Boeing 707. In einer Minute wird sie hier sein, dachte Clairon. Vielleicht ist Manuel Aranda dann schon aus seinem Wagen gestiegen. Enormes Glück natürlich, wenn es gleich beim ersten Versuch klappt. Näher kam der Mercedes, immer näher. Lauter schwoll das Toben der Düsen an, immer lauter. Ihr Dröhnen nahm beständig zu, es wurde ungeheuer stark, denn die niedere Wolkendecke wirkte wie eine Echokammer. Nun begann die Luft zu vibrieren, Clairon konnte es fühlen. Er preßte sich gegen die Rückseite des großen Grabsteins. Der vibrierte nicht.
Von den Zweigen der Bäume, von den Grabhügeln stäubten Schneewolken auf, von den Ästen fielen ganze Brocken. Nun kam die Boeing, nun würde sie sofort über dem Friedhof sein. Man konnte sie nicht sehen, die Wolken hingen zu tief. Der Mercedes blieb stehen. Gott sei gepriesen, dachte Clairon.
Die unsichtbare Boeing röhrte, heulte und kreischte. Sie jaulte und donnerte und schien jeden Moment explodieren zu wollen. So wurde der Frieden dieser riesigen Stätte des Todes immer wieder zerstört, von halb sechs Uhr früh bis lange nach Mitternacht.
Dem weinenden Engel fiel ein Klumpen Schnee vom Haupt.
Clairons Augen verengten sich zu Schlitzen. Eine unmenschliche Ruhe, die er in solchen Momenten stets erlebte, überkam ihn. Da drüben, etwa 110 Meter entfernt, stand der Mercedes. Clairon hob den Lauf um eine Winzigkeit seitlich rechts empor und berücksichtigte dabei die geringere Entfernung. Jetzt sah er das Fenster des linken vorderen Wagenschlags im Zielfernrohr.
Steig aus, dachte Clairon. Steig nun schön aus, mein Freund. Nicht zu langsam, nicht zu schnell. Und bleib stehen, ein Augenblick genügt. Ich habe wahrhaft Glück, dachte Clairon, in zitternder Luft, im Höllenlärm der Düsen. Dieser Manuel Aranda, den ich nicht kenne, von dem ich nichts weiß, dieser Mann, den ich töten muß, wird es gleich hinter sich haben. Und ich auch. Komm heraus, Mann, dachte Clairon, komm nun heraus.
Der Wagenschlag öffnete sich. Eine Gestalt wurde sichtbar. Es war kein Mann. Es war eine Frau.
4
»Wie heißt die Tote?«
»Steinfeld.«
»Valerie Steinfeld?«
»Sie kennen den Namen?«
»Na, hören Sie! Hat doch oft genug in den Zeitungen gestanden. Ich hab alles gelesen. Im ›Kurier‹ und im ›Express‹ und in der ›Kronenzeitung‹. Eine unheimliche Geschichte ist das. Kein Mensch weiß …«
»Wo liegt das Grab?« fragte Manuel Aranda ungeduldig. Er war groß und schlank und sah auf den Pförtner herab. Der Pförtner war klein und alt. Er trug eine dunkle Uniform, eine Tellerkappe und einen nikotinverfärbten Walroßschnurrbart. Er tat beim Haupteingang Dienst.
In der Mauer neben der rechten Portalseite befand sich eine Loge, die Tür stand offen. Aranda sah einen Tisch, zwei Stühle, ein Telefon, ein Wandbord mit vielen Schlüsseln und Steckuhren für die Nachtwachleute. Auf dem Zementboden schmolz Schnee zu Dreck. Von der Decke hing eine kahle elektrische Birne herab und erhellte die Loge, deren Wände schwarz und grünlich verfärbt waren. Auf dem Tisch erblickte Aranda eine halbgeleerte Flasche Bier, daneben lagen Brot und Wurst. Teilchen von beiden fanden sich in des Pförtners gelblichem Schnurrbart.
»Sind Sie von der Polizei?« Der kleine Mann blinzelte Aranda an. Sein spitzes Gesicht war sehr weiß, die Ohren und die Nase waren gerötet, auch die Augen. Er sprach ein wenig schwerfällig. Aranda überlegte, ob sich wohl Bier in der Bierflasche befand.
»Nein«, sagte er. »Ich bin nicht von der Polizei.«
»Aber ein Ausländer sind Sie! So eine braune Haut! Und dann der Akzent. Obwohl der Herr sehr gut deutsch sprechen.« Der Pförtner legte den Kopf schief. »Vielleicht ein Verwandter von der Frau Steinfeld?«
»Auch kein Verwandter!« sagte Aranda sehr laut, während er die Fäuste in den Taschen seines Kamelhaarmantels ballte.
»Pardon«, brummte der Pförtner gekränkt. »Man interessiert sich halt. Gerade bei so einem Fall …«
»Das Grab! Wo liegt das Grab?«
»Ja, also auswendig weiß ich das leider nicht. Bestattet worden ist sie vorgestern, gelt?«
»Am Dienstag, ja.«
»Ich ruf die Verwaltung an, warten Sie.« Der Pförtner ging in die Loge. Manuel Aranda wartete. Im Ausschnitt des Kamelhaarmantels steckte ein breiter Kaschmirschal. Er trug halbhohe, pelzgefütterte Schuhe, Handschuhe, eine braune Persianermütze. Er fröstelte. In der Tat, tief sonnengebräunt war das ovale Gesicht. Aranda hatte graue Augen, eine ebenmäßige Nase und volle, in der Kälte bläulich verfärbte Lippen. Er machte den Eindruck eines Mannes, der vollkommen erschüttert und verwirrt, von Ängsten und Zorn erfüllt ist. Er war sechsundzwanzig Jahre alt.
In seiner Loge erregte sich der Pförtner lauthals am Telefon.
»Was ist denn das für ein Sauladen, den ihr da habt? Va – le – rie Stein – feld! Vorgestern! Ihr werdet doch, Gott behüte, noch wissen, wo die Steinfeld liegt!« Er streichelte seine Flasche.
Hysterisch klingelnd fuhr eine rot-weiße Straßenbahn die Simmeringer Hauptstraße hinab, an deren westlicher Seite sich, viele Kilometer lang, die hohe Mauer des Friedhofs erstreckt. Ein Pferdefuhrwerk war auf die Schienen geraten und schlitterte hin und her. Der Kutscher schlug die starken Rösser, die mit ihren Hufen auf dem eisigen Pflaster ausglitten. Funken stoben. Auch am Rand der Straße türmten sich Berge von Schnee, doch hier war er schmutzig, braun, grau und schwarz. Der Kutscher bekam sein schweres Gespann endlich von den Schienen. Die Tiere hielten, erschöpft keuchend.
Manuel Aranda fühlte, wie ihn eine Welle der Benommenheit überkam. Dieses Schwindelgefühl empfand er immer wieder, seit er in Wien war. Es ging stets rasch vorbei. Aber es vermittelte Aranda jedesmal das Gefühl größter Verlassenheit, Hilflosigkeit und ohnmächtiger Wut. Er kam sich vor wie ein Mensch nahe dem Ausbruch einer schweren Krankheit. Er mußte an einen Irrgarten denken, in den er weiter und weiter hineintaumelte, mit jeder neuen Minute, wie in einen endlosen Tunnel, in immer größere Finsternis und Kälte. Es war das Geheimnis, das ihn schwach und elend machte, dachte er, dieses Geheimnis …
Er wandte den Kopf, wobei sich sein Schwindelgefühl kurz, aber jäh verstärkte, und sah den blauen Mercedes, den er nach seiner Ankunft in Wien gemietet hatte und der wenige Schritte von ihm entfernt parkte. Rechts vom Haupttor, an der Friedhofsmauer, stand eine lange Reihe sauberer kleiner Hütten. Vor ihnen waren Kränze mit Natur- und Kunstblumen ausgebreitet, Gebinde, alle Arten von Kerzen, Kerzenhaltern, Windgläsern, Kupferkannen und Kupfertöpfen. Jenseits der Straße, in dunstverhangenen Feldern, lagen Gärtnereien. Den Besitzern gehörten wohl diese Geschäfte, die trotz Kälte und Winter geöffnet waren. Vermummte Männer und Frauen standen davor.
Der Portier erboste sich immer noch am Telefon.
»Eine Affenschande ist das! Der Herr wartet! Dann suchen Sie die Karteikarte. Die kann ja nicht verschwunden sein!«
Rasselnd, mit kreischenden Bremsen, kam nun ein Straßenbahnzug aus der Gegenrichtung vor dem Haupttor zum Stehen. Aranda las, was auf den Reklametafeln stand, welche Triebwagen und Anhänger an ihren Dächern trugen:
SCHWECHATER – RECHT HAT ER!
Die Bahn setzte sich ratternd wieder in Bewegung. Was ist SCHWECHATER? überlegte Aranda. Wie weit von Buenos Aires bin ich entfernt? Fliegen Sie zurück, hat der Hofrat gesagt. Aber ich fliege nicht zurück. Auf keinen Fall. Das habe ich ihm klargemacht. Da gab er dann nach. Ich muß wissen, wie es geschehen ist, warum sie es getan hat, wer ihr den Auftrag …
»Sie, Herr!«
Aranda drehte sich schnell um, und da waren wieder das Schwindelgefühl und die Angst, zu stürzen. Der alte, gutmütige Portier stand im Eingang seiner Loge.
»Ich hab Sie schon zweimal …« Er schluckte. »Ist Ihnen nicht gut? Sie schauen so blaß aus. Wollen Sie einen Schnaps?«
»Nein, danke. Nun?«
»Jetzt weiß ich es.« Der Pförtner blinzelte, seine geröteten Augen tränten. »Die Frau Steinfeld liegt im Abschnitt F 74. Wie sie begraben worden ist, vorgestern, da haben sie da sicherlich den Schnee weggeschaufelt, daß man hat gehen können. Aber was ist inzwischen heruntergekommen! Allein letzte Nacht! Da wird alles wieder dick zugeschneit sein, ganz bestimmt! F 74, das liegt aber ganz weit draußen, schon fast am anderen Ende. Laufen tun Sie da glatt eine halbe Stunde.«
»Ich habe einen Wagen. Darf man …«
»Nur auf den Hauptalleen! Kostet aber fünf Schilling.«
Aranda legte einen 20-Schilling-Schein in die ausgestreckte Hand des Mannes.
»Ich danke, Herr Baron!« Der Pförtner riß einen Zettel von einem Block. »Hinten sind die Gruppen aufgedruckt.« Er sprach Aranda jetzt direkt ins Gesicht. Also doch kein Bier in der Flasche, dachte dieser und trat etwas zurück. »Wenn Sie bei der 74er ankommen – entschuldigen Sie einen Moment, bittschön!« Des Pförtners Gesicht hatte sich plötzlich erhellt, während er an Aranda vorbeiblickte. Seine Stimme wurde heiter: »Endlich! Ich hab mir direkt schon Sorgen gemacht!«
»Zuerst konnte ich nicht rechtzeitig weg, und dann ist zwei Kilometer von hier plötzlich mein Wagen stehengeblieben«, sagte eine weibliche Stimme.
Manuel Aranda wandte den Kopf diesmal langsamer, um das Schwindelgefühl zu vermeiden. Hinter ihm stand eine Frau von etwa dreißig Jahren und seiner Größe. Aranda sah ein ebenmäßiges, ernstes Gesicht, eine kleine Nase und einen schönen Mund. Das Haar, das unter einem fest geknüpften Kopftuch hervorschaute, war kastanienbraun. Die junge Frau hatte zu viel Puder und Schminke aufgelegt. Sie trug eine sehr große dunkle Brille mit runden Fassungen. Ihre Augen blieben dadurch unsichtbar. Stiefel und Mantel waren aus Seehundfell.
»Guten Tag«, sagte die junge Frau. Aranda verbeugte sich stumm.
»Was war denn mit dem Auto?« forschte der Pförtner. Die junge Frau erfreute sich seiner Sympathie. Er empfand Verbundenheit mit ihr. Vor zwei Tagen war sie, unter einem Schwächeanfall taumelnd, in seine Loge gekommen und hatte um ein Glas Wasser gebeten. Sie wollte irgendein stärkendes Medikament schlucken, das sie bei sich trug, und während sie danach ein paar Minuten wartete, bis ihr besser wurde, hatte sie sich mit ihm unterhalten.
»Die Benzinpumpe«, antwortete sie jetzt. »Ihre Membran ist brüchig geworden in der Kälte. Also mußte ich den Wagen abschleppen lassen. Das dauert vielleicht eine Ewigkeit, bis jemand hier herauskommt! Dann habe ich die Elektrische genommen.« Die junge Frau hob die Schultern und wies mit dem Kinn zur anderen Straßenseite. »Aber jetzt hat der Steinmetz drüben geschlossen. Auf einer Tafel steht, man soll hier nachfragen.«
Der Rotnasige dienerte eifrig.
»Hat in die Stadt müssen, der Herr Ebelseder. Aber hat es mir herübergebracht für den Fall, daß Sie doch noch kommen. Bezahlt haben Sie es schon, sagt er.« Der Pförtner stockte. »Ja, nur zum Tragen ist es doch viel zu schwer – den weiten Weg, meine ich.«
»Ich nehme ein Taxi. Da drüben stehen ein paar.«
»Das geht natürlich …« Des Pförtners zerfurchtes Gesicht erhellte sich neuerlich. »Oder aber der Herr ist so freundlich und nimmt Sie mit. Der will nämlich auch hin.«
»Wohin?« Die Stimme der jungen Frau klang plötzlich brüchig.
»Na, zu Ihrem Grab! Kurios ist das, also wirklich! Kennen sich die Herrschaften vielleicht?«
Die junge Frau musterte Manuel Aranda durch die dunklen Brillengläser. »Nein«, sagte sie, doch ein banger Ton schwang in ihrer Stimme. Plötzlich fühlte Aranda Erregung und Neugier.
»Sie sind Irene Waldegg«, sagte er.
»Woher wissen …« Sie brach ab. Er sah, wie sich der schöne Mund hart schloß.
»Man hat mir Fotos gezeigt.«
»Die Polizei?«
»Wer sonst«, antwortete er kurz.
Sie starrte ihn an.
Er sagte aggressiv: »Ich bin Manuel Aranda. Der Name ist Ihnen doch bekannt?«
»Ja«, sagte Irene Waldegg. Danach sahen sie einander an wie Feinde. Dem Pförtner entging das.
»Da haben wir es!« freute er sich. »Jetzt kennen die Herrschaften sich doch! Ich hab das Ding drinnen. Ich …«
Dreimal nacheinander, kurz und schnell, ertönte ein Hupsignal. Vor der Einfahrt zum Friedhof hielt ein großer, weißer Lincoln mit blaugetönten Fensterscheiben. Der Mann am Steuer hatte ein viereckiges Gesicht, einen breiten Unterkiefer, Sommersprossen, und sein blondes Haar war zu einer Igelfrisur geschoren. Über die Stirn lief eine kurze, wulstige Narbe. Der Mann trug einen rostbraunen Dufflecoat. Er winkte ungeduldig den Pförtner herbei und hielt ihm einen Hundertschillingschein hin.
»Schnell«, sagte der Igelkopf. »Machen Sie schnell!« Er sprach mit amerikanischem Akzent. Seine Zähne waren groß, weiß und unregelmäßig, er biß auf einem Kaugummi herum, während er wartete.
Irene Waldegg und Manuel Aranda sahen einander immer noch an. Menschen gingen an ihnen vorbei, sie bemerkten es nicht. Ein Flugzeug dröhnte über ihre Köpfe hinweg, niedrig, knapp nach dem Start schon in den Wolken, mit tobenden Düsen. Die Luft zitterte. Sie sahen sich an, der junge Mann und die junge Frau. Der Lärm ließ nach. Die Frau sagte etwas.
»Wie bitte?« Er hatte nicht verstanden.
Sie wiederholte: »Ein seltsamer Ort für ein Zusammentreffen.«
»Ich habe ihn nicht gewählt.«
»Ich auch nicht«, sagte Irene Waldegg, und ihre Lippen zuckten plötzlich, als wollte sie weinen.
»Aber natürlich wußten Sie, daß ich in Wien bin.«
»Natürlich. Schauen Sie mich nicht so an!« rief sie erregt. »Ich habe keine Schuld daran!«
»Was weiß ich?« sagte Manuel Aranda.
»Was soll das heißen?« Ihre Stimme hob sich empört.
»Das soll heißen, daß ich gar nichts weiß«, antwortete er.
Irene Waldegg fragte heftig: »Warum haben Sie mich nicht angerufen? Warum sind Sie nicht zu mir gekommen? Wie lange halten Sie sich schon in Wien auf?«
»Zwei Tage.«
»Also! Warum nicht?«
»Ich hatte viel zu tun, um die Leiche freizubekommen. So viel Formalitäten. Ich habe noch keine Zeit gefunden.«
Endlich hatte der Pförtner gewechselt. Der Mann am Steuer des weißen Lincolns trat auf das Gaspedal. Sein Wagen schoß mit wimmernden Pneus in den Friedhof hinein.
»Zwölf Kilometer Höchstgeschwindigkeit!« schrie ihm der Pförtner empört nach. Er kam zurück. »Leute gibt’s!« knurrte er. »Und keinen Groschen Trinkgeld. So, jetzt hol ich es Ihnen aber endlich, Fräulein.« Er verschwand in seiner Loge.
»Keine Zeit«, sagte die Frau mit den Seehundstiefeln und dem Seehundmantel bitter. »Aber Zeit, hier herauszukommen, die haben Sie.«
»Ich will das Grab sehen.«
»Warum?«
»Weil …« Er brach ab, verspürte wieder Schwäche, Einsamkeit, Trauer.
»Ich will jetzt alles sehen, was damit zusammenhängt. Ich will jetzt mit allen Menschen reden, mit allen, die damit zu tun hatten.«
»Nur mit mir nicht!« Irene Waldeggs Stimme klang aggressiv.
»Ich wäre auch zu Ihnen gekommen«, antwortete er ebenso aggressiv. »Verlassen Sie sich darauf!«
»Ich bin keine Verbrecherin«, sagte sie laut. »Sie waren bei der Polizei. Bei Hofrat Groll.«
»Ja. Und?«
»Und sagt Groll, daß ich eine Verbrecherin bin?«
»Nein.«
»Daß ich Schuld daran habe?«
»Nein.«
»Daß er mich verdächtigt?«
Verflucht, dachte Aranda, was soll das? Wer hat denn hier ein Recht auf einen solchen Ton? Sie oder ich? Ach, wir beide! Ich muß achtgeben, dachte Aranda, daß mein Haß mich nicht um meinen Verstand bringt. Er sprach ruhiger: »Der Hofrat sagte nicht das geringste gegen Sie. Aber trotzdem, Sie müssen doch verstehen …«
Irene Waldegg unterbrach ihn verbissen: »Ich verstehe schon. Aber trotzdem! Aber trotzdem kann man mir natürlich nicht trauen! Gerade mir nicht. Ich bin Apothekerin! Wie leicht komme ich an Gift heran! Ich bin belastet. Schwer belastet! Mit mir kann man nicht so einfach reden. Über mich muß man erst Erkundigungen einholen, mich bespitzeln lassen, sehen, ob ich nicht doch mitschuldig bin!«
»Das habe ich nicht gesagt!«
»Aber gedacht! Ich will Ihnen sagen, was ich denke. Ich denke, daß Ihr Betragen sehr ungehörig ist, Herr Aranda. Sie sind nicht der einzige, der einen schweren Verlust erlitten hat.«
Strahlend kam der Pförtner aus seiner Loge. Er lärmte geschwätzig: »Da hätten wir es, Fräulein! Alles in Ordnung? So, wie Sie es haben wollten? Ich find ja, er hat es sehr schön gemacht, der Herr Ebelseder, richtig künstlerisch! Und es wäre auch noch zur Bestattung fertig geworden, wenn Sie ihm rechtzeitig Bescheid gesagt hätten, sagt er.« Der Pförtner überreichte Irene Waldegg ein Gebilde aus Schmiedeeisen, das aussah wie ein leicht geöffneter Zirkel von etwa einem halben Meter Größe, mit einem breiten Querstab am spitzen Ende. Zwei Metallschenkel trafen sich oberhalb des Querstabes an der Kante eines kleinen Metallrahmens, hinter dem unter Glas schwarzumrandetes und schwarzbedrucktes Papier steckte. Der rotnasige, rotohrige Pförtner äußerte: »Das Holzkreuz auf dem Gab nehmen Sie einfach heraus, Fräulein, und werfen es in einen Abfallkorb. Stehen genug herum. Und das da müssen Sie in die Erde stoßen. Mit aller Kraft. So tief es geht. Nachher hält es schön ins Frühjahr, bis daß man den Stein setzen kann.«
Irene Waldegg nahm den großen schwarzen Zirkel mit beiden Händen. Aranda las, was auf dem Pate-Zettel stand:
VALERIE STEINFELD
6. MÄRZ 1904 – 9. JANUAR 1969
Darunter war noch ein Kreuz gedruckt.
»Eishart die Erde, natürlich. Aber jetzt, wo Sie den Herrn Bekannten getroffen haben, wird der Ihnen ja helfen. Ich meine …« Der Pförtner war irritiert. »Hab ich was Falsches gesagt? Soll ich doch lieber ein Taxi …«
»Nein!« Aranda sprach laut und schnell. »Kein Taxi.« Er wandte sich an Irene Waldegg. »Vergeben Sie mir mein Benehmen, bitte. Fahren wir zusammen. Ich … ich muß Sie vieles fragen …«
Sie stand stumm da, eine pathetische Gestalt mit dem Eisengebilde in den Händen und den großen, dunklen Gläsern vor den Augen. Endlich nickte sie.
Der Pförtner kam in Bewegung.
»Ich helfe Ihnen!«
Schnell nahm er Irene Waldegg die provisorische Grabtafel ab und eilte zu Arandas Wagen. Er schwankte, aber nur wenig. Die beiden jungen Menschen gingen ihm nach.
Der Pförtner verstaute den großen Zirkel im Fond des Mercedes. Aranda fragte Irene Waldegg: »Was für einen Wagen fahren Sie?«
»Auch einen Mercedes. Allerdings eine andere Type.«
»Wollen Sie dann nicht lieber ans Steuer? Ich finde mich hier doch nie zurecht.«
»Meinetwegen.« Irene Waldegg hob eine Hand nach der großen Brille, als wollte sie diese abnehmen, dann ließ sie die Hand wieder sinken und glitt hinter das Lenkrad des Mietwagens. Der Pförtner schloß den Schlag. Er folgte Aranda um den Mercedes herum zur anderen Seite.
»Alles in Ordnung mit dem Fräulein?« fragte er leise.
»Alles«, sagte Aranda.
»Ist ihr wohl sehr nahegegangen.«
»Natürlich.«
»Ja, der Tod«, sagte der Pförtner gemütvoll und steckte mit einer tiefen Verbeugung den zweiten Geldschein ein, den Aranda ihm reichte. Dann warf er die Wagentür zu und zog die Kappe. Dabei stellte sich heraus, daß er vollkommen kahl war.
Irene Waldegg fuhr langsam an.
Der Wagen rollte in die breite Allee hinein, die zur Dr.Karl Lueger-Kirche führt. Er holperte über Eisschwellen. Irene Waldegg sah starr geradeaus.
»Es muß einen Grund geben!« sagte Aranda.
»Es gibt keinen.«
»Wir kennen ihn nicht. Noch nicht! Hofrat Groll behauptet, Ihre Tante war geistig völlig normal.«
»Völlig!«
»Nun«, sagte Manuel Aranda, »dann muß es natürlich einen Grund dafür geben, warum Valerie Steinfeld meinen Vater vergiftet hat.«
5
Die Krähen schrien, die Krähen kreischten, die Krähen krächzten.
»Nichts«, sagte Irene Waldegg, den Wagen langsam und vorsichtig lenkend. »Nichts, nichts gibt es! Man kann den Verstand verlieren, wenn man immer wieder daran denkt. Ich finde keine Erklärung, kein Motiv. Nicht das abwegigste, nicht das unwahrscheinlichste. Es ist alles ganz unwirklich …«
»Aber Valerie Steinfeld ist tot«, sagte Manuel Aranda. »Und mein Vater ist tot. Das ist nicht unwirklich. Das ist die Wirklichkeit! Valerie Steinfeld hat meinen Vater vergiftet. Dann hat sie selber Gift genommen. Nach Ansicht der Polizei gibt es darüber keinen noch so geringen Zweifel.«
Irene Waldegg sagte: »Der Hofrat Groll ist ein kluger, erfahrener Mann. Und es sind ausgesuchte Spezialisten, die mit ihm arbeiten. Hat Groll Ihnen ein Motiv nennen können? Einen Grund? Ach, Grund! Den kleinsten Anhaltspunkt nur?«
Vorsicht, dachte Aranda. Ich habe dem Hofrat mein Ehrenwort gegeben, darüber zu schweigen.
Aranda hatte sich in der kurzen Zeit seines Wiener Aufenthalts lange und mehrmals mit dem hohen Polizeibeamten unterhalten. Er wußte vieles über viele Menschen.
Ich weiß eine Menge, wovon du nichts ahnst, dachte Aranda, die junge Frau von der Seite betrachtend. Aber ich werde dir nichts davon verraten. Ich wäre ein Schuft, wenn ich es täte, denn der Hofrat vertraut mir. Ich vertraue dir nicht, ich wäre verrückt, wenn ich einem von euch vertraute!
»Nein, nicht den kleinsten Anhaltspunkt«, log Manuel Aranda.
Irene Waldegg fuhr um den runden Platz vor der Kirche. Vom tiefverschneiten Dach und von allen Mauervorsprüngen hingen schwere Eiszapfen herab. Die junge Frau bog in eine Allee ein, die nach Südwesten führte.
»Seit wann kennen Sie den Hofrat Groll?« fragte Aranda.
»Seit … jenem Abend. Er ließ mich von seinen Männern holen und in die Buchhandlung bringen – damit ich meine Tante identifizierte, und zu einem ersten Verhör.« Irene Waldegg hob die Schultern. Sie schauderte. »Es war furchtbar. Die beiden sahen entsetzlich aus. Das Gift hatte …«
»Schon gut«, sagte er. »Aber Sie konnten Ihre Tante identifizieren.«
»Sofort.«
»Und meinen Vater?«
»Ich habe Ihren Vater nicht gekannt, Herr Aranda!«
»Sind Sie sicher?«
»Vollkommen sicher.« Wenn sie log, war sie die geborene Lügnerin.
»Hat Ihre Tante jemals seinen Namen erwähnt?«
»Niemals. Da bin ich auch ganz sicher. Ich sage Ihnen ja, es ist zum Verrücktwerden!« Ja, du sagst es, dachte er. Ein wenig zu häufig sagst du es.
»Sie haben mit Frau Steinfeld zusammengelebt?« Aranda sah Irene Waldegg noch immer an. Ein schönes Gesicht. Ein offenes Gesicht. Aber ich kann die Augen nicht sehen, dachte er. Was für Augen hat diese Frau? »Ich glaube, ich hätte doch ein Taxi nehmen sollen«, sagte diese Frau ruhig.
»Was heißt das?«
»Das heißt, daß ich genug von diesen Fragen habe. Sie wissen doch genau Bescheid! Der Hofrat hat Ihnen doch alles gesagt! Meinen Sie, Sie könnten mich bei einer Lüge ertappen? Sie halten mich für schuldig, immer noch. Ich nahm Ihre Entschuldigung vorhin ernst – leider.«
So geht das nicht, dachte er. Diese Frau ist keine Idiotin. Ich, ich bin es, der sich wie ein Idiot benimmt. Er sagte: »Die Entschuldigung war ernst gemeint, wirklich. Ich bin nur völlig kopflos und ratlos. Ich … ich werde Ihnen sagen, was ich weiß, was der Hofrat mir erzählt hat! Sie haben mit Frau Steinfeld zusammengewohnt, Ihrer Tante, ja! In der Wohnung von Frau Steinfeld in der … den Straßennamen habe ich vergessen.«
»Gentzgasse.«
»Gentzgasse, richtig. Sie sind Apothekerin. Die Möven-Apotheke in der Lazarettgasse gehört Ihnen. Sie haben da zuerst bei Ihrem Onkel gearbeitet, und als der vor drei Jahren starb, erbten Sie das Geschäft.« Das ist der bessere Weg, dachte Aranda. Sie darf nicht von vornherein meine Feindin sein. Sonst komme ich niemals weiter. Sie sitzt schon nicht mehr so verkrampft da, ihr Gesicht ist schon etwas weicher geworden.
»Sie haben Spikes an den Rädern, nicht wahr?« fragte Irene Waldegg.
»Ja.« Er runzelte irritiert die Brauen und fuhr fort. »Frau Steinfeld war nicht Ihre einzige Verwandte. Das weiß ich auch. Ihre Eltern leben im Süden Österreichs, in …«
»Villach«, sagte sie. »Das liegt in Kärnten. Ich bin nach Wien gekommen, um hier zu studieren.«
»Ja, das hat mir der Hofrat erzählt. Und Frau Steinfeld hat in dieser Buchhandlung Landau in der Seilergasse gearbeitet.«
»Waren Sie schon dort?«
»Ich war noch bei niemandem. Keine Zeit, das sagte ich doch. Ich wollte heute noch hingehen. Aber zu allererst wollte ich das Grab von Frau Steinfeld sehen.«
Irene Waldegg sagte: »Den Buchhändler Martin Landau und seine Schwester hat der Hofrat auch gleich noch am Abend rufen lassen. Auch die beiden hatten Ihren Vater niemals zuvor gesehen und seinen Namen niemals zuvor von meiner Tante oder sonst jemandem gehört. Das ist Ihnen bekannt, nicht wahr?«
»Ja, das ist mir bekannt. Können wir … können wir nicht ein wenig freundlicher miteinander sprechen, Fräulein Waldegg? Sie sehen doch, ich gebe mir Mühe, mich zu beherrschen, gerecht zu sein, freundlich …« Sie antwortete nicht. Aber sie nickte kurz.
»Ich weiß, daß Ihre Tante schon lange in dieser Buchhandlung gearbeitet hat. Wie lange? Das weiß ich nicht, wirklich nicht.«
»Eine Ewigkeit.« Zum erstenmal klang ihre Stimme weicher. »Sie war dort schon angestellt, als ich geboren wurde. Ich bin einunddreißig. Seit 1938 hat Valerie da gearbeitet.«
»Valerie?«
»Ich nannte sie nur Valerie. Sie hatte das lieber. Sie meinte, es macht sie jünger.« Irene Waldegg bog in eine neue Allee ein. Hier war kein Mensch mehr zu erblicken. Die neue Allee lief geradeaus. »Zuerst war Valerie als Verkäuferin angestellt, glaube ich, dann, nach dem Krieg, als Erste Verkäuferin, und seit zwölf Jahren als Prokuristin.«
»Und an dem Tag, an dem es passierte, was war da?«
Irene Waldegg schaltete einen Gang zurück, denn eine große Fläche Glatteis lag vor ihnen. Die junge Frau schwieg, und sofort flackerte wieder Mißtrauen, Argwohn in Aranda auf. Legte sie sich eine gute Lüge zurecht, endlich eine Lüge, wie?
»Nun!«
»An dem Tag, an dem es passierte …« Irene Waldegg brach ab.
»Ja! Heute vor einer Woche!«
Sie sprach mit Mühe ruhig: »Wir gingen am Morgen gemeinsam aus dem Haus, Valerie und ich. Wir sind immer gemeinsam gegangen. Ich brachte sie mit dem Wagen in die Buchhandlung, bevor ich zur Apotheke fuhr.« Sie bemerkte nicht, wie sie plötzlich in der Gegenwart sprach: »Das geht schon so, seit ich den Wagen besitze, jahrelang. Nur immer dann nicht, wenn ich Nachtdienst habe. Morgen zum Beispiel.«
»Morgen was?«
»Heute habe ich Nachtdienst. Da kann ich Valerie morgen früh nicht in die Buch …« Irene Waldegg brach ab. »Schrecklich«, sagte sie. »Ich habe mich noch nicht daran gewöhnt, daß sie tot ist.« Sie fuhr sich mit einer Hand über die Stirn. Die Geste rührte Aranda. Diese Frau hat einen Menschen verloren – genau wie ich, dachte er. Sie ist verzweifelt – genau wie ich. Ratlos, verwirrt, angsterfüllt, zornerfüllt – wie ich. Nein, das ist kein Theater, das sie mir vorspielt. Vielleicht habe ich einen Menschen gefunden in dieser Stadt des Zwielichts, die eine der schönsten Städte der Welt ist, einen Menschen unter Millionen, dem ich doch vertrauen darf?
»Valerie war so lustig an dem Morgen«, sagte jener Mensch.
»Warum?«
»Sie hatte einen Farbfernseher gewonnen. Beim Preisausschreiben einer Zeitung. Sie machte immer alle Preisausschreiben mit – solange ich zurückdenken kann. Sie sagte: Einmal hat jeder Mensch Glück.«
»Einmal hat jeder Mensch Glück«, wiederholte er laut. »Das hat Frau Steinfeld bei einer anderen Gelegenheit auch gesagt. Bei einer ganz anderen Gelegenheit.«
Wieder schauderte sie.
»Ja, ich weiß.«
»Weiter«, sagte er. »Erzählen Sie weiter.«
Sie begann leise: »Niemals gewann sie etwas. Aber an diesem Tag – ich meine, am Abend vorher, als sie heimkam – lag ein Brief von dieser Zeitung da. Eine Benachrichtigung, daß sie gewonnen hätte. Valerie sah so gern fern …« Irene Waldegg sagte verloren: »Inzwischen ist der Apparat gekommen. Ein sehr schönes Modell …« Wieder bog sie ab. Die Landschaft wurde immer gespenstischer, die Schneeberge zu beiden Seiten der Allee wuchsen höher und höher an.
Aranda sagte: »Ihre Tante ist nicht mehr heimgekommen an jenem Abend. Hat Sie das nicht beunruhigt?«
»Zuerst nicht. Sie kam häufig später – es war oft noch viel zu tun nach Geschäftsschluß. Natürlich, als es neun wurde, machte ich mir Sorgen. Das Wetter war so schlecht. Schneesturm. Ich dachte an einen Unfall. Und ich wollte eben in der Buchhandlung anrufen, da klingelte es … Die Kriminalbeamten kamen, um mich zu holen.«
»Sie haben also nicht mehr mit Ihrer Tante telefoniert.«
»Nein.«
»Aber Valerie Steinfeld, die hat telefoniert.«
»Ja«, antwortete Irene Waldegg leise. »Ich habe das Gespräch gehört.«
»Ich auch«, sagte Manuel Aranda. »Dreimal.«
6
»Getötet! … Getötet habe ich ihn! … Kapsel … mit der Kapsel … da liegt er jetzt! … Einmal … hat jeder Mensch Glück …«
Stammelnd erklang die Frauenstimme, lallend, Pausen lagen zwischen den teils herausgeschrienen, teils geflüsterten Worten.
Der Hofrat Wolfgang Groll drückte auf eine Taste des Magnetophons, das auf einem kleinen Tischchen stand. Die Bandteller hielten an. Aus dem Lautsprecher des Geräts erklang nur das Summen des elektrischen Stroms. Ein magisches Auge glühte grün.
Der Hofrat Groll sagte: »Das ist die Stimme von Frau Valerie Steinfeld.
Drei Zeugen haben sie wiedererkannt und sind bereit, das zu beschwören, Herr Aranda.«
»Wie ist es zu dieser Aufnahme gekommen?« fragte Manuel. Er trug einen dunkelblauen Anzug, ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte. Seit eineinhalb Stunden saß er im Arbeitszimmer des Hofrats Groll vom Sicherheitsbüro der Polizeidirektion Wien. Groll, den Aranda aus zahlreichen Fernschreiben an die Polizeidirektion in Buenos Aires und von zwei Transatlantik-Telefonaten her kannte, war in den letzten eineinhalb Stunden noch einmal im Detail auf das rätselhafte Verbrechen eingegangen. Er hatte Aranda alles erzählt, was geschehen war. Er hatte die Namen der anderen Menschen genannt, die mit dem Fall – als Verwandte oder Zeugen – in Verbindung standen. Er hatte sie genau beschrieben. Dem Hofrat Groll war Manuel Aranda sofort sympathisch gewesen; er betrachtete den hektisch erregten und dabei todmüden jungen Menschen voller Besorgnis. Eine Uhr zeigte fast Mitternacht.
Um 21 Uhr 50 war Aranda in Wien gelandet. Ein Taxi hatte ihn zu dem Luxushotel ›Ritz‹ am Kärntner-Ring gebracht, in dem sein Vater abgestiegen war.
Die Eingangshalle des ›Ritz‹ erstrahlte im Licht von drei mächtigen Kristallüstern. Marmorsäulen glänzten, an den mit Palisanderholz verkleideten Wänden hingen alte Gobelins. Aus Marmorplatten bestand der Boden, auf dem kostbare Teppiche lagen. Hinter der Eingangshalle befand sich eine zweite, noch größere. Dort gab es Club-Garnituren, Schreibecken, weitere Lüster, Stehlampen mit schweren Seidenschirmen und ein Podium, auf dem ein Fünf-Mann-Orchester leise Evergreens spielte.
Links vom Eingang befand sich die Theke des Portiers, rechts die der Reception. Bei ihr arbeiteten drei Angestellte, auf der anderen Seite drei Portiers. Aranda, dessen Taxi wartete, ging zur Reception. Ein Mann von etwa fünfundvierzig Jahren eilte ihm entgegen.
»Señor Manuel Aranda?«
»Si.«
»Bienvenido en Viena, Señor Aranda!«
Aus dem offenen, großen Büro hinter der Reception kam ein älterer, schlanker Mann mit schlohweißem Haar heran. Seine Stimme war leise und ernst: »Buenas noches, Señor Aranda. Reciba mi mas sincera condolencia …«
»Danke. Ich spreche deutsch«, sagte Aranda. Daraufhin hießen ihn die beiden Herren noch einmal in deutscher Sprache herzlich in Wien willkommen und erlaubten sich, zu dem schweren Verlust, den er erlitten hatte, ihr Beileid auszusprechen. Der Jüngere war stellvertretender Receptionschef; als er sich vorstellte, hörte Aranda seinen Namen: »Pierre Lavoisier, mein Herr, zu Ihren Diensten.« Der Mann von der Reception stellte auch den Weißhaarigen vor, der in seinem eleganten schwarzen Anzug, der silbernen Krawatte, der Perle darin, dem weißen Hemd mit dem weichen Kragen und seiner vorbildlichen Haltung aussah, wie einem britischen Schneidermagazin entstiegen: »Graf Romath, unser Direktor.«
Eine Gruppe von Damen und Herren in Abendkleidung ging lachend an ihnen vorüber.
Graf Romath grüßte seine Gäste, sah andere Menschen näherkommen und bat: »Gehen wir zu mir, Herr Aranda. Nur einen Moment.« Er eilte schon voraus, dabei ein wenig trippelnd. Er war weit über sechzig. Sein Büro befand sich am Ende eines kurzen Ganges, hinter der Reception. Der Raum war mit großem Geschmack eingerichtet. Es gab auch hier eine Stehlampe neben einem antiken Rundtisch, brokatüberzogene Fauteuils, Chinabrücken über rotem Fußbodenvelours, schwere rote Damastvorhänge, ein Bild an der Wand, die brusthoch von Mahagonipaneelen verdeckt wurde.
Das Bild war eine großartige Kopie des ›Maskensoupers‹ von Adolph Menzel, Aranda kannte das Gemälde. In einem schiefergrauen, breiten alten Rahmen zeigte es, etwa 35 mal 40 Zentimeter groß, als Hauptfarben ein geisterhaftes Gold, viel brennendes Rot, leuchtendes Lila, Schwarz. Auf dem Schreibtisch des Büros stand eine schmale, hohe Kupferkanne. In ihr befanden sich Blüten, die an Orchideen erinnerten, weiß und bräunlich, mit leuchtend goldgelben Flecken.
»Es ist furchtbar, ganz furchtbar, mein Herr«, sagte der Graf, an seine Perle tupfend. »Niemand kann es fassen. Niemand weiß eine Erklärung.«
»Haben Sie meinen Vater noch gesehen – nach dem Tod?« fragte Aranda.
»Ja. Ich … ich wurde in jene Buchhandlung gerufen, um Ihren Herrn Vater zu identifizieren. Er trug einen Paß bei sich. Aber sie brauchten jemanden, der ihn gekannt hatte. Ein wunderbarer Mensch, Ihr Herr Vater. Ein wirklicher Gentleman. Wir haben uns ein paarmal unterhalten …«
»Worüber?«
»Über Argentinien. Ich hatte Besitz drüben, wissen Sie. Vor dem Krieg habe ich fünf Jahre da gelebt.« Der Graf fuhr mit einer Hand durch das weiße Haar. »Wir erhielten Ihr Telegramm. Sie wollen also wirklich das Appartement Ihres Herrn Vaters?«
»Ja«, sagte Aranda. In diesem Büro überkam ihn zum erstenmal jenes Schwindelgefühl, das immer wiederkehren sollte.
»Ganz wie Sie wünschen, natürlich.« Der Graf spielte mit der Perle an seiner Krawatte. »Die Polizei hat das Appartement durchsucht. Es ist nichts beschlagnahmt worden. Wir haben nach der Untersuchung selbstverständlich alles wieder in Ordnung gebracht.«
»Dann lassen Sie bitte mein Gepäck hinaufbringen.«
»Gewiß.« Der Graf trat vor. »Darf ich mir erlauben, Sie zu begleiten und Ihnen das Appartement zu zeigen?«
»Ich fahre noch einmal weg.«
»Jetzt?« Die Brauen des Direktors hoben sich.
»Ja. Mein Taxi wartet. Ist es weit bis zur …« – Aranda zog einen Zettel aus der Tasche seines Kamelhaarmantels – »… Berggasse?«
»Berggasse?«
»Das Sicherheitsbüro. Ich habe bei der Zwischenlandung in Paris den Hofrat Groll angerufen. Er sagte, er würde mich gerne noch heute empfangen, auch wenn es spät werden sollte. Ich bat um eine Unterredung. Sie können sich vorstellen, daß ich so schnell wie möglich …«
»Natürlich«, sagte der Graf. »Ich fürchte nur, selbst der Hofrat steht vor einem Rätsel. Aber Ihr Wunsch ist völlig verständlich. Ich könnte an Ihrer Stelle auch nicht zu Bett gehen, ohne wenigstens … Eine Viertelstunde mit dem Wagen ist es bis zur Berggasse, verzeihen Sie.«
»Würden Sie wohl den Hofrat anrufen und ihm sagen, daß ich unterwegs bin?«
»Sie erledigen das gleich, Herr Lavoisier.«
»Ja, Herr Direktor.« Pierre Lavoisier ging zur Tür und öffnete sie für Manuel. »Darf ich bitten?«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: