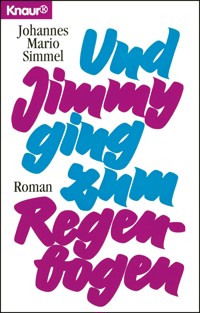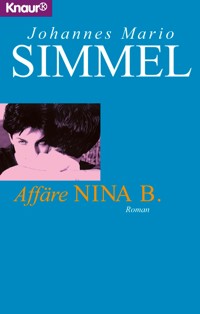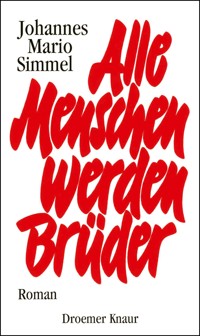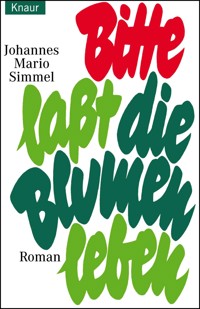4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zweiundzwanzig Zentimeter Zärtlichkeit - das ist der Titel einer der vielen hundert Geschichten von lustigen und traurigen, erregenden und alltäglichen Dingen, geschrieben von Johannes Mario Simmel in mehr als dreißig Jahren. Zweiundsiebzig wurden für diesen Band ausgewählt - Geschichten voll Heiterkeit und Zorn, voll Bitterkeit und Verständnis, voll Erschütterung und dennoch immer voller Glauben an den Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Johannes Mario Simmel
Zweiundzwanzig Zentimeter Zärtlichkeit
und andere Geschichten aus dreiunddreißig Jahren
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Liebe Leserin, lieber Leser!
Sie kennen bislang – ich weiß es – nur meine Romane und, wenn Sie sehr jung sind, meine Kinderbücher. Daß ich viele Hunderte Geschichten geschrieben habe, das ahnt kaum jemand. Allenfalls denken vielleicht ein paar Menschen über den Geschichtenschreiber Simmel nach, sofern sie in einer Zeitung oder in einer Zeitschrift etwas lesen, das ich geschrieben habe, weil es mir am Herzen lag.
Wenn eine solche Geschichte heute erscheint, dann hat das genau dieselben Gründe, aus denen ich meine aberhundert Geschichten geschrieben habe – in den letzten dreiunddreißig Jahren, heute etwas seltener, früher unentwegt. Weil ich nämlich fünfundzwanzig Jahre lang Reporter gewesen bin.
In dieser langen Zeit schrieb ich Kommentare, Glossen, lustige, traurige, erbitterte und nachdenkliche Geschichten, mahnende, beschwörende und zornige. Über Glück und Unglück habe ich geschrieben, über Revolutionen, Kriege, Aufstände, Armut, Hunger und Reichtum. Ich war Gerichtssaalreporter und habe Berichte über die großen Kriminalfälle ebenso notiert wie über das, was den sogenannten ›kleinen Leuten‹ passierte – an komischen, tragischen und das Herz erhebenden Dingen. Ich war einfach das ›Mädchen für alles‹.
Fünfzehn Jahre lang habe ich für eine große Illustrierte gearbeitet. Dort war es geradezu selbstverständlich, daß ich – immer ich! – die jeweils anfallenden Oster-, Weihnachts-, Muttertags- oder Neujahrsgeschichten schrieb und was es sonst noch alles an Erbaulichem gibt.
Mit diesem Buch wird Ihnen eine kleine Auswahl meiner Geschichten vorgelegt. Weil es aber, wie gesagt, immer auch Geschichten gewesen sind, in denen steht, was die Menschen im letzten Dritteljahrhundert erheitert, erregt und erschüttert hat, ist auf diese Weise tatsächlich so etwas wie eine Art von Zeitgeschichte entstanden, wenn auch nur in einem ersten kleinen Querschnitt.
›Wien, Wien und soviel Traurigkeit‹ zum Beispiel schrieb ich 1978, die ›Kleine Fanfare‹ 1945, unmittelbar nach Kriegsende – also genau dreiunddreißig Jahre zuvor.
Ich hoffe, daß ich damit so etwas wie ein – allerdings reichlich ungewöhnlicher – Historiker der Welt, in der wir leben, geworden bin: ›Geschichte‹, die gemacht wird, und ›Geschichten‹, die man schreibt, hängen ja nicht nur sprachlich aufs engste zusammen. Jetzt, beim Durchlesen, sind mir wieder viele, viele Dinge eingefallen, die ich längst vergessen hatte, die ich mir aber unbedingt hätte merken müssen. Es wäre schön, wenn es Ihnen beim Lesen ebenso erginge wie mir, denn wir alle vergessen viel zu schnell. Und das dürfen wir nicht!
Im November 1978
J. M. S.
Marlene
Die Frau des Zweiten Speditionsbuchhalters Emil Krummrück starb vor fünf Jahren. Sie war der letzte Mensch gewesen, dem Krummrück sich zugehörig gefühlt hatte. Alle seine anderen Verwandten waren schon tot, und Freunde besaß er längst nicht mehr. Der Zweite Buchhalter Krummrück wurde von Vorgesetzten, Kollegen und Nachbarn häufig als ›schwierig‹ bezeichnet, obwohl er das gar nicht war. Er war nur sehr schüchtern und verschreckt.
Wenn man den Fall ohne falsche Sentimentalität betrachtete, dann mußte man zugeben, daß Krummrück einigermaßen abstoßend aussah – die Ruine von einem Menschen, der verbogene Aufhänger für eine Reihe abgetragener Kleidungsstücke. Man konnte sich gar nicht vorstellen, daß er einmal ein Kind (Gott bewahre, sogar ein hübsches Kind!) gewesen sein sollte. Er sah aus, als sei er bereits mit seinen nunmehr dreiundsechzig Jahren auf die Welt gekommen.
Nach dem Tod seiner Frau, die zu Lebzeiten auf ihn geachtet hatte, tat Emil Krummrück aber auch wahrhaftig nichts, um etwas vorteilhafter zu wirken. Im Gegenteil, er vernachlässigte sich. Und das wiederum war ein progressiver Vorgang. Zuerst redete er sich, weil er schüchtern und verschreckt war, ein, alle Leute hielten ihn einfach für abstoßend und scheußlich und wollten nichts mit ihm zu tun haben. Das stimmte zum Teil sogar. Aber daß er so scheußlich und abstoßend aussah, kam eben daher, weil er einfach nicht mehr daran dachte, sich ein wenig zu pflegen. Und je länger Krummrück sich vernachlässigte, um so abstoßender und scheußlicher sah er aus – und es ist verständlich, daß mehr und mehr Menschen nichts mit ihm zu tun haben wollten. Krummrück zog aus dieser Entwicklung die falschen Schlüsse: Zuerst verfluchte er sein tristes Los, dann resignierte er verbittert. Und hätte doch besser daran getan, neue Wäsche und neue Schuhe zu kaufen und sich regelmäßig die Haare schneiden zu lassen.
Als Krummrücks Frau drei Jahre tot war, wurde es ganz schlimm mit ihm. Da ließ er sich gehen wie noch nie! Da hatten manche seiner Hemden faserige Manschetten, manche seiner Strümpfe Löcher und manche seiner Krawatten Flecken von Eigelb und Bratensauce. Da sprach er kaum noch (außer in dem dunklen, vollgeräumten Speditionsbüro, wenn er mußte), und er gewöhnte sich an, stundenlang in einem kleinen Park auf einer Bank zu sitzen und den ziehenden Wolken zuzusehen. Manchmal stellte er sich vor, wie seine Frau da oben irgendwo auf ihn wartete; aber meistens war er froh darüber, daß man diese Geschichten vom Wiedersehen im Himmel und von der ewigen Seligkeit durchaus nicht unbedingt glauben muß. Der Zweite Buchhalter Emil Krummrück hatte nun schon nicht einmal mehr Sehnsucht nach seiner Frau. Soweit war es mit ihm gekommen. Selbst die Krägen mancher seiner Hemden waren bereits ausgefranst, und den Friseur besuchte er nur noch, wenn der Chef ihn hinbefahl.
In den armseligen kleinen Park jedoch ging Krummrück weiterhin täglich. Er hätte nicht sagen können, warum. Mehr und mehr gewöhnte er sich ab, über das nachzudenken, was er tat und was er nicht tat.
Nachdem er so mehrere Monate lang seine Bank besucht hatte, setzte sich eines Nachmittags ein kleiner Vogel in den Kies vor seine Füße und betrachtete ihn neugierig. Krummrück, der nichts mehr haßte, als wenn ihn jemand neugierig betrachtete, trat nach dem Vogel, und dieser flog weg. Zwei Minuten später kam er wieder.
Es war eine etwa sperlingsgroße Kohlmeise, ihr Bauch war gelb mit einem schwarzen Längsband, der Kopf schwarz, und im übrigen zeigte das kleine Tier grünliche, graue und weiße Farben in seinem Gefieder. Krummrück trat wieder nach ihm, aber diesmal flog der Vogel nicht mehr fort. Er hüpfte nur zur Seite und plusterte sich auf. Krummrück wandte den Kopf und gab vor, die Meise nicht zu bemerken. Nach einer Minute blinzelte er heimlich aus den Augenwinkeln nach dem Vogel. Die Meise saß noch immer da. Immer noch kokett aufgeplustert.
Mißgelaunt überlegte Krummrück, ob sie vielleicht hungrig war. So wühlte er in den Taschen seines ungebügelten Anzugs, bis er ein halbes Brötchen entdeckte, das er nicht aufgegessen hatte. Er zerdrückte das Brötchen und begann Krümel zu streuen. Die kleine Meise pickte sie sofort auf. Ab und zu hüpfte sie wiederum zur Seite, legte das Köpfchen schief und sah Krummrück an. Das ging eine halbe Stunde lang so. Dann wurde es dämmrig. Krummrück stand auf und wanderte fort. Und auch die Meise flog heim.
Am nächsten Nachmittag brachte Krummrück ein großes Stück Weißbrot mit in den Park. Er genierte sich ein wenig und dachte zu seiner Beruhigung daran, daß es Menschenpflicht ist, hungrigen Tieren zu helfen. Er setzte sich auf seine Bank und wartete. Nicht lange. Schon nach ein paar Minuten kam die kleine bunte Meise angesegelt und landete elegant auf dem Kies. Und Krummrück holte das große Stück Weißbrot hervor. Er war ganz allein im Park an diesem Nachmittag, und es sah ihn keiner, nur die Meise. Und nur die Meise sah, daß Krummrücks mürrisches, schlecht rasiertes Gesicht einmal an diesem Nachmittag von einem fröhlichen Lächeln überzogen wurde und sofort gar nicht mehr so häßlich wirkte … Das war nun der Beginn einer Freundschaft.
Krummrück und die Meise trafen einander täglich, auch an Sonn- und Feiertagen. Im Büro wurde der einsame Zweite Buchhalter stets bereits um halb fünf Uhr unruhig. Punkt fünf schloß er seinen Schreibtisch und machte, daß er fortkam. Bei einem Vogelhändler kaufte er besondere Leckerbissen – Haferflocken, Semmelbrösel, Sonnenblumenkerne und das teure, fabelhafte ›Spezial-Misch-Meisen-Futter‹.
Krummrück hatte die Meise ›Marlene‹ getauft, denn er war zwar seiner Frau stets herzlich zugetan gewesen und hatte sie aus Mangel an Gelegenheit nie betrogen, doch sein bißchen Phantasie wurde noch immer beflügelt und sein armseliger Körper noch immer erwärmt beim Gedanken an die atemberaubende Erscheinung jener unsterblichen Filmdame mit den schönsten Beinen und der aufregendsten Stimme der Welt. Krummrück hatte niemals aufgehört, sie wie ein unirdisches Wesen zu verehren, seit er jenen Film gesehen hatte, in dem die Dame sang, sie sei von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt.
Jeden Tag, pünktlich um halb sechs, erschien Krummrück bei seiner Bank im Park und fütterte Marlene, die ganz zahm war und sitzen blieb und nicht mit jedem feinen Happen fortflog, um wiederzukehren. (Wie es andere Meisen tun.) Nachdem Krummrück Marlene gefüttert hatte, saßen sie beide da und sahen einander an.
Dann kam der Freitag, da passierte es zum ersten Mal: Krummrück wartete umsonst. Marlene erschien nicht. Er wartete, bis es dunkel geworden war und ging endlich schwankend nach Hause, als sei er betrunken. Er war verzweifelt! Zu Hause stellte er bebend Überlegungen hinsichtlich der Gründe an, die Marlene dem Rendezvous ferngehalten haben konnten. Vielleicht war sie tot! Es gab so viele heimtückische Katzen und so viele rücksichtslose Autorowdies. Nein, nein, nein, das wäre zu schrecklich gewesen! Krummrück suchte und fand eine Menge anderer Gründe, aber keiner beruhigte ihn. Er schlief kaum in dieser Nacht. Am nächsten Nachmittag, Schlag halb sechs, saß er dann wieder auf seiner Bank. Und wieder wartete er umsonst. Marlene blieb verschwunden. Krummrück war ein leicht zu entmutigender Mensch. Er weinte still vor sich hin, denn zum ersten Mal in seinem langen, ereignislosen Leben hatte er das entsetzliche Gefühl, vollkommen verlassen zu sein. Beim Tod seiner Frau hatte er dieses Gefühl längst nicht so stark gehabt wie jetzt, nach dem Verschwinden der kleinen Meise, die vielleicht gestorben war. Krummrück saß da und weinte und wischte die Tränen fort, mit tintenbeschmierten Fingern.
Er ging noch sieben Tage vergeblich in den Park, und am achten wurde er krank. Er wurde so krank, daß der Arzt eine Nachbarin bat, öfter nach ihm zu sehen. Krummrück lag steif in einem häßlichen Bett, starrte zur Decke empor, und wenn er im Fieber sprach, konnte der Arzt ihn nicht begreifen.
»Er redet immer von einer Marlene«, sagte der Arzt zu der Nachbarin. »Wie hieß denn seine Frau?«
»Emma«, antwortete die Nachbarin und dachte angestrengt nach, ob sie nicht eine Marlene kannte, zu der man Krummrück in eine verbotene oder skandalöse Beziehung hätte setzen können.
Dann bekam der Zweite Buchhalter auch noch eine Lungenentzündung. Nun mußte er ins Krankenhaus. Es ging ihm immer elender. Ein paar Tage lang sah es so aus, als müßte er sterben. Man rechnete allgemein schon ganz fest mit seinem Tod. Krummrück starb beinahe, aber dann doch nicht. Er erholte sich, wenn auch völlig lustlos und ohne jede Freude. Drei Wochen später stand er wieder auf klapprigen Beinen. Er sah noch abstoßender aus, denn nun war er auch noch bleich und abgezehrt. Der Chefarzt sagte zu ihm: »Jetzt müssen Sie sich aber sehr schonen und noch ein Weilchen bei uns bleiben, damit Sie wieder zu Kräften kommen.«
»Jaja«, antwortete Krummrück. Rede du nur, dachte er. Mir ist es ganz gleich, ob ich noch einmal zu Kräften komme oder nicht. Mir ist alles gleich.
Der erste Tag, an dem er ein wenig ausgehen durfte, führte ihn in den Park und zu seiner Bank. Der Park lag gleich hinter dem Krankenhaus. Krummrück hatte keine Hoffnung mehr, Marlene zu sehen, er wollte nur noch einmal auf der Bank sitzen, auf der er einst so glücklich gewesen war, glücklicher als sonst irgendwo. Noch einmal im Park sitzen und an Marlene denken wollte er – dann sollte geschehen, was da wolle. Diese Welt war doch zum Kotzen! Krummrück fühlte sich noch sehr schwach, darum schlief er gleich ein. Als er erwachte, war es genau halb sechs. Ein dünnes Piepsen hatte ihn geweckt. Er schlug die Augen auf und merkte, wie eine große Glückseligkeit ihn überkam. Denn vor ihm im Kies hüpfte Marlene hin und her. Sie sah ihn an, als wolle sie sich entschuldigen. Die Gründe für ihr Fernbleiben hatte sie mitgebracht. Die Gründe flatterten unbeholfen um Krummrück herum – drei winzige Meisen, Marlenes Kinder. Krummrück bewegte sich nicht. Er saß vollkommen still. Die Kinder flatterten auf seine Schultern.
Da dachte der Zweite Buchhalter Emil Krummrück: Zum Teufel, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, daß diese Welt zum Kotzen ist. Diese Welt ist doch schön! Wunderbar ist sie! Und mir ist es gar nicht egal, ob ich abkratze oder nicht, ob ich wieder zu Kräften komme oder nicht. Ich will zu Kräften kommen! Und also werde ich noch ein Weilchen im Krankenhaus bleiben. Und dann mache ich einen ordentlichen Menschen aus mir. Neue Sachen zum Anziehen werde ich kaufen und einen elektrischen Rasierapparat, und zum Friseur gehe ich von nun an alle vierzehn Tage, ich schwör’s. Lange genug habe ich meinen Mitmenschen ein Bild des Abscheus geboten. Nun soll das aber anders werden. Was denn – dreiundsechzig Jahre, das ist doch kein Alter!
Der Zweite Buchhalter Emil Krummrück wurde wieder ganz gesund und kräftig. Er hielt alle Versprechen, die er sich selbst gegeben hatte, und auf einmal lächelten fremde Menschen in der Straßenbahn ihn an, und die Kollegen luden ihn ein zum Kegeln und zum Bier, und Emil Krummrück lachte glücklich. Plötzlich hatte er eine Menge Bekannte und Freunde. Jeden Nachmittag aber ging er in den Park und traf da Marlene und brachte ihr das gute Futter wie eh und je. Marlene kam nun wieder allein – die Kinder hatten sich schnell selbständig gemacht.
In dem kleinen Park lernte Emil Krummrück dann die achtundfünfzigjährige Oberbauratswitwe Cecilie Peterka kennen. Sie saß eines Tages auf seiner Bank, als er kam, und sie sah zu, wie er Marlene fütterte, die mächtig eifersüchtig war, jedoch ihre Gefühle verbarg, denn es gab ihr Lieblingsfutter – Sonnenblumenkerne.
Aus dem Zweiten Buchhalter Emil Krummrück wurde – o Wunder des gepflegten Äußeren! – ein Erster Buchhalter Emil Krummrück. Der Witwe Peterka kam er bei den täglichen Begegnungen im Park seelisch rasch näher. Marlene fühlte es natürlich, aber sie ließ sich niemals etwas anmerken, wenn ihr gleichwohl das Herz weh tat, denn schließlich war sie ja auch nur ein weibliches Wesen.
Dann, als die Wochen und Monate verstrichen, machte Cecilie Peterka Krummrück den Vorschlag, zu ihr zu ziehen. Sie hatte eine große Wohnung, und wenn sie zusammenlebten, konnte die Oberbauratswitwe sich richtig um den Ersten Buchhalter kümmern. Also übersiedelte Krummrück. Selbstredend dachten die beiden neuen Lebensgefährten nicht ans Heiraten – da waren doch die Renten! Aber zusammen alt werden, ja, das wollten sie.
Es gab soviel zu tun, und Krummrück war so aufgeregt und selig, daß er viele Wochen lang nicht in seinen Park kam. Er vergaß ihn richtig. Schließlich jedoch erinnerte er sich an Marlene, und er ging, um nach ihr zu suchen. Er fand sie nicht. Er ging noch ein paarmal in den kleinen Park, doch Marlene sah er nie wieder.
Der lustige Clown und seine bitteren Tränen
Kinder, Kinder, war das eine Zirkusvorstellung! Sie fand am Tag vor dem Heiligen Abend statt. Das ganze Land versank bereits, wie es sich gehörte, in tiefem Schnee, und an allen Dachrinnen hingen glitzernde Eiszapfen, aber in dem Zelt war es warm und gemütlich, und es roch nicht nur wie üblich nach Leder und Stall, sondern auch nach Lebkuchen, Pfeffernüssen und Tannenreisig.
Dreihundertsiebenundzwanzig Kinder mit ihren Eltern besuchten die Vorstellung. Die kleinen Jungen und Mädchen waren an diesem Nachmittag die Gäste der Fabrik, in der ihre Väter arbeiteten. Schon im November hatte der Mann, dem die Fabrik gehörte, gesagt: »Das war ein gutes Jahr für uns alle. Ich möchte deshalb eine besonders schöne Weihnachtsfeier für uns alle haben, nicht so eine von den gewöhnlichen. Ich schlage vor, wir gehen alle zusammen in den Zirkus. Und wer Kinder hat, bringt sie mit. Ich selber bringe meine drei auch mit!«
Und da saßen sie nun, zwei kleine Mädchen und ein kleiner Junge, neben ihren Eltern und mitten unter den dreihundertvierundzwanzig anderen Kindern. Und das lang ersehnte Weihnachtsfest war sozusagen schon in vollem Gang.
Zuerst hatte es Schokolade gegeben und Kuchen, und danach gab es Limonade und Bonbons, und danach gab es viele Geschenke. Die kleinen Mädchen bekamen Puppen und bunte Handtaschen und süße Lutschfische, und die kleinen Jungen bekamen interessante Bücher und Füllfederhalter, die beinahe aus Gold waren, und aufregende Zusammenlegspiele.
Und dann begann die Zirkusvorstellung.
Das war das Allerschönste für die Kinder! Sie saßen selig in dem Riesenzelt und freuten sich, wenn die schwarzen Ponys tanzten, und gruselten sich, wenn die Löwen brüllten, und waren furchtbar aufgeregt, wenn die schönen Damen in den Silbertrikots hoch oben an ihren Trapezen durch die Luft sausten.
Ach, und dann kam der Clown!
Schon als er in die Manege stolperte, erhoben die dreihundertsiebenundzwanzig Kinder ihre Stimmchen zu einem einzigen schrillen Schrei des Entzückens. Von da an konnte man sein eigenes Wort nicht mehr verstehen. Die Kinder lachten, daß das Zelt wackelte. Sie lachten so sehr, daß sie Tränen in die Augen bekamen. Es wurde vielen ganz schlecht vor Lachen.
Der Clown war aber auch großartig! Die Späße, die er machte, waren so ungeheuerlich, daß sogar die Erwachsenen nach Luft schnappten, selbst der Herr Direktor. Und den hatte noch niemand jemals nach Luft schnappen sehen.
Dieser Clown sprach überhaupt nicht, er brauchte keine Worte, um komisch zu sein. Stumm spielte er den Kindern vor, was sie zu sehen verlangten. Er machte ein Ferkel nach und ein Krokodil und einen Tanzbären. Am komischsten war er, als er einen Hasen nachmachte.
Das war allerdings auch der Moment, in dem der große alte Clown nervös zu werden begann. Das war der Moment, in dem er das kleine Mädchen mit der roten Schleife im Haar entdeckte.
Das kleine Mädchen saß zwischen Vater und Mutter in der ersten Reihe, ganz nahe bei der Manege. Es war ein hübsches kleines Mädchen mit einem klugen, schmalen Gesicht und einem feierlichen blauen Kleid.
Der Vater neben ihm lachte. Und die Mutter lachte. Nur das kleine Mädchen mit der roten Schleife lachte nicht. Es war das einzige von dreihundertsiebenundzwanzig Kindern, das nicht lachte.
Der alte Clown dachte bei sich: Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob wir dich nicht auch zum Lachen bringen, meine Liebe! Und er spielte nun sozusagen nur noch für das kleine Mädchen in der ersten Reihe.
Der alte Clown war so gut wie noch nie.
Aber … es half nichts. Das kleine Mädchen blieb ganz ernst. Und ganz ernst sah es den Clown mit großen, starren Augen an, ohne den Mund zu verziehen. Es war ein nettes kleines Mädchen, eines der nettesten. Nur daß es eben nicht lachte.
Dem Clown wurde die Sache allmählich unheimlich. Hinter all seinem Spaß steckte eine Menge Arbeit und wochenlanges Nachdenken. Er paßte stets genau auf, wie seine Zuschauer reagierten, wann der da zu lachen anfing, und wann der da zu lachen aufhörte. Danach richtete er sich bei seinen Späßen. Er nannte das den Kontakt mit dem Publikum. In dieser Vorstellung mit den vielen Kindern war es ihm leichtgefallen, Kontakt zu finden, denn die Kinder waren dankbare Zuschauer. Nur das kleine Mädchen nicht.
Plötzlich befiel den alten Clown, mitten im Hasen-Nachmachen, eine maßlose Traurigkeit und eine schreckliche Ratlosigkeit. Am liebsten hätte er die Vorstellung abgebrochen. Er fühlte, er konnte einfach nicht mehr weiterspielen, wenn dieses kleine Mädchen in der ersten Reihe ihn weiter so ansah.
Und darum tat er etwas Ungewöhnliches.
Er trat vor das kleine Mädchen hin und fragte höflich: »Sag einmal, gefällt dir die Vorstellung nicht?«
Das kleine Mädchen sah ihn starr und ernst an und erwiderte freundlich: »O doch, sie gefällt mir sehr!«
»Ja, aber warum lachst du dann nicht, so wie alle anderen Kinder lachen?« fragte der Clown.
»Worüber soll ich denn lachen, bitte?«
»Nun«, sagte der Clown verlegen, »über mich zum Beispiel.« Der Vater des kleinen Mädchens wollte etwas sagen, aber der Clown gab ihm ein Zeichen, er wollte, daß das Mädchen selbst antwortete.
»Verzeihen Sie bitte«, antwortete dieses, »ich wollte Sie nicht kränken, aber ich kann über Sie nicht lachen.«
»Und warum nicht?«
»Weil ich Sie nicht sehe«, sagte das kleine Mädchen. »Ich bin blind.«
Daraufhin wurde es in dem Riesenzelt totenstill. Das kleine Mädchen saß stumm und freundlich vor dem alten Clown, und dieser wußte nicht, was er sagen sollte. Es dauerte lange, bis er es ungefähr wußte.
Indessen erklärte die Mutter: »Erika war noch nie im Zirkus! Wir haben ihr nur immer davon erzählt.«
»Und diesmal wollte sie unbedingt wissen, wie so ein Zirkus wirklich ist«, sagte der Vater.
Der Vater war Werkmeister in der großen Fabrik. Und er hatte seine Frau und seine Tochter sehr lieb. Sie hatten ihn auch lieb. Es war eine glückliche Familie.
Der Clown fragte bedrückt: »Und weißt du jetzt, wie so ein Zirkus wirklich ist, Erika?«
»Ach«, antwortete Erika fröhlich, »ich weiß natürlich schon allerhand! Vati und Mami haben mir alles erklärt. Die Löwen habe ich brüllen hören und die Ponys wiehern, und ich kann mir eigentlich alles schon gut vorstellen in meiner Phantasie. Nur eines nicht.«
»Und was ist das?« fragte der Clown, der schon wußte, was es war.
»Warum Sie komisch sind«, sagte Erika mit der roten Haarschleife. »Warum man über Sie lachen muß. Also, das ist das einzige, was ich mir absolut nicht vorstellen kann!«
»Hm«, sagte der große Clown. Danach wurde es noch einmal totenstill im Zirkus. Und dann tat der große Clown etwas sehr Hübsches. Er neigte sich vor und sagte: »Paß auf, Erika, ich mache dir einen Vorschlag.«
»Ja, bitte?«
»Aber nur, wenn du auch wirklich wissen willst, warum die andern Kinder über mich lachen.«
»Natürlich möchte ich das wissen!«
»Na schön. Dann werde ich, wenn es deinen Eltern recht ist, morgen nachmittag zu dir kommen.«
»Zu mir nach Hause?« fragte Erika aufgeregt.
»Ja, zu dir nach Hause. Und dann werde ich dir zeigen, was komisch an mir ist. Einverstanden?«
Erika nickte begeistert und schlug die Hände zusammen: »Au fein! Vati, Mami, er kommt zu uns!«
»Das ist sehr nett von Ihnen, mein Herr«, sagte der Vater leise. Und die Mutter fügte noch leiser hinzu: »Wir danken Ihnen sehr.«
»Keine Ursache«, sagte der alte Clown. »Wo wohnen Sie?« Er erfuhr die Adresse und nickte. »In Ordnung. Sagen wir um sechs Uhr?«
»Um sechs Uhr«, sagte Erika. »Ach, ich freue mich schon so!« Der Clown strich ihr über das Haar, holte tief Atem und kam sich vor wie ein Mann, dem gerade ein Hundertkilogrammgewicht vom Rücken gefallen ist.
»Die Vorstellung geht weiter, Herrschaften!« rief er.
Die anderen Kinder klatschten. Sie beneideten im Moment alle glühend die kleine blinde Erika, die der wunderbare Clown persönlich besuchen wollte …
In dieser Nacht schneite es. Und am nächsten Tag schneite es. Es schneite immer weiter. Um halb sechs Uhr gab es bei Erika zu Hause die Weihnachtsbescherung. Die Kerzen brannten hell auf dem Christbaum, und das kleine Mädchen betastete alle die schönen Geschenke, die auf dem Tisch lagen, und gab dem Vater einen Kuß und der Mutter einen Kuß, aber fragte immer wieder: »Glaubt ihr, daß er auch kommt? Glaubt ihr, daß er auch wirklich kommt?«
»Bestimmt«, sagte die Mutter. »Er hat es doch versprochen.«
Er kam auf die Minute pünktlich. Im Radio sangen viele Stimmen gerade ein Lied, in welchem vom Frieden auf Erden die Rede war, als die Flurglocke läutete.
Erika selbst lief hinaus, um zu öffnen. Auf dem Gang stand der alte Clown.
Er trug einen Wintermantel und darunter einen dunklen Anzug. Er hatte weiße Haare und ein zerfurchtes, blasses Gesicht. Aber das sah Erika natürlich nicht.
Sie schüttelte ihm die Hand und sagte stotternd vor Aufregung: »Das … das … das ist aber nett, daß Sie wirklich gekommen sind!«
»Na, erlaube mal«, sagte der Clown. Dann begrüßte er die Eltern. Und dann überreichte er seine Geschenke für Erika: drei Bücher, die in einer besonderen Schrift gedruckt waren, welche Blinde lesen können.
Erika hatte schon ein paar Bücher in dieser Schrift gelesen und war sehr glücklich über die drei neuen. Aber es kam noch schöner.
»Wenn ich vielleicht einen kleinen Cognac haben könnte«, sagte der alte Clown. Er bekam einen – und keinen kleinen.
Nachdem er ihn getrunken hatte, nahm er Erika an der Hand und führte sie zu einem Sessel, der vor dem Weihnachtsbaum stand. Die Eltern sahen schweigend zu, wie der alte Clown Erika auf den Sessel setzte und ihre kleinen Hände ergriff und vor ihr niederkniete.
»Streich mal über mein Gesicht«, sagte er dabei. »Und über den Hals. Und über die Schultern. Und die Arme und Beine. Das ist nämlich das erste: Du mußt ganz genau wissen, wie ich aussehe.«
Dabei sah der Clown ohne Maske und Kostüm eigentlich gar nicht komisch aus. Das wußte er. Und es war ihm auch gar nicht geheuer bei dem Experiment, auf das er sich eingelassen hatte. (Darum hatte er den Cognac verlangt.) »Fertig?« fragte er zuletzt.
»Mhm«, sagte Erika.
»Du weißt, wie ich aussehe?«
»Genau.«
»Na, dann kann es ja losgehen«, sagte der Clown. »Aber bitte, nimm deine Hände nicht von mir fort. Du mußt mich dauernd abtasten, damit du auch alles begreifst, was ich mache.«
»Na klar«, sagte Erika.
Und der alte Clown begann zu spielen. Er machte alles noch einmal, was er schon im Zirkus gemacht hatte. Die Eltern standen bei der Tür und hielten einander an den Händen und sahen zu.
»Jetzt kommt der Tanzbär«, sagte der alte Clown. Die dünnen, zarten Fingerchen Erikas wanderten über ihn, während er den Tanzbären nachmachte. Und noch blieb ihr Gesicht ernst.
Aber der Clown ließ sich nicht beirren, obwohl es die schwerste Vorstellung seines Lebens war. Er machte das Krokodil nach. Und danach das Ferkel. Schneller und schneller glitten Erikas Finger über sein Gesicht und seine Schultern hinweg, sie atmete unruhig, ihr Mund stand offen. Und auch die Erwachsenen atmeten unruhig.
Es schien, als könnte Erika mit ihren kleinen Händen wirklich sehen, wie andere Kinder mit den Augen, denn auf einmal kicherte sie. Dünn und kurz. Aber sie kicherte. Und zwar beim Ferkel.
Der große alte Clown verdoppelte seine Bemühungen. Da begann Erika zu lachen.
»Und jetzt kommt der Hase«, sagte der Clown und begann seine Glanznummer. Erika lachte lauter, immer lauter. Sie verschluckte sich vor Heiterkeit.
»Noch einmal!« rief sie selig. »Bitte, noch einmal!«
Da machte der alte Clown noch einmal den Hasen. Und noch einmal. Und noch einmal. Erika bekam nicht genug. Die Eltern sahen einander an. So hatte Erika noch niemals in ihrem Leben gelacht.
Zuletzt war sie völlig außer Atem.
Sie rief: »Mami! Vati! Jetzt weiß ich, was ein Clown ist! Jetzt weiß ich überhaupt alles! Das ist ganz bestimmt das schönste Weihnachtsfest von der Welt!«
Ihre Wangen glühten. Ihre kleinen Finger glitten noch immer über das Gesicht des alten Mannes, der vor ihr kniete.
Und plötzlich erschrak Erika ein wenig. Denn sie hatte bemerkt, daß der große Clown weinte.
Wien, Wien und soviel Traurigkeit
Wenn ich mir was wünschen dürfte,
wünscht’ ich mir ein wenig Glück.
Denn wenn ich gar zu glücklich wäre,
hätt’ ich Sehnsucht nach der Traurigkeit.
Aus einem alten Lied, das Marlene Dietrich sang.
Ich habe diese Sehnsucht. Immer, wenn ich nach Wien komme, erfüllt sie mich. Meine Mutter stellte, wenn ich als kleiner Junge einmal traurig war, eine Porzellantaube auf den Schrank meines Kinderzimmers. Am Sockel der Taube lief eine Schrift entlang, die lautete: ›Nur dem Fröhlichen blüht des Lebens Baum‹. Und des Lebens Baum blühte dann auch mir stets gleich wieder. Damals war ich immer so fröhlich, sagen die Leute. Aber das war in einer anderen Zeit, die fern liegt, wie hinter einem Rauch.
1924 wurde ich in der Stadt Wien geboren. Meine Eltern stammten aus Hamburg, mein Vater hatte seine Firma in Wien zu vertreten. So kam ich im ›Rudolfinerhaus‹ zur Welt. Und auch meine Schwester wurde in Wien geboren, später.
Heute lebe ich in Monaco, direkt am Meer. Doch in Wien war ich, als der Anstreicher einzog, und in Wien war ich, als er sich in Berlin umbrachte und Europa in Trümmern lag. Meinen einundzwanzigsten Geburtstag feierte ich in der tiefsten Etage des dreistöckigen Kellers eines vierstöckigen Hauses auf dem Neuen Markt, schräg gegenüber dem Donner-Brunnen, direkt gegenüber dem Hotel Meissl & Schaden, das total ausbrannte. (Scheissl & Maden haben die Wiener dieses Hotel immer genannt.)
Da unten, im Keller, hatte sich eine verwegene Gesellschaft versammelt: geflohene Kriegsgefangene, deutsche Deserteure, politisch und rassisch Verfolgte, ein paar alte Damen, eine ehemalige Schönheitskönigin, deren Mann von den Nazis ins KZ Mauthausen gebracht worden war. Dieser schönen Frau verdanke ich es, daß ich noch am Leben bin. Und dieses Haus wurde zum Schauplatz meines ersten Romans ›Mich wundert, daß ich so fröhlich bin‹. Vor mehr als dreißig Jahren habe ich ihn geschrieben. Mich wundert’s immer mehr …
1945, im Sommer, wurde ich Dolmetscher der amerikanischen Militärpolizei. In der Station Währingerstraße/Ecke Martinstraße. Da war zuvor ein Möbelgeschäft gewesen. Seit vielen Jahren ist da wieder ein Möbelgeschäft. (Mit meiner schon begonnenen Chemiker-Laufbahn hatte es damals ein Ende. Die Laboratorien waren zerstört, ich mußte Geld verdienen – für meine Mutter, meine Schwester und mich.) Meinen ersten Roman schrieb ich, wenn ich Nachtdienst hatte und alles ruhig war. Im Hinterzimmer der MP-Station. Die Amis schenkten mir eine Schreibmaschine und Papier.
Wenn ich nun in diese Stadt komme, sehe ich mir stets das Möbelgeschäft an. Für mich ist es keines, wird es niemals eines sein. Ich sitze da immer wieder in der Zeitmaschine des H. G. Wells, und ich sehe grüngestrichene Auslagescheiben und einen Station-Jeep auf dem Pflaster, und es ist wieder 1945 für mich, und tausend Geschichten von damals fallen mir ein, lustige, tragische. Mich wundert, daß ich so fröhlich bin …
Draußen in Neustift am Wald, im Talkessel der riesigen Weinberge, stehe ich dann auf der alten ›Nuß-Allee‹, dem Haus gegenüber, in dem ich so viele Jahre lang gelebt habe – als Kind, als Junge, als Heranwachsender. In der Zeit meiner Kindheit habe ich mit meiner jüngeren Schwester und vielen anderen Kindern die Nüsse gesammelt, die von den alten Bäumen der Allee gefallen sind.
Meine Mutter hatte einen Wunsch. Sie wollte ›auf dem Friedhof über unserm Haus‹ begraben werden. Es war ein sehr schöner Friedhof, alt, klein und erfüllt von einem fast schon unwirklichen Frieden. Inzwischen ist er gewaltig angewachsen und läuft die ganze ›Sommerhaide‹ entlang. Seit 1965 liegt meine Mutter dort.
Meine Schwester hat Wien nie verlassen. Sie lebt ganz in der Nähe, in einem anderen Haus. Verheiratet mit dem politischen Karikaturisten Angerer (Rang) vom ›Wiener Kurier‹. In ihrem Haus gibt es eine Bücherwand und darin eine Ecke voller Fotos, die meisten vergilbt. Von unserer Familie sind nur noch wir zwei am Leben. Mein Vater mußte weg, 1938, als die Nazis kamen. Sein Name stand auf den Listen mit der Überschrift: ›Sofort zu liquidieren!‹ Als ›Politischer‹. Er war Sozialdemokrat, sein Leben lang. Wie sein Vater. Wie ich es bin. Meine Mutter hatte viele Sorgen. Einem einzigen Menschen konnte sie alle diese Sorgen anvertrauen: der Mila.
Mila Blehova, so hieß die kleine Frau aus einem tschechischen ›Städtl‹, die seit meiner Geburt da war und bei uns blieb und die engste Vertraute und beste Freundin meiner Mutter wurde in jenen schlimmen Jahren. Die Mila! Sie war der gütigste und mutigste und gerechteste Mensch, den ich je traf. Ich habe dieser Frau einen Roman gewidmet – ›Affäre Nina B.‹. Im Roman spielt sie eine große Rolle. So, wie sie im Buch ist, genauso war sie im Leben.
Über die Höhenstraße fahre ich zum Cobenzl. Da gibt es ein berühmtes Restaurant und eine berühmte Bar und ein sehr großes Espresso, rund gebaut, keine Wände, nur Glasscheiben. In diesem Espresso habe ich oft gesessen, später, als ich schon nicht mehr in Wien lebte, wenn ich hierherkam, um zu arbeiten. In diesem Espresso habe ich viel geschrieben und auf die Stadt hinuntergesehen, und jedes Jahr waren es mehr Tote, an die ich denken mußte. Ich habe Telefongespräche angemeldet nach fernen Städten, sehr, sehr fernen, und ich habe einer Frau gesagt, daß ich sie liebe, wenn ich auch glaubte, daß ich sie nie wiedersehen würde. Und ich habe Schillinge in die Musikbox geworfen und immer dieselbe Platte gewählt – unser Lied, ›Stormy Weather‹. Und jene Frau in der Ferne hat die Musik gehört …
Jetzt stehe ich wieder vor diesem Espresso. Schneidend kalt pfeift der Wind hier oben. Die Eingangstür ist mit Brettern vernagelt. ›Geschlossen‹ steht auf einem Brett. Ich blicke durch die schmutzigen Scheiben. Das Inventar ist verschwunden, der Fußboden herausgerissen. Keine Musikbox mehr. Selten habe ich so Trostloses gesehen. Vermutlich soll hier alles renoviert werden – für den nächsten Sommer.
Trotzdem: Ich werde nie mehr hierherkommen. Denn nie mehr wird es so sein wie einst …
1945, im Herbst, wurde ich von einem Mann in den Prater gerufen. Im Prater hatte es die schwersten Kämpfe zwischen Sowjets und SS gegeben. Beinahe alles war zerstört. Der Mann, der mich rief, hatte einen berühmten Namen als Verleger. Er wollte, daß ich ›Moby Dick‹ neu übersetzte. Als das wunderbare Buch zu einem Viertel fertig war, starb der Mann. Die Frau nahm sich das Leben. Ich weiß nicht, wo das Manuskript geblieben ist. Nun suche ich das Haus von einst. Es ist verschwunden.
Ich gehe hinüber in den Wurstl-Prater, in dem ich vor einem Vierteljahrhundert zugesehen habe, wie Carol Reed den ›Dritten Mann‹ drehte. Es ist noch früh am Vormittag. Kein Mensch zu sehen. Die Geisterbahn, das Riesenrad, die Budenstraßen sind geschlossen. Ratten huschen vorbei. Kein Laut. Greller, kraftloser Wintersonnenschein. Kälte treibt mir Tränen in die Augen.
Die UNO-City. Eine unheimliche Totenstadt. Auch hier keine Menschenseele. Wolkenkratzer. Dazwischen die bizarren Fassaden halbfertiger Gebäude. Sie ragen in den hellen Himmel. Ich stolpere über Trümmer. Die Damen und Herren von der UNO sollen hier einziehen. Aber sie möchten das nicht.
Was ist die UNO heute? Reden wir lieber nicht davon! Damals, als wir von der ›Charta der Vereinten Nationen‹, als wir von Roosevelts ›Vier Freiheiten‹ voll Seligkeit und Erwartung zum erstenmal hörten, hatte ich hier in der Nähe ein Wochenendhaus gemietet. Im Dachstuhl schrieb ich dann später meinen zweiten Roman: ›Das geheime Brot‹. Da war es mit der Seligkeit schon wieder vorbei. ›Spaltung‹ und Blockade in Berlin. Kalter Krieg. Ernüchterung. Verzweiflung. Weltuntergangsstimmung. Orwells ›1948‹, Gheorghius ›25 Uhr‹, Arthur Koestlers ›Sonnenfinsternis‹ und ›Gottes Thron steht leer‹ …
Da gab es eine Zeitung – ›Neues Österreich‹. Es gibt sie längst nicht mehr. Damals arbeitete ich dort. Hielt diesen Zusammenbruch aller unserer Hoffnungen nicht aus. Schrieb ›Das geheime Brot‹ – wider besseres Wissen, aus Protest, um den Lesern und mir Mut zu machen. So wie ein Kind im Finstern singt. Ich erzählte die Geschichte von lauter armen Leuten, die sich nicht entmutigen lassen und es fertigbringen, aus einer Ruine wieder ein Haus zu machen. Der Chefredakteur des ›Neuen Österreich‹ lehnte den Vorabdruck ab. Er hatte Angst, die Leser könnten protestieren gegen so viel Fröhlichkeit. Die Kritiker nannten das Buch ein ›Wunsch-Märchen‹.
Das schiefe Holzhäuschen gibt es nicht mehr, die ganze Schrebergartenkolonie ist abgerissen worden, ich weiß es seit vielen Jahren. Trotzdem komme ich immer wieder hierher. Jahrzehnte später erst ist ›Das geheime Brot‹ berühmt geworden. Heute wird es gekauft wie nie zuvor. Was sind das für Menschen, in der ganzen Welt, die heute dieses Buch von einst lesen? Menschen voller Angst vor der nächsten Katastrophe, denke ich, denn ich habe selbst Angst vor der nächsten Katastrophe.
Hier, in der Nachbarschaft der halbfertigen UNO-City, wurde jener Roman geschrieben.
›Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren …‹ Ach, es ist schon so lange her. Über die Nordwestbahnbrücke rollt ein endloser Güterzug. Die Lokomotive pfeift laut. Die große Reichsbrücke, stromabwärts, ist im vergangenen Sommer eingestürzt. Wie viele bunte Blumen blühten in dem Garten vor meinem kleinen Wochenendhaus! An einer Wand gab es draußen einen Stall. Kaninchen raschelten in ihm … Innere Stadt.
Die uralten Cafés, die Weinstuben, die ›Beisln‹, die ›Durchgänge‹ zwischen zwei Gassen. Hier saß ich mit Freunden nächtelang, hier lief ich mit ihnen nächtelang herum, und wir debattierten über Camus und erregten uns über Sartre, über Hemingway, Silone, Tennessee Williams, Huxley. Damals war ich Österreichs jüngster Kulturredakteur in der ›Welt am Abend‹, und Schönberg, Priestley, Thornton Wilder, Henry Moore waren Sensationen für uns. Damals gingen drei oder vier von uns in jedes Konzert, zu jeder Galerieausstellung, in jeden neuen Film, zu jeder Theaterpremiere. Und infolge der anschließenden Diskussionen wurden die Kritiken so spät fertig, daß ich am Morgen zuletzt selber mit den Manuskripten zur Druckerei rennen mußte. Die lag am Fleischmarkt. Die Redaktion befand sich in der Wollzeile, ein paar uralte Gäßchen mit ›Durchgängen‹ dazwischen.
Und da war jenes sehr schöne Mädchen, das unbedingt Journalistin werden wollte und plötzlich in meinem Zimmer stand. Ich wollte sofort, als ich das Mädchen sah, etwas ganz anderes, und deshalb engagierte ich sie als Filmkritikerin. Sicherheitshalber sah ich mir den ersten Film, den sie rezensieren sollte, heimlich vorher an. Aber an ihrer Arbeit mußte ich überhaupt nichts ändern – sie hatte nur eine etwas eigenwillige Art der Interpunktion.
Natürlich verliebten wir uns ineinander. Das Glück dauerte ganze zwei Jahre. Dann verloren wir uns aus den Augen. 1972 fand ich sie in Cannes wieder. Und im März 1976 haben wir geheiratet – in Wien, auf dem Standesamt Martinstraße/Ecke Währingerstraße, schräg gegenüber dem schönen Möbelgeschäft, in dem ich einst als Dolmetscher der Military Police arbeitete!
Ach, und die vielen, vielen Nächte in meinem Redaktionszimmer bei der ›Welt am Abend‹! Diese Zeitung war französisch lizenziert, jede Besatzungsmacht besaß ihre eigene Zeitung. Und wenn ich Nachtdienst hatte, kamen immer Freunde aus anderen Redaktionen, und es kamen alliierte Kulturoffiziere – als der Kalte Krieg begann, heimlich –, und es kamen Korrespondenten von AP und UP und INS und TASS – wahrhaftig! Und meine Jugendliebe kam, natürlich.
Was für ein wunderbares Leben hatten wir doch! Die Russen brachten Wodka und Fleisch, die Amis Konserven und Zigaretten, die Engländer Whisky, die Franzosen Rotwein. Und alle, alle brachten Bücher und Schallplatten und Zeitschriften aus der ganzen Welt. Wir saßen bis zum Morgen zusammen, so viele Nächte, und debattierten – die Russen mit den Amis, die Engländer mit den Österreichern, eine einzige große Familie war das. Was gab es da für Freundschaften, was für Pläne, lieber Gott!
Wien – Sehnsucht nach Traurigkeit. Ich gehe in die alten Cafés und ›Beisln‹, sofern sie noch existieren, ich gehe in die Hofreitschule, ins Burgtheater, in die Oper. Nur die Erinnerung geht mit – die Erinnerung an so viele, die gestorben sind oder verdorben, die versagt oder ganz große Karrieren gemacht haben, die verschollen sind, verkommen, wer weiß, wo und wie und warum. Ich bin noch da – ein Weilchen noch, denn unser Leben ist so kurz, und unser kleines Sein umschließt ein Schlaf.
Wieder einmal bin ich heimgekehrt in die Fremde, die einst mein Zuhause war. Prinz-Eugen-Straße Nr. 30. Ein graues Haus, unverändert. Sitz des Paul Zsolnay Verlags. Hier erschien ich eines Tages im Jahr 1946 und sagte, ich hätte ein Buch anzubieten. ›Begegnungen im Nebel‹ war der Titel. Das Manuskript wurde angenommen. Ich bekam einen Vertrag und tausend Schilling Vorschuß. Das war ein ungeheures Vermögen, und ich war schon betrunken, bevor ich mit dem Lämmlein (so nenne ich die Frau, die ich mir herübergerettet habe aus unser aller Stunde Null) überhaupt den ersten Schluck Wein trank im ›Terrassen-Café‹ in Gersthof. Das ›Terrassen-Café‹ gibt es nicht mehr so, wie es damals war, Paul von Zsolnay, der aus der englischen Emigration zurückkehrte, ist schon lange tot. Den Verlag leitet seitdem mein Schulfreund Hans W. Polak. Ich habe viele neue Freunde in Wien – nur noch wenige von damals.
Wien hat sich sehr verändert. Oft finde ich meinen Weg nicht mehr. Es gibt Trabantenstädte, sie bauen eine gewaltige U-Bahn, da sind neue Wohnviertel, Schnellstraßen, ein riesiger Flughafen in Schwechat.
Vor einem Luftangriff war ich einmal hier draußen in Schwechat. Mit dem Fahrrad schaffte ich es noch bis zum Zentralfriedhof. Dann kamen die Bomber. Ich kletterte über eine Mauer und kroch unter einen ungeheuer kitschigen Grabstein. Über ihm erhob sich ein mächtiger Pavillon – wahrhaftig! Aber diese Monstrosität rettete mir – wieder einmal – das Leben. Rechts und links detonierten Bomben einer ›Flying Fortress‹, die, von der Flak getroffen, nun ihre ganze Bombenlast einfach ausklinkte, um leichter zu werden, höher steigen, vielleicht entkommen zu können. Die dicken Marmor- und Eisenplatten des Mausoleums schützten mich. Viele Bomben trafen die Gräber und wühlten sie auf. Als alles vorüber war, hingen Skelette mit grinsenden Totenköpfen in den Ästen der Bäume.
Immer wieder fahre ich hinaus zu diesem Zentralfriedhof, der unfaßbar groß ist und von dem die Wiener sagen, Chicago sei nur doppelt so groß, aber nicht einmal halb so lustig. Das Grab im Mausoleum habe ich wiedergefunden. Wenn ich heimkehre nach Monaco, erzähle ich meiner Frau stets von allen Wegen, die ich gegangen bin. Des Abends sehen wir dann aus unserem gläsernen Haus auf dem Dach eines Wolkenkratzers hinab auf die Lichter von Monte Carlo und die Lichter der Schiffe draußen auf dem Meer, rote, gelbe, grüne.
Und immer wieder sprechen wir von Wien und von all dem Schönen und Schrecklichen, das uns widerfahren ist in dieser Stadt, aber eigentlich meistens nur von dem Schönen. Und so wird meine Sehnsucht nie enden, diese Sehnsucht nach der Traurigkeit über eine vergangene Zeit.
Gewiß geschieht nichts, was geschieht auf dieser Welt, sinnlos oder zufällig. Hast Du vielleicht doch recht gehabt, liebe Mila Blehova, als Du sagtest, wir müßten keine Angst haben, das Böse siegt niemals? Vielleicht, Mila, dauert es also nur sehr, sehr lange? So wären meine Reisen nach Wien und meine Wege in die Vergangenheit also nicht Sehnsucht nach Traurigkeit, sondern Sehnsucht nach Hoffnung? Niemand kann mir das sagen.
Doch wenn ich zum letztenmal diese Stadt Wien und alle Stätten meiner Erinnerung gesehen haben werde, wenn ich dort bin, Mila, wo Du bist, dann werde ich, der stets so vieles wissen wollte, endlich wissen, was wert ist, gewußt zu werden.
Kleine Fanfare
Es gibt Leute, die machen aus jedem Park einen Misthaufen. Dann gibt es solche, die machen aus jedem Misthaufen einen Park. Und schließlich existiert, wie es scheint, im Augenblick in Wien eine Gruppe von Menschen, die es sich zum Ziel gesetzt hat, aus den Parks, welche ihre Vorgänger zu Misthaufen werden ließen, wieder Parks zu machen. Das Ganze kann als reversibler Prozeß gewertet werden, bei dem am Ende bestenfalls wieder das zutage kommt, was ursprünglich da war. Gesehen mit den Augen eines exakten Wissenschaftlers, entbehrt ein solcher Vorgang deshalb jedes schöpferischen Sinnes und kann Zynikern allein zur Illustration der Art und Weise dienen, in der wir unser Leben verbringen.
Es ist nicht schwer, etwas Schönes kaputtzumachen. Das haben wir alle gesehen. Aber aus den Trümmern das Schöne wiedererstehen zu lassen – dazu gehört, wie zum Mut, mehr als eine Faust. Dazu gehört auch ein Kopf. Und ein Herz. Denken Sie doch: ein Herz!
Mit der den Journalisten eigenen Unbekümmertheit unternehmen wir es an dieser Stelle, ein paar Dutzend Männern zu danken, die wir gar nicht kennen. Wir sehen sie manchmal, wenn wir durch die Straßen der Stadt laufen, und denken dann, daß es an der Zeit wäre, ihnen die Hand zu schütteln. Manche von ihnen tragen alte Militärhosen, andere Overalls. Manche halten Gartenschläuche in der Hand, andere Schaufeln und Rechen. Sie säen Grassamen in den festgetrampelten Lehm um die Luftschutzbunker und tragen alte Konservenbüchsen und geborstene Nachttöpfe zu Hauf. Sie streuen Kies auf schmale Fußwege und setzen Pelargonien an ihre beiden Seiten. Der Schweiß rinnt ihnen dabei über den mageren Rücken, sie halten einen Zigarettenstummel im Mundwinkel fest und summen, wenn sie gut gelaunt sind, die Melodie eines amerikanischen Schlagers vor sich hin.
Um sie herum macht die Großstadt Krach. Straßenbahnen klingeln vorüber, Autos fahren nach Westen und Osten, und tausend junge Mädchen mit Aktentaschen und gelegentlichen Sorgenfalten auf der Stirn laufen in ihre Büros, um vor dem Chef zu zittern.
An den Ecken stehen ein paar Herren in nagelneuen Anzügen und breitkrempigen Hüten. Sie tragen kleine Schnurrbärte, sprechen ein gebrochenes Deutsch und unterhalten sich ernst über den neuen Schleichhandelskurs des Dollars. Oder über fünfzig Eisenbahnwaggons voll Zucker. Oder über zweitausend Kühlschränke, sofort greifbar, eine einmalige Gelegenheit. Ihre Hände sind makellos sauber und mit Ringen geschmückt. Die Hände der Männer, die in den verwüsteten Parks herumklettern und verbogene Traversen fortschleppen, sind dreckig. Aber sie sind dennoch hundertmal sauberer als die untadeligen der Herren mit den breitkrempigen Hüten, an denen unsichtbarer Schmutz klebt wie Pech und Schwefel.
Die Männer, denen diese Zeilen gelten, sind Helden, die es von sich selbst nicht wissen. Sie sind es möglicherweise eben deshalb. Sie setzen sich mit ihrer Arbeit ein lebendes Denkmal, das schöner ist als alle Denkmäler aus Stein und Bronze. Kein Mensch weiß, wie sie heißen. Sie sind so anonym wie die Samenkörnchen, die sie in den mißhandelten Großstadtboden legen.
Für die großen Feldherren, Demagogen und Menschenschlächter wurden noch zu allen Zeiten Fanfaren geblasen, und erwachsene Männer standen vor ihnen stramm wie vor dem lieben Gott. Wir haben keine Fanfare. Aber wir würden, wenn wir eine besäßen, mit Vergnügen in sie stoßen, unseren unbekannten Freunden zu Ehren. Wir stehen auch vor niemandem stramm. Aus Prinzip nicht. Aber vor den Männern in den geflickten Arbeitsanzügen würden wir tief den Hut ziehen. Wenn wir einen hätten. In der Bibel, die wir in letzter Zeit gelegentlich mit großem Interesse lesen, findet sich irgendwo eine Stelle, an der es heißt, daß unser Leben ein gutes Leben gewesen ist, wenn wir zwei Grashalme dort zum Gedeihen bringen, wo vorher nur einer wuchs.
Unsere Freunde lassen Grashalme zu Hunderttausenden wachsen. Dort, wo vorher überhaupt kein Gras wuchs. Dort, wo vorher Luftschutzhelme und alte Sparherde herumlagen. Nicht nur Grashalme. Sondern auch blaue, weiße und rote Blumen, duftende Sträucher und junge Bäume, deren Blätter im Wind Boogie-Woogie tanzen.
Sie machen Parks aus Misthaufen.
Parks für uns alle. Auf den Lehnen der frischgestrichenen Bänke steht nicht mehr ›Kampf bis zum Sieg‹ oder ›Wer plündert, wird erschossen‹ oder ›Nur für Arier‹. Es steht überhaupt nichts auf ihnen. Sie sind für alle Menschen da, die sich müde fühlen. Oder die verliebt sind. In den neuen Parks werden wir alle zu Mitgliedern einer großen Familie. Vorübergehend wenigstens. Wir lächeln, wenn ein Baby zwei Zitronenfaltern nachstolpert, wir pfeifen leise einer jungen Dame in einem hellen Sommerkleid nach und geben höflich Auskunft, wenn jemand uns um die Zeit fragt. Wir gehen durch die neuen Parks, riechen das Gras und die roten Nelken und haben ein ungemein angenehmes Gefühl im Magen. So, als hätten wir eben ein neues Hemd angezogen. So, als hätte uns gerade jemand ein CARE-Paket geschenkt. So, als hätten wir endlich wieder ein ganz reines Gewissen.
Die Männer, welche die Parks für uns wiederschaffen, sind Helden, weil sie anderen mit ihrer Arbeit Freude, nichts als Freude bereiten. Das können wenige Helden von sich sagen. Die meisten bringen Tränen, Tod und Zerstörung, Ungerechtigkeit und Hunger mit sich. Unsere Freunde, denen wir hier danken, fangen es leise und behutsam an. Sie wollen niemandem weh tun. Nicht einmal den Regenwürmern. Wer mit Blumen verkehrt, wird mit der Zeit ein guter Mensch. Vielleicht müßten wir alle Kresse vor unseren Fenstern ziehen, um glücklicher zu werden …
Wir wissen nicht, wem zuerst die Idee kam, Wiens Parkanlagen wieder instandzusetzen. Wahrscheinlich einem ganz gewöhnlichen Menschen in einem ganz gewöhnlichen Büro. Eine große Idee ist immer sehr einfach. Sie kann jedem von uns kommen. Aber diesem Mann, den wir nicht kennen, kam sie. Vielleicht war es auch eine Gruppe von Menschen, die jenen Plan faßte, uns eine unrationierte Zuteilung an Freude zu schenken. Wir wissen es nicht. Vielleicht waren es hundert. Vielleicht waren es fünfzig. Aber selbst wenn es ein einziger gewesen wäre, so sei ihm gedankt.
(Das war die erste Kurzgeschichte meines Lebens.)
Zweiundzwanzig Zentimeter Zärtlichkeit
Er heißt Juanito de Valespier, ist Franzose und hat einen Stammbaum, der bedeckt einen Bogen Packpapier. Einen großen. Und dabei ist er so klein. Als ich ihn kennenlernte, vor dreizehn Jahren, da konnte jedes ausgewachsene Meerschweinchen es mit ihm aufnehmen. Heute mißt er zweiundzwanzig Zentimeter. Heute ist er ein alter Herr, einundneunzig Jahre alt. Der liebe Gott möge ihn uns noch lange erhalten. Einundneunzig – das ist kein Spaß. Obwohl Juanito noch immer auf jedes Bett und auf jeden Stuhl springt, und wenn die dreimal so hoch sind wie er. Das machen Sie mal nach! Aber ach, ein Hundejahr steht eben für sieben Menschenjahre, und da ist so mancher Zahn, der Juanito fehlt. Ein Yorkshire-Terrier ist er. Sie wissen schon – das sind diese ganz Kleinen mit den langen Haaren, die ihnen ins Gesicht hängen, weshalb sie Schleifen zum Hochbinden benötigen. Weil er so winzig ist, wurde Juanito ›Moustique‹ getauft, das heißt ›Mücke‹.
Vor dreizehn Jahren besuchte mich die erste Große Liebe meines Lebens. Damals lernte ich Moustique kennen. Ich muß etwas gestehen: Ich mochte Hunde nie. Ich und Shakespeare. Der mochte sie auch nicht. Sie erinnern sich: ›… die Hunde, die durch ihr Bellen Gottes Frieden stören und den Gesang der Nachtigall …‹ (Goethe übrigens konnte Hunde auch nicht leiden. Wie ich.) Außerdem habe ich Angst vor Hunden, die größer sind als fünfzehn Zentimeter. Und die Hunde merken das natürlich sofort.
Moustiqe war zwölf Zentimeter groß, also noch drei Zentimeter unter der Angstschwelle, aber dafür war er damals ein ungeheurer Kläffer, und wenn jemand Gottes Frieden störte und den Gesang der Nachtigall, dann er.
Moustique ließ sich von keinem Fremden anrühren. (Adel verpflichtet.) Wenn es jemand versuchte, schnappte er zu. Er hatte die schlimme Gewohnheit, alle Menschen, sofern sie lange Hosen trugen, blitzschnell in dieselben zu kneifen, denn er hatte eine schlechte Meinung von den Menschen und argwöhnte stets, sie könnten etwas gestohlen haben und forttragen. Und dann, Gott sei’s geklagt, war er noch nicht stubenrein. Ein so junger Hund, das wäre ja auch zuviel verlangt, nicht wahr? Aber Moustique, in seiner Kindheit Blüte, übertrieb. Kein Vorhang, kein Tischbein, das er nicht angepinkelt hätte.
Bei mir war es eine mit Seidenbrokat überzogene Couch, die er sich aussuchte. Weil es doch meine erste Große Liebe war (nicht Moustique, sein Frauchen, das wir hier einmal Angela nennen wollen), legte ich, um Auseinandersetzungen zu vermeiden, ein Kissen über den feuchten Fleck, den der Edelmann auf dem Seidenbrokat hinterlassen hatte. Angela merkte es wohl, Moustique merkte es wohl. Sonst niemand. Die beiden dankten es mir mit Blicken …
Dreizehn Jahre später kam ich zu Angela. Sie lebt im Süden, am Meer, hoch oben in einem Penthaus, um das eine riesige Terrasse läuft. Als ich ihre Wohnung betrat, geschah das erste Wunder. Moustique kam mir entgegen, langsam und feierlich. Ich dachte an meine Hosenbeine, Gottes Frieden und so weiter. Nichts dergleichen! Moustique kniff nicht, Moustique bellte nicht. Moustique rieb sich an meinen Schuhen, sprang vor Freude immer wieder in die Höhe und gab keine Ruhe, bevor ich ihn nicht in den Arm genommen und gestreichelt hatte. (Hinter den Ohren, wie Hunde es lieben.) Danach kam ich aus dem Staunen nicht mehr heraus. Moustique begann mit mir zu schmusen, daß Angela fast eifersüchtig wurde. Moustique fraß Plätzchen, zerkleinert, nur noch aus meiner Hand. Moustique saß, wenn ich saß, nur noch in meinem Schoß. Wohin ich in der Wohnung ging – Moustique ging mit, dicht vor oder hinter meinen Füßen, ich mußte sehr achtgeben. Er hatte nicht vergessen – einundneunzig Menschenjahre nicht! –, daß ich ihm einst Schelte erspart hatte, als ich das Kissen auf den Pinkel-Fleck legte. Moustique war der erste Hund, der mich liebte. Und er war der erste Hund, den ich liebte, ganz plötzlich, ich konnte nicht anders. Da hatten wir das zweite Wunder.
Apropos Pinkeln: Moustique verließ schon lange nicht mehr das Penthaus. (Sein Alter, die Gefahren der Straße …) Er erledigte alle Geschäfte auf einem Seitentrakt der Terrasse, der immer mit dem Gartenschlauch saubergespritzt wurde. Angela nannte diese Gegend die ›Avenue de Pipi‹.
Moustique und ich wurden unzertrennlich. Wo immer ich war, da war auch er. Wenn ich nicht da war, dann suchte er mich überall und sprang immer wieder auf ›meinen‹ Sessel, um traurig meine Abwesenheit festzustellen. Oh, aber jedes Wiedersehen war ein Freudenfest, ein Hopsen, Streicheln, Flirten – niemals ein Bellen, niemals ein Kneifen! Moustique verließ mich auch nachts nicht. Er schlief am Fußende des Bettes. Wenn ihm kalt war, kroch er unter die Decke. Morgens, sofern er fand, daß ich lange genug geschlafen hatte und arbeiten mußte, weckte er mich mit vielen kleinen zärtlichen Schubsen seiner Nase auf meine Nase, meinen Hals, meine Wangen. Schlug ich dann die Augen auf, stand er auf meiner Brust, das Köpfchen schiefgelegt, und mit einer seiner winzigen Pfoten streichelte er mich ganz sanft.
Einmal, als ich im Bad saß, wollte Moustique auf den Wannenrand springen. Er sprang – aber er landete in der Muschel des Klos, das unmittelbar neben der Wanne stand. Wir zogen ihn heraus und wuschen sein ergrautes Haar und trockneten es, und ich fragte Angela, wie Moustique solch Irrtum hatte unterlaufen können.
»So etwas passiert ihm manchmal«, sagte sie. »Ist es dir denn nicht aufgefallen?«
»Aufgefallen, was?«
»Na, daß er dauernd direkt vor deinen Füßen läuft und sich bloß deshalb so schnell bewegen kann, weil er seit dreizehn Jahren in dieser Wohnung lebt und genau weiß, wo jedes Möbelstück steht, wo die Türen und Mauern sind. Er weiß nicht, wie du aussiehst«, sagte Angela, »er weiß nicht, wie ich aussehe. Er weiß nicht mehr, wie irgend etwas aussieht. Seit einem Jahr geht bei ihm alles nur noch nach Geruch und Geräusch und Gefühl und Erinnerung. Hast du denn wirklich nicht bemerkt, daß der arme Moustique blind ist?«
Karussell umsonst
Jakob Odernja ist dreiundvierzig Jahre alt und hat eine Metzgerei in Göttingen. Der Fleischerladen ist klein und alt, und dementsprechend schlecht ist das Geschäft. Außer dieser Metzgerei hat Jakob noch eine Frau – Hilde – und drei Kinder im Alter von sieben, neun und zwölf Jahren. Die Kinder sind in Ordnung, typische lustige Göttinger Kinder. Mit der Frau ist die Sache ein wenig schwieriger. Die Frau ist eigentlich ein Mann, so energisch ist sie. Alle haben Angst vor ihr. Auch Jakob. In der Metzgerei und zu Hause hat die Frau die Hosen an. Jetzt übrigens nicht mehr. Jetzt ist sie Jakob und seinen drei Kindern weggelaufen. Ganz plötzlich. Wegen einer Registrierkasse.
Das kam so:
Die Odernjas besaßen zwar eine nur schlecht gehende Metzgerei, aber daneben auch noch ein bißchen Geld. Das hatten sie sich im Laufe der Jahre zusammengespart. Und in die Göttinger Kreissparkasse gelegt. Als die Metzgerei nun schlechter und schlechter ging, da beschlossen die Odernjas eines Tages, dafür dem unerquicklichen Äußeren ihres Ladens und mangelnder Werbung die Schuld zu geben. Sie wollten einen Teil des Ersparten dazu verwenden, das Geschäft wieder ›feinzumachen‹, die Wände weißen zu lassen, eine neue Inneneinrichtung zu kaufen und vor allem eine Registrierkasse. So eine große, moderne, mit Chrombeschlägen, die klingelte, wenn man auf ihr addierte. Von einer solchen Kasse versprachen die Odernjas sich Wunder.