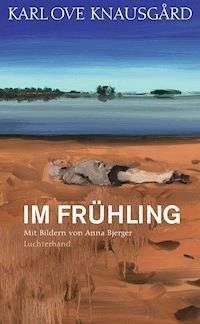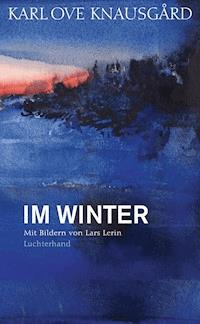10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über die Natur der Engel – und das Wesen der Menschen ...
Wie sieht es aus, das Göttliche? Hat es die Engel wirklich gegeben? In seinem hymnisch gefeierten Roman stellt Knausgård die großen universalen Fragen und geleitet uns durch die gewaltigen alttestamentarischen Erzählungen: über Kain und Abel, Noah und die Sintflut, über Sodom und Gomorrha, gelangen wir nach einem Zwischenstopp im spätbarocken und schließlich aufgeklärten Europa auf eine Insel vor der norwegischen Küste – bei einem modernen, schuldbeladenen Menschen, der die Einsamkeit sucht und die überwältigende Schönheit des Lebens findet …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1039
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
KARL OVE KNAUSGÅRD
Alles hat seine Zeit
ROMAN
Aus dem Norwegischen von Paul Berf
AUS IRGENDEINEM GRUND sind uns die Cherubim, jene fettleibigen und rotwangigen Putti, von denen die Gemälde der Spätrenaissance und des Barocks förmlich überschwemmt werden, als das Idealbild der Engel im Bewusstsein haften geblieben. Und völlig abwegig ist dies letztlich wohl nicht, da die Engel in dieser Epoche in mancher Hinsicht ihre Blütezeit erlebten. Gleichzeitig bildet diese den Wendepunkt in ihrer Geschichte. Damals erkannten es nur wenige, aber ihr Verfall hatte bereits eingesetzt, und für uns, die wir ihre Bilder im Lichte der Zeit betrachten können, die seither vergangen ist, sind die Anzeichen unübersehbar: Ihnen ist etwas Gieriges und Verhätscheltes zu eigen, das selbst die einschmeichelndste Pose nicht übertünchen kann, und vielleicht lässt sich gerade dies am schwersten verstehen – wie Unschuld und Reinheit, an deren Attributen sie doch unverbrüchlich festhielten, sich so leicht in ihr Gegenteil verkehren konnten. Doch genau das traf ein. Nun werden viele sagen, dass den Engeln nur recht geschah, weil sie nicht den Verstand hatten aufzuhören, sondern sich immer tiefer in die Welt hineinlocken ließen, der sie doch eigentlich dienen sollten, um schließlich in ihr gefangen zu sein. Mir persönlich scheint das grausame Schicksal, das sie ereilt hat, jedoch nicht wirklich im Verhältnis zu ihren Sünden zu stehen. Aber das ist natürlich meine ganz persönliche Meinung. Für die Engel spielt dies ohnehin keine Rolle mehr. Sie erinnern sich nicht länger, woher sie kommen oder wer sie einst waren, Begriffe wie Würde und feierlicher Ernst sind für sie inzwischen bedeutungslos geworden, ihr Denken ist allein darauf gerichtet, Nahrung aufzunehmen und sich fortzupflanzen.
Der Ursprung der Engel ist ungewiss. Um 400 n. Chr. behauptete Hieronymus, sie entstammten einer Zeit lange vor der Entstehung der Welt, und begründete dies mit ihrer auffälligen Abwesenheit in der Schöpfungsgeschichte, in der sie mit keinem Wort erwähnt werden, während Augustinus seinerseits den gegenteiligen Standpunkt vertrat, indem er Argumente dafür vorbrachte, dass die Engel in der Schöpfungsgeschichte erwähnt wurden, wenn auch nur indirekt, da sie in Gottes ersten Befehl, Es werde Licht!, mit einbegriffen waren und folglich am ersten Tag erschaffen wurden. Dieses Argument, das Thomas von Aquin aufgriff und verfeinerte, setzt allerdings voraus, dass das Verhältnis zwischen Engeln und Licht nicht nur, wie gemeinhin angenommen wurde, metaphorisch ist, sondern sich die beiden auf komplizierte Weise ineinander verstricken, zu etwas nahezu Identischem werden. Licht ist kein Engel, aber die Engel sind Licht. So schön der Gedanke auch ist und so viel er auch über die Natur der Engel aussagen mag, greift er dennoch zu kurz. Licht ist, wie sich der Bibel entnehmen lässt, nur eine von zahlreichen Erscheinungsformen der Engel, warum sollte also gerade sie als Bezeichnung herhalten, als diese vollendeten, von Gott bevorzugten Geschöpfe entstanden? Weil sie sich in ihrer Außerirdischkeit weder beschreiben noch verstehen lassen? Wenn das der Fall ist, erscheint es trotz allem seltsam, dass ihr Name unmittelbar darauf, in der Erzählung vom Garten Eden, ohne jede Scheu genannt wird und sie dort, es ist das erste Mal, dass die Engel in der Heiligen Schrift direkt erwähnt werden, so konkret und resolut präsent erscheinen, dass sie mit Schwertern ausgerüstet sind.
Ich glaube deshalb, Hieronymus hatte Recht mit seiner Argumentation: Die Engel werden in der Schöpfungsgeschichte nicht erwähnt, weil sie bereits existierten. Ob sie immer existiert haben, wie unter anderem Antinous Bellori behauptet, lässt sich unmöglich mit Gewissheit sagen. Überhaupt ist alles, was die Engel betrifft, in eine Art Nebel der Unklarheit gehüllt; wir wissen nicht, wann sie entstanden sind, wir wissen nicht, woher sie kommen, wir wissen nicht, welche Eigenschaften sie haben, wie sie denken oder was sie sehen, wenn sie uns sehen. Gleichzeitig werden sie in der gesamten Bibel mit einer Vertrautheit verfolgt, die ihre Gegenwart derart selbstverständlich erscheinen lässt, dass sie keiner näheren Erläuterung bedarf. Diese Ambivalenz ist nur natürlich, da das wichtigste Kennzeichen der Engel gerade darin besteht, dass sie zwei Welten angehören und die eine stets in die andere einbringen. An kaum einer anderen Stelle wird das so deutlich wie in der Erzählung vom Fall Sodom und Gomorrhas. Sie sind von einer Aura des Fremden umgeben (als Lot sie im Abendlicht vor dem Stadttor erblickt, läuft er ihnen entgegen und verneigt sich mit dem Angesicht zur Erde), wirken aber auch vertraut, denn unmittelbar darauf lädt er sie zu sich ein, backt ungesäuerte Kuchen und bereitet eine Mahlzeit vor, die sie verspeisen. Vermutlich ist es die eingangs erwähnte Vertrautheit, die es dem Verfasser nicht erforderlich erscheinen lässt, die Situation eingehender zu beschreiben. Da sitzen zwei Engel an einem Tisch in einer Küche in Sodom und speisen, zwei Engel, die von Gott entsandt wurden, um über das Schicksal der Stadt zu entscheiden, sie unter Umständen auszulöschen, und dann erfahren wir nichts darüber, wie die Stimmung ist, wie sie aussehen, was sie zueinander sagen. Nur diese lakonische Feststellung … und er machte ihnen ein Mahl und buk ungesäuerte Kuchen, und sie aßen. Das ist alles. Aber die Engel müssen dort eine ganze Weile gesessen haben, zumindest die Zeit, die es braucht, um ungesäuerte Kuchen zu backen, und ihre Anwesenheit muss Lot nervös gemacht haben, da er als Einziger wusste, in welcher Angelegenheit sie unterwegs waren. Ich kann ihn vor mir sehen, wie er vor dem Ofen steht und darauf wartet, dass die Kuchen fertig sind, wie er ein ums andere Mal verstohlen zu den beiden Engeln hinüberschaut, die schweigend am Tisch sitzen, seine Verzweiflung, die sich jedesmal steigert, wenn ein neuer Laut von der Straße zu ihnen hereindringt, denn er weiß, wozu sie im Stande sind, die Einwohner der Stadt, die kurz zuvor von der Anwesenheit der Fremden erfahren haben und sich nun in der Dunkelheit vor dem Haus versammeln. In Anbetracht der Dinge, die vorher geschehen sind, deutet einiges darauf hin, dass die Engel einen gewissen Widerwillen ausstrahlen – anfangs lehnen sie die Einladung ab, sie hatten vorgehabt, die Nacht auf den Straßen zu verbringen, aber Lot beharrt so sehr darauf, dass sie sich schließlich überreden lassen –, während Lot seinerseits sicher übereifrig und wie ein Plappermaul erscheint, weil er so fixiert darauf ist zu verhindern, dass sie begreifen, was vor dem Haus vor sich geht.
Dann sind die Kuchen endlich fertig. Er holt sie aus dem Ofen und stellt sie zum Abkühlen beiseite, deckt den Tisch mit Speisen und Getränken, spürt, dass die körperliche Nähe zu ihnen das Herz in seiner Brust schwer schlagen lässt, spürt die Kälte, die sie umgibt, bekämpft das Gefühl jedoch, reibt sich die Hände und platzt munter heraus:
»Jetzt wollen wir es uns aber so richtig schmecken lassen!«
Er bekommt keine Antwort. Obwohl im Bibeltext nur steht, dass sie speisen, bin ich mir einigermaßen sicher, sie müssen ziemlich hungrig gewesen sein und tüchtig zugelangt haben, ohne auch nur den Versuch zu machen, ihren Heißhunger zu verbergen. Die genaue Formulierung im Text lautet … und sie aßen. Der unerwartete Punkt beendet den Satz abrupt. Doch die Sprache ist nur eine Karosserie, und was die Sprache in sich birgt, wird von der erreichten Geschwindigkeit weitergeschleudert, über den Punkt hinweg, aus dem Satz heraus und zwischen die Zeilen, wo es natürlich nicht mehr gelesen, nur noch erahnt werden kann.
Sie essen. Während die eine Hand den Knochen hält, von dem sie mit ihren Zähnen immer neue Bissen reißen, tastet die andere blindlings über den Tisch, um sicherzustellen, dass ein Stück Brot oder Käse zur Hand ist, sobald der Bissen hinuntergeschluckt wurde, wenn sie denn nicht bereits um den Kelch mit Wein geschlossen ist, den Lot immer wieder füllt, ohne dass sie es zu bemerken scheinen, da sie vollauf damit beschäftigt sind, sich mit dem vollzustopfen, was sie vor sich haben. Sie schmatzen und schlürfen, ihre Wangen glänzen vor Fett, ab und zu gleiten die Augäpfel nach oben und lassen ihren Blick weiß und leer erscheinen. Obwohl ihr Anblick Lot mit Angst erfüllt, wünscht er sich doch, die Mahlzeit möge dauern, denn so lange sie essen, nehmen sie nichts um sich herum wahr, und auf der Straße vor dem Haus haben die Leute inzwischen begonnen, seinen Namen zu rufen. Deshalb erhebt er sich vorsichtig, sobald auf dem Tisch etwas zur Neige zu gehen droht, schiebt sich in die Speisekammer und holt weitere Speisen, die er möglichst diskret vor ihnen abstellt, um bloß keine Aufmerksamkeit zu erregen und so den tranceartigen Zustand zu stören, in dem sie sich befinden.
Vielleicht klappt es ja doch, denkt er. Nach einer Mahlzeit wie dieser werden sie bestimmt schläfrig sein, und wenn er verkündet, dass er sich zum Schlafen zurückziehen wird, könnten sie versucht sein, seinem Beispiel zu folgen. Der Abend ist trotz allem bereits fortgeschritten, denkt er. Und ein Nachtlager hat er auch schon für sie vorbereitet.
Diese Gedanken muntern Lot auf. Dann aber entdeckt er, dass die beiden Engel dasitzen und ihn anschauen. Mit hochrotem Gesicht erkundigt er sich, ob sie satt sind. Sie nicken und danken ihm für das Essen. Vor dem Haus ist es still. Nachdem er den Tisch abgedeckt hat, streckt er die Arme in die Höhe und gähnt.
»Es ist spät geworden«, sagt er. »Wird es nicht allmählich Zeit, sich schlafen zu legen?«
Die Engel schieben ihre Stühle zurück und stehen auf. Das Ungestüme ihrer Mahlzeit ist von ihnen abgefallen, nun strahlen die beiden Diener des Herrn von Neuem Ruhe und Würde aus, und für einen Moment bildet Lot sich ein, er hätte das Ganze nur geträumt.
»Ich habe euch gleich da drüben ein Lager für die Nacht bereitet«, sagt er und zeigt zum Nebenzimmer. »Wenn ihr mir bitte folgen wollt …?«
Es funktioniert, denkt er. Es funktioniert!
In diesem Augenblick klopft jemand fest an die Haustür. Lot tut so, als wäre nichts passiert, und bewegt sich weiter durch den Raum, aber in seinem Rücken sind die Engel stehen geblieben.
»Was war das?«, sagt der eine.
»Sicher nur ein paar Lausebengel«, erwidert Lot. »Kümmert euch nicht darum.«
Dann dringt von der Straße ein Ruf zu ihnen herein.
Lot!, wird gerufen. Wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht? Führe sie heraus zu uns, dass wir sie erkennen.
Ihm bleibt keine andere Wahl. Mit der Kerze in der Hand geht er an den beiden Engeln vorbei und öffnet die Tür zu der Menschenmenge, die sich vor dem Haus versammelt hat. Aber er hat die Hoffnung noch immer nicht aufgegeben. Denn so steht geschrieben: Lot ging heraus zu ihnen vor die Tür und schloss die Tür hinter sich zu und sprach: Ach, liebe Brüder, tut nicht so übel!
Zentral ist an dieser Stelle nicht die Aufforderung, die er an seine Mitbürger richtet, sondern die Information, dass er zuvor sorgsam bedacht gewesen ist, die Tür hinter sich zu schließen. Lot versucht also weiterhin zu verhindern, dass die Engel erfahren, was vor sich geht. Ich finde, dies hat etwas geradezu Rührendes; wie verzweifelt muss er sein, wenn er die Engel mit Hilfe einer geschlossenen Tür am Einblick zu hindern sucht?
»Seht, ich habe zwei Töchter, die noch nie etwas mit einem Mann zu schaffen hatten«, sagt er. »Lasst mich sie zu euch hinausführen und macht mit ihnen, was ihr für richtig erachtet! Tut nur diesen beiden Männern nichts, da sie unter den Schatten meines Daches getreten sind!«
Aber sie hören nicht auf ihn.
»Geh uns aus dem Weg!«, rufen sie. »Hier ist dieser eine Mann gekommen, um hier als Fremder zu wohnen, und dann will er sich immer zum Richter aufspielen! Jetzt wollen wir dir schlimmer zusetzen als ihnen!«
Rasend stürmen sie heran und umdrängen ihn, um sich Zugang zum Haus zu verschaffen.
Das ist der Moment, in dem die Engel eingreifen. Sie packen Lot, ziehen ihn ins Haus, schließen die Tür hinter sich und schlagen die Menschenmenge vor dem Haus gleichzeitig mit Blindheit, sodass sie nicht mehr in der Lage ist, ihnen zu folgen. Man könnte fast meinen, sie hätte im Namen Lots die Wut gepackt. Er muss ihnen im Laufe des Abends wohl sympathisch geworden sein, sie haben insgeheim über seine hilflosen Versuche geschmunzelt, ihnen seine eigentlichen Absichten zu verbergen.
»Hast du hier jemanden, entweder einen Schwiegersohn oder Söhne oder Töchter oder sonstwen, der in dieser Stadt zu dir gehört, dann führe sie fort von diesem Ort!«, sagen sie zu ihm. »Denn nun werden wir diesen Ort zerstören, denn es sind dem Herrn laute Klagen über die Leute zu Ohren gekommen, und der Herr hat uns gesandt, um ihn zu zerstören.«
Lot tut, wie ihm geheißen, geht hinaus und spricht mit seinen Schwiegersöhnen, aber es mangelt ihm an der nötigen Autorität, sie denken, er mache Witze. Danach hat er nichts Besseres zu tun, als sich schlafen zu legen. Denn als nächstes steht geschrieben: Da nun die Morgenröte aufging, hießen die Engel den Lot eilen und sprachen: Mache dich auf, nimm dein Weib und deine zwei Töchter, die vorhanden sind, dass du nicht auch umkommst in der Missetat dieser Stadt.
Als Lot zögert, nehmen die Engel alle vier an der Hand und geleiten sie aus der Stadt. Am gleichen Tag zu späterer Stunde wird sie in Schutt und Asche gelegt und alles Leben in ihr ausgemerzt. Am nächsten Morgen, so steht geschrieben, steigt der Rauch vom Land auf wie der Rauch von einem Schmelzofen.
Es ist eine eigenartige Erzählung, und es fällt nicht leicht, die Rolle der Engel in ihr zu begreifen. Traditionell bilden sie das Bindeglied zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen, sind zugleich Boten und das, wovon die Botschaften künden. Die Botschaft des Engels, der Maria aufsucht, um ihr mitzuteilen, dass sie schwanger ist, ist gleichzeitig das, was sie schwängert. Handlung und Bedeutung bilden eine Einheit bei den Engeln. Alles, was sie tun, muss gedeutet werden. Deshalb sind ihre Handlungen im Allgemeinen so groß und einfach wie die Gesten von Schauspielern auf einer Bühne, die ebenfalls mit Rücksicht auf den Abstand zum Zuschauer ausgeformt werden, und deshalb erscheint ihr Verhalten Lot gegenüber so eigenartig. Ist er nicht zu klein für sie? Kommen sie ihm nicht zu nahe? Schon, könnte man sagen, aber vielleicht ist ja gerade das der Punkt? Vielleicht wollen sie dadurch den kleinen, redlichen und fürsorglichen Mann herausheben und zugleich die grauenvollen Handlungen rechtfertigen, die folgen: Der einzig Reine wird verschont, alle anderen sind unrein, sie haben es verdient, bestraft zu werden. Und das ist, aus unserem Blickwinkel betrachtet, sicher richtig. Den Engeln muss es jedoch in einem anderen Licht erschienen sein. Was immer wir über sie denken mögen, ist belanglos. Sie gehören nicht hierher, wie sie auch nicht in den Himmel gehören; die Bewegung dazwischen ist ihr Element. Mitgefühl ist ihnen fremd, sie stehen uns und allem, was zu unserer Sphäre gehört, gleichgültig gegenüber, daher die Aura der Grausamkeit, die sie oftmals umgibt.
Doch im Verhältnis zu Lot zeigen sie also Einfühlungsvermögen und Fürsorglichkeit.
Woran mag das liegen?
Ich denke, die Erklärung ist simpel. Bekanntermaßen können die Engel jede beliebige Form annehmen. Weniger bekannt ist hingegen, dass die Form, die sie annehmen, für sie auch eine Bedrohung darstellt. Halten sie zu lange an ihr fest, beginnt die Form sie zu prägen, und falls sie die Warnsignale nicht erkennen, wird die Form sie schließlich vollends vereinnahmen. In Sodom zeigten sie sich als Menschen. Es war mit Sicherheit so geplant, dass sie durch die Straßen gehen, Sünder von Nicht-Sündern scheiden und anschließend die Stadt vernichten sollten. Lots Eingreifen vereitelte diesen Ablauf der Ereignisse jedoch. Anfangs lehnen sie seine Einladung noch ab, dann aber müssen sie gedacht haben: Warum eigentlich nicht? Ein wenig Essen und eine kurze Pause können doch nicht schaden, oder? Als sie ihn erst einmal zu seinem Haus begleitet hatten, mussten sie dort sitzen und warten, bis die Kuchen fertig würden, weiterhin engelhaft in ihrem Schweigen, ihrer Würde und ihrer Kälte, während sich ihre Gedanken gleichzeitig sachte in ihrer Umgebung verhakt und sie all das bemerkt haben müssen, was Engeln sonst nie ins Bewusstsein dringt, sodass sie sich, als die Mahlzeit beendet war, fatal in Lots trivialer Wirklichkeit verstrickt hatten. Dieser verzagte Mann bedeutete ihnen plötzlich etwas, und die Impulse, nach denen sie handelten, richteten sich eher nach ihm als nach dem Auftrag, in dem sie unterwegs waren. Das könnte die rasende Wut erklären, mit der Sodom und Gomorrha zerstört wurden. Sobald Lot aus ihrem Blickfeld verschwunden war, sahen sie wieder sich selbst, begriffen, wie schwach sie gewesen waren, und ließen ihren Zorn an den beiden Städten aus. Denn sie vernichteten nicht nur alle Häuser und alle Einwohner, sondern auch die gesamte Ebene und alles, was in der Erde wuchs – und Lots Frau, der es nicht gelang, die Vergangenheit einfach fahren zu lassen, nicht einmal das Böse in ihr, verwandelten sie in eine Salzsäule.
Einem modernen Leser der Bibel fällt auf, wie eng die Verbindung zwischen dem Diesseits und dem Jenseits früher war. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass Gott echtes Interesse an den Menschen hatte, schon der nichtigste Anlass reichte aus, um ihn sich zeigen und zu den Menschen sprechen zu lassen oder einen seiner Engel auf die Erde zu senden, um den göttlichen Willen zu vollstrecken. Diese fortwährenden Eingriffe führten allerdings nie zu einer dauerhaften Verbesserung. Im Gegenteil, alles verfiel immer wieder in den alten Trott. Alles Gute und Gerechte scheint das Ergebnis gewaltiger Anstrengungen zu sein, die ständig wiederholt werden müssen, in einem permanenten Instandhaltungsprozess, der die Kräfte jedes Menschen übersteigt. Auch Lot, der unerwartete Günstling der Engel, wurde schließlich schwach. Nach der Flucht aus Sodom ließ er sich mit seinen beiden Töchtern in den Bergen über Soar nieder. Noch zu ängstlich, um sich wieder in die Stadt hinabzuwagen, wohnten sie in einer Höhle, wo er beide schwängerte. Sicher, sie lebten nach einem Vorfall, der an das Jüngste Gericht erinnerte, alleine in den Bergen und mögen in ihrer Verwirrung geglaubt haben, die letzten noch lebenden Menschen zu sein, und sicher, die Begattung geschah auf Initiative der Töchter, die ihn mit Wein betrunken machten, ehe sie sich zu ihm legten, aber Lot muss trotzdem genau gewusst haben, welche Grenze er überschritt. Er wollte seine Töchter haben, und er bekam sie. Denn so dicht können sich die Gedanken der Begierde über dem Himmel des Bewusstseins verfilzen, dass nicht einmal ein schmaler Streifen Licht zur Seele hinabreicht, deren dunkler und feuchter Grund alles Leben außer den niedersten Lebensformen ausschließt; Moose und Pilze, Käfer und Gewürm, die eine oder andere schleimige Schnecke, die blind im Morast kriecht. Und von wem kann man schon erwarten, dass er unter solchen Umständen das Richtige tut? Eine Zeit lang schaffst du es vielleicht noch, die Lichtung offen zu halten. Gerecht und erleuchtet bist du dann, früher oder später schläfst du jedoch ein, und wenn du erwachst, wirst du einmal mehr von Dunkelheit umfangen. Reichen deine Kräfte, machst du dich von Neuem ans Werk, wenn nicht, gibst du auf. Die menschliche Seele ist eine Rodung im Wald, und dem göttlich Reinen und Makellosen muss es völlig unbegreiflich sein, warum sie immer wieder zuwächst. Das ist der Kampf, von dem die Bibel erzählt. Die Dunkelheit, die sich immer und immer wieder herabsenkt, über Mensch auf Mensch, Generation für Generation, Jahrhundert für Jahrhundert, bis die Verzweiflung unerträglich geworden ist und die Erzählung in der Beschreibung der wahnwitzigen apokalyptischen Raserei endet, die Johannes auf Patmos offenbart wurde. Dass sie lange unterdrückt gewesen ist, lässt sich eindeutig der folgenden Passage entnehmen: Und es wurden die vier Engel los, die bereit waren auf die Stunde und auf den Tag und auf den Monat und auf das Jahr, dass sie töteten den dritten Teil der Menschen. Sie köpfen die Menschen, sie verbrennen sie, sie martern sie bei lebendigem Leib, und aus dem Brunnen des Abgrunds senden sie Schwärme giftiger Heuschreckenskorpione auf sie herab, die weder dem Gras noch Büschen oder Bäumen Schaden zufügen, sondern nur den Menschen, denen das Siegel Gottes auf der Stirn fehlt. Sterne stürzen auf die Erde, die Sonne verfinstert sich, die Wälder brennen in gewaltigen Feuerstürmen, das Meer wird zu Blut. Ein riesiges Heer wird ausgesandt, zwanzigtausend Mal zehntausend Männer, und auf ihren Pferden mit Löwenhäuptern, in feuerroten, dunkelroten und schwefelgelben Kettenhemden, müssen sie für Johannes ein überwältigender Anblick gewesen sein. Seine Beschreibungen sind so detailliert, dass es keinen Grund gibt anzuzweifeln, dass er gesehen hat, worüber er schreibt, aber trotzdem gibt es einen Missklang, denn nachdem er seine Vision in der Höhle auf Patmos hatte, sind Dinge geschehen, die das von ihm beschriebene Szenario unmöglich machen. Die Welt wird untergehen, jedoch nicht auf diese Weise. Die Engel haben all ihre Macht verloren, die sie einmal hatten. Würden sie heute gegen uns in den Krieg ziehen, hätten wir keine Mühe, sie zu zermalmen. Es ist anzunehmen, dass sie zu jener Zeit tatsächlich alles auszulöschen planten und es auch so gekommen wäre, wenn bei ihnen nicht etwas fürchterlich schiefgegangen wäre, sodass es keinen Grund gibt, Johannes Vorwürfe zu machen, denn er handelte in gutem Glauben, und die Raserei, deren Zeuge er geworden war, war zumindest echt.
Es war der Erfolg des Christentums, den die Engel nicht vorhersahen. Zu der Zeit, als sie Johannes die Apokalypse vor Augen führten, war das Christentum nichts weiter als eine kleine, unbedeutende Minderheitenreligion, vergleichbar den UFO-Sekten unserer Zeit, und da man den Christen allerorten mit Misstrauen begegnete, sie später sogar verfolgte, folterte und tötete, rechnete niemand damit, dass ihr Glaube Bestand haben könnte. Als sich das Christentum in den ersten Jahrhunderten nach Christus auf einmal auszubreiten begann, traf diese Entwicklung die Engel völlig unvorbereitet. Seele für Seele in Land für Land wurde bekehrt. Und alle priesen sie die Engel. Gedichte wurden über sie geschrieben, Bilder gemalt, Abhandlungen verfasst, Geschichten erzählt. Im Mittelalter waren die Engel schließlich in aller Menschen Bewusstsein. Wenn sie sich zeigten, lösten sie Zustände aus, die an Hysterie erinnerten, denn durch ihre Gegenwart verkündeten sie, wer auserkoren worden war, Gottes Willen auszuführen, ob dieser nun darin bestand, sein Vermögen abzugeben und sein Leben den Armen zu widmen, wie im Falle eines Franz von Assisi, oder das französische Heer in den Kampf gegen die Engländer zu führen, wie Jeanne d’Arc, oder auch nur, sich selber blutig zu peitschen, wie die zahlreichen Flagellanten es taten. Körper wurden von Krämpfen geschüttelt, fielen in tiefe Trance, sprachen in unverständlichen Zungen, Wunden öffneten sich plötzlich. Die Engel selbst standen außerhalb dieser monströsen Inkarnation von Gottes Wort, aber es muss faszinierend für sie gewesen sein, dass sie durch ihre bloße Gegenwart ein Phänomen hervorrufen konnten, das ihnen über die Maßen fremd war. Sie selber waren hell, schön, rein und müssen sich mehr und mehr an der Anbetung berauscht haben, die ihnen zuteil wurde. Jedenfalls offenbarten sie sich immer öfter und wurden mit der Zeit auch Gegenstand einer anderen, nicht weniger intensiven Form der Huldigung, und zwar durch die Berge wissenschaftlicher Schriften und Abhandlungen über Engel, die im Mittelalter verfasst wurden und in denen ihre zahlreichen Erscheinungsformen in einer Art Taxonomie der Engel dokumentiert, systematisiert und klassifiziert, Familien, Arten und Unterarten differenziert wurden. So unterschied der in Uppsala lehrende, schwedische Theologe Lönnroth zwischen materiellen und immateriellen, sichtbaren und unsichtbaren, unveränderlichen und veränderlichen Engeln mit oder ohne freien Willen. In seinem Werk Über die himmlische Hierarchie ging Pseudo-Dionysios davon aus, dass es neun Klassen von Engeln gab, während Gregorius Tholosanus meinte, es seien in Übereinstimmung mit den sieben Planeten sieben Klassen, wobei die guten sich über dem Mond, die bösen darunter befänden. Johannes Durandus diskutierte die Frage, ob Engel ein Gedächtnis haben oder sich ihr Bewusstsein in einem ewigen Jetzt befindet. Waren sie reine Form (creatura rationalis et spiritualis)? Oder waren sie, wie der Mensch, sowohl Form als auch Materie (creatura corporalis et rationalis)? Bodine und David Crusius verfochten, in Theatrum naturae respektive Hermetica philosophia, die These, dass sie voll und ganz körperlich waren. Bodine meinte jedoch, seltsam genug, sie müssten rund sein wie Kugeln, da dies die perfekteste aller Formen sei, während Bochard sich sogar zu der Behauptung verstieg, sie seien auch sterblich, nähmen Nahrung zu sich und hätten Verdauung.
Wahrlich, das Mittelalter war das Zeitalter der Engel. Können wir es ihnen da zum Vorwurf machen, dass sie sich von der gewaltigen Aufmerksamkeit geschmeichelt fühlten? Dass sie immer öfter in der Nähe der Menschen zu finden waren, selbst wenn sie dort keine bestimmte Aufgabe auszuführen hatten? Nach wie vor strahlten sie mit ihren strengen Mienen, schlichten Gewändern und steifen Bewegungen Würde aus. Nach wie vor hatte ihre Schönheit etwas Hartes und Grausames, aber nicht aus einer Verwilderung heraus, sondern ihrem Gegenteil, einer schier unmenschlichen Beherrschung, die allerdings endete, wenn sie sangen – oh, der Gesang der Engel, wie schön er war! –, denn dann wurden ihre Züge sanft, ihre Wangen röteten sich, die Augen füllten sich mit Tränen. Doch so konnte es unmöglich bleiben. Im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts wurden ihre Aufenthalte unter den Menschen immer länger und zahlreicher, zu Beginn des 15. Jahrhunderts kam es zu ersten Veränderungen in der Physiognomie der Engel. Ein Gemälde von Francesco Botticini aus dieser Periode zeigt mit wünschenswerter Deutlichkeit, was geschehen ist. Michael, Raphael und Gabriel, drei der Erzengel, wandeln mit einem jungen Knaben durch eine Landschaft, wahrscheinlich eine italienische. Michael trägt traditionsgemäß eine Rüstung, in der Hand hält er ein erhobenes Schwert, dennoch ist nichts Mächtiges oder Furchterregendes an seiner Gestalt, im Gegenteil – sein Gesicht ist sanft und knabenhaft, die Wangen sind ein wenig füllig, die Haare lang und sorgsam frisiert, und zu seiner schwarzen Rüstung hat er sich für rote Schuhe entschieden, ein passendes Rot, ein goldbestickter Umhang und eine rote Schwertscheide mit vergoldetem Endstück, sodass er eher einem jungen, eitlen Adligen gleicht als einem siegreichen Kriegsherren, unter dessen Kommando alle Engel des Himmels stehen. Sicher, in seinem Blick hat er sich etwas von seiner früheren Rücksichtslosigkeit bewahrt, aber so lange seine Gestalt ansonsten derart manieriert und selbstverliebt auftritt, gleicht sein Blick eher dem hochmütigen Antlitz eines verwöhnten Jünglings. Raphaels Gewand ist violett, über die Schultern hat er sich einen roten, goldbestickten Umhang geworfen, der um den Hals von einer einzigen Perle zusammengehalten wird und so drapiert ist, dass an den Armen die mattgrüne Innenseite sichtbar wird. Um die Taille trägt er eine rote und schwarze Schärpe, auch sie goldbestickt, während seine Flügel mit grünen und schwarzen Kreisen dekoriert sind, nicht unähnlich der Musterung von Pfauenfedern. Seine Hüften sind breit, die Körperhaltung feminin, die Haare lang und golden, das Gesicht so schön wie das einer schönen Frau. Der kleine Mund ist verkniffen, der Blick in den halb geschlossenen Augen voller Langeweile und Überdruss. Auch Gabriels Gestalt ist in einen Seidenumhang gehüllt, der dunkelgrün ist und einen schwarzen, goldbestickten Kragen hat, während seine Flügel rot sind, sein Gesicht ist in einer Geste zum Betrachter hin gehoben, die herausfordernd hätte sein können, wäre da nicht dieser fast schon demonstrativ desinteressierte Blick. Er weiß, dass er gesehen wird, er weiß, dass er gut aussieht, reagiert darauf jedoch mit Teilnahmslosigkeit. Gleichzeitig sind seine Augen aber auch voller Trauer, was seinen Blick rätselhaft erscheinen lässt. Warum starrt er uns so an? Er muss etwas von uns wollen.
Aber was?
Zu Beginn der Renaissance ging man dazu über, die Engel mit Blicken abzubilden, die diesem ähnelten und ausnahmslos Mitleid mit den Menschen ausdrückten, als wären die Engel ihnen erst jetzt nahe genug gekommen, um zu verstehen, was sie vor Augen hatten. Aber Gabriels Blick ist anders, in sich gekehrt: Er leidet nicht mit uns, sondern mit den Engeln. Als Einziger ahnt er, wohin der Weg führt, den sie eingeschlagen haben. Es ist schade um die Engel, scheint er sagen zu wollen, während er an uns vorbeigeht. Doch das deutlichste Zeichen dafür, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte, sind letztlich ihre Gloriolen. Während sie zu Zeiten Cimabues und Giottos so stark leuchteten, dass sie bisweilen Scheiben aus Gold glichen, sind sie hier so blass, dass sie wie Gabriels rote Flügel nur vor einem dunklen Hintergrund sichtbar werden. Vor dem Himmel sind sie durchsichtig. Diese Engel sind gefallen, fallen jedoch so langsam, dass sie es selber nicht merken.
Die Tatsache, dass ein weiteres Jahrhundert vergehen sollte, bis diese Veränderungen auch das Leben, Verhalten und Wesen der Engel zu prägen begannen, muss entweder bedeuten, dass sie im Hinblick auf ihr Schicksal weiterhin mit Blindheit geschlagen waren, was angesichts der langen Zeitspanne wenig wahrscheinlich sein dürfte, oder aber sie zogen schlichtweg keine Konsequenzen daraus, sondern lebten in der Hoffnung, dass ihr neuer Zustand nur vorübergehender Art sein würde, so wie manche Menschen die Augen noch vor den schwerwiegendsten Symptomen verschließen und erst einen Arzt aufsuchen, wenn die Krankheit so weit fortgeschritten ist, dass es ihnen nicht länger möglich ist, die Wahrheit zu leugnen, nicht einmal vor sich selbst. Denn nachdem sie im 15. Jahrhundert in der Nähe einzelner italienischer Stadtstaaten zu einem immer alltäglicheren Anblick geworden waren, zogen sich die Engel in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts allmählich zurück, vermutlich in dem Versuch, das alte Weltbild wiederherzustellen, in dem das Erscheinen eines Engels ein so einzigartiges und seltenes wie Furcht einflößendes und bedeutungsvolles Ereignis gewesen war, was ihnen jedoch nicht gelang, denn dazu waren sie den Menschen nun zu vertraut geworden. Sie waren zu weit gegangen, ganz gleich, ob es aus Übermut oder nur aus mangelnder Wachsamkeit geschehen war. Mancherorts waren Engel ein so alltäglicher Anblick geworden, dass die Aura ihrer Offenbarung, die eiskalte Furcht und ekstatische Freude, die ihr Anblick stets ausgelöst hatte, peu à peu geschwächt wurde. Väter zeigten sie ihren Kindern, Bauern hielten sie für ein gutes Omen, Landpfarrer fühlten sich geschmeichelt, wenn sie sich in den Kirchen zeigten. Sie schienen schon immer da gewesen zu sein. Selbst der Lichtschein ihrer nächtlichen Lagerfeuer in den Bergen vor den Toren der Städte, der unter den Menschen anfangs solche Angst und Unruhe ausgelöst hatte, nicht zuletzt, weil man sich erzählte, dass die Engel in großen Scharen die ganze Nacht hindurch vollkommen regungslos auf der Erde saßen und immer nur in die Flammen starrten, als wären sie hypnotisiert oder lebende Tote, war mit der Zeit zu einem Zeichen für das genaue Gegenteil geworden. Im Laufe vieler Generationen hatte sich die Vorstellung herausgebildet, die Engel würden über ihre Stadt wachen. Dass sich diese Vertrautheit nur in recht wenigen Quellen widerspiegelt, ist kaum verwunderlich, da es in der Natur des Menschen liegt, eher dem Ungewöhnlichen als dem Gewöhnlichen, eher der Ausnahme als der Regel Aufmerksamkeit zu schenken. Die Leute hatten ebenso wenig Grund, die Wanderungen der Engel auf der Erde zu erwähnen, wenn sie sich Briefe schrieben, wie den Flug der Vögel am Himmel. Eine Ausnahme bildete die Kunst, in der die Engel nach wie vor gemalt und besungen wurden. Doch auch dort verblich ihre überirdische Aura, immer mehr sah man in ihnen einfach etwas Schönes, so wie ein Tier oder eine Blume oder eine Landschaft schön ist.
Als sie dann anfingen, sich zurückzuziehen, zog sich dieser Prozess über mehrere Generationen hinweg, sodass den Menschen die Veränderung nicht weiter auffiel. Das kollektive Gedächtnis gibt seine Vorstellungen nämlich nur sehr langsam auf, und in ihm sollte der Anblick von Engeln noch lange ein gewöhnliches Phänomen bleiben.
Die fast schon manische Beschäftigung eines Antinous Bellori mit der Anwesenheit der Engel in der Welt muss vor diesem Hintergrund verstanden werden. Bellori wurde 1551 in Ardo geboren, einem kleinen Dorf in den Bergen im äußersten Norden Italiens, wo er aller Wahrscheinlichkeit nach lebte, bis er 1565 sein Studium begann. Abgesehen von einer bestimmten Begebenheit, auf die er Zeit seines Lebens immer wieder zurückkommen wird, ist uns über seine ersten Lebensjahre nur wenig bekannt. Weder die Namen seiner Eltern noch seines Heimatdorfs tauchen in Antinous’ Schriften auf, und da seine Aufzeichnungen ansonsten umfangreiches autobiografisches Material beinhalten, hat dieses Dunkel der Kindheit die Neugier vieler seiner Leser geweckt. Doch wenn man versuchen möchte, Antinous zu verstehen, sollte man sich nicht seinem Inneren zuwenden. Denn selbst wenn es einem gelänge, seine innere Landschaft zu dokumentieren, wie sie tatsächlich war, bis in die kleinste Spalte und Furche im Massiv seines Charakters hinein, unmerklich geformt von der langsamen Erosion der Begebenheiten, und man den Lauf der Gefühlsströme bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen würde, Erlebnissen in der Kindheit, der Jugend oder dem Mannesalter, so würde man trotz allem nicht klüger werden, da die Bedeutung des Dokumentierten doch stets unbekannt bliebe. Selbst wenn die Ereignisse und Beziehungen in seinem Leben bis ins Detail mit einem Leben in unserer Zeit zusammenfielen, das wir verstehen und kennen, würden wir ihm doch niemals näherkommen. Antinous war in erster Linie ein Teil seiner Zeit. Will man verstehen, wer er war, ist sie es, die man untersuchen muss. Dass wir diesem Unterschied so wenig Beachtung schenken, liegt womöglich vor allem am anhaltenden Einfluss Freuds, dieses spekulativen Genies des 20. Jahrhunderts, dessen fatale Verwechslung von Kultur und Natur, kombiniert mit dem ebenso fatalen Beharren auf den inneren Konsequenzen äußerer Begebenheiten, mehr als alles andere unser Selbstverständnis geprägt und uns derart weit von unseren Vorfahren entfernt hat, dass wir glauben, sie wären so gewesen wie wir. Aber unsere Welt ist nur eine von vielen möglichen, woran uns nicht zuletzt die Schriften eines Antinous Bellori und seiner Zeitgenossen erinnern.
Die alles entscheidende Begebenheit in Antinous’ Leben trug sich zu, als er elf Jahre alt war. Wo er herkam, erfahren wir nicht, ebenso wenig, wohin er danach ging, und gerade dass dieses Ereignis vom Dunkel des Unerwähnten umgeben ist, lässt jedes Detail in seiner Geschichte mit ungeheurer Deutlichkeit hervortreten. Der rote Schimmer im Erdreich, auf dem er geht, das grüne Laub in den Bäumen entlang des Flusses, dem er sich nähert, die gelbe Sonne, der blaue Himmel, die Libelle, die für einen Moment direkt vor ihm in der Luft hängt, ehe sie sich gleichsam löst und in der nächsten Sekunde unterwegs zu den Bäumen ist. Die Angelrute, die er über der Schulter trägt, seine staubigen Füße, die Stirn, auf der Schweißperlen glänzen. Wie der Schatten der Bäume von den Sonnenstrahlen in kleine, zitternde Flecken aus Licht zersplittert wird, sobald der Wind die Äste erfasst und langsam auf und ab wippen lässt. Das Grün auf den Steinen am Flussufer, die Kontraktionen der Strömung an der schwarzen Wasseroberfläche, die Hosenbeine, die das Wasser dunkel färbt, als er die Füße hineintaucht, die Augen, die sich wonnevoll schließen.
Den ganzen langen Sonntag hat er sich hierauf gefreut. Hierher zu kommen, zu der Vertiefung im Flussbett, dem schattigen Kolk, seinem Stammplatz, und zu fischen.
Nach einer Weile steht er auf, holt einen Wurm heraus, den er in der Tasche hat, und spießt ihn auf den Haken. Selbst mit halb aufgespießtem Körper versucht der Wurm noch, sich freizuwinden. Mit seiner blassrosa Farbe und den kleinen Rillen in der Haut ähnelt er ein wenig einem Finger, denkt Antinous und studiert ihn einige Sekunden, ehe er nach dem sich weiter krümmenden Wurmende greift und den Haken auch dort hindurchpresst. Anschließend wirft er die Angel aus.
Als eine halbe Stunde später noch immer kein Fisch angebissen hat, folgt er dem Flusslauf ein paar hundert Meter stromaufwärts zu seiner nächsten Angelstelle. Doch auch hier beißt nichts an. Rastlos, wie er ist, beschließt er, die Angelrute zu verstecken und stattdessen zu einem Erkundungsgang im Tal aufzubrechen. Er steht eine Weile über der Stromschnelle und starrt auf das glitzernde Wasser, fasziniert davon, dass sich all seine Bewegungen unablässig am gleichen Ort abspielen, angefangen beim anschwellenden Strom ganz oben, wo es aussieht, als fließe das Wasser unter einer Haut, bis zum brausenden Wasserfall die Absätze herab, der in die unterhalb wartenden Wassermassen gleichsam eingepflügt wird und dort an der Oberfläche unzählige kleine Strudel bildet.
Die Strudel sind doch aus Wasser, denkt er. Aber warum fließen sie dann nicht fort, wenn das Wasser fortfließt?
Er hievt oberhalb der Stromschnelle einen Stock in den Fluss und läuft neben ihm flussabwärts, schneller und schneller, bis der Stock über die Kante des Wasserfalls schießt und in der Gischt verschwindet. Als der Stock unmittelbar darauf in den Strudel hineingleitet, steht Antinous bereit, um ihn wieder herauszupflücken. Zwei Mal wiederholt er dieses Spiel, ehe er es Leid ist und sich vom Fluss entfernt. Er folgt einem Pfad, der den unwegsamen Berghang hinaufführt, und bleibt schweißgebadet auf dem Gipfel stehen, um auf die Ebene hinabzuschauen. Das Dorf, aus dem er kommt, das im Schatten der Berge auf der anderen Talseite liegt, ist im grellen Gegenlicht nur noch mit Mühe auszumachen. Der Gedanke, dass ein Fremder es wahrscheinlich nicht entdecken würde, erfüllt ihn mit Stolz, denn er weiß, er sieht. Eine Zeit lang vergnügt er sich damit, dem Fremden verschiedene Häuser und Orte zu zeigen, der jedesmal aufs Neue verblüfft reagiert, ist das wirklich ein Haus? Wer hätte das gedacht? Das sieht doch aus wie ein Teil des Bergs! Dann dreht er sich um und schaut zu dem Wald im Tal auf der anderen Seite hinunter. Dunkelgrün und dicht liegt er dort, von Bergen umkränzt, wie in einem Krater. Man erzählt sich Geschichten über diesen Wald, aber jetzt, an manchen Stellen aufgehellt durch Lichtungen, Wiesen und kleine glitzernde Gewässer, wirkt er nicht im mindesten bedrohlich, und ohne noch länger darüber nachzudenken, folgt Antinous weiter dem Pfad.
Als er ins Tal hinabkommt, fällt ihm auf, wie still es dort ist. Die Luft zwischen den Bäumen steht gleichsam ermattet von der Hitze. Durch die Schatten unter den Baumwipfeln steigen Trosse aus Licht nach oben, an manchen Stellen gefüllt von kleinen Taschen tanzender Insekten. Es riecht schwül nach trockenen Tannennadeln, warmer Erde. Das Wasser des Bachs, dessen Lauf er folgt, fließt im Dunkel unter den riesigen Fichten grünschwarz, blau und glitzernd dort, wo der Himmel sich öffnet, glänzend und weißschäumend in den terrassenförmigen Fällen, die zu dem kleinen See in der Mitte des Tals hinabführen.
Voller Abenteuerlust läuft er mal hierhin, mal dorthin, und ohne einen Gedanken an den herannahenden Abend zu verschwenden, bewegt er sich immer tiefer in den Wald hinein. Er sieht ein Wespennest unter einem Ast, er sieht eine Wiese voller Schmetterlinge, er sieht eine tote Kuh in einem Graben, und der widerwärtige Gestank, der aufsteigt, als es ihm endlich gelingt, mit einem Stock ein Loch in den verwesenden Bauch zu stoßen, lässt ihn sich fast übergeben. Er sieht eine ausgetrocknete Schlangenhaut in einem Steinhaufen, er sieht einen Kirschbaum in voller Blüte, er sieht nur wenige Meter entfernt einen Hasen vorbeihoppeln, und als die Sonne untergeht, liegt er vor einem großen Ameisenhaufen auf dem Bauch und studiert das seltsame Treiben, das sich dort entfaltet. Er merkt überhaupt nicht, dass die Sonnenstrahlen immer höher die Felshänge hinaufklettern und sich das Tal um ihn herum allmählich mit Dunkelheit füllt. Er merkt auch nicht, dass die Vögel nicht mehr singen und das gleichmäßige Summen der Insekten nach und nach verklingt. Er betrachtet die Arbeiter, die in langen Reihen mit ihren winzigen Lasten organischen Materials auf dem Rücken heranmarschieren, seien es nun Tannennadeln, Stücke von Blättern, Grashalme oder Teile toter Insekten, die sie auf ihrem Weg gefunden haben, und die verteilt postierten Wächter, die fortwährend an die Reihen herankrabbeln und an ihnen schnüffeln wie Hunde, um sich ab und zu aufzurichten und mit den Vorderbeinen zu fechten, woraufhin die fremde Ameise, die möglicherweise geglaubt hatte, ihre Identität wäre in der Menge ein gut gehütetes Geheimnis, augenblicklich davoneilt und im Unterholz verschwindet.
Nach einer Weile hebt er einen Ast vom Boden auf und steckt ihn vorsichtig in den Ameisenhaufen, neugierig auf das Chaos, das er so verursacht, diese rasende Verdichtung aus dünnen Beinen und rundlichen Körpern, die entsteht, als von allen Seiten Ameisen herbeiströmen. Gleichzeitig widerstrebt ihm sein eigenes Tun, er will im Grunde nicht alles kaputt machen, aber es hat etwas nahezu Magisches, auf diese Art einen Handlungsablauf beeinflussen zu können, und es ist ja auch nicht so, dass er ihren Haufen einreißt, oder? So fleißig, wie sie sind, werden sie die Schäden bestimmt schnell wieder repariert haben.
Er schiebt den Stock auf der anderen Seite des Ameisenhaufens hinein und ist gespannt, wie sie auf diese neue Herausforderung reagieren werden. Eine weitere Welle von Ameisen schwappt heraus, während die vorige, in dem Glauben, die Gefahr wäre nun vorbei, bereits mit der Reparatur des Schadens beschäftigt ist, den er verursacht hat. Eine ganze Zeit wechselt er zwischen den beiden Stellen hin und her und vergnügt sich damit zu beobachten, wie schnell sie sich von Angriff auf Verteidigung einstellen, bis er, gedankenlos, den Stock, so fest er kann, in den Haufen hineinstößt und hin und her ruckt. Wie die poröse Mischung aus Erde, Tannennadeln und Zweigen unter seinen Bewegungen nachgibt, empfindet er als eigentümlich befriedigend. Und da Teile des Ameisenhaufens bereits eingestürzt sind, kann ich genauso gut weitermachen, denkt er. Gleichzeitig beginnt er sein Handeln zu verabscheuen. Doch seltsamerweise ist es gerade diese Abscheu über sich selbst, die ihn zum Weitermachen animiert. Er ahnt, wie sehr er es bereuen wird, sobald es vorbei ist, und will den Moment möglichst lange hinauszögern, während die Verzweiflung darüber, was er tut, eine Art Raserei in ihm entfacht. Er fängt an, mit dem Fuß gegen den Ameisenhaufen zu treten, wilder und immer wilder, und gibt sich erst zufrieden, als dieser vollends eingestürzt und die Erde schwarz von krabbelnden Ameisen ist. Da erst wirft er den Stock fort und eilt davon.
Obwohl die Dämmerung alles verdüstert, was er sieht, und sich an manchen Stellen zu schwellenden Segeln aus Dunkelheit zusammengezogen hat, bedenkt er immer noch nicht, wie spät es bereits ist. Er will nur möglichst viele Meter und viel Zeit zwischen sich und seine Untat legen. Was habe ich nur getan, denkt er, was habe ich nur getan, was habe ich nur getan.
Erst als der Weg, dem er folgt, auf eine Wiese führt, an die er sich nicht erinnern kann, wird ihm der Ernst seiner Lage bewusst. Schon bald wird es ganz dunkel sein. Und er ist nicht nur kilometerweit von zu Hause entfernt, sondern auch weit weg von dem Weg, der dorthin führt.
Lange steht er regungslos am Waldsaum und blickt auf die Wiese hinaus. Der Gipfel des dunklen Berges hinter ihr hebt sich deutlich vom blauschwarzen Himmel ab, an dem der Mond, der den ganzen Tag bleich und gespenstisch über den Horizont geglitten ist, nun deutlich hervortritt. Er kann die Schatten sehen, die von den Bergen dort oben geworfen werden, die glänzenden Lichtungen.
Er hat das Gefühl, der Mond würde auf ihn zugleiten, aus dem Weltall herangleiten wie ein Schiff vom Meer.
Plötzlich schaudert es ihn: Ganz in der Nähe raschelt es in einem Gestrüpp. Etwas bewegt sich flink über den Waldboden, aber als es verstummt, geschieht dies nicht, um Stille Platz zu machen, wie er unbewusst erwartet hat; es macht stattdessen den Weg frei für ein Gewirr aus anderen leisen Geräuschen. Hier bricht ein Zweig, dort raschelt ein Busch, in der Ferne ruft irgendwo eine Eule. Dann fährt der Wind mit einem Seufzer durchs Tal, und die Äste an den Bäumen hinter ihm setzen sich in Bewegung. Er denkt, dass sie Blinden ähneln, die nach etwas greifen. Oder Toten, die zum Leben erwachen. Er stellt sich vor, wie ihre Schatten unsichtbar durch die Dunkelheit gleiten, die ihn umgibt. Aber wenn er ganz still stehen bleibt, denkt er, wird vielleicht gar keiner merken, dass er hier ist. Kein wildes Tier, keine bösen Geister, keine toten Seelen … Gleichzeitig brennt er darauf, fortzukommen. Bald wird es stockfinster sein, und wenn er bis dahin nicht aus dem Wald heraus ist, wird er niemals den Weg nach Hause finden.
Mehrfach nimmt er all seinen Mut zusammen und denkt, jetzt laufe ich, doch jedesmal hindert ihn die Angst daran, seinen Gedanken in die Tat umzusetzen. Erst als die Eule von Neuem ruft und er hört, dass sie näher gekommen ist, mündet der Gedanke in eine Bewegung. Er läuft los, und er läuft, so schnell er kann, denn die Eulen sind Geschöpfe des Teufels, sie haben Menschenaugen und Vogelkörper, dass er eine von ihnen kurz nach seiner Tat gehört hat, ist ein Zeichen. Vielleicht sogar mehr als ein Zeichen. Vielleicht fliegen die Eulen in diesem Moment zwischen den schwarzen Baumwipfeln im Wald umher und suchen nach ihm. Vielleicht erblicken sie ihn in diesem Moment. Vielleicht stürzen sie sich in diesem Moment auf ihn herab …
Im gleichen Augenblick erkennt er, dass er sich wieder dem Ort seiner Untat nähert. Er will den eingerissenen Ameisenhaufen nie wieder sehen, schon der Gedanke daran erfüllt ihn mit Verzweiflung, und da er es auch nicht wagt, stehen zu bleiben, läuft er in dem Glauben in den Wald hinein, einen leichten Bogen zu beschreiben, der ihn hundert Meter weiter wieder auf den Weg zurückführen wird.
Wie ein verängstigtes Tier bricht er durch das dichte Unterholz. Er nimmt Kurs auf einen ungefähr fünfzig Meter vor ihm stehenden Baum: Als er ihn erreicht, schwenkt er nach links und läuft weitere fünfzig Meter, um anschließend Ausschau nach dem Weg zu halten. Hier muss er ungefähr verlaufen, denkt er. Hinter dem Baumstamm dort. Als er diesen erreicht, wird ihm klar, dass der Weg hinter den Baumstämmen dort liegen muss. Falls er ihn nicht gekreuzt hat, ohne es zu merken?
Nein, nie im Leben!
Doch als er auch nicht hinter den Baumstämmen liegt, treiben Zweifel einen Keil in seine Gedanken. Er hält inne und lehnt sich an einen Baum, um Atem zu schöpfen, während er in die Dunkelheit vor sich späht. Kann er zu weit gelaufen sein? Liegt der Weg etwa im Wald über ihm?
Dann begreift er. Der Weg hat natürlich die Richtung geändert!
Deshalb ist er noch nicht auf ihn gestoßen. Ich muss einfach weiterlaufen, denkt er, und blickt für einen Moment gen Himmel, wo die Dunkelheit inzwischen die letzten Reste von Blau verdrängt. Dann rennt er wieder los. Diesmal läuft er mehrere hundert Meter, bis erneut Zweifel die Oberhand gewinnen. Hier verläuft kein Weg. Er muss in die falsche Richtung gelaufen sein. Der Weg liegt in der anderen Richtung, denkt er und eilt die Strecke zurück, die er gekommen ist. Mittlerweile kann er kaum noch die Hand vor Augen sehen. Er stolpert, rappelt sich wieder auf, stolpert erneut. Der Gedanke, sich verlaufen zu haben, ist so beängstigend, dass er ihn verscheucht, indem er sich jedesmal, wenn er auftaucht, ein wenig Mut zuspricht. Er glaubt nach wie vor, die Formationen in der Landschaft, die ihn umgibt, wiederzuerkennen. Den entwurzelten Baum, die moosbewachsene Felswand, die sumpfige Wiese. Selbst als sich zeigt, dass diese Zeichen trügen, weigert er sich, seiner Unsicherheit Raum zu geben, denn wenn er einfach nur weiter geradeaus läuft, denkt er, muss er früher oder später auf den Weg oder den Berghang stoßen. Er verirrt sich in ein Dornengestrüpp, eine Wange und beide Handrücken werden aufgekratzt, aber er spürt es gar nicht, er wird den Weg finden, der ganz in der Nähe ist, das weiß er. Vielleicht hinter dem Hügel da drüben, denkt er, aber dort verläuft er ebenso wenig wie hinter dem nächsten Hügel …
Schließlich fehlt ihm die Kraft, um noch weiterzulaufen, und die Angst, die in der letzten halben Stunde auf eigene Faust in ihm umhergestrolcht ist, eingeschlossen hinter seinem pochenden Herzen und den gehetzten Atemzügen, bekommt wieder Kontakt zu dem, was sie ausgelöst hat. Selbst der kleinste Laut fällt wie ein Stein durch ihn hindurch und verbreitet widerstandslos seine Ringe aus Verängstigung, sobald er den Grund trifft. Hätte ich doch nur diesen Ameisenhaufen nicht kaputt gemacht, denkt er.
Im bleichen Mondlicht haben sich die Schatten um ihn herum zu Gestalten gesammelt. Er sieht sie genau, sie stehen in Trauben unter den Bäumen und bewachen ihn, und wenn sie sich etwas zuflüstern, ist es sein Name, den sie flüstern. Antinous, flüstern sie. Antinous. Ohne sie aus den Augen zu lassen, bleibt er stehen, faltet die Hände und beginnt zu beten.
Vater unser, der du bist im Himmel.
Ein Seufzen läuft durch die Gestalten in dem Wald, der ihn umgibt.
Heute Abend habe ich einen Ameisenhaufen kaputt gemacht. Aber ich wollte das nicht. Ich weiß nicht, warum ich es getan habe. Es war eine Sünde, und ich bereue. Bitte vergib mir.
Ziehen sie sich zurück?
Hilf mir fort von hier. Bitte hilf mir fort von hier.
Ja, sie ziehen sich zurück. Erst wagt er nicht recht, es zu glauben, und späht misstrauisch in die Dunkelheit hinein. Als diese jedoch selbst dann regungslos bleibt, als er einen Schritt in sie hinein macht, erkennt er, dass sie verschwunden sind.
Jetzt kommt es nur noch darauf an, den Weg zu finden, denkt er. Er weiß nicht mehr, woher er gekommen ist, und geht in die Richtung, in der die Abstände zwischen den Bäumen am größten zu sein scheinen. Er denkt, dass Gott seine Schritte lenkt. Der Wald wird immer lichter, bis er sich nach ein paar hundert Metern zu einer Lichtung öffnet. Und dort liegt der Bergrücken.
Dort liegt der Bergrücken!
Dass er den Weg nicht sehen kann, auf dem er am Tag herabgestiegen ist, stört ihn nicht im Geringsten, denn der Berghang steigt sanft an und lässt sich selbst im Dunkeln mühelos erklimmen. Und auf der anderen Seiten liegt die Ebene. Ist er erst einmal in sie hinabgelangt, wird er den Weg zum Dorf finden, als wäre es das Leichteste auf der Welt.
Doch als er eine Viertelstunde später endlich auf dem Bergkamm Halt macht, muss er feststellen, dass der Berg nicht sanft zur Ebene hin abfällt, wie er geglaubt hat, sondern steil in eine Felsschlucht mündet, aus der ein weiterer Berghang aufsteigt.
Das kann nur bedeuten, er befindet sich auf der anderen Seite des Tals. Zwischen ihm und der Ebene liegt der ganze Wald.
Diesmal gelingt es ihm nicht mehr, die Tränen zurückzuhalten. Ein Schluchzen durchzuckt ihn, und der nachfolgende Strom von Gefühlen stößt auf keinen Widerstand mehr, er steigt ungehindert in ihm auf, bis dieser Strom ihn völlig ausfüllt und er weinend zu Boden sinkt. Auch die Gedanken lösen sich auf und stürzen in die Fluten. Nichts anderes wahrnehmend als seine eigene Verzweiflung, liegt er eingeschlossen in seine eigene Dunkelheit, in der die Zeit nicht existiert, denn als die Tränen versiegen und er allmählich wieder normal atmet, hat er keine Ahnung, wie lange er fort gewesen ist.
Er denkt, es ist, als hätte ich geschlafen und wäre an einem anderen Ort wieder aufgewacht.
Mit völlig entspanntem Körper setzt er sich auf und reibt sich die Augen am Ärmel seines Hemds trocken. Wenigstens hat er den Wald hinter sich gelassen! Die baumlose Dunkelheit hier oben wirkt in gewissem Sinne reiner, denkt er und beschließt auszuhalten, was immer ihn noch erwarten mag.
Als Erstes muss er einen sicheren Ort zum Schlafen finden.
Er rappelt sich auf und geht den Bergkamm entlang, das Terrain vor sich dabei prüfend musternd. Eine Minute später fällt sein Blick auf einen Felsvorsprung, der sich unter ihm aus dem Berg schiebt. Als er hinunterklettert, erkennt er erfreut, dass der Felsvorsprung das Dach einer schmalen, aber tiefen Höhle bildet, die sich noch dazu an ihrem Ende etwas verbreitert, sodass fast ein kleiner Raum entsteht. Hier kann er wohlbehütet schlafen. Aber was nicht gut ist: Der Untergrund ist hart und uneben, und nachdem er mehrere Schlafstellungen ausprobiert hat, krabbelt er erneut ins Freie, um etwas Tannengrün von den Bäumen zu holen, die auf dem Hang unterhalb der Höhlenöffnung wachsen.
Das ist der Moment, in dem er es entdeckt. Etwa fünfhundert Meter unterhalb schwebt ein schwaches Licht in der Dunkelheit. Sein erster Impuls ist hinzueilen, und so macht er sich auch daran, hinabzuklettern, hält jedoch bereits nach wenigen Metern inne, denn wer ist um diese Zeit eigentlich noch unterwegs? Es könnten Hirten sein, es könnten aber auch Räuber sein …
Oder ist es etwa jemand aus dem Dorf, der nach ihm sucht?
Für Kinder gibt es nur eins, was sich schwerer zurückhalten lässt als Tränen, und das ist Freude. Antinous bildet da keine Ausnahme. Wie unwahrscheinlich es ist, dass ausgerechnet hier jemand nach ihm sucht, kommt ihm gar nicht in den Sinn. Genauso wenig, wie unsinnig es wäre, dies in einer derart undurchdringlichen Dunkelheit zu tun. Man hadert nicht mit seiner Freude, man gibt sich ihr hin, und nach anfänglichem Zögern setzt er den steilen Abstieg in die Schlucht fort. Hätte er sicher sein können, dass sie ihm wohlgesonnen waren, hätte er ihnen zugerufen, doch das tut er nicht; im Gegenteil, er achtet darauf, sich möglichst leise zu bewegen. Löst sich ein Stein und rollt hinab, bleibt er eine Weile stehen, bevor er weiterklettert.
Im oberen Teil ist der Hang steil, sodass er an mehreren Stellen nach einem Halt für Hände und Füße suchen muss, aber im letzten Stück wird es flacher, und schon bald steht er am Flussufer, umgeben vom Rauschen des Wasserfalls, dessen weißen Wasserschwall er vage in der Dunkelheit rechts von sich ausmachen kann. Linkerhand verschwindet der Fluss hinter einem Felsvorsprung, der ungefähr fünfzehn Meter hoch ist und jegliches Licht verdeckt. Da er nicht weiß, was ihn dahinter erwartet, beschließt er, den Hang wieder ein Stück hinaufzusteigen, um sich ihnen möglichst unbemerkt zu nähern, wer immer sie auch sein mögen.
Obwohl das Licht hinter dem Felsvorsprung verborgen bleibt, ist die Dunkelheit an seiner Kuppe gleichwohl blasser, wie der Himmel, unmittelbar bevor die Sonne sich über den Horizont erhebt, und er kann die Konturen jedes einzelnen Baums in dem Wald aus kleinen und schmalen Bäumen um sich herum erkennen. Er denkt, dass hinter dem Felsen vielleicht sein Vater zusammen mit anderen Männern aus dem Dorf um ein Feuer sitzt. Die Vorstellung, wie sehr sie sich freuen werden, wenn er wie aus dem Nichts zu ihnen stößt, lässt ihn vor Glück schaudern. Aber wenn sie es sind, denkt er, müsste ich sie eigentlich bald hören. Sie haben ja keinen Grund, still zu sein. Es sei denn, sie hätten sich schlafen gelegt?
Er bleibt stehen und lauscht. Doch alles, was er hört, ist sein eigenes Herz. Angesichts dieser Stille beunruhigt, tritt er mit dem Fuß zunächst behutsam auf, als er weitergeht, ehe er im Schritt das Gewicht auf ihn verlagert, und als er den obersten Teil des Felsvorsprungs erreicht, der kahl ist, legt er sich auf den Bauch und robbt voran. Kurz vor der Felskante macht er Halt und lauscht.
Nichts.
Vorsichtig hebt er den Kopf und lugt über die Felskante. Der Anblick versetzt ihn in Angst und Schrecken. Zwei in Umhänge gehüllte Männer stehen regungslos am Ufer des Flusses und starren zu ihm herauf. Blitzschnell duckt er sich und presst sein Gesicht auf die Erde. Haben sie ihn gesehen? Oder war es nur ein Geräusch, was sie aufblicken ließ? Er schließt die Augen und versucht zu hören, ob sie auf dem Weg zu ihm sind. Hört er auch nur einen Zweig brechen, wird er aufspringen und so schnell er kann fortlaufen. Aber es bleibt still, und wenige Sekunden später, als er sich eingeredet hat, dass sie nichts gesehen haben können, da ihr eigenes Licht sie geblendet haben muss, hebt er erneut den Kopf über den Felsrand. Die beiden Gestalten haben sich nicht von der Stelle gerührt, blicken nun jedoch in das Wasser vor ihnen. Der eine hält eine Fackel in der Hand, der andere einen Speer. Beide tragen Kettenhemden unter ihren Umhängen und an der Seite ein Schwert. Der Lichtkegel der Fackel krümmt sich um sie, sodass es aussieht, als stünden sie in einer Höhle aus Licht.
Langsam waten sie in den Fluss hinaus. Etwa in der Mitte bleiben sie stehen, und der eine senkt seine Fackel zur Wasseroberfläche, während der andere den Speer zum Wurf hebt. Das flackernde Licht, in das die Flamme sie taucht, hüllt ihre Gesichter und die obersten Teile des Oberkörpers in Schatten. Dennoch ist es unmöglich, die Augen von ihnen zu wenden. Auf seltsame Weise trifft Antinous’ Blick auf keinen Widerstand, es ist, als würde er in ihnen verschwinden. Er betrachtet das leuchtende Rot ihrer Umhänge, gesättigt vom Licht ihrer Fackel, er betrachtet das schwarze Metall der Kettenhemden und die schimmernden Scheiden aus Silber, den gesenkten Arm und den Widerschein des Feuers auf der Wasseroberfläche. Er betrachtet ihre unergründlichen Gesichter, halb verborgen von Dunkelheit, er betrachtet die kleinen Strömungsstrudel um ihre Stiefel, die langen, schmalen Finger, die sich um den Speer krümmen, das gebeugte Handgelenk, und will nur immer in ihrer Nähe sein. Ohne zu bedenken, was er tut, richtet er sich auf und geht langsam nach unten, dabei stets im Schutz der Bäume bleibend und den Blick auf die beiden Gestalten gerichtet, die durch nichts andeuten, dass sie ihn gehört haben könnten, sondern weiter regungslos verharren. Auf halbem Weg nach unten entdeckt er ihre Flügel und denkt, was bis zu diesem Moment nur eine unausgesprochene Ahnung war: Es sind zwei Engel, die dort im Fluss stehen. Die Welle aus Angst und Freude, die ihn daraufhin durchströmt, ist nahezu unerträglich. Dennoch wagt er sich ganz hinab bis zu einer kleinen Erhebung im Berg nur noch zehn Meter von ihnen entfernt, wo er sich versteckt. Aber obwohl er es will, ist er doch nicht in der Lage, sie anzusehen, ihre Nähe überwältigt ihn, und lange bleibt er ganz still liegen, mit geschlossenen Augen und das Gesicht zu Boden gepresst.
Als das Nachbild der Engel auf seiner Netzhaut verblasst ist, füllt sich die Dunkelheit in seinem Kopf mit dem Rauschen des Wasserfalls, dem kaum vernehmlichen Rieseln des Wassers in Ufernähe, seinem eigenen pochenden Puls. Aber obwohl er sich größte Mühe gibt, hört er doch keinen Laut von ihnen, und mit der Zeit gewinnt das Verlangen, sie zu sehen, die Oberhand gegen seine Furcht. Er öffnet die Augen und will gerade den Kopf heben, als aus ihrer Richtung eine Art Fauchen ertönt. Entsetzt bleibt er liegen. Haben sie ihn entdeckt? Einer von ihnen macht im Fluss einen Schritt, er hört das Wasser um die Füße des Engels plätschern, aber danach wird wieder alles still, und er hebt langsam den Kopf. Diesmal achtet er darauf, dass sein Blick sich ihnen mit großer Vorsicht nähert. Sachte lässt er ihn über die schwarze Wasseroberfläche gleiten, in den Lichtschein der Fackeln hinein, anfangs nur sichtbar als ein glänzenderer Ton im Schwarz, dann heller und heller werdend, bis seine Augen den Lichtreflex an der Stelle erreichen, wo das Wasser gelb und orange aufflammt.
Daraufhin richtet er sich auf und nimmt alles mit einem einzigen Blick in sich auf.
Ihre Gesichter sind weiß und schädelgleich, die Augenhöhlen tief, die Wangenknochen hoch, die Lippen blutleer. Ihre Haare sind lang und hell, der Hals schlank, die Handgelenke schmal, die Finger krallenförmig. Und sie zittern. Die Hände des einen zittern.
In diesem Moment legt der andere den Kopf in den Nacken, öffnet den Mund und stößt einen Schrei aus. Wild und klagend erhebt er sich entlang der Felswände in der Schlucht. Dieser Schrei ist nicht für menschliche Ohren bestimmt. Die Verzweiflung eines Engels ist unerträglich, und fast zerrissen vor Angst und Mitleid presst Antinous erneut sein Gesicht auf den Erdboden. Er will ihnen helfen, aber er kann ihnen nicht helfen, er will für sie jemand sein, aber er kann für sie niemand sein, er will fortlaufen, aber er kann nicht fortlaufen. Erneut hört er das Fauchen, diesmal gefolgt von einem Klatschen, und als er wieder zu ihnen schaut, hebt der eine gerade den Speer aus dem Wasser. Der Fisch, den der Speer durchbohrt hat, schlägt im Lichtschein der Fackel schimmernd einige Male mit der Schwanzflosse, bis der Engel ihn von der Speerspitze abzieht und ihm das Genick bricht.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: