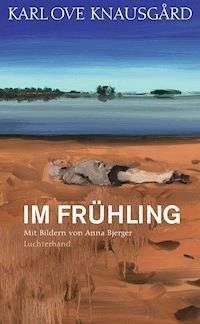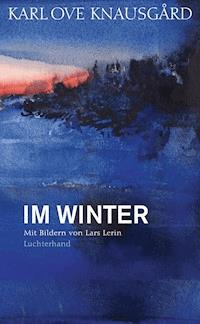12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Karl Ove Knausgård sitzt mit Frau, vier Kindern und Hund zu Hause in Schonen. Er schaut Fußball im Fernsehen und schläft vor dem Bildschirm ein. Er mag Spiele, die Unentschieden ausgehn, Zigaretten, Kaffee und Argentinien.
Fredrik Ekelund ist nicht zu Hause. Er ist in Brasilien, wo er am Strand Fußball spielt und Public Viewing betreibt. Er liebt Spiele, die 4:3 ausgehen, Caipirinha und Brasilien.
"Kein Heimspiel" ist ein ungewöhnliches Fußballbuch, in dem zwei Autoren die WM in Brasilien und den Fußball als Ausgangspunkt für Reflexionen über Leben und Tod, Kunst und Politik, Klasse und Literatur nutzen. "Faszinierend, fesselnd, aufschlussreich." Sunday Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 941
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
BUCH
Karl Ove Knausgård sitzt mit Frau, vier Kindern und Hund zu Hause in Schonen. Er schaut Fußball im Fernsehen und schläft vor dem Bildschirm ein. Er mag Spiele, die Unentschieden ausgehen, Zigaretten, Kaffee und Argentinien.
Fredrik Ekelund ist nicht zu Hause. Er ist in Brasilien, wo er am Strand Fußball spielt und Public Viewing betreibt. Er liebt Spiele, die 4:3 ausgehen, Caipirinha und Brasilien.
»Kein Heimspiel« ist ein ungewöhnliches Fußballbuch, in dem zwei Autoren die WM in Brasilien und den Fußball als Ausgangspunkt für Reflexionen über Leben und Tod, Kunst und Politik, Klasse und Literatur nutzen. »Faszinierend, fesselnd, aufschlussreich.« Sunday Times
AUTOREN
KARL OVE KNAUSGÅRD wurde 1968 geboren und gilt als wichtigster norwegischer Autor der Gegenwart. Er lebt mit seiner Familie an der schwedischen Südküste.
FREDRIK EKELUND ist ein schwedischer Schriftsteller, Lyriker und Filmemacher – sowie Kapitän der schwedischen Fußballnationalmannschaft der Autoren.
KARL OVE KNAUSGÅRDFREDRIK EKELUND
KEIN HEIMSPIEL
Aus dem Norwegischenvon Ulrich Sonnenborg
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die norwegische Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Hjemme Borte« im Verlag Pelikanen, Oslo. Anmerkung des Übersetzers:Während der Fußballweltmeisterschaft schrieben sich Karl Ove Knausgård und Fredrik Ekelund täglich Emails, die sie selbst als Briefe bezeichneten. Da diese Mails tatsächlich den Charakter von Briefen haben, wurde in der Übersetzung der Begriff »Brief« beibehalten.1. AuflageDeutsche Erstveröffentlichung April 2018 Copyright © der Originalausgabe 2014 Pelikanen Forlag asCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018by btb Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenUmschlaggestaltung: semper smile, München unter Verwendung einer Vorlage von Asbjørn Jensen sowie Fotos von scanpix (oben) und Christina Ottosson Öygarden (unten)Autorenfoto: Christina Ottosson ÖygardenSatz: Uhl + Massopust, AalenRK · Herstellung: scISBN 978-3-641-17439-2V001www.btb-verlag.dewww.facebook.com/btbverlag
Limhamn, 10. Juni
Lieber Karl Ove!
Ich beginne mit einer Erinnerung an den 19. November 1983. Da lebte ich in Paris, ging ganz in meinen Studien auf, wohnte in der Cité Universitaire, schrieb für die inzwischen eingegangene Tageszeitung Arbeitet und saß an einer Arbeit über einen französischen Schriftsteller, den ich im Jahr zuvor entdeckt hatte, Georges Navel. Es war eine glückliche Zeit meines Lebens. Im August hatte der Bonnier Verlag meinen ersten Roman angenommen, daher lebte ich im Rausch der Gewissheit, dass ich werden würde, wovon ich bereits seit einiger Zeit geträumt hatte: Schriftsteller. Tagsüber ging ich ins Collège de France und hörte Michel Foucault und Emmanuel Le Roy Ladurie, oder ich schlich mich in die École Normal zu Jacques Derrida. Foucault und Derrida zu Füßen zu sitzen, trug dazu bei, den intellektuellen Rausch zu verstärken, in dem ich damals lebte.
Der 19. November war der Tag vor meinem dreißigsten Geburtstag. Ich saß in einer Studentenkneipe am Boulevard Saint-Michel, als sich mir direkt gegenüber ein Mann mit einem sorgenvollen und ein wenig strengen Indianergesicht setzte. Wir fingen an, uns zu unterhalten. Es stellte sich heraus, dass er Mexikaner war und als Chemiker in der Rue d’Assas arbeitete, direkt in der Nähe. Für den kommenden Tag hatte ich ein kleines Geburtstagsessen in meiner Studentenbude geplant, und unversehens hatte ich Juan, so hieß er, zu diesem Mittagessen eingeladen. Wir wurden Freunde, sahen uns häufiger, und nach einer Weile erzählte er mir, er sei wegen einer Amerikanerin nach Paris gezogen, mit der er ein Kind hatte. In Paris hatte er jedoch seine Homosexualität entdeckt, wurde geschieden und wohnte nun zusammen mit einem Franzosen. Eines Tages redeten wir über Octavio Paz. Ich drückte meine Bewunderung für den mexikanischen Poeten aus und gab meinem neuen Freund zu verstehen, dass ich Spanisch lernen wolle, um Paz in der Originalsprache lesen zu können; ich schlug vor, dass wir, Juan und ich, Paz gemeinsam lesen könnten. Und das taten wir. Auf einer Parkbank im Jardin du Luxembourg. Er las mir laut vor. Ich wiederholte es und ließ mir Sätze wie El laberinto de la soledad und A cinco años de Tlatelollo auf der Zunge zergehen, und ich fand allein das Wort soledad so schön, dass es sich lohnte, eine ganz neue Sprache zu lernen.
So kam es, dass die lateinamerikanische Tür sich einen Spalt weit für mich öffnete.
Zwei Jahre später, am 18. Dezember 1985, flog ich mit meinem Bruder, einem gemeinsamen Freund und seiner chilenischen Frau nach Chile. Ich sollte für die Tageszeitung Sydsvenskan über die Reise schreiben, darüber, wie es für Esmerita, die Frau meines Freundes, war, nach zehn Jahren Exil in das Chile der Militärdiktatur zurückzukehren. Wir landeten bei glühender Hitze in Santiago und fuhren weiter nach La Calera, einer armen Stadt, die von einer sterbenden Zementindustrie geprägt war. Doch dort, im Slumviertel, in dem ihre Familie wohnte, wollte Esmerita mich nicht haben, aus Angst, dass ich ihren Mann, der eigentlich für mich dolmetschen sollte, in Schwierigkeiten bringen könnte. Also nahm ich meine sieben Sachen, fuhr zurück nach Santiago und zog in ein heruntergekommenes Hotel, in dem ich meine Schreibstube einrichtete. Vor meiner Abreise hatte ich eine Reihe von Interviews mit Politikern, Gewerkschaftsführern und Autoren verabredet, aber all diese Gespräche waren mit meinem Freund Stefan als Dolmetscher geplant gewesen. Nun war ich auf mich selbst gestellt, aber die Fragen konnte ich ja immerhin stellen, und an den Abenden danach saß ich allein mit meinem Tonbandgerät stundenlang in meinem Hotelzimmer und transkribierte die Antworten, die ich auf meine Fragen bekommen hatte. Auf diese Weise öffneten sich die spanischen und die lateinamerikanischen Türen sperrangelweit.
Die Parkbank in Paris hatte die Grundlagen gelegt, und nun tat ich einen weiteren Schritt und saß plötzlich bei José Donoso, einem der »magischen Realisten«, und bei Nicanor Parra, dem Kultdichter, und stellte meine Fragen. Parra ließ mich in seinem großen Haus am Fuß der Anden übernachten, einem Haus, das über einem Abgrund gebaut war, so wie ganz Chile über einem Abgrund lebte, wie er mir sagte, mit der ständigen Gefahr eines Erdbebens. Er brachte mir die Bedeutung des Cuecas bei (des chilenischen Nationaltanzes), schälte Tomaten und Zwiebeln auf eine feierliche, beinahe religiöse Weise, pries das Einfache und gab mir, einem unbekannten schwedischen Autor, das Gefühl, sein compañero zu sein. Plötzlich saßen wir in seinem Auto, immer wieder fuhren wir in dem großen Kessel herum, der Santiago genannt wird, er redete, und ich hörte zu. Er zeigte mir die Stadt, nicht zuletzt Nerudas Haus, La Chascona; Neruda war vor allem wichtig, weil Parras eigene Ästhetik eine Art Antipoesie war, die sich aus Protest gegen Nerudas romantische, suggestive Bilderflut entwickelt hatte: monoton und schläfrig. Laut meinem Freund in der Nacht von Santiago war Neruda ein Crooner, ein Frank Sinatra der Poesie.
Ich war überwältigt von seiner Großzügigkeit, und erst sehr viel später – so geht es mir oft, es dauert einige Zeit, bis ich normalerweise begreife, was ich erlebt habe – regte sich der Gedanke/der Verdacht, dass er all dies vielleicht auch aus einem anderen Grund getan hatte: um mit Hilfe eines großen Artikels in einer schwedischen Zeitung (der dann ja auch erschien) einen Schub in Richtung Nobelpreis zu erhalten, den sein ewiger Gegenspieler Neruda im Jahre 1972 bekommen hatte. Sicher sein kann ich mir natürlich nicht, aber der Gedanke daran hat mich seither nicht mehr losgelassen.
Wie auch immer, Karl Ove, die Parkbank im Jardin du Luxembourg und die Reise nach Santiago verhalfen mir zu meinen Spanischkenntnissen und sorgten dafür – wenn man jeder Sprache ein eigenes Haus zugestehen will –, dass es mir möglich war, in das spanische Haus zu klettern. Seltsamerweise fühlte ich mich dort augenblicklich so heimisch, als hätte das Spanische auf mich oder in mir gewartet. Es gibt eine Leichtigkeit in der spanischen Sprache, derart klingende, schöne Vokale, und all das führte mich schließlich auch zum Portugiesischen – der brasilianischen Variante, nota bene –, auch schön, aber schwieriger zu sprechen, schwieriger zu verstehen und weit mehr konsonantenbestimmt, mit nicht der gleichen Menge Luft.
Es war schön, dich gestern in eurem üppig blühenden Garten in Glemmingebro gesehen zu haben. Ich kann mir kaum einen schärferen Kontrast zwischen dieser Idylle in Schonen und Rio de Janeiro vorstellen. Jetzt ist es wieder so weit. Lateinamerika, zum zwanzigsten Mal, glaube ich. Als ich damals, 1985, nach Chile flog, hatten wir einen Zwischenstopp in Recife, und als ich die Gangway hinunterstieg, legte ich mich nieder und küsste den Boden. Eine intuitive Handlung, wie eine Huldigung an die Fußballhelden meiner Kindheit: Pelé und Garrincha. Inzwischen tue ich so etwas nicht mehr, den Boden küssen, aber ich verspüre eine starke Sehnsucht, und in Gedanken befinde ich mich schon lange dort.
Herzliche Grüße,
Fredrik
Glemmingebro, 11. Juni
Lieber Fredrik,
du hast recht: die Kontraste könnten nicht größer sein. Ungefähr zu der Zeit, als du in Rio de Janeiro aus dem Flugzeug gestiegen bist, war ich auf einem Klassenfest meiner ältesten Tochter, am Strand, einige Kilometer von hier, wir haben zuerst Würstchen gegrillt und dann Schlagball gespielt: dritte Klasse gegen Eltern, mit langen Schatten im Licht der untergehenden Sonne. Ich wollte dir eigentlich schreiben, sobald die Kinder im Bett liegen, gegen neun, aber ich war vor wenigen Tagen in den USA und habe immer noch Probleme mit dem Jetlag: Um halb neun schlief ich deshalb in voller Montur ein, mit allen Kindern um mich herum, und wachte erst um halb zwei in der Nacht wieder auf, umgeben von Stille. Der Reserveplan war, heute Vormittag zu schreiben, ich hatte eine Nanny bestellt, so heißen die jetzt, die sich um unsere vier Monate alte Tochter kümmern sollte, während ich schreibe. Anne, das ist der Name unserer kleinen Tochter, ist für gewöhnlich sanft und fröhlich und macht nie Probleme – sie schläft um halb neun und wacht morgens um sechs oder halb sieben wieder auf –, aber ausgerechnet heute schrie sie wie besessen. Das Kindermädchen kam nicht mir ihr zurecht, ich musste ihr Anne abnehmen, sie zunächst beruhigen, ihr danach etwas zu essen geben und die Windeln wechseln. Und als ich sie dann aus der Hand gab, was passierte? Ein neuer Anfall, sie brüllte, bis ihr Gesicht rot angelaufen war und die Tränen aus den Augen sprangen. Ich übernahm wieder, und als sie sich beruhigt hatte, nahm die Nanny sie im Kinderwagen mit. Sie sind noch immer draußen und gehen im nieselnden Sommerregen spazieren. Und ich kann endlich schreiben.
Aus dem reichen, dichten und großzügigen Brief, den du gestern geschrieben hast, ziehe ich den offensichtlichen Schluss, dass du ein Romantiker bist. Habe ich recht damit? Auf jeden Fall war das, was du geschrieben hast, für mich romantisch. Studium in Paris, Foucault und Derrida, die Begegnung mit jungen Menschen aus Südamerika – ich denke daran, was Paris für die lateinamerikanischen Schriftsteller bedeutet hat, vor allem für Cortázar, der viele Jahre in Paris im Exil lebte und dort einige der fantastischsten Geschichten schrieb, die ich je gelesen habe. Was du schreibst, erzeugt einen Sog bei mir, dort sein zu wollen, und ein Gefühl, dass es zu spät ist, dass sämtliche Züge abgefahren sind. Aber du warst dort. Und man hatte gerade dein erstes Buch angenommen – auch das ist romantisch, der junge Schriftsteller in Paris. Und auf einen letzten romantischen Punkt in deinem Brief möchte ich auch noch hinweisen, bevor ich damit aufhöre, und der hat mit der Arbeiterbewegung zu tun, sowohl die Beschreibungen der manuellen Arbeit, die sich in einigen deiner Bücher finden, als auch die Solidarität mit der arbeitenden Klasse. Als du mich einen Tag, bevor du aufgebrochen bist, hier im Garten besucht hast, haben wir über einen Aspekt gesprochen, über deine Faszination für die norwegische Kommunistische Arbeiterpartei AKP und nicht zuletzt für ihre vielen guten Autoren. Vor allem Dag Solstad, aber auch der Gentleman am Rande, der einzigartige Kjartan Fløgstad, der eine Sonderstellung genießt (auch in dem Sinne, dass er immer allein dasteht). Er war nie AKP-Mitglied, aber links, und sein Werk hat eine starke und nachhaltige Unterströmung. Von Schweden aus gesehen haben die siebziger Jahre in Norwegen und wie sie in der Literatur verarbeitet wurden etwas Exotisches. Wenn man aber wie ich in Norwegen aufgewachsen ist, war es weder romantische noch exotische Literatur, es war ganz einfach die absolut dominierende Literatur. Ich glaube, man darf die Bedeutung der dominierenden Literatur in der Zeit, in der man aufwächst, gar nicht unterschätzen, der Literatur, die einem so nahe ist, dass man sie im Vergleich zu den Büchern, die man später selbst schreibt, gar nicht erkennt. Dag Solstad, das war die europäische, vielleicht besonders die deutsche Literatur – obwohl ich das damals nicht wusste –, das waren Peter Handke, Robert Musil, Hermann Broch: die Moderne und die Nachbeben der Moderne. Streng, lakonisch, konzentriert, avanciert. Kjartan Fløgstad, das war die lateinamerikanische und spanische Literatur, das waren das Sprudelnde, der Überfluss, die Wortspiele und der Witz, aber auch das volkstümliche Leben, was dem rein literarischen Verständnis von Literatur am meisten fernliegt. Wenn jemand mir folgende Frage gestellt hätte: »In welchem Roman möchtest du am liebsten leben?«, hätte ich in zehn von zehn Fällen Fløgstads Bücher gewählt. Aber wenn die Frage gelautet hätte: »In welchem Roman fühlst du dich zu Hause?«, hätte ich leider Solstad sagen müssen. Ich bin Protestant bis in die Knochen. Ich bin jemand, der sich Dinge versagt, der nein zu Dingen sagt, und wenn ich auch gern über das quirlige, dampfende, extrovertierte und lebhafte Treiben auf der Welt lese, in dem es eine Fülle an Menschlichem, nicht aber an Materiellem oder Ökonomischem gibt, so ist es doch keine Welt, in der ich leben könnte; ich kann mich darin kaum aufhalten, ich wende mich ab, sehne mich danach, allein zu sein, ich schaffe es nicht, mich zu all dieser Großzügigkeit und Wärme zu verhalten.
Warum schreibe ich das?
Du weißt es wahrscheinlich schon. Brasilien, das ist nichts für mich. Nicht das brasilianische Leben, das ich tatsächlich nie erlebt habe und nur aus Beschreibungen kenne, und auch nicht der brasilianische Fußball. Während der WM 2002 in Korea und Japan, als Deutschland auf Brasilien traf, hielt ich zu Deutschland. Das hatte ich vorher nie getan, und vermutlich werde ich es auch nie wieder tun. Aber es ging um das kleinere Übel. Ich sah das Spiel mit meinem Bruder in einer Bar in Stockholm, und als Brasilien ein Tor schoss, beugte er sich vor und klatschte demonstrativ und direkt vor meiner Nase, als wollte er mir sagen: Du liegst dermaßen falsch, verstehst du das nicht?
Nicht zu Brasilien zu halten, auf Distanz zum brasilianischen Fußball zu gehen, ist ein wenig so, als würde ich sagen, ich ziehe hässliche Frauen hübschen vor, wenn ich wählen kann, entscheide ich mich immer für das hässliche Mädchen. Oder, um ein anderes Beispiel zu nehmen, das nicht sofort als sexistisch gelesen wird (das Buch soll ja auch in Schweden erscheinen), es ist, als würde ich sagen, ich lese lieber schlechte Bücher als gute.
Das war nicht immer so. Als ich jung war, wollte ich hinaus in die Welt, ich wolle alles sehen, riechen, hören und schmecken. Ich wollte das Leben. Ich wollte raus, hatte Pläne, durch Europa zu reisen, unterwegs zu arbeiten, mehrere Jahre fort zu sein und unterdessen an dem großen Roman zu schreiben. Ich wollte Menschen begegnen, Abenteuer erleben, mich verlieben, mich betrinken, die Welt bejahen. Dazu kam es jedoch nicht, ich bin nie losgefahren, stattdessen blieb ich in Bergen hocken – niemals Paris wie du, niemals Lateinamerika – und leitete einen langsamen, das Leben verneinenden Prozess ein, der jetzt seinen Höhepunkt erreicht hat; ich bin in einem winzig kleinen Dorf auf dem Land in Schweden gelandet, wo ich kaum einen Menschen kenne und überhaupt keine Sozialkontakte habe (gestern, beim Grillen mit den Eltern, habe ich tatsächlich mit niemandem geredet). Ich trinke so gut wie nichts, ich esse wenig, ich mache mir überhaupt nichts aus Essen. Ich habe ein permanent schlechtes Gewissen, weil ich zu wenig arbeite – denn nichts zu tun, ist nicht gut, das ist herumlungern.
Deshalb löst dein Brief, der von Jugend und Leben handelt, eine so starke Sehnsucht in mir aus. Aber der Zug ist abgefahren, und wenn morgen die Weltmeisterschaft beginnt, sympathisiere ich wie immer mit zwei Mannschaften: Argentinien und Italien. Wie du weißt, sind beide traditionell zynische Teams, die zu ihren besten Zeiten defensiv immer extrem gut organisiert waren und eher mit den Schwächen der Gegner als mit ihren eigenen Stärken gespielt haben. Sie haben immer über extreme Fähigkeiten verfügt, aber aus irgendeinem Grund setzten sie sie nie auf eine exzessive Art und Weise ein, niemals tun sie etwas Schönes um der Schönheit willen, sondern nur, wenn es in ein Ergebnis mündet. Und die Tatsache, dass sie es könnten, es aber zurückhalten, appelliert an etwas tief in mir Sitzendes.
Die ersten Fernsehbilder, an die ich mich erinnere, stammen aus dem Sommer 1978, der Weltmeisterschaft in Argentinien. Die Menschenmenge auf den Tribünen, die konfettiübersäten Grasplätze. Ricardo Villa, Osvaldo Ardiles, Mario Kempes. Ich wusste natürlich nichts von der politischen Situation, ich war neun Jahre alt, aber ich war verzaubert. Argentinien, die Mannschaft wie das Land, standen für etwas Abenteuerliches. Später wuchs das Abenteuerliche, denn ich las Borges, ich las Cortázar – ich lese jetzt Cesar Aires –, und ich las den polnischen Exilschriftsteller Witold Gombrowicz. (Seine Tagebücher sind fantastisch, sie wurden in Argentinien geschrieben, und wenn er gegen Ende nach Paris zieht, in die alte Welt, scheint es, als würden die Tagebücher sterben, sie verlieren ihre ganze Vitalität, ihre ganze Kraft – entsprang sie seinem Exildasein in Buenos Aires?) Darin steckt viel Romantik, aber eine andere Form der Romantik als die, die ich bei dir und in deinem Brief finde – aus dem einfachen Grund, dass dieses Brasilien, das du bejahst, eine physische Größe in deinem Leben ist, du bist dort unzählige Male gewesen, du hast Freunde dort, und du verfügst über handfeste Kenntnisse der Kultur – du sprichst die Sprache und hast brasilianische Literatur ins Schwedische übersetzt –, und du spielst Fußball wie ein Brasilianer. Das kommt noch dazu! Brasilien ist für dich gelebtes Leben, es ist lebendig. Argentinien für mich? Ich bin nie dort gewesen, es ist nur ein Traum, Fantasien, lediglich in den Büchern verankert, die ich gelesen habe. Es ist das Gegenteil von gelebt, das Gegenteil von lebendig, es ist Nicht-Leben, das in seiner letzten Konsequenz lebensverneinend ist – deshalb war der Arbeitstitel meines letzten Romans, der schließlich Min Kamp hieß, lange Argentina.
Morgen beginnt die WM. Ich freue mich. Ich erinnere mich an alle Weltmeisterschaften seit 1978, ich weiß noch, was ich getan habe, wie ich gelebt habe, wer ich war und in welchem Zustand der Welt sie stattfanden. Aber ich habe sie immer nur im Fernsehen gesehen, nie in der Wirklichkeit, und ich möchte gern, dass es so bleibt – denn das ist der Ausgangspunkt für dieses Buch, oder? Das Leben gegen den Tod, Ja gegen Nein, Brasilien gegen Argentinien.
Alles Gute,
Karl Ove
PS: Ich habe den Tipp für die WM-Wette ausgefüllt, zu der uns Eirik eingeladen hat, heute Abend ist die letzte Chance, du bekommst meine Tipps, sobald ich die Kinder zu Bett gebracht habe.
Rua Assunção 174, Botafogo, Rio, 11. Juni
Lieber Karl Ove!
Danke für deinen Brief. Wenn ich von Elterntreffen lese, geht mir durch den Kopf, wie sehr ich die Zeit vermisse, als meine Kinder klein waren, die Nähe zu ihnen, aber die Elterntreffen – das ist zum Glück vorbei. Ich bin inzwischen gelandet. Nach einem langen Flug steige ich immer leicht verwundert aus dem Flugzeug – darüber, dass ich am Leben bin. Dass ich nicht tot bin. Dass das Flugzeug auch diesmal nicht in den Atlantik gestürzt ist. Diese Flughafen- und Flugzeugwelt ist so unwirklich. Die Entfremdung in der Abflughalle, alle sind irgendwie ausschließlich in Körper verwandelt, große Fleischbrocken in Anzügen und Kostümen. Und beinahe alle mit so verschlossenen Gesichtern. Wie konnte es zur Normalität werden, sich bei einem transatlantischen Flug auf einen Platz zu setzen, ohne die nächsten Mitpassagiere überhaupt zu grüßen? Wie sind wir so geworden?
Ich las auf dem Flug Rubens Figueiredo, einen Autor aus Rio, der fantastische Erzählungen schreibt, die in einer traumartigen Dschungellandschaft spielen, betäubte mich anschließend mit einem Whiskey, drei Gläsern Rotwein und einer Schlaftablette. Erwachte ausgeruht, und dann, erst dann – also nach zehn Stunden – redete ich mit meiner unmittelbaren Nachbarin, einer Frau aus Rio in den Vierzigern. Ein Wort, Karl Ove, ein winziges Klopfen an einer fremden Tür, und die Welt öffnet sich. Wie oft habe ich das nicht schon erlebt, und ich liebe es. Sie war mit zwei Kolleginnen in Moskau und Wien, sie arbeitet in der Schönheitsbranche, hat einen eigenen Salon in Rio und zeigte mir plötzlich Fotos von ihrem Sohn, einem zwanzig Jahre alten Jungprofi in Cagliari, Italien. Die Fußballtür! Dann beschrieb sie sich selbst lachend als eine flamenguista doente (fanatische Flamengo-Anhängerin), und als ich sagte, ich würde in Botafogo wohnen, schlug sie vor, dass wir uns zu dritt, mit ihrer Freundin Patricia, ein Taxi teilen sollten, was wir auch taten. Und so glitt das Taxi, während ich mit einer weiteren Kosmetiksalonbesitzerin ein intensives Gespräch führte, durch den Morgen von Rio, durch das düstere, arme nördliche Rio, feucht und grau unter regenschweren Wolken auf einer Autobahn, auf der mir immer balas perdidas (Kugeln auf Abwegen) durch den Kopf gehen, denn hier gibt es zwei Gangs, eine auf jeder Seite der Autobahn, die sich in einem ewigen Krieg miteinander befinden; es heißt, dass die Kugeln einige Male Leute in vorbeifahrenden Autos getroffen hätten. So sterben unschuldige Menschen jedes Jahr in Rio: Schlafende in ihren Betten, Liebende im Bett eines Luxushotels, Mütter auf dem Weg in den Kindergarten, Taxifahrer, die nur versuchen, ihrer Arbeit nachzugehen.
Dieser Gedanke ist hier also immer präsent: der schnelle Tod.
Beide wunderten sich im Auto über das Bild von Brasilien im Ausland. Ich antwortete, wie es meiner Ansicht nach ist: Die ausländischen Medien lieben das romantisierende Bild vom brasilianischen Fußball und Karneval und das Bild von der Gewalt und den Favelas. Die Schönheit verkauft sich, die Gewalt verkauft sich, und die Wahrheit – die weitaus komplexer ist – nimmt Schaden. Hin und wieder merke ich, dass dies auch einer der Gründe ist, warum ich mich dafür entschieden habe, über das Land zu schreiben, um dieses Bild zu erweitern und eine Form von Gleichgewicht zu schaffen. Sie setzten mich an einem rostigen Eisentor an der Rua Assunção 174 ab, wo mich mein Gastgeber schlaftrunken empfing – es war sieben Uhr, als ich ankam. Er heißt Afonso Machado und ist Musiker, Gitarrist, hat mit vielen Großen gespielt, unter anderem mit Chico Buarque und Elza Soares. Bei Afonso habe ich ein eigenes Zimmer in einer alten Villa, die zwischen dem Dschungel, einer Bergwand, anderen Villen und einigen Mietshäusern liegt.
Inzwischen habe ich mich in meiner eigenen Welt eingerichtet: Bibliothek, Fernseher, CD-Player, Bücher, Drucker. Was für ein Glück es ist, sich jedes Mal seine eigene Welt und Werkstatt aufzubauen – was auch immer passiert. Von hier aus schreibe ich dir, und schaue ich aus dem offenen Fenster, sehe ich einen Zipfel des Himmels, zwei Wohnblocks und alle zehn Minuten einen Inlandsflug, der in niedriger Höhe auf Santos Dumont zu über den Himmel dröhnt. Und hier gibt es auch fußballhistorischen Boden, denn nur wenige hundert Meter weiter liegt Fluminenses schlossartiges Stadion, und auf diesem Platz, Laranjeiras, wurde Brasilien 1919 zum ersten Mal südamerikanischer Meister, mit einem Tor in der Nachspielzeit von Arthur Friedenreich, dem Mulatten, der weiß sein wollte, ein Tor, das in Pixinguinhas Choro Um a zero (Eins zu null) verewigt wurde.
Ich kam sofort gut zurecht mit Afonso, er hat den Schalk in den Augen, ein Lächeln auf den Lippen, eine herzliche Ausstrahlung und, wie so viele hier, das Rioartige, diese lockere, leicht entspannte Haltung, die nicht ironisch oder aufgesetzt ist, sondern ganz natürlich. Er servierte mir ein Frühstück, und schon nach wenigen Minuten waren wir dort, wo man hier gern landet, in der Welt des Fußballs. Er ist Botafogo. So heißt das. Man ist seine Mannschaft, man begnügt sich nicht damit, zu ihr zu halten. Und mit einem Mal redeten wir über Garrincha, Botafogos besten Spieler aller Zeiten. Ich erzählte von Lasse Westmans Film und Garrinchas schwedischem Sohn Ulf Lindberg. Er erzählte, dass er mit Elza Soares auf Tournee war, die viele Jahre eine stürmische Affäre mit Garrincha hatte, und er erzählte von ihrer Stimme, wie unglaublich er sie fand und noch immer findet. Und dann erzählte er, zwischen zwei Bissen, dass sein Vater ihn ins Maracanã-Stadion mitnahm, als er klein war, um Botafogo zu sehen. Er war dort an dem Tag, als Botafogo 1962 Flamengo vor hundertsechzigtausend Zuschauern im Finale der Meisterschaft von Rio mit 3:0 schlug, Garrinchas vielleicht bestes Spiel überhaupt, absolut vergleichbar mit der Eröffnung der Gruppenspiele 1958 zwischen Brasilien und der Sowjetunion im Ullevi-Stadion von Göteborg, eine Vorstellung, die Drillo erschütterte, wie du weißt, den sechzehnjährigen Drillo, der nach Göteborg trampte, nur um die x- und o-beinigen Genies aus nächster Nähe zu sehen.
Ja, es ist so, wie du schreibst, es gibt ein Alter, in dem wir für neue Eindrücke, die wir nie wieder vergessen, absolut empfänglich sind. Die erste Weltmeisterschaft, die durch deine Poren drang, war 1978, daher deine Liebe zu Argentinien. Meine erste WM erlebte ich in dieser Form 1970, als Pelé auf dem Höhepunkt seiner Karriere war und Brasilien, wie viele meinen, die beste Nationalmannschaft hatte, die jemals existiert hat. Aber, und das ist ein wichtiges »Aber«, ich scheue zurück vor deiner Dichotomie, deinem Entweder-Oder, dass man das eine oder das andere sein muss, wo man – wie ich! – doch häufig spürt, dass man sowohl als auch ist. Als ich zwölf war, gewann England die Weltmeisterschaft mit Spielern wie Bobby Charlton, Bobby Moore, Nobby Stiles und Alan Ball. Spieler, die ich ins Herz schloss, nicht zuletzt Moore, den ich so männlich und attraktiv fand und deshalb – zumindest bildete ich mir das damals ein – auch gut. Ich liebte den niederländischen Totalfußball. Cruyff und Neeskens waren die Boten einer neuen Welt. Ich habe eine innere Kartei mit großen deutschen Fußballspielern, die ich bewundere (Seeler, Beckenbauer, Netzer, Rummenigge, Littbarski, Häßler zum Beispiel), und dass Argentinien 1978 gewann, gefiel mir auch, nicht zuletzt Kempes’ Naturgewalt, die Art, wie er durch den Konfettischneefall stürmte, ohne dass ihn jemand aufhalten konnte. Und Maradona, Karl Ove, verdammt! Es gibt keinen anderen Fußballer – mit Ausnahme von Garrincha –, den ich mehr bewundert habe als el pibe de oro. Es gehört zu meinen größten Momenten, als ich ihn 1990 in Florenz erlebte, nach dem Achtelfinale zwischen Argentinien und Brasilien, das er mit ein paar genialen Dribblings im Mittelfeld entschied, bevor er den Ball an Caniggia weiterspielte: Ich saß ganz vorn bei der Pressekonferenz und war vollkommen gefangen von ihm: dieser intelligente Blick, die raschen Antworten, die demütige Haltung gegenüber dem geschlagenen Gegner. Als alles vorbei war, stand er vom Podium auf, und dann hörte ich plötzlich meine eigene Stimme sagen: Diego, por favor! Worauf er, der in Italien so verhasst war und über den so schlecht geredet wurde, sich umdreht, zu mir kommt und sein Autogramm auf den Block schreibt, den ich ihm hinhalte. Und im selben Moment verwandeln sich die übrigen zweihundert Sportjournalisten in genau den gleichen kleinen Jungen wie ich, und als sie das Podium stürmen, kann ich mich mit meinem kostbaren, später gerahmten Kleinod hinausstehlen.
Aber klar, halten wir eine Art Debatte über den Fußball am Leben, doch dafür eignen sich Brasilien–Italien oder Brasilien – und England /Deutschland besser als Gegenpole, und das Spiel in Barcelona 1982 (Italien–Brasilien 3:2) enthielt doch alles, was es über den Gegensatz zwischen dem »Brasilianischen« (was immer es auch ist) und dem »Italienischen« (was immer das auch ist) zu sagen gibt.
Du hast recht mit der Romantik. Komisch, dass du es ausgerechnet jetzt erwähnst, denn erst vor ein paar Wochen habe ich festgestellt, dass ich genau das bin, ein Romantiker. Aber ein Romantiker, der Krieg gegen sich selbst führt und der versucht, sämtliche romantischen Abarten zu bekämpfen. Die Romantik hat mich geprägt, ich spürte sie bereits in den siebziger Jahren, als ich mich vom Maoismus angezogen fühlte, nicht zuletzt von der norwegischen Variante, die zu einem merkwürdigen skandinavischen Ur-Maoismus geworden ist, interessanter und spannender als unserem eigenen, dem etwas leblosen schwedischen Maoismus. Solstad, Hoem und auch Obrestad wurden irgendwann wichtig für mich, als ich meine ersten unsicheren Schritte als Schriftsteller unternahm. Solstad brachte mir bei, dass sich Politik und Literatur kombinieren lassen. Hoem lehrte mich die Metaperspektive (Fährfahrten der Liebe), und Obrestad, dass es wichtig ist, morgens früh aufzustehen und zur Arbeit zu gehen (in die Fabrik oder, wo ich damals arbeitete, im Hafen). Später zerschlug Fløgstad, der vermutlich kein ML’er war, das meiste und brachte die Welt mit Büchern wie Dalen Portland und Fyr og Flamme (Feuer und Flamme) einen Schritt weiter. Er zeigte, dass die Politik so groß wie das Leben ist und dass Parteipolitik (in diesem Fall die Politik der AKP beziehungsweise der Schwedischen Kommunistischen Partei) immer zu Sterilität und dem Tod der Kunst führt.
Exotismus und Romantik gehen häufig Hand in Hand und bedingen sich gegenseitig. Für mich waren Oslo und Norwegen exotisch, obwohl es nur eine andere, etwas protestantischere Variante des Schwedischen war. Aber es war ein Exotismus, der mir damals gefiel, der mich prägte und mich zu dem Schriftsteller werden ließ, der ich wurde, und wenn ich mich selbst durch das Fernglas der Geschichte betrachte, einen jungen Mann, der im Sommer 1976 auf einer Brücke auf Bygdøy Arild Asnes oder Sauda, Streik! liest, in der schwedischen Hafenarbeitergewerkschaft organisiert ist und in jenem Herbst aus Anlass seines Todes eine poetische Hymne auf Mao schreibt, dann sehe ich einen jungen Mann – einen guten, wie ich finde –, der die Welt verändern wollte und glaubte, der Marxismus-Leninismus wäre dafür das beste und klügste Werkzeug, der allerdings noch nicht genügend über die Schattenseiten des totalitären Denkens gelernt hatte.
Heute Abend werde ich irgendwo hier in Botafogo mit Afonso zu Abend essen, weshalb ich daran denken muss, was du über Essen, Trinken und Frauen schreibst; sieh es mir nach, aber ich bin ein wenig betrübt, denn alles, was du schreibst, widerstrebt mir total: Ich liebe es, zu essen und zu trinken, und manchmal habe ich das Gefühl – bei einem lecker gedeckten Tisch in Gesellschaft von guten Freunden, oder in einem Steakhouse wie dem Porcão hier in Rio (für einen festen Preis kann man so viel essen, wie man will) –, dass ich kein Mensch bin, sondern eher eine Art fleischfressendes Wesen, das eins wird mit dem, was ich esse; eine stille Ekstase (zu Hause behaupten Marianne und die Kinder immer, dass ich ein brummendes Geräusch von mir gebe, wenn ich in diesem Zustand bin), die sich auch in meinem Verhältnis zu Wein, Bier und Schnaps finden lässt. Ich versuche die ganze Zeit, weiter und weiter zu gehen, etwas anderes, Größeres zu erreichen – etwas Dionysisches? Und was du über Frauen schreibst, verstehe ich auch nicht. Oder besser: Ich verstehe es, aber mir geht es genau umgekehrt. Wenn eine hübsche Frau den Raum betritt, in dem ich mich befinde, durchzuckt mich ein elektrischer Schlag, das passiert oft, und es ist nicht nur Jorge Amados’ Wunsch, mit allen Frauen der Welt zu schlafen, es ist vielmehr eine Art Verehrung der Schönheit, die Freude, einen kurzen Moment das Privileg zu haben, am Mysterium der Schönheit teilzuhaben. Nachdem all dies bei den Maoisten (lies: den Hyperprotestanten) der siebziger Jahre tabu war, im protestantischen Sinn tabu, kam es vor, dass ich mich damals in einer Art Impuls, um alle Äußerungen Eros’ in mir zu bekämpfen, kastrieren und in eine Jan-Myrdalsche Lampe verwandeln wollte, in ein in jeder Hinsicht geschlechtsloses und aufgeklärtes Wesen, dessen gesamte menschliche Aktivität auf Argumentation und Dialektik reduziert war. Um Gottes willen!
Hier mache ich für heute einen Punkt. Jetzt ist die Copacabana dran. Im besten Fall Fußball oder Volleyball mit alten Freunden. Im schlimmsten Fall nur ein kleiner Sprung ins Wasser, gefolgt von einem oder zwei Caipirinha(s).
Herzliche Grüße,
Fredrik
Glemmingebro, 12. Juni
Lieber Fredrik,
danke für deinen Brief. Ich bekam ihn spät und las ihn im Bett vor dem Einschlafen, mit leicht geröteten Wangen, denn er handelt von der Wirklichkeit, während meiner dies nicht tat; ich schrieb über Theorien, über etwas Fixiertes und Verzerrtes, und war eigentlich ganz zufrieden damit, als ich den Punkt erreichte, wo es um Leben und Tod ging, um ja oder nein, um alles oder nichts. Dein Brief korrigiert diesen Ansatz auf freundliche Weise, nicht, indem du es kommentierst, sondern weil du ein Beispiel für etwas anderes bist, nämlich Komplexität. Mir geht es häufig so, dass ich etwas schreibe, das an und für sich gut klingt, um dann – es kann eine Stunde oder mehrere Jahre später sein – zu begreifen, dass es niemals so ist, niemals so einfach, niemals nur das eine oder das andere. Um was es dabei geht, ist eigentlich Distanz, und es ist ein grundlegendes literarisches Problem, denke ich: Schreiben schafft eine Distanz zu dem, worüber man schreibt, und Distanz vereinfacht. Die Form vereinfacht zusätzlich. Denkt man sich die Literatur als eine autonome Größe, ist es kein Problem, dann hat sie keine repräsentative Verantwortung. Will man hingegen über das Leben schreiben, dann ist die Vereinfachung eine Hülle, etwas, das man ständig bekämpfen muss. Das geschieht, indem man so nah wie möglich herangeht, dort hineingeht, wo alle großen Linien, alle generalisierenden Überbauten nicht länger gelten oder sich nicht greifen lassen. Für mich, so sehe ich es, ist das schlichtweg die eigentliche Aufgabe der Literatur. Nicht notwendigerweise in Form von Realismus oder Beschreibung der Wirklichkeit, aber als ein beharrliches, nie ruhendes Insistieren und Suchen nach Auflösung der Strukturen, hin zu dem, was wir wissen. Im Leben sieht es anders aus, da ist es beinahe umgekehrt, Vereinfachungen und Generalisierungen sind notwendig, sie bilden den Rahmen für den Alltag und das Leben miteinander, ihre Abwesenheit würde alles chaotisch und unüberschaubar werden lassen. Es ist abstrakt, ich weiß, nur eine Idee, die ich habe, vielleicht sogar eine fixe Idee, aber sie basiert auf Erfahrung, und zwar auf einer ganz bestimmten Erfahrung: Linda, meine Ehefrau, hat eine bipolare Diagnose, und in den Phasen ihres Lebens, in denen die Ausschläge, die damit verbunden sind, nicht in Schach gehalten werden können, sieht es aus, als würde sich ihre Persönlichkeit verändern – von einem deprimierten Zustand, in dem alles still und stumm ist, unantastbar und unmöglich, hin zu einem euphorischen Zustand, wo alles offen, beweglich, möglich und positiv ist. Und zwischen diesen beiden Extremen gibt es sämtliche nur vorstellbaren Ebenen. In unserem Leben hier geht es also darum, Stabilität zu finden, Regeln, das Feste und sich Wiederholende – die Routinehandlungen waren sozusagen ein Weg durch das Unüberschaubare und Chaotische, und das hat ganz ausgezeichnet funktioniert, uns geht es gut, uns allen. Aber angesichts der Tatsache, dass ein Mensch, den man so gut kennt, wie man eben jemanden kennt, mit dem man viele Jahre zusammengelebt hat, sich plötzlich verändert, plötzlich die Balance verliert, frage ich mich, was Persönlichkeit eigentlich ist, was Charakter eigentlich ist. Normalerweise sehe ich beides als etwas Festes an, als einen Kern, etwas Unveränderliches. Selbstverständlich mit Variationen – wir alle kennen jemanden, der plötzlich in seinem Leben einen neuen Frühling erlebt und mit anderen, ihm bisher fremden Dingen beginnt –, aber dennoch, es bleibt überschaubar und relativ vergleichbar. Wenn ich darüber nachdenke, weiß ich nicht allzu viel über diejenigen, die ich kenne, aber von den meisten habe ich ein klares Bild – er ist so, sie ist so –, und auf der Basis dieser Vereinfachung bin ich mit ihnen zusammen. Die Distanz, die solche Generalisierungen schafft, ist notwendig, damit das soziale Leben funktioniert. Deshalb legen wir ja auch nie die Seele auf den Tisch, wenn man sich begegnet, und wenn es geschieht – denn bisweilen passiert es, es gibt immer jemanden, der sich nicht daran hält –, wird es unangenehm, unerträglich, eine uns auferlegte Bürde, und wir empfinden es als Erleichterung, wenn wir verschwinden können. In der Literatur ist es umgekehrt, dort sucht man vor allem die Grenzüberschreitungen, sowohl als Autor wie als Leser. Dort geht es um Auflösung. Es scheint eine ganz pragmatische Wahrheit zu sein, die wir möglicherweise kennen, vielleicht aber auch nicht, zu der wir uns aber nur selten verhalten. Sie zeigt sich in Krisen, wenn jemand stirbt, wenn jemand geboren wird, wenn sich jemand verliebt, und alle Regeln, alle Beschränkungen mit einem Schlag aufgehoben sind.
Du schreibst in deinem Brief viel über Dinge, die sich öffnen. Die Tür zum Spanischen und Lateinamerikanischen, die sich dir in deiner Jugend erst einen Spalt öffnete, dann sperrangelweit. Du schreibst aber auch darüber, wie man sich Menschen gegenüber öffnet – erst das unpersönliche Lufthafenmilieu, wo jeder nur mit sich selbst beschäftigt ist, bis hin zu den Menschen, neben denen man an Bord des Flugzeugs sitzt, nur wenige Zentimeter voneinander entfernt, und dann die Öffnung, das Leben, das plötzlich mit einer gewaltigen Kraft in Erscheinung tritt: die Inhaberin eines Schönheitssalons mit ihrem italienischen Fussballprofi-Sohn! Und so ist es ja tatsächlich, jeder Mensch ist eine Tür, die sich öffnen lässt, und dahinter ist ein Leben, ebenso stark und schimmernd wie das eigene Leben. Es ist, als hättest du einen Zauberstab, Fredrik – du berührst deinen Nächsten mit einigen wenigen Worten, und er oder sie öffnen sich. Ich lese deinen Reisebericht nach Rio wie einen Roman, ich sehe alles vor mir und bin auf der Reise dabei – aber dass sich dieser Roman in Realzeit abspielt, dass du nun dort bist, mitten in Rio und mit all dem, was dort passiert, während ich hier allein in meinem Arbeitszimmer in Glemmingebro sitze, kann ich nicht begreifen. Für mich bist du jetzt in einem Roman. Und es kommt mir vor, als könnte was auch immer geschehen.
Vor kurzem habe ich mit meinem Freund und Nachbarn Geir Angell telefoniert. Er hat, wie du weißt, überhaupt kein Interesse an Fußball, seine einzige Sportart ist Boxen – er besteht darauf, dass es kein Sport ist, sondern etwas ganz anderes –, jedenfalls erzählte ich ihm ein bisschen von deinen und meinen beiden Briefen. Ich beschrieb dich als einen Hedonisten – auch wenn es eine Reduktion ist, stimmt es doch, oder? Du genießt es zu essen, zu trinken, du genießt die Literatur, du genießt Fußball –, und dann erzählte ich ein bisschen darüber, welche Art von Fußballer du bist und welches Verhältnis du zu diesem Sport hast. Ich sagte wohl so etwas Wahres wie, dass du darin aufgehst. Geir fragte daraufhin, was ich eigentlich für ein Verhältnis zum Fußball habe. Ich gehe nicht darin auf, ich spiele selbst nicht mehr, also was ist es? Bin ich auch hier nur ein Zuschauer? Also jemand, der außen vor steht und nur schaut?
Mich hat Fußball interessiert, solange ich mich erinnern kann. Einige meiner allerfrühesten Erinnerungen handeln vom Fußball, ich war vielleicht fünf oder sechs Jahre alt, und wir spielten dort, wo wir wohnten, hin und wieder waren wir richtig viele Kinder, manchmal spielten wir nur zu zweit oder zu dritt, aber es war immer etwas, worauf wir uns freuten: ein Ball, ein Spielfeld, zwei Jacken als Tormarkierung. Oh, die Schreie in der Abendluft, der Ball, schwer und schlüpfrig vor Feuchtigkeit oder so trocken und leicht, dass man die Blase zwischen den Ledernähten sehen konnte; die konstante Spannung und die Enttäuschung, wenn die Ersten nach Hause gingen und die Mannschaften umgruppiert werden mussten, vielleicht zwei gegen zwei, bis es nicht mehr länger ging, entweder weil es zu dunkel war oder die Letzten nach Hause schlichen. Im Herbst im Regen, im Winter im Schnee, im Frühling im Schlamm, im Sommer in der Hitze: Fußball, Fußball, Fußball. Auf der asphaltierten Straße vor dem Haus, auf der leicht abfallenden Wiese, auf dem Plateau direkt hinter dem Felsen, unten am See, auf dem Spielfeld aus festgetrampelter Erde im Wald. Ich erinnere mich, dass einmal ein richtiges Turnier organisiert wurde, jeder konnte eine Mannschaft anmelden, und wir aus unserer Straße meldeten uns. Diese Spannung. Wir fuhren ein paar Kilometer mit dem Rad, um zum Austragungsort zu kommen, wir hatten Trikots (T-Shirts in ungefähr der gleichen Farbe), und wir spielten auf einem ordentlichen Platz gegen eine ordentliche Mannschaft. Es ist eine der intensivsten Erinnerungen aus meiner Kindheit, die ich habe. Dieser Tag. Ich glaube, wenn man ehrlich mit sich selbst ist und die unterschiedlichen Altersstufen demokratisch betrachtet, also mit den gleichen Rechten, dann gehört dieser Tag, als wir eine Mannschaft zusammenzimmerten und ein ganzes Turnier spielten, zu den größten Augenblicken meines Lebens. Ich stand im Tor, damals wollte ich Torwart werden, allerdings konnte ich mich nur auf eine Seite werfen, nach links, und als ich sieben Jahre alt war und anfing, im Verein Fußball zu spielen (bei der G-Jugend in Trauma – ein Name, bei dem alle Kolleginnen meiner Mutter lachten, wenn sie ihn auf dem Rücken meiner Trainingsjacke lasen, sie waren Krankenpflegerinnen in der Psychiatrie), gab es bereits einen Torwart, also wurde ich Feldspieler. Ich entsinne mich, dass wir zwei Mal in der Woche trainierten, und in der Saison gab es pro Woche ein Spiel. Außerdem kickten wir abends zu Hause und in jeder freien Minute in der Schule. Die Mannschaft, in der ich spielte, hatte vier, fünf besonders talentierte Spieler, wir gewannen unsere Spiele gewöhnlich mit sechs, sieben Toren Unterschied, nicht selten zweistellig, und ich glaube, solange ich dabei war, wurden wir jedes Jahr in unserer Klasse Erster – also bis wir von dort fortzogen, als ich dreizehn war. Wir spielten jeden Sommer beim Norway Cup, in einem Jahr gehörten wir sogar zu den letzten sechzehn, als wir auf die Mannschaft von Tromsø trafen, in der alle Spieler einen Kopf größer waren als wir. Ich spielte im Mittelfeld und gehörte nicht zu den guten Spielern, und obwohl ich davon träumte und den Ball an langen, trägen und langweiligen Sommertagen Stunde um Stunde an eine enorme Backsteinmauer treten konnte oder mit einem Freund auf dem Rasenplatz stundenlang Elfmeterschießen übte, war es doch nie das Wichtigste, nicht deshalb spielte ich Fußball. Ich spielte, weil es mir immer Spaß machte, egal wann. Es wurde nie langweilig. Es war immer spannend. Und heute denke ich, vielleicht war deshalb alles andere nicht so wichtig, denn entscheidend war, dass man etwas gemeinsam unternahm, alle waren dabei, niemand war ausgeschlossen, man verschwand in der Gruppe. Fußball spielen hieß, an einem Ort zu sein, es war wie eine eigene Welt in der Welt, in der eigene Regeln galten und ich glücklich war. Zum Teufel, ja, darum ging es: um Glück. Nicht man selbst, sondern ein anderer zu sein. Das ging so weiter, bis ich sechzehn war. Dann kam ich auf andere Ideen, was mich betraf, und die Tatsache, dass ich kein wirklich guter Fußballer war, stand mir plötzlich im Weg. Ich hörte britischen Postpunk, Musik war unendlich wichtig, und nur, wenn ich besonders gut gewesen wäre, hätte ich das Fußballspielen noch rechtfertigen können. Dann hätte ich in Würde weiterspielen können, aber ich war nicht besonders gut, also hörte ich auf. Gleichzeitig fing ich an zu trinken und fand etwas Ähnliches im Alkohol: eine Welt in der Welt, in der andere Regeln galten und in der man vor sich selbst verschwand. Ich sah mir jedoch weiterhin Fußball an. Meine Mannschaften waren Start Kristiansand in Norwegen, Liverpool in England und alle vier Jahre bei der Fußball-Weltmeisterschaft Italien und Argentinien.
Damals in den siebziger Jahren war Fußball noch nicht so kommerziell wie heute, er war noch nicht so groß, er war noch nichts, was allen gefiel und alle verfolgten. In meiner Klasse gab es vielleicht fünf Kerle, die sich damit beschäftigten. Im Fernsehen gab es so gut wie nie Fußball – jeden Samstag wurden die Toto-Spiele der englischen Liga gezeigt, außerdem das FA-Cup-Finale im Mai, ein großer Tag, sowie der Europapokal der Landesmeister, der UEFA-Pokal und der Pokal der Pokalsieger, ebenfalls im Mai. Dazu kamen die Länderspiele der norwegischen Nationalmannschaft. Ich bin in einer fußballinteressierten Familie aufgewachsen. Mein Großvater, der in Kristiansand wohnte, fuhr jeden zweiten Sonntag mit dem Fahrrad ins Stadion zu den Heimspielen von IK Start. Ich erinnere mich, dass es spannend war; kurz bevor das Spiel angepfiffen wurde, war die Straße vor unserem Haus voller Fans, und dann noch einmal, sobald das Spiel vorbei war. Wenn Großvater nach Hause kam, war das Ergebnis seinem Gesicht abzulesen. Immer sprach er negativ von der Mannschaft, immer waren sie schlecht, aber das war eigentlich nur die übliche Art und Weise, wie alle über die Spieler redeten, denn am übernächsten Sonntag fuhr er wieder ins Stadion, vermutlich voller neuer Hoffnung. Wir waren auch manchmal im Stadion, weil mein Vater sich ebenfalls die Heimspiele ansah und meinen Bruder und mich hin und wieder mitnahm. Zum Fußball zu gehen, gehörte zu den wenigen Dingen, die mein Bruder und ich mit unserem Vater unternahmen, und es gehörte zu den wenigen Dingen, die wir als Familie gemeinsam mit vielen anderen Familien gemein hatten. Noch immer läuft es mir kalt den Rücken hinunter, wenn ich den kollektiven Schrei eines Fußballstadions höre. IK Start gewann 1978 zum ersten Mal die norwegische Meisterschaft, ich muss einige Spiele gesehen habe, erinnere mich aber an keines mehr. Dagegen erinnere ich mich, dass mein Vater einmal mitten in der Woche nach Kristiansand fuhr, das muss im Jahr darauf gewesen sein, 1979, denn da spielte Start gegen Eintracht Frankfurt im UEFA-Cup. Es war eine große Sache für meinen Vater, eine deutsche Mannschaft im Stadion von Kristiansand. Wir fuhren zu mehreren Auswärtsspielen, ich erinnere mich allerdings nur an wenige, nur daran, dass wir beinahe den ganzen Vormittag im Auto saßen, um dann zwei Stunden in einem fremden Stadion zu sitzen. Danach viele Stunden Heimfahrt in der Dunkelheit. Ich entsinne mich an ein Spiel gegen Mjøndalen oder die Braunhemden, wie sie unpassenderweise genannt wurden. 1980 war ich im Stadion, als Start zum zweiten Mal norwegischer Meister wurde und wir den Platz stürmten. Danach feierten wir die Mannschaft vor den Umkleidekabinen, sie kamen heraus und warfen uns ihre Trikots zu, ich erwischte eins, es gehörte Svein Mathisen, aber ein erwachsener Mann riss es mir aus den Händen. Oh, die Namen dieser Spieler lassen eine ganze Welt wiederauferstehen: Svein Mathisen, Helge Skuseth, Reidar Flaa, Trond Pedersen, Roy Amundsen, Steinar Aase. Ich las Fußballzeitschriften, ich las die Sportseiten aller Zeitungen nach den Spielen, ich sah mir alles an, was im Fernsehen an Fußball gezeigt wurde. Dass Fußball nicht so verfügbar war wie heute, war vermutlich ein Teil des Vergnügens, denn Milan, Real Madrid oder Bayern München waren beispielsweise so selten zu sehen, dass man es geradezu als ein Geschenk betrachten musste, als eine Gnade. In dieser Welt, in der sich eigentlich alles um Fußball drehte, war die Weltmeisterschaft etwas ganz Außergewöhnliches. Jeden Tag Spiele, viele mit Spielern, über die ich nur gelesen hatte. Die erste WM, bei der ich groß genug war, um alles mitzubekommen … war das 1982? Frankreich, mit Rocheteau als Flügelspieler, dieser klassische langhaarige Flügeldribbler-Typ, erinnerst du dich an ihn, Fredrik? Das Spiel gegen Deutschland, war das im Halbfinale? Ich glaube noch immer, dass es das beste Fußballspiel war, das ich je gesehen habe. Ich trauerte noch mehrere Tage später, das ist tatsächlich das einzig passende Wort für die Gefühle, mit denen mich das Spiel hinterlassen hatte: Trauer. Und ist es nicht unglaublich, dass bei derselben Weltmeisterschaft Zico und Socrates für Brasilien spielten und Paolo Rossi für Italien? Für mich sind das drei verschiedene Wirklichkeiten, und jede hat ihre Abteilung in dem Gewölbe meiner Erinnerungen. Dort liegen die Spiele, aber auch die ganze Welt, aus der ich sie sah. 1998, ich erinnere mich an Argentinien gegen England, an meinen ersten Roman, der fertig war und erscheinen sollte, aber auch – gleichsam abgetrennt von allem anderen – an Brasilien gegen Norwegen, den Strafstoß in den Schlussminuten, ich konnte ihn mir einfach nicht ansehen, die tränenerstickte Stimme meines Bruders am Telefon direkt danach, wir hatten Brasilien besiegt und die Gruppenspiele überstanden. Ich habe das Spiel in Molde gesehen, hinterher umarmten sich die Menschen auf der Straße, Bekannte wie Unbekannte. Die Weltmeisterschaft 2002, als Italien vom Schiedsrichter betrogen wurde, ich sah das Spiel in Stockholm in einer italienischen Bar und war so verliebt wie nie zuvor – das war damals, als die Spiele morgens übertragen wurden. Wir haben sie im Bett gesehen. Schweden gegen Argentinien, dann das Senegal-Spiel, bei dem Schweden nach Anders Svenssons Pfostenschuss herausgekickt wurde, du hast es vor ein paar Tagen hier im Garten erwähnt, er traf nur den Pfosten, und sie waren draußen. Die WM 2006, da hatten wir bereits zwei Kinder, und dann das Finale zusammen mit ihnen in einem Hotelzimmer in Bergen, ich meine mich zu erinnern, dass es draußen dunkel war und blitzte, und Zidane – es war ein so unglaublicher Genuss, jede einzelne Bewegung von ihm zu sehen, er muss einer der größten europäischen Spieler aller Zeiten sein – versetzte Materazzi einen Kopfstoß. Und Spanien bei der vorletzten WM, die wir hier draußen gesehen haben, wir hatten ein Haus gemietet, waren vormittags schwimmen und hatten uns dann ein Haus angesehen – und dieses Haus schließlich gekauft! –, abends haben wir uns dann die Spiele angesehen. Es war ein perfekter Sommer, so wie alle Sommer mit einer Fußballweltmeisterschaft perfekt sind.
Meine Tippreihe habe ich dir auch gestern nicht geschickt, Fredrik – ich bin auf dem Sofa eingeschlafen, während die Kinder Kinderfernsehen sahen, vollkommen erschlagen vor Müdigkeit, der Jetlag ist noch immer nicht überwunden. Und als die Kinder mich weckten, damit ich sie ins Bett bringe, und nachdem ich ihnen vorgelesen hatte, war ich so müde, dass ich nur noch die Kraft hatte, deinen Brief zu lesen, das Licht zu löschen und im Schlaf zu versinken. Aber nachher werde ich es umgehend machen – erst muss ich die Kinder abholen, es ist ihr letzter Schultag, und mit ihnen auf die Abschlussfeier gehen. Hoffentlich schaffe ich es zu tippen, bevor das erste Spiel angepfiffen wird. Soweit ich weiß, geht es heute Abend um zehn los. Selbst auf die Gefahr hin, mich zu blamieren: Meine erste Eingebung sagt mir, dass Kroatien 2:1 gewinnt. Aber wie du weißt, enden Eröffnungsspiele ja häufig unentschieden, daher ist mein Tipp 1:1.
Ich hoffe, es geht dir gut dort drüben, Fredrik – pass auf, dass du auch für mich ein bisschen mitlebst!
Alles Gute,
Karl Ove
Botafogo, 12. Juni
Lieber Karl Ove,
es ist herrlich, über deine Beziehung zum Fußball in all seinen Formen zu lesen, denn hier kommst du, wie schon so oft in deinen Texten, diesem Proust’schen so unglaublich nahe, das zu deinem Markenzeichen geworden ist: ganz tief ins Innere. Ich habe als Autor ein Leben lang gebraucht, um zu verstehen, dass ich genau das tun soll, dass ich dem gedachten Leser die Seele übersetzen und ihm all das begreiflich machen soll, was in uns geschieht. Nur auf diese Art lässt sich die Distanz durchbrechen, von der du schreibst, nur so werden die Paradoxe lebendig und die Worte lebendige Wirklichkeit. Die Form und die akribische Arbeit mit der Form helfen uns, ins Herz dessen vorzustoßen, was wir sagen/schildern wollen, und an genau diesem Punkt, wenn wir spüren, dass die Transformation gelingt, in diesem magischen Augenblick begreifen wir, was sich wie ein Klischee anhört, aber ganz real ist: die Freude, etwas zu schaffen.
Ich verstehe, was du über Linda schreibst, gleichzeitig begreife ich aber nicht, wie man in und mit diesen Schlägen leben kann. Ich kann nur sagen und schreiben, dass ich den Kampf bewundere, den ihr führt und geführt habt, den Kampf gegen die Realität dieser Krankheit in eurem Leben, den Kampf mit den Kindern, dem Schreiben, dem Abholen aus dem Kindergarten, dem Essen und all diesen Kleinkindwirklichkeiten. Auf der Netzhaut hat sich mir ein ganz klares Bild von dir vor ein paar Jahren eingebrannt, als du mitten in der Arbeit an, ich glaube, Band 3 oder 4 von Min Kamp stecktest. Ich stand mit meinem Auto auf der Skolgatan und wartete auf ein paar Musiker, die ich zu einem gemeinsamen Auftritt abholen sollte. Ich stand vor der Pizza Siciliana, als du vorbeikamst. Es goss wie aus Kübeln, ich saß im Auto, die Scheibenwischer liefen, und in diesem Regen, den Kinderwagen fest im Griff und mit deinem ernsten, konzentrierten Blick, erschienst du mir wie der Kapitän eines Kinderwagenschoners im Sturm, mit Kindern, die an allen Ecken des Wagens hingen und baumelten, und nun gelingt es mir endlich, dieses Bild für mich zu formulieren – dieser kraftvolle Wille nach vorn, mit dem Leben, den Kindern, der Liebe, Linda und dem Schreiben, das deine stärkste Kraft ist. Niemand hält dich auf. Nichts hält dich auf. Und dann warst du verschwunden, die Straße hinunter, wie ein fortgespültes Traumbild.
»Die Seele auf den Tisch«? Ja, es ist merkwürdig. Wir leben, kämpfen und verkehren miteinander: Freunde, Liebste, Kollegen, Bekannte aus der Kindheit, und doch wissen wir so verschwindend wenig voneinander. Wir sehen einander so selten. Wir sehen uns nicht in die Augen. Und wie ängstlich wir jedes Mal sind, wenn es geschieht. Mit den Jahren habe ich versucht, dies zu ändern, und versuche jetzt, so oft wie möglich in die Gesichter anderer Menschen zu schauen und ihrem Blick bewusst zu begegnen, um zu sehen, was geschieht, aber auch, weil ich die Wirklichkeit will, die Intensität, das Leben; vermutlich hängt es damit zusammen, dass ich älter werde, wie du weißt, bin ich im Herbst sechzig geworden, und ich möchte, dass alles real ist, greifbar. Ich möchte die Zeit, die mir noch bleibt, nicht damit vergeuden, sinnlose schlafwandlerische Gespräche zu führen oder somnambul durchs Leben zu gehen (apropos Augen: Lena Andersson hat vor einigen Jahren in einem Artikel in Dagens Nyheter einen interessanten Gedanken geäußert, nachdem sie Jan Myrdal in irgendeinem Zusammenhang getroffen hat, ich glaube, sie hat ihn interviewt. Ihre Schlussfolgerung war, dass Myrdal in all seiner totalitären Naivität gelandet ist, weil er nicht fähig ist, dem Blick eines anderen Menschen zu begegnen. Er konnte ihr nicht in die Augen sehen, als er sich mit ihr unterhielt. Das ist ein Emmanuel-Lévinas-Gedanke: Wenn man den Leuten niemals tief in die Augen blickt, droht die Welt zu einem großen Meccano-Bausatz zu werden, in der Menschen en masse einer Idee geopfert werden, zumal, wenn man nicht selbst diese Welt sehen will, diese Menschen, und den man bereit ist, für irgendeinen politischen Gedankengang zu opfern). Und daher provozieren mich auch Leute, die gähnen (ich habe tatsächlich vor vielen Jahren mal mit einer Frau Schluss gemacht, weil sie so oft gegähnt hat, ich empfand das als eine klare Ohrfeige, und lange danach – wir blieben gute Freunde – erklärte sie es nicht mit Müdigkeit oder Gleichgültigkeit, sondern als eine rein physische Mundbewegung, einen Reflex, der keinen tieferen Sinn hätte, hm …), die nichts von ihrem Leben wollen oder früh von Festen und Abendessen aufbrechen. Ich weiß, Karl Ove, dies muss dir wie eine Art Hysterie vorkommen, und vielleicht ist es tatsächlich ein Ausdruck von Verzweiflung; ich bin offen für diesen Gedanken und glaube, es liegt daran, dass ich vor acht Jahren meinen Prostatakrebs überlebt habe. Nach der Operation und als klar war, dass ich noch eine Erektion bekommen kann, habe ich mir geschworen, von nun an für alles zu kämpfen, was Sinn und Intensität hat, es sollte keinerlei Rückfälle in das schlafwandlerische Leben mehr geben.
Nun will ich nicht behaupten, dass dies immer gelungen ist, aber die Ambitionen sind da, und vielleicht legst du darauf den Finger, wenn du das Wort Hedonist verwendest. Ja, ich will, dass alles Geschmack hat. Und gestern passierte hier etwas, was damit zusammenhängt. Nachdem ich den Brief an dich geschrieben hatte, ging ich zur U-Bahnstation Botafogo und nahm die Bahn nach Cantagalo, eine Station in Copacabana. (Für die meisten Menschen ist Copacabana ein Synonym für den Strand, aber es ist weit mehr. Es ist ein Stadtteil mit über hundertfünfzigtausend Einwohnern, ein geschäftiger, brodelnder Stadtteil.) Die Station hat ihren Namen nach einem der Berge dort bekommen, und als ich auf der Rua Barata Ribeiro ans Licht trat, spürte ich ein Kribbeln in der Brust, ein wohliges Schaudern zu leben, ein Glücksgefühl. Du bist jetzt hier! Genau jetzt bist du hier, mitten in diesem Gewimmel, mitten in dieser Wirklichkeit, die Bars sind überfüllt, der Verkehr rauscht vorbei und dort, ganz am Ende der Straße, wie ein blauer Zipfel: der Atlantik.
In diesem Moment bin ich hier angekommen, aber es geht gar nicht um die Weltmeisterschaft (das muss vollkommen absurd in deinen Ohren klingen, aber ich weiß nicht mehr, wie interessiert ich überhaupt an diesem Schauspiel bin, ich spüre eine immer stärker werdende Aversion gegen diese große und zutiefst korrupte FIFA-Maschinerie), sondern um Rio und Brasilien, um die Freude darüber, in einer Welt zu sein, die ich immer häufiger nicht mehr verstehe. Jedes Mal, wenn ich mich zu »Brasilien« äußere, spüre ich, dass mir das, worüber ich rede, aus den Händen gleitet, wie Seife oder ein Aal, wie etwas, das sich nicht wirklich greifen lässt. Während eines Gesprächs, das ich im Frühjahr des vergangenen Jahres mit einem Freund hier führte, mit Lennart Palméus, einem ehemaligen Seemann, der nach seiner Zeit auf See über zwanzig Jahre Korrespondent für Dagens Industri war und jetzt Inhaber eines Strandhotels ist – wir gingen durch Lapa, das Boheme-Viertel im Zentrum der Stadt –, erzählte ich ihm, dass ich verdammt noch mal das Gefühl hätte, dieses Land nie ganz zu verstehen, egal wie viel ich über Brasilien lese oder wie oft ich auch hier bin. Und er, der seit dreißig Jahren hier lebt und vier Kinder mit einer brasilianischen Frau aus Espirito Santo hat, lachte über sein ganzes wettergegerbtes Seemannsgesicht und sagte: Genau so, Fredrik, geht’s mir auch! Was hat es damit auf sich? Gib mir Frankreich, Italien, Deutschland, Argentinien und eine Unzahl anderer Länder, und ich habe das Gefühl, dass ich sie analysieren und mit einer bestimmten Form von Rationalität erklären kann, aber das funktioniert nicht mit Brasilien, und das liegt an Afrika, glaube ich. Ich weiß zu wenig über Afrika und die afrikanische Religion und Kultur, denn Brasilien ist Afrika plus Portugal, Frankreich, Niederlande und verschiedene Indianerkulturen in einer verwegenen Mischung, dem sogenannten Synkretismus. In unserer europäischen Welt sind wir fast immer entweder-oder, hier ist man häufig sowohl-als auch (zum Beispiel katholisch und Anhänger des Macumba).
Ich ging über die Avenida Atlântica hinunter zum Strand, vorbei an Bars mit Fans aus der ganzen Welt. Dann warf ich mich in die Wellen, aber ich wage mich nie sonderlich weit hinaus, denn es gibt gefährliche Strömungen, und schon so mancher Gringo hat seine Rio-Träume auf dem Grund beendet, in den Armen der Meeresgöttin Yemanja. Der Anblick der Containerschiffe am Horizont, der Zuckerhut, die Hochhäuser entlang des Strands (Copacabana ist eigentlich ein ziemlich hässlicher Stadtteil, geopfert auf dem Altar der Bauspekulation, er besteht nahezu ausschließlich aus unpersönlichen Hochhäusern, trotzdem gibt es hier so ein ganz bestimmtes Flair, und das liegt am Strand, am Leben an diesem sechs Kilometer langen Strand, der die Basis liefert für dieses Rio-Gefühl, diese höchst konkrete Variante von Hedonismus, wenn du so willst. Der Strand symbolisiert das entspannte Leben der Cariocans, der Einwohner von Rio. Danach ein bisschen joggen am Meer, gefolgt von ein paar Dehnübungen, um dann mit nervösen Schritten zum Sportplatz bei Posto 4 zu gehen, wo ein Fußballspiel in vollem Gang ist.
Ich sehe von der Seitenlinie aus interessiert zu, und plötzlich kommen die Fragen. You want to play? Und wenn ich antworte: Sim, quero jogar (ja, ich will spielen) werde ich mit einem breiten Lächeln von O Ladrão