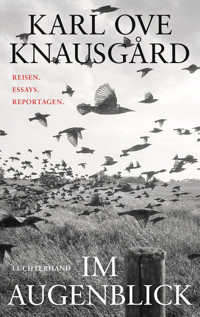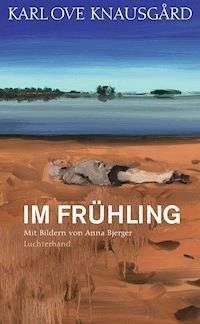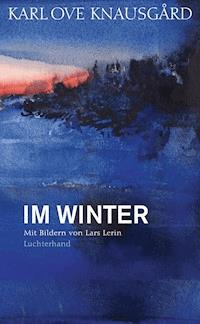7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Jahreszeiten-Bände von Karl Ove Knausgård: "Im Herbst" ist der erste Teil einer aus vier Bänden bestehenden grandiosen Liebeserklärung an das Leben und die sinnlich erfahrbare Welt. Enthalten: Briefe an eine ungeborene Tochter, Reflektionen über alltägliche Phänomene.
Ein Kind wird zur Welt kommen. Und ein Vater setzt sich hin, um ihm zu schreiben. Er will dem Kind zeigen, was es erwartet, die Myriade von Phänomenen und Materie, Tieren und Menschen, die wir die Welt nennen. Er schreibt über die Sonne und den Dachs, über die Thermoskanne und Urin, über das Bett und die Einsamkeit, während das Kind im Dunkeln wächst.
„All das Fantastische, dem du bald begegnen wirst, das du bald sehen darfst, verliert man so leicht aus den Augen, und es gibt fast so viele Arten, dies zu tun, wie es Menschen gibt. Deshalb schreibe dieses Buch für dich. Ich will dir die Welt zeigen, wie sie ist und wie sie uns umgibt, die ganze Zeit. Nur indem ich das tue, kann ich selbst sie sehen. Was macht das Leben lebenswert?“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
KARL OVE KNAUSGÅRD
IM HERBST
Mit Bildern von Vanessa Baird
Aus dem Norwegischen von Paul Berf
LUCHTERHAND
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die norwegische Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »OM HØSTEN« im Verlag Oktober, Oslo.
Copyright © der Originalausgabe 2015 by Forlaget Oktober as, Oslo
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 by Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Lektorat: Regina Kammerer
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Schutzumschlaggestaltung: buxdesign, München
Schutzumschlagillustrationen: Vanessa Baird
ISBN 978-3-641-18746-0V002
www.luchterhand-literaturverlag.de
Brief an eine ungeborene Tochter | 28. AUGUST
SEPTEMBER
Äpfel
Wespen
Plastiktüten
Die Sonne
Zähne
Schweinswale
Benzin
Frösche
Kirchen
Pisse
Rahmen
Dämmerung
Bienenzucht
Blut
Blitze
Kaugummis
Tünche
Kreuzottern
Mund
Daguerreotypie
Brief an eine ungeborene Tochter | 29. SEPTEMBER
OKTOBER
Fieber
Gummistiefel
Quallen
Krieg
Schamlippen
Betten
Finger
Laub
Flaschen
Stoppelfelder
Dachse
Säuglinge
Autos
Einsamkeit
Erfahrung
Läuse
Van Gogh
Vogelzug
Tanker
Erde
Brief an eine ungeborene Tochter | 22. OKTOBER
NOVEMBER
Konservendosen
Gesichter
Schmerz
Morgengrauen
Telefone
Flaubert
Erbrochenes
Fliegen
Vergebung
Knöpfe
Thermosflaschen
Die Weide
Toilettenschüsseln
Krankenwagen
August Sander
Schornsteine
Der Raubvogel
Stille
Trommeln
Augen
Brief an eine ungeborene Tochter
28. AUGUST. Jetzt, da ich dies schreibe, weißt du nichts von dem, was dich erwartet, in welcher Welt du entstehst. Und ich weiß nichts von dir. Ich habe eine Ultraschallaufnahme gesehen und meine Hand auf den Bauch gelegt, in dem du liegst, das ist alles. Sechs Monate sind es noch bis zu deiner Geburt, und in dieser Zeit kann alles Mögliche passieren, aber ich glaube, das Leben ist stark und unbändig, ich glaube, dass alles gut gehen wird und du gesund und munter und kräftig zur Welt kommen wirst. Das Licht der Welt erblicken wirst, wie man so sagt. Als Vanja, deine älteste Schwester, geboren wurde, war es Nacht und die Dunkelheit voll von wirbelndem Schnee. Unmittelbar bevor sie herauskam, zog eine der Hebammen an mir, du nimmst sie in Empfang, sagte sie, und das tat ich, ein kleines Baby glitt in meine Hände, glatt wie eine Robbe. Ich freute mich so, dass ich weinte. Als eineinhalb Jahre später Heidi geboren wurde, war es Herbst und der Himmel bedeckt, es war kalt und feucht, wie so oft im Oktober, sie kam am Vormittag, es war eine schnelle Geburt, und als der Kopf schon draußen war, der Rest des Körpers jedoch noch nicht, drang ein leiser Ton über ihre Lippen, es war ein so beglückender Moment. John, so heißt dein großer Bruder, kam in einer Kaskade aus Wasser und Blut, das Zimmer hatte keine Fenster, man fühlte sich wie in einem Bunker, und als ich hinterher hinausging, um eure beiden Großmütter anzurufen, überraschte mich das Licht draußen und dass das Leben weiterging, als wäre nichts Besonderes passiert. Es war der fünfzehnte August 2007, ungefähr fünf oder sechs Uhr, in Malmö, wohin wir im Sommer des Vorjahres gezogen waren. An jenem Abend fuhren wir später zu einem Patientenhotel, und am Tag darauf holte ich deine Schwestern, denen es großen Spaß machte, eine grüne Gummieidechse auf seinen Kopf zu setzen. Dreieinhalb und knapp zwei Jahre waren sie damals alt. Ich machte Fotos, eines Tages werde ich sie dir zeigen.
So erblickten sie das Licht der Welt. Nun sind sie groß, nun haben sie sich an die Welt gewöhnt, und es ist eigenartig, dass sie so verschieden, so ganz und gar sie selbst sind, es immer schon waren, vom ersten Augenblick an. Ich nehme an, dass es bei dir genauso sein wird und du schon die bist, die du sein wirst.
Drei Geschwister, eine Mutter und ein Vater, das sind wir. Das ist deine Familie. Ich erwähne das als Erstes, weil es das Wichtigste ist. Gut oder schlecht, warm oder kalt, streng oder lieb, das spielt keine Rolle, dies ist das Wichtigste, dies sind die Beziehungen, durch die du die Welt sehen wirst und die, direkt oder indirekt, in Gestalt von Widerstand und Unterstützung deine Wahrnehmung von fast allem formen werden.
Im Moment, in diesen Tagen, geht es uns gut. Als die Kinder heute in der Schule waren, fuhren deine Mutter und ich nach Limhamn, zu einem Café dort, und in der Spätsommerwärme – es war ein ganz fantastischer Tag, Sonne, blauer Himmel, ein Hauch von Herbst in der Luft und alle Farben irgendwie tief, aber auch klar – sprachen wir darüber, wie du heißen sollst. Ich hatte Anne vorgeschlagen, falls du ein Mädchen bist, und Linda meinte daraufhin, der Name gefalle ihr sehr, er habe etwas Leichtes und Helles, und wir möchten, dass man dies mit dir verbindet. Falls du ein Junge bist, sollst du, schlugen wir vor, Eirik heißen. Dann hast du den gleichen Laut im Namen wie deine drei Geschwister – ein j –, denn wenn du die Namen laut aussprichst, haben sie ihn alle – Vanja, Heidi, John.
Nun schlafen sie, alle vier. Ich sitze in meinem Arbeitszimmer, das eigentlich ein kleines Haus mit zwei Zimmern und einer Mansarde ist, und schaue über den Hof zu dem Haus hinüber, in dem sie liegen, zu den dunklen Fenstern, die unsichtbar wären, wenn es dahinter nicht die Straßenlaternen gäbe, deren Licht die Küche mit einem schwachen, gespenstischen Schein erfüllt. Dieses Haus sind eigentlich drei nebeneinanderliegende Häuser, die zu einem verbunden wurden. Zwei davon sind aus rot lackiertem Holz, eines ist aus weißgetünchtem Stein. Einst wohnten Familien darin, die auf einem der großen Bauernhöfe hier arbeiteten. Zwischen diesen beiden Häusern liegt ein Gästehaus, das wir das Sommerhaus nennen. Innerhalb des Hufeisens, das sie gemeinsam bilden, liegt der Garten, der sich etwa dreißig Meter bis zu einer weißen Mauer erstreckt. Dort stehen zwei Pflaumenbäume, ein alter, an dem ein Ast so breit gewachsen und gleichzeitig so schwer geworden ist, dass er von zwei Krücken gestützt werden muss, und ein junger, den ich letztes Jahr im Sommer gepflanzt habe, jetzt trägt er zum ersten Mal Früchte, außerdem ein Birnbaum, auch er alt und viel höher als das Haus, sowie drei Apfelbäume. Einer der Apfelbäume war in einer ziemlich schlechten Verfassung, viele der Äste waren abgestorben, er wirkte leblos und starr, aber dann beschnitt ich ihn Anfang des Sommers, was ich noch nie getan hatte, und ich steigerte mich hinein, schnitt immer mehr ab, ohne darauf zu achten, was dabei herauskam, bis ich endlich, spätabends, herunterstieg und ein paar Schritte zurücktrat, um den Baum in Augenschein zu nehmen. Entstellt war das Wort, das mir zu ihm einfiel. Mittlerweile sind die Zweige nachgewachsen, das Laub ist üppig, und er hängt voller Äpfel. Diese Erfahrung habe ich bei der Gartenarbeit gemacht – es gibt keinen Grund, vorsichtig zu sein oder sich vor etwas zu fürchten, das Leben ist so robust, es kommt gewissermaßen in Kaskaden, blind und grün, und das ist zuweilen beängstigend, weil auch wir leben, aber sozusagen unter kontrollierten Bedingungen, die uns veranlassen, das Blinde, das Wilde, das Chaotische, sich zur Sonne Streckende zu fürchten, das aber meist schön ist, in einer tieferen Weise als das Visuelle, denn die Erde riecht nach Fäulnis und Dunkelheit, wimmelt von flitzenden Käfern, sich windenden Würmern, die Blumenstiele sind saftig, die Blüten randvoll mit Düften, und die Luft, kalt und schneidend, warm und feucht, erfüllt von Sonnenstrahlen oder Regen, legt sich um die nach innen gewandte Haut wie Umschläge aus Gegenwärtigkeit. Hinter dem Haupthaus liegt die Straße, die hundert Meter weiter in einer Art stillgelegtem, halbindustriellem Gelände endet, die Gebäude haben Wellblechdächer und die Fenster sind zersprungen, Motoren und Radachsen liegen davor und verrosten halb im Gras verschwunden. Auf der anderen Seite, hinter dem Haus, in dem ich sitze, liegt ein großes Hofgebäude aus rotem Backstein, es ist schön, wie es dort zwischen all dem grünen Laub steht.
Rot und grün.
Dir sagt das nichts, aber für mich liegt so viel in diesen beiden Farben, etwas an ihnen zieht mich magisch an, und ich glaube, das ist einer der Gründe dafür, warum ich Schriftsteller geworden bin, denn ich spüre diese Anziehungskraft so stark und begreife, dass sie wichtig ist, aber mir fehlen die Worte, um es auszudrücken, und deshalb weiß ich nicht, was es ist. Ich habe es versucht, und ich habe kapituliert. Die Kapitulation sind die Bücher, die ich veröffentlicht habe. Eines Tages kannst du sie lesen, und vielleicht wirst du dann verstehen, was ich meine.
Das Blut, das in den Adern fließt, das Gras, das auf der Erde wächst, die Bäume, oh, die Bäume, die sich im Wind wiegen.
All das Fantastische, dem du bald begegnen, das du bald sehen darfst, verliert man so leicht aus den Augen, und es gibt fast so viele Arten, dies zu tun, wie es Menschen gibt. Deshalb schreibe ich dieses Buch für dich. Ich will dir die Welt zeigen, wie sie ist und wie sie uns umgibt, die ganze Zeit. Nur indem ich das tue, kann ich selbst sie sehen.
Was macht das Leben lebenswert?
Kein Kind stellt diese Frage. Für Kinder ist das Leben selbstverständlich. Das Leben versteht sich von selbst: Ob es gut oder schlecht ist, spielt keine Rolle. So ist es, weil sie nicht die Welt sehen, nicht die Welt studieren, nicht die Welt überdenken, sondern so tief in der Welt sind, dass sie zwischen ihr und sich selbst nicht unterscheiden. Erst wenn das geschieht, wenn ein Abstand zwischen dem entsteht, was sie sind, und dem, was die Welt ist, meldet sich die Frage: Was macht das Leben lebenswert?
Ist es das Gefühl, die Klinke herabzudrücken und die Tür aufzuschieben und zu spüren, wie sie auf ihren Scharnieren nach innen oder außen schwingt, immer leicht und willig, und daraufhin in einen neuen Raum zu gelangen?
Ja, die Tür schlägt auf wie ein Flügel, und das allein macht das Leben schon lebenswert.
Hat man viele Jahre gelebt, ist diese Tür selbstverständlich. Das Haus ist selbstverständlich, der Garten ist selbstverständlich, der Himmel und das Meer sind selbstverständlich, selbst der Mond, der nachts über den Häuserdächern hängt und scheint, ist selbstverständlich. Die Welt spricht für sich selbst, aber wir hören nicht zu, und da wir uns nicht mehr in ihrer Tiefe aufhalten und sie als einen Teil unserer selbst erleben, ist es, als würde sie für uns verschwinden. Wir öffnen die Tür, aber es hat keine Bedeutung, es ist nichts, nur etwas, was wir tun, um von einem Zimmer in ein anderes zu gelangen.
Ich möchte dir unsere Welt zeigen, wie sie jetzt ist: die Tür, den Fußboden, den Wasserhahn und die Spüle, den Gartenstuhl an der Mauer unter dem Küchenfenster, die Sonne, das Wasser, die Bäume. Du wirst sie auf deine eigene Weise sehen, du wirst deine eigenen Erfahrungen machen und dein eigenes Leben führen, so dass ich dies natürlich vor allem mir selbst zuliebe tue: dir die Welt zu zeigen, meine Kleine, macht mein Leben lebenswert.
Äpfel
Aus irgendeinem Grund sind die Früchte im Norden mühelos zugänglich, sie haben nur eine dünne, leicht durchbeißbare Schale über dem Fruchtfleisch, was für Birnen und Äpfel genauso gilt wie für Pflaumen, man kann sie einfach so verspeisen, während Früchte, die weiter südlich wachsen, häufig von einer dicken, ungenießbaren Schale umgeben sind, wie zum Beispiel Orangen, Mandarinen, Bananen, Granatäpfel, Mangos und Passionsfrüchte. Normalerweise bevorzuge ich, ausgehend von meinen sonstigen Vorlieben im Leben, Letzteres, zum einen, weil der Gedanke, dass man sich Genuss durch eine vorausgehende Arbeit verdienen muss, bei mir sehr ausgeprägt ist, zum anderen, weil ich mich seit jeher zum Verborgenen und Geheimen hingezogen gefühlt habe. An der Oberseite der Apfelsine ein Stück Schale herauszubeißen und für eine kurze Sekunde den bitteren Geschmack wahrzunehmen, der in die Mundhöhle schießt, um zwischen Schale und Fruchtfleisch Platz für den Daumen zu schaffen, und die Frucht anschließend Stück für Stück zu schälen, entweder, wenn die Schale dünn ist, in kleinen Fetzen, oder, wenn die Schale dick und die Verbindung zum Fruchtfleisch lose ist, in einem einzigen langen Streifen, hat zudem etwas von einem Ritual, fast so, als befände man sich zunächst im Säulenhof des Tempels und bewegte sich dann langsam auf den innersten Raum zu, wenn die Zähne in die dünne, blanke Haut beißen und der Fruchtsaft in den Mund rinnt und ihn mit seiner Süße füllt. Sowohl die Arbeit als auch das Geheime, die Unzugänglichkeit, steigern den Wert des Genusses. Äpfel sind da anders. Man braucht bloß die Hand auszustrecken, nach dem Apfel zu greifen und hineinzubeißen. Keine Arbeit, kein Geheimnis, einfach direkter Genuss, das fast explosive Freisetzen des scharfen, frischen und säuerlichen, aber trotzdem immer auch süßen Apfelgeschmacks im Mund, der zuweilen die Nerven zucken lässt und nicht selten auch die Gesichtsmuskeln dazu bewegt, sich zu verziehen, als wäre der Abstand zwischen Mensch und Apfel exakt so groß, dass dieser Schock in Miniaturform nie völlig verschwindet, ganz gleich, wie viele Äpfel man in seinem Leben gegessen hat.
Als ich noch recht klein war, begann ich, den ganzen Apfel zu essen, nicht nur das Fruchtfleisch, sondern auch das gesamte Kerngehäuse mit allen Kernen und sogar den Stiel. Nicht, weil es mir schmeckte, glaube ich, auch nicht, weil mich der Gedanke antrieb, ich dürfe nichts verschwenden, sondern weil das Verspeisen des Griebs und Stiels sich dem Genuss widersetzte. Es war eine Art Arbeit, wenngleich in umgekehrter Reihenfolge: erst die Belohnung, dann der Job. Für mich ist es bis heute undenkbar, einen Apfelbutzen fortzuwerfen, und wenn ich sehe, dass meine Kinder es tun – manchmal schmeißen sie halb gegessene Äpfel weg –, bin ich entrüstet, sage aber nichts, denn ich möchte, dass sie das Leben bejahen und eine Beziehung des Überflusses zu ihm haben. Ich möchte, dass sie fühlen, das Leben zu führen ist leicht. Deshalb habe ich auch meine Einstellung zu Äpfeln geändert, nicht willentlich, sondern weil ich mehr gesehen und mehr verstanden zu haben glaube und deshalb heute weiß, dass es nie um die Welt an sich geht, sondern immer darum, wie wir zu ihr in Beziehung treten. Dem Geheimen steht das Offene gegenüber, der Arbeit die Freiheit. Letzten Sonntag fuhren wir zum Strand, zehn Kilometer von hier, es war einer dieser ersten Herbsttage, in die sich der Sommer hineinstreckt, um sie fast völlig mit seiner Wärme und Ruhe auszufüllen, und gleichzeitig waren alle Touristen seit Langem nach Hause zurückgekehrt, und der Strand lag menschenleer. Ich machte mit den Kindern einen Spaziergang in den Wald, der bis zum Ufer hinunter wächst und größtenteils aus Laubbäumen besteht, zwischen die sich die eine oder andere rotstämmige Kiefer mischt. Die Luft war warm und stand, die Sonne hing schwer von Licht am leicht dunkelblauen Himmel. Wir folgten einem Weg tiefer hinein, und dort, mitten im Wald, stand ein Apfelbaum und hing voller Früchte. Die Kinder waren genauso erstaunt wie ich, Apfelbäume wachsen in Gärten, nicht wild im Wald. Können wir die essen, fragten sie. Ich sagte Ja, bedient euch. In einem plötzlichen Aufblitzen, ebenso erfüllt von Glück wie von Trauer, begriff ich, was Freiheit war.
Wespen
Wespen haben einen zweigeteilten Körper, dessen hinterer Teil geformt ist wie eine Art leicht gerundeter Kegel mit einer glatten und glänzenden Oberfläche, wohingegen der vordere runder und nur ein Drittel so groß ist, dafür gehen von diesem jedoch die Beine, Flügel und Fühler ab. Das gelbschwarze Muster, die glänzende Oberfläche und die abgerundete Kegelform lassen den hinteren Teil aussehen wie ein kleines Osterei oder vielleicht auch wie ein winziges Fabergé-Ei, studiert man ihn nämlich genauer, fällt einem ins Auge, wie regelmäßig und schön das Muster ist; wie dünne Bänder teilen die schwarzen Streifen das Gelb, und wo die schwarzen Punkte neben den Streifen liegen, gleicht dies sorgsam lackierten Brettern. Die Härte, die uns nicht groß erscheint, es ist kaum mehr als ein leichter Druck mit den Fingern erforderlich, um die Schale aufplatzen und das weiche Innere herausquellen zu lassen, die aber in der Welt der Wespe panzerartig sein muss, lässt einen an eine Rüstung denken, und wenn die Wespe mit ihren sechs Beinen, zwei Flügelpaaren und zwei Fühlern heranfliegt, erscheint sie einem beinahe wie ein Ritter in voller Montur. Dieser Gedanke kam mir vorige Woche, als das Wetter sommerlich schön war und ich beschloss, die Gelegenheit zu nutzen, um die Westwand des Hauses zu streichen. Ich wusste, dass in der Belüftungsöffnung ein Wespennest war, denn wenn wir abends ins Bett gingen, hörten wir häufig ihr Summen hinter der Wand, und es hörte genau dort auf, wo die Wespen hineinkrochen, und gelegentlich hatte es eine von ihnen auch in unser Zimmer geschafft, obwohl Fenster und Tür geschlossen waren. Als ich die Leiter anlehnte und mit Farbeimer und Pinsel in der Hand hoch genug gestiegen war, um die Bretter unter dem Dachfirst zu erreichen, dachte ich nicht an sie, denn obwohl sie nur einen Meter von unserem Bett entfernt lebten, hatten sie sich nie gegen uns gewandt, und es schien uns, als existierten wir für sie überhaupt nicht oder als wären wir nur ein Teil des Hintergrunds, vor dem sie ihr Leben führten. An diesem Nachmittag änderte sich das allerdings. Kaum hatte ich begonnen zu streichen, als auch schon ein schwaches Scharren aus der Belüftungsöffnung an mein Ohr drang; eine Wespe krabbelte heraus, hob summend vom Rand ab, flog etwa zwanzig Meter hoch, wo sie nur ein winziger Punkt vor dem gewaltigen Blau des Himmels war, ehe sie direkt auf mich zusteuerte, während zur selben Zeit eine weitere Wespe aus der Belüftung krabbelte und dann noch eine und noch eine. Insgesamt fünf Wespen flogen um mich herum. Ich versuchte, sie mit der linken Hand fort zu wedeln, vorsichtig, um nicht von der Leiter zu fallen, was aber natürlich aussichtslos war. Sie stachen mich nicht, aber die aufdringlichen Bewegungen und das hitzige Summen reichten völlig, ich stieg die Leiter hinab, rauchte eine Zigarette und überlegte, was zu tun war. Die Situation hatte etwas Demütigendes, im Vergleich zu mir waren sie schließlich so winzig, nicht länger als das äußerste Glied meiner Finger, und wesentlich dünner. Ich holte die Fliegenklatsche aus der Küche und stieg wieder hinauf. Kaum hatte ich den Pinsel in die rote, zähflüssige Farbe getunkt und die erste Farbe verstrichen, ertönte erneut das Scharren. Kurz darauf saß die erste Wespe draußen auf der Schwelle, ließ sich in die Luft fallen und begann, mich zu umkreisen; wenig später war ich erneut umzingelt. Ich schlug nach ihnen und traf zwei, allerdings nur in der Luft, was lediglich zur Folge hatte, dass sie heftig aus ihrer Flugbahn geschleudert wurden. Ich kam kaum zum Streichen, gab auf, schüttete die Farbe in den größeren Eimer zurück und wusch den Pinsel aus. Ein paar Stunden später stieg ich so vorsichtig, wie ich nur konnte, die Leiter hinauf, verschloss die Belüftungsöffnung mit Klebeband, schlich mich wieder hinunter, eilte ins Haus und ins Schlafzimmer hinauf, wo ich auch die Innenseite zuklebte. Als wir am Abend ins Bett gingen, nahm das Summen draußen kein Ende. Das tat es auch am nächsten Abend nicht. Aber dann wurde es still.
Plastiktüten
Da Plastik eine so extrem lange Zerfallszeit hat, da die Zahl der Plastiktüten auf der Welt so groß ist und immer größer wird, Tag für Tag, und da sie so leicht sind und den Wind auffangen können wie ein Segel und ein Ballon, stößt man an den überraschendsten Orten auf Plastiktüten. Als ich gestern das Auto parkte, nachdem ich zum Einkaufen im Geschäft gewesen war, hing auf dem Dach des Hauses flatternd eine Plastiktüte, ihre Träger hatten sich in der Kletterpflanze verfangen, die dort wächst. Und ein paar Tage zuvor, als ich vier Johannisbeersträucher pflanzen wollte, die ich gekauft hatte, und etwa einen Meter von dem Zaun am Ende des Grundstücks entfernt Löcher für sie aushob, stieß ich auf eine Schicht aus zerbrochenen Dachziegeln und Plastikstreifen, die ich anhand des aufgedruckten Logos als Einkaufstüten identifizierte. Wie sie dorthin gelangt sind, weiß ich nicht, aber ihr Anblick hatte etwas Beunruhigendes, denn das dünne Plastik, so weiß und glatt im Kontrast zur schwarzen und körnigen Muttererde, war so offensichtlich ein Fremdkörper. Die Eigenschaft der Erde, sich alles, was in ihr landet, anzuverwandeln, gilt nicht für Plastik, das so hergestellt ist, dass es alles abstößt: Die Erde gleitet über die Oberfläche des Plastiks, findet nirgendwo Halt, findet keine Stelle, an der sie eindringen könnte, und für Wasser gilt das Gleiche. Die Plastiktüte hat etwas Unantastbares, sie befindet sich sozusagen außerhalb von allem, auch von der Zeit und ihrer unbarmherzigen Modalität. Es versetzte mir einen kleinen Stich der Trauer, als ich sie sah, ohne dass ich wirklich begriff, warum es so war. Vielleicht war es der Gedanke an die Verunreinigung, vielleicht der Gedanke an den Tod, es mag aber auch der Gedanke gewesen sein, dass ich die Johannisbeersträucher nun doch nicht an dieser Stelle würde pflanzen können. Wahrscheinlich war es alles zusammen. Als ich den Spaten einige Meter weiter in die Erde stach und dort ein Loch aushob, überlegte ich, warum fast alle meine Gedanken und Assoziationen in diesen Bahnen verliefen, in Problemen und Sorgen und Finsternis endeten statt in Freude, Leichtigkeit und Licht. Zum Schönsten, was ich je gesehen hatte, gehörte eine Plastiktüte, die auf einer Insel weit draußen im Meer vor einem Bootssteg im Wasser trieb, warum war sie mir nicht in den Sinn gekommen? Das Wasser war ganz klar gewesen, wie es nur ist, wenn es kalt und still ist, mit einem leicht kühlen, grünen Ton darin, und die Plastiktüte hatte, aufgespannt und reglos, in etwa drei Metern Tiefe gestanden. Sie glich nichts anderem als sich selbst, keinem Lebewesen, keiner Qualle, auch keinem Luftballon, es war bloß eine Plastiktüte. Dennoch blieb ich stehen und betrachtete sie. Das war auf Sandøya, dem äußersten Eiland der Inselgruppe, die den Namen Bulandet trägt und vor der westnorwegischen Küste im Meer liegt. Außer mir wohnten dort nur drei Menschen. Die Luft war eiskalt, der Himmel blau, der Steg, auf dem ich stand, halb von Schnee bedeckt. Tag für Tag ging ich dorthin, angezogen von der Unterwasserwelt, in der Ketten und Taue verschwanden, von ihrer Klarheit und Unzugänglichkeit. Die Seesterne, die Muscheltrauben, der Tang, aber in erster Linie der Raum, in dem sie auftauchten, das Meer, das auf der anderen Seite der Insel in langgestreckten und schweren Wellen gegen das Ufer schlug, hier jedoch zwischen den Wänden aus Fels und Betonkai stillstand, über dem Grund aus Sand, also im Hafenbecken, das es mit seiner Durchsichtigkeit füllte. Oder vielmehr, ganz durchsichtig war das Wasser natürlich nicht, da es das Licht ein wenig verzerrte, ähnlich wie dickes Glas, so dass die weiße Plastiktüte, die in der ganzen Zeit, die ich dort stand, absolut regungslos mitten zwischen Oberfläche und Grund hing, leicht grünlich schimmerte und nicht im Besitz jener Schärfe war, die weißes Plastik an Land bekommt, im Tageslicht, wenn zwischen ihm und dem Licht nur Luft ist, sondern leicht verschleiert und gewissermaßen gedämpft wirkte.
Warum war es so schwer, die Augen von dieser versunkenen Plastiktüte abzuwenden?
Ihr Anblick erfüllte mich nicht mit Freude, ich verließ den Ort nicht frohen Mutes. Ebenso wenig erfüllte es mich mit Befriedigung, sie zu sehen, es war nicht so, dass in meinem Inneren etwas zur Ruhe kam, wie Hunger und Durst, wenn sie gestillt werden. Aber es tat gut, sie zu sehen, wie es guttut, ein Gedicht zu lesen, das in einem Bild von etwas Konkretem endet und darin gleichsam Halt findet, so dass sich das Unerschöpfliche in ihm in Ruhe entfalten kann. Gebauscht von Wasser, die Griffe oben, stand die Plastiktüte an jenem Tag im Februar 2002 in ein paar Metern Tiefe. Dieser Augenblick war nicht der Anfang von etwas, nicht einmal von einer Einsicht, er war auch nicht das Ende von etwas, und vielleicht war es ja das, woran ich dachte, als ich vor ein paar Tagen in die Erde spähte, dass ich immer noch mitten in etwas war und es immer sein würde.
Die Sonne
An jedem einzelnen Tag seit meiner Geburt ist die Sonne da gewesen, trotzdem habe ich mich nie wirklich an sie gewöhnt, vielleicht, weil sie sich so von allem anderen unterscheidet, was wir kennen. Sie ist eines der wenigen Phänomene in unserer Lebenswelt, dem wir uns nicht nähern können, denn dann würden wir vernichtet, auch können wir weder Sonden, Satelliten noch Raumschiffe zu ihr schicken; auch sie würden vernichtet werden. Dass wir ebenso wenig mit bloßem Auge in die Sonne blicken können, ohne zu erblinden oder unser Sehvermögen zu schädigen, empfinde ich zuweilen als eine absurde Bedingung, ja, fast als eine Demütigung: Gleich da oben, sichtbar für alle Menschen und Tiere auf der ganzen Welt, hängt ein riesiger, brennender Himmelskörper, und wir können ihn nicht einmal ansehen! Aber so ist es. Wenn wir nur wenige Sekunden direkt in die Sonne schauen, füllt sich unsere Netzhaut mit kleinen, wabernden, schwarzen Flecken, und halten wir den Blick auf sie gerichtet, breitet sich die Schwärze auf der Innenseite der Augen aus wie Tinte auf Löschpapier. Über uns hängt also eine lodernde Kugel, die uns nicht nur all unser Licht und all unsere Wärme spendet, sondern auch der Ursprung und Grund allen Lebens ist, gleichzeitig ist sie absolut unnahbar und steht dem, was sie erschaffen hat, völlig indifferent gegenüber. Es fällt einem schwer, im Alten Testament von dem monotheistischen Gott zu lesen, ohne an diese Eigenart zu denken. Ein charakteristischer Zug in der Beziehung zwischen Mensch und Gott besteht nämlich darin, dass der Mensch Gott nicht ansehen kann, sondern den Kopf senken muss. Und das markanteste Bild für die Gegenwart Gottes in der Bibel ist das Feuer, es verkörpert das Göttliche, aber auch immer die Sonne, da alles Feuer und alle Brände hier Ableger von ihr sind. Gott ist der unbewegte Beweger, schrieb Thomas von Aquin, und sein Zeitgenosse Dante schilderte das Göttliche als einen Fluss aus Licht und beendete La Divina Commedia