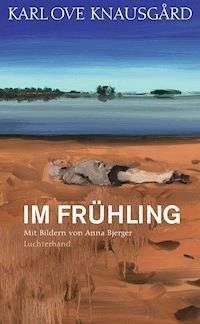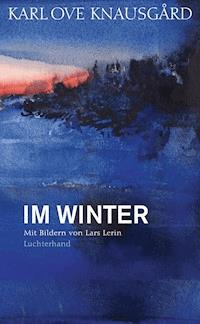15,99 €
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ist das menschliche Leben wirklich das Zentrum der Welt?
»Ich liebe dieses Buch. Es liegt eine solche Zärtlichkeit in dieser Geschichte.« Dagens Nyheter
»Literarische Magie!« Aftonbladet
Woher kommt es, das Leben, und was bedeutet es eigentlich? Um diese beiden Fragen kreist der neue Roman von Karl Ove Knausgård – der in einem inneren Zusammenhang zu seinem letzten Buch „Der Morgenstern“ steht. Was ist geschehen, bevor dieser unerklärliche, weithin sichtbare Stern am Himmel auftauchte und anscheinend sämtliche physikalische Regeln außer Kraft setzte?
Alles beginnt 1986 im Süden Norwegens. Der junge Syvert Løyning kehrt vom Militärdienst zu seiner Mutter und seinem Bruder ins Haus der Familie zurück. Im fernen Tschernobyl ist gerade ein Atomreaktor explodiert, Norwegen selbst wird von einer Regierungskrise erschüttert. Syvert weiß nicht wirklich, wohin mit sich. Was hält die Zukunft für ihn bereit? Eines Nachts träumt er von seinem toten Vater, und ein unheimliches Gefühl beginnt sich in ihm festzusetzen: sein Vater will ihm eine Botschaft übermitteln. Aber welche könnte das sein? Ratlos beginnt er sich die nachgelassenen Sachen von ihm genauer anzuschauen. Und muss schließlich feststellen, dass es ein anderes Leben gab, das sein Vater führte. Eines, das bis in die Sowjetunion führt.
Ein Leben, das mit der russischen Wissenschaftlerin Alevtina zu tun hat, die viele Jahre später an einem Wochenende mit ihrem Sohn nach Samara reist, um den achtzigsten Geburtstag ihres Vaters zu feiern, und da noch nicht weiß, dass sie bald Besuch aus Norwegen bekommen wird. Und mit ihrer alten Freundin Vasilisa, einer Lyrikerin, die ein Buch über einen eigenwilligen und alten Zug der russischen Kultur schreibt: den Glauben an ein ewiges Leben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1285
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Contents
HELGE
SYVERT
JEWGENIJ
VASILISA
ALEVTINA
Die Ewigkeitswölfe
SYVERT
JEWGENIJ
VASILISA
ALEVTINA
SYVERT
Literaturhinweise
Dank
Quellen
Lesen Sie mehr von Karl Ove Knausgård:
Newsletter-Anmeldung
KARL OVE KNAUSGÅRD
DiE Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit
Roman
Aus dem Norwegischen von Paul Berf
Luchterhand
Buch
Ist das menschliche Leben wirklich das Zentrum der Welt?
Woher kommt es, das Leben, und was bedeutet es eigentlich? Um diese beiden Fragen kreist der neue Roman von Karl Ove Knausgård – der in einem inneren Zusammenhang zu seinem letzten Buch »Der Morgenstern« steht. Was ist geschehen, bevor dieser unerklärliche, weithin sichtbare Stern am Himmel auftauchte und anscheinend sämtliche physikalische Regeln außer Kraft setzte?
Alles beginnt 1986 im Süden Norwegens. Der junge Syvert Løyning kehrt vom Militärdienst zu seiner Mutter und seinem Bruder ins Haus der Familie zurück. Im fernen Tschernobyl ist gerade ein Atomreaktor explodiert, Norwegen selbst wird von einer Regierungskrise erschüttert. Syvert weiß nicht wirklich, wohin mit sich. Was hält die Zukunft für ihn bereit? Eines Nachts träumt er von seinem toten Vater, und ein unheimliches Gefühl beginnt sich in ihm festzusetzen: sein Vater will ihm eine Botschaft übermitteln. Aber welche könnte das sein? Ratlos beginnt er sich die nachgelassenen Sachen von ihm genauer anzuschauen. Und muss schließlich feststellen, dass es ein anderes Leben gab, das sein Vater führte. Eines, das bis in die Sowjetunion führt.
Ein Leben, das mit der russischen Wissenschaftlerin Alevtina zu tun hat, die viele Jahre später an einem Wochenende mit ihrem Sohn nach Samara reist, um den achtzigsten Geburtstag ihres Vaters zu feiern, und da noch nicht weiß, dass sie bald Besuch aus Norwegen bekommen wird. Und mit ihrer alten Freundin Vasilisa, einer Lyrikerin, die ein Buch über einen eigenwilligen und alten Zug der russischen Kultur schreibt: den Glauben an ein ewiges Leben …
Autor
KARLOVEKNAUSGÅRD wurde 1968 geboren und gilt als wichtigster norwegischer Autor der Gegenwart. Die Romane seines sechsbändigen, autobiographischen Projekts wurden weltweit zur Sensation. Sie sind in 35 Sprachen übersetzt und vielfach preisgekrönt. 2015 erhielt Karl Ove Knausgård den WELT-Literaturpreis, 2017 den Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur, 2022 nahm er in Kopenhagen den Hans-Christan-Andersen-Literaturpreis entgegen. Er lebt in London.
Die norwegische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Ulvene fra Evighetens Skog« im Forlaget Oktober, Oslo. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Die Übersetzung wurde von NORLA, Oslo, gefördert.
Der Verlag bedankt sich sehr herzlich dafür.
Copyright © der Originalausgabe 2021 Forlaget Oktober, Oslo
© der deutschsprachigen Ausgabe 2023 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkterstraße 28, 81673 München
Lektorat: Regina Kammerer
Covergestaltung: buxdesign/München unter Verwendung eines Motivs von © Ruth Botzenhardt
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-25715-6V003
Für Michal
Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen,
und der Tod wird nicht mehr sein,
noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein;
denn das Erste ist vergangen.
HELGE
Gerade habe ich Rockin’ all over the world gehört, das Album von Status Quo. Ich bin noch ganz aufgewühlt. Als die Platte herauskam, habe ich sie nonstop gehört. Das war 1977, und ich war elf. Seither habe ich die Lieder nie mehr gehört. Bis eben, als ich im Büro saß, mich langweilte und ein paar Spuren in die Vergangenheit folgte, über eine Band, die einer Band ähnelte, die wiederum einer Band ähnelte, und sie plötzlich auf dem Bildschirm vor mir auftauchte. Das Bild des Erdballs, leuchtend im schwarzen Weltraum, mit dem Bandnamen in einer Art elektrischen Schrift und dem Titel der Platte darunter in Computerbuchstaben – wow! Aber so richtig überwältigt war ich erst, als ich das Album anwählte. Ich erinnerte mich an jeden Song, es war, als stiegen die Melodien und Riffs aus ihrem Versteck im Unterbewusstsein nach oben, um das zu treffen und zu umarmen, woraus sie einst erschaffen worden waren. Nun begegneten sie endlich wieder ihrem Ursprung, ihren Eltern, diese alten Status Quo-Songs. Aber nicht nur das. Mit ihnen tauchte ein Schwarm von Erinnerungen auf, dicht an dicht, an Aromen, Gerüchen, Bildern, Ereignissen, Stimmungen, Atmosphären – you name it. Die Gefühle waren außer Stande, die große Menge von Informationen zu verarbeiten, alles bebte und zitterte in mir während der Dreiviertelstunde, die es dauerte, mir das Album anzuhören.
Ich hatte es auf Kassette gehabt – keiner, den ich kannte, besaß einen Plattenspieler, außer meiner Schwester, die aber ohnehin nur klassische Musik und Jazz hörte – und hatte es ständig auf dem schwarzen Kassettenrekorder laufen lassen, den ich im Vorjahr zu Weihnachten bekommen hatte. Er lief mit Batterien, und ich nahm ihn meistens mit, egal, wohin ich ging. Sang auch die Lieder immer mit.
Wahnsinn, das wieder zu hören!
Und das!
Tutututake us alone men a ment to tain going you where
De du du de du du!
Status Quo, Slade, Mud, Gary Glitter, das waren die Bands, die wir hörten, die etwas Älteren mochten auch noch Rory Gallagher, Thin Lizzy, Queen und Rainbow. Dann kippte das alles, jedenfalls bei mir, denn plötzlich drehte sich alles um Sham 69, The Clash, The Police, The Specials. Aber all diesen Bands bin ich bis heute gelegentlich gefolgt. Status Quo dagegen nicht. Deshalb war es, als würde etwas in mir explodieren. Deshalb weinte ich, als ich diese Melodie hörte:
An ai laik it ai laik it ai like it ai like it ai la la la la laik it la
la la laik it
here we go-o:
rockin’ all over the world
Es war im Grunde nicht viel Gutes, was in jenem Jahr des Herrn 1977 passierte, jedenfalls nicht bei mir, es ging eher darum, dass etwas passierte, und nicht zuletzt, dass etwas war.
Dass ich war. Und dass ich dort war.
Zum Beispiel in meinem Zimmer.
Mmmm, der Geruch des elektrischen Heizofens.
Die Musik aus dem Kassettenrekorder.
Nicht sonderlich laut, Vater war zu Hause, aber dennoch so laut, dass die Stimmungen direkt in mich eindrangen.
Der Schnee draußen. Sein Geruch, wenn er nass war, fast so viel Regen wie Schnee.
An ai laik it ai laik it ai laik it ai la la la laik it la la la laik it
Hilde, die meine Tür öffnet.
»Da draußen treibt sich ein Mädchen herum und läuft auf und ab. Kennst du sie?«
Ich stellte mich ans Wohnzimmerfenster. Da war tatsächlich ein Mädchen, das an unserem Zaun entlang ging. Auf die Straße trat und zur gegenüberliegenden Seite wechselte, wo sie stehenblieb und zum Haus hinaufschaute. Sie konnte mich nicht sehen, aber trotzdem. Und danach ging sie wieder zurück, zwischen die Sträucher und weiter am Zaun entlang.
»Kennst du sie?«, fragte Hilde.
»Ja«, sagte ich. »Das ist Trude. Sie geht in die Parallelklasse.«
»Und was macht sie hier?«
Ich zuckte mit den Schultern.
»Sieht ganz so aus, als wäre sie hinter mir her.«
»Ha«, sagte Hilde. »Du bist doch erst zwölf.«
»Ich hatte schon viele Freundinnen«, erwiderte ich.
»Denen du ein Küsschen auf die Wange gegeben hast.«
»Von wegen, ich habe geknutscht.«
»Dann geh raus zu ihr.«
Ich schüttelte den Kopf.
»Warum nicht? Gehst du mit einer anderen?«
»Sie ist ein bisschen speziell.«
»Zurückgeblieben?«
»Nein, nein. Nur anders.«
»Klingt gut, wenn du mich fragst.«
»Das liegt daran, dass du selbst speziell bist«, sagte ich und sah sie an, denn ihre Miene erhellte sich, als ich es sagte.
»Zurückgeblieben«, fuhr ich fort.
Dann klingelte es.
»Das ist Trude«, sagte Hilde. »Willst du nicht aufmachen?«
»Kannst du mir einen Gefallen tun und ihr sagen, dass ich nicht zu Hause bin?«
»Was bekomme ich dafür?«
»Irgendwas.«
»Die Hälfte von deinen Samstagssüßigkeiten.«
»Okay.«
Ich stand auf der Treppe und hörte Hilde sagen, dass ich nicht zu Hause sei und sie nicht wisse, wo ich mich herumtriebe. Und dann sah ich Trude im Schneetreiben nach Hause gehen.
Ob es sich exakt so abgespielt hat, weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich, dass ich sie gesehen habe, und ich erinnere mich, dass ich eine Menge Süßes weggab, damit Hilde log. Aber am besten erinnere ich mich an den Schnee, an das Gefühl von Schnee, die Stimmung. Neblig war es auch noch. Weißer nasser Schnee, grauer Nebel. Und Rockin’ all over the world.
Gibt es eine Erinnerung, die einen nicht bestätigt?
Natürlich nicht, denn der Mensch, der das denkt, ist aus Erinnerungen aufgebaut, die ihn darin bestärken, dass es das ist, was er oder sie ist.
Aber ich habe eine Erinnerung, die gleichsam für sich selbst steht. Die mit nichts anderem zusammenhängt. Es war etwas, das ich sah. Und es passierte im selben Winter, ungefähr eine Woche vor Weihnachten 1977. Daran erinnere ich mich ganz ohne die Hilfe der Musik. Diese Erinnerung leuchtet unverständlich in mir.
Unser Haus lag an einer Straße. Auf der einen Seite fiel der Wald schräg zu einer langen, schmalen Bucht ab, auf der anderen lag die Siedlung. Folgte man der Straße bis zur Kreuzung nach unten und wandte sich von dort nach rechts, gelangte man zu einer flachen Brücke, die über die Bucht führte, an deren Außenseite eine Reihe von schwimmenden Bootsstegen und dahinter wiederum der Sund lag.
Eines Abends ging ich allein die Straße hinunter. Es war dunkel und neblig, der Schnee auf der Straße war im Laufe des Tages teilweise geschmolzen, der Asphalt voller Schneematsch. Ich weiß nicht mehr, wohin ich wollte oder wo ich gewesen war, all das ist aus meinem Gedächtnis verschwunden. Vielleicht wollte ich zu den Bootsstegen hinunter, um zu schauen, ob dort jemand war, es war ein Ort, an dem wir oft herumhingen. Wie auch immer: Dunkelheit, Nebel, Asphalt mit Schneematsch. Der Anorak glänzend im Licht der Straßenlaternen. Über die Brücke. Das Wasser schwarz und kalt.
Aber was war das?
Da unten leuchtete etwas.
Tief unten im schwarzen Wasser war etwas, das leuchtete.
Es vergingen einige Sekunden, bis ich begriff, was es war.
Es war ein Auto.
Erst als ich das verstand, bemerkte ich, dass ein Bordstein fehlte und Reifenspuren zum Rand führten.
Da die Scheinwerfer noch leuchteten, musste es gerade erst passiert sein.
Ich machte kehrt und lief die Straße hinauf. Ich musste zu einem Telefon und einen Krankenwagen rufen. Als ich mich den Häusern näherte, war ich mir meiner Sache allerdings nicht mehr so sicher. Es war nicht gesagt, dass es ein Auto war. Es konnte auch etwas anderes sein. Vielleicht würde ich für nichts und wieder nichts einen riesigen Apparat in Gang setzen. Was würde Vater dazu sagen?
Ich kam zu unserem Haus, zog Jacke und Schuhe aus. Vaters Kopf lugte aus seinem Büro heraus, als er mich hörte.
»Wo bist du gewesen?«
»Oben an dem neuen Geschäft«, antwortete ich.
»Das Essen steht auf dem Tisch«, sagte er. »Und danach geht es sofort ins Bett.«
»Okay«, meinte ich.
Ich tat, wie mir geheißen. Aß die Brote, die er mir gemacht hatte, und ging ins Bett. Lange lag ich in der Dunkelheit und dachte an das Licht unten im Wasser, an das Auto, das unter Wasser lag und leuchtete, während ich hier lag.
Am nächsten Tag waren ein Krankenwagen, ein Streifenwagen und ein Kranwagen dort unten. Am Tag darauf stand es auf der Titelseite der Zeitung. Alle redeten darüber. Nur ich nicht. Heute, fünfunddreißig Jahre später, habe ich immer noch keinem Menschen erzählt, was ich an jenem Abend gesehen oder was ich gemacht habe. Denn ich weiß, wenn ich das Richtige getan hätte, hätte ich ihn retten können. Aber ich tat nicht das Richtige, und er starb. Das braucht keiner zu erfahren. Es ist meine Erinnerung, ganz allein meine, und wenn nichts Unvorhergesehenes geschieht, werde ich sie mit ins Grab nehmen.
SYVERT
Der Flughafenbus stand mit laufendem Motor und eingeschalteten Scheinwerfern im strömenden Regen vor der kleinen Ankunftshalle. Ich hastete zu ihm, legte den Rucksack in den offenen Gepäckraum, stieg ein und setzte mich auf einen der hintersten Sitze. Ich kannte den Fahrer, der rauchend unter dem Vordach stand, in dem grauen, unförmigen Anzug der Busgesellschaft, es war der Vater von Eva, einem Mädchen aus meiner alten Klasse. Er sah auf den Parkplatz mit all den Autodächern hinaus, während er die glühende Zigarette mit der Hand abschirmte.
Ich überlegte, woran er wohl dachte. An den Sonntagsbraten mit Rosenkohl? Dass kein Mensch Rosenkohl mochte, aber alle ihn machten? Oder täuschte sein Aussehen? Dachte er auf seinen vielen Busfahrten an versaute Sachen?
Er war so schwer, dass der Bus leicht schaukelte, als er den Fuß auf das Trittbrett setzte. Ich zählte zum Spaß die Fahrgäste, es waren nicht viele, mich eingerechnet zehn. Alle saßen schweigend und verstreut auf ihren Sitzen. Einer von ihnen, ein Typ in meinem Alter, aber mit viel längeren Haaren, hatte einen Kopfhörer aufgesetzt. Das Geräusch, das daraus drang, hörte sich an wie das Summen von Bienen oder so.
Mit dem Geldgürtel, der von seiner Hüfte hing, ging der Fahrer den Mittelgang hinauf, um Fahrkarten zu verkaufen. Als er vor mir stehenblieb, reichte ich ihm einen Tausender.
»Hast du es nicht kleiner?«, fragte er.
»Nein, tut mir leid«, antwortete ich.
Er sah mich an, schaute aber sofort weg, als ich seinem Blick standhielt, und begann, in den Geldscheinen in seiner Tasche zu blättern. Die Krempe seiner Schirmmütze war nass und glänzte im Licht der Lampe an der Decke direkt über ihm.
»Den kann ich nicht wechseln«, sagte er.
»Und was machen wir jetzt?«, fragte ich.
»Na ja, du darfst diesmal umsonst fahren.«
»Danke«, sagte ich.
Kurz danach ließ er den großen Motor an, schaltete und fuhr vom Flughafengelände. Ich holte den Kopfhörer aus der Seitentasche meines Anoraks und setzte ihn auf, drehte die Kassette im Walkman um und drückte auf Play. Van Halens erste Platte war darauf und als sie lief, traten der Asphalt, die Straßenlaternen, der Flughafenzaun und das schwache Motorengrollen in den Vordergrund, während die Landschaft aus Bäumen, Felskuppen, Flussläufen und Sandstränden sich irgendwie zurückzog wie etwas aus einer Wirklichkeit zweiten Grades.
Vor vier Monaten war ich das letzte Mal zu Hause gewesen. An Weihnachten, ich hatte Heimaturlaub gehabt, die Stadt war voller Bekannter gewesen, und ich war jeden Abend ausgegangen. Jetzt war April, die allermeisten befanden sich in Oslo oder Bergen oder Trondheim, und ich war aus dem Militärdienst entlassen worden. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, mir ein paar Monate Zeit zu lassen, um darüber nachzudenken, was ich in Zukunft machen wollte, aber als der Bus nun die Steigung hinter der Brücke hinauffuhr und die Ebene am Rand des Stadtzentrums vor uns auftauchte, ahnte ich, dass ich mich vor allem langweilen würde. Wie sollte ich mir die Tage vertreiben?
Lange schlafen konnte ich vergessen, zumindest, wenn ich Mutters Vorwürfe vermeiden wollte. Eine Woche lang würde sie vielleicht Ruhe geben, es als eine Art wohlverdienter Ferien betrachten, aber danach würde sie meckern. Ich hörte innerlich ihre Stimme, die Art und Weise, wie sie manchmal meinen Namen rief, als würde sie gleichzeitig ein Urteil fällen.
Wir hielten an einer Ampel. Ich hob die Knie, presste sie gegen die Rückenlehne vor mir und rutschte auf dem Sitz nach unten. Direkt vor dem Fenster stand ein Radfahrer mit einem Fuß auf der Erde und dem anderen auf der Pedale. Seine leichte Regenjacke blähte sich im Wind wie eine Tüte.
Entweder langgezogen und fordernd – Syy-yvert! –, oder kurz und scharf – Syvert! – so klang mein Name aus ihrem Mund. Dass ich genauso hieß wie Vater, schwang auch mit. Jedenfalls bildete ich mir das ein. Fest stand, dass sie noch immer wütend auf ihn war, weil er gestorben war und alles ihr überlassen hatte.
Vor dem Narvesen-Kiosk am Busbahnhof hing eine Clique Jugendlicher herum, ansonsten waren kaum Menschen unterwegs, als ich den Platz überquerte, um den Bus zu wechseln. Ich probierte den gleichen Trick wie vorhin beim Fahrer, aber er zählte wortlos neun Hunderter und einen Fünfziger ab, gab sie mir, ehe er den Rest des Wechselgelds aus seinem Apparat drückte, zusammen mit der kleinen, quadratischen, blassgelben Fahrkarte.
Ein paar Sekunden, bevor der Bus losfuhr, kam Gjert angerannt. Ich erkannte ihn sofort. Wir hatten all die Jahre in derselben Mannschaft gespielt, sowohl Handball als auch Fußball, deshalb war sein gedrungener, kräftiger, etwas kantiger Körper für mich unverwechselbar.
Er blieb vor dem Busfahrer stehen, zog eine Monatskarte aus dem Portemonnaie, zeigte sie, ging nach hinten, löste dabei mit der einen Hand den Knoten an seiner Kapuze und zog sie mit der anderen zurück.
»Du fährst jetzt auch mit dem Bus?«, fragte ich. »Hast du den Lappen verloren, oder was ist los?«
Er blieb stehen und grinste.
»Syvert«, sagte er. »Bist du auf Urlaub?«
»Nein, heute entlassen worden«, antwortete ich.
»Gratuliere«, sagte er und setzte sich vor mich, lehnte sich mit dem Oberkörper ans Fenster und legte ein Bein auf beide Sitze.
»Ach, ich weiß nicht«, sagte ich. »Hätte eigentlich noch gut ein paar Monate weitermachen können.«
»Du warst Koch, stimmt’s?«
»Ja.«
»Gute Stellung.«
»Ja.«
Die Tür wurde geschlossen, der Bus fuhr über den leeren Platz zur Ampelkreuzung neben dem Bahnhof.
»Hast du den Lappen verloren?«, fragte ich.
»Ach was. Aber ich habe einen Unfall gebaut.«
»Bekommst du keinen Mietwagen?«
»Die Karre zu reparieren, kostet mehr, als ich dafür bezahlt habe. Ich schaue mich gerade nach einem neuen um.«
»Verstehe«, meinte ich.
»So sieht es aus«, sagte er. »Und was hast du jetzt so vor?«
Ich zuckte mit den Schultern.
»Aber du bleibst eine Weile zu Hause?«
»Denke schon.«
»Dann komm doch zum Training.«
»Ja?«
»Morgen Abend.«
»Warum nicht«, sagte ich.
»Aber ruf Terje vorher an und frag ihn, ob das in Ordnung geht. Außerdem muss ich dich warnen. Wir haben einen neuen Trainer. Einen Dänen. Mads. Bei ihm wird viel geredet.«
»Geredet?«
»Ja, Theorie.«
»Theorie?«
»Taktik. Er bringt sogar Tafeln zum Training mit.«
Wir plauderten die halbe Stunde, die der Bus nach Hause brauchte. Gjert wohnte zwei Kilometer entfernt, in einer Siedlung aus den Siebzigern, während wir in einem Haus aus den Dreißigern lebten, erbaut von meinem Großvater auf dem, was damals noch der Hof seiner Eltern gewesen war. Wir leben gewissermaßen in den Resten einer alten Zeit, hatte ich viele Male gedacht. Die meisten anderen aus meiner Klasse in der Grund- und Gesamtschule waren Zugezogene, wenn auch nicht von weit her, während es etwa zehn bis zwanzig Prozent so ging wie mir, sie hatten Eltern, die einer anderen Generation anzugehören schienen als die Eltern der Siedlungskinder, es war, als gäbe es etwas in der Zeit, was wir hier nicht richtig mitbekommen hatten. Gjert hing dazwischen, denn wir waren tatsächlich verwandt, entfernt, obwohl er in der Siedlung aufgewachsen war. Das zeigte sich jetzt; während die anderen von dort weggezogen waren, und sei es auch nur in die Stadt, war er geblieben.
Er hatte rötliches Haar, in der Farbe, die von den Engländern »ginger« genannt wird, blaue Augen mit einem kalten Blick, einen breiten Mund, aber schmale Lippen. Er lachte gern, war aber nicht der Typ, der Witze riss, er war weder eloquent noch fantasievoll, wurde aber allseits respektiert, obwohl er meistens nicht viel Aufhebens von sich machte. Es war verflucht schwer, gegen ihn zu spielen, denn er warf sich in die Tacklings und Duelle, als hätte er nichts zu verlieren. Auch ich war kräftig, ehrlich gesagt kräftiger als er, und bestimmt zwanzig Zentimeter größer, aber ich war ein ruhigerer Typ. Er wurde wütend, wenn wir ein Tor kassierten, schrie manchmal den Schiedsrichter an, wenn er falsch oder feige gepfiffen hatte, und verlor gelegentlich die Beherrschung und holte von den Beinen, wen auch immer er bestrafen wollte.
»Schrecklich, wie gut gelaunt du bist«, sagte ich, als wir uns der Stelle näherten, an der er aussteigen würde. »Hast du etwa eine Freundin gefunden?«
»Ja, habe ich«, sagte er und sah plötzlich im Bus nach vorn.
»Machst du Witze?«, sagte ich.
»Nein«, antwortete er.
»Wer ist sie? Jemand, den ich kenne?«
Er schüttelte den Kopf.
»Ich bin ihr Silvester bei einer Fete auf der anderen Seite der Stadt begegnet.«
»Kommt sie von da?«
Er nickte.
»Wie alt ist sie?«
»Sechzehn.«
»Sieh einer an«, sagte ich. »Also auf dem Gymnasium? Oder?«
»Berufsschule.«
»Hat sie auch einen Namen?«
»Bente.«
Als ich aus dem Bus stieg und auf unser Haus zuging, hatte es aufgehört zu regnen. Es lag etwa hundert Meter weiter am Waldrand, am Ende eines schmalen Kieswegs, der nass und voller Pfützen war, deren Oberfläche vom Wind gekräuselt wurden, der vom unsichtbaren, aber dennoch immer spürbaren Meer kommend über die Ebene heranströmte.
Eine schwache Unruhe breitete sich in mir aus, als ich das Licht in den Fenstern sah. Ich wusste, dass Joar sich darüber freute, dass ich kam, und es wahrscheinlich viele Tage getan hatte.
Es war wichtig, ihn nicht zu enttäuschen.
Ich hatte keine Ahnung, ob Mutter von ähnlichen Gefühlen erfüllt war. Sie wusste es sicher zu schätzen, dass ich nach Hause kam, daran zweifelte ich nicht, ich war mir nur nicht sicher, was ihr Motiv betraf, vielleicht ging es ihr in erster Linie darum, Hilfe zu bekommen bei allem, was ihr wichtig war, und nicht so sehr darum, dass gerade ich ihr half.
Egal. Ich hatte nicht vor, lange zu bleiben.
Als ich die Tür öffnete, stand Joar im Flur.
»Hab dich aus dem Bus steigen sehen«, sagte er und grinste.
»Darfst du so spät noch auf sein?«
Sein Grinsen verschwand, und er sah mich mit seinem durchdringenden Blick an.
»Ich bin immerhin zwölf«, sagte er.
»Das weiß ich!«, sagte ich. »Ich mache doch nur Spaß.«
Ich zerzauste ihm die Haare, ehe ich den Rucksack absetzte. Bratendunst hing in der Luft. Ich ging ins Treppenhaus und sah Mutter in der Küche mit einem Bratenwender in der Hand am Herd stehen.
»Hallo, Syvert«, sagte sie. »Gute Reise gehabt?«
»Ja, klar«, sagte ich. »Hier alles in Ordnung?«
»Ja, klar. Ich habe uns ein paar Frikadellen gemacht.«
»Lecker«, meinte ich.
»Ich habe den Tisch gedeckt«, sagte Joar.
»Dann können wir essen«, sagte Mutter. »Holst du etwas, worauf ich die hier stellen kann?«
Sie hob die Bratpfanne vom Herd. Ich nahm einen der Untersetzer, die daneben auf der Arbeitsplatte lagen, und platzierte ihn mitten auf den Tisch. Sie hatte zusätzlich noch Spiegeleier und Bratkartoffeln gemacht.
»Das ist vielleicht kein Essen für einen Koch wie dich«, sagte sie.
»Du weißt doch, was man über das Essen beim Militär sagt«, erwiderte ich.
Als Joar ins Bett gegangen war, blieb ich mit Mutter im Wohnzimmer, und wir sahen fern. Obwohl es nicht besonders spät war, schlief sie ein, saß mit gähnendem Mund und zurückgelegtem Kopf auf der Couch. Ab und zu ließ sie ein leises, scharrendes Schnarchen hören.
»Möchtest du die Nachrichten nicht sehen?«, fragte ich nach einer Weile.
»Hm?«, sagte sie und richtete sich auf.
Sie sah erst zu mir, dann zum Fernseher. Strich sich mit der Hand über den Mund.
»Ich muss wohl eingenickt sein«, sagte sie.
»Willoch verhandelt anscheinend noch«, sagte ich und grinste sie spöttisch an, sie sah so aus, als hätte sie nicht die geringste Lust, über Politik zu reden. »Glaubst du, dass er gehen muss?«
»Das glaube und hoffe ich«, antwortete sie. »Und es sieht ganz so aus, als würde dein Freund Hagen dabei helfen.«
»Er hat die Wahl zwischen Pest und Cholera«, sagte ich.
Sie schnaubte und beugte sich vor, um sich eine Zigarette zu drehen.
»Ich hatte gehofft, du wärst bei der Armee zur Vernunft gekommen«, sagte sie.
»Hagen ist vernünftig.«
»Ach was. Er ist aalglatt. Ich kann ihn nicht leiden.«
»Ich habe nie behauptet, dass ich ihn mag«, sagte ich. »Du musst zwischen der Sache und der Person unterscheiden. Ich unterstütze die Politik. Nicht den Politiker.«
»Ja, ja. Irgendwann wirst du schon sehen.«
»Du meinst, dass ich dann das Gleiche denke wie du? Dass es das Richtige ist?«
»Nein, nicht doch«, sagte sie und zündete die Zigarette an. »Es ist gut, dass du deinen eigenen Kopf hast.«
»Aber vielleicht nicht auf die Art?«
Sie sah mich an und schmunzelte.
»Du bist immer schon ein Sturkopf gewesen, Syvert.«
»Und von wem habe ich das, wenn ich fragen darf?«
»Ein Sturkopf und ein Querulant«, sagte sie. »Schon, als du klein warst.«
»Nur, weil ich nicht in allem die gleiche Meinung habe wie du?«
Sie sagte nichts, ließ den Blick von mir zum Fernseher gleiten, wo der Wetterbericht lief.
»Genau das ist das Problem mit der Politik in diesem Land«, sagte ich. »Die Leute wählen die Arbeiterpartei, weil sie es immer getan haben. Das ist sicher und gut. Aber warum soll es nur eine Art geben, die Dinge zu tun, und nur eine Art zu denken? In unserem Land leben vier Millionen Menschen! Aber es geht keinem mehr darum, Dinge zu verändern. Es muss nicht so sein, wie es jetzt ist. Warum sollen wir zum Beispiel nur ein einziges Fernsehprogramm haben? Wir könnten hundert haben! Warum soll das Staatsfernsehen darüber entscheiden, was wir sehen? Und warum soll der Staat alles besitzen und regeln? Warum müssen die Geschäfte auf Gedeih und Verderb so früh zumachen? Warum können sie nicht rund um die Uhr geöffnet sein? Warum sollen andere über unser Leben bestimmen?«
»Es geht uns doch gut hier«, erwiderte sie. »Das wirst du ja wohl zugeben müssen. Wenn du bedenkst, wie viel Elend es an anderen Orten der Welt gibt.«
»Aber wir sind nicht frei. Weißt du, es ist durchaus möglich, es gut zu haben und gleichzeitig frei zu sein.«
Im Fernsehen erschien das Pausenbild. Mutter gähnte, rauchte noch ein paar Züge, drückte die Kippe aus, nahm den Aschenbecher und stand auf.
»Ja, wollen wir ins Bett?«, sagte sie. »Du hast bestimmt einen langen Tag gehabt.«
»Nein, nein. Aber geh ruhig. Gute Nacht.«
»Gute Nacht.«
Sie lief mit dem Aschenbecher in die Küche und räumte dort ein paar Minuten herum, ehe ihre Schritte die Treppe hinauf verschwanden. Ich schaltete den Fernseher aus, stellte mich ans Fenster und sah hinaus. Das Licht der Lampen an der Hauswand und der Scheune streckte sich wie immer über den Hof und ein kleines Stück über das Feld, wo es im Meer der Dunkelheit erlosch.
Ich merkte, dass ich mich über Mutter ärgerte. Sie nahm mich niemals ernst, es schien, als würde sie glauben, dass ich eigentlich überhaupt nicht meinte, was ich meinte.
Ich holte den Rucksack aus dem Flur, trug ihn in mein Zimmer hinauf und packte ihn aus, bevor ich mich hinlegte. Das Letzte, was ich vor dem Einschlafen tat, war zu wichsen, wobei ich an Bente dachte, Gjerts Freundin, die ich nie gesehen hatte.
Mitten in der Nacht wachte ich von einem Geräusch auf. Ehe es mir gelang, es zu identifizieren, herrschte schon wieder Stille. Es hatte sich angehört wie das Jammern einer Katze, und damit ließ ich es bewenden und schloss die Augen.
Aber das Geräusch kehrte wieder. Jetzt hörte ich, dass es aus dem Haus kam, nicht von draußen.
War das Joar?
Weinte er?
Ich kam auf die Beine und ging vorsichtig in den Flur, blieb vor seiner Tür stehen.
Richtig, von dort kam das Jammern.
Ich öffnete die Tür und schaute hinein.
»Stimmt etwas nicht?«, fragte ich leise.
Er lag mit dem Rücken zu mir und antwortete nicht.
Ich ging ins Zimmer.
»Joar?«, sagte ich. »Stimmt etwas nicht?«
Er war still geworden.
Ich ging zum Bett und setzte mich auf die Kante. Legte die Hand auf seine Schulter.
»Hattest du einen Alptraum?«, fragte ich. »Hast du schlecht geträumt?«
Er drehte sich zu mir um.
»Ich habe von Mama geträumt.«
»Und was hast du geträumt?«
»Sie ist auf den Hof gekommen und hat zum Himmel gesehen. Und dann hat sie den Mund aufgemacht, und ein Vogel ist rausgeflogen.«
»Ein Vogel?«, sagte ich und musste mir auf die Lippe beißen, um nicht zu grinsen.
»Ein Spatz«, sagte er.
»Aber das klingt doch wie ein schöner Traum«, meinte ich. »Seltsam, aber schön.«
»Kapierst du denn gar nichts?«, erwiderte er. »Sie wird sterben.«
Ihm entfuhr ein Schluchzen, als er das gesagt hatte. Ich strich ihm durchs Haar, er drehte den Kopf weg.
»Aber Joar. Das war doch nur ein Traum.«
»Sie wird sterben«, wiederholte er ins Kissen hinein.
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, und strich ihm erneut über den Kopf.
»Fass mich nicht an«, sagte er.
Ich zog die Hand zurück.
»Ich werde dich nicht anfassen«, sagte ich. »Aber es ist wichtig, dass du begreifst, dass es einen Unterschied zwischen den Träumen und der Wirklichkeit gibt.«
Er sagte nichts.
Hörte er mir überhaupt zu?
»Es mag ja sein, dass du dich davor fürchtest, dass Mama stirbt«, fuhr ich fort. »Erst recht, weil Papa tot ist. Und weil du Angst hast, träumst du davon. Verstehst du? Der Traum bedeutet nicht, dass Mama stirbt, sondern dass du Angst hast, sie könnte sterben.«
Er sah mit seinen dunklen Augen zu mir auf.
»Du bist ja so hohl, Syvert.«
Ich stand auf.
»Du flennst hier wegen eines Traums, nicht ich«, sagte ich. »Ich habe nur versucht, nett zu sein.«
»Warum bist du wütend?«
»Ich bin nicht wütend«, sagte ich. »Aber du kannst zu anderen Leuten nicht alles Mögliche sagen.«
»Aber es ist wahr. Du bist hohl. Warum soll ich nicht die Wahrheit sagen?«
»Du hast geflennt, junger Mann. Weil du geglaubt hast, deine Mama würde sterben. Wie hohl ist das denn?«
Ich bereute es in dem Moment, als ich die Tür hinter mir schloss, und blieb still im Flur stehen und überlegte, ob ich zurückgehen sollte.
Wenn er wieder anfing zu flennen, würde ich es tun.
Aber er blieb still, und ich ging und legte mich hin.
Nur ein paar Stunden später wurde ich wieder wach, diesmal davon, dass Mutter den Wagen anließ. Ich schlief wieder ein und erwachte erst, als sie gegen neun zurückkam. Ich stand auf, schlang mir ein Handtuch um die Hüften und ging in den Flur, öffnete die Tür zu Joars Zimmer, ehe mir einfiel, dass es Freitag war, und nicht Samstag, wie ich gedacht hatte, und Joar somit in der Schule.
Er ist daran gewöhnt, allein zur Schule zu gehen, wenn Mutter arbeitet, es macht also nichts, dass ich geschlafen habe, dachte ich und ging ins Bad.
Mutter hatte zwei Putzstellen, eine in einem Bürogebäude in der Stadt, von wo sie jetzt kam, und eine in der Schule, wo wir wohnten, die sie am Nachmittag putzte. Außerdem übernahm sie an den Wochenenden relativ oft Sonderschichten im Altenheim. Sie hatte keine Ausbildung und musste deshalb nehmen, was sie kriegen konnte. Ich hätte mir gewünscht, sagen zu können, dass sie sich nicht beklagte, aber das tat sie.
Ich ließ das Handtuch auf den Boden fallen und betrachtete mich im Spiegel. Mein größter Vorzug war der Oberkörper, es kam darauf an, die Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken, irgendwie am ersten Eindruck meines Gesichts vorbeizukommen.
Ich drehte mich. Der Rücken war breit und von Grübchen bedeckt, die Pickel hinterlassen hatten. Der Hals war kurz und kräftig.
Wie ein Ochse.
»Syvert, bist du im Bad?«, rief Mutter von unten.
Ich antwortete nicht, drehte das Wasser in der Dusche an und stellte mich unter den Strahl. Aus irgendeinem Grund dachte ich an Keith, den eitelsten Mann, den ich kannte. Wie er nach dem Training immer vor dem Spiegel stand und sich kämmte, verflucht geschniegelt, mit schwarzen, spitzen Schuhen, pastellfarbigen Sakkos mit hochgekrempelten Ärmeln und ständig neuen Jeans. Keiner machte ihm deshalb Vorwürfe, denn er war auch cool, und in seinen Augen gab es etwas Finsteres und Gefährliches. Es hätte mich nicht gewundert, wenn er statt eines Kamms ein Messer aus der Gesäßtasche gezogen hätte. Andererseits verschwand das alles, wenn er auf den Platz kam. Es war nicht das Trikot, das ihn aufs Normalmaß zurechtstutzte, denn er sah darin absolut scharf aus, das Hemd in die Shorts gesteckt und mit neuen, frisch geputzten Schuhen, sondern sein Spiel: Sobald es losging, erwies er sich als plumper, eifriger, technisch wenig versierter linker Verteidiger.
Sein Gesicht hätte sich auch bei einem Mädchen gut gemacht. War es das, was ihnen gefiel? Denn wenn wir in ein Lokal kamen, sahen die Frauen immer zu ihm, es war jedes Mal das Gleiche. Sein Name war auch ein Vorteil. Alle fragten danach. Keith? Daraufhin konnte er erzählen, dass sein Vater Engländer war, und sich ein wenig im Exotischen suhlen.
Aber das gönnte ich ihm. Mit ihm in der Mannschaft kamen jedenfalls immer Frauen zu unserem Tisch.
Ich drückte etwas Duschgel heraus und wusch mich, trocknete mich ab, sprühte Deo auf, knotete das Handtuch wieder um die Taille und ging in mein Zimmer, um mich anzuziehen.
Als ich in die Küche hinunterkam, hatte Mutter Eier mit Speck gemacht, das Ganze lag auf einem Teller mitten auf dem Tisch. Außerdem hatte sie Brotscheiben aufgeschnitten und Butter und Käse herausgestellt, und der Kaffee stand auf der Platte der Kaffeemaschine. Ich setzte mich und begann zu essen. Die vollgesogenen Felder vor den Fenstern leuchteten gelb vor einem grauen und stillen Himmel. Das Auto hatte tiefe Spuren in den nassen Schotter gegraben, sah ich, und dachte, dass es vielleicht das Beste wäre, in diesem Frühjahr eine Fuhre Kies anliefern zu lassen.
»Ist Joar gut zur Schule gekommen?«, fragte Mutter, die aus der Waschküche trat.
»Das weiß ich nicht«, sagte ich. »Ich habe geschlafen. Ich denke schon. Er war jedenfalls nicht hier, als ich aufgewacht bin.«
Als sie eine Tasse aus dem Schrank holte, erstarrte sie. Halb vorgebeugt legte sie eine Hand in den Rücken.
»Hast du einen Hexenschuss?«, fragte ich.
»Ich habe nur manchmal Rückenschmerzen.«
»Bist du beim Arzt gewesen?«
Sie schnaubte.
»Ein Arzt kann da auch nichts machen. Das kommt von der Arbeit, was denn sonst.«
»Ein Physiotherapeut könnte etwas bringen«, sagte ich.
»Ja, sicher«, entgegnete sie.
»Aber das willst du nicht?«
»Es ist okay, so wie es ist«, sagte sie. »Ich mache dir eine Liste von Sachen, die getan werden müssen.«
»Danke«, sagte ich und grinste.
»Könntest du vielleicht als Erstes die Reifen wechseln? Dann sparen wir uns die Werkstattrechnung.«
»Hast du die Reifen jemals in der Werkstatt wechseln lassen? Ich dachte, Onkel Einar hat dir geholfen, als ich nicht hier war?«
»Jetzt bist du ja da.«
»Ich erledige das«, sagte ich. »Aber nicht heute.«
»Was hast du denn heute vor, was so wichtig ist?«
»Ich wollte nur mal kurz in die Stadt«, sagte ich.
Sie sah mich an.
»Wenn du willst, kannst du das Auto nehmen. Aber dann musst du um zwei zurück sein.«
»Kein Problem.«
»Könntest du dann auch einkaufen gehen?«
»Wusste ich doch, dass du einen Hintergedanken hast«, sagte ich und lachte.
»Wir müssen Essen im Haus haben«, erwiderte sie. »Zumindest, wenn du zu Hause bist.«
»Schon klar«, sagte ich und schnitt das Eigelb aus dem Eiweiß heraus, schob es auf die Gabel und steckte es in den Mund, wo es kalt verlief. »Schreib mir einen Einkaufszettel.«
Mutter hatte keine Stereoanlage im Auto, nur ein Radio, so dass ich den Kopfhörer aufsetzte, ehe ich den Motor anließ. Ich ließ AC/DC laufen und als ich in Richtung Hauptstraße fuhr, sang ich bei HellsBells mit. Auf der asphaltierten Straße gab ich Gas, denn um diese Uhrzeit war kaum ein Auto unterwegs, und ich sauste durch den Wald, an Schule und Sporthalle vorbei, wo die Jacken und Mützen der Kinder das ganze Grau mit ihren vielen Farbtönen von Rot und Blau aufhellten, am Lebensmittelladen und dem neuen Friseursalon vorbei. Hells bells, Hells bells, sang ich und schlug den Takt auf dem Lenkrad. Auf der E18 landete ich hinter einem Sattelschlepper und ließ den Wagen nach jeder Kurve auf die Gegenfahrbahn driften, als wäre er eine Jolle im Schlepptau, um nach einer Chance zu spähen, ihn zu überholen, aber jedes Mal kam mir irgendein Idiot entgegen, und erst auf dem langen, sanften Anstieg, auf dem es eine Kriechspur gab, die der Sattelschlepper zum Glück benutzte, kam ich an ihm vorbei und konnte wieder beschleunigen.
Ich hätte nicht wütend auf Joar werden sollen. Aber ich war völlig unvorbereitet gewesen; schließlich hatte er geweint und Angst gehabt.
Es war nicht so, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Im Gegenteil, er war superintelligent und wirklich lieb. Er konnte nur nicht lügen. Konnte einfach nichts sagen, was nicht wahr war.
Und das war ja im Grunde eine gute Eigenschaft.
Ich schaute zu der riesigen Fabrik hinunter. Sie brütete in der Landschaft, was nicht zuletzt daran lag, dass um sie herum jegliche Vegetation verschwunden war.
War ich wirklich hohl?
Natürlich nicht. Er hatte sich auf das bezogen, was ich gesagt hatte, das über die Träume. Aber auch das war nicht hohl. Es stimmte ja. Er fürchtete sich davor, dass Mutter sterben könnte, und daraufhin träumte er davon.
An Vater konnte er sich kaum erinnern, er war erst vier gewesen, als er starb.
Papa, Papa, hatte er gesagt, als er plötzlich nicht mehr da war. Papa, Papa.
Aber Papa kam ja nie, und daraufhin vergaß er ihn.
Jedenfalls hatte ich das geglaubt.
Ein Jahr später saß er auf der Rückbank, als wir in die Stadt fuhren, und sagte plötzlich, dass Papa im Himmel sitze und uns lenke.
Ich hatte mich zu ihm umgedreht und ihn gefragt, wie er das meine.
»Mama fährt das Auto, und Papa fährt Mama. Und mich und dich.«
Damals hatte ich ihn nur angegrinst und mich wieder nach vorne gedreht. Mutter hatte einfach so getan, als hätte sie nichts gehört.
Jetzt fragte ich mich, wie ihm dieser Gedanke in den Sinn gekommen war.
Woher hatte er das alles?
Vor mir lag die Stadt wie auf einem Präsentierteller, am Ende des Flusstals mit dem Meer direkt davor und den sanften, bewaldeten Anhöhen zu beiden Seiten. Das Meer war ruhig und grau, mit einer Art metallischem Glanz an der Oberfläche, der den Unterschied zum tiefhängenden Himmel, der genauso grau war, schärfer machte, als man es erwarten würde.
Ich stellte den Wagen im Parkhaus in der Festningsgaten ab und ging zum Arbeitsamt, wo ich fast eine Stunde warten musste, bis ich an der Reihe war. Ich hatte geglaubt, dass ich nur ein Formular ausfüllen musste, aber wie sich herausstellte, war es nicht ganz so einfach, sich arbeitslos zu melden. Abgesehen von dem Formular musste ich ein Gespräch mit einem Berater führen, das nicht sofort stattfinden konnte, sondern erst eine Woche später, außerdem musste ich noch einen Kurs für Arbeitssuchende belegen, wie mich die überarbeitete Sachbearbeiterin informierte. Erst wenn das alles abgehakt war und nach einer mehrwöchigen Bearbeitungszeit würde ich möglicherweise Arbeitslosengeld erhalten.
»Und was macht man, wenn man kein Geld hat?«, fragte ich. »Ich meine, wenn es akut ist?«
»Dann müssen Sie zum Sozialamt«, sagte sie.
Ich dankte ihr, nahm den kleinen Stapel mit Papieren und Broschüren, den sie mir gegeben hatte, und ging. Zwei von denen, die draußen warteten, kannte ich. Sie waren auf dem Gymnasium eine Klasse unter mir gewesen. Der eine hieß Håvard, meinte ich mich zu erinnern, er hatte ganz kurze Haare auf dem Kopf und einen langen Zopf, der ihm auf den Rücken fiel, war immer schwarz gekleidet und hatte bei einem der neuen Lokalradiosender eine eigene Sendung. Es überraschte mich nicht im geringsten, ihn dort zu sehen, aber es provozierte mich trotzdem, denn er stand sozusagen in Opposition zur Gesellschaft, darum drehte sich alles bei ihm, und dann saß er hier herum und nahm von derselben Gesellschaft Geld an.
Ich fühlte mich eklig, als ich die Dronningens gate hinabging. Es war ein Fehler gewesen, mich arbeitslos zu melden, es widersprach allem, wofür ich politisch stand. Ich hatte mir gesagt, dass der Wehrdienst eine Pflicht war, etwas, das ich nicht selbst gewählt hatte, und als sie mich dann im März entließen, mitten im Semester, so dass ich keine Möglichkeit hatte, eine Hochschule zu besuchen, war es ihre Pflicht, finanziell für mich zu sorgen. Aber das war natürlich Unsinn, nur eine Entschuldigung. Es war egal, wie viele da drinnen mit den Händen im Schoß nebeneinandersaßen, ich wusste, dass es für jemanden, der wirklich arbeiten wollte, auch Jobs gab.
Am Kiosk in der Fußgängerzone kaufte ich zwei Zeitungen und setzte mich in das Café in der Stadtbibliothek. Als Erstes checkte ich die Aktienkurse in Die Seefahrt. Bei meinen Aktien hatte sich nichts getan, obwohl es mehr als zwei Wochen her war, dass ich zuletzt nachgesehen hatte. Der Wert meiner Investition hatte sich also weiterhin mehr als halbiert. Zu glauben, dass der Kurs sich kurzfristig erholen würde, bedeutete, an den Weihnachtsmann zu glauben, aber ich verspürte dennoch einen Hauch von Enttäuschung. Ich war mir so clever vorgekommen, als ich es getan hatte. Nicht in Statoil oder eine der anderen großen Ölgesellschaften, sondern in zwei kleine Offshorefirmen hatte ich mein Geld gesteckt. Fast das gesamte Erbe meines Vaters, das ich an meinem achtzehnten Geburtstag bekommen hatte, hatte ich investiert. Mutter wusste nichts davon, obwohl es nicht so war, dass ich etwas Illegales getan oder das Geld verspielt hätte oder so. Ich hatte vorgehabt, ihr davon zu erzählen, sobald ich eine ansehnliche Stange Geld beisammenhätte, jedenfalls genug, um ihre Einwände im Keim ersticken zu können.
Es war noch Zeit, Aktien waren eine langfristige Investition.
Ich legte Die Seefahrt zur Seite und las stattdessen die Lokalzeitung. Die Arbeiterpartei sperrte sich immer noch, begriff ich, man wollte die Benzinabgabe nur mittragen, wenn gleichzeitig der Spitzensteuersatz angehoben wurde. Sie waren mit anderen Worten einer Meinung mit Willoch, fügten aber eine Forderung hinzu, die er nicht erfüllen konnte, so dass er zurücktreten musste und sie wieder an die Macht kommen konnten. Das war Doppelmoral. Sie waren eigentlich dafür, würden aber dagegen stimmen. Und Hagen konnte ja nicht für die Benzinabgabe stimmen. Schließlich war er Vorsitzender einer Partei gegen Steuern und Abgaben. Das war ihr Fundament.
Natürlich tauchte dieser Håvard-Typ im Café auf, als ich dort saß. Zusammen mit ein paar Kumpel setzte er sich an den Nebentisch. Er nickte mir zu, bestimmt, weil er mich dort gesehen hatte und uns das in seinen Augen zu Verbündeten machte, ich nickte zurück, stand auf und ging hinaus. Durchs Fenster sah ich, dass er sich schon meine Zeitung genommen hatte und darin las.
Ich ging zum Marktplatz und betrat den Empfang des Eckhauses, in dem die Lokalzeitung ihr Stadtbüro hatte. Ein älterer Mann in einem dunkelblauen Mantel und mit weißen Haaren, die so schütter waren, dass sie einer Wolke aus Staub glichen, sprach mit der Frau am Empfang, und ich begriff, dass es um eine Ausgabe der Zeitung ging, die nicht gekommen war. Sie nickte mehrmals freundlich, hatte lange, blonde Haare und ein sonnengebräuntes Gesicht, lange, schwarze Wimpern. Es sei nicht das erste Mal, dass die Zeitung nicht gekommen sei, erklärte er, und sie nickte dazu, sie nahm die Sache ernst. Offenbar ist sie im Osterurlaub im Süden gewesen, dachte ich, sie wirkte nicht wie jemand, der in die Berge fuhr. Sie bedauerte, was vorgefallen war, und meinte, er könne die aktuelle Zeitung jetzt bekommen, aber das wollte er nicht, es ging ihm ums Prinzip. Als er mit dem Regenschirm unter dem Arm verschwand, lächelte sie mich an.
Ich lächelte auch.
»Sitzt Dag jetzt hier? Oder ist er draußen in der Zentrale?«
»Er arbeitet hier, aber ich weiß nicht, ob er da ist. Warten Sie bitte kurz, ich höre mal nach. Wie ist Ihr Name?«, fragte sie, schon mit dem Telefonhörer am Ohr, der von einer angehobenen Schulter an Ort und Stelle gehalten wurde.
»Syvert«, sagte ich.
Sie ist hübsch, aber vielleicht etwas zu alt, dachte ich und spürte, dass ich einen Ständer bekam. Sie war sicher mindestens fünfundzwanzig.
»Du hast Besuch«, sagte sie in den Hörer. »Syvert ist hier.«
Dag kannte ich schon mein ganzes Leben. Wir waren Cousins, er war der Sohn des Bruders meines Vaters, wir waren zusammen aufgewachsen und in der Schule neun Jahre in dieselbe Klasse gegangen, und obwohl wir uns für verschiedene Gymnasien entschieden hatten – er war in der Stadt in die Kathedralschule gegangen, die als besser galt –, hatten wir uns weiter häufig gesehen. Meistens hatten wir denselben Bus zur Schule und nach Hause genommen, und wenn wir am Wochenende mit unseren neuen Freunden ausgingen, landeten wir trotzdem oft am selben Tisch. Er hatte mit sechzehn angefangen, für die Zeitung zu schreiben, für ihre wöchentlich erscheinende Jugendseite, und hatte seine Sache gut gemacht, denn nach dem Gymnasium hatte er eine einjährige Aushilfsstelle bekommen und war jetzt in seinem zweiten Jahr dort. Als ich in sein Büro kam, saß er über die Schreibmaschine gebeugt.
»Ja, hallo«, sagte er, ohne aufzuschauen.
»Ja, hallo«, sagte ich und setzte mich auf den Stuhl auf der anderen Seite des Tisches.
»Ich will das nur kurz fertigschreiben«, sagte er. »Zwei Minuten.«
»Mach ruhig weiter«, sagte ich, zog den Reißverschluss der Jacke auf und sah dabei auf den Platz vor dem Fenster und den kleinen Park dahinter, wie dort alles vollkommen regungslos stand und den fallenden Regen entgegennahm.
Dag hatte eine Pigmentstörung, er war ein sogenannter unechter Albino, was bedeutete, dass seine Haare und seine Haut weiß waren, während die Augen, die bei einem echten Albino rot gewesen wären, braun waren. Als Kind war er stolz darauf gewesen, es hatte ihn herausgehoben, während es ihn in der Pubertät gequält hatte.
»Bist du gestern gekommen?«, fragte er und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, den Arm auf die Lehne gelegt.
Ich nickte.
»Möchtest du einen Kaffee?«, fragte er und war schon auf den Beinen, noch ehe ich Ja sagen konnte, er verschwand zur Tür hinaus und kam einen Augenblick später mit einer Tasse in jeder Hand zurück.
»Danke«, sagte ich, als er mir eine reichte.
»Verdammt, du Arsch, du bist entlassen worden!«, sagte er und setzte sich.
»Ja«, sagte ich.
»›Ja‹?«, erwiderte er. »Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Freust du dich denn gar nicht?«
»Ich hätte gut noch länger bleiben können.«
»Dann werd doch Berufssoldat.«
»Als Koch? Nein, danke.«
»Das ist der Startschuss für deine Karriere. Am Ende kannst du Generalkoch werden.«
»Oder Streptokoch«, sagte ich.
Wir lachten.
»Übrigens, wie heißt die Frau, die am Empfang arbeitet?«
»Marianne?«
»Ja, die da vorhin gesessen hat.«
»Das ist Marianne. Du interessierst dich für sie?«
»Natürlich«, sagte ich. »Du nicht?«
Er schüttelte den Kopf.
»Es ist nicht gut, sich mit jemandem auf der Arbeit einzulassen. Da habe ich meine Prinzipien.«
»Das sagst du jetzt nur, weil du bei keiner hier eine Chance hast«, sagte ich und lachte.
»Gehst du heute Abend aus?«, fragte er. »Um zu feiern?«
Ich zuckte mit den Schultern.
»Nein, ich habe nichts geplant. Mal sehen, was sich ergibt. Gehst du?«
»Ich weiß es noch nicht. Aber ich war sicherheitshalber im ›Monopol‹«, sagte er und nickte zu einer Tüte hin, die an der Wand unter dem Haken stand, an dem seine Jacke hing.
»Was hast du gekauft?«
»Rum.«
»Bacardi?«
»Nein. Braunen Rum. Ich weiß nicht mehr, wie die Marke heißt. Hast du den schon mal probiert? Schmeckt richtig gut. Brennt ganz schön.«
»Nein, den habe ich ehrlich gesagt noch nie getrunken. Mischst du ihn mit etwas?«
Er schüttelte den Kopf.
»Das könnte man bestimmt. Keine Ahnung. Aber ich mag ihn pur.«
»Ich habe in letzter Zeit einige Margaritas getrunken«, sagte ich. »Hast du das schon mal probiert?«
»Klar. Mit Salz auf dem Glas, stimmt’s?«
»Mm.«
»Ja, das schmeckt auch gut«, sagte er.
»Und Tequila Slammer natürlich«, sagte ich. »Hast du das schon mal probiert?«
»Klar. Ein, zwei Mal.«
»Das hast du nicht«, sagte ich und lachte.
»Woher zum Teufel weißt du das?«
»Weil du ›ein, zwei Mal‹ gesagt hast. Das hast du nur gesagt, damit es glaubwürdig klingt. Habe ich recht oder habe ich recht?«
»Ich habe zumindest jemanden gesehen, der einen getrunken hat, und dabei gedacht, dass ich das mal probieren sollte«, meinte er.
»Ha, ha!«
Er zog eine Schachtel Zigaretten aus der Hemdtasche und zündet sich eine an, schob den Stuhl zurück und legte die Füße auf den Tisch.
»Und was hast du jetzt vor?«, fragte er.
»Ach, ich fahr wieder nach Hause, ich muss unterwegs noch für meine Mutter einkaufen gehen.«
»Mit deinem Leben, du Idiot.«
»Ach das«, sagte ich. »Keine Ahnung. Aber ich bin gerade beim Arbeitsamt gewesen und habe mich arbeitslos gemeldet.«
»Hast du?«
»Ja. Es gibt ja im Grunde nicht so viele Alternativen.«
Er nahm die Füße wieder herunter, zog den Stuhl näher an den Tisch heran, streckte den Arm aus und klopfte über dem Aschenbecher mit dem Zeigefinger auf die Spitze der Zigarette.
»Könntest du dir vorstellen, dich dazu interviewen zu lassen?«, fragte er.
»Wozu?«
»Dazu, dass du arbeitslos bist. Weißt du, das ist ein Thema. Junger Mann wird von der Armee entlassen und in die Arbeitslosigkeit gezwungen. Soll das wirklich so laufen? Wer ist dafür verantwortlich? Und was wird getan?«
Er sah mich an.
»Bist du einverstanden? Ich kann dich natürlich nicht selbst interviewen, weil wir verwandt sind, aber ich könnte einem anderen einen Tipp geben. Das ist eine gute Sache. Und es ist wichtig. Die Arbeitslosenzahlen sind im Moment ja verflucht hoch.«
»Ich glaube eher nicht«, sagte ich. »Wenn ich will, kann ich bestimmt einen Job finden. Außerdem habe ich keine Lust, wie ein Opfer dazustehen.«
»Aber das ist doch nicht deine Schuld! Jetzt komm schon, Syvert. Du bist arbeitslos, das ist eine Tatsache. Es macht doch nichts, wenn wir darüber berichten? Denk wenigstens einmal darüber nach.«
»Darüber nachdenken kann ich«, sagte ich und stand auf. »Aber es machen? Vergiss es.«
Er zuckte mit den Schultern.
»Dann sehen wir uns vielleicht irgendwo da draußen.«
»Das würde mich nicht wundern«, sagte er.
Ich stellte die Einkaufstüten in der Küche ab, damit Mutter die Lebensmittel einräumen konnte, und ging wieder hinaus, rollte die Sommerreifen vom Heuboden herunter, holte den Wagenheber aus der Garage und begann, die Reifen zu wechseln. Ich dachte an Vater. Das tat ich mittlerweile nur noch selten, aber an besonderen Tagen, an Weihnachten, dem Nationalfeiertag oder meinem Geburtstag, oder wenn etwas Besonderes passierte, wenn wir zum Beispiel unerwartet Besuch bekamen, oder wenn ich sozusagen aus einem neuen Winkel in das Vertraute eintrat wie jetzt, als ich zuerst in die Scheune und danach in die Garage gegangen war, wenn so etwas passierte, dann tauchte der Gedanke an ihn gelegentlich auf.
Der Wagenheber sank ein, zwei Zentimeter in den Schotter, der rund um den roten Metallfuß hochquoll. Es regnete nicht mehr, aber die Luft war immer noch feucht und der Himmel schwer; der Nebel hing grau zwischen den grünen Kiefern am Waldrand.
Als ich die Reifen auf der einen Seite gewechselt hatte und das Auto gerade auf der anderen anhob, hielt der Schulbus an der Kreuzung. Eine Minute später stand Joar mit glänzendem Parka und einer weißen Mütze, die er in die Stirn geschoben hatte, neben mir.
»Kannst du bitte die Reifen auf den Heuboden hochrollen?«, sagte ich.
Sein Gesicht strahlte, was er sofort zu verbergen versuchte.
»Ich bringe nur schnell den Ranzen rein«, sagte er und ging mit Schritten zum Haus, die mich ahnen ließen, dass sie gebremst wurden: Eigentlich wollte er rennen.
Den letzten Reifen wechselte er ganz allein, ich schraubte ihn nur fest, und anschließend gingen wir ins Haus, um zu essen.
Es würde Kabeljau geben, und die ganze Küche roch nach Fisch.
Mutter hob die Stücke mit dem Schaumlöffel aus dem Topf und auf die Platte, während Joar und ich uns hinsetzten. Die Schüssel mit den Kartoffeln stand schon dampfend auf dem Tisch, neben einer Platte mit gekochten Möhren und Blumenkohl.
»Was ist das Erste, woran du dich erinnern kannst?«, fragte Joar und schielte aus seinem gesenkten Gesicht zu mir hoch.
»Meine erste Kindheitserinnerung?«
»Was ist das Erste, woran du dich erinnerst?«, wiederholte er, fast gereizt.
Mutter setzte die Platte mit Fisch auf den Tisch und ging zur Spüle, um die Becher mit Wasser zu füllen.
»Ich weiß nicht, ob es die erste ist«, sagte ich. »Aber ich glaube, es ist, dass ich auf einer kleinen Hängebrücke stehe und auf und ab hüpfe, so dass sie schaukelt. Ich muss drei oder vier oder so gewesen sein.«
Ich sah zu Mutter hinüber.
»Erinnerst du dich? Dass wir irgendwo spazieren gegangen sind, wo es eine Hängebrücke gab?«
Sie schüttelte den Kopf und setzte sich.
»Bitte sehr«, sagte sie. »Bedient euch.«
»Kannst du es beschreiben?«, fragte Joar.
Ich legte ein Stück Fisch auf seinen Teller und eins auf meinen eigenen.
»Ich halte das Tau fest und hüpfe, und das Wasser rauscht unter den Brettern.«
»Wie sieht dein Gesicht aus?«
»Ich lächele. Ich freue mich total. Deshalb erinnere ich mich bestimmt daran.«
»Das heißt, du siehst dich selbst von außen?«
»Ja«, antwortete ich.
»Kann es dann eine Erinnerung sein?«, fragte er.
»Natürlich ist es eine Erinnerung«, sagte ich.
»Aber wir sehen uns selbst doch nicht von außen«, meinte er und hob die Zeigefinger an die Augen und markierte mit ihnen einen kleinen Kanal. »Wir sehen hinaus.«
»Das ist wahr«, sagte ich und stach das Messer zwischen das weiße Fleisch und die graue, sehnige Haut, die sich fast von selbst ablöste.
»Das heißt, du hast das, was eigentlich passiert ist, verändert.«
»Ja, hört sich ganz so an«, sagte ich. »Aber ich erinnere mich doch daran. Es ist also passiert. Ich sehe es nur von außen statt von innen. Das ist alles.«
Ich teilte das Stück und holte die Gräten heraus. Sie waren wie eine Art Prothese, die wie ein Fremdkörper in all dem Weichen lag.
»Wie kommt es, dass du darüber nachdenkst, Joar?«, fragte Mutter.
»Ich habe mich in einem Traum von außen gesehen«, sagte er. »Und da ist mir klar geworden, dass ich mich immer von außen sehe, wenn ich träume. Ich fand das irgendwie seltsam. Findet ihr nicht auch?«
»Doch, kann sein«, sagte Mutter.
»Siehst du dich von außen, wenn du träumst?«, fragte er.
»Ich habe keine Ahnung«, antwortete Mutter.
»Joar hat heute allein die Reifen gewechselt«, sagte ich.
»Nur einen«, sagte Joar.
»Toll«, sagte Mutter und lächelte eine Sekunde oder zwei, ehe ihr Gesicht wieder auf die Weise ernst wurde, die einen begreifen lässt, dass ihr Lächeln gespielt war.
Kurz nach halb sechs, als ich auf dem Bett lag und die neue Platte hörte, die ich in der Stadt gekauft hatte, Master of Puppets, näherte sich auf der Straße ein Auto. Mutter bekam abends nie Besuch, und von Joars Freunden würde keiner im Auto kommen, offensichtlich wollte also jemand zu mir.
Ich stand auf und ging zum Fenster. Es war ein Ascona, er hielt vor dem Haus und hupte.
»Syvert!«, rief Mutter von unten. »Gjert ist hier!«
Oh, verdammt.
Ich suchte Shorts, Trikot und Trainingsjacke aus dem Schrank heraus, eilte nach unten, holte die Fußballschuhe aus der Waschküche und ging zum Auto hinaus, dessen Motor lief.
»Ja, hallo«, grüßte Gjert, als ich die Tür öffnete und mich hineinsetzte.
»Ja, hallo«, sagte ich und zog den Sicherheitsgurt über die Brust, während er auf die Straße hinunterfuhr. Das Licht wanderte über den Heubodenaufgang, danach strömte es über das Feld und ließ die Schilder an der Hauptstraße schwach schimmern, ehe es sich über der Schotterstraße festsetzte.
»Du hattest es vergessen?«
»Ja.«
»Macht nichts. Ich habe heute mit Terje gesprochen, es ist okay, dass du kommst.«
»Schön«, sagte ich. »Aber hast du nicht gesagt, du hättest kein Auto? Das Ding hier ähnelt ziemlich eindeutig einem Auto?«
»Ehrlich gesagt habe ich es heute gekauft.«
»Wie viel hast du dafür bezahlt?«
»Fünftausend. Es hat auch eine Stereoanlage«, sagte er und lehnte sich vor, um sie einzuschalten. Das Armaturenbrett leuchtete auf, und im nächsten Moment donnerte die Musik in den Wagen.
»Der Klang ist ziemlich gut«, meinte er.
»Was lässt du da laufen?«
»Hörst du das nicht?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Accept. ›Balls to the wall‹.«
»Jetzt höre ich es«, sagte ich.
Als wir auf die Baracke zugingen, sah ich mehrere schattenhafte Gestalten, die unter den Bäumen auf dem Weg zum flutlichtbeleuchteten Ascheplatz gingen. Dort standen bereits fünf, sechs mit Mützen, Handschuhen und weiten Trainingsjacken und kickten Bälle zwischen sich hin und her.
»Wer legt eigentlich ein Training auf Freitagabend?«, fragte ich.
Gjert schüttelte den Kopf.
»Ja, es ist idiotisch. Es ist nicht einmal vorgekommen, dass alle da gewesen sind.«
Der fallende Regen war unsichtbar, nur im Flutlicht nicht, wo der leichte Wind die Tropfen wie ein Netz erscheinen ließ, das über den Platz geworfen wurde.
In der Kabine saßen Keith, Vegard, Karsten und Glenn und zogen sich an.
»Hallooo«, sagten sie, als sie mich sahen. »Der Elch ist zurück!«
»Der Elch läuft auf der letzten Felge«, sagte ich. »Ich bin seit Weihnachten keinen Meter mehr gelaufen.«
Ich zog Schuhe und Hose aus, setzte mich auf die Bank und beugte mich über den Beutel, fischte Shorts, Strümpfe und T-Shirt heraus.
»Bist du jetzt endgültig wieder zu Hause?«, fragte Glenn und sah hoch, er saß ansonsten vorgebeugt und band seine Schuhe zu, die schwarze Tolle hing ihm in die Augen.
Ich nickte.
»Er ist gestern entlassen worden«, sagte Gjert.
»Bist du?«, sagte Keith. »Dann willst du heute Abend feiern?«
»Ich weiß nicht recht«, antwortete ich. »Geht ihr weg?«
»Hat das Zebra Streifen?«, fragte Glenn zurück.
»Hat Karsten Klöten?«, sagte Keith und stand auf. Wir lachten, er grinste zufrieden und lief mit diesem leicht steifen Gang durch den Raum, den man annimmt, wenn man mit Schraubstollen unter den Füßen geht. Sie klackerten über den Boden.
»Ihr wisst ja, warum ich der Elch genannt werde?«, sagte ich. »Es liegt nicht daran, dass ich so große Schritte mache.«
»Hö, hö«, sagte Karsten und holte eine Dose mit Tigerbalsam heraus, womit er seine Oberschenkel einrieb. Der minzartige Geruch war stechend. Karsten wirkte im Sitzen gar nicht so groß, er hatte irgendwie das Gesicht eines kleinen Mannes, vielleicht auch das Auftreten, immer ein bisschen ausweichend und zurückhaltend, aber wenn er aufstand wie jetzt, kamen seine Länge und Breite zur Geltung. Er war zwei Meter groß und kräftig gebaut, und manchmal nannten wir ihn Dick, wohl auch, weil sein bester Freund seit der Grundschule Glenn war, oder eben Doof, der ziemlich klein und hager war, zumindest, wenn er neben Karsten ging.
Ich band die Schuhe zu, zog den Reißverschluss der Jacke hoch, sah zu Gjert hinüber, der in Shorts dasaß und mit langsamen Bewegungen seine Strümpfe auseinanderfaltete. Keiner brauchte so lange wie er, um sich umzuziehen. Und keiner hatte im Winter so viele Schichten Kleider an wie er.
»Ich gehe schon mal raus«, sagte ich. »Es hat ja keinen Sinn, auf dich zu warten.«
Er nickte ernst, sozusagen über eine größere Arbeit gebeugt. Ich stand auf und ging zusammen mit Vegard und Glenn und Karsten hinaus. Die Luft spannte auf den nackten Schenkeln. Hinter den im Licht aus den Fenstern im Nebel schimmernden Bäumen begannen wir zu laufen. Ich kannte den Trainer nicht, der die Mannschaft nach Weihnachten übernommen hatte, und blieb vor ihm stehen.
Er war noch recht jung, um die dreißig. Er hatte scharf geschnittene Gesichtszüge. Ein dünner Mund mit einem schmalen Bart darüber. Blasse Haut, glatte, schwarze Haare. Er sah eher aus wie jemand in einer Synth-Pop-Band als ein Fußballtrainer.
»Hallo«, sagte ich. »Ich heiße Syvert. Ich habe früher in der Jugendmannschaft gespielt und wollte fragen, ob ich heute Abend mittrainieren darf?«
Er nickte.
»Terje hat mir schon gesagt, dass jemand kommt. Wo spielst du normalerweise?«
»Mittelfeld«, antwortete ich.
»Okay«, sagte er.
Als Erstes trabten wir ein paar Runden um den Platz, dann absolvierten wir fünf Minuten lang kurze Intervallläufe, ehe wir ein paar Bahnen über den ganzen Platz rannten. Am Ende war ich kurz davor, mich zu übergeben, und als wir anfingen, fünf gegen fünf zu spielen, waren meine Beine so weich und zittrig, dass ich kaum fähig war, einen Pass zu schlagen. Nach einer Weile erholte sich mein Körper jedoch, und ich schaffte es, passabel mitzuspielen.
Ich merkte, dass ich es vermisst hatte, alles daran. Die Reflexwesten, die Plastikkegel, das Flutlicht, den Aschenplatz, den ständigen Wechsel dazwischen, ein eigenes Spiel aufzubauen und das des Gegners zu stören, die unterschiedlichen Spielertypen, die es ganz unabhängig vom Niveau in allen Mannschaften gibt. Das Atmen, die Körper, die gegeneinanderprallten, der fallende Regen, die ballfordernden Rufe, die Warnungen, die Gesten, wenn jemand ein Tor schoss, ironische, triumphierende, abwinkende.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: