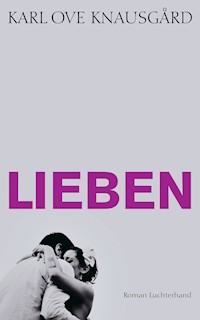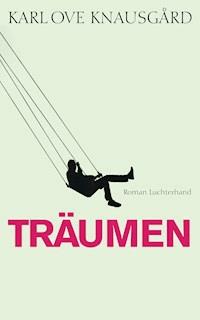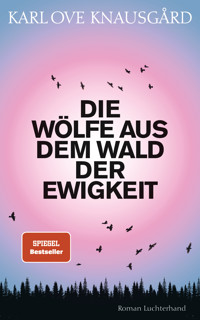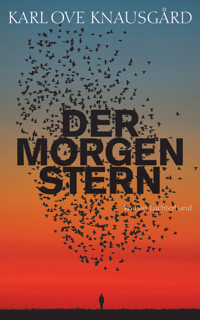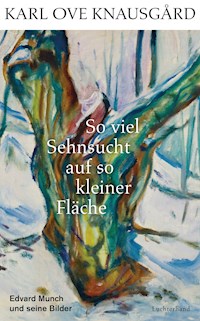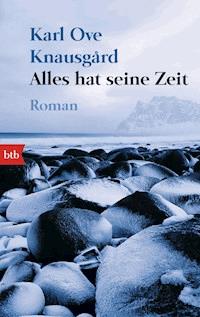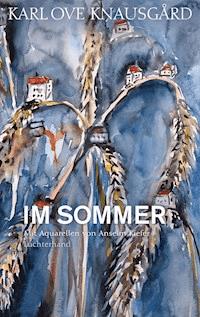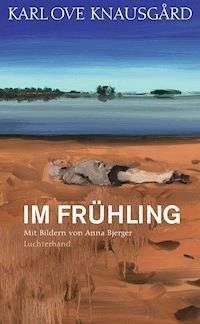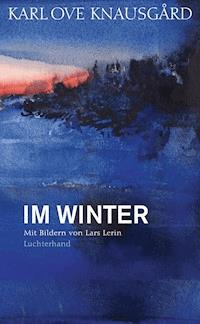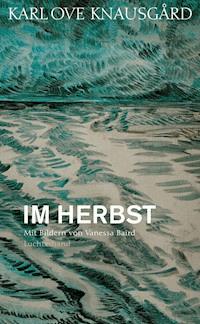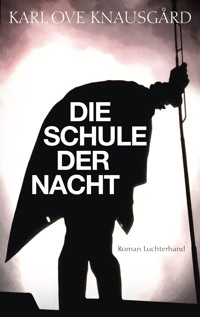
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was geschieht, wenn der Mensch sich aller Moral entledigt und nur noch um sich selbst kreist? Über die Kräfte, die uns formen, sowohl die dunklen als auch die hellen.
Eine winzige Insel vor der norwegischen Küste: Kristian Hadeland, erfolgreicher Künstler mit einer Karriere in London und einer bevorstehenden Retrospektive am MoMa in New York, hat sich in die Abgeschiedenheit zurückgezogen. Er will seinem Leben ein Ende setzen. »Tod und Vergänglichkeit«, das war das große Thema seines fotografischen Werks, mit dem er sich über sämtliche Regeln hinwegsetzte und in der Kunstwelt für Furore sorgte. Für diesen Ruhm ist er einen faustischen Bund eingegangen. Jetzt steht er vor den Trümmern eines rücksichtslosen Lebens und bittet um Erlösung. Möglicherweise vergeblich.
Karl Ove Knausgårds neuester Roman »Die Schule der Nacht« ist Teil der großangelegten Morgenstern-Serie, die LeserInnen und KritikerInnen in der ganzen Welt begeistert. Ausgangspunkt ist das plötzliche Erscheinen eines neuen Sterns am Himmel, der unheimliche Kräfte freisetzt, sämtliche physikalische Regeln sprengt und die Menschen auf ihr Innerstes zurückwirft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 854
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Was geschieht, wenn der Mensch sich aller Moral entledigt und nur noch um sich selbst kreist?
Eine winzige Insel vor der norwegischen Küste: Kristian Hadeland, erfolgreicher Künstler mit einer Karriere in London und einer bevorstehenden Retrospektive am MoMA in New York, hat sich in die Abgeschiedenheit zurückgezogen. Er will seinem Leben ein Ende setzen. »Tod und Vergänglichkeit«, das war das große Thema seines fotografischen Werks, mit dem er sich über sämtliche Regeln hinwegsetzte und in der Kunstwelt für Furore sorgte. Für diesen Ruhm ist er einen faustischen Bund eingegangen. Jetzt steht er vor den Trümmern eines rücksichtslosen Lebens und bittet um Erlösung. Möglicherweise vergeblich.
Karl Ove Knausgårds neuester Roman »Die Schule der Nacht« ist Teil der großangelegten Morgenstern-Serie, die LeserInnen und KritikerInnen in der ganzen Welt begeistert. Ausgangspunkt ist das plötzliche Erscheinen eines neuen Sterns am Himmel, der unheimliche Kräfte freisetzt, sämtliche physikalische Regeln sprengt und die Menschen auf ihr Innerstes zurückwirft.
Autor
KARLOVEKNAUSGÅRD wurde 1968 geboren und gilt als einer der wichtigsten norwegischen Autoren der Gegenwart. Die Romane seines sechsbändigen autobiographischen Projektes wurden weltweit zur Sensation. Sie sind in 35 Sprachen übersetzt und vielfach preisgekrönt. 2015 erhielt Karl Ove Knausgård den WELT-Literaturpreis, 2017 den Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur, 2022 den Hans-Christian-Andersen-Literaturpreis. Er lebt mit seiner Familie in London.
KARL OVE KNAUSGÅRD
DIE SCHULE DER NACHT
Roman
Aus dem Norwegischen von Paul Berf
Luchterhand
Die norwegische Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »NATTSKOLEN« im Forlaget Oktober, OsloDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Die Übersetzung wurde von NORLA, Oslo, gefördert. Der Verlag bedankt sich sehr herzlich dafür.
Copyright © der Originalausgabe 2023 Forlaget Oktober, Oslo
© der deutschsprachigen Ausgabe 2025 Luchterhand Literatur Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR)
Lektorat: Regina Kammerer
Umschlaggestaltung: buxdesign | München nach einem Entwurf von Greger Ulf Nilson unter Verwendung einer Fotografie von © Thåström, 2020 by Tommy Ericsson
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-32412-4V002
www.luchterhand-literaturverlag.de
facebook.com/luchterhandverlag
Für meinen Bruder, Yngve
Die Uhr wird schlagen.
ERSTER TEIL
Es gibt keinen Grund, sich vor dem Tod zu fürchten – wenn es dich gibt, gibt es ihn nicht, und wenn es ihn gibt, gibt es dich nicht. So oder so ähnlich formulierte es einst Epikur. Es ist so, stelle ich es mir immer vor, als teilte man sich eine Wohnung mit einem Mieter, den man niemals sieht. Die Wohnung hat zwei Zimmer mit zwei Türen. Geht man durch die eine Tür, tritt der Mieter durch die andere. Man kann hören, wie er dort herumkramt, aber geht man hinein, geht er dorthin, wo man gerade war, und beschäftigt sich in diesem Raum. So führen wir unsere Leben, mit dem Tod gleich nebenan. Begegnen wir ihm eines Tages in der Tür, ist es aus. Das Raffinierte daran ist, dass wir nie wissen, wann es passiert, nur, dass es früher oder später passieren wird. Natürlich können wir, wenn wir wollen, unser Schicksal auch selbst in die Hand nehmen und die Begegnung herbeiführen.
Genau das habe ich vor.
Der Ton in dem wenigen, was ich soeben geschrieben habe, lässt es so klingen, als wäre es für mich etwas Leichtes und Unverbindliches – eine Wohnung, eine Begegnung mit einem Mieter –, aber die Leichtigkeit liegt in der Sprache, nicht in mir. Wenn ich formulieren könnte, was ich empfinde, während ich hier sitze, die Verzweiflung, die an mir reißt und zerrt, Tag und Nacht, die abgrundtiefe Dunkelheit, würde man es verstehen, aber das kann ich nicht, denn in der Sprache selbst liegt Hoffnung, in der Sprache selbst ist es hell. Die Nacht, sie ist sprachlos. Und die Sprache richtet sich immer an einen anderen. In Sprache Einsamkeit zu vermitteln, ist deshalb unmöglich. Wo Einsamkeit ist, ist die Sprache nicht, wo Sprache ist, ist die Einsamkeit nicht.
Ich bin also mit anderen Worten »einsam«. Und ich werde mir das Leben »nehmen«.
Vorher werde ich jedoch das hier schreiben. In den kommenden Monaten werde ich jeden Tag in dem Zimmer oben aufwachen, nach unten gehen, Kaffee kochen und dann Platz nehmen, an dem Schreibtisch am Fenster, auf den kleinen Hafen hinausschauen, und dahinter auf das Meer – in dieser Jahreszeit ist es meist grau und schwarz –, Kaffee trinken, rauchen und an dieser Geschichte schreiben, bis sie abgeschlossen ist. Warum, weiß ich nicht recht. Hängt es damit zusammen, dass alles, was geschieht, einfach ins Nichts verschwindet und die Geschehnisse dadurch in gewisser Weise sinnlos werden? Damit, dass sie sich völlig nutzlos ereignen. Bringt man sie zu Papier, existieren sie zumindest an einem Ort. Wer eventuell lesen möchte, was ich schreibe, interessiert mich nicht. Vielleicht du, Emil, weil dir das Haus gehört, das ich mir in diesen Wochen heimlich ausleihe. Sollte es so sein, hoffe ich, du kannst mir verzeihen – ich denke hoffentlich daran, aufzuräumen und zu putzen, so dass du das Haus in einem besseren Zustand vorfindest, als du es verlassen hast. Vielleicht bist du es, Jelena – dann musst du nicht weiterlesen: Du weißt, was kommt. Vielleicht bist du es, der Polizist, der hier seine Arbeit macht und das Haus durchsucht, nachdem ihr meinen toten Körper gefunden habt, der irgendwo in der Nähe an Land gespült wurde. Oder draußen auf dem Meer vor sich hin treibend, entdeckt von Fischern oder einem Seemann auf einem der großen Frachter, die an der Küste entlang hin- und herfahren, und die ich täglich durchs Fenster sehe. Ich weiß es nicht, und es interessiert mich auch nicht. Ich schreibe dies für mich selbst. Oder auch »mich selbst«. Die beiden Wörter, die alles enthalten sollen, was wir waren, alles, was wir sind, und alles, was wir sein werden. In diesem Moment, während ich hier sitze, bin ich nur ein Bruchteil davon, vielleicht nur ein Prozent, während der Rest, der ganze Krempel, in meinen Zellen gelagert liegt. Manches davon kann ich selbst aktivieren, das nennt man Erinnerung, während das meiste kommt und geht, wie es will. So geht es allen, wahrscheinlich auch den Katzen und Hunden. Als Lebewesen sind sie uns überlegen – nicht nur, weil viele ihrer Sinne höher entwickelt sind als die unseren, darüber hinaus war es auch ein evolutionärer Geniestreich von ihnen, die Entwicklung des Bewusstseins bei der Feststellung Ich bin hier zu stoppen, und nicht, wie wir es leider getan haben, bis zur Frage nach dem Warum weiterzumachen.
Prokrastination nennt man das. Ich will nicht denken, ich will nicht wissen, ich will nicht verstehen. Aber ich muss. Oder nicht?
Doch.
Ich will nicht darüber schreiben, was mir widerfahren ist. Aber ich will auch nicht sterben, bevor ich es getan habe.
Und wo soll ich anfangen?
Vielleicht am Anfang?
*
Dem Namen Christopher Marlowe begegnete ich zum ersten Mal im August 1985, in jenem Sommer, in dem ich nach London ging, um dort an einer Kunstakademie, die mich überraschenderweise angenommen hatte, Fotografie zu studieren. Ich wusste so gut wie nichts über englische Kultur, außer dem Bereich, der mit Musik zu tun hatte, und so ziemlich das Erste, was ich tat, war deshalb, zu der großen, alten Buchhandlung Foyles in der Charing Cross Road zu gehen und die Taschenbuchausgaben von zehn britischen Gegenwartsromanen zu kaufen sowie Shakespeares gesammelte Werke und ein Buch über Kreativität. Ich begann mit Shakespeare, aber seine Dramen erwiesen sich als nahezu undurchdringlich für mich, so dass ich einige Tage später zu Foyles zurückkehrte und eine Biografie über den Mann und ein Buch über die Zeit erwarb, in der er lebte, um zu schauen, ob sie sein Werk zugänglicher machen konnten. Ich steckte die Bücher in den Rucksack und ging durch die Straßen dessen, was, wie ich heute weiß, der Stadtteil Bloomsbury war, und weiter nach Camden Town, wo ich mich vor einem Pub niederließ, ein Bier bestellte und anfing, willkürlich in der Biografie zu blättern. Als ich dabei zum ersten Mal den Namen Christopher Marlowe las, schaute ich auf und mein Blick fiel im selben Moment auf einen großen Lieferwagen, auf dem in grüner Schrift auf weißem Grund Marlowe Removals stand. Damit nicht genug, las ich als Nächstes, dass dieser Marlowe in Deptford getötet worden war – dem Stadtteil, in den ich nur ein paar Tage zuvor gezogen war … Jemand gab mir einen Hinweis, den ich nicht verstand. Ich schlug lediglich das Buch zu, schob es in den Rucksack und trottete in nördliche Richtung weiter, in dieser gigantischen Metropole, in der ich mich niedergelassen hatte.
Der Unterricht begann erst drei Wochen später, und ich kannte niemanden, deshalb kaufte ich mir ein Fahrrad und begann, die nähere Umgebung zu erkunden. Gleichzeitig machte ich eine Menge Fotos, zweifelte aber konstant daran, ob ich wirklich auf dem erforderlichen Niveau für die Akademie war. Die Bude, die ich mietete, war klein und spärlich möbliert – eine Schlafcouch und ein Schreibtisch und ein Bücherregal –, so dass ich dort möglichst wenig Zeit verbrachte. Die nähere Umgebung war auch nicht gerade ansprechend – die Gegend entlang des Flusses war ein heruntergekommenes Industriegebiet voller verlassener Gebäude, Fabrikschornsteine, eingeschlagener Scheiben, Haufen von Backsteinen und Fachwerkbalken von Gebäuden, die man abgerissen hatte, ohne neue zu errichten. Holpernde Lastwagen mancherorts, Schrotthändler, und wo die Vegetation ein wenig Grün im ansonsten Farblosen beisteuerte, lag immer auch Müll. Die Geschäfte an den Straßen weiter weg vom Fluss waren ärmlich und führten sehr unterschiedliche Artikel, bei denen ich mir einbildete, dass sie in die sechziger Jahre gehörten, und die ich selbst noch nie gesehen hatte, an manchen hingen Schilder über der Tür, die aussahen, als stammten sie aus dem vorigen Jahrhundert oder zumindest aus den zwanziger oder dreißiger Jahren. Cafés mit handgeschriebenen Tafeln und gehäkelten Gardinen in den Fenstern, ein Bäcker, eine Metzgerei, in der die Verkäufer weiße, blutbefleckte Schürzen trugen. Mitten in diesem altertümlichen Milieu lag ein cooler Plattenladen, klein, aber mit guten Sachen. Solid Cut hieß er, und in den ersten Wochen gab ich dort einige Pfund aus. Es gab auch Geschäfte aus anderen Ländern, ich tippte auf Afrika – eines von ihnen verkaufte Perücken und Zöpfe und farbenfrohe Stoffe, und ich fotografierte es von außen. Ich hätte mir durchaus vorstellen können, einzutreten und im Ladeninneren Bilder zu machen, verzichtete aber darauf, da ich noch zu wenig darüber wusste, welche Regeln dort galten.
Abends saß ich in nahegelegenen Pubs, an denen kein Mangel herrschte, trank Bier und las. Sie waren ausnahmslos verraucht, und die Einrichtung stammte aus vergangenen Zeiten. Die Menschen darin lachten mehr, als ich es von daheim gewohnt war, und die Angestellten nannten ihre Kunden love. Von dem England, das ich aus NME und Sounds kannte, war nur wenig zu sehen – vereinzelt liefen Typen in Mänteln und mit coolen Haaren vorbei, ab und zu saßen ein, zwei Goths in einem Pub, und es kam vor, dass sie Jam oder U2 oder Alarm spielten – einmal hörte ich »Into the Valley«, mit den Skids und ein anderes Mal »Teenage Kicks« mit den Undertones –, aber das hatte vermutlich mit diesem Teil der Stadt zu tun, denn sowohl in Camden als auch in Soho wäre die Atmosphäre eine völlig andere gewesen.
Es ist wirklich seltsam, ein paar Abende hintereinander am selben Ort, und man erkennt die Leute wieder, manche nicken einem vielleicht zu, man kommt ins Gespräch, und wenn das mehrmals passiert, seid ihr auf einmal Freunde, vielleicht sogar fürs Leben, ohne dass etwas ausgemacht oder eine Entscheidung getroffen worden wäre. Hans, einen zehn Jahre älteren holländischen Künstler lernte ich in diesen Tagen auf die Art kennen. Er war nicht der einzige Künstler in der Gegend, wie ich bald erkannte; sie war so ärmlich, dass die Leute es sich leisten konnten, dort Ateliers zu mieten und zu wohnen. Es waren viele Drogen im Umlauf, jedenfalls im Vergleich zu dem, was ich gewohnt war, und es gab reichlich Träume, die im Sand verliefen oder radikal zurechtgestutzt wurden. Selbst willensstarke Persönlichkeiten wurden manchmal innerhalb von ein, zwei Jahren zu fast nichts abgewetzt. Wovon, konnte man sich fragen. Welche Kräfte sind stark genug, um Menschenleben abzuschleifen? Die biologische Seite des Ganzen ist schon okay, zwischen zwanzig und dreißig beginnen wir, körperlich zu verfallen, dieser Prozess tickt in uns allen. Aber die psychologische Erosion, wovon wurde sie gesteuert? Vom Schicksal natürlich. Von all den tausend Zufällen, die einen ausgerechnet dorthin führen, ausgerechnet zu ihnen, wo der Wille, die Träume und die Fähigkeiten auf das stoßen, was dort ist. Und deshalb wird die künstliche Intelligenz, die KI, niemals so denken können wie wir. Auch wenn Maschinen lernfähig sind und sich von Erfahrungen verändern lassen, sind die Parameter rational, so dass Maschinen unabdingbar und für alle Zeit außerhalb der tiefen, langsamen Schichten der Wirklichkeit stehen werden, in denen sich das Schicksal bewegt, und deshalb werden sie auch immer außerhalb von uns stehen. Selbst eine so simple Sache wie, eine willkürliche Zahl zu nennen, erweist sich für die Maschinen als schwierig, denn ganz gleich, was man machte, es gab immer ein Programm im Hintergrund, das den Algorithmus definierte und den Zufall aufhob. Die Lösung bestand darin, die Maschinen mit anderen, chaotischen Systemen in der Natur zu verknüpfen und die Auswahl davon bestimmen zu lassen, was dort geschah. Aber die Frage von Zufall und Schicksal erweist sich für künstliche Intelligenzen als andersartig und wesentlich komplexer, denn im Menschlichen ist das Zufällige häufig aufgeladen mit Sinn und liegt jenseits unserer Kontrolle, und oft auch jenseits unseres Verständnisses. Wie soll man Maschinen Zugang zu etwas verschaffen, von dem wir selbst nicht wissen, was oder wo es ist?
Jetzt höre ich mich an wie Hans. Maschinen, die reden und mit der Welt interagieren, das war seine Domäne. Als wir uns das erste Mal unterhielten, hatte ich davon natürlich keine Ahnung. Und im Grunde konnte er auch keine haben – im Spätsommer 1985 waren denkende Maschinen nichts als ein wüster Traum. Aber in Gedanken war er schon dort, an der Kreuzung zwischen Biologie und Technik.
Er war mir an einem der Abende aufgefallen, ein großer, hagerer Mann mit üppigen Haaren von unbestimmbarer Farbe, mit kantigem Kinn und schmalen Augen, in einer verwaschenen Jeans, die früher einmal schwarz gewesen sein dürfte, mit zu kurzen Hosenbeinen, und in einem dünnen, blauen, selbstgestrickten Pullover mit grünem Muster. Er war einen Kopf größer als alle anderen im Raum, und vermutlich fiel er mir deshalb auf, aber auch, weil er so laut redete, als er mit seinen Freunden Billard spielte, die mit der Lautstärke deutlich sorgsamer umgingen, und weil seine Bewegungen so achtlos waren. Ich dachte, dass er offensichtlich betrunken war, seine Freunde dagegen nicht. Außerdem sah er ein bisschen dumm aus. An jenem Abend las ich einen der englischen Romane, die ich mir gekauft hatte, als vor mir plötzlich eine Stimme sagte:
»Bist du gerade erst hergezogen?«
Ich schaute auf, und vor mir stand dieser lange Schlacks.
»Wie kommst du darauf?«
»Hierher verläuft sich kein Tourist, und zu Besuch bist du auch nicht, denn dann würdest du hier nicht allein herumsitzen und lesen. Außerdem habe ich dich hier noch nie gesehen. Also bleibt im Grunde nur noch eine Möglichkeit. Woher kommst du?«
»Aus Norwegen.«
»Ach, wirklich? Interessierst du dich für Eisschnelllauf?«
Als ich nicht Nein sagte, sondern nur mit den Schultern zuckte, fragte er, ob er mir ein Bier ausgeben dürfe. Normalerweise hätte ich dankend abgelehnt, es war nicht meine Art, Fremde zu umgarnen, aber ich hatte tagelang mit niemandem gesprochen und war es leid zu lesen und dachte deshalb, dass es nicht schaden könnte, und kurz darauf saß er an meinem Tisch, beide Hände, die groß waren, um das Bierglas gelegt, und wollte wissen, was ich über norwegische Eisschnellläufer wusste. Als ich klein war, hatte ich an vielen Wintertagen mit Vater vor dem Fernseher gesessen und Eisschnelllaufmeisterschaften gesehen, aber ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, dass es mich geprägt hatte. Natürlich wusste ich von den vier S, erinnerte mich aber nur an zwei von ihnen – Sten Stensen und Kay Stenshjemmet.
»Merkwürdig, dass du dich ausgerechnet an Stensen erinnerst«, meinte er. »Er war ja der blasseste von ihnen und Langstreckenspezialist, so dass er praktisch keinen Mehrkampfwettbewerb mehr gewann, als die anderen den Durchbruch schafften. Gehörst du zu denen, die immer zum Underdog halten?«
»Ich halte in der Regel zu niemandem.«
»Die beiden anderen sind Jan Egil Storholt und Amund Sjøbrend. Sjøbrend ist interessant. Er wird immer unterschätzt. Er hatte eine fantastische Technik, sie war viel besser als die der anderen. Seine Winkel waren nahezu perfekt, keiner lief die Kurven wie er, sein Timing war stets grandios. Aber er gewann nicht besonders oft. Warum nicht, wenn seine Technik so einzigartig war, wie ich sage?«
Er sah mich mit einem intensiven Blick an.
»Keine Ahnung«, antwortete ich so desinteressiert, wie es nur ging, in der Hoffnung, das würde ihn ein wenig bremsen.
»Er hatte Pech. Weißt du, manche Menschen haben seltsamerweise mehr Pech als andere.«
»Ja«, sagte ich und trank einen großen Schluck Bier aus dem Glas, das er vor mir auf den Tisch gestellt hatte. Es war gratis, aber nun erschien mir der Preis auf einmal sehr hoch.
»Alle Sportarten im Freien enthalten Elemente von Unberechenbarkeit, erst recht im Wintersport. Es ist Zufall, ob es schneit, wenn du den Skihang hinunterfährst, oder ob die Sicht gut ist. Beim Eisschnelllauf wechselt nicht nur das Wetter, sondern auch die Eisqualität. Aber damit ist es demnächst vorbei. Bei uns zu Hause bauen sie gerade eine Eissporthalle. Sie soll nächstes Jahr eingeweiht werden. Das wird den Sport revolutionieren. Dann wird es interessant.«
Er machte eine Pause und wollte wohl, dass ich ihn fragte, warum.
»Ich finde Eisschnelllauf ziemlich monoton und langweilig«, sagte ich. »Es ist immer das Gleiche.«
»Genau!«, erwiderte er. »Und jetzt wird das Ganze also noch gleichförmiger. Du musst dir den Eisschnelllauf als ein geschlossenes System vorstellen, in dem die Parameter das Eis, die Bahn, die Schlittschuhe und die Gesetze der Physik sind. Früher waren die Bahn und die Schlittschuhe feste Größen, und die Gesetze der Physik sind bekanntlich in Stein gemeißelt, während Eis und Wetter unbestimmt sind. Sobald der Sport in die Halle umzieht, werden auch sie zu festen Größen, und daraufhin wird es eine annähernd optimale Art geben, die Sportart auszuüben – man könnte sich zum Beispiel einen Eisschnelllaufroboter vorstellen, der alle Kurven optimal läuft, perfekt ausbalanciert zwischen dem Tempo, seinem Gewicht und den Fliehkräften. So wird der Läufer selbst zum einzigen unbestimmten Faktor. Er ist geprägt von seiner biologischen Unbändigkeit. Das macht jeden Lauf zu einem Kampf zwischen der Unvollkommenheit der Biologie und der potentiellen Vollkommenheit des Systems. Aber was ist das Vollkommene? Was ist das Optimale? Warum gibt es einen Punkt, der nicht überschritten werden kann? Noch interessanter ist vielleicht, dass wir fähig sind, Maschinen zu bauen, die das Optimale erreichen können, während wir selbst dies nicht können. Der Eisschnelllauf zeigt den Kampf, nein, er ist der Kampf zwischen dem Menschen und den Kräften, in deren Gewalt wir sind. Und der, mein Freund, ist weder monoton noch langweilig!«
»Ich merke, dass du darüber gründlich nachgedacht hast«, sagte ich. »Es kann in London nicht viele geben, mit denen man sich über Eisschnelllauf unterhalten kann.«
»Mehr als du denkst«, sagte er. »Aber es stimmt schon, viele sind es nicht.«
»Und was machst du hier in der Stadt?«
»Ich bin fleißig. Was ist mit dir?«
»Ich studiere Fotografie.«
»Oh!«, sagte er und begann augenblicklich, über die Fotografie als Medium zu sprechen. Er interessierte sich nicht für die Bilder, sondern für die Technik an sich. Es war eine Tirade; die Worte kamen so schnell, dass ich unmöglich etwas einwerfen konnte. Als er eine Viertelstunde später aufstand, wusste ich von ihm nur, dass er Hans hieß, aus den Niederlanden stammte und eine Theorie über den Eisschnelllauf entwickelt hatte. Und ich wusste ein wenig über seine Persönlichkeit. Dass er so dumm war, wie er aussah, hatte er widerlegt. Er war der Typ Mensch, der gern andere belehrte, gern Vorträge hielt, gern als jemand dastehen wollte, der ein Denker war, am liebsten ein etwas unorthodoxer. Er hielt sich für interessanter, als er war – aber das galt natürlich für fast alle. Kannte ich jemanden, der sich selbst uninteressant fand?
Nein. Diejenigen, die nicht so viel verstanden, verstanden auch nicht, dass sie nichts verstanden, und waren mit dem Wenigen zufrieden, das sie verstanden, was für sie alles war. In dieser Hinsicht war der Mensch weise beschaffen.
In den Wochen vor Unterrichtsbeginn sah ich Hans noch einige Male, wir grüßten uns und wechselten ein paar Worte, aber ich hatte kein Interesse an einem erneuten Vortrag, und er ergriff nicht noch einmal die Initiative, und als es Herbst wurde, war er fort. Es fiel mir nicht weiter auf, er war nur ein Typ, mit dem ich mich ein einziges Mal unterhalten hatte, und die Kunstakademie nahm meine ganze Zeit und Kraft in Anspruch. Erst als ich ihn wiedersah, es muss Mitte Dezember gewesen sein, im selben Pub, fiel mir ein, dass es ihn gab.
»Wie läuft es mit dem Fotografieren?«, fragte er.
»Es läuft gut.«
»Kann ich mal sehen?«
»Was sehen?«
»Deine Bilder.«
Ich sah ihn erstaunt an. Er deutete ein Lächeln an, griff sich ans Kinn.
»Warum willst du sie sehen?«
Er zuckte mit den Schultern.
»Ich interessiere mich für Fotografie. Wo hast du sie?«
»Ein paar in der Akademie. Ein paar zu Hause.«
»Sind sie groß?«
»Nein, nein.«
»Kannst du mich nicht in meinem Atelier besuchen und sie mitbringen? Dann kannst du dir auch gleich meine Sachen anschauen, wenn du schon einmal da bist.«
»Sicher«, sagte ich, einigermaßen perplex angesichts all der Stufen, die er übersprungen hatte. Ich war zudem überrascht, dass er ein Atelier hatte und folglich Künstler sein musste – nichts an ihm hatte meine Gedanken in diese Richtung gelenkt. Doch am folgenden Freitag legte ich vorsichtig einen Stapel Fotos, die ich ausgewählt hatte, in einen Karton, verpackte ihn in Plastik – es regnete in Strömen – und steckte das Paket in meinen Rucksack, ehe ich Regenklamotten und Stiefel anzog und das Fahrrad auf die Straße hinuntertrug. Sein Atelier lag auf dem Weg nach Peckham, nicht mehr als eine Viertelstunde entfernt. Es war dunkel, es schüttete, und auf der gesamten Strecke war viel Verkehr. Autos glänzten in den Scheinwerfern der Wagen, die sich dahinter befanden, wütendes Hupen, aufheulende Motoren, rote Rücklichter wie Laternen in einem See aus Asphalt und Dunkelheit. Es war herrlich, einfach an ihnen vorbeizugleiten und zu spüren, wie der Regen auf mein Gesicht schlug, sämtliche Geräusche waren durch die Kapuze der Regenjacke dumpf und wie unter Wasser.
Das Atelier sei schwer zu finden, hatte er erklärt, deshalb waren wir in einem Café auf der anderen Seite des Bahnhofs verabredet. Offenbar hatte er mich durchs Fenster gesehen, denn er kam heraus, als ich gerade das Fahrrad abschloss.
»Kristian«, sagte er. »Hast du die Bilder dabei?«
Ich nickte und schlug zwei Mal mit der Hand auf den Rucksack auf meinem Rücken.
»Wollen wir sofort los? Oder möchtest du vorher noch einen Kaffee trinken?«
»Wir können gehen. Ist es weit?«
»Zehn Minuten.«
Unterwegs erzählte er mir, dass er in meinem Alter nach London gekommen und ebenfalls »Fotograf« gewesen war – er zeichnete mit den Fingern Anführungszeichen, als er dies sagte – und dass er eigentlich nur geplant hatte, ein paar Wochen hier zu bleiben, auf der Couch eines Kameraden, aber er sei von der Stadt verhext worden – das waren seine Worte – und geblieben.
»Fotografierst du noch?«, fragte ich, als ich das Fahrrad neben ihm schob. Die Kapuze hatte ich abgezogen, um hören zu können, was er sagte, meine Haare waren bereits klatschnass.
Er schüttelte den Kopf.
»Und was für Bilder hast du gemacht?«
»Bilder.«
»Du meinst ›Bilder‹«, sagte ich und wiederholte seine Anführungszeichen.
»Schön zu sehen, dass du mich verstehst«, erwiderte er und lachte.
Ich hatte mich natürlich gefragt, warum er darum gebeten hatte, meine Fotos sehen zu dürfen, und ganz generell, was er eigentlich von mir wollte – wir waren weiß Gott keine Freunde, kaum Bekannte –, aber dass er selbst fotografiert hatte und in meinem Alter nach London gekommen war, erklärte so einiges. Außerdem verband uns, dass wir beide Ausländer waren.
Wir bogen in eine kleine Seitenstraße ein, in der die endlose Reihe von Backsteinhäusern abbrach. Um uns herum standen schäbige Gewerbegebäude, von Maschendrahtzäunen umgeben, mit Gras und Büschen, die überall dort wucherten, wo sie den Raum dazu fanden.
»Da sind wir«, sagte er nach etwa hundert Metern und blieb vor etwas stehen, das früher offenbar eine Autowerkstatt gewesen war. Ein metallenes Garagentor voller Graffiti, weiße Backsteinwände mit abblätternder Farbe. Ich wollte das Fahrrad abschließen, aber er winkte ab.
»Nimm es mit rein.«
Er schloss eine Tür an der Kopfseite auf, schaltete das Deckenlicht ein. Es war tatsächlich eine Werkstatt. Mitten im Raum gab es noch eine Arbeitsgrube. Am anderen Ende führte eine Treppe zu einem Raum hinauf, der ein Fenster zur Halle hatte und früher wahrscheinlich ein Büro gewesen war.
»Ganz schön groß«, sagte ich. »Ist das alles deins?«
»Es gehört mir nicht, falls du das meinst. Aber ich bin der Einzige, der die Räume nutzt. Möchtest du einen Drink?«
»Ja, klar.«
»Setz dich«, sagte er und nickte zu ein paar Möbeln an der Wand. Ein altes Sofa, ein Tisch und ein Stuhl. Daneben standen in einer Reihe drei Eimer, in die Tropfen von der Decke klatschten.
Während er hinter der Arbeitsgrube durch eine Tür verschwand, zog ich die Regenklamotten aus, hängte sie über das Fahrrad und holte das Paket mit den Fotos heraus. Ich hielt es in der Hand, als er mit zwei Flaschen und zwei Gläsern zurückkam, die er auf den Tisch stellte.
»Du zuerst oder ich?«, fragte er, während er Schnaps in die Gläser einschenkte. Ich nahm jedenfalls an, dass es Schnaps war; die Flasche hatte kein Etikett.
»Das spielt keine Rolle.«
Er füllte die Gläser mit einer Flüssigkeit auf, die rosa war, und reichte mir ein Glas. Wir stießen an. Der Schnapsgeschmack war intensiv und brannte im Hals.
»Ich mache ihn selbst.«
»Wirklich? Das schmeckt man gar nicht.«
»Ja, ich weiß. Ich habe viele Jahre Erfahrung. Lass mal sehen, was du hast.«
Ich setzte mich auf das Sofa und zog das Plastik ab, danach den Deckel und das halb transparente Deckpapier.
»Man könnte meinen, du hast eine Reliquie mitgebracht«, sagte er. »Sind dir deine Bilder heilig?«
»Ach was«, sagte ich und spürte, wie ich rot wurde. Bis zu diesem Moment hatte es mir nichts bedeutet, was er zu den Bildern sagen oder nicht sagen würde. Jetzt fürchtete ich mich plötzlich davor, dass sie ihm nicht gefallen könnten.
Ich reichte ihm den Stapel.
»Wo ist die Toilette?«
»Es ist die Tür da vorn«, antwortete er und nickte zur Kopfwand hin.
Warum sollte mir seine Meinung wichtig sein, dachte ich beim Pinkeln. Die Toilette war klein wie ein Verschlag, und es gab kein Handtuch, so dass ich einen langen Streifen Toilettenpapier abzog und mir die Hände damit abtrocknete. Meine Bilder waren gut, und sie würden nicht schlechter werden, nur weil er es sagte.
Als ich wieder zurückkam, lagen sie in einem Haufen vor ihm auf dem Tisch.
»Die sind schön«, sagte er.
»Ja?«
»Ja. Du kannst was.«
Aus seinem Mund klang es wie eine Beleidigung. Ich griff nach dem Stapel und blätterte darin. Ich hatte Bilder von verschiedenen Menschen an den exakt selben Orten gemacht. So saßen zum Beispiel fünf Personen auf dem Stuhl in meiner alten Bude – Helene, Mutter, Filip, Joachim und Elise – fünf lagen nackt in meiner Badewanne, fünf saßen am Küchentisch und so weiter. Sie saßen oder lagen auf die gleiche Weise, trugen sogar die gleichen Kleider, wodurch alles gleich war, nur die Gesichter nicht. Es war die Serie, auf Grund der man mich an der Akademie angenommen hatte.
Ich legte die Bilder auf Kante, hüllte sie in das Deckpapier und steckte sie in den Karton. Hans sah mich die ganze Zeit an.
»Sie sind schön«, sagte er wieder.
»Aber?«
»Aber sie drücken nur eine Idee aus. Hat man die Idee kapiert, bleibt von ihnen nichts mehr übrig. Die Bilder an sich haben keinen Wert. Sie sind mit einer Idee verbunden. Nicht mit der Welt. Du hättest genauso gut einen Satz über sie schreiben können. Zum Beispiel, ›Die Menschen sehen unterschiedlich aus, führen aber gleiche Leben‹.«
»Das stimmt nicht. Es sind Bilder von Menschen. Wenn sie nicht mit der Welt verbunden sind, was ist dann mit ihr verbunden?«
Er lächelte, ohne noch etwas zu sagen.
»Was wolltest du mir zeigen?«
»Du bist doch nicht sauer? Komm schon, jetzt trinken wir etwas. Danach gehen wir ins Atelier und schauen uns dort um.«
Er füllte sein eigenes Glas, das bereits leer war. Ich verdünnte die Mixtur in meinem ein wenig. Die Stimmung war angespannt, was ihn aber nicht zu stören schien, er saß in Gedanken versunken auf dem Sofa. Das kantige Kinn war ein klein wenig vorgeschoben, wie bei einem Seewolf, das war es, was seinem Gesicht einen Anstrich von etwas Dümmlichem gab, und ich fragte mich, warum, welche Verbindung das Unterbewusstsein zwischen Intelligenz und Kiefern herstellte, die sich in einer etwas verschobenen Position präsentierten. Dann überlegte ich, was für ein Künstler er sein mochte. Bis jetzt hatte ich keine Spuren von etwas Visuellem gesehen – nicht an den Wänden, weder in der Werkstatt noch auf dem Klo. Grün gestrichener Boden, schwarze Wände, alles aus Beton. War er vielleicht »Künstler«?
Der Gedanke ließ mich grinsen, woraufhin er ruckartig zum Leben erwachte, er trank einen großen Schluck seines Mixgetränks, legte eine Hand auf jedes Knie, richtete den Blick auf mich.
»Ideen gehören dazu. Darum geht es nicht. Aber selbst Ideen haben einen physischen Ausdruck, stimmt’s? Nichts kann außerhalb des Physischen existieren. Deine Fotos sind physische Gegenstände. Du kannst sie in der Hand halten. Und die Menschen, von denen du Bilder gemacht hast, sind physisch. Und die Transformation, von Mensch zu Bild, ist ein physischer Prozess. Die Lichtphotonen sind physisch, sie haben ein Gewicht.«
»Aber die Ideen nicht.«
»Doch! Um zu existieren, müssen sie sich an einem konkreten Ort befinden. Das ist der springende Punkt! Alles, was wir wissen und denken, ist ganz konkret an einen Ort gebunden. Der Marxismus oder der Glaube an ein ewiges Leben, es existiert physisch.«
»Also im Gehirn?«
»Zum Beispiel. Alle Gedanken, Ideen und Vorstellungen sind in den Neuronen kodiert.«
»Selbstverständlich.«
»Ist das so selbstverständlich? Nun, das ist es vielleicht. Aber ich sehe nichts davon in deinen Bildern. Sie sind nicht aus einem Guss. Alles ist aufgeteilt. Das Foto für sich, das Motiv für sich, die Idee für sich. Es ist schon in Ordnung, dass sie nichts ins Wanken bringen, du stehst ja noch ganz am Anfang, aber dass es da keinen Willen gibt, etwas ins Wanken zu bringen, das sollte dir zu denken geben. Wenn nicht, kannst du genauso gut anfangen, Fotos für einen Immobilienmakler zu machen. Findest du nicht?«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Alle möglichen Gefühle wirbelten durch mein Inneres, keines von ihnen war gut.
»Natürlich findest du das nicht!«, sagte er und lachte. »Du willst das, was du gemacht hast, mit Zähnen und Klauen verteidigen. Aber es geht hier ja nicht nur um dich. Es geht um die gesamte Bildkultur. Es sind nur Wiederholungen. Es ist nur das Aufrechterhalten des Gleichen.«
»Das Aufrechterhalten von was?«
»Von einem Raum! Einem Verständnisraum! Ist dir der Gedanke noch nie gekommen? Jede Fotografie hat eine bestimmte Perspektive, die jemand ausgewählt hat, ja, okay, der Fotograf. Was du dann vor allem siehst, ist der Wille. Du siehst den Willen. Es ist der Wille, der abgebildet wird. Wie entfernt man diesen Willen? Darüber solltest du als Fotograf nachdenken. Oder?«
»Ich hätte gerne deine Fotos gesehen.«
Er lachte wieder. Das war offenbar ungeheuer komisch.
»Meine Bilder waren genau wie deine Bilder! Natürlich waren sie das! Aber komm, jetzt sehen wir uns meine Sachen an.«
Er stand auf, und ich folgte ihm zu dem Raum auf der anderen Seite. Dort blinkten die Neonröhren an der Decke mehrmals in der Dunkelheit, und als sie aufblitzten, sah ich, dass der Raum vom Boden bis zur Decke gefüllt war, ehe sich das Licht stabilisierte und in dem Durcheinander Details hervortraten. Am bemerkenswertesten, und das, was meinen Blick als Erstes auf sich zog, war eine Reihe von Schaufensterpuppen, die mit ausgestreckten Armen an der hinteren Wand stand. Es sah aus, als warteten sie auf ihre Kinder. An den Längsseiten ragten dichtgedrängt Regale hoch, auf einigen von ihnen standen ausgestopfte Tiere, auf anderen lagen Steine und Muscheln, unter ihnen große Meeresmuscheln. Darüber hinaus sah ich Tierschädel, an einer Stelle lagen Stapel von getrockneten Binsen, an einer anderen Zweige und Farne. Außerdem gab es dort zwei Fernsehapparate, der eine offen, die Eingeweide sichtbar, und ich zählte drei Computer. Unter dem Fenster stand eine Drehbank, und eine mehrere Meter lange Metallbank unter den Regalen entlang der Seitenwand war voller Lötkolben, Kabel und Elektronikzubehör. Außerdem gab es Bretter, neben den Puppen an die Wand gelehnt, und an verschiedenen Stellen hingen Werkzeuge an der Wand wie in einer Garage, und über Tuben mit Ölfarbe hinaus entdeckte ich auch mehrere Eimer, die anscheinend Wandfarbe enthielten.
Dagegen nichts, was er erschaffen hatte. Keine Bilder, keine Skulpturen.
Der Regen schlug schwer gegen das Fenster, das den Raum und uns beide spiegelte.
Er ging zu einem Holzkasten, der auf einem Tisch stand, und etwa zwei mal zwei Meter groß war.
»Das ist ›Ratte‹.«
»Was ist ›Ratte‹?«
»Es ist ein Labyrinth. Möchtest du es sehen?«
Ich nickte. Der Kasten war oben offen, und als ich näher trat, sah ich, dass eine größere Menge dünner Holzleisten tatsächlich ein Labyrinth bildete.
Er hob etwas, das wie eine ausgestopfte Ratte aussah, aus dem Regal, setzte sie an das eine Ende des Labyrinths und drückte auf einen Knopf an der Seite des Kastens. Wenige Sekunden später glitt die Ratte zögerlich durch einen der schmalen Gänge. An seinem Ende stieß sie gegen die Wand, glitt zurück, probierte den nächsten.
Es war unheimlich, das zu sehen. Sie sah so lebensecht aus, und es kam einem so vor, als würde sie denken. Ich musste mir immer wieder sagen, dass sie nicht lebendig war.
Aber was war abgesehen davon der springende Punkt?
Mit Kunst hatte das jedenfalls nichts zu tun.
Sobald sie gegen eine Wand stieß, glitt sie jedes Mal zurück und fing von vorne an, gleichzeitig erinnerte sie sich an die früheren Öffnungen, so dass sie allmählich immer tiefer in das Labyrinth vordrang.
Als sie nach vielem Hin und Her die andere Seite erreicht hatte, drückte sie mit der Schnauze auf einen Schalter. Eine Lampe blinkte und eine Glocke ertönte.
Hans lachte.
»Ich freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich das sehe«, sagte er. »Aber was meinst du?«
»Schön«, sagte ich. »Du kannst was.«
»Ach, komm schon!«, schrie er fast. »Daran kannst du dich doch nicht aufhängen! Zum Teufel, sag die Wahrheit.«
»Und die wäre?«
»Du bist schwer beeindruckt, fasziniert und ein bisschen verschreckt!«
Er schaltete aus, nahm die Ratte und legte sie ins Regal zurück, direkt gegenüber von einer ausgestopften Katze und einem ausgestopften Dachs.
»Woraus hast du sie gemacht?«, fragte ich.
»Ich habe sie nicht gemacht. Es ist eine Ratte. Eine ausgestopfte, natürlich.«
»Entschuldige, dass ich frage, aber was soll das?«
Er sah mich entgeistert an.
»Ist das ein Kunstwerk?«, fragte ich.
Er schüttelte den Kopf und sah dabei zu Boden, als fände er meine Frage unfassbar dumm.
Statt zu antworten, hob er den Kopf, sah mir in die Augen und legte die Hand auf meine Schulter, wie es ein Vater vielleicht in dem Moment tut, bevor sein Sohn in den Krieg zieht.
»Jetzt trinken wir was«, sagte er. »Und dann zeige ich dir meine Schildkröten.«
»Du hast Schildkröten?«
»Habe ich. Und die habe ich selbst gemacht.«
In der Werkstatt füllte er erneut unsere Gläser.
»Verstehst du etwas von Computern?«, fragte er.
»Nein. Nicht das Geringste. Du?«
»Interessiert es dich? Bist du neugierig?«
»Warum sollte ich?«
»Ja, warum solltest du?«, erwiderte er ironisch und stand auf. Sein Schnaps war stark, er schliff bereits die Kanten in meinem Inneren ab, so dass dort eine größere Beweglichkeit entstand, allerdings auch eine geringere Übersicht. Als mein Blick Hans folgte, während er durch die Halle ging und in dem Gerümpelraum verschwand, dachte ich aus irgendeinem Grund an meine Schwester Liv. Nichts Tiefsinniges, es war nur etwas, was ich einmal gesehen hatte, sie war mit einem Welpen in der Jacke zur Schule gegangen, es war nur dieses eine Bild, der Körper mit den zwei Gesichtern, ihrem und dem des Hundes – aber es war genug, um in dem Blick, der Hans folgte, nicht gegenwärtig zu sein. Die Augen sahen ihn, aber meine Gedanken waren nicht dabei, und so war es fast, als geschähe nicht, was ich sah. Im nächsten Moment stand er wieder im Raum und hielt etwas Schweres in den Händen, das er absetzte.
War das eine Schildkröte?
Er verschwand erneut, kehrte mit einer weiteren zurück. Und noch einer. Er winkte mich zu sich.
»Was ist das?«, fragte ich.
»Das sind meine selbstgemachten Schildkröten.«
Er kniete, hob eine von ihnen ein wenig an und schob die Hand unter den Panzer. Sie begann vorwärts zu gleiten und summte dabei leise. Er machte das Gleiche mit den beiden anderen und richtete sich mit einem breiten Grinsen auf. Eine der Schildkröten erreichte den Rand der Arbeitsgrube, hielt inne, setzte zurück und glitt an ihr entlang. Die zweite schob sich geradewegs auf die Wand zu, hielt jedoch an, ehe sie dagegen stieß, und bewegte sich danach ebenfalls rückwärts und setzte ihren Weg in eine andere Richtung fort.
»Sind sie eine Art Roboter?«
»Du kannst sie nennen, wie du willst. Schau hin.«
Er schaltete das Licht aus, und wir standen einige Sekunden in dem stockfinsteren Raum, bis er eine Taschenlampe anknipste. Zuerst hielt er sie unter sein Gesicht und sagte uäääähh und sah mich dämonisch grinsend an. Dann schwenkte er die Lichtsäule über den Boden.
»Kommt, meine Schildkröten«, sagte er. »Kommt, putt, putt, kommt, putt, putt, putt.« Und das Seltsame war, dass sie tatsächlich kamen. Sachte glitten alle drei auf das Licht zu, und als er das Licht über den Boden bewegte, folgten sie ihm.
»Es sieht aus, als wären sie lebendig«, sagte ich.
»Nicht wahr! Schau.«
Er leuchtete eine von ihnen direkt an, und sie wich zurück.
Er lachte laut. Schaltete das Licht wieder an und setzte sich, während die drei Schildkrötenpanzer sich langsam und in der Art von Trilobiten durch den Raum bewegten.
»Und, was sagst du?«, fragte er. »Interessierst du dich immer noch nicht für Computer?«
»Natürlich nicht.«
Er grinste.
»Schöne Spielzeuge hast du da. Aber ich begreife nicht, dass du den Nerv hasst, damit deine Zeit zu vergeuden.«
»Die Römer kannten die Dampfmaschine. Aber sie benutzten sie nur für kleine Spielzeuge. Sie konnten sich nichts anderes vorstellen.«
»Willst du damit sagen, dass die Schildkröten für etwas anderes benutzt werden könnten, als mit ihnen zu spielen? Und für was, zum Beispiel?«
»Weißt du was, jetzt habe ich deine Denkfaulheit satt. Jetzt trinken wir. Noch ein paar Gläser, und ich bin genauso dumm wie du!«
Als ich, wohlig betrunken, nach Hause kam, stellte ich fest, dass ich vergessen hatte, die Nadel von der Platte zu heben, sie glitt auf der innersten Rille lautlos im Kreis. Ich hob sie an und setzte sie auf der ersten Rille wieder ab, drehte laut. First and Last and Always konnte ich mein Leben lang hören, ohne es leid zu werden. Ich aß ein paar Scheiben Brot, trank ein paar Gläser Wasser, machte die Couch zum Bett, drehte die Platte um, schaltete das Licht aus und legte mich hin. Ich schlief gern zu Musik ein, wenn die Gedanken in die klangliche Dunkelheit glitten und sich schließlich nicht mehr von ihr unterscheiden ließen. Die Kritik, die Hans geäußert hatte, interessierte mich nicht. Er konnte in meiner Achtung nicht sinken, da ich ohnehin keine große Achtung vor ihm hatte, und es fiel mir nicht schwer auszublenden, was er über meine Bilder gesagt hatte. Er war niemand. Seine dumme Ratte, was war das? Ein Labyrinth mit verborgenen Schienen, etwas, das wahrscheinlich jeder mit etwas technischem Wissen basteln konnte.
Aber die Szenen in der Autowerkstatt lebten in mir weiter, tauchten in den nächsten Wochen häufig in meinen Gedanken auf. Ich rief sie nicht ab, sie zeigten sich mir sozusagen, als trage das Unterbewusstsein ein Wissen in sich, über das mein Bewusstsein nicht verfügte, und nun, fast ärgerlich, zu vermitteln versuchte. Aber Bewusstsein und Unterbewusstsein sind nicht auf der gleichen Wellenlänge, sie bilden zwei unterschiedliche Systeme, undurchdringlich für das jeweils andere. Und so endete es dort, bei den Bildern aus der leeren Werkstatt. Hans mir gegenüber auf dem Sofa, der Stapel Fotos auf dem Tisch, er in der Rumpelkammer vor der Ratte im Labyrinth stehend, die drei mobilen Schildkröten auf dem Fußboden. Die Bilder waren mit einer Stimmung verbunden, draußen die Dezemberdunkelheit mit ihrem strömenden Regen, drinnen das scharfe Licht, die Tropfen, die von der Decke in die Plastikeimer fielen, die vielen ausgestopften Tiere und die Puppen und Computer. Was für eine Stimmung war das? Eine Stimmung von etwas, das nicht so war, wie es sein sollte. Von etwas, das nicht zusammenpasste. Nicht als Gedanken dazu, nur als Gefühle – vage und unklar, alles. Anders war es mit dem, was er über meine Bilder gesagt hatte, und dem, was mir seiner Meinung nach fehlte, der Wille »etwas ins Wanken zu bringen«. Daran dachte ich intensiv. Und was er über die Perspektive gesagt hatte, dass man sah, was der Fotograf wollte, fast mehr als das Motiv selbst, tauchte auf einmal in jedem visuellen Material auf, mit dem ich mich beschäftigte. Es zerstörte meinen Blick, denn jetzt sah ich es. Auf diese Weise wurde sein Problem zu meinem. Aber nur mich quälte es; er war ja kein Fotograf mehr.
Die Weihnachtsferien an der Akademie begannen früh, vor mir lagen zehn Tage allein in meiner Wohnung, ehe ich nach Hause fliegen würde, und weil diejenigen in meiner Klasse, mit denen ich in Kontakt stand, die Stadt verlassen hatten, zog ich in Erwägung, Hans anzurufen. Er hatte mir seine Nummer gegeben, was eindeutig zeigte, dass er gewillt war, in Verbindung zu bleiben. Es war seine Initiative gewesen, ich selbst war zurückhaltend, um nicht zu sagen kühl gewesen. Dennoch rief ich ihn vom Pub aus an, als ich eines Abends so viel getrunken hatte, dass mein Urteilsvermögen nicht das übliche Niveau erreichte. Es war nicht so, dass ich den Zettel mit seiner Nummer immer bei mir trug, ich kannte sie auswendig – das galt nicht speziell für ihn, ich erinnerte mich an alle Nummern, die man mir nannte –, aber er ging nicht an den Apparat, worüber ich froh war, als ich am nächsten Morgen erwachte.
Ein paar Tage später fuhr ich über Weihnachten heim. Meine Eltern holten mich am Flughafen Fornebu ab, sie standen in der Ankunftshalle, als ich, den Rollkoffer hinter mir her schleifend, aus dem Zoll kam. Hui, waren sie froh, mich zu sehen. Lächeln und Umarmungen, bei Mutter sogar Tränen in den Augen.
»Man könnte meinen, ich wäre zwanzig Jahre weggewesen«, sagte ich. »Und zwar in China oder so.«
Vater nahm mir resolut den Koffer ab, während Mutter, ebenso leicht gerührt wie dominant, ebenso verwirrt wie willensstark, schon auf dem Weg zum Auto anfing, mich auszufragen. Der Wagen war neu, stellte sich heraus, als wir davor stehen blieben. Das war nicht wirklich überraschend, Vater tauschte sein Auto immer alle zwei Jahre gegen ein neues aus.
»Warum habt ihr mir nicht gesagt, dass wir ein neues Auto haben?«, sagte ich dennoch.
»Du hast uns ja nicht gerade häufig angerufen«, antwortete Vater und sah mich lächelnd an.
Kritik äußerte er immer mit einem Lächeln und freundlicher Stimme. Nur wer ihn gut kannte, wusste, entscheidend war, was er sagte, nicht die Art, wie er es sagte.
Als wir fuhren, war der Himmel schwarz und voller Sterne, die Landschaft verschneit.
Es war bemerkenswert, wie leer alles war. In London standen überall Gebäude, meilenweit in alle Richtungen, und wohin man auch sah, waren Menschen. Dort hatte ich kaum einmal daran gedacht, aber hier, während wir durch die leere, offene Landschaft fuhren, in der zwischen den Häusern manchmal Kilometer lagen, traf es mich mit voller Wucht. Es erschien mir arm. London war arm, die Stadt war hässlich und heruntergekommen, überall gab es menschliches Elend, aber sie war nicht arm an Menschen und Ereignissen. Hier herrschte Grabesruhe.
Die Heizung rauschte. Im Radio plauderte jemand Belangloses. Mutter und Vater saßen vorn reglos in bequemem Schweigen. Ich lehnte den Kopf ans Fenster, schlief ein und erwachte, als wir durch das Tor und anschließend den Anstieg zum Haus hinauffuhren. Hier lag noch mehr Schnee. Er hatte den Weg kürzlich mit seinem Traktorschneepflug geräumt, er war glänzend blank.
Ich ging hoch und packte in meinem Zimmer aus. Es war gemütlich und warm; Mutter war am Morgen offenbar oben gewesen und hatte den Heizkörper angestellt. Staubgesaugt hatte sie mit Sicherheit auch.
Als Erstes legte ich die Kartons mit Bildern auf den Schreibtisch. Ich würde in den nächsten Tagen viel freie Zeit haben und hatte mir deshalb überlegt, an meinem Buch zu arbeiten. Anschließend hängte ich die Hemden in den Schrank und legte die restlichen Kleidungsstücke in die Kommode, ehe ich mich ans Fenster stellte und hinaussah. Tagsüber konnte man meilenweit sehen, jetzt schloss die Dunkelheit alles aus außer den Wirtschaftsgebäuden, die ausnahmslos hell erleuchtet waren. Der Schnee unter den Lampen war gelb. Nachts eine kranke Farbe, das hatte ich immer schon gedacht.
Das Zimmer empfand ich wie ein Fell, das ich abgeworfen hatte. Eine Schlange konnte nicht weniger für ihre alte Haut empfinden als ich für diesen Raum.
»Kristian?«, rief Mutter von unten. »Kaffee und Kuchen!«
Sie hatte die weiße Decke auf den Tisch gelegt, auf der das alte Kaffeegeschirr stand, im Adventsleuchter brannten die Kerzen. Im Kamin loderte ein Feuer.
»Ich vergesse immer, wie traditionsbewusst du bist«, sagte ich. »Wie passt das eigentlich zu deiner radikalen Grundhaltung?«
»Es ist kein Widerspruch, es sich gemütlich machen zu wollen und gleichzeitig einen Sinn für Gerechtigkeit zu haben«, erwiderte sie.
»Und wie läuft es an der Akademie?«, fragte Vater. »Gefällt es dir?«
»Oh ja. Es gibt viel zu tun. Viel Neues.«
»Dürfen wir etwas von dem sehen, was du gemacht hast? Hast du was dabei?«
»Ja, habe ich. Ich kann nachher ein paar Arbeiten herunterholen.«
»Hast du schon Freunde gefunden?«, fragte Mutter. Eigentlich sagte sie nicht das norwegische, sondern das dänische Wort für »schon«. Sie war Dänin, und obwohl sie seit mehr als dreißig Jahren in Norwegen lebte, war ihr Norwegisch von dänischen Vokabeln, Tonfällen und Klängen durchsetzt. Meine Freunde hatten sie deshalb niemals richtig ernst genommen. Mütter müssen die Muttersprache sprechen, wenn nicht, sind sie keine richtigen Mütter, so hatten sie es offenbar empfunden.
»Ja, klar. Alle in meinem Jahrgang und ein paar andere Leute.«
Sie hatten mich gefragt, ob sie mich besuchen könnten, da sie gern reisten, aber ich hatte Nein gesagt, ich müsse mich zuerst etwas besser einfinden. Ich hatte nichts gegen sie, im Gegenteil, ich mochte sie ganz gern. Aber wenn Menschen Häuser waren, die einander durch die Fenster ansahen, und kommunizierten, indem sie Türen öffneten und Laute hinausließen, fehlte meinem Haus ihnen gegenüber eine Wand, und ihrem Haus eine Wand gegenüber meinem, so dass wir direkt in das Haus des jeweils anderen gehen konnten, wenn wir zusammen waren. Das gefiel mir nicht.
Als Mutters Mutter starb, hatte sie erklärt, ein Teil der Trauer bestehe darin, eine Zeugin zu verlieren, jemanden, der sie ihr ganzes Leben gekannt hatte und wusste, wer sie war. Ich war damals erst fünfzehn, aber ich erinnerte mich, dass ich darauf reagiert hatte, denn wer wollte Zeugen für das, was man sagte und tat? Und wer wollte, dass einem der Mensch, der man als Achtjähriger oder Neunzehnjähriger war, sein Leben lang an den Kopf geworfen wurde?
»Und, ist hier etwas passiert?«, fragte ich und steckte mir einen Lebkuchen in Form eines Schweins in den Mund.
»Nein, ich glaube eigentlich nicht«, sagte Mutter. »Im Februar fahren wir nach Jerusalem.«
»Jerusalem?«
»Ja. Es ist eine der ältesten Städte der Welt. Ich habe schon immer Lust gehabt, dorthin zu reisen.«
»Du auch?«, fragte ich und lächelte Vater an. Die Haut um seine Augen in dem großen schweren Kopf runzelte sich, als er mein Lächeln erwiderte.
»Oh ja.«
»Wir werden in einem Hotel übernachten, in dem die Menschen gewohnt haben, über die Selma Lagerlöf geschrieben hat«, sagte Mutter. »Hast du ihren Roman gelesen? ›Jerusalem‹?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Er steht im Bücherregal, falls du eines Tages Lust darauf bekommen solltest.«
»Mal sehen.«
»Aber morgen Vormittag holen wir den Baum«, sagte Vater.
»Natürlich«, sagte ich. »Kommen Helene und Liv?«
»Helene kommt. Und Liv eigentlich auch«, sagte Mutter.
Sie schenkte aus der Kanne, die sie langsam anhob, Kaffee in meine Tasse, so dass der Kaffee für Sekunden wie eine Säule in der Luft stand, bis sie die Kanne aufrichtete und auf den Tisch zurückstellte. Der rote Stein in dem Ring an ihrem Finger leuchtete in dem vielen Licht, und als ich sie ansah, galt für den roten Stein, der in einer Kette um ihren Hals hing, das Gleiche.
»Hier gibt es immer guten Kaffee«, sagte ich.
Sie lächelte mich an. Es wirkte so, als hätte sie zwei Alter. Ein junges für die Augen und ein älteres für den Rest ihres Gesichts.
»Du musst auch die Krapfen probieren. Sie sind von heute.«
»Ich glaube, damit warte ich bis Weihnachten.«
»Ach, stimmt ja«, sagte Mutter. »Vidar hat heute angerufen. Ich habe ihm gesagt, du würdest ihn zurückrufen, wenn du da bist.«
»Und was ist, wenn ich das nicht will?«
»Vidar ist ein guter Junge«, kam von Vater.
»Sicher, aber ich muss mich doch nicht mit allen guten Menschen auf der Welt treffen.«
»Du machst natürlich, was du willst«, sagte Mutter. »Jedenfalls habe ich es dir jetzt ausgerichtet!«
Erst oben in meinem Zimmer fiel mir ein, dass Vidar mittlerweile an der Technischen Hochschule studierte und sich mit Computern auskannte. Ein Bier war auch nicht zu verachten. Ein Spaziergang durch die frische, eiskalte Luft.
Ich kniete vor den Getränkekästen mit meinen Platten darin und begann, in ihnen zu blättern. Das bedeutete heimzukommen. Ich hatte nicht wenige Stunden darauf verwandt, die perfekte Reihenfolge hinzubekommen, damit die Platten einander befruchteten. Man konnte sich einerseits für etwas entscheiden, das ich gleiten nannte – bei dem es Verbindungen zwischen den Platten gab, sie hatten einen gemeinsamen Nenner, gleichzeitig hatte die zweite etwas anderes, was auf eine dritte hindeutete, die auf eine vierte verwies, wo man sich plötzlich, aber unmerklich sehr weit von der ersten entfernt hatte. Man konnte beispielsweise sämtliche Fäden ausnutzen, die zwischen Bowies Album Lodger und Remain in Light von den Talking Heads verliefen, die beide Brian Eno produziert hatte und auf denen Adrian Belew Gitarre spielte, und via Eno zu Jon Hassel gehen, der auf einem seiner Ambient-Alben spielte, und weiter zu David Sylvian, auf dessen Brilliant Trees Hassel Trompete spielte, und dort konnte man zum Beispiel Mick Karn aufgreifen und zu Bauhaus übergehen – da er mit Peter Murphy die Band Dalis Car hatte – oder man konnte Karn in eine andere Richtung folgen und bei Ultravox, New Order, PIL oder Can und Holger Czukay enden. Eine andere Möglichkeit war, Belew statt Eno von Bowie und Byrne zu folgen, und daraufhin endete man natürlich ganz woanders, zum Beispiel bei Shriekback, XTC oder The Police. Wenn man nicht auf die Art gleiten wollte, konnte man das Gegenteil tun, auf Kontraste setzen und zwei sehr unterschiedliche Platten aufeinandertreffen lassen. Das war anspruchsvoller – es musste ja stimmen. In irgendeiner Weise musste die ungewohnte Kombination richtig, sogar selbstverständlich wirken, wenn man sie erst einmal sah. Unabhängig von der Methode lautete das Ziel, die Plattensammlung zum Leben zu erwecken, bis sie vor Sinn fast explodierte. Es war so möglich, eine mittelmäßige Plattensammlung mit vielen schlechten Scheiben auf ein anständiges Niveau zu heben, und zwar nur durch die Reihenfolge. Ich war sehr gut darin. Und als Fotograf wurde ich erst richtig gut, als ich es verstand, dieses Talent auch auf meine Bilder anzuwenden. Es war wirklich exakt das Gleiche – die Bilder konnten gleiten oder sie konnten unerwartet gegeneinander krachen.
Ich hielt inne. Seventeen Seconds folgte auf Revolver, und das war wahnsinnig falsch, auch wenn ich verstand, was ich mir dabei gedacht hatte – The Cure waren gar nicht so düster und industriell, wie immer behauptet wurde, hinter ihrem experimentellen Sound verbarg sich eine Popband, während sich im Fall der Beatles eine experimentelle Band hinter den Popsongs verbarg, besonders deutlich in »Tomorrow Never Knows« – und genauso übel war, dass auf sie Zen Arcade von Hüsker Dü folgte. Es tat mir in den Augen weh. Was hatte ich mir nur dabei gedacht.
Falsch, falsch, falsch.
Ich blätterte den Stapel durch, um neue Kandidaten zu finden. Das Problem war natürlich, dass ich nicht einfach irgendwo eine Platte herausziehen konnte, ohne dass sie eine Lücke hinterließ, die gefüllt werden musste. Ideal wäre es, wenn ich zwei gegeneinander austauschen könnte.
Ich zögerte vor Lodger. Das Album konnte möglicherweise vor Seventeen seconds stehen, aber definitiv nicht dahinter. Nein, auch nicht davor. Ich suchte weiter. Was war mit NEU!? Nein, sie schloss, sie öffnete nicht.
Sollte ich stattdessen gleiten?
Das würde große Veränderungen und viel Arbeit bedeuten. Aber warum eigentlich nicht? Schließlich war Weihnachten, und vor mir lagen viele ereignislose Tage.
Ich musste Vidar anrufen, bevor es zu spät wurde. Gleichzeitig war es heikel, die Sammlung zurückzulassen, wenn etwas so offensichtlich nicht stimmte.
Wie wäre es, einfach Faith und Pornography dahinter zu haben, dann würde das Depressive verstärkt werden, und danach Bauhaus zu nehmen? Und danach Birthday Party? Als Nächstes konnte Hüsker Dü folgen! Birthday Party war sowohl düster als auch scheppernd und der perfekte Übergang zwischen Bauhaus und Hüsker Dü. Ein wenig so, wie das Missing Link zwischen den Menschen und den Affen.
Mit dieser Idee im Kopf stand ich auf und ging nach unten, um Vidar anzurufen. Anscheinend hatte er direkt neben dem Telefon gesessen und gewartet, denn er hob sofort ab. Wir verabredeten, uns in einer halben Stunde im Stasjonen zu treffen. Ich ging hoch und holte den alten Mantel aus dem Schrank, fand unten am Kleiderhaken einen von Vaters alten Schals, zog mir die Schuhe an.
»Ich bin mal kurz weg«, rief ich.
»Okay«, rief Mutter zurück.
Die Kälte schlug mir entgegen, als ich die Tür öffnete. Auf dem Weg zur Kreuzung knirschte der Schnee unter den Schuhen. Der Himmel war klar und voller Sterne. So sollten meine Bilder sein. Kalt, scharf, schwarz, voller glitzernder Lichtpunkte, die keiner erreichen, die man nur sehen konnte.
Ich achtete darauf, meine Umgebung wahrzunehmen, als ich den Fußgänger- und Fahrradweg hinabging, der Blick war vielleicht nicht meine Waffe, wohl aber mein Werkzeug, und musste wie andere Werkzeuge gepflegt werden.
Der Weg war sorgfältig geräumt worden, obwohl ihn kaum jemand benutzte, man sah die Spuren der Schneeketten und des Pflugs. Ein Schneewall trennte ihn von der Straße, auf der vereinzelt Autos gedämpft vorbeifuhren. Ich hatte alle Fotografen in zwei Schulen eingeordnet, diejenigen, die Bilder von der Welt machten, wie sie war, und diejenigen, die unterstrichen, was in ihr war. Sie monumental machten, mit Licht skulptierten, das Dramatische in Dingen, Landschaften und Menschen herausarbeiteten. Ich hatte ein wenig geschwankt, war aber mehr und mehr der Überzeugung, dass meine Zukunft im Monumentalen lag. Die Welt zu betonen, nicht aufzulösen. So könnte eine der Straßenlaternen, an denen ich vorbeiging, isoliert gesehen verblüffend und massiv wirken, mit schimmerndem Metall, vielleicht gewellt von Eis, das Licht, das wie eingefroren in der Dunkelheit stand. Welchen Sinn hatte es, das Alltägliche und Gewöhnliche zu unterstreichen? Meine Reihe von verschiedenen Menschen in gleichen Umgebungen tendierte stärker in diese Richtung, die Information lag nicht wie ein Mantel um das Motiv herum, sondern verstreut, das war eine Schwachstelle des Ganzen, aber die Idee dahinter war stark und konzentriert. Das Aufnahmekomitee der Akademie hatte dies gesehen. Da spielte es keine Rolle, dass dieser holländische Möchtegernkünstler dazu nicht in der Lage gewesen war.
Im Stasjonen wartete der Sohn des Getreidebauern bereits. Er lächelte, als er mich sah, stand auf und umarmte mich, lachte sogar kurz.
»Schön, dich zu sehen«, sagte er.
»Danke gleichfalls«, erwiderte ich, wickelte den Schal ab, stopfte ihn in den Ärmel des Mantels und hängte diesen über den Stuhlrücken. »Wie geht’s?«
»Gut. Ich bin gestern nach Hause gekommen. Wann bist du gekommen?«
»Gerade eben. Ich gehe mir ein Bier holen.«
Das Lokal in den Räumen des stillgelegten Bahnhofs war etwas mehr als halb voll. Während der Barkeeper zapfte, schaute ich mich um. Zum Glück nicht viele bekannte Gesichter. Ein paar aus der Peripherie am Gymnasium und eine Clique, mit der Helene oft losgezogen war. Am Tisch hinter ihnen saßen drei junge Frauen, eine von ihnen, klein und mollig, aber mit recht hübschen Zügen, begegnete meinem Blick, als ich hinübersah, und als ich mich zu Vidar setzte und kurz zu ihr schaute, um sie abzuchecken, tat sie es wieder. Beide Male so, dass die anderen es nicht mitbekamen, was verdeutlichte, dass ihr der Gedanke nicht fremd war, von ihnen losgeeist zu werden.
»Und, wie ist London?«, sagte Vidar mit seinem vollkommen offenen Gesicht.
»Es ist schön da«, sagte ich. »Was ist mit Trondheim?«
»Doch, doch.«
Sie war vielleicht vier, fünf Jahre älter als ich.
»Prost«, sagte Vidar.
»Prost«, sagte ich.
Wir redeten darüber, was wir seit unterer letzten Begegnung gemacht hatten, während es um uns herum immer voller wurde. Es stellte sich heraus, dass er da oben mit einer Frau zusammenlebte, sie hieß Wenche, und er zog das Portemonnaie heraus und zeigt mir ein Bild von ihr. Ein großes, rundes Matronengesicht, schmale Lippen, energische Augen. Sie kann sich sicher gut um ihn kümmern, dachte ich, während ich lächelte und ihm dazu gratulierte, dass er so einen guten Fang gemacht hatte. Er lächelte stolz und steckte das Portemonnaie wieder ein.
»Ich habe in London einen seltsamen Typen kennengelernt, zu dem ich dich etwas fragen will«, sagte ich. »Er ist eine Art Künstler und macht viel mit Computern und so. Er hat mir ein Labyrinth gezeigt, das er gebaut hat, mit einer Ratte. Ist das etwas Besonderes, weißt du das?«
»War es ein gebautes Labyrinth?«
»Ja, es war aus Holz. Ich kann es für dich zeichnen.«
Ich zog mein Notizbuch heraus und fertigte rasch eine Skizze an.
»Das ähnelt Claude Shannons Labyrinth.«
»Wer ist das?«
»Er ist einer der Väter des Computers. Er gehörte zu den Leuten, die in den dreißiger und vierziger Jahren die Grundlagen für digitale Computer entwickelt haben. Er war eigentlich Ingenieur bei einer Telefongesellschaft. Bells.«
»Aha?«
»Er hat so ein Labyrinth gebaut. Wenn ich mich richtig erinnere, nannte man es ›Shannon’s rat‹. Er hat es zu Hause mit Telefontechnik gebaut, wenn wir es so nennen können.«
»Und worum ging es dabei?«
»Es ging darum, dass die Ratte ein Erinnerungsvermögen hatte. Sie hatte ein Gedächtnis. Und sie war lernfähig. Wenn sie den falschen Weg nahm, kehrte sie um und erinnerte sich später daran, wenn sie es von Neuem probierte. Was er damals gemacht hat, ist sehr wichtig für alles, was heute passiert.«
»Und warum will jemand das jetzt wiederholen?«
»Keine Ahnung. Das kann im Grunde jeder bauen.«
»Sogar du?«
Er lachte.
»Ja, klar. Es ist ein sehr einfaches Prinzip.«
»Er hat mir auch ein paar kleine Roboter gezeigt, die Hindernissen auswichen und dem Licht folgten.«
»Die stammen ungefähr aus derselben Zeit. Das sind Waltons Schildkröten.«
»Dann gibt es sie? Ich meine, sie sind bekannt?«
»Oh ja.«
»Dann ist der Typ, den ich getroffen habe, also gar nicht originell? Er hat das nicht selbst erfunden?«
»Nein, nein. Das sind Klassiker.«
Ich sah, dass Vidar sich freute, mir gegenüber brillieren zu können. Das kam nicht oft vor, er war ja eher ein ruhiger Vertreter, und ich hatte wohl nie zuvor Interesse an etwas gezeigt, worin er gut war. Das ging auf die Zeit zurück, als wir klein waren. Damals war es so leicht gewesen, ihn hereinzulegen und herumzukommandieren – ich erinnerte mich, dass ich ihm einmal sagte, er bekäme Muskeln, wenn er die Schubkarre schieben würde, die wir gebaut hatten, erst recht, wenn ich darin