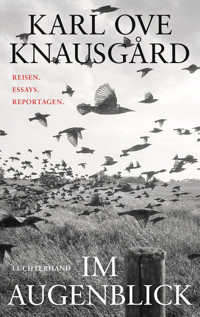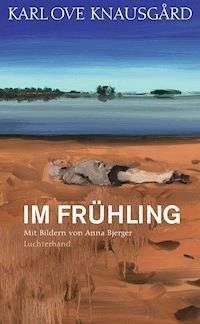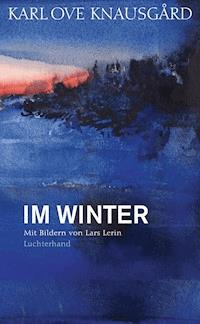8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Jahreszeiten-Bände von Karl Ove Knausgård: "Im Sommer" ist der vierte und letzte Teil einer grandiosen Liebeserklärung an das Leben und die sinnlich erfahrbare Welt - geschrieben von einem Vater für seine jüngste Tochter.
Knausgård schreibt über Wassersprenger und Schnecken, Rote Johannisbeeren und Tränen, über Weidenröschen, den Zirkus, Marienkäfer und das Fischen von Krabben. Er führt auch Tagebuch, in dem die kleinen Ereignisse im Leben einer Familie vor dem Hintergrund all dessen registriert werden, was ein Sommer an Gedanken, Erinnerungen, Sehnsüchten, Erlebnissen von Kunst und Literatur zum Leben erweckt.
"Die Zeit ist abgrundtief, die Sicht, die man als Kind hat, reicht nicht weit. Für mich war die Kindheit meiner Großeltern außer Reichweite, sie war etwas, worüber ich nichts wusste – und für meine Kinder ist die Kindheit meiner Eltern außer Reichweite! Von ihren Urgroßeltern in Westnorwegen, bei denen ich jeden Sommer verbrachte, haben sie keine Ahnung. Es nützt nichts, dass ich von ihnen erzähle, sie können das an nichts festmachen, die Menschen, die in den Geschichten auftauchen, sind tot und sind es während ihres ganzen Lebens gewesen. Der Keller mit den Steinwänden und dem oftmals feuchten Boden mit dem Abfluss, in den das Wasser rieselte, die weißen Schüsseln, mit den Bergen glänzend roter Johannisbeeren darin, die Milcheimer, der kleine Traktor und all die anderen Dinge, die in meiner Erinnerung leuchten, sagen ihnen nichts, denn die Welt wird von innen erleuchtet, von innen heraus entsteht die Bedeutung der Dinge und Orte."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
INHALT
Die Jahreszeiten-Bände von Karl Ove Knausgård: »Im Sommer« ist der vierte und letzte Teil einer grandiosen Liebeserklärung an das Leben und die sinnlich erfahrbare Welt – geschrieben von einem Vater für seine jüngste Tochter.
»Die Zeit ist abgrundtief, und die Sicht, die man als Kind hat, reicht nicht weit. Für mich war die Kindheit meiner Großeltern jenseits meiner Reichweite, sie war etwas, worüber ich nichts wusste – und für meine Kinder ist die Kindheit meiner Eltern jenseits ihrer Reichweite! Von ihren Urgroßeltern in Westnorwegen, bei denen ich jeden Sommer verbrachte, haben sie keine Ahnung. Es hilft nicht, dass ich von ihnen erzähle, sie haben keine Berührungspunkte, die Menschen in den Erzählungen sind tot und sind es während ihres ganzen Lebens gewesen. Der Keller mit den Steinwänden und dem häufig nassen Fußboden mit dem Abfluss, in den das Wasser lief, die weißen Bottiche, gefüllt mit Bergen glänzender Roter Johannisbeeren, die Milchkannen, der kleine Traktor und all die anderen Dinge, die in meiner Erinnerung leuchten, sagen ihnen nichts, denn die Welt wird von innen erleuchtet, und aus dem Inneren erwächst die Bedeutung von Dingen und Orten.«
»Das ist Knausgårds Methode. Er will dem Leben nahekommen. Er will sich von Gedanken und Gefühlen durchströmen lassen.« Dagbladet
AUTOR
Karl Ove Knausgård wurde 1968 geboren und gilt als wichtigster norwegischer Autor der Gegenwart. Die Romane seines sechsbändigen, autobiographischen Projektes wurden weltweit zur Sensation. Seine Bücher sind in über 30 Sprachen übersetzt und vielfach preisgekrönt. 2015 erhielt Karl Ove Knausgård den WELTLiteraturpreis, 2017 den Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur. Er lebt mit seiner Familie an der schwedischen Südküste.
KARL OVE KNAUSGÅRD
IM SOMMER
Mit Aquarellen von Anselm Kiefer
Aus dem Norwegischen von Paul Berf
LUCHTERHAND
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die norwegische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »OM SOMMEREN« im Verlag Oktober, Oslo.
Die Übersetzung wurde von NORLA, Oslo, gefördert. Der Verlag bedankt sich dafür.
Copyright © der Originalausgabe 2016 by Forlaget Oktober as, Oslo
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 by Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Aquarelle: Anselm Kiefer
Lektorat: Regina Kammerer
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Schutzumschlaggestaltung: buxdesign, München
Schutzumschlagmotiv: Morgenthau, 2013, Aquarell auf Papier 40,3 x 50,7 © Anselm Kiefer. Foto: © Georges Poncet
ISBN 978-3-641-18745-3V002
www.penguin.de
JUNI
Rasensprenger
Kastanienbäume
Kurze Hosen
Katzen
Campingplätze
Sommernacht
Sommernachmittag
Intelligenz
Schaum
Birken
Schnecken
Rote Johannisbeeren
Sommerregen
Fledermäuse
Sjekte
Wölfe
Tränen
Mixer
Tagebuch, Juni
JULI
Rasen
Eiswürfel
Möwen
Taufliegen
Kirschbäume
Makrelen
Wespen
Stuntshow
Spielplätze
Die Fledermaus
Grill
Sting
Schmalblättriges Weidenröschen
Hunde
Gjerstadholmen
Mücken
Ohnmacht
Gletschertöpfe
Tagebuch, Juli
AUGUST
Kleider
Eiscreme
Salz
Regenwürmer
Ekelöf
Fahrrad
Backer
Zynismus
Pflaumen
Haut
Schmetterlinge
Eier
Fülle
Erdwespen
Zirkus
Wiederholung
Krebsfischen
Marienkäfer
JUNI
Rasensprenger
Mir ist nie wirklich bewusst gewesen, dass ich einen Rasensprenger besitze, er ist nur eines von vielen Dingen gewesen, die ich anschaffte, als wir dieses Haus kauften, ähnlich wie der Rasenmäher, die Gartenscheren, die Harken und alle anderen Gerätschaften, die zu einem Garten gehören. Obwohl ich den Schlauch unzählige Male an den Wasserhahn im Flur des Sommerhauses geschraubt habe, das Wasser erst zischen, danach rauschen hörte und anschließend sah, wie sich im Garten der dünne Wasserstrahl erhob, etwa fünf Meter hoch, häufig im Sonnenlicht glitzernd, um langsam wehend zur einen Seite zu fallen, sich danach erneut zu heben und zur anderen Seite zu fallen, in dieser Bewegung, die für mich seit jeher einer winkenden Hand gleicht, habe ich ihn nie mit mir oder meinen Habseligkeiten verbunden, als würde das, was er verkörpert, nicht mich verkörpern, oder, anders ausgedrückt, dass mein Leben hier nicht wirklich das meine ist, sondern lediglich etwas, worin ich mich in diesem Moment rein zufällig befinde. Eine so große Schlussfolgerung aus etwas so Kleinem wie einem Metallbügel voller Löcher zu ziehen, durch die Wasser strömt, mag reichlich übertrieben wirken, aber von allen Dingen, die mir aus den Sommern meiner Kindheit in Erinnerung geblieben sind, ist der Rasensprenger das emblematischste, der Einzelgegenstand, der im Gedächtnis die meisten Stimmungen und Geschehnisse an sich versammelt und die meisten Assoziationen auslöst. Jeder Haushalt in unserer Siedlung besaß einen Rasensprenger, und alle waren vom gleichen Typ, so dass dieser glitzernde Bogen aus dünnen Wasserstrahlen an sonnigen Sommertagen überall zu sehen war. Oft waren die Rasenflächen, auf denen sie standen, menschenleer, als lebten sie ihr eigenes, selbständiges Leben als eine Art große, freundliche, wasserbasierte Wesen. Wenn das Wasser auf dem Gras landete, war das Geräusch nahezu unhörbar, nicht mehr als ein leichtes und feines Rieseln, das manchmal vom Rauschen des Schlauchs oder des Wasserhahns übertönt wurde, wenn dieser nicht ganz aufgedreht war, während das Geräusch zu einem Rascheln oder sogar Knattern anschwellen konnte, falls der Rasensprenger so aufgestellt war, dass sein Wasser die Blätter an Sträuchern oder Bäumen traf. Diese Laute, die gewissermaßen systematisch und geduldig, wie von einer sorgsamen Arbeit herrührend, lauter und leiser wurden und ebenfalls zu der Wahrnehmung beitrugen, dass dieser Wasserbogen ein selbständiges Geschöpf war, dauerten manchmal den ganzen Tag und bis in den Abend hinein an, unberührt von den übrigen Aktivitäten der Bewohner, zuweilen auch die Nacht hindurch, obwohl das nur selten vorkam, da es aus irgendeinem Grund als unpassend galt, in der Dunkelheit zu wässern. Bei uns zu Hause bestimmte mein Vater über den Rasensprenger, ich kann mich nicht daran erinnern, jemals meine Mutter dabei beobachtet zu haben, wie sie ihn umstellte oder das Wasser auf- und zudrehte, ohne dass ich zu sagen wüsste, warum das so war. Der Wasserhahn befand sich in der Waschküche im Keller, und der Schlauch führte durch ein schmales, rechteckiges Kellerfenster in den Garten, das sich drinnen ganz oben, gleich unter der Decke befand, wohingegen es draußen weit unten, unmittelbar über dem Erdboden lag. Dass sich dieses Fenster nicht schließen ließ, solange Vater den Rasen sprengte, löste in mir ein leicht schmerzliches Gefühl aus, während die unterschiedliche Höhe des Fensters innen und außen andererseits magisch und anziehend wirkte. Der Bogen aus Wasser und all seine Aspekte, visuell und akustisch, sowie der Nutzen für den Garten standen für etwas bedingungslos Gutes. Die Tatsache, dass ich heute selbst Herr über einen Rasensprenger bin und ihn anschließe und an verschiedenen Stellen in meinem eigenen Garten aufstelle, sollte mir deshalb etwas bedeuten, nicht unbedingt viel, aber doch ein bisschen, da das Leben, das ich damals nur beobachtete – das Leben der erwachsenen Männer und Frauen –, nun zu meinem eigenen geworden ist, zu etwas, das ich nicht länger von außen betrachte, sondern von innen ausfülle. Das tut es jedoch nicht, es bereitet mir keine besondere Freude, den Rasensprenger anzuschließen, nicht mehr jedenfalls, als es mir Freude bereitet, mir ein Brot zu schmieren oder die Schuhe auszuziehen, sobald ich ins Haus komme. Heute ist es die Welt des Kindes, die ich von außen betrachte, und welches Bild könnte diese Asymmetrie adäquater darstellen als das Kellerfenster, das sich zugleich hoch unter der Decke und tief unten am Erdboden befindet?
Kastanienbäume
Wir haben einen Kastanienbaum im Garten, der in der Ecke zwischen den beiden Häusern steht und mehr als zwanzig, vielleicht sogar fünfundzwanzig Meter in die Höhe ragt. Die längsten Äste spreizen sich sicherlich zehn Meter weit vom Stamm ab, und als eine der ersten Maßnahmen, die ich nach unserem Einzug ergriff, sägte ich die untersten ab, da einige den Weg zwischen den Häusern teilweise versperrten, während andere über das Dach gewachsen waren und auf diesem ruhten. Doch obwohl diese Kastanie so groß ist – aus der Ferne ist sie es, die man von unserem Anwesen sieht, nicht die Häuserdächer – und obwohl ich in sie geklettert bin und an ihr herumgesägt habe, ist sie mir doch niemals aufgefallen, habe ich nie an sie gedacht. Ganz so, als existierte sie überhaupt nicht. Inzwischen erscheint es mir unfassbar, dass ich fünf Jahre Seite an Seite mit einer so großen Schöpfung gelebt habe, ohne sie zu sehen. Was ist das für ein Phänomen, etwas zu sehen, ohne es zu sehen? Wahrscheinlich geht es darum, dass die Dinge, die wir sehen, keinen Eindruck hinterlassen. Aber worin hinterlässt das, was wir tatsächlich sehen, einen Eindruck? Wir sagen, dass etwas unserem Leben einen Sinn gibt, als wäre der Sinn etwas, was wir geschenkt bekommen, aber im Grunde glaube ich, dass es sich umgekehrt verhält, wir sind es, die dem einen Sinn geben, was wir sehen. Und diesem Kastanienbaum, den ich betrachte, da ich diese Zeilen schreibe, habe ich keinen Sinn gegeben. Er war da, und ich wusste durchaus, dass er da war, es war ja nicht so, dass ich auf dem Weg zwischen den Häusern gegen ihn lief, aber er hatte keine Bedeutung für mich und damit keine reale Existenz.
Dann ergab es sich, dass ich in diesem Frühjahr und Sommer mit den Bildern des Malers Edvard Munch gearbeitet habe. Immer wieder habe ich mir all seine Gemälde angesehen, und die meisten von ihnen sind mir vertraut geworden. Er malte mehrere Kastanienbäume, und vor allem eines dieser Gemälde hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es zeigt einen Kastanienbaum an einer Straße in einer Stadt und ist fast impressionistisch gemalt, womit ich meine, dass sämtliche Oberflächen eher als Farben, weniger als solide Objekte erscheinen, sie sind eher für das Auge als für die Hand, eher für den Augenblick als für die Dauer. Der Kastanienbaum blüht, und die weißen Blüten sind wie kleine Pfosten in alldem Grün gemalt, in dem sie leuchten wie Laternen. Wenn ich zu dem Kastanienbaum vor meinem Fenster hinausschaue, ähneln seine Blüten in nichts den Blüten, wie Munch sie malte – sie sehen nicht aus wie vertikale Striche, sondern wie kleine, in vier oder fünf Etagen angeordnete Bäusche, auch sind sie nicht kreideweiß, sondern weisen Nuancen von Beige und Braun auf. Trotzdem führte Munchs Bild dazu, dass ich, als der Baum Ende Mai blühte, zum ersten Mal begriff, dass da ein Kastanienbaum steht. Das Gleiche ist mit den Bäumen geschehen, die auf dem Weg ins Zentrum von Ystad auf den Bürgersteigen die Straße säumen, die parallel zur Eisenbahnlinie am Hafenbecken verläuft, wo die großen Fähren nach Polen und Bornholm thronen. Das sind ja Kastanienbäume, dachte ich, als sie anfingen zu blühen. Und es lag nicht am Namen, nicht daran, dass ich nunmehr sagen konnte, dass es Kastanien waren, was ich früher nicht hätte sagen können – denn das hätte ich durchaus gekonnt, da ich die ganze Zeit über sehr wohl gewusst hatte, was für Bäume das waren –, entscheidend war vielmehr, dass die Kastanienbäume jetzt einen vertrauten Platz in meinem Bewusstsein einnahmen. Und ich denke, diese Vertrautheit meinen wir, wenn wir über das Authentische sprechen. Denn Vertrautheit hebt radikal die Distanz auf, die in allen Theorien des vorigen Jahrhunderts zur Entfremdung eine so zentrale Rolle gespielt hat und in unserer Sehnsucht nach dem Greifbaren weiterwirkt, das wir als der Wirklichkeit näher stehend erleben. Die Pole sind nicht Moderne und Antimoderne, Fortschritt und Rückschritt, das ergibt sich nur aus der Balance zwischen Vertrautem und Nicht-Vertrautem, daraus, wo man den Schwerpunkt setzt, was wiederum davon abhängt, was wir benötigen und mit unserem Leben wollen. Wollen wir uns die Kastanie aneignen, wollen wir sie sehen und ihr in unserem Inneren Raum zugestehen, wollen wir jedes Mal, wenn wir an ihr vorbeikommen, ihre Gegenwart, ihren ganz eigenen Platz in der Wirklichkeit spüren? Was die Kastanie artikuliert, was sie ausdrückt, ist nichts als sie selbst. Und vielleicht gilt ja für uns das Gleiche, dass alles, was wir artikulieren, was wir ausdrücken, nichts ist als wir selbst? Eine bestimmte Gegenwart an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit? Immer öfter denke ich, dass die Gedanken nur etwas sind, was mich durchströmt, dass die Gefühle nur etwas sind, was mich durchströmt, und dass ich ebenso gut ein anderer sein könnte und es nicht entscheidend ist, wer ich bin, sondern dass ich bin, was so auch für den Kastanienbaum gilt, der in diesem Moment still brütend vor dem Fenster steht, mitten in seinem Wirbel aus grünen Blättern und weißen Blüten.
Kurze Hosen
Ich trage heute eine kurze Hose, sie ist moosgrün und reicht mir bis knapp über die Knie, und obgleich sie in der Hitze bequemer ist als eine lange Hose, haftet ihr doch etwas leicht Unangenehmes an, als würde sie mich kleiner machen, als wäre ich zu alt für sie. Der Begriff selbst, kurze Hose, ist in seiner simpel beschreibenden Art infantil, eine Bezeichnung, die sich ein Kind hätte einfallen lassen können, verwandt mit Fuß Ball, Kletter Baum, Nuckel Tuch, Holz Schuh. Schreibe ich stattdessen, dass ich heute Shorts trage, empfinde ich das gleich als weniger kindisch, und ergänze ich, dass sie olivgrün sind, klingt es nicht mehr, als hätte ich ein Kleidungsstück für einen Zehnjährigen angezogen, sondern eher eins für einen jungen Mann Anfang zwanzig, der unterwegs zu einem Musikfestival ist. Mitte der neunziger Jahre las ich einen Roman, der mich sehr beeindruckte und mir eine Form für Strömungen und Bereiche in mir gab, die bis dahin undefiniert geblieben waren. Es war Ein Kind zur Zeit des britischen Autors Ian McEwan. Die Haupthandlung kreist um das größte Grauen von allen, um ein Kind, das verschwindet, aber mir ging eine der parallelen Handlungsebenen des Buchs nicht mehr aus dem Sinn, in der es um Regression und Infantilität geht – ein Mann, der, wenn ich mich recht erinnere, Parlamentsabgeordneter ist, fällt in die Kindheit zurück, er trägt kurze Hosen und beginnt, in Bäume zu klettern, in denen er Baumhäuser baut und spielt, wie er es als Kind getan hat. Ich empfand das als grotesk, denn der Fall war in einem ganz anderen Maß und auf eine ganz andere Weise jeglicher Würde beraubt als der Fall in den Alkoholismus oder die Drogensucht. Gleichzeitig fühlte ich mich davon jedoch auch angezogen, denn ich war nicht nur von einer großen Nostalgie allem gegenüber erfüllt, was mit meiner Kindheit zusammenhing – dem Geruch schmelzenden Schnees und dem Anblick der weißen Eiskanten, von denen Wasser auf die Straße rann, zum Beispiel unter einem dunstigen Himmel, beschwor zuweilen eine Sehnsucht danach herauf, in die damalige Zeit zurückzukehren, in der ich das Gleiche als Kind erlebt hatte, die so intensiv war, dass es schmerzte –, ich sehnte mich auch danach, so umhegt zu werden, wie ich es damals wurde. Nicht direkt, nicht einmal in Worte gefasst, denn ich las McEwans Roman, und all diese vagen, uneingestandenen Gefühle flossen in eine Form zusammen, so dass ich sie von außen, als etwas Objektives in der Welt betrachten konnte. Das Groteske daran stand mir ebenso klar vor Augen. Der Erwachsene, der noch einmal Kind sein will, ist noch grotesker als der Alte, der noch einmal jung sein will, und diese Erkenntnis nutzte ich, um meinen ersten Roman zu schreiben, in dem die Sehnsucht danach, ein Kind zu werden, in die Sehnsucht nach dem Kind transformiert wurde – ich entsann mich der intensiven Gefühle, als ich mich, noch in der Grundschule, die allerersten Male verliebte, und ließ die Hauptfigur darin eintauchen und sich in ein Kind verlieben. Heute erscheinen mir diese Sehnsucht und die Gefühle seltsam, und als ich heute Morgen die kurze Hose anzog, da es erneut ein heißer Tag zu werden versprach, verspürte ich ein schwaches Unbehagen angesichts dieser Form, angesichts der Lebensverleugnung in diesem Zurückblicken, und musste mir selbst sagen, dies ist nur ein Stück Stoff, das die Beine unbedeckt lässt. Aber auch wenn die Nostalgie vorbei oder bis zur Unkenntlichkeit verwässert ist, weiß ich doch, dass in mir andere solcher unbewussten Strömungen und Muster existieren – so habe ich mich als Erwachsener stets in Beziehungen begeben, die an jene in meiner Kindheit erinnerten, und so nahm die Person, die ich liebte, die gleiche Position ein wie mein Vater, sie war jemand, den ich besänftigen, jemand, den ich zufriedenstellen wollte, den ich fürchtete und von dem ich mich zugleich bezaubern lassen konnte – und erwachsen zu werden bedeutet vielleicht mehr als alles andere, sich von solchen Mustern zu lösen, indem man sich ihrer bewusst wird und sie sich eingesteht, damit man in einem Bündnis mit demjenigen leben kann, der man ist oder sein will, und nicht mit dem, der man war oder sein wollte. An alten Mustern festzuhalten hat den Vorteil, dass sie einem Sicherheit geben, so schmerzhaft oder zerstörerisch sie auch sein mögen. Das Freie ist unsicher, in der Freiheit kann alles Mögliche passieren, und eines der Paradoxe des Lebens, jedenfalls eines der Paradoxe meines Lebens, besteht darin, dass ich heute, unterwegs ins Offene und Freie, keine Verwendung mehr dafür habe; im ersten Teil meines Lebens, bevor ich vierzig wurde, als alle Möglichkeiten vor mir lagen, hätte ich dies gebrauchen und mich daran erfreuen können. Denn was will ein Mann mittleren Alters in kurzer Hose mit Freiheit?
Katzen
Gestern Nachmittag lag im Gras unter dem Kastanienbaum ein Kaninchenkopf. Die Augen fehlten, und das Gesicht war so malträtiert worden, dass ich das Tier nur anhand seiner langen Ohren als Kaninchen identifizieren konnte. Die Katze hatte es getötet, es war das zweite Kaninchen, das sie innerhalb von zwei Tagen totgebissen hatte, beide Male mit demselben Modus Operandi, ein abgerissener Kopf, der ohne Augen und mit blutigem Fell im Garten zurückgelassen wurde. Während ich dies schreibe, sitzt die Katze in der Fensternische, schaut ins Haus hinein und wartet darauf, dass drinnen jemand aufsteht, sie sieht und hereinlässt. Es ist eine Sibirische Katze mit langem, grauschwarzem Fell und buschigem Schwanz, die von der Frau, der wir sie abkauften, Amaga getauft wurde, ein Name, den sie weiterhin trägt. Amaga schläft gern in Hohlräumen, je enger, desto besser, scheint es, Kisten, Kartons, Koffer, Puppenwagen, aber auch Fensternischen, Treppenstufen, Betten, Sofas und Stühle sind Plätze, an denen sie sich hinlegt. In unserem Haus lebt sie am ehesten als eine Art Untermieterin, sie kommt und geht, wann sie will, frisst ihr Futter an einem eigenen Ort, verschläft die Tage, ist die ganze Nacht draußen. Gelegentlich schauen Bekannte von ihr vorbei, ich sehe sie manchmal im Garten sitzen und darauf warten, dass sie herauskommt. In der Charakterisierung der Rasse heißt es, sie sei sensibel und leistungsfähig, und obwohl diese Beschreibung extrem anthropomorph ist, trifft sie dennoch recht gut die Art, wie ich sie erlebe. Als ich aufwuchs, hatten wir mehrere Katzen, und alle hatten verschiedene Persönlichkeiten, von der scheuen, aber sanften Sofi, einer grauen, langhaarigen Norwegischen Waldkatze, zu ihrer Tochter Mefisto, ebenfalls langhaarig, ganz schwarz und sowohl eleganter als auch hingebungsvoller als die Mutter, bis zu deren Sohn Lasse, der impulsiv, unkontrolliert und unübersehbar bedeutend dümmer war als seine Vorfahren. Schon wenn man ihn nur ansah, begann dieser Kater zu schnurren, er wurde niemals richtig stubenrein und liebte es, wenn man mit ihm schmuste. Dieses Schmusen war zweifellos der Höhepunkt in seinem Leben, weshalb er versuchte, es in Orgien in Körperkontakt zu verwandeln, seine Nase lief, die Pfoten fuhren mit ausgefahrenen Krallen auf und ab, er legte sich auf den Rücken, spreizte die Beine, rieb sich an allem, woran er sich nur reiben konnte. Lasse besaß weder Würde noch Integrität, und als er anfing, Mefisto zu verjagen und das Haus für sich allein in Beschlag zu nehmen, wurde er schließlich zum Tierarzt gebracht, wo ihn sein Schicksal ereilte. Amaga ist Lasses Gegenteil, ihre Integrität ist absolut, und obwohl sie genauso scheu ist wie Sofi, ist sie längst nicht so sanftmütig. Sie hat etwas Scharfes in ihrem Charakter, was selbst dann noch spürbar ist, wenn sie sich kraulen lässt, denn obwohl sie schnurrt und die Augen schließt, wenn man sie streichelt, bleibt sie zugleich stets wachsam; sie kann sich jederzeit abwenden, aufstehen und auf den Fußboden hinunterspringen, um sich zurückzuziehen. Als wir vor zwei Jahren einen Hund bekamen, ging sie als Erstes zum Angriff über, sie kratzte ihn neben dem Auge, so dass Blut floss, und von da an hatte der Hund panische Angst vor ihr, sie bestimmte völlig über ihn. Für das Mädchen, das wir ein Jahr zuvor bekommen hatten, interessierte sie sich anfangs nicht, als es dann jedoch gehen lernte und der Katze hinterherstolperte, duckte Amaga sich fast schildkrötenhaft auf den Boden und lief davon, wie sie es immer tut, wenn sie Gefahr wittert. Tatze, Tatze, rief das Mädchen – das war ihr Name für die Katze, was natürlich hilfreich war, denn so konnte ich, wenn ich das Tier sah, stets auf sie zeigen und »da ist die Tatze« sagen – und versuchte, sie zu erwischen, indem sie nach dem Schwanz griff. Normalerweise gelang ihr das nicht, schließlich war Amaga viel schneller und huschte einfach davon, es sei denn, sie schlief, und wenn wir dann nicht rechtzeitig zur Stelle waren, fauchte Amaga das Mädchen an, und wenn die Kleine sich davon nicht abschrecken ließ, kratzte die Katze sie. Zwei Mal ist das passiert, und seither hat sie Respekt vor Tatze, wirft nicht mehr mit Dingen nach ihr, greift nicht nach ihrem Schwanz, möchte sie aber gerne streicheln, was sie auch darf, obgleich ich nicht glaube, dass die Katze etwas davon hat, denn wenn die kleine Kinderhand durch das weiche und oft verfilzte Fell streicht, liegt sie nur angespannt und mit wachsamen Augen da. Diese Selbstbeherrschung ist bewundernswert, wenn man bedenkt, dass ihre Instinkte sie ansonsten zu durchgebissenen Kehlen und einem Schwelgen in Blut und Augen führen. Ja, durch das Zusammenleben mit der Katze stellt sich mir inzwischen die Frage, was eigentlich Instinkte sind. Früher habe ich sie mir als eine Art automatische Handlungen vorgestellt, als etwas vorprogrammiert Unveränderliches bei Tieren, getrennt von dem Wenigen, was sie an Gedanken und Gefühlen besitzen, und dass sie zu zähmen bedeutete, ihnen ein anderes System zu implantieren, das ebenso automatisch war, und dazu führte, dass die Instinkte zurückgedrängt oder in andere Bahnen gelenkt wurden. Dass die Instinkte bei großen Raubtieren stärker waren, etwa bei Löwen und Tigern, und deshalb leichter die Wand durchbrechen konnten, die ihre Zähmung errichtet hatte, so dass sie die Menschen, die sie gezähmt hatten, die sie fütterten und für sie sorgten, manchmal ohne Vorwarnung angriffen und in Stücke rissen. Wir können das Instinkt nennen, wir können es Natur nennen, wir können es das wahre Wesen der Tiere nennen. Aber wenn ich einen Löwen oder Tiger im Zoo sehe, habe ich nie das Gefühl, dass das, was wir Instinkte nennen, über sie bestimmt, dass sie ein Spielball ihrer Instinkte und gewissermaßen eingesperrt in eine kleine Zahl von Reaktionsmöglichkeiten sind. Mir kommt es eher so vor, als würden sie tun, was sie wollen, dass sie eine Handlung nie bewerten oder beurteilen, sondern einfach handeln, und der entscheidende Unterschied zwischen uns und ihnen nicht darin liegt, dass wir denken und sie nicht, sondern darin, dass wir moralische Vorstellungen haben und sie nicht. Ich bin mir sicher, Amaga hat uns aufmerksam beobachtet und weiß genau, wer wir sind, die sechs Mitglieder dieser Familie, die in ihrem Haus wohnt. Ich bin mir außerdem sicher, dass sie uns als eine Art große, dumme Katzen betrachtet, langsam und geistig träge, und selbst wenn sie nicht denken sollte, dass sie uns überlegen ist, bin ich mir doch sicher, dass sie es mit jeder Faser ihres Wesens spürt.
Campingplätze
Ein Campingplatz ist ein abgegrenzter Ort, der zum Übernachten gedacht ist und meist vor den Toren von Städten und größeren Ortschaften, nicht selten in der Nähe von Stränden oder anderen Erholungsgebieten liegt und an dem Reisende gegen Bezahlung in mitgebrachten Zelten oder Wagen die Nacht verbringen können. Außer dem kleinen Flecken Erde von ein paar Quadratmetern, den Zelt- und Wohnwagenbesitzer nutzen, solange sie dafür bezahlt haben, stellt der Campingplatz einige gemeinsam zu nutzende Einrichtungen wie Toiletten, Duschen und einen Kiosk zur Verfügung, in dem die gebräuchlichsten Waren erhältlich sind, sowie häufig auch einen Spielplatz für die Kinder und, wenn der Platz gut ausgestattet ist, ein Schwimmbecken. Der Campingplatz ist mit dem Hotel verwandt, das ebenfalls ein Ort ist, an dem Reisende die Nacht verbringen können, aber während das Hotel verlangt, dass man seine Privatsphäre aufgibt und sein Leben für ein paar Stunden in einem unbekannten Raum führt, im Laufe der Zeit bewohnt von Hunderten oder Tausenden Menschen, die sich alle diesen vier Wänden untergeordnet haben und sich für einige Stunden von deren Fremdheit einrahmen lassen, kommt der Campingplatz den Reisenden und ihrer Selbständigkeit entgegen, indem er sie ein eigenes, mitgebrachtes Zuhause errichten und so eine Zone von Vertrautheit und Heimlichkeit mitten im Fremden etablieren lässt. Nun könnte man meinen, diese Möglichkeit zur Selbständigkeit wäre der Unselbständigkeit des Hotels überlegen, dass wir in unserer sogenannten individualistischen Gegenwart die Freiheit des Campingplatzes mehr zu schätzen wüssten als die Einengung des Hotels, aber das stimmt natürlich nicht, der Status des Campingplatzes ist gering und in den letzten Jahrzehnten noch gesunken. Der Grund dafür ist eine simple, aber versteckte oder möglicherweise sogar geheim gehaltene Tatsache: Geld und Freiheit sind einander widersprechende Größen. Der sinkende Status des Campingplatzes ist untrennbar mit dem Vormarsch des Wirtschaftsliberalismus und der Privatisierung verbunden, und Geld schafft Unterschiede zwischen Dingen, stuft ab und etabliert Grenzen in einem System, das die Welt umfasst und in dem sich alles, was nicht bewertet werden kann, außerhalb befindet, wodurch das Offene direkt mit dem Wertlosen verbunden ist. Die Freiheit des Wanderers, des Menschen, der geht, wohin er will, und schläft, wo es sich gerade ergibt, existiert heute nur noch in Gestalt des Obdachlosen, der in der gesellschaftlichen Rangordnung ganz unten steht, und von einem Ort zum nächsten zu fahren und seine eigene Wohnstatt und sein eigenes Essen mitzubringen, was auf seine Weise die Welt öffnet und eine Reminiszenz an die Freiheit des Wanderers in sich birgt, wird ebenso wenig als erstrebenswert betrachtet. Man denke nur an die Roma und ihren Status in der Gesellschaft. Es gibt also eine Skala von dem obdachlosen Menschen, der auf Bänken und in Hauseingängen, in Parks und Stadtwäldern schläft, bis zu dem Menschen, der in riesigen Wohnungen oder Häusern, hinter Alarmanlagen und Portiers in der Lobby lebt. Aus diesem Grund ist es völlig undenkbar, dass ein Mann wie der Unternehmer Kjell Inge Røkke, der aus der Arbeiterklasse stammt, heute jedoch einer der reichsten Norweger ist, im Urlaub zelten geht, obwohl er das vielleicht in der Kindheit mit seiner Familie getan hat, und, falls dies zutrifft, sehr wohl den Geruch von taufeuchten Zeltwänden am Abend und das Geborgenheit schenkende, aber auch spannende Gefühl kennt, zum Klang der leisen Stimmen von den anderen Zelten einzuschlafen, vor denen die Männer und Frauen auf ihren Campingstühlen sitzen und sich in der einsetzenden Sommerdunkelheit unterhalten. Die Freude, unterwegs zu sein, denn am nächsten Tag wird das Zelt abgebaut, das Gepäck wieder im Auto verstaut, fährt man zum nächsten Campingplatz weiter, wo einen alles Mögliche erwarten könnte: Wird es dort ein Schwimmbecken geben? Werden sie dort Softeis verkaufen? Werden dort andere Kinder im selben Alter sein? Wird es Trampoline geben? Liegt der Platz am Meer und hat einen Sandstrand? Liegt er am Fluss, liegt er am Wald, am Berg, an einer Weide, auf der grimmige Ochsen stehen? Ich erinnere mich noch gut an die Spannung der Campingreisen, die ich in meiner Kindheit erlebte, in den siebziger Jahren, als Camping die populärste Art war, Urlaub zu machen, und man entlang der Straßen vollgepackte Autos stehen sah, neben aufgestellten Campingtischen und Kühltaschen, in einer Zeit, in der man sich noch nicht schämte, mitgebrachtes Essen zu verspeisen (das in der gleichen Beziehung zum Restaurant steht wie das Zelt zum Hotel), weil die Leute einfach weniger Geld hatten. Campingplätze gibt es noch, aber da die Menschen heute mehr Geld haben, ist das einzig Logische geschehen: Langsam wurden die mobilen Zelte und Wagen weniger mobil, um sie herum entstanden Gärten, sie wurden mit Annehmlichkeiten und Schmuckgegenständen gefüllt, mit Fernsehern und Computern, Kühlschränken und Wäschetrocknern, und ähnelten so immer mehr normalen Behausungen, in die sie sich nun endgültig verwandelt haben, so dass die Campingplätze nun Orte sind, an denen die Leute das halbe Jahr wohnen, eingezäunt und eingefriedet und unbeweglich, und das Einzige, was an Ortswechsel und Beweglichkeit erinnert, sind die Räder an den riesigen Wagen, die jetzt nicht mehr Freiheit bedeuten, sondern nur noch Symbole für die Freiheit sind. Diese Campingplätze gestalten eine Art erstarrte Sehnsucht, nicht unähnlich der Pose des Poeten, der in seinem Turm sitzt und über das Offene und Freie dichtet.
Sommernacht
Eines Nachts saß ich mit ihr, die ich liebte, auf einer Hotelterrasse, wir waren gerade unten in der Stadt gewesen und hatten in einem Restaurant gegessen, ich war verschlossen und gequält gewesen, sie hatte versucht, mich da herauszuholen, am Ende jedoch aufgegeben, so dass wir nun zwei Menschen waren, die schwiegen und nur ganz selten etwas sagten, um das Schweigen zu brechen, wenn es zu bedrückend wurde. Wir hatten draußen gesessen, in einem Hinterhof, entlang des Zauns wuchsen Rosenbüsche, die Blüten waren groß und blutrot. Der Himmel über uns war blau gewesen, die Häuserdächer um uns herum hatten im Sonnenlicht goldrot geleuchtet. An den anderen Tischen war die Stimmung gut gewesen, viele hatten ihre Mahlzeit beendet, saßen entspannt mit ausgestreckten Beinen und tranken Kaffee oder Wein, unterhielten sich und spielten mit den Händen mit irgendetwas auf dem Tisch herum, mit einer Schachtel Zahnstocher, dem Cognacglas, der Kaffeetasse. Wir zahlten, der Kellner bestellte uns ein Taxi, es war ein Kleinbus, und als er durch die Straßen aus der alten Stadt herausraste, war es, als würden wir und was wir waren, zwischen den vielen Sitzen verschwinden. Das Hotel lag am Ende einer langen Allee, auf einer kleinen Anhöhe über dem Sund. Unser Zimmer, in dem wir uns seit unserer Ankunft am späten Nachmittag kaum aufgehalten hatten, war weiß, maritim eingerichtet, mit Blick auf das Meer. Sie ließ Wasser in die Badewanne ein, die so groß war, dass in der Breite Platz für zwei bot. Ich löschte das Licht, und wir legten uns in das heiße Wasser. Die Sonne war untergegangen, aber der Himmel war noch hell und schwebte über dem dunklen Wasser. Auf der einen Seite stand schwarz und still ein großer Baum, und über diesem leuchtete ein einsamer Stern. Das muss ein Planet sein, sagte ich. Ja, stimmt, sagte sie. Vertragen wir uns, fragte ich. Natürlich vertragen wir uns, erwiderte sie. Wir liebten uns im Schlafzimmer, zogen uns an und gingen in das Restaurant hinunter, in dem die Tür zur Terrasse offenstand. Das Restaurant war leer, der Barkeeper räumte alles fort und ließ über die Musikanlage leise Jazz laufen. Wir traten auf die Veranda hinaus und setzten uns an einen Tisch. Das Wasser im Sund lag vollkommen still. An dem hellen Himmel waren weitere Sterne aufgetaucht, und hinter den drei alten Laubbäumen, die von dort, wo wir saßen, wie einer aussahen, war der Mond aufgegangen. Ich konnte ihn nicht sehen, nur eine schimmernde, gelbe Säule in dem dunklen Wasser zwischen den Blättern, wusste aber, dass er voll war. Eine Fledermaus schwirrte durch die Luft. Außer der leisen Musik drang kein Laut aus dem Hotel. Alle schliefen. Unten am Wasser quakte mehrmals eine Ente. Von der anderen Seite des Sundes, wo ein Wald bis zum Wasser hinab wuchs, hallte der Ruf eines anderen Vogels herüber, er stieß einen langen, pfeifenden Ton aus. Dann wurde es wieder still. Ich drehte den Kopf und blickte landeinwärts zu der kleinen Stadt hinüber, in der wir vorhin gewesen waren. Ihre Lichter leuchteten und glitzerten, umgeben von Dunkelheit, unter dem hellen Himmel. Es war eine magische Nacht. Nach einer Weile standen wir auf und nahmen den Pfad zum Wasser hinab, die letzten Meter auf einer steilen Treppe. Ein Holzsteg streckte sich hinaus, und an seinem Ende stand eine Bank, auf die wir uns setzten. Wir sagten nichts, wir mussten nichts sagen, dachte ich, das würde es nur zerstören, denn die Stille lag fast einer Glocke gleich über der Landschaft. Von hier aus sahen wir den Mond hoch über dem Wald, vollkommen rund. Ohne Konkurrenz von Bergen oder Städten gehörte ihm der Himmel. Obwohl das Wasser um uns still und glatt lag, schien es sich zu heben, dachte ich. Das eine oder andere leise Plätschern war zu hören, es kam von Fischen, die kurz auftauchten. Ist das nicht schön, sagte ich. Doch, sagte sie. Es ist sehr schön. Und bald wird es langsam hell, sagte ich. Ja, sagte sie. Dass es unsere letzte gemeinsame Nacht sein sollte, wusste in dem Moment keiner von uns, aber an den nächsten beiden Tagen kam alles, was zwischen uns gestanden hatte, zur Sprache, und wir fanden keinen anderen Weg, es zu bewältigen, als uns zu trennen. Bis heute schmerzt es mich, daran zu denken, dass wir in jener Nacht zusammen waren, der schönsten, die ich jemals erlebt habe, und sie nicht auf gleiche Weise erlebt haben können, wie ich es damals geglaubt hatte. Das Wir, das ich so intensiv empfand, galt nur für mich.
Sommernachmittag
Früher an jenem Tag, der unser letzter gemeinsamer sein sollte, waren wir in einer anderen Stadt gewesen, und nachdem wir durch die provinzielle Fußgängerzone gegangen waren, an dem Rathaus im Renaissancestil und der großen Backsteinkirche vorbei, gelangten wir in einen Park und legten uns in seiner Mitte aufs Gras. Abgesehen von ein paar Mädchen im Teenageralter, die vielleicht dreißig Meter hinter uns auf einer Bank im Schatten eines Baumes saßen, war kein Mensch zu sehen. Von überallher ertönte Vogelgesang. Normalerweise fällt er mir nicht auf, nun hörte ich nichts anderes. Ist es nicht eigenartig, dass die Vögel so singen, dass auch wir es schön finden, sagte ich. Es müsste ja nicht so sein. Ja, sagte sie. Im Garten meiner Eltern gibt es ein paar Vögel, die sich ganz furchtbar anhören. Nur einzelne heisere, hässliche Töne. Und dann die Möwen. Sie sind die ekligsten Vögel, die ich kenne. Wenn sie groß sind, erinnern sie einen an Dinosaurier. Es sind Dinosaurier, erwiderte ich. Das weiß ich, sagte sie. Aber nicht alle Vögel lösen diese Assoziation aus. Die Vögel hier im Park tun es zum Beispiel nicht. Stimmt, sagte ich und dachte an Dinosaurier, die wie kleine Vögel sangen. Das hätte unser gesamtes Bild von ihnen verändert. Ich sagte jedoch nichts mehr dazu, sondern zündete mir eine Zigarette an und legte mich rücklings ins Gras. Ein paar kreideweiße Wolken trieben über den blauen Himmel. Die Laubbäume raschelten in dem Wind, der nun, am Nachmittag, aufkam. Im Herbst und Winter neigt sich der Tag am Nachmittag dem Ende entgegen und trifft auf eine Wand aus Dunkelheit, im Frühjahr wird er gleichsam verdünnt, wohingegen er sich an einem Sommernachmittag vertieft und reicher wird. Das Licht wird voller, das Blau des Himmels tiefer, und in der Landschaft ist die Wärme der Sonne vom Tag bewahrt worden, an manchen Stellen stärker als anderswo, so etwa im glühend heißen Asphalt oder in der Luft auf kleinen Lichtungen im Wald. Die Seebrise weht vom Meer heran, lässt die Baumwipfel sachte, wie aus einem Schlaf erwachend, wanken, während die Blätter mit Geräuschen wie von einem rauschenden Bach oder von einem langgezogenen, genüsslichen Seufzer flattern. Sieh mal, dahinten, sagte sie, der Baum, siehst du, wie er leuchtet? Ich setzte mich auf und schaute zu dem Baum hinüber, in dessen Richtung sie genickt hatte. Er wuchs am anderen Ufer des schmalen Flusses, der an dem Park vorbeifloss. Das Bett, dem er folgte, war so tief, dass wir das Wasser nicht sehen konnten. Die Lichtreflexe, gleichsam zart und durchsichtig, die über den dicken Baumstamm flackerten, schienen deshalb aus dem Baum selbst zu kommen. Wir saßen da und beobachteten es. Das Licht bewegte sich wie Wasser, wogend und rieselnd. Ich dachte daran, wie es bloß möglich war, in eine Schule zu gehen und wild um sich zu schießen, alle zu töten, die man sah, Kinder und Erwachsene, wenn die Welt doch so ruhig und schön war, voller Vogelgesang und Sonnenlicht, strömender Flüsse und regungsloser Bäume. Wahrscheinlich war es so, weil das, was ist, und das, was geschieht, zwei verschiedenen Kreisläufen folgt, weil das Unveränderliche und sich Wiederholende, der Stillstand und die ewige Schönheit der Welt, etwas sind, was der andere Kreislauf, der Handlungen und Triebe, der in allem Wesentlichen der Kreislauf des Menschen ist, nur flüchtig streift. Werden diese Kreisläufe nicht offengehalten, sind auch sie nicht hell und frei, sondern verengen und verdunkeln sich, was mit uns allen in einem höheren oder geringeren Maße geschieht, dann sind sie es, die wichtig werden, sind sie es, die wir werden. Und das, bloß Mensch zu sein, und nicht Mensch in der Welt, ist gefährlich. Es ist immer schon gefährlich gewesen und wird immer gefährlich bleiben. Das dachte ich, als ich das vom Wasser reflektierte Licht betrachtete, das an diesem Sommernachmittag über den Stamm huschte, und wusste gleichzeitig, dass ich mich immer daran erinnern würde, weil ich es zusammen mit ihr sah.
Intelligenz
Als Intelligenz bezeichnet man die Fähigkeit, Zusammenhänge zu verstehen. Jeder Mensch besitzt diese Fähigkeit, die sich möglicherweise vor allem dadurch auszeichnet, dass sie begrenzt ist: Alle verstehen etwas, keiner versteht alles. Doch die Grenzen für das Verständnis sind unterschiedlich abgesteckt und in jedem Einzelnen von uns endlich. Dass traumatische Erlebnisse oder eine große Sensibilität äußeren Umständen gegenüber das Verständnisniveau absenken und große Willensanstrengungen es erhöhen können, heißt nicht, dass Intelligenz eine relative Größe, sondern nur, dass sie potentiell ist, was bedeutet, dass sie vollständig ausgeschöpft oder nicht vollständig ausgeschöpft werden kann. Der Begriff Intelligenz ist seiner Natur nach komparativ, denn wenn die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen, für alle gleich wäre, wie zum Beispiel die Fähigkeit, sich zu kratzen, für alle gleich ist und sich unmöglich abstufen lässt, wäre der Begriff Intelligenz sinnlos. Intelligent ist man nur, weil man intelligenter ist als andere. Und da die Intelligenz auch ein Zusammenhang ist, den man aus der Fähigkeit heraus verstehen muss, die man besitzt, sind diejenigen, die intelligenter sind als man selbst, oft schwerer, ja, fast unmöglich zu sehen. Der Intelligentere wird dich klar und deutlich sehen, all deine gedanklichen Begrenzungen werden für ihn offen zutage treten, während du den Intelligenteren nicht intelligenter finden wirst als dich selbst, sondern nur das vom Intelligenten erkennst, was innerhalb der Grenzen deines eigenen Denkens sichtbar wird. So ähnlich, wie ein Hund alle wie Hunde sieht. In egalitären Gesellschaften ist Intelligenz eine der ambivalentesten Kategorien, weil der Unterschied, den die Intelligenz verkörpert, nicht überbrückbar ist, und nicht überbrückbare Unterschiede sind nun einmal fundamental nicht-egalitär. In diesem Punkt gleicht Intelligenz der Schönheit, die für egalitäre Gesellschaften ebenfalls eine problematische Kategorie darstellt. Die Lösung war und ist, so zu tun, als gäbe es sie nicht oder als wäre sie unwichtig, ein Spiel, das in der Schule beginnt, in der sowohl Intelligenz als auch Schönheit doppelt kommuniziert werden: Man lernt einerseits, dass das Aussehen unwichtig ist und die inneren Werte zählen und dass alle den gleichen Wert haben, gleichzeitig wird diesem grundlegenden Wertverständnis, mit dem alle einverstanden sind und das alle Wissensebenen durchzieht, fortwährend dadurch widersprochen, dass die Schönen konsequent mehr Aufmerksamkeit bekommen und besser behandelt werden als die Hässlichen, von den Lehrern genauso wie von anderen Erwachsenen und ihren Mitschülern. Auch die Intelligenz bricht den Vertrag über die Gleichheit, allerdings auf andere Weise, denn während das Schöne keine Bedrohung darstellt, vielleicht weil es so unumgänglich und in gewissem Sinne so endlich ist, stellt die Intelligenz eine Bedrohung dar, denn wir können alle denken, wir können alle Zusammenhänge verstehen, und so kann es schwierig sein, sich damit abzufinden, dass manche besser denken, dass manche mehr Zusammenhänge verstehen und dies leichter und besser tun als man selbst. Die Bedrohung ist konstant vorhanden, in der Schulzeit jedoch akuter, da diese eine der wenigen Phasen ist, in der die mentalen Fähigkeiten und die Denkkapazität der Schüler nicht nur kontinuierlich getestet, sondern auch benotet werden, so dass sämtliche Unterschiede zwischen den Menschen diesbezüglich enthüllt werden. Alle Intelligenten, mit denen ich zur Schule ging, versuchten zeitweise, ihre Intelligenz zu verbergen, sie herunterzuspielen, denn die Konsequenz der Intelligenz bestand darin, dass sie ausgeschlossen wurden, dass sie unbeliebt waren und in manchen Fällen auch gemobbt wurden. Bei den schönen Menschen, mit denen ich zur Schule ging, passierte das nie, im Gegenteil, sie wurden ausnahmslos umschwärmt. Im Gymnasium hieß der intelligenteste von allen Gjermund, und in einer Pause schrieben wir mit schwarzem Filzstift in Großbuchstaben an die Tafel, die über die ganze Seitenwand des Klassenzimmers lief: GJERMUNDISTHÄSSLICH. Wir hielten das für ironisch, denn so etwas machten eigentlich nur Grundschüler, wohingegen wir Gymnasiasten waren, und was wir taten, Grundschüler zu parodieren, veränderte in unseren Augen die Botschaft und machte sie zu etwas anderem und Harmlosem. Auf Gjermund wirkte dies allerdings nicht so, er wurde leichenblass, als er es sah, ihm standen Tränen in den Augen. Er ließ sich jedoch nichts anmerken, und der Augenblick ging vorüber, zumindest für uns. Aber keiner entfernte die Buchstaben, so dass es für ihn wahrscheinlich anders war, da er diese Worte für den Rest des Schuljahres tagtäglich sehen musste. Ich habe keine Ahnung, was aus ihm geworden ist, aber eines weiß ich, dass sich die Beziehung zur Intelligenz im zwischenmenschlichen Bereich verändert, wenn man erwachsen ist, denn selbst eine egalitäre Gesellschaft benötigt Menschen, die durch ihre Intelligenz hervorstechen, und die Schule ist nicht in erster Linie dazu da, Wissen zu vermitteln, sondern um zu sieben, damit die Intelligenten an den richtigen Stellen landen, während alle anderen lernen sollen, dass es keine Unterschiede zwischen den Menschen gibt, damit sie später akzeptieren können, dass sie von den Intelligenten gelenkt werden.
Schaum
Alles geschieht gesetzmäßig. Die Luft bewegt sich, weil irgendwo Druckunterschiede entstanden sind und all die unsichtbaren Partikel in gewaltige Taschen rasen, um sie auszufüllen. Der Druck dieser Bewegung treibt die Meeresoberfläche vor sich her, und da sich keine Hohlräume bilden, in die das Wasser hineinfließen könnte, türmt es sich stattdessen zu Wellen auf. Diese Wellen werfen sich, getrieben vom Wind, stetig voran, und wenn sie auf die Oberfläche schlagen, ziehen sie Luft mit sich. Würden Luft und Wasser anderen Gesetzen folgen, könnte man sich vorstellen, dass die Luft, die von den Wellen nach unten gezogen wird, sich ansammeln und als große Unterwasserschächte, höhlenartige Systeme aus Luft existieren würde, doch so ist es natürlich nicht, denn die Luft ist leicht, das Wasser schwer, wodurch das Wasser augenblicklich alle Räume der Luft kurz unter der Meeresoberfläche ausfüllt. Doch die Bewegung ist mechanisch, die Luft vereinigt sich nicht mit dem Wasser, sie wird lediglich in immer kleinere Taschen gepresst, die alle die gleiche Form haben, kleine, runde Blasen, umgeben von ziemlich dünnen Wänden aus Wasser. Diese Blasen bilden für wenige Sekunden enorme Strukturen, die von den Wellen wieder hoch- und vorwärtsgepresst werden und die wir immer dann sehen können, wenn es windig ist auf See, wenn weiße Schaumspitzen auf der ansonsten grauschwarzen oder graugrünen Wasseroberfläche auftauchen und verschwinden. Prustend, zischend, rauschend werfen sie sich pferdekopfartig nach vorn, gehen unter, tauchen wieder auf. Diese Existenz des Schaums ist von extrem kurzer Dauer; wenn die Welle nach vorn geschleudert wird und sich auflöst, bleibt der Schaum eventuell noch für eine Sekunde im Wasser, in Gestalt sich windender Schleier aus Weiß, aber nur, um sich im nächsten Augenblick aufzulösen und zu verschwinden. Beständig scheint er zu sein, weil immer wieder das Gleiche geschieht, in diesem unfassbaren Überfluss von Wiederholungen, der das Universum kennzeichnet. Bilden sich an einem windigen Tag nicht unendlich viele kleine Luftblasen an der Oberfläche? In dieser Explosion aus Formationen, Strukturen, Mustern und Formen wird an nichts gespart. Sie währt nur kurz, am nächsten Tag liegt das Meer unter Umständen vollkommen glatt, und alle Schaumwirbel sind verschwunden, aber kurz ist sie nur für uns, ähnlich wie die Explosion des Weltalls aus Formationen, Strukturen, Mustern und Formen für uns von langer Dauer ist. Statt innerhalb von Sekundenbruchteilen werden sie über Milliarden Jahre hinweg zersetzt. Allerdings fällt es einem nicht sonderlich schwer, sich ein Wesen mit einem anderen Zeitempfinden vorzustellen, ein Wesen, für das eine Sekunde eine Ewigkeit währen würde und dem das Meer und der Schaum des Meeres unbeweglich und kristallisiert erschienen. Stellt man sich des Weiteren vor, dass nicht nur die Zeit relativ ist, sondern auch der Raum, könnte ein ganzes Universum in einer dieser Luftblasen Platz finden, die dann, für dieses Wesen, ewig unbeweglich und von Gesetzen gelenkt würden, die beobachtet und aufgezeichnet, aber nie verstanden werden könnten. Vielleicht würde diesem Wesen im Laufe der Zeit auffallen, dass sich alle Himmelskörper im unendlichen Raum entfernen, so dass es unausweichlich zu der Schlussfolgerung gelangen würde, dass dieses Universum der Entropie unterworfen ist und unerbittlich seinem Ende entgegengeht? Dass The Big Bang wie das Knallen des Champagnerkorken und das Universum wie die Ansammlung von Blasen war, die durch den engen, eiskalten Flaschenhals aufstiegen und sich in die wartenden Gläser ergossen, die irgendwo in einer Wohnung hell glitzernd zum Anstoßen erhoben wurden?
Birken
Im monochromen Reich des Waldes, in dem fast alles grün ist oder das Grün betont, wie etwa der gräuliche Farbton der Fichtenrinde, stechen die Birken mit ihrer weißen Borke heraus, und so kommt einem leicht der Gedanke, dass sie einer feineren Art angehören, einer Art Adel der Bäume, stramm und elegant, nervös und schön. Doch sowohl Schönheit als auch Genealogie sind Vorstellungen, die der menschlichen Sphäre angehören und weder über Tiere noch Bäume etwas Wesentliches aussagen, wenn wir also denken, dass die Fichte düster und grüblerisch, die Kiefer stolz und freiheitsliebend, die Espe ängstlich, die Eiche majestätisch und die Birke empfindsam und ihrem wahren Wesen nach vielleicht einem Pferd ähnlicher ist als einem Baum, sind wir selbst es, in die wir sie verwandeln, ist es unser eigenes Inneres, das wir in die Außenwelt verpflanzen. Doch obwohl ich weiß, dass es so ist, dass alles, was im Wald wächst, uns und unseren Vorstellungen darüber indifferent gegenübersteht, auch Darwins Evolutionstheorie und Linnés Verwandtschaftssystem, löst der Anblick eines von Buschwindröschen bedeckten Waldbodens in mir stets den Gedanken aus, dass Buschwindröschen nicht nur schön sind, sondern auch gut, während ich den Anblick einer Birke, zum Beispiel jener, die bei uns im Garten wächst, gleich neben dem Platz, an dem ich das Auto parke, mit Zerbrechlichkeit assoziiere. So ist es natürlich, weil die Birke inmitten der anderen Bäume heraussticht und ich in der menschlichen Sphäre daran gewöhnt bin, dass diejenigen, die herausstechen, auch immer verletzlich sind. Als ich aufwuchs, wusste ich genau, wo alle Birken wuchsen, sie definierten den Ort, an dem sie standen, ähnlich wie die Bushaltestelle, der Brückenkopf, der Felsvorsprung, der Sumpf und der Kolk es taten. Außerdem waren mir die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Birken wohlvertraut, wie sie im Winter völlig ihr Volumen verloren, so wie Hunde oder Katzen mit üppigem Fell schrumpfen, sobald sie nass werden, wie sich die Zweige im Frühjahr mit blassgrünen Knospen füllten, die sie unabhängig davon, wie alt die Bäume waren – und manche von ihnen waren wahrscheinlich im Alter meiner Großeltern –, jung und schüchtern wirken ließen, wie die kleinen paillettenförmigen Blätter im Sommer in dichten Streifen hingen und das Laubwerk aussehen ließen wie Kleider, und wie sie in den Stürmen Anfang des Herbsts manchmal Schonern glichen, deren Segel sich im Wind blähten, oder Schwänen, die mit den Flügeln schlugen, wenn sie von der Wasseroberfläche abhoben. Die Birke war eine der wenigen Baumarten, in die wir nicht kletterten, denn ihre Rinde war glatt, und es fiel uns schwer, mit den Schuhsohlen Halt zu finden, außerdem teilte sich der Stamm in der Regel erst weiter oben in größere Äste auf. Trotzdem waren die Birken nicht nur etwas für das Auge – jedes Frühjahr begaben wir uns zu ihnen, machten einen Schnitt in einen der Äste, legten eine Flasche daran, banden sie fest und ließen sie dort bis zum nächsten Tag hängen, an dem sie mit einer grünglänzenden Flüssigkeit gefüllt war, die wir tranken und die so süß war wie Saft. Ich weiß nicht, woher dieses Wissen stammte, aber alle besaßen es, dies war in den Siebzigern, als die Leute noch eigenhändig Beeren pflückten, nicht nur, um einen Spaziergang zu machen, sondern um die Haushaltskasse zu entlasten – aus dem gleichen Grund gingen sie auch fischen –, und das Leben der Kinder war in dieses Manuelle eingewoben, wir bastelten uns Flöten aus Salweidenzweigen und Löwenzahnstielen, Pfeil und Bogen aus jungen Laubbäumen, wir tranken Birkensaft und bauten Hütten aus Fichtenzweigen, saßen aber auch in unseren Zimmern und hörten Status Quo, Mud, Slade und Gary Glitter. Mit dem unfassbaren Alter der Baumarten beschäftigten wir uns nicht, aber ebenso wenig beschäftigten wir uns mit dem unfassbaren Alter unseres eigenen Geschlechts; für uns war alles hier und jetzt, war alles gleichzeitig, die Birke, das Auto, das Klassenzimmer, das Wäldchen, die Blaubeerbüsche, die Musik, die Fische, das Boot. Und in gewisser Weise stimmt es, denn wenn man von den Bergen und dem Meer absieht, währte so gut wie nichts von allem, womit wir uns umgaben, länger als ein Menschenleben, auch nicht die Birken, die in seltenen Fällen bis zu dreihundert Jahre alt werden können, aber normalerweise ungefähr hundert Jahre leben. Doch während sich die Musik, die wir hörten, vom englischen Glamrock zum englischen Punk und Postpunk wandelte und unsere Kleider von den weiten Hosenschlägen und Strickjacken der Siebziger zu den schwarzen Jacketts und Doc-Martens-Schuhen der Achtziger übergingen, und wir zur selben Zeit dort wegzogen, während es die Kinder, die neu hinzukamen, nicht mehr in den Wald zog, blieben die Birken stehen, wie sie es immer getan hatten, in Posen, die erstmals vor Millionen Jahren erprobt worden waren, in der Kreidezeit, als die weißen und schwarzen Stämme der Birken und ihre zartgrünen Blätter in den Wäldern auftauchten und ihre charakteristischen Bewegungen im Wind erstmals einen Platz auf der Bühne der Welt einnahmen.
Schnecken
Alle Namen, die wir diesen kleinen, weichen, schleimigen und dunklen Tieren gegeben haben, die überall, wo die Erde feucht ist, so gemächlich umherkriechen – Weichtier, Lungenschnecken, Blasenschnecken, Wegschnecken, Waldschnecken –, haben selbst etwas Feuchtes und Weiches, will mir scheinen, und wenn ich eine Schnecke sehe, fällt mir jedes Mal auf, dass sie unweigerlich Dinge auf den Kopf stellt, die ansonsten dem intim Menschlichen angehören und dort das Schönste ausdrücken – das Nackte ist das Verletzliche, das Feuchte ist die Lust, die Lunge ist der Lebensgeist, der Wald steht für die reine Natur –, denn die Nacktheit der Schnecken, die Feuchtigkeit der Schnecken, die Lungen der Schnecken und der Wald der Schnecken sind eher abstoßend, etwas zutiefst Unerwünschtes und Ekelerregendes. Dass Schnecken mit Haus weniger ekelhaft sind als Nacktschnecken, wie eine Schildkröte weniger ekelerregend ist als eine Kröte, könnte darauf hindeuten, dass es das Nackte an sich ist, worauf wir reagieren – was naheliegend erscheint, denn ist nicht das Ekelhafteste an einer Ratte ihr haarloser Schwanz? –, gleichzeitig gibt es jedoch genügend andere Tiere, die keine klare Trennlinie zwischen ihrem Äußeren und Inneren haben, zum Beispiel Quallen oder Regenwürmer, und die deshalb eigentlich genauso abstoßend wirken müssten. Ist es so, weil die Schnecken uns ähnlicher sind, weil sie uns näherstehen als Quallen? Und gerade die Tatsache, dass sie Lungen haben, dass sie Herzen haben, dass sie Augen haben, dazu führt, ihre Nacktheit abstoßend erscheinen zu lassen? Die Augen sind sicherlich eine völlig andere und fremdartige Konstruktion mit ihrer Positionierung am äußeren Ende eines Fühlers, von denen die Schnecke zwei Paare hat, das obere für die Augen, das untere für Gerüche, als eine Art ausgelagerte Nase. Was sehen wir, wenn wir sie nach einer verregneten Nacht langsam und erhobenen Hauptes kriechen sehen? Sie gleichen uralten Majestäten, Herrschern des Waldbodens, Kaisern des modernden Laubs und der feuchten Erde. Doch diese Würde, die uns ins Auge sticht und uns bewegen sollte, sie zu erheben, wie die Ägypter ihre Katzen erhoben und die Inder ihre Kühe, verschwindet völlig in dem Ekelhaften, das ihre Nacktheit und ihre schleimige Glätte ausstrahlen. Haben sie nicht etwas fast schon Provozierendes? Etwas Widernatürliches? Sie ähneln etwas aus dem Inneren, Organen in einem Körper, Lungen, Lebern, Herzen, die alle glatt und abgerundet und nackt sind, ohne einen Unterschied zwischen ihrem Inneren und dem Äußeren. Sind sie deshalb ekelerregend, weil sie aussehen wie kleine Lungen, die auf eigene Faust umherkriechen, mit Augen auf Stielen wie kleine Lebern, wie kleine Herzen? Deshalb wirken sie beinahe provozierend, denn sie sind widernatürlich, und dann kriechen sie ganz selbstverständlich herum, fressen, vermehren sich, und alles soll so verdammt langsam passieren, alles soll so verdammt würdevoll geschehen – zum Teufel, was glauben diese Schnecken eigentlich, wer sie sind? Millimeter für Millimeter glitschen sie zwischen den feuchten Grashalmen, den nassen Farnen dahin, über das weiche Moos, und leben ihr Leben in einem Bündnis mit ihren Fähigkeiten und Begrenzungen, wie alle Lebewesen es tun. In meiner Kindheit waren alle Schnecken schwarz und tauchten nach Regenfällen auf, wie aus dem Inneren der Erde, wenn sie auf einmal überall waren, mitten auf den Rasenflächen, den Wegen, selbst den schwarzen Asphaltstraßen in unserer Siedlung. Man erzählte sich, dass es Regen gäbe, wenn man auf eine Schnecke trete, so dass wir dies tunlichst vermieden. Trotzdem passierte es, manchmal aus Versehen, gelegentlich auch mit Absicht: Jedes Kind dürfte wohl irgendwann einmal auf eine Schnecke getreten sein und gesehen haben, wie ihr feuchtes Inneres auf den Asphalt quillt und das Schwarze sich mit Orange und Weiß vermischt. Seit damals hat eine neue Schneckenart Nordeuropa erobert, die sogenannten Mörderschnecken, große Wegschnecken aus Portugal oder Spanien, die sich rasend schnell vermehren und in den Gärten große Schäden anrichten, da sie sich alles einverleiben, was ihnen in den Weg kommt. In einem Jahr war unser Garten voll von ihnen, sie waren überall, als hätte es sie vom Himmel geregnet. Meine Schwiegermutter scharte regelmäßig die Kinder um sich und machte Jagd auf sie. Ausgerüstet mit einem Eimer und scharfen Gartenscheren gingen sie über das Gras, und wenn sie eine Schnecke fanden, schnitten sie diese in zwei Teile und warfen die Teile in den Eimer. Ich ertrug es nicht, ihnen dabei zuzusehen, geschweige denn, mich zu beteiligen, es war so grausam. Aber eine solche Attacke, bei der vielleicht zwanzig Schnecken eliminiert wurden, war nutzlos, denn ein paar Tage später waren sie wieder so zahlreich wie zuvor. Schließlich, einige Zeit nachdem meine Schwiegermutter abgereist war, ging ich selbst mit Eimer und Gartenschere hinaus. Ich kniete vor einer der braunen Schnecken. Sie war so lang wie mein Mittelfinger, dick wie eine Wurst, mit längs verlaufenden Rillen in der Haut, und der breite Fuß, der an einen Gürtel erinnerte, war beige. Als ich sie aufhob, wand sie sich träge in meinem Griff, und als ich sie zwischen die Klingen der scharfen Schere hielt, bewegten sich die Fühler. Ich presste die Schenkel der Schere aufeinander, und als die Klingen ihren Körper durchschnitten, hörte ich, dass sie schrie, leise und gellend.