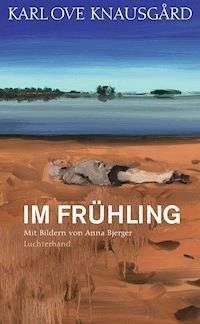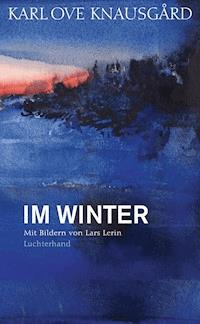
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Jahreszeiten-Bücher von Karl Ove Knausgård: "Im Winter" ist der zweite Teil einer aus vier Bänden bestehenden grandiosen Liebeserklärung an das Leben und die sinnlich erfahrbare Welt. Enthalten: Briefe an eine neu geborene Tochter, Essays über Weihnachten und den Schnee, das Licht am Winterhimmel und ein Feuerwerk zwischen den Jahren, das Leben im Winter.
„Es ist seltsam, dass es dich gibt, du aber nichts darüber weißt, wie die Welt aussieht. Es ist seltsam, dass es ein erstes Mal dafür gibt, den Himmel zu sehen, ein erstes Mal dafür, die Luft auf der Haut zu spüren. Es ist seltsam, dass es ein erstes Mal dafür gibt, ein Gesicht, einen Baum, eine Lampe, einen Pyjama, einen Schuh zu sehen. In meinem Leben passiert das so gut wie nie. Aber bald ist es so weit. In ein paar Monaten nur werde ich dich zum ersten Mal sehen.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die norwegische Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »OM VINTEREN« im Verlag Oktober, Oslo. Die Übersetzung wurde von NORLA, Oslo, gefördert.
Die Götterlieder der Älteren Edda. Übersetzt, kommentiert und herausgegeben von Arnulf Krause. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 2006, S. 21, 38, 141, 147, 178.
Copyright © der Originalausgabe 2015 by Forlaget Oktober as, Oslo
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 by Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Lektorat: Regina Kammerer
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Schutzumschlaggestaltung: buxdesign, München
Schutzumschlagillustrationen: Lars Lerin
ISBN 978-3-641-18747-7V002
www.luchterhand-literaturverlag.de
Brief an eine ungeborene Tochter | 2. DEZEMBER
DEZEMBER
Der Mond
Wasser
Eulen
Wasseraffen
Der erste Schnee
Geburtstag
Münzen
Christina
Stühle
Reflektoren
Rohre
Unordnung
Wintergeräusche
Weihnachtsgeschenke
Weihnachtsmänner
Gäste
Die Nase
Kuscheltiere
Kälte
Feuerwerk
Brief an eine ungeborene Tochter | 1. JANUAR
JANUAR
Schnee
Nikolai Astrup
Ohren
Björn
Der Otter
Menschliche Kontakte
Leichenzug
Krähen
Grenzen setzen
Die Krypta
Winter
Sexuelle Begierde
Thomas
Züge
Georg
Zahnbürsten
Das Ich
Atome
Loki
Zucker
Brief an eine neugeborene Tochter | 29. JANUAR
FEBRUAR
Hohlräume
Gespräche
Das Lokale
Q-tips
Hähne
Fisch
Stiefeletten
Lebensgefühl
J.
Busse
Gewohnheiten
Das Gehirn
Sex
Schneewehen
Punkt des Verschwindens
Die siebziger Jahre
Feuer
Operation
Kanaldeckel
Fenster
Brief an eine ungeborene Tochter
2. DEZEMBER. Den ganzen Sommer und ganzen Herbst hast du in ihrem Bauch gelegen. Umgeben von Wasser und Dunkelheit bist du durch die verschiedenen Entwicklungsphasen des Fötus gewachsen, die von außen der Evolution unserer menschlichen Art gleichen, von einem urzeitlich garnelenartigen Wesen mit einer Wirbelsäule, die geformt ist wie ein Schwanz, und einer Haut über dem zentimeterlangen Körper, die so dünn ist, dass sein Inneres deutlich hindurchscheint – wie eine dieser Regenjacken aus durchsichtigem Plastik, die du eines Tages sehen und über die du dann möglicherweise dasselbe denken wirst wie ich, dass sie irgendwie obszön sind, vielleicht, weil es einem widernatürlich erscheint, durch Haut zu sehen, und eine solche Regenjacke eine Art Haut ist, die wir anziehen –, bis zur ersten säugetierähnlichen Form, sobald nicht mehr die Wirbelsäule, sondern der Kopf dominiert, riesig im Verhältnis zum schlanken, gebogenen Unterkörper und den ungeheuer dünnen, stielartigen Armen und Beinen, ganz zu schweigen von den schmalen nadelähnlichen Fingern und Zehen. Die Gesichtszüge haben sich noch nicht entwickelt, Augen, Nase und Mund lassen sich nur erahnen, ähnlich wie bei einer Skulptur, an der die Feinheiten erst noch herausgearbeitet werden müssen. Und so ist es wohl auch, nur mit dem Unterschied, dass diese Arbeit nicht von außen nach innen verläuft, sondern von innen nach außen: Du veränderst dich selbst, du wächst aus dem Fleisch hervor. So, mit vagen und undeutlichen Gesichtszügen, sahst du Ende Juni aus, als wir Urlaub auf Gotland machten, in einem Haus, das tief im Wald auf der vorgelagerten Insel Fårö stand, auf einer kleinen Lichtung zwischen Kiefern, wo die Luft nach Salz roch und die Geräusche vom Meer zwischen den Stämmen rauschten. Vormittags gingen wir an einem der langen, schmalen Ostseestrände schwimmen, aßen in einem Gartenrestaurant dort, schauten an den Abenden Filme im Haus. Deine älteste Schwester war da neun, deine zweitälteste sieben und dein Bruder fünf, fast sechs. Sie halten einen ganz schön auf Trab, vor allem die beiden Mädchen, bei denen der Altersunterschied so gering ist, dass sie ständig das Gefühl haben, den Abstand zwischen sich aufs Neue ausloten zu müssen, weshalb sie sich streiten und gelegentlich auch prügeln, allerdings nie, wenn sie am Strand sind, nie, wenn sie schwimmen gehen, dann machen sie alles gemeinsam, und so ist es schon immer gewesen: Im Wasser verschwinden sämtliche Konflikte, sämtliche Probleme, dort vergessen sie alles um sich herum und spielen einfach. Außerdem haben sie ihren kleinen Bruder furchtbar gern, sie finden ihn unheimlich süß und behaupten manchmal, dass sie ihn heiraten würden, wenn er nicht ihr Bruder wäre. Zwei Monate später, Ende August, hatte er seinen ersten Schultag, und du lagst weiter winzig klein in deiner Finsternis, der Kopf gigantisch im Verhältnis zum Körper, die Beine wie kleine Zweige, aber mit Nägeln an den Zehen und den kleinen Fingern, die du nun bewegen konntest, was du wahrscheinlich auch tatest, dir den Daumen in den Mund stecktest, um an ihm zu lutschen. Du warst in allem ahnungslos, wusstest nicht, wo du warst oder wer du warst, aber vage, ganz vage, musst du gewusst haben, dass du warst, da es Unterschiede in deinen Zuständen gab, denn obwohl du nichts fühltest, wenn die Hand vor deinem Kopf schwebte, musstest du doch etwas empfinden, wenn du sie in den Mund schobst, und dieser Unterschied, dass etwas ist und etwas anderes etwas anderes ist, muss wohl der Ausgangspunkt des Bewusstseins sein. Mehr kann es jedoch kaum gewesen sein. Alle Geräusche, die zu dir drangen, Stimmen und Motorenlärm, Möwenschreie und Musik, Hämmern, Scheppern, Rufe, müssen einfach da gewesen sein wie die Dunkelheit und das Wasser, wie etwas, das du nicht als etwas Eigenes wahrnahmst, denn es kann für dich keinen Unterschied zwischen dir und deiner Umgebung gegeben haben: Du warst bloß etwas, das wuchs, das sich ausstreckte. Du warst das Dunkel, du warst das Wasser, du warst das Holpern, wenn deine Mutter eine Treppe hinaufging. Du warst die Wärme, du warst der Schlaf, du warst der winzige Unterschied, der entstand, sobald du erwachtest.
Die Bilder vom ersten Schultag deines Bruders wirst du jedoch irgendwann sehen; eins hängt im Esszimmer an der Wand, darauf stehen sie alle drei und lächeln, jeder von ihnen auf die für sie oder ihn typische Art, mit dem Garten, grün und glänzend im Licht der Sonne, als Hintergrund, in ihren neuen Schulkleidern, unter einem blauen Spätsommerhimmel.
Das klingt idyllisch und glückserfüllt. Und so war es auch, sowohl die Tage an den Stränden von Fårö als auch der erste Schultag waren gute Tage. Aber wenn du dies später einmal liest, Liebes, wenn alles gutgeht und die Schwangerschaft normal verläuft, was ich hoffe und glaube, wofür es allerdings keine Garantie gibt, wirst du wissen, dass das Leben nicht so aussieht, dass die Tage voller Sonne und Lachen nicht die Regel sind, obwohl es sie auch gibt. Wir sind uns gegenseitig ausgeliefert. All unsere Gefühle und Wünsche und Begierden, unsere gesamte individuelle psychologische Konstitution, mit ihren vielen merkwürdigen Schlupfwinkeln und harten Platten, einst in der frühen Kindheit erstarrt, fast unmöglich aufzubrechen, steht den Gefühlen und Wünschen und Begierden anderer und ihrer individuellen psychologischen Konstitution gegenüber. Auch wenn unsere Körper einfach und geschmeidig und in der Lage sind, Tee aus dünnstem und feinstem chinesischen Porzellan zu trinken, und unsere Manieren so gut sind, dass wir in den meisten Situationen wissen, was von uns erwartet wird, gleichen unsere Seelen Dinosauriern, sie sind wuchtig wie Häuser, bewegen sich langsam und schwerfällig, aber wenn sie ängstlich oder wütend werden, sind sie lebensgefährlich, schrecken sie vor nichts zurück, um zu verletzen oder zu töten. Mit diesem Bild möchte ich sagen, selbst wenn äußerlich alles vertrauenerweckend erscheint, geschehen im Inneren immer ganz andere Dinge, in einer ganz anderen Größenordnung. Während ein Wort im Äußeren nur ein Wort ist, das zur Erde fällt und verschwindet, kann ein Wort im Inneren zu etwas Gigantischem anwachsen und sich dort viele Jahre halten. Und während ein Ereignis im Äußeren bloß ein Ereignis ist, oft Vertrauen einflößend und stets schnell überstanden, kann es im Inneren alles entscheidend werden und Angst auslösen, die hemmt, oder Verbitterung hervorrufen, die hemmt, oder umgekehrt zu Übermut führen, der zwar nicht hemmt, aber zu einem Absturz führen kann, der genau dies tut. Ich kenne Menschen, die jeden Tag eine Flasche Schnaps trinken, ich kenne Menschen, die Psychopharmaka nehmen wie Bonbons, ich kenne Menschen, die versucht haben, sich das Leben zu nehmen, einer wollte sich auf dem Dachboden erhängen, wurde aber gefunden, ein anderer nahm eine Überdosis im Bett und wurde gefunden und im Krankenwagen in die Klinik gebracht. Ich kenne Menschen, die längere Zeit in der Psychiatrie verbracht haben. Ich kenne Menschen, die schizophren oder manisch-depressiv gewesen sind, die Psychosen erlitten haben und ihr Leben niemals in den Griff bekommen. Ich kenne Menschen, die verbittert sind und die Schuld für ihren Zustand oder Niedergang anderen geben, oft in Zusammenhang mit Dingen, die zehn oder zwanzig oder dreißig Jahre zurückliegen. Ich kenne Menschen, die ihre Liebsten schlagen, und ich kenne Menschen, die sich mit allem abfinden, weil sie nichts mehr vom Leben erwarten.
All dieses Erstarrte und Elende, dieses Leiden und dieser Sinnverlust sind auch Teil des Lebens und überall zu finden, aber nicht immer leicht zu sehen, nicht nur, weil der Ausgangpunkt im inneren Leben liegt, sondern auch, weil die meisten versuchen, diese Dinge zu verbergen, und weil es so schmerzt, sie sich einzugestehen: Das Leben soll doch heiter, das Leben soll doch leicht, das Leben soll doch wie die Kinder sein, die lachend am Ufersaum über den Strand laufen, die am ersten Schultag lächelnd in eine Kamera blicken, zum Bersten voll von Erwartung und gespannter Vorfreude.
Sein Kind an diesem ersten Tag zur Schule zu begleiten, was wir hoffentlich eines Tages mit dir tun werden, ist ein denkwürdiger Augenblick für die Eltern, aber auch ein herzzerreißender, denn dort, wo sie in den nächsten fünfzehn Jahren die meisten Tage verbringen werden, müssen sie allein zurechtkommen. Das ist es, was sie vor allem lernen werden, denke ich, mit anderen zusammen zu sein – denn das Wissen an sich ist nicht so wichtig, das erwerben sie früher oder später ohnehin. Vor einem Jahr hatte eine deiner Schwestern Probleme, ich sah es, konnte aber nichts dagegen tun. Es ging um ein paar Mädchen, mit denen sie gern zusammen sein wollte. Manchmal spielten die anderen mit ihr, dann war sie voller Freude, manchmal spielten sie nicht mit ihr, dann blieb sie auf dem Schulhof allein, dann saß sie allein in der Schulbücherei und las in der großen Pause. Ich konnte nichts tun. Ich hätte mit ihr reden können, aber erstens wollte sie nicht darüber sprechen, und zweitens, mit welchen Worten hätte ich ihr helfen können? Dass sie unglaublich toll, unglaublich schön ist und dass dies nur eine unbedeutende Episode am Anfang eines Lebens ist, das sich in einer vielfältigen Weise entwickeln wird, die sie und wir nicht überblicken können? Es half ihr nicht, dass ich sie toll fand, wenn die anderen es nicht taten. Es half ihr nicht, dass ich sie humorvoll und clever fand, wenn die anderen es nicht taten. Als sie und ich eines Abends spazieren gingen, wollte sie wissen, ob wir nicht umziehen könnten. Ich fragte, wohin. Australien, sagte sie. Ich dachte, das ist so weit weg, wie man nur kommen kann. Ich fragte, warum Australien? Sie antwortete, dort hätten sie Schuluniformen. Und warum willst du eine Schuluniform tragen, fragte ich. Weil dann alle das Gleiche anhaben, antwortete sie. Warum ist das so wichtig, wollte ich wissen. Weil keiner sagt, dass meine Kleider schön sind, wenn ich neue anhabe, meinte sie. Das sagen sie zu allen anderen, wenn sie neue Kleider tragen. Sind meine Kleider nicht schön, fragte sie und sah mich an. Doch, antwortete ich ihr und sah fort, denn in meinen Augen standen Tränen. Doch, deine Kleider sind wirklich schön.
Schwierigkeiten erwarten auch dich. Aber bis dahin ist es noch weit! Jetzt ist es Dezember, drei Monate werden noch vergehen, bis du geboren wirst, und danach folgen ein paar Jahre, in denen du vollkommen abhängig von uns bist und in einer Art Symbiose mit uns lebst, bis der Tag im August kommt, an dem wir auch dich zu deinem ersten Schultag begleiten. Wenn du dies liest, liegt er bereits Jahre zurück und ist eine deiner zahlreichen Erinnerungen.
Gestern hatten wir hier einen heftigen Temperatursturz, am Abend waren es ein paar Grad unter null, alle Pfützen froren zu Eis, und die Scheiben der Autos waren vom Frost geriffelt. Bevor ich ins Bett ging, stand ich draußen auf dem Hof und schaute zum Himmel hinauf, der ganz klar und voller Sterne war. Als ich ins Haus kam, lag Linda auf dem Rücken im Bett, ihr Bauch war halb entblößt. Sie hat gerade getreten, sagte sie. »Sie«, das bist du. Vielleicht tut sie es noch mal? Ich schaute den Bauch an, und dann, nur Sekunden später, sah ich, dass er kurz ausbeulte, es kam mir vor, als huschte ein leichtes Kräuseln über ihn, ähnlich wie sich das Wasser kräuselt, wenn sich ein Meerestier direkt unter der Oberfläche bewegt. Das war dein Fuß, der von der Innenseite gegen die Decke trat. Wärst du in diesem Moment geboren worden, hättest du überleben können, auch wenn die Chancen schlecht gestanden hätten. Du träumst, wenn du schläfst, und du erkennst die unterschiedlichen Geräusche, die du hörst.
Vielleicht hast du begonnen, etwas von der Welt draußen zu ahnen, und wenn du die Fähigkeit hättest zu reflektieren, würdest du vermutlich annehmen, die Welt bestünde aus einem kleinen dunklen, mit Wasser gefüllten Raum, in dem du schwebtest, und dass alles außerhalb rein akustisch wäre und aus Klängen aller Art bestünde. Dass dies das Universum wäre, in dem du ganz allein wärst. Und vielleicht ist es hier draußen ja auch so, dass wir in einem großen, schwarzen Raum voller Sterne und Planeten allein sind und es außerhalb dieses Raums Geräusche gibt, sozusagen aus einem noch größeren Raum, in den wir niemals werden vordringen können, sondern nur, mit der Zeit, vielleicht vom äußersten Rand des Universums kommend, die Geräusche hören können.
Es ist merkwürdig, dass du existierst, aber nichts darüber weißt, wie die Welt aussieht. Es ist merkwürdig, dass es ein erstes Mal dafür gibt, den Himmel zu sehen, ein erstes Mal dafür, die Sonne zu sehen, ein erstes Mal dafür, die Luft auf der Haut zu spüren. Es ist merkwürdig, dass man ein Gesicht, einen Baum, eine Lampe, einen Pyjama, einen Schuh zum ersten Mal sieht. In meinem Leben kommt das kaum noch vor. Bald ist es jedoch so weit. In wenigen Monaten werde ich dich sehen – zum ersten Mal.
Der Mond
Der Mond, dieses gewaltige Gebirge, das weit draußen die Reise der Erde um die Sonne begleitet, ist der einzige Himmelskörper in unserer unmittelbaren Nähe. Wir sehen ihn abends und nachts, wenn er das Licht der Sonne reflektiert, das uns verborgen ist, so dass der Mond selbstleuchtend wirkt und in der Höhe scheinbar allein das Terrain beherrscht. Manchmal wirkt er weit entfernt, wie eine kleine, ferne Kugel, manchmal kommt er näher und hängt wie eine große leuchtende Scheibe knapp über den Baumwipfeln wie ein Schiff, das sich dem Hafen nähert. Mit bloßem Auge kann man erkennen, dass seine Oberfläche uneben ist; manche Flächen sind hell, andere dunkel. Bevor das Teleskop erfunden wurde, glaubte man, die dunklen Bereiche wären Meere. Andere dachten, es wären Wälder. Heute wissen wir, dass die Schatten dort oben riesige Ebenen aus Lava sind, die einst aus dem Inneren des Monds hochdrang, ehe sie erstarrte. Richtet man ein Teleskop auf den Mond, sieht man, dass er vollkommen leblos und unfruchtbar ist und aus Staub und Steinen besteht wie eine riesige Sandgrube. Nicht einmal Wind wirbelt dort etwas hoch; auf dem Mond herrscht Stille und Reglosigkeit, er ist wie ein ewiges Bild von einer Welt vor dem Leben oder einer Welt nach dem Leben. Ist es so zu sterben? Ist es das, was uns erwartet? So ist es wohl. Auf der Erde, umgeben vom überbordenden, kriechenden und fliegenden Leben, bekommt der Tod etwas Versöhnliches, als wäre auch er ein Teil von allem, was keimt und wächst, als verschwänden wir darin, wenn wir sterben. Doch das ist eine Illusion, eine Fantasie, ein Traum. Das interstellare Nichts, das absolut Leere und absolut Schwarze, mit der ewigen und unendlichen Einsamkeit, die dies bedeutet und die der Mond uns, indem er der Erde ähnelt, blitzartig erkennen lässt, ist das, was uns erwartet. Der Mond ist das Auge des Todes, blind hängt es dort, gleichgültig uns und unseren Geliebten gegenüber, diesen Wellen aus Leben, die sich tief unter ihm auf der Erde heben und senken. So bräuchte es allerdings nicht zu sein, denn der Mond ist uns so nah, dass man von hier aus zu ihm reisen kann wie zu einer weit entfernten Insel. Zwei Tage dauert diese Reise. Überdies war uns der Mond früher so viel näher. Heute ist er gut dreihunderttausend Kilometer entfernt; als er entstand, waren es nur zwanzigtausend. Er muss gigantisch gewesen sein am Himmel. Wenn wir bedenken, welche seltsamen Wesen von der Urzeit bis in unsere Tage auf der Erde erschaffen wurden, mit den eigentümlichsten Besonderheiten ausgestattet, um den unterschiedlichen Bedingungen in ihrer Lebensumwelt zu begegnen, hätte es im Grunde keiner großen Verschiebungen bedurft, damit auch Wesen hätten entstehen können, die mit den notwendigen Eigenschaften ausgerüstet gewesen wären, die kurze Strecke im Raum zu bewältigen, so wie das Leben auf der Erde seit jeher die Entfernungen selbst zu den entlegensten Inseln bewältigt und das Leben zu ihnen getragen hat. Die Schachtelhalme, diese primitiven Urzeitpflanzen, wäre es nicht vorstellbar, dass ihre Halme eine Art Rotation entwickelt hätten, die sie langsam durch die Atmosphäre und den Weltraum getrieben hätten, bis sie etwa eine Woche später sanft im Mondstaub gelandet wären? Oder die Quallen, hätten sie nicht die Meere verlassen und wie Glocken durch die Luft schweben können? Luftfische, wären diese wirklich seltsamer gewesen als blinde, selbstleuchtende Tiefseefische? Ganz zu schweigen von den Vögeln. Dann hätte das Leben auf dem Mond an das auf der Erde erinnert, wäre aber gleichwohl anders, gewissermaßen eine radikale Version der Galapagos-Inseln gewesen, und die Vögel des Mondes, fast schwerelos, sauerstoffunabhängig, hätten in Schwärmen über der Erde auftauchen können, sichtbar als kleine Punkte hoch, hoch oben, die sachte größer geworden wären und mit ihren riesigen, papierdünnen Flügeln über dem Land geschwebt hätten, schimmernd im Licht des Mondes, dieser Heimstatt des Heiligen und Schrecklichen für die Menschen jener Zeit.
Wasser
Jeden Tag steht in einer großen Glaskaraffe Wasser auf dem Tisch. Es ist ganz klar, ganz durchsichtig, und hat selbst keine Form: Gieße ich es in die Gläser der Kinder, nimmt es augenblicklich den neuen Wänden folgend Gestalt an. Kleckere ich, läuft es, leicht anschwellend, über den Tisch und tropft unter Umständen auf den Fußboden, denn das ist die charakteristischste Eigenschaft des Wassers, es sucht stets den Weg zum niedrigsten Punkt des Raums. Regnet es draußen, gleiten die Tropfen langsam die Fensterscheibe herab, auf die Fensterbank, wo sie sich in Trauben sammeln, die sich lösen und auf die Erde unter ihr fallen, wogegen das Wasser in den Gläsern der Kinder, die diese gierig an die Lippen setzen, ihre Kehlen hinabrinnt. Dass diese Flüssigkeit, ohne eigene Farbe, ohne eigenen Geschmack, ohne eigene Form, so leicht zu kontrollieren, ganz in der Gewalt ihrer Umgebungen, etwas mit den Wellen zu tun haben soll, die sich jeden Herbst und Winter auf dem Meer entlang der Küste auftürmen und mit gewaltiger Kraft an Land schlagen, in diesem Inferno aus Schaum, Rauschen und Tosen, ist ebenso schwer zu fassen wie die Tatsache, dass die kleine Flamme, die so still vom Docht der Kerze hochragt, etwas mit den gewaltigen, kilometertiefen Bränden gemein haben soll, die manchmal in den Wäldern wüten und alles vernichten, was ihnen in den Weg kommt. Aber so ist es. Wasser steht auf dem Tisch, Wasser läuft aus dem Hahn. Wasser lässt Straßen glänzen, Felder dunkler werden, Wiesen leuchten. Wasser rauscht in Bächen, stürzt Berghänge herab, liegt unbeweglich in enormen Ansammlungen mitten im Wald. Wasser umspült Kontinente. In meiner Kindheit, als die Welt noch neu war, zog es uns ans Wasser. Zum Waldsee, zum Bach, zur schmalen Bucht. Keiner von uns machte sich Gedanken darüber, was es mit dem Wasser auf sich hatte, aber es erfüllte uns mit etwas, einer Spannung, etwas Unerhörtem und Dramatischem, einer Art Dunkelheit. Das Wasser war ein Rand, unsere Welt endete dort, selbst wenn es nur wie ein Kolk im Wald lag, einige hundert Meter von den hell erleuchteten Häusern entfernt, oder unter der Betonbrücke unten am Bootshafen, wo wir an Abenden im März manchmal von Eisscholle zu Eisscholle sprangen, eigentümlich aufgekratzt in der bläulichen Dunkelheit, die Stiefeletten und Hosenbeine schwer von Nässe, die Handflächen rot von Kälte. Mehr als dreißig Jahre später kehrte ich dorthin zurück und begegnete meinem besten Freund von damals. Ich fragte ihn, ob er sich erinnere, dass wir auf die Eisschollen gesprungen seien. Er nickte und war genauso erstaunt wie ich, dass wir das tatsächlich getan hatten, wir hätten dort leicht umkommen können. Und dann erzählte er mir etwas, das im Vorjahr passiert war. Er war denselben Weg hinabgegangen, im Winter, spätabends, es schneite und die Sicht war schlecht, er war über die Brücke gegangen, von der aus er, tief unten im schwarzen Wasser, Licht gesehen hatte. Er hatte sich vorgelehnt, was zum Teufel leuchtete dort unten auf dem Grund? Es war ein Auto, das von der Straße abgekommen war, es musste gerade erst passiert sein. Er rief einen Krankenwagen, er kam, Taucher schwammen zu dem Wagen hinunter und hoben den Fahrer heraus, er war ertrunken. Das Auto wurde am nächsten Tag geborgen, und obwohl ich es nicht gesehen hatte, stand mir das Bild klar und deutlich vor Augen, wie das Wasser aus den Öffnungen in der Karosserie des in der Luft hängenden Wagens strömt und plätschernd die schwarze Oberfläche trifft, auf der die wirbelnden Schneeflocken schmelzen.
Eulen
Während die Gesichter anderer Raubvögel vorspringen und in gewisser Weise aerodynamisch wirken, im Flug wie eine Verlängerung des Körpers mit dem Schnabel als Pfeilspitze, ist das Gesicht der Eulen flach und rund und ihr Schnabel klein und erinnert an eine Nase. Der flache und runde Eindruck dieses Gesichts wird von einem Kreis aus Federn verstärkt, der es umkränzt, und dass für ihr Gesicht gewissermaßen Raum geschaffen wurde, ähnlich einer Lichtung im Wald, lässt das Gesicht der Eule nackt und fast ein wenig greisenhaft erscheinen. Wahrscheinlich wird die Eule deshalb im Volksglauben als unheimlicher Vogel betrachtet, verbunden mit den Mächten der Toten: Wenn eine Eule in der Nähe des Hauses ruft, wird darin bald jemand sterben. Die anderen Raubvögel sind nur Raubvögel. Auch wenn es vom Adler hieß, er könne kleine Kinder greifen, und er folglich als Gefahr wahrgenommen wurde, war er doch niemals unheimlich, weil der Adler eins ist mit sich selbst, seine Gestalt und seine Handlungen bilden eine Einheit, und dieses Einheitliche, obgleich Grausame – etwa, wenn die kräftigen Krallen einen Körper aufreißen und der gelbe Schnabel rot von Blut ist und die Augen unmenschlich ins Leere starren, seelenlos und kalt –, ist vorhersehbar. Das Unheimliche ist an das Unvorhersehbare, das Ambivalente geknüpft, an das, was vom einen ins andere umschlägt. Die Eule ist ein Raubvogel, aber ihr Gesicht gleicht dem eines alten Mannes. Und obwohl auch ihre Augen starren, sind sie doch groß und rund, und im Gegensatz zu allen anderen Vögeln haben Eulen Lider, so dass sie blinzeln. Ich sah einmal eine Eule in einem Tierpark, und auch wenn es mich nicht wirklich schockierte, als sie plötzlich blinzelte, war es dennoch aufwühlend. Nie zuvor hatte ich darüber nachgedacht, dass Vögel nicht blinzeln. Als diese Eule, es war ein Uhu von der Größe eines Kleinkinds, auf einmal blinzelte, kippte sie vom Vogelhaften ins Menschliche. In Kombination mit ihrer vollkommenen Ruhe erweckte sie den Eindruck, etwas zu wissen, als besäße sie eine Form von Erkenntnis, die tiefer und wahrhaftiger war als alles, was uns umgab, der asphaltierte, sonnenbeschienene Weg vorbei an den Käfigen, die Kioske, die Eis und Limonade und Bratwürstchen verkauften, die Eltern, die kleine Karren mit Rucksäcken oder Kindern darin hinter sich herzogen. Aus diesem Grund ist die Eule in der römischen Mythologie die Begleiterin Minervas; sie ist die Göttin der Weisheit, Musik und Poesie. Als Hegel schrieb, dass die Eule der Minerva erst in der hereinbrechenden Dämmerung ihren Flug beginnt, dachte er an die Weisheit. Seine Worte lassen sich so verstehen, dass die Weisheit oder die Erkenntnis auf das Geschehen folgt wie die Nacht auf den Tag, aber man kann es auch so verstehen, dass die Weisheit zur Nacht gehört, zum Finsteren, Dunklen, Schlafenden, zu dem, was dem Toten naheliegt, aber nicht tot ist, zu jenem Grenzland, in dem die Eulen im Volksglauben unterwegs sind, wenn sie mit ihren Rufen die Ankunft des Todes in der Welt der Lebenden ankündigen. Und natürlich könnte man sagen, dass die mythologische Verbindung der Eulen zur Dichtung aus dem gleichen Grenzland stammt. Das Auffälligste an den Eulen ist allerdings nicht, was sie verkörpern, sondern was sie sind, für sich genommen, als Vögel. Denn nichts von dem, was sich um das Auftreten der Eulen bündelt, worin sie für uns eintauchen und woraus sie wieder auftauchen, gehört zum Wesen der Eulen, das vielmehr das indifferente und instinktive eines Raubvogels ist. Eulen leben davon, kleine Tiere zu töten, die sie mit ihren Krallen in Stücke reißen und im Ganzen verschlucken. Was sie nicht verdauen können, wie Knochen und Fell, würgen sie wieder heraus, in diesen charakteristischen Ballen, die man gelegentlich auf dem Waldboden findet. Alles an den Eulen ist darauf abgestimmt, selbst der Federkranz um das Gesicht, weil dieser Kranz Geräusche auffängt wie ein Trichter, nicht unähnlich der Art, wie altmodische Kopfhörer arbeiteten, und weil Geräusche das sind, wonach Eulen sich bei der Jagd in erster Linie orientieren. Ihre Ohren sind asymmetrisch, damit sie besser lokalisieren können, woher die Laute kommen. Nachts sehen Eulen bis zu hundert Mal besser als wir, und ihr Federkleid ist so extrem weich, dass ihr Flug nahezu lautlos ist. So können sie ganz still in pechschwarzer Finsternis durch den Wald schweben, ohne gegen Stämme und Äste zu stoßen, und auf dem Erdboden ihre Beute aufspüren, die durch nichts gewarnt wird, bis die Krallen in sie eindringen. Die Eule ist nichts anderes als das: ein lautloser und effektiver Raubvogel. Wenn die wahre Aufgabe der Dichtung die Offenbarung ist, dann ist es dies, was sie offenbaren soll, dass die Wirklichkeit ist, was sie ist. Dass der Wald mit seinen dichtstehenden Fichten und seinem schneebedeckten Boden wirklich ist. Dass die einsetzende Dämmerung wirklich ist. Dass die Eule, die von ihrem Ast abhebt und über das Feld fliegt, wirklich ist. Dass ihre lautlosen Flügelschläge wirklich sind, dass die unsichtbaren und für unsere Ohren unhörbaren Schallwellen, die an ihre Ohren dringen, wirklich sind. Dass die jähe Änderung der Flugrichtung wirklich ist, dass der Sturzflug zur Erde, mit den Krallen voraus, wirklich ist, dass die Maus, in die ihre Krallen eindringen, wirklich ist. Dass das Rot des Bluts auf dem grauweißen Fell wirklich ist, wenn die Flügel schlagen und die Eule durch die Dunkelheit aufsteigt und zwischen die Baumstämme fliegt, wo sie im nächsten Moment verschwindet.