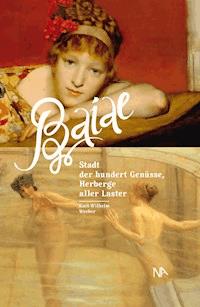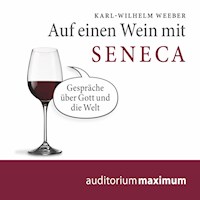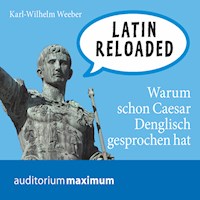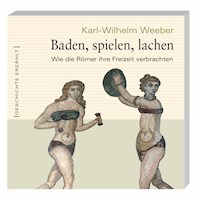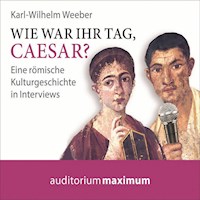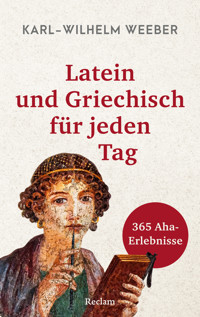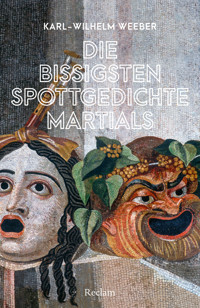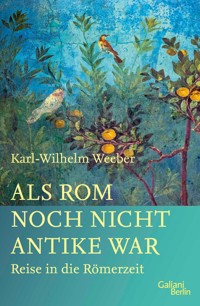
24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Rom von unten: Von Sklaven, Bio-Römern, Traumdeutern, vierbeinigen Zirkusstars, Normalos und Außenseitern. Rush Hour in den Hauptstraßen, Obdachlose unter den Brücken und prächtige Wochenendhäuser, hohe Einwanderungszahlen und Unisex-Toiletten – New York? Berlin? Rom zur Kaiserzeit! Diese Zeitreise ist ein Muss für alle Geschichtsinteressierten, die mehr über das echte Leben im Alten Rom wissen möchten. Was war eigentlich auf den Straßen los, während die ruhmreichen Gladiatoren sich in der Arena die Schädel einschlugen und Feldherren venividivici das Römische Reich vergrößerten? Wie lebte es sich in der kosmopolitischen Hauptstadt, berühmt für eine blühende Wirtschaft, mit Smog und Stau? Und in einer Klassengesellschaft mit dekadentem Luxus und großer Armut? Der provokante Slogan »60-Jährige von der Brücke!« wurde schon zur römischen Kaiserzeit heftig diskutiert. Karl-Wilhelm Weeber führt als kundiger Cicerone mit viel Witz und Esprit durch das Rom der Kaiserzeit, er erzählt, was Nachtigallen kosteten (lebend) und wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, das 10. Lebensjahr zu erreichen. Wir erfahren, dass Xenophobie in der Einwanderungsstadt (Griechen! syrische Frauen!) die Ausnahme war, Diskriminierung von Menschen mit Behinderung aber gang und gäbe, dass schon damals Raubbau an der Natur betrieben und kritisiert wurde, und dass – funktionierender Rechtsstaat hin, florierende Wirtschaft her – das Leben für die Allermeisten kein Zuckerschlecken war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Karl-Wilhelm Weeber
Als Rom noch nicht Antike war
Reise in die Römerzeit
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Karl-Wilhelm Weeber
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Karl-Wilhelm Weeber
Karl-Wilhelm Weeber, Honorarprofessor für Alte Geschichte, arbeitet seit Jahrzehnten zur römischen Alltags- und Sozialgeschichte sowie zum Fortleben der lateinischen Sprache. Er hat zahlreiche Bücher dazu veröffentlicht, darunter Spectaculum. Die Erfindung der Show im antiken Rom (2019), Couchsurfing im Alten Rom: Zu Besuch bei Wagenlenkern, Philosophen, Tänzerinnen u.v.a. (2022) und Latein und Griechisch für jeden Tag (2023).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Rom von unten: Von Sklaven, Bio-Römern, Traumdeutern, vierbeinigen Zirkusstars, Normalos und Außenseitern.
Rush Hour in den Hauptstraßen, Obdachlose unter den Brücken und prächtige Wochenendhäuser, hohe Einwanderungszahlen und Unisex-Toiletten – New York? Berlin? Rom zur Kaiserzeit! Diese Zeitreise ist ein Muss für alle Geschichtsinteressierten, die mehr über das echte Leben im Alten Rom wissen möchten.
Was war eigentlich auf den Straßen los, während die ruhmreichen Gladiatoren sich in der Arena die Schädel einschlugen und Feldherren venividivici das Römische Reich vergrößerten? Wie lebte es sich in der kosmopolitischen Hauptstadt, berühmt für eine blühende Wirtschaft, mit Smog und Stau? Und in einer Klassengesellschaft mit dekadentem Luxus und großer Armut? Der provokante Slogan »60-Jährige von der Brücke!« wurde schon zur römischen Kaiserzeit heftig diskutiert.
Karl-Wilhelm Weeber führt als kundiger Cicerone mit viel Witz und Esprit durch das Rom der Kaiserzeit, er erzählt, was Nachtigallen kosteten (lebend) und wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, das 10. Lebensjahr zu erreichen. Wir erfahren, dass Xenophobie in der Einwanderungsstadt (Griechen! syrische Frauen!) die Ausnahme war, Diskriminierung von Menschen mit Behinderung aber gang und gäbe, dass schon damals Raubbau an der Natur betrieben und kritisiert wurde, und dass – funktionierender Rechtsstaat hin, florierende Wirtschaft her – das Leben für die Allermeisten kein Zuckerschlecken war.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Lisa Neuhalfen
Covermotiv: Rome. Italy. Fresco depicting scenes of a garden from Villa Livia of Prima Porta, 1st C AD, Palazzo Massimo alle Terme, Museo Nazionale Romano © mauritius images / Susana Guzman / Alamy / Alamy Stock Photos
ISBN978-3-462-31365-9
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Einführung
I. Sklaven – Leben im Schatten der Säulen
Vierhundert Kreuzigungen? – Eine unerhörte Protestdemo und ein gnadenloses Exempel
»So viele Feinde wie Sklaven« – Desolidarisierung unten versus Solidarisierung oben
Naturgegebene Sklaverei? – Ein dürftiges, aber bequemes Konstrukt des großen Aristoteles
Ein dialektischer Freiheitsbegriff ohne gesellschaftliche Sprengkraft – Die Position der Stoiker
Die römischen Saturnalien – Erinnerung an ein Goldenes Zeitalter ohne Unfreie
Kriegsgefangenschaft, Geburt, Piraterie – Quellen der Sklaverei
Demütigung auf dem Sklavenmarkt – Der Mensch als Ware
Eine Sklavenhaltergesellschaft? – Wer Latein lernt, begegnet untypischen Familien
Sklavenluxus und Luxussklaven – Statussymbole ohne ökonomischen Mehrwert
De profundis – Die Qualen der Bergwerks- und Mühlensklaven
Handwerker, Wasserbauer, Händler – Unfreie Hilfsarbeiter und Geschäftsführer
Unfreie Ärzte und Lehrer – Griechische Entwicklungshilfe für Rom
Der unfreie Pauker als Herr der Gerte – Arme Schlucker mit Lizenz zum Prügeln
Umjubelte Ehrlose – Sklaven und Freigelassene als Stars im Showbusiness
Sexueller Missbrauch und Zwangsprostitution – Die hässliche Fratze des »Herrenrechts«
servi publici – Wie Roms Bürger von Unfreien verwaltet wurden
»Minister« mit unfreier Herkunft – Umstrittene Freigelassene an den Hebeln der staatlichen Macht
Wenige Pflichten, viele Rechte – Repressionsformen der »Herrengewalt«
»Halt mich fest, weil ich geflohen bin« – Halsbänder von »Fluchtsklaven«
Freundschaft, Treue, Schutz – Sklaverei und Humanität
Theater und Thermen, Bordell und »Ehehafen« – Kleine Freiheiten des Alltags
Die Filzkappe als Erlösung – Roms großzügige Freilassungspraxis
Civis Romanus sum! – Eine erstaunliche Bürgerrechtsverleihung durch Privatleute
II. Schmutzige Arbeit? – Aus der verschwiegenen Welt der Berufsvereine
»Cuspinus Pansa zum Aedil!« – Maultiertreiber, Zimmerleute und Sackträger als Wahlkampfhelfer
Zusammenschlüsse kleiner Leute – Misstrauen und Anpassungsdruck
100 Sesterze und eine Amphore Wein als Aufnahmegebühr
Tankstelle für Selbstbewusstsein – Wie der »Bodensatz der Gesellschaft« sich wehrt
»Mitspielen« und ernst genommen werden – Ein Wirgefühl auf demokratischer Grundlage
»Wer Unruhe schafft, zahlt zur Strafe vier Sesterze!« – Tafelrunden der Harmonie und Heiterkeit
Frugale Mahlzeit oder Trinkgelage mit Schlemmerei? – Scharfe Polemik von der christlichen »Konkurrenz«
Sterbekassen-Solidarität – Sicherheit für posthumen Gedenkservice
Stolz auf die »schmutzige« Handarbeit – Grabreliefs als Meuterei gegen die Normen setzende Elite
Kotelett-Hacken unter »Muttis« strengem Blick – Ein ungewöhnliches Dokument von Emanzipation
III. Diskriminierung und Integration von Außenseitern – Menschen mit Behinderung
»Unauslöschliches Gelächter« – Der göttliche Krüppel Vulcan als Spottobjekt
Zahnlos, einäugig, idiotisch – »Lustig« und literarisch brauchbar
»Fettsack« und »Schieler«, »Schluckspecht« und »Glatzkopf« – Beinamen mit schwerer Hypothek
Viele Wege in die Behinderung – und nur wenige Auswege
Blinde Rechtsanwälte, einarmige Staatsmänner – Beispiele gelungener Integration
»Von den Göttern im Zorn erschaffen«? – Ein Mehrfachbehinderter auf Roms Kaiserthron
»Lieblinge« vom »Markt der Missgeburten« – Humor ohne Empathie
IV. Vom Asyldorf zur Millionenmetropole – Rom als Migrantopolis
Überfremdung, Verdrängung, Multikulti – Wie Wutbürger über ein »unrömisches Rom« herziehen
»Griechlein« in der »griechischen Stadt« Rom – Zur Ambivalenz eines Akkulturationsprozesses
Alltagstoleranz ohne xenophobe Grundstimmung – Friedliche Koexistenz im römischen Melting Pot
Jüdische »Exklusivität« – Unverständnis ohne Rassismus und Fremdenhass
»Ein Ort, an dem jeder Gott willkommen ist« – Religiöse Pluralität als Kernkompetenz Roms
»Aus dem ganzen Erdkreis hierhin geeilt …« – Migrantenströme in Richtung Rom
Push-Faktor Sklaverei – Millionen Zwangsimmigranten aus aller Herren Ländern
»Bio-Römer« – Eine selten wahrgenommene Minderheit
Arbeitsplätze, Ausbildung, Lebensqualität – Pull-Faktoren der Einwanderung
Ein Flüchtling als nationaler Ahnherr, der erste König als Asylgründer – »Diese Stadt weist keinen ab«
Aufnahmebereitschaft, Integrationswille, administrative Liberalität – Willkommenskultur in Maßen
»Hose ausgezogen und Toga angelegt« – Senatoren aus Gallien als Zumutung?
Orbis in urbe – Roms gelungenes Integrationskonzept
V. Erwachsenwerden in Rom – Einblicke in das Leben von Kindern und Jugendlichen
Hohe Mortalität, viel Instabilität, wenig Geborgenheit – Fortunas Einbrüche in eine »heile Familienwelt«
Kindestötung, Kindesaussetzung, Kindesverkauf – Die patria potestas in Theorie und Praxis
Kein Herz für Kinder? – Zum Problem anachronistischer Fehlurteile
Spielen in beengten Verhältnissen und frühe Kinderarbeit – Begrenztes Wissen über Unterschichten
Abgeschoben zur Amme? – Wenig »Lust« auf ein zweites Selbst
Puppen, Nüsse, Blindekuh – Spielen wie die jungen Römer
Mädchen spielen im Haus – Eine Laune der »missgünstigen Natur«?
»Außenseiter« und »unvollständige Erwachsene«? – Antike und moderne Kinderbilder
Gewalt in der »Erziehung zur Vernunft«? – Liberale Theorien, konservative Praxis
Privatsache Schulbesuch – Brüll- und Bimspädagogik als Standard
Unfreie Pädagogen und Lehrer mit Lizenz zum Prügeln – Die Schule als angsterfüllter Raum
Grundschule, »Grammatik« und Rhetorik – Drei Stufen der Schulausbildung
Von engen schulischen Freiräumen zu »Rüpeleien verkommener junger Leute«
Sport und Spiele in der Freizeit – Jugendgefährdung inklusive
Verliebter Jüngling, hartherziger Alter und ein cleverer Sklave – Generationenkonflikte in der Komödie
Liberalität als Sittenverfall? – Wie sich alte und moderne Ideologen an eine statische Vorstellung vom mos maiorum klammern
Randale aus Übermut und Spaß an der Provokation – Alkoholisierte junge »Herren« im nächtlichen Rom
VI. Verehrt und gefürchtet, verspottet und kaltgestellt – Die Alten und die Gesellschaft
»Sechzigjährige von der Brücke!« – Hintergründe eines altenfeindlichen Slogans
»Die Krönung des Alters ist das Ansehen …« – gravitas verlangt Respekt
Kompetenzfelder Urteilskraft und Erfahrung – Wie der Senat zu seinem Namen kam
»Bis zum letzten Atemzug über die Seinen herrschen« – Roms »väterliche Gewalt« als autokratisches Regime
Alter plus Armut – Eine Kombination der Trostlosigkeit
»Für den betagten Menschen kommt der Tod zu spät …« – Ist das Alter eine Krankheit?
Kraftlose Patienten, hilflose Ärzte – Das Alter als Zumutung und Ärgernis
»Schimpflich ist die Liebe im Greisenalter …« – »Würdelose« Senioren als Spottobjekte
Der Alte Cato über die Vorzüge des Alters – Ciceros Lebenshilfe-Klassiker De senectute
Schleichender Bedeutungsverlust – Wenn fürs alte Eisen die »Freuden der Landwirtschaft« bleiben
Wie alt ist »alt«? – Und wie viele Alte gab es?
VII. Landleben – Das süße und das nicht so süße
»Lustbesitzungen« in rustikalem Ambiente – Wo Protzen wichtiger war als Produzieren
Marmor und Stuck, Edelsteine und Wandmalereien – Ländliche Feriendomizile als Leuchttürme kultivierter Lebensart
Schöne Landschaften, weite Ausblicke – »Luxussucht« und Herrschaftswille
Der Gutshof – Wirtschaftsgebäude, Arbeitskräfte, Erntehelfer
»Wie ein Feldherr seine Arbeitstruppen führen …« – Anforderungsprofil eines unfreien Gutsverwalters
»Der Verwalter soll kein Herumtreiber und Liebschaften abgeneigt sein …« – Agrarmanager mit solidem Lebenswandel gesucht
Die vilica als Chefin des Haushaltes – Aber nicht als Chefin des Chefs …
Weinselige Landfeste – Seltene Inseln des Durchatmens
Bukolische Idylle versus harte Realität – Hirtenleben zwischen literarischem Arkadien und forderndem Alltag
Ein gelernter Hirte mit Durchsetzungsvermögen – Roms Gründerkönig Romulus
Selbstversorger und Marktbelieferer – Kleinbauern als Rückgrat der römischen Landwirtschaft
»Angst, am nächsten Tag hungern zu müssen« – Der Kleinbauer und sein Frühstück
Prekäres Leben auf dem Lande – Eine poetische Genrestudie als historische Quelle
Arme Schlucker als glückliche Menschen? – Von Agrarromantik keine Spur
Die »Zauberkunst« der Arbeit – Ein Mythos, der mehr als ein Mythos ist
VIII. Zweibeinige Herrscher, vierbeinige Diener – Tiere in der römischen Zivilisation
Cave canem! – Der Hund als Haus-Detektiv
Von treuen Hätschelhunden und fehlenden Schmusekatzen – Tierliebe à la romaine
Ein honigsüßer Sperling, grüßende Elstern und enthemmte Papageien – Gefiederte Haustiere waren »in«
Ohrringe, Halsbänder und menschliches »Futter« für Lieblingsmuränen – Fischteichbesitzer mit snobistischen Allüren
Langsame Ochsen, zähe Maultiere und elend zerhauene Esel – Die animalischen Dienstleister des römischen Wirtschaftswunders
»Das Maultier treibt mich noch in den Ruin!« – Der Kleinbauer und sein Tragetier
Unfreiwillige Vegetarier und Liebhaber fetten Schweinefleisches – Aspekte einer fremden Welt
Innereien für die Götter, Fleisch für die Menschen – Kann man den Bauern trauen?
Lamm und Zicklein, Gans und Drossel – Delikatessen für den verwöhnten Gaumen
Vermutungen, Bedenken, Unsicherheiten – Große weiße Flecken auf der »Landkarte« des römischen Fleischkonsums
Rennpferde als Celebrities – Roms vierbeinige Circus-Stars
Mächtige Renngesellschaften, Ställe aus Marmor und Fluchtafeln mit Verwünschungen – Die »Raserei des Circus«
»Spielende« Arena-Tiere – Rohstoff eines mörderischen Schauvergnügens
9000 Tiere »verbraucht« – Eine »würdige« Einweihung des Colosseums
Tier gegen Tier, Tier gegen Mensch und das Tier als Henker – Varianten römischer Arena-»Spiele«
»Wagen voll von Triumphen über die Berge« – Zur Logistik einer Tierfang-»Industrie«
Erschließung neuer Lebensräume oder Störung des ökologischen Gleichgewichts? – Jäger auf Herkules’ Spuren
»Wie kann ein kultivierter Mensch daran Gefallen finden?« – Mitleid als Ausnahmeemotion
IX. Panem et circenses – Ein Lehrstück in historischem Zynismus
Ein politikfreies Sozialstaatsparadies?
»Sozialleistungen« zum Nulltarif – Getreiderationen für viele und Wasser für alle
Kaiserliche »Großzügigkeit« – Ein Zubrot, aber keine Lebensgrundlage
Feiertage als Frei-Tage? – Ein modernes Missverständnis
Warum man auf Lateinisch kein schönes Wochenende wünschen konnte
Amüsement in Dauer-Berieselung? – Mit schlichter Mathematik gegen ein Klischee
Öffentliches »Groß-Tun« – Massenunterhaltung als Rendite der Macht
Herrscher und Beherrschte im Dialog – Eine neue Semantik politischer Willensbildung
Restitutionsforderungen und Steuerärger – Der Circus Maximus als Protestort von Wutbürgern
Polemik oder Analyse? – Wenn der Satiriker zum Historiker mutiert
Wahlgeschenke, Anspruchsmentalität, Korruption – Fehlentwicklungen einer Republik
Fürsorge eines pater patriae – Der Kaiser als Erbe »volksfreundlicher« Politik
»Gunst des Volkes« – Machtpolitische und Überlebens-Strategien im Einklang
X. Zwischen Naturverehrung und Naturzerstörung – Die Römer und ihre Umwelt
»Wühlen in den Eingeweiden von Mutter Erde« – Moralisten-Empörung mit ökologischem Unterton
»Frieden mit den Göttern« – Geben und Nehmen im Verhältnis zur Natur
»Als Sieger blicken sie auf den Einsturz der Natur …« – Bergbau mit aller Macht
Zivilisatorischer Fortschritt oder Ruin? – Die Natur als Herausforderung
»Sozusagen eine zweite Natur schaffen« – Vom Herrschaftsanspruch des menschlichen Geistes
Bändigen, bezwingen, überwinden – Mit imperialer Mentalität gegen die Natur
Eine systematische »Entleerung von Wäldern und Bergen« – Tiere als makabres »Spielmaterial«
Heilige Bäume? – Holzwirtschaft ohne Nachhaltigkeit
Erosionsschäden durch Abholzung – Die Römer als »Waldkiller« im Mittelmeerraum?
»Bleirohre sind der Gesundheit nicht zuträglich« – Sorgloser Umgang mit einem Risikostoff
Umweltflucht vor Smog – Roms »dicke Luft« als Umweltbelastung
Krach, Stress und Seuchen – Angriffe auf die Gesundheit in einer Millionenstadt
XI. Pax Romana? – Innere Sicherheit, Verbrechen und Kriminalitätsbekämpfung
Robin Hood auf der Via Appia? – Bulla Felix und die 600 Räuber
»Gebt den Sklaven genug zu essen …!« – Zur Räubersoziologie der römischen Kaiserzeit
Kriminelle Milieus – Verhasste Outlaws und ihre »bürgerliche« Unterstützerszene
Besser »nackt und verletzt« als »von Räubern ermordet« – Was Grabinschriften über die Sicherheit auf römischen Landstraßen verraten
Sozialbanditen? Fehlanzeige! – Erst recht für -innen
»Piraterie, solange die menschliche Natur die gleiche bleibt« – Hinter den Kulissen des Pax-Romana-Narrativs
Bürgerwehren und Wachhunde, Bodyguards und Knüppel, Selbst- und Nachbarschaftshilfe – Wie schützt man sich vor Kriminellen?
Vom »Freund und Helfer« keine Spur – Ein Staat ohne Schutzpolizei
Diebstahl, Körperverletzung, Giftmord – Mutmaßungen zur großstädtischen Kriminalität
»Abscheuliche Zügellosigkeit« – Wie Hooligans Rom zeitweise terrorisierten
Feuerwehr, Stadtkohorten, Prätorianer – Sicherheitsorgane mit geringer Bürgernähe
Klassenjustiz, Folter und Hinrichtungsshows – Ein Rechtsstaat ohne Menschenrechte
XII. Sterne, Träume und Orakel – Blicke in die Zukunft aus einer ungewissen Gegenwart
Lebensrisiken ohne solidarisches Netz – Die Chance der Mantik
Blutregen, Eingeweide und Vogelflug – Botschaften der Götter als Hinweise auf die Zukunft
»Geboren im Sternbild des Steinbocks« – Wie man Astrologie politisch instrumentalisiert
Graue Eminenzen der Wahrsagekunst – Hofastrologen als »treuloser Menschenschlag«?
Die Ausweisung »suspekter Elemente« als Ritterschlag – Ohnmacht und Macht der »Chaldäer«
Sternendeutung am Circus – Von Winkel-, Märtyrer- und Laien-Astrologen
»Soll ich den Gastwirt heiraten und den Mantelhändler verlassen?« – Roms Verzicht auf eine Dummensteuer
Träume als verschlüsselte Botschaften – Vom »ältesten Orakel der Welt«
Machthaber und Mantik – Traumbotschaften als historische Wirkkräfte
Der Tempelschlaf als Heilungschance – Eine anerkannte medizinische Behandlungsmethode
Bettnässen, Beischlaf, Erdbeben – Aus dem Traum-Ratgeber des Artemidor
Unpopuläre Ja/Nein-Antworten – Delphi und Co mit Nachfrage-Rückgang
Werde ich reich sein und lange leben? – Ein antikes Taschenorakel im Selbstversuch
XIII. Prostitution – Zur Allgegenwart der Un- und Doppelmoral
Brutale Zwangsprostitution und komödiantisches Amüsement – Ein beklemmendes Vergnügen
Blühender Frauenhandel – »legal« und kriminell
»Nackt stand sie da …« – Wie menschliche »Ware« verschachert wurde
Freie, aber selten freiwillige »Verdienerinnen« – Sexarbeit zum Überleben
Bordell und Kammer, Straßen und Gräber, Kneipen und Gasthöfe – Omnipräsenz der Prostitution
Kellnerinnen und Tänzerinnen, Kurtisanen und »Stricher« – Sex-Märkte unterschiedlicher Niveaus
Wenn der Beischlaf so viel kostet wie zwei Brote … – Sexuelle Ausbeutung zum Billigtarif
»Hier habe ich viele Mädchen gevögelt« – Ein pompejanisches »Modell«-Bordell
Stickige, qualmende, stinkende Kammer – Arbeitsplatz einer »kaiserlichen Hure«
Frauen »mit und ohne Schamgefühl« – Zur Kanalisierung des männlichen Sexualtriebs
»Mit dem Körper Gewinn erzielen« – Moralische Ausgrenzung, aber kein Straftatbestand
Steuerliche »Abschöpfung« des Beischlafs – Der Staat beutet mit aus
XIV. Romosexualität – Anderssein im Spiegel satirischer Brechung
Der Rausch des Prometheus – Wie Homosexualität in die Welt kam …
Von der »Tribade« zur »Lesbe« – Terminologisches zur weiblichen Homosexualität
»Autonomer« Frauen-Sex? – Die Satire fährt schwere Geschütze auf
Einebnung der Gegensätze – Bisexualität als »Normalität«
Schutz frei geborener Knaben, »Jagd« auf schöne »Lieblinge« – Päderastische Normen im antiken Rom
»Die Waffe meines Unterleibs wird dich ausweiten …« – Penetration als Drohkulisse
»Frau aller Männer« – Verachtung und Verhöhnung der »Weichlinge«
Mund und Po im Sauberkeits-Wettstreit – Oralsex als »unmännlicher« Dienst am Partner
Wenn der bärtige Callistratus den strengen Afer heiratet … – … dann laufen die Satiriker Amok
Nero und Elagabal als »Bräute« – Skandalöse Hochzeiten im Kaiserpalast
Römische Sexualmoral – Weder vergleichbar noch vorbildhaft
XV. Wohin die satten Leute zu gehen pflegen – Von Nachttöpfen, Gemeinschaftsklos und Prachtlatrinen
In kaum einem Lateinbuch, aber in jeder römischen Wohnung zu finden – Die matella
Ein-, Zwei- und Mehrsitzer – Private und öffentliche Latrinen
Fäkalgestank und »Wildpinkeln« – Keine dominanten Probleme
Vespasiennes – Kleine Rache am Erfinder der Urinsteuer
Warum Vacerra die Latrine zum Speisen aufsucht – Barrierefreie Kommunikation
Latrinale Gleichberechtigung – Roms erstaunliche Unisex-Toiletten
Wohlfühlort und Wellness-Erlebnis – Die Prachtlatrine als Distinktionsbedürfnis
Wenn »Blähungen ins Hirn steigen …« – Wie man über Defäkation nicht spricht
Literaturverzeichnis
I. Sklaven
II. Schmutzige Arbeit?
III. Menschen mit Behinderung
IV. Rom als Migrantopolis
V. Kinder und Jugendliche
VI. Alte Menschen
VII. Landleben
VIII. Tiere
IX. Panem et circenses
X. Natur und Umwelt
XI. Pax Romana?
XII. Sterne, Träume und Orakel
XIII. Prostitution
XIV. Romosexualität
XV. Latrinen
Bildrechtenachweis
Einführung
Vor einigen Monaten machte eine aufsehenerregende Meldung die Runde. Im Zuge einer forcierten Gleichstellungspolitik hat Island beschlossen, im öffentlichen Raum – gegebenenfalls neben dem getrennten Standard – Unisex-Toiletten verpflichtend zu machen. Nicht wenige erkennen darin einen Fortschritt. Wenn das so ist, waren die Römer erstaunlich fortschrittlich – ein Attribut, das ihnen normalerweise nicht gerade anhaftet. Denn ihre öffentlichen Latrinen waren Unisex-Toiletten – jedenfalls nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung, die sich auch auf diesem Gebiet in den letzten Jahrzehnten intensiviert hat. Der archäologische, von literarischen Quellen nicht infrage gestellte Befund ist noch überraschender, wenn man einen Blick auf die teilweise gut erhaltenen Latrinen in römischen Bädern und anderswo wirft: Trennwände? Fehlanzeige! Man saß ohne Begrenzung und Sichtschutz nebeneinander. Der feinen Gesellschaft passte das irgendwann nicht mehr, und so ersann sie die römische Prachtlatrine – ein soziologisches Phänomen, das angesichts der starken Gegensätze zwischen Arm und Reich in der römischen Gesellschaft nicht ganz so überraschend daherkommt.
In diesem Fall waren mal die Bessergestellten eine Randgruppe, wenn auch privilegiert und nur freiwillig ausgegrenzt. Normalerweise dienen ihre Lebensverhältnisse dazu, uns über »die« Römer zu informieren. Kein Wunder, denn aus ihren Reihen stammten die allermeisten Schriftsteller, und sie verfügten über die finanziellen Mittel, um bauliche Spuren zu hinterlassen, die die Jahrtausende überdauerten. Aber das ist ein ziemlich unvollständiges, vielfach sogar trügerisches Römer-Bild. Über die einfachen Menschen erfahren wir relativ wenig – und wenn, dann aus der Perspektive der Wohlhabenden.
Trotzdem: Rom – das ist nicht nur die Geschichte von Kaisern und Senatoren, Militärs und Millionären. Die althistorische Forschung der letzten Jahrzehnte hat sich zunehmend auch der Sozial- und Alltagsgeschichte zugewandt und die Quellen – neben der schriftlichen Überlieferung auch das epigraphische und das archäologische Material – daraufhin befragt, was sie über das Leben der Angehörigen einzelner Gruppen zu berichten wissen: über die Alten und die Jungen, über Menschen mit Migrationshintergrund und Kleinbauern, über Kriminelle und Handwerker, Prostituierte und Menschen mit Behinderung. Und natürlich über die Unfreien, die in der Stadt Rom wohl fast ein Drittel der Bevölkerung ausmachten und im gesamten Imperium ein knappes Fünftel. Arbeits- und Lebensbedingungen der Sklavinnen und Sklaven sind allerdings ziemlich gut dokumentiert, weil das Gros von ihnen für die Angehörigen der Oberschicht tätig war.
Die vorliegende Darstellung möchte wichtige Ergebnisse dieser sozialgeschichtlichen Neuorientierung aufgreifen und damit ein lebendiges Rom präsentieren, das die Sterilität und Verstaubtheit mancher Klassik-Vorstellungen hinter sich lässt. Dabei geht es nicht um ein neues, sondern um ein ergänztes und erweitertes Rom-Bild, in dem auch die »Normalos« ihren Platz finden.
Sie kommen in der »klassischen« Vorstellung vom antiken Rom meist nur als Masse vor, die das Colosseum, den Circus Maximus, die Theater und Thermen füllte. Das Stichwort »Brot und Spiele« verbindet sich für viele mit der Vorstellung von einer Art Sozialparadies, in dem Hunderttausende vom Staat alimentiert und mit circenses politisch ruhiggestellt wurden. Das ist jedoch eine üble Geschichtsklitterung, die die kleinen Leute gewissermaßen auf die Anklagebank der Geschichte verbannt und ihnen ihre eigentliche Lebensleistung – ihre Arbeit und ihr Durchhalten in prekären Lebensverhältnissen – aberkennt. Mit dieser diffamierenden Legende soll endlich aufgeräumt werden.
Schließlich werden einige Aspekte von großer Aktualität angesprochen: Wie hielten es die Römer mit der Umwelt, wie gingen sie mit sexuellen Minderheiten – konkret: den Homosexuellen – um, wie ernst war es ihnen mit dem Tierschutz, wie sah es mit der Integration von Menschen mit Behinderung aus und wie mit dem Zusammenleben von Menschen mit Migrationshintergrund und »Bio-Römern«?
Schauplatz unserer »unklassischen« historischen Reise in die Römerzeit ist im Wesentlichen Rom selbst, die Hauptstadt des Imperium Romanum und mit rund einer Million Einwohnern die bei Weitem größte Metropole. Viele Aspekte, auf die wir dort stoßen, lassen sich aber für das gesamte Römische Reich verallgemeinern. Zeitlich stehen das erste und das zweite nachchristliche Jahrhundert im Mittelpunkt. Sie werden häufig als Blütezeit Roms angesehen. Eine Blütezeit auch für das »Rom von unten«?
I. Sklaven – Leben im Schatten der Säulen
Im Jahr 61 n.Chr. wurde Rom von einem aufsehenerregenden Verbrechen erschüttert. Pedanius Secundus, als Stadtpräfekt einer der höchsten und mächtigsten Beamten des Reiches, wurde von einem seiner Sklaven ermordet. Das Motiv des Mörders blieb im Unklaren. Die einen wollten wissen, dass sich sein Herr nicht an die Freilassungsabsprache gehalten habe, obwohl beide schon einen Preis ausgehandelt hätten – ein Verstoß gegen Treu und Glauben, der moralisch, aber nicht juristisch anstößig gewesen wäre. Andere munkelten von einem Eifersuchtsdrama. Sklave und Herr hätten sich in denselben Jüngling verliebt, und der Sklave habe diese Konkurrenzsituation durch die Bluttat beenden wollen.[1]
An der Schuld des Täters gab es offensichtlich keinen Zweifel. Nach römischem Recht hatte er den Tod durch entehrende Kreuzigung verdient – darin waren sich alle einig. Auf Mitleid oder mildernde Umstände durfte kein Unfreier rechnen, der seinen Herrn umbrachte, mochte der auch ein übler Peiniger und Menschenschinder sein. Wohl aber entzündete sich eine erregte öffentliche Diskussion an der Frage, wie mit den anderen Sklaven des Haushalts zu verfahren sei. Die rechtliche Grundlage dafür war ebenso klar wie bindend: Nach einem Senatsbeschluss wohl aus dem Jahr 10 n.Chr. waren sämtliche Angehörige der unfreien familia zunächst unter Folter zu verhören, um die Schuldigen und die Umstände der Tat zu ermitteln, und sodann zu töten. Nur so sei im Vorfeld eines Attentatsplans »die Sicherheit eines herrschaftlichen Hauses zu gewährleisten, indem die Sklaven unter Androhung der Todesstrafe gezwungen würden, ihrem Herrn gegen Personen von innerhalb und außerhalb des Hauses Hilfe zu leisten« – so der Jurist Ulpian.[2]
Vierhundert Kreuzigungen? – Eine unerhörte Protestdemo und ein gnadenloses Exempel
Vermutlich unter dem Eindruck einer aufwühlenden Bluttat war das entsprechende senatus consultum Silanianum in der Zwischenzeit noch einmal verschärft worden. Alle Unfreien des Haushalts wurden in Kollektivhaftung für den Mord an einem Herrn genommen, und zwar unabhängig von einem individuellen Verschulden. Derjenige, der nichts geahnt hatte und ebenso schockiert über den Tod seines Herrn sein mochte wie dessen Angehörige, wurde genauso behandelt wie der Mitwisser oder Mittäter: Unterlassene Hilfeleistung, auch wenn die Notwendigkeit der Hilfeleistung sich erst aus der Tat selbst ergab. Ausgenommen von dieser auf massive Abschreckung zielenden brutalen Mithaftung waren lediglich unmündige, blinde, taube und altersschwache Sklaven.
Von denen gab es im Haushalt des Pedanius Secundus indes nur wenige, dagegen sehr viele »normale« Sklaven, die nun zur »Verantwortung« gezogen werden sollten. Genauer gesagt: an die 400. Sie alle waren dem senatus consultum Silanianum zufolge Todeskandidaten. Als nun Massenhinrichtungen bevorstanden, gärte es mächtig in der Bürgerschaft. Vielen Römern erschien das grausame Vergeltungsprozedere ungerecht. Sie gingen auf die Straße, protestierten und setzten sich vehement dafür ein, den »traditionellen« Senatsbeschluss nicht anzuwenden. Der Widerstand nahm von Tag zu Tag zu; er drohte in einem unkontrollierten Tumult zu enden, zumal die Demonstranten auch das Senatsgebäude belagerten. Spontane – und gesteuerte – Demonstrationen waren in der Hauptstadt keine Seltenheit; vor allem in den Stätten der Massenunterhaltung – wie im Circus, Theater und Amphitheater – gehörten sie zur üblichen politischen Interaktion zwischen dem Kaiser und seinem Volk.
Diesmal galt der Aufruhr aber nicht der Durchsetzung eigener Interessen wie dem Protest gegen hohe Getreidepreise und Steueranhebungen, sondern die Menschen setzten sich aus Mitleid für Sklaven ein, die einer Art Staatsräson geopfert werden sollten. Die Demonstrationen und Blockaden machten auch auf viele Senatoren Eindruck. Sie begannen umzudenken. »Tauben« und »Falken« standen sich im Senat gegenüber. Wohin sich die Mehrheit neigte, war ungewiss. Ein erster Erfolg für die Protestierer war die Bereitschaft des Senats, überhaupt über die Angelegenheit zu diskutieren und nicht einfach den geltenden Beschluss zu exekutieren.
In dieser Situation ergriff Gaius Cassius das Wort, ehemaliger Konsul und führender Jurist, ein strammer Traditionalist, der keinen Hehl aus seiner Überzeugung machte, dass früher alles besser gewesen sei und die Dinge sich grundsätzlich zum Schlechteren entwickelt hätten. In vielen Diskussionen, so Cassius, habe er darauf verzichtet, Einspruch gegen bedenkliche Neuerungen zu erheben, um seine Autorität nicht als notorischer Neinsager zu beschädigen. Jetzt aber sei es mit seiner Zurückhaltung vorbei, dies sei der Tag, an dem der Staat dringend seines Rates bedürfe.
Der war, was den Umgang mit den »schuldigen« Sklaven anging, eindeutig: Auf keinen Fall dürfe man von der jahrzehntelang mit guten Gründen durchgehaltenen Linie abweichen. »Wen wird seine Würde künftig schützen, wenn sie nicht einmal einen Stadtpräfekten geschützt hat? Welche Zahl von Sklaven wird ihn sichern, wenn nicht einmal vierhundert Sklaven den Pedanius Secundus geschützt haben?« Unschuldige sollten das sein, von denen Demonstranten die Todesstrafe abwenden wollten? »Glaubt ihr wirklich, ein Sklave hätte den Plan zur Ermordung seines Herrn gefasst, ohne eine Drohung auszusprechen, ohne sich in einem unbedachten Moment zu verplappern? Aber angenommen, er hat seinen Plan geheim gehalten, er hat sich eine Waffe verschafft, ohne dass seine Umgebung etwas davon mitgekriegt hat: Hätte er die Wachen passieren, die Schlafzimmertür öffnen, Licht hineintragen und die Mordtat vollenden können, ohne dass irgendjemand etwas davon bemerkt hätte?«[3]
Es müsse Mitwisser gegeben haben, das sei völlig klar. Ebenso sei klar, dass nicht alle Bescheid gewusst hätten. »Ja, es werden auch einige Unschuldige ums Leben kommen.« Das sei nichts anderes als bei der berüchtigten Dezimierungsstrafe im Militär. Wenn wegen Feigheit der gesamten Einheit jeder Zehnte zu Tode geprügelt werde, so treffe das auch Soldaten, die sich persönlich nichts hätten zuschulden kommen lassen: »Jeder größeren exemplarischen Bestrafung haftet etwas Ungerechtes an. Was Einzelne trifft, wird indes durch den Nutzen für die Allgemeinheit aufgewogen.«[4]
Mit seiner hochemotionalen Rede, die generalpräventive Überlegungen mit Angstmache verband – alle seine Zuhörer waren ja selbst Sklavenhalter –, erreichte Cassius, was er wollte. Zwar gab es manche Unmutsäußerung, Zwischenrufe und einiges unwillige Gemurmel, aber niemand raffte sich zu einer Gegenrede auf. Und so blieb das senatus consultum Silanianum in Kraft; eine Mehrheit der Senatoren stimmte dem Hardliner zu, der nicht versäumt hatte, darauf hinzuweisen, dass »früher schon Klügere als wir diese Frage erörtert haben«[5] – im traditionsbewussten römischen Senat durchaus kein hohles Totschlagargument, sondern der ernst zu nehmende und ernst genommene Hinweis auf die Weisheit der Väter.
Mit dem Senatsbeschluss war die Angelegenheit jedoch noch nicht zu Ende. Der Widerstand im Volk dauerte an, und er erklärte sich nicht nur damit, dass viele Protestierer selbst keine Sklaven besaßen, sondern wohl auch damit, dass ein nicht unerheblicher Teil der hauptstädtischen Bevölkerung Abkömmlinge ehemaliger Sklaven und Freigelassene waren. Grundsätzlich gab es keine Solidarität zwischen den kleinen Leuten und den Sklaven, wohl aber loderte der Volkszorn in diesem konkreten Fall auf, weil die bevorstehende Rache-Maßnahme als ungerecht und maßlos empfunden wurde. Es ging den Demonstranten nicht um ein sozusagen gemeinsames Unterhaken von Unterprivilegierten, nicht um einen programmatischen Angriff auf das »System«, sondern es war ein von Empörung, Mitleid und Gerechtigkeitsgefühl gesteuertes Aufbegehren: Das konnte doch nicht wahr sein, was da drohte!
Die Leute machten Ernst. Sie griffen zu Pflastersteinen und Brandfackeln und verhinderten so, dass die »schuldigen« Sklaven zur Hinrichtung gebracht werden konnten. In diesem Moment griff der Kaiser ein. Nero drückte mit scharfen Worten sein Missfallen an den Kundgebungen und der Radikalisierung der »Opposition« aus, und er ließ Militär aufmarschieren. Der gesamte Weg zur Hinrichtungsstätte wurde von eng stehenden Militärposten gesichert, und das senatus consultum Silanianum wurde gnadenlos durchgesetzt; vierhundert Sklaven, die sich sub eodem tecto befunden hatten, als ihr Herr ermordet wurde, »unter demselben Dach« – so lautete die verhängnisvolle Formel –, erlitten den Kreuzestod.
»So viele Feinde wie Sklaven« – Desolidarisierung unten versus Solidarisierung oben
Grausame Exzesse im Umgang mit Sklaven, wie sie sich im Jahr 61 ereigneten, gehörten in der römischen Welt keineswegs zur Normalität. Das zeigen gerade die damals von der unbarmherzigen Exekution geltenden Rechts ausgelösten Proteste und Unruhen. Eine Bürgerschaft, in der so etwas häufiger vorgekommen wäre, hätte nicht so empört reagiert. Das betrifft nicht nur die Quantität, also die riesige Zahl der damals Hingerichteten, sondern auch die »Qualität«, d.h. das Verbrechen des Herrenmordes einerseits und die brutale Vergeltung auch gegenüber persönlich nicht Schuldigen andererseits: Im Gegenteil, Berichte über tödliche Übergriffe von Unfreien gegen ihre Herren sind, sieht man von der Epoche der großen Sklavenaufstände im 2. und 1. Jh.v.Chr. ab, eher selten. Zweifellos kamen sie aus den unterschiedlichsten Gründen vor, und zweifellos war die Dunkelziffer in diesem Bereich ziemlich hoch, wenn Attentate als Unfälle getarnt oder Giftanschläge nicht aufgedeckt wurden. Aber nichts berechtigt zu der Annahme, dass sich die römischen Herren pausenlos vor ihren Sklaven hätten fürchten und in ständiger Sorge vor einem Anschlag oder einer permanenter Konspirationsbereitschaft hätten leben müssen. Aufs Ganze gesehen, war die Situation zwischen Sklavenbesitzern und ihren Sklaven entspannt.
Gleichwohl war Vorsorge getroffen für den Fall, dass dennoch gefährliche Spannungen auftraten. Das senatus consultum Silanianum war solch eine Vorsichtsmaßnahme, die abschrecken und bedrohlichen Eskalationen in einem einzelnen Haushalt zuvorkommen sollte. Die Botschaft richtete sich weniger an potenzielle Täter, die zu einem Anschlag auf das Leben ihres Herrn entschlossen waren, als an ihre Mitsklaven, die von entsprechenden Plänen Wind bekamen. Sie konnten ihre eigene Haut nur retten, wenn sie den Plan aufdeckten und ihren Herrn warnten. Dass sie damit möglicherweise sogar einen guten »Kumpel« ans Messer lieferten, lag im perfiden Kalkül der drohenden Kollektivbestrafung begründet. Solidarische Anwandlungen sollten im Keim erstickt werden. Jeder ist sich selbst der Nächste – diese Lektion lernten Sklaven früh, und sie wurden in vielen Situationen daran erinnert. An einer Solidarität unter Sklaven konnten die Freien kein Interesse haben. Und sie nutzten alle Gelegenheiten und Möglichkeiten der Vereinzelung und Desolidarisierung – bewusst und mit voller Absicht oder ganz spontan aus dem Gefühl heraus.
Es gab die Redewendung totidem hostes, quot servi, man habe »so viele Feinde wie Sklaven«[6] – einer der vielen »Sprüche«, die man im Alltag, häufig genug augenzwinkernd, so dahinsagte, ohne dabei an ein Damoklesschwert tatsächlicher Bedrohung zu denken. Und doch gab es da offensichtlich im Unterbewusstsein vieler Sklavenhalter ein latentes Unbehagen, ob die Sklavenhalter wirklich sicher seien vor ihren Unfreien. Wohl auch deshalb wurde ein Antrag im Senat abgelehnt, der Sklaven verpflichten wollte, sich in der Bekleidung von Freien zu unterscheiden. »Kurz darauf wurde den Leuten klar«, berichtet Seneca, »welch große Gefahr drohe, wenn unsere Sklaven anfangen sollten, uns zu zählen.«[7] Von der Diskriminierungsinitiative nahm man rasch wieder Abstand.
Vier Jahrzehnte nach dem Mord an Pedanius Secundus sollte Rom durch ein weiteres Verbrechen an einem Sklavenbesitzer alarmiert werden. Um das Jahr 101 überfielen einige Sklaven ihren Herrn Larcius Macedo in seiner Villa bei Formiae während des Bades. Im Glauben, sie hätten ihn getötet, ließen sie ihn auf dem heißen Boden der Thermen liegen. In Wirklichkeit überlebte Macedo das Attentat, starb aber wenige Tage später an seinen Verletzungen. Das Motiv der Sklaven war eindeutig: Erbitterung und Wut auf einen berüchtigten Menschenschinder, »einen ebenso hochmütigen wie grausamen Herrn«, charakterisiert ihn der Jüngere Plinius – und fügt hinzu, dass sich dieser unerbittliche Sklaventreiber »zu wenig oder vielleicht zu oft klargemacht hat, dass sein eigener Vater selbst noch Sklave gewesen war«.[8]
Im Grunde also ein klarer Fall, bei dem man eine gewisse Sympathie mit den Tätern verspüren könnte, auf jeden Fall aber keine mit dem Opfer, das seine Sklaven offensichtlich bis aufs Blut gereizt und zu ihrer Verzweiflungstat getrieben hatte – Plinius sei Dank für seine luziden Worte über das Kompensationsmotiv des Sklavenquälers. Umso mehr erstaunt man, wie unser Chronist – selbst ohne Zweifel ein fürsorglicher, seinen eigenen Sklaven ausgesprochen zugewandter Herr – die aufsehenerregende Bluttat bewertet: »Da siehst du, wie vielen Gefahren, wie vielen Entwürdigungen, wie vielen Verhöhnungen wir ausgesetzt sind!« »Wir« – das ist die Gesamtheit aller Sklavenbesitzer, die jetzt gewissermaßen zur Solidarität ausgerechnet mit einem Sklavenschinder aufgerufen wird, der die gesamte Institution der Sklaverei durch sein individuelles Fehlhandeln desavouiert hat. »Und niemand darf sich sicher sein«, fügt Plinius hinzu, »nur weil er glaubt, ein nachsichtiger und milder Herr zu sein. Denn die Herren werden nicht aufgrund eines Urteilsspruches ermordet (der ihr Verhalten in Rechnung stellt), sondern aufgrund eines Verbrechens.«
Eine ziemlich krause Logik, wenn man bedenkt, wie Plinius selbst zuvor den »Urteilsspruch« der Sklaven begründet und Macedo als Hassfigur gezeichnet hat, die Aggressionen geradezu auf sich gezogen habe. Diese rationale Analyse gerät angesichts des Erschreckens über den gewaltsamen Tod eines Mit-Sklavenhalters völlig in Vergessenheit. Irrationale Angst, dass es auch dem »guten« Sklavenhalter ans Leder gehen könnte, beherrscht das Resümee – vielleicht ein tiefer Blick in das Gemüt nicht nur des Sklavenbesitzers Plinius.
In solchen Augenblicken mochte manchen nachdenklichen Freien zu Bewusstsein kommen, dass auch sie »prekär« lebten, insofern sie ebenso wie Macedo zu Opfern der unterdrückten unfreien Minderheit werden konnten. Jedoch zog niemand die Konsequenz daraus, für die Abschaffung der Sklaverei einzutreten oder auf die Dienste von Sklaven zu verzichten, obwohl er die notwendigen Mittel dafür gehabt hätte. Sklaverei war eine Normalität und eine gesellschaftliche Gegebenheit, die nicht grundsätzlich infrage gestellt wurde.
Naturgegebene Sklaverei? – Ein dürftiges, aber bequemes Konstrukt des großen Aristoteles
Die Institution der Sklaverei wurde nicht einmal von den Sklaven selbst infrage gestellt, soweit sich das den Quellen entnehmen lässt, die zugegebenermaßen samt und sonders die Herrenperspektive einnehmen. Doch auch wenn die Stimmen der Betroffenen nicht zu hören sind, lässt sich doch aus ihrem Handeln ablesen, dass sie nicht für eine sklavenlose Gesellschaftsordnung eintraten. Bei keinem der großen Sklavenaufstände war die Abschaffung der Sklaverei ein programmatisches Ziel. Die Sklaven wollten persönlich frei sein, das schon. Und sie wollten sich an ihren bisherigen Unterdrückern rächen – und zwar, indem sie die Herrschaftsverhältnisse umkehrten. Ehemalige Sklaven versklavten jetzt ihre Herren, und der große Sklavenführer Spartacus zwang zuvor freie Römer, am Grabe eines seiner Mitanführer als Gladiatoren zu kämpfen. Mit einer fundamentalen Befreiungsideologie, einem Kampf für die Freiheit aller und gegen die Versklavung von Menschen durch Menschen hatte das nichts zu tun – was man den aufständischen Sklaven nicht vorwerfen sollte. Wieso hätten ausgerechnet wenig gebildete, jahrelang drangsalierte und traumatisierte Sklaven eine Alternative zur bestehenden Gesellschaftsordnung entwickeln und theoretisch begründen sollen? Das hätte man, wenn überhaupt, dann eher von Intellektuellen aus der Oberschicht erwarten können, die über die notwendige Bildung und Selbstdistanz verfügten, um andere – gerechtere – Modelle menschlichen Zusammenlebens zu ersinnen, zu propagieren und sich energisch für ihre Realisierung einzusetzen.
Dazu hat sich indes keiner aufgerafft. Eine antike Abolitionistenbewegung hat es nicht gegeben. Wohl aber die theoretische Einsicht, dass Sklaverei nichts Natürliches bzw. Naturgegebenes sei, ja sogar, dass sie ethisch gesehen als Unrecht zu gelten habe. Die griechischen Sophisten – oder zumindest einige von ihnen – haben das im 5. Jh.v.Chr. deutlich so gesagt: »Die Gottheit hat alle Menschen frei entlassen«, heißt es in einer Rede des Alkidamas, und: »Niemanden hat die Natur zum Sklaven gemacht.«[9] Mit anderen Worten: Dieses Herrschaftsverhältnis lasse sich nicht unter Berufung auf die phýsis, »Natur«, begründen. Es sei ein Geschöpf des nómos, der »Gewohnheit«, der »gesellschaftlichen Vereinbarung«. Bei dieser Klarstellung blieben die Sophisten jedoch stehen; sie leiteten daraus, soweit das rekonstruierbar ist, nicht die Forderung ab, auf die Sklaverei zu verzichten. Auch in anderen Bereichen trafen die Menschen ja gesellschaftliche Vereinbarungen, die sich mit mehr oder wenigen guten Gründen über die Natur hinwegsetzten. Selbstverständlich war auch der nómos eine Autorität; von daher ergab sich keine zwangsläufige Notwendigkeit, die ethische Erkenntnis in gesellschaftliche Realität umzusetzen.
Die Position der Sophisten entsprach außerdem nicht gerade der Mehrheitsmeinung. Die wurde einige Zeit später vom großen Aristoteles vertreten und gewissermaßen ein für alle Mal theoretisch begründet. Für ihn war die Sklaverei naturgegeben, allerdings nur die Versklavung von »Barbaren« durch Griechen. Für Aristoteles gibt es ein allgemeines Prinzip, das die Menschheit von Natur aus in Herrschende und Dienende einteilt. Das sei bei Männern und Frauen der Fall, meint er, insofern es für das Weibliche nützlicher sei, vom Männlichen regiert zu werden. Ebenso verhalte es sich bei Freien und Unfreien; für die Letzteren »ist das Dienen zuträglich und gerecht«. Das erkenne man schon an der natürlichen Beschaffenheit der Körper. Die einen – Sklaven – seien »kräftig für die Beschaffung des Notwendigen gebaut«, die anderen – Freien – »aufgerichtet und brauchbar für ein politisches Leben«[10]. Aristoteles muss freilich einräumen, dass »häufig auch das Gegenteil davon vorkommt«.[11] Schon allein mit diesem Zugeständnis diskreditiert sich das scheinbare Argument von der naturgegebenen Sklaverei selbst. Damit schwächt Aristoteles auch seine These, dass es für die Sklaven selbst das Beste sei, von Herren regiert zu werden, weil »sie zwar Vernunft annehmen, aber nicht selbstständig besitzen können« – ähnlich wie der Körper der Seele, das Tier dem Menschen und das Weibliche dem Männlichen untertan sein müsse.
Es lohnt einfach nicht, die logisch überaus löchrige Argumentation des Aristoteles ausführlich darzulegen und zu widerlegen. Sie ist alles andere als ein Ruhmesblatt der antiken Philosophie – wenig mehr als eine philosophisch verbrämte Rechtfertigung des gesellschaftlichen Status quo, bei der es um nichts anderes ging als um ebendiese Legitimation. Die Sklavenbesitzer konnten mit dieser »philosophischen« Rückendeckung bestens leben, und es hatte ja niemand ein wirtschaftliches Interesse daran, die bequeme ideologische Grundlage der vermeintlich naturgegebenen Sklaverei zu erschüttern. Kein Wunder, dass sich nicht nur antike Sklavenhalter gern auf Aristoteles beriefen, sondern in der Neuzeit auch noch spanische Conquistadoren und nordamerikanische Sklavenhalter.
Indes reichte das gefällige, logisch dürftige Konstrukt des Aristoteles auch vielen römischen Denkern und Rechtsgelehrten als Legitimation der Sklaverei nicht aus. Insbesondere die Juristen favorisierten einen anderen Begründungsansatz, und zwar den der Empirie. Wohin man in der antiken Welt auch blickte, stieß man auf Strukturen von Sklaverei. Sie schien damit ein Ausfluss des ius gentium zu sein, eines »Völkerrechts«, das durchweg die fundamentale Unterscheidung der Menschen in Freie und Unfreie kannte. Mit einem Naturrecht habe das nichts zu tun, sagt der bedeutende Rechtsgelehrte Ulpian klipp und klar: »Was das Naturrecht angeht, sind alle Menschen gleich.«[12] Aber eben nicht, wenn man sich umschaue, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse sich überall entwickelt hätten. Da sei zu konstatieren: »Sklaven befinden sich in der Gewalt ihrer Herren. Diese Gewalt entspringt dem Völkerrecht. Denn unterschiedslos bei allen Völkern können wir feststellen, dass den Herren die Gewalt über Leben und Tod ihrer Sklaven zusteht. Und alles, was durch einen Sklaven erworben wird, wird für den Herrn erworben.«[13] Fazit: Weil es überall so ist, ist es rechtmäßig – eine logisch wenig ambitionierte, pragmatisch-schnörkellose Begründung der Sklaverei.
Ein dialektischer Freiheitsbegriff ohne gesellschaftliche Sprengkraft – Die Position der Stoiker
Auch die Stoiker, in Rom seit dem 1. Jh.n.Chr. die einflussreichste Philosophenschule mit vielen Anhängern in der Oberschicht, wandten sich gegen die These von der naturgemäßen Sklaverei und betonten demgegenüber die Gleichheit aller Menschen im Sinne der gleichen Teilhabe am göttlichen Logos. »Willst du bedenken, dass er, den du deinen Sklaven nennst, demselben Samen entsprungen ist, sich an demselben Himmel freut, in gleicher Weise atmet, lebt und stirbt wie du?«[14], setzt sich Seneca für den Gedanken der prinzipiellen Gleichheit aller Menschen ein. Aber auch die Stoa zieht daraus nicht die Schlussfolgerung einer juristischen Gleichstellung. Für sie ist Versklavung ein Schicksal, das letztlich den freien Willen des Menschen nicht beeinträchtigt. Wie Armut, Krankheit und andere Widrigkeiten ist der Verlust der bürgerlichen Freiheit ein Adiaphoron, d.h. es macht in letzter Konsequenz keinen Unterschied, ob es einem widerfährt oder nicht – wenn man sich im Inneren von solchen Scheinwerten lossagt. Geld, Gesundheit oder eben auch die Freiheit sind solche Scheinwerte, weil man sie verlieren oder irgendein dahergelaufener Pirat sie mir wegnehmen kann. Ein wirkliches Gut ist nur das, auf das ich jederzeit und in jeder Lage zurückgreifen kann – also etwa meine Einstellung zur Sklaverei. Solange ich im Inneren ein freier Mensch bin, der sich nicht von Äußerlichkeiten abhängig macht, bin ich kein Sklave im philosophischen Sinn.
Das heißt umgekehrt, dass auch ein Sklave aufgrund seines Menschseins und seiner Teilhabe an der Allvernunft das höchste Ziel der Stoa erreichen kann: ein Weiser zu werden, dessen innere Unabhängigkeit kein äußerer, ihm nicht verfügbarer Umstand zu beeinträchtigen vermag. Damit verbindet sich eine Neudefinition von Freiheit: Wahre Freiheit ist die mentale Unabhängigkeit von Dingen, die ohnehin nicht in meiner Macht liegen; die juristisch-bürgerlich-soziale Freiheit kann insofern kein Wert sein.
Und was kein echtes Gut ist, braucht nicht durchgesetzt und erkämpft zu werden. Damit kamen die Stoiker als Vordenker einer Abschaffung der Sklaverei nicht infrage. Eher trugen sie mit dieser Umwertung des Freiheitsbegriffs zur Zementierung der gesellschaftlichen Verhältnisse bei. Allerdings forderten sie, aufgrund ihrer prinzipiellen Gleichheit Sklaven als menschliche Verwandte human und mild zu behandeln, als Mit-Menschen, die »dieselbe Milch getrunken haben«[15] und deshalb Anspruch auf das erheben können, was man heute als Fairness bezeichnet. Es gibt Anzeichen dafür, dass dieser stoische Appell die Gesetzgebung der römischen Kaiserzeit beeinflusst und in einzelnen Punkten, was die Sklaven und ihre Behandlung angeht, humanisiert hat. Aber von einem neuen Menschenbild lässt sich nicht sprechen und schon gar nicht von einer grundsätzlichen Neuorientierung. Wenn überhaupt, dann machte die Stoa dem einzelnen versklavten Menschen ein Angebot, das Unglück seines Sklavendaseins leichter zu ertragen – indem er sich weigerte, es als Unglück zu definieren.
Die römischen Saturnalien – Erinnerung an ein Goldenes Zeitalter ohne Unfreie
War eine Welt ohne Sklaven überhaupt vorstellbar? Für die meisten Römer einschließlich der Sklaven hieß die Antwort wohl: allenfalls als Utopie. An diese Utopie wurde einmal im Jahr erinnert: beim Saturnalienfest im Dezember, dem römischen »Karneval«, der sich durch Ausgelassenheit, hohen Weinkonsum und die temporäre Außerkraftsetzung gesellschaftlicher Regeln auszeichnete. Dazu gehörte etwa das Verbot des Glücksspiels gegen Geld. Zwar setzten sich die Römer permanent darüber hinweg, aber an den Saturnalien war diese Missachtung des Gesetzes vom »Saturnalien-Gesetz« selbst erlaubt.
Was die Sklaven angeht, so erhielten sie in diesen Tagen in liberalen Haushalten das Recht auf freie Rede. Sie durften sagen, was ihnen nicht passte, ohne Sanktionen befürchten zu müssen. Und sie ließen sich von ihren Herren bedienen; für eine kurze Zeit drehte sich das Herrschaftsverhältnis um. Das war kein Rechtsanspruch der Sklaven, sondern eine Tradition, deren Respektierung ganz in der Macht der Herren stand. Natürlich diente diese kurzfristige Entlassung der Sklaven aus dem Klammergriff des unbedingten Gehorsams auch als Ventil. Sie konnten Dampf ablassen und sich psychohygienisch Luft schaffen, um letztlich in ein neues Jahr der Unterdrückung zu starten – ein bisschen Genugtuung vor den nächsten Demütigungen.
Insofern waren die Saturnalien mit ihrer scheinbaren Sklaven-Freiheit eher ein systemstabilisierendes Element. Interessant ist gleichwohl die Begründung für diesen Brauch: Er erinnerte wie der Name des Festes an die Herrschaft Saturns. Der regierte dem Mythos zufolge die Welt, bevor sein Sohn Jupiter »übernahm« und das Goldene Zeitalter, die aurea aetas, damit zu Ende war. Diese Zeit aber hatte keine Sklaven gekannt, sondern nur freie, selbstbestimmte und glückliche Menschen, die im Frieden mit der Natur und im Frieden mit ihren Mitmenschen lebten. Erst mit dem Ende des Goldenen Zeitalters waren Bosheit und Ungerechtigkeit in die Welt gekommen, Betrug und Gewalt, Unzufriedenheit und Habsucht. Eine verhängnisvolle Spirale des Immer-mehr-haben-Wollens hatte jene Eintracht und jenen Frieden zerbrechen lassen, die der Sage nach die aurea aetas prägten. Der Krieg war erfunden worden und mit ihm die Kriegsgefangenschaft, die älteste und ergiebigste Quelle der Sklaverei.
Im Mythos spiegelt sich historische Erfahrung, jedenfalls zum Teil. Das trifft auch auf den Ursprung der Sklaverei zu: Die absolute Herrschaft eines Menschen über einen anderen resultiert aus dem »Recht des Siegers« im Krieg. Ihm steht alles zu, was er sich mit Gewalt unterworfen hat: das Land, die Habe und eben auch der Körper der Besiegten. Bezwungene Feinde, die die Waffen niederlegten, ergaben sich auf Gnade oder Ungnade. Das »oder Ungnade« wird heutzutage kaum als echte Alternative zur Kenntnis genommen. Bei den Römern war das anders: Auf Gnade oder Ungnade umfasste eben auch die Ungnade, und das heißt die Tötung des Feindes oder seine völlige Inbesitznahme bis hin zur Auslöschung seiner bürgerlich-sozialen Existenz durch die Überführung in den Status eines Sklaven, der nur noch dem Willen seines Herrn untertan war.
In diesem totalitären Verständnis von Sich-Ergeben ist es gar nicht zynisch gemeint, wenn man die Versklavung als Ausdruck von Milde interpretierte: Im Akt der Versklavung verzichtete der Sieger darauf, den Besiegten zu töten. Er begnügte sich damit, ihn zu versklaven, und »rettete« ihn damit vor Schlimmerem, dem Tod. Tatsächlich glaubte man allgemein an die (falsche) Etymologie, dass sich servus, der »Sklave«, von servare, »retten«, ableite (statt von servire,»dienen«). »Die Bezeichnung ›Sklaven‹ kommt daher, dass Feldherren ihre Gefangenen gewöhnlich verkaufen und sie dadurch retten und nicht töten«, meint der Jurist Florentinus im 2. Jh.[16], und noch ein halbes Jahrtausend später wird Isidor von Sevilla im 7. Jh. den Ursprung der Sklaverei ähnlich definieren: »Das Wort servus haben sie daher genommen, dass die, die nach dem Kriegsrecht von den Siegern hätten getötet werden können, indem sie gerettet wurden, zu Sklaven wurden« (cum servabantur, servi fiebant).[17]
Kriegsgefangenschaft, Geburt, Piraterie – Quellen der Sklaverei
Ist solch ein Siegerrecht oder Kriegsrecht fair gegenüber den Besiegten? Die Römer hätten nicht gezögert, die Frage mit Ja zu beantworten. Denn zumindest theoretisch hätten die Besiegten, bevor sie in die Hand des Siegers fielen, sich selbst das Leben nehmen und sich damit die Ungnade der Sklaverei ersparen können. Der Freitod galt jedenfalls in der griechisch-römischen Welt nicht als etwas Unmoralisches.
Die wichtigste Quelle der Sklaverei neben der Kriegsgefangenschaft war die natürliche Reproduktion. Genauer gesagt, waren Kinder von Sklavinnen unfrei. Da der Körper der Sklavin dem Herrn gehörte, war er auch Eigentümer ihrer Leibesfrüchte. Im Unterschied zu den Vätern – pater semper incertus hieß die Rechtsregel im Vor-DNA-Zeitalter, »der Vater ist immer unsicher« – war die Zuordnung von Kindern zu ihren Müttern eindeutig. Daher bestimmte sich der Rechtsstatus von Kindern nach dem der Mutter. Im Hause geborene Sklaven (vernae) galten im Allgemeinen als angenehmer für die Sklavenbesitzer. Modisch ausgedrückt: Sie waren leichter zu »handeln«, weil sie die Freiheit nie kennengelernt hatten und als Unfreie sozialisiert wurden.
Die Schuldsklaverei – Folge des Leihens auf den Körper und des Unvermögens, Schulden anders als durch Überlassung des beliehenen Körpers an den Gläubiger zu begleichen – war auf relativ kurze geschichtliche Epochen beschränkt. Es barg auch sozialen Sprengstoff, wenn Menschen, die zuvor Nachbarn oder jedenfalls gleichberechtigte Mitglieder der Bürgergemeinde gewesen waren, plötzlich zu rechtlosen Unfreien in ebendieser Bürgergemeinschaft degradiert wurden.
Eine nicht zu unterschätzende Quelle der Sklaverei war die Kindesaussetzung. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten stieg die Zahl der ausgesetzten Kinder rasant an; Mädchen waren davon stärker betroffen als Jungen. Wer sich eines solchen Kindes annahm und es aufzog, hatte das Herrenrecht über den Findling. Aus heutiger Sicht eine zynische ökonomische Rechnung: Die entsprechende »Investition« war riskant, da die Kindersterblichkeit hoch war; die »Rendite« bestand darin, eine Sklavin oder einen Sklaven »preisgünstig« zu erwerben und sie bzw. ihn wirtschaftlich auszubeuten – junge Frauen beispielsweise durch Zwangsprostitution in einem Bordell. Weder die Aussetzung noch die Versklavung eines ausgesetzten Kindes kollidierte mit dem Gesetz. Konnte allerdings ein solches Kind später nachweisen, dass es von freien Eltern abstammte, hatte es Anspruch auf sofortige Freilassung. Ob die »Pflegefamilie« in diesem Fall Regress- und Schadensersatzansprüche geltend machen konnte, war unter Juristen umstritten. Freilich war es für die meisten Betroffenen so gut wie ausgeschlossen, den Nachweis ihrer freien Geburt zu führen – es sei denn, ein Zufall kam zu Hilfe, wie ihn Komödiendichter in Wiedererkennungsszenen gern konstruierten, um die Handlung in einem Happy End ausklingen zu lassen.
Auch diejenigen, die durch kriminelle Akte in die Sklaverei geraten waren, hatten nur geringe Chancen, ihren wahren Rechtsstatus nachzuweisen und damit der Unfreiheit wieder zu entkommen. Menschenraub und Piraterie waren eindeutig illegal, wurden aber auch in friedlichen Zeiten praktiziert und indirekt durch Beamte gedeckt, die nicht so genau hinschauten, woher die auf den Sklavenmärkten angebotene »Ware« stammte. Es gab Banden, die sich in Grenzregionen des Imperiums auf die Menschenjagd spezialisiert hatten und so für Nachschub an Unfreien sorgten. Zudem gab es Kriminelle, die innerhalb des Römischen Reiches Beute machten. Die Gefahr für Schiffsreisende, von Seeräubern überfallen, versklavt oder zur Lösegelderpressung festgehalten zu werden, war zu allen Zeiten und in allen Teilen des Mittelmeeres gegeben.
Der jähe Wechsel des Glücks, dass ein wohlhabender, einflussreicher Schiffspassagier bei einer Piratenaktion unversehens zu einem hilflosen Sklaven degradiert wurde, war nicht nur ein Topos in den Philosophen- und Rhetorenschulen. Solche Schicksale gab es in der Realität zuhauf, und die Opfer dieser ausgesprochen lukrativen Verbrechen hatten größte Mühe, sich aus den Fängen der Unfreiheit wieder zu befreien. Vor allem im östlichen Mittelmeer existierten kriminelle Netzwerke, die den illegalen Sklavenhandel in großem Maßstab betrieben und alle Tricks nutzten, um die Identifizierung gekidnappter Menschen als freie Bürger zu verhindern und zu erschweren. Der schlechte Ruf, in dem Sklavenhändler (mangones) allgemein standen, erklärte sich auch aus ihrer Mitgliedschaft in solchen kriminellen Vereinigungen, die Freie völlig willkürlich und widerrechtlich versklavten.
Demütigung auf dem Sklavenmarkt – Der Mensch als Ware
Für jeden Menschen, der auf welchem Wege auch immer in die Sklaverei gelangte, war das eine Katastrophe. Sie begann mit der Gefangennahme und einem qualvollen Fußmarsch zum nächstgelegenen oder auch, wenn der Sklavenhändler sich größeren Profit davon versprach, zu einem entfernteren Sklavenmarkt. Um sie an der Flucht zu hindern, wurden den Sklaven Halsringe umgelegt, die mit einer Kette untereinander verbunden waren.
Sklavenmärkte gab es überall, häufig sogar in kleineren Ortschaften. Die menschlichen Verkaufs-»Objekte« wurden auf einem Gerüst ausgestellt, nicht selten nackt, damit kein körperlicher »Mangel« verborgen blieb. Um den Hals trugen die Sklaven vielfach Schilder, auf denen ihre Herkunft, ihr Alter und ihre besonderen Qualifikationen standen. Potenzielle Käufer schauten sich die angebotene »Ware« genau an, tasteten sie ab und erkundigten sich beim Händler nach dem Preis und nach besonderen Eigenschaften, die die Tafel unerwähnt ließ. Gab es Vorerkrankungen? Hatte der Sklave schon einmal einen Fluchtversuch unternommen? War er kriminell geworden, oder hatte er einen anderen »Mangel« (vitium)? All das waren Faktoren, die den Preis mindern konnten.
Weibliche »Ware« wurde vor allem hinsichtlich ihrer Tauglichkeit für sexuelle Dienstleistungen – auch als »Lustobjekt« des Käufers – begutachtet – das alles natürlich mit anzüglichen, beleidigenden, beschämenden Kommentaren. Egal, ob sie der Sprache, in der über sie verhandelt wurde, mächtig waren oder nichts von dem verstanden, was da, von Gesten, Ausrufen und Griffen begleitet, gesprochen wurde – es war eine äußerst entwürdigende, angsterfüllte Atmosphäre, in der den Sklaven ihre Ohnmacht und Verlassenheit zu Bewusstsein kam. Wie sie selbst taxiert wurden, so versuchten auch sie, vom Habitus und von der Miene des Kaufinteressenten abzulesen, was für ein Herr sie da erwartete. Was mochte das für ein »Typ« sein, dem sie für ihr weiteres Leben voll und ganz ausgeliefert sein würden? Für welche Arbeiten mochte er sie vorsehen? Würde er sie in eine anonyme familia rustica zusammen mit Dutzenden anderer Unfreier stecken oder sie in eine familia urbana mit der Aussicht auf einigermaßen menschliche Behandlung aufnehmen?
Die Verwendung richtete sich nach der Ausbildung, den physischen Kräften, intellektuellen Fähigkeiten und dem Aussehen des einzelnen Sklaven bzw. der einzelnen Sklavin. Insofern konnten die Verkaufs-»Objekte« ahnen, wozu man sie kaufte; wissen konnten sie es nicht. Und auch nicht, wie sie behandelt würden, verbal gedemütigt oder geschlagen, sexuell missbraucht oder zur peinvollen Mühlenarbeit abgeordnet, weiterverkauft, verliehen oder verschenkt. Sklaven waren menschliche Ware, und so wurden sie behandelt. Nach ihren Wünschen fragte auf dem Sklavenmarkt niemand. Sie hatten zu antworten, wenn sie gefragt wurden, und ansonsten zu schweigen und abzuwarten, bis man sie an den Mann oder an die Frau gebracht hatte. Sie waren eingeschüchtert von der ganzen Situation, aber sicher auch von vorangehenden Drohungen des Sklavenhändlers, bloß kein falsches Wort zu sagen, das ihren Verkaufswert mindern könnte. In dieser Atmosphäre etwa zu behaupten, man sei eigentlich ein freier Mensch und illegal auf den Sklavenmarkt verschleppt worden, war illusorisch. Es hätte strenge Peitschenhiebe nach sich gezogen.
Natürlich ist manches von dem gerade Gesagten spekulativ. Es gibt keine authentischen Zeugnisse von Sklaven, die von diesen furchtbaren Momenten in ihrem Leben berichten würden. Ganz anders sieht es bei denen aus, die um die menschliche Ware feilschten. Über ihre Verhandlungen und besonders über die juristischen Hintergründe sind wir bestens unterrichtet. Da wurden ja jedes Jahr viele Zehntausend entsprechender Kaufverträge geschlossen – ein Beschäftigungsprogramm auch für Juristen. Häufiger Streitpunkt waren tatsächliche oder vermeintliche Mängel: Ein »Vorleser«, der sich als Analphabet herausstellte, musste vom Verkäufer zurückgenommen werden, ein Daker, der in Wirklichkeit ein Syrer war, desgleichen, weil eine arglistige Täuschung über seinen Charakter vorlag: In der an oberflächlichen ethnischen Etikettierungen nicht armen Welt der Antike sagte man Syrern eine Neigung zum Stehlen nach. Ärger gab es regelmäßig auch bei falschen Angaben über die Gesundheit des Sklaven. Mancher Käufer ließ sich ausdrücklich versichern, dass der Sklave nicht an Epilepsie litt, und selbstverständlich mussten auch psychisch-moralische »Defekte« bzw. das, was sich dem Käufer so darstellte, wahrheitsgemäß angegeben werden, so z.B. eine Neigung zum Weglaufen oder zum »Bummeln«.
Als Marktaufseher waren die Aedilen zuständig. Sie verfügten daher in ihrem Edikt: »Wer Sklaven verkauft, muss den Käufer darüber in Kenntnis setzen, welche Krankheit oder welchen Mangel ein jeder aufweist, wer schon einmal einen Fluchtversuch unternommen hat oder ein Herumtreiber ist: Das alles soll beim Sklavenverkauf öffentlich und wahrheitsgemäß erklärt werden. Ist aber ein Sklave unter Verletzung dieser Offenbarungspflicht verkauft worden … so werden wir dem Käufer und allen, die von diesem Geschäft betroffen sind, das Recht einräumen, ein Gerichtsverfahren anzustrengen, dass dieser Sklave zurückgegeben wird.«[18]
Der Verkäufer war auch für »Mängel« schadensersatzpflichtig, die er beim Verkauf nicht kannte, es sei denn, im Vertrag wurde diese Gewährleistung ausdrücklich ausgeschlossen. Diese Bestimmung traf auch bei offengelegten Einschränkungen zu; solche »Mängel« konnten ja beim Kaufpreis berücksichtigt werden. Die defekte »Ware« Mensch musste lediglich ehrlich deklariert werden.
War man handelseinig geworden, so nahm der Käufer seine »Ware« mit oder ließ sie von Helfern in sein Haus oder dahin schaffen, wo sie fortan eingesetzt wurde. Diesen Einsatz nannten die Römer servire, »als Sklave dienen«. Das deutsche »servieren« und das englische service leiten sich davon ab. Im Unterschied zum lateinischen servire beruhen die modernen Begriffe indes auf einer freien Entscheidung des Service-Leisters. Und auch der im süddeutschen Sprachraum gängige Gruß »Servus« (»zu Diensten«) hat eine sehr abgemilderte Bedeutung angenommen. Als »Sklave« des Gegrüßten empfindet sich keiner, der »Servus« sagt – was umgekehrt nicht dazu verleiten sollte, den servus-Begriff der Römer zu verharmlosen. Mit Freiwilligkeit hatte dieses »Dienen« nichts zu tun.
Eine Sklavenhaltergesellschaft? – Wer Latein lernt, begegnet untypischen Familien
Gedient« wurde überall im Römischen Reich, d.h. Sklaven waren omnipräsent. Sie gehörten geradezu selbstverständlich dazu. Insofern war Rom eine Sklavenhaltergesellschaft. Es gab keinen gesellschaftlichen Bereich, keinen Beruf und keinen Ort, in dem man nicht auf Menschen gestoßen wäre, die in Unfreiheit lebten. Da es keine Statistiken oder gar Personenstandsregister aus dem Altertum gibt, ist man, was Größenordnungen angeht, auf Schätzungen angewiesen. Sie differieren naturgemäß stark, weil sie außer soliden Quellen auch spekulative Elemente und persönliche Wertungen einzelner Forscher enthalten, die sich mit der Demographie der römischen Welt beschäftigen. Sicher kann man sagen, dass der Prozentsatz an Sklaven in der Hauptstadt am höchsten gewesen ist. Dort hatte das Gros der Oberschicht-Angehörigen mindestens einen Stadthaushalt mit teilweise mehreren Dutzend oder sogar mehreren Hundert Sklaven. Die Gesamtzahl stadtrömischer Unfreier wird heute auf bis zu einem Drittel der Gesamtbevölkerung Roms geschätzt, d.h. im frühen 1. Jh. um die 300.000.
Auch Italien hatte überproportional viele Sklaven, an die 20 Prozent vielleicht, während ihre Zahl im gesamten Imperium bei rund 10 Prozent lag. Bei einer Gesamteinwohnerzahl von 60 bis 70 Millionen auf römischem Reichsgebiet im 1. und 2. Jh. ist von rund 7 bis 10 Millionen Unfreien auszugehen. Für das römische Ägypten stehen valide Quellen zur Verfügung, denen zufolge 15 Prozent der Stadt- und acht Prozent der Landbevölkerung unfrei war. Die Tendenz – größere Sklavenpopulationen in der Stadt als auf dem Lande – dürfte auf das Gesamtimperium zu übertragen sein, wenngleich mit deutlichen regionalen Abweichungen zu rechnen ist.
Es handelt sich bei all diesen Zahlen um Größenordnungen. Aber selbst wenn sie nach oben zu verschieben sind, was den Anteil der Sklaven an der Gesamtbevölkerung angeht, so steht doch fest, dass die Unfreien stets in der deutlichen Minderheit geblieben sind. Da die allermeisten Sklaven den oberen zehn Prozent der freien Bevölkerung gehörten, ist klar, dass die normale römische Familie keinen Sklaven besaß. Die Verteilung des Sklavenbesitzes war extrem einseitig; in einer modernen Gerechtigkeitsdebatte würde man »ungerecht« sagen, wenn man von dem Aspekt der Menschenrechte und der ethischen Fragwürdigkeit der Sklaverei absehen könnte. Angesichts teilweise sehr phantasievoller Vorstellungen ist also zu betonen, dass der kleine Mann in Rom, der Normalbürger, von einem eigenen Sklaven nur träumen konnte. Arme Schlucker – das waren weit über 50 Prozent der Bevölkerung – sind nie Sklavenbesitzer gewesen. Die römische Normalfamilie, die Schülerinnen und Schülern im Lateinbuch begegnet, hat in der Regel zwei bis drei Sklaven. Es handelt sich also um eine Normalfamilie der Oberschicht, die die Lateineleven in ihrem ersten Lernjahr begleitet.
Im Hinblick auf die absoluten Zahlen ist es nicht mehr ganz so einfach, von einer »Sklavenhaltergesellschaft« zu sprechen. Zumindest in einem naiven Verständnis würde dieser Begriff einen erheblich höheren demographischen Sklaven-Faktor erwarten lassen, knapp über oder an der Grenze zur Mehrheit möglicherweise. Noch komplizierter wird es dadurch, dass es sich bei der »Sklavenhaltergesellschaft« um einen alten ideologischen Kampfbegriff aus der Zeit des linientreuen Marximus-Stalinismus handelt. Marxistische Historiker bezeichneten die Antike so, um der schematischen Kategorisierung der Menschheitsgeschichte zu genügen. Sie definierte die griechisch-römische Antike als Sklavenhalterordnung, insofern die Produktionsverhältnisse entscheidend durch die unfreie Arbeit bestimmt worden seien.
Das ist indes eine nicht nur sehr fragwürdige, sondern auch widerlegbare und vielfach widerlegte These. Außer dem griechischen Sparta, das die unterworfene Helotenbevölkerung in der Weise für sich arbeiten ließ, dass die spartanischen Vollbürger selbst keiner Erwerbsarbeit nachgehen mussten, hat es in der gesamten Antike keinen Staat gegeben, dessen ökonomisches Fundament die Sklaverei gewesen wäre.
Sklavenluxus und Luxussklaven – Statussymbole ohne ökonomischen Mehrwert
Das trifft ebenso und gerade auf Rom zu. Die allermeisten Männer mussten einer Erwerbsarbeit nachgehen, auch viele Frauen waren berufstätig, und außerdem gab es Kinderarbeit in nennenswertem Umfang. Die Vorstellung, dass vor allem in der Hauptstadt Rom Zehn- oder gar Hunderttausende Römer staatlich alimentiert worden wären und nicht für ihren und ihrer Familie Lebensunterhalt hätten arbeiten müssen, ist kompletter Unfug. (Im Kapitel »Panem et circenses« wird das näher ausgeführt.) Und ebenso die Vorstellung, dass »die« Sklaven die Arbeit für die Freien erledigt hätten. Tatsächlich haben in allen Bereichen Freie und Unfreie Hand in Hand gearbeitet, auf den Feldern ebenso wie beim Bau von Häusern, Theatern und Tempeln, in der Schmiedewerkstatt ebenso wie beim Friseur und beim Kaufmann um die Ecke. Bis auf die Rentiers der Oberschicht, die ein paar Prozent der Bevölkerung ausmachten, haben auch die Freien gearbeitet und, wie die demographische Statistik leicht erkennen lässt, das Vielfache dessen zum Bruttosozialprodukt beigetragen, was die Unfreien dazu beisteuerten.
Hinzu kommt, dass ein nicht geringer Teil der Sklaven nicht in der Produktion tätig war, sondern Dienstleistungen erbrachte, die dem Komfort und der Bequemlichkeit der Reichen zugutekamen: Hausarbeiten, persönliche »Betreuung« bis hin zum Anziehen der Herrin oder des Herrn, Entertainment im weitesten Sinne vom Vorlesen bis zum Lieblingssklaven, mit dem man sich sexuell vergnügte, und andere Dienste, die Luxus waren und insofern keinem Freien den Arbeitsplatz wegnahmen. Die feinen Römer waren da ausgesprochen erfindungsreich. Sie ließen sich von Sänftenträgern und Kammerdienern, von Possenreißern und Namensnennern, von Trancheuren und Boten, von Harfenspielerinnen und Lustknaben (pueri delicati), von Tänzern und ständigen Begleitern (pedisequi), von Sonnenschirmhaltern und Fackelträgern, von Vorschmeckern und Ringverwaltern, von Masseuren und Friseuren verwöhnen. »Wir wandeln auf fremden Füßen, wir lesen mit fremden Augen, und wir grüßen mit fremdem Gedächtnis«, beschreibt ein Kritiker diese unproduktiven Dienstleistungen.[19]
In seinem berühmten »Sklavenbrief« führt Seneca seinen Standesgenossen geradezu genüsslich vor Augen, zu welch »perverser« Aufgabenteilung der Sklavenluxus geführt habe: »Einer tranchiert kostbares Geflügel. Mit sicheren Schnitten führt er die kundige Hand durch Brust und Keulen, schneidet Bissen zurecht, der Unglückliche, der für diese eine Sache lebt, Geflügel elegant zu zerlegen – wenn nicht der noch ärmer dran ist, der ihm das um seines Genusses willen beibringt, als der, der gezwungen wird, es zu erlernen. Ein anderer, der Mundschenk, trägt Frauenkleidung und muss mit dem Alter kämpfen: Er kann dem Knabenalter nicht entfliehen (…) und durchwacht die ganze Nacht, die er zwischen der Trunkenheit seines Herrn und dessen Geilheit aufteilt. (…) Ein anderer, dem die Kontrolle über die Gäste übertragen ist, steht unglücklich da und wartet darauf, wen seine Schmeichelei und die Unbeherrschtheit seines Schlundes oder seiner Zunge für eine Einladung am kommenden Tag empfiehlt. Nimm die Einkäufer hinzu, die genaue Kenntnis von den Geschmacksnerven ihres Herrn haben, die wissen, welcher Speise Geschmack ihn anregt, welcher Speise Aussehen ihm Spaß macht, durch welche kulinarische Neuigkeit er von Überdruss befreit werden kann, wovor er aufgrund seines Sattseins Ekel empfindet, worauf er gerade an diesem Tage Appetit hat.«[20]