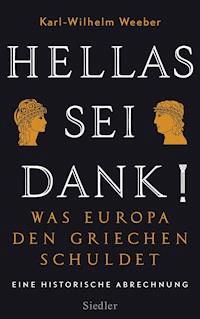
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
So macht Alte Geschichte Spaß: Wie viel Griechenland steckt in uns?
In seinem neuen Buch rechnet Karl-Wilhelm Weeber ab – und zwar ganz im Sinne der Griechen. Denn sie waren es, die uns die Demokratie brachten, Philosophie lehrten und die Dichtkunst schenkten. Was ist schon der Euro gegen Sokrates, Alexander und Olympia? Gewohnt unterhaltsam und lehrreich zugleich erkundet Weeber die Antike und hält uns vor Augen, warum wir auch heute nicht ohne sie leben können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
EINFÜHRUNG
Das alte Hellas, ein Geberland
»Scheitert der Euro, dann scheitert Europa.« So hat es die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel auf einem der vielen dramatischen Höhepunkte der Schuldenkrise beschlossen. Eine radikalere Reduktion Europas auf die blanke Ökonomie ist kaum denkbar. Ist Europa tatsächlich nur eine Art Wohlfahrtspakt, eine Chiffre für eine einheitliche Wirtschaftszone, ein Synonym für einen Markt? Gibt es außer der finanziellen und wirtschaftlichen keine andere Form der Stabilität? Eine geistige Tradition vielleicht, die nicht gleichzeitig mit dem Experiment Euro untergeht?
Natürlich gibt es auch dieses andere Europa. Und dieses Europa ist weit vom Scheitern entfernt. Es ist sogar, auch wenn man sich den kritischen Blick für die moralischen Katastrophen Europas im Laufe der letzten drei Jahrtausende nicht verstellen lassen sollte, eine Erfolgsgeschichte. Zu behaupten, dass die Welt Europa an geistigen Impulsen und kulturellen Errungenschaften mehr zu verdanken hat als anderen Kontinenten und Kulturen, gilt zwar heutzutage als inopportun und politisch nicht korrekt. Da liegt dann das böse Wort vom Eurozentrismus ganz nahe. Das ist so eine Totschlagvokabel, die zwar mit Recht vor einer zu eingeschränkten Sicht auf die Weltgeschichte und erst recht auf eine multipolar globalisierte Welt zu Beginn des 21. Jahrhunderts warnt, die aber auch die fatale Botschaft transportiert, Europa solle sich bloß nicht zu wichtig nehmen: Der alte Kontinent solle sich gebührend klein machen in einer größer gewordenen Welt und Demut statt Arroganz einüben. Keine Frage, dass es europäische Arroganz gegeben hat und dass sie alles andere als hilfreich im Umgang mit anderen Völkern und fremden Kulturen gewesen ist. Aber mittlerweile scheint das Pendel eher zur anderen Seite auszuschlagen. Von europäischem Selbstbewusstsein und Stolz auf den gewaltigen Beitrag Europas zur Weltkultur ist wenig die Rede. Wer von der »abendländischen Tradition« spricht, gerät, obwohl das ein präziser historischer Terminus ist, rasch unter Ideologieverdacht. Die damit verbundenen Identitätsangebote und Sicherheiten hinsichtlich einer geistigen Heimat in einer ja nicht gerade unter europäischen Vorzeichen globalisierten Welt bleiben auf diese Weise ungenutzt. Historische Bewusstseinswurzeln werden gekappt oder vertrocknen. Europäer streiten sich über die gerechte Verteilung des Schuldenkuchens und reden über europäische Solidarität, nicht aber über ein gemeinsames Wirgefühl, das sich aus einer gemeinsamen abendländischen Geschichte und Kultur auf dem Fundament der griechisch-römischen Antike entwickelt hat.
Andere Identitätsfragen dominieren die öffentliche Diskussion: Wie viel Islam darf’s denn sein? Gehört der Islam zu Deutschland, oder gehören nur die hier lebenden Muslime zu Deutschland? Wer wie z.B. der amtierende Bundespräsident Joachim Gauck nachfragt, wo denn der Islam Europa geprägt habe, muss sich von einem Spiegel -Redakteur auffordern lassen, in einem etymologischen Lexikon doch mal arabischstämmige Wörter nachzuschlagen. Da werde er dann unter anderem auf »Alkohol« und »Atlas« stoßen.1 Alkohol stimmt, bei Atlas raten wir eher zu einem Griechisch-Lexikon. Atlas war nämlich in der griechischen Mythologie einer der Titanen, der dem Kartenwerk und dem Atlasgebirge seinen Namen gegeben hat. Das liegt zwar in einem arabischsprachigen Land, hat aber trotzdem einen griechischen Namen. Politisch vielleicht nicht ganz so korrekt, sachlich aber schon.
Nun wollen wir aus diesem Zufallsfund nicht den Schluss ziehen, dass die islamische Kultur bei uns schon bekannter sei als die griechische. Aber es scheint doch nicht ganz so abwegig zu sein, jene geistigen Prägungen in Erinnerung zu rufen, die Europa den Griechen verdankt. Es sind natürlich die alten Griechen, um die es in diesem Buch geht: Sie haben in zentralen Bereichen unserer Kultur die Grundlagen gelegt, haben das Abendland geistig gewissermaßen angeschoben. Sie haben uns das philosophische Staunen und Fragen gelehrt, haben das Theaterspiel und die meisten Literaturgattungen begründet und die Fundamente einer wissenschaftlichen Medizin gelegt. »Politik« ist nicht zufällig ein griechisches Wort, und auch die Staatsform, die zumindest die westliche Welt für die beste hält, ist eine griechische Erfindung: die Demokratie, in der das »Volk« (démos) über die »Macht« (krátos) verfügt.
Unter der historischen Perspektive ist Hellas für Europa das, was die finanziell starken Länder Europas heute nicht ohne überheblichen Zungenschlag zu sein beanspruchen: ein Geberland. Und was für eines! Was in der griechischen Antike grundgelegt worden ist, wurde über die Jahrtausende – auch durch römische und später zum Teil arabische Vermittlung – in die Geistesgeschichte Europas so intensiv eingespeist, dass viele den Ursprung aus den Augen verloren haben. Das ist, um ein weiteres griechisches Wort zu verwenden, an sich kein Drama. Aber in einer Zeit, da ganz Europa die Griechen vornehmlich als den Bettler vom Balkan wahrnimmt, der nur an unser Geld will, sollte man sich verstärkt auch an dieses andere Vermächtnis, die Leistung Griechenlands für Europa, erinnern. Man muss, da ja das heutige Griechenland an seinen finanziellen Problemen nicht ganz unschuldig ist, nicht unbedingt pathetisch mit Günter Grass von »Europas Schande« sprechen, darf aber dem poetischen Leitartikler doch zustimmen, wenn er einem geschichtsvergessenen Europa ins Stammbuch schreibt: »Geistlos verkümmern wirst Du ohne das Land, dessen Geist Dich, Europa, erdachte.«
Das ist wohl wahr. Über die ganze finanzielle Misere und die Wut über die Griechen sollte Europa, meinen auch wir, sein griechisches Erbe und Wesen nicht vergessen, sondern es vielmehr als Chance sehen, sich selbst in weiterem Rahmen denn als Finanzclub zu definieren und Selbstbewusstsein eben auch aus diesen Wurzeln und ihrem großartigen Wachstum in den letzten zweieinhalb Jahrtausenden zu beziehen.
Es sind die Wurzeln, nicht die späteren Wachstumsschübe, die dieses Buch zutage fördern will. Aber wir erheben dabei nicht den Anspruch der Vollständigkeit; aus der Fülle dieses Wurzelwerkes mussten wir eine Auswahl treffen, die durchaus subjektiven Überlegungen und Vorlieben verpflichtet ist. Man hätte durchaus andere Akzente setzen, weitere, objektiv gesehen vielleicht sogar wichtigere Themen behandeln können. Ob beispielsweise der »Tonnen-Philosoph« Diogenes so viel Platz verdient, das kann man kritisch sehen. Wir haben uns für diesen besonders »unklassischen« Farbtupfer auch deshalb entschieden, um die enorme Bandbreite der griechischen Klassik zu illustrieren. Einige Wiederholungen nehmen wir in Kauf, weil die Kapitel in sich geschlossene Einheiten bilden und der Lesefluss nicht durch Verweise auf andere Kapitel gestört werden soll.
Dieses Buch wendet sich an ein Lesepublikum, das etwas mehr über unsere griechische Vergangenheit und Gegenwart erfahren möchte, als es die Schlagwörter vom Ursprungsland der Demokratie und der Olympischen Spiele, des hippokratischen Eids und des Delphischen Orakels bieten. Dabei geht es nicht nur um Kontinuitäten in der Tradition, sondern auch um Traditionsbrüche. Der »olympische Geist« ist ein lehrreiches Beispiel dafür, wie man eine moderne Sportinszenierung klassisch legitimiert und sich dabei einen Mythos schafft, der zum ursprünglichen Geist des alten Olympia in teilweise krassem Gegensatz steht. Oder auch das Thema Erotik: ein griechischer Begriff zwar, der sich vom Liebesgott Eros ableitet, aber in wesentlichen Inhalten von modernen, gesellschaftlich anerkannten Erotikvorstellungen weit entfernt. Gleichwohl hat die Einstellung der alten Griechen zur Erotik tiefe Spuren in der Geistes- und Kulturgeschichte Europas hinterlassen – auch wenn kaum jemand auf den Gedanken käme, darin heutzutage besonders Vorbildhaftes finden zu wollen.
Dies soll kein Jubelbuch in der Tradition deutscher Hellas-Schwärmerei sein. Eine wohlwollende, hier und da in Bewunderung übergehende Grundhaltung scheint uns mit einer durchaus kritischen Distanz vereinbar – zumal »Kritik« ein griechisches Wort ist: Mit krínein bezeichneten die Griechen das »unterscheidende Urteilen«. Wo wir indes der Überzeugung sind, dass wir von unseren griechischen Kulturvätern aktuell einiges dazulernen können, da erlauben wir uns, Klartext zu reden und dabei ruhig auch einmal anzuecken. Nicht jedem wird etwa das Plädoyer dafür gefallen, dass auch und gerade eine Demokratie sich in ausdrucksstarken, Pracht und Selbstbewusstsein spiegelnden öffentlichen Bauwerken repräsentieren sollte – so wie die athenische Demokratie es uns mit der Bebauung der Akropolis vorgemacht hat. Oder auch bei der Schaukultur der Masse: Welch seichter, verblödender TV-Quatsch wird heute einem Millionenpublikum Tag für Tag zugemutet, und welche grandios-anspruchsvolle Theaterkost – Aischylos, Sophokles, Euripides – haben sich Tausende einfacher Athener Bürger, tagelang auf harten Holzbänken sitzend, zugemutet? Nein, dieser Kontrast markiert nicht den Untergang des Abendlandes, aber er weist in diesem Punkt auf einen kulturellen Abstieg hin. Da hat unsere Zivilisation, wie man heute sagt, noch eine Menge Luft nach oben.
Wenn sich mit diesem Buch eine Werbebotschaft verbindet, so bezieht sie sich vor allem auf einen Bereich, in dem die hier angesprochenen Themen, Anregungen und Fragestellungen traditionell zu Hause sind und von dem sie idealerweise in die gesamte Gesellschaft ausstrahlen. Das ist der Griechisch-Unterricht am Gymnasium. Zugegeben: Er hat sich zu einem Exotenfach entwickelt; der seit Jahren anhaltende Boom des Lateinunterrichts hat die Zahl der Griechisch-Schüler nicht mit in die Höhe nehmen können. Aber es gibt ihn noch, diesen Freiraum inmitten all des Effizienz-und Kompetenzgedröhnes, der auf den Ursprung von Schule verweist: scholé ist – natürlich! – ein griechisches Wort, und das bedeutet »Muße« – geistvoll verbrachte Zeit, die der Bildung der Persönlichkeit ohne Blick auf eine unmittelbare praktische Verwertung dient. Bedenkt man, dass das staunende und Nachdenken auslösende Fragen am Anfang einer überaus erfolgreichen griechischen und damit europäischen Wissenschaftsgeschichte gestanden hat, dann war das schulisch-mußevolle Herangehen an die Dinge vielleicht gar nicht so ineffizient, wie es bei vordergründiger Betrachtung den Anschein hat.
Wir erhoffen uns nichts Utopisches, nichts, für das es »keinen Ort« (ou, »nicht«, tópos, »Ort«; outopía ist allerdings kein altgriechisches Wort, sondern eine Neuschöpfung von Thomas Morus im 16. Jahrhundert) gibt. Wir wünschen uns nur, dass der kleine, ja winzige Schutzraum des Griechisch-Unterrichts wenigstens erhalten bleibt und dass Leserinnen und Leser, denen wir unser griechisches Erbe etwas näherbringen konnten, sich dafür einsetzen. Wenn Griechisch scheitert, scheitert das Gymnasium – wir sind nicht so töricht, dieses Junktim à la Merkel herzustellen. Aber es wäre ein Riesenverlust und ein, trauen wir uns, es so zu nennen: Verrat an der glanzvollen deutschen Bildungsgeschichte, wenn wir uns vom Orchideenfach Griechisch gänzlich verabschieden würden. Das sagt übrigens einer, der die demokratische Öffnung des Gymnasiums in den letzten Jahrzehnten ausdrücklich als großen gesellschaftlichen Fortschritt empfindet und der mit einem auf Exklusivität bedachten humanistisch-elitären Bildungsideal nichts anzufangen weiß. Griechisch ist keine Bastion der Reaktion oder gar der Repression, sondern eine Bühne des freien, fragenden und forschenden Geistes. Durch dieses Fragen, das auch das Überkommene infrage stellte, sind die Griechen unter anderem auf etwas höchst Fortschrittliches, ja geradezu Revolutionäres gestoßen: die Demokratie. Und deshalb ist der Griechisch-Unterricht auch Teil einer großen demokratischfreiheitlichen Tradition – mag man das auch nicht jedem Griechisch-Unterricht in der Vergangenheit so angemerkt haben.
Versteht sich dieses Buch auch als Werbung für das zeitgenössische krisengeschüttelte Hellas? Wie seriös ist es eigentlich, eine »historische Abrechnung« vorzulegen, die eine Art geschichtlicher Identität zwischen »alten« und »modernen« Griechen suggeriert? Natürlich ist jeder Vergleich ohne ein echtes Tertium Comparationis unseriös. Wir denken eher an eine moralische Verpflichtung, eine emotionale Bindung zu einer Wiege, die die eigene Wiege bleibt, auch wenn jetzt ein anderer darin liegt. Auch die Wiege als solche sollte es uns – neben der viel beschworenen Solidarität mit dem griechischen Nachbarn im gemeinsamen europäischen Haus – wert sein, das, was wir Hellas schulden, auch in anderer als nur geistiger Münze zurückzuzahlen.
Klar, das ist kein rationales Argument, das ist aus Sicht vieler antigriechischer Wutbürger pure Gefühlsduselei. Aber es ist ein Gefühl gegenüber den alten und den arg gebeutelten modernen Griechen, dessen sprachliches Copyright wieder einmal bei unseren griechischen Kulturvätern liegt: Sympathie. sympátheia heißt »Mit-Empfinden«, »Mit-Leiden«, aber es heißt nicht »Mitleid«. Das haben die Griechen nicht nötig, die alten nicht und die heutigen auch nicht. Denn dafür steht Europa viel zu tief in ihrer Schuld.
KAPITEL 1
Politik – Ein griechisches Gen
Der Staat als Krimineller? –Anfragen eines politischen Griechen
Wie kann man sich nur wünschen, von der Politik verschont zu bleiben? Wie kann man sich nur selbst als unpolitischen Menschen bezeichnen? Wie kann man nur behaupten, Politik sei ein schmutziges Geschäft?
Wer sie dafür hält, hat selbst keine sauberen Hände, würde ihm ein Grieche der klassischen Zeit entgegenhalten. Und wer sich als unpolitisch outet, dem würde er Egoismus und Eigennutz vorwerfen. Wer von Politik verschont bleiben will, dem geschieht es recht, seiner Freiheit verlustig zu gehen und sich unter einem tyrannischen Regime wiederzufinden. Der Despot hat in der Tat kein Interesse am politischen Engagement der Bürger. Wobei »Bürger« schon ein falscher Begriff ist: despótes ist der »Herr«, die anderen sind folglich seine Untergebenen.
Ein Grieche des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. hätte auch wenig Verständnis für die heutzutage populäre Formulierung gehabt, der Staat greife seinen Bürgern in die Tasche, wenn er Steuern und Sozialabgaben erhöht. Klar, die Steuern kommen ja nicht etwa den Bürgern zugute und ebenso wenig die Renten- und Krankenkassenbeiträge, das alles verschlingt der Moloch Staat. Der, hört man nicht selten, plündert seine Bürger regelrecht aus – und die starren gebannt darauf, dass sie im Juni/Juli endlich anfangen können, ihr Geld für sich selbst zu verbrauchen, nachdem der gefräßige Staat ihnen dem medienwirksamen Bild der »Steuer- und Sozialuhr« zufolge die Hälfte ihres Jahreseinkommens im ersten Halbjahr weggenommen hat.
Wir neigen dazu, unseren Staat nicht nur als Bedrohung zu empfinden und zu fürchten, sondern ihn sogar zu kriminalisieren – ohne einen Gedanken darauf zu verschwenden, dass wir selbst es sind, die Gemeinschaft der Bürger, die diesen Staat konstituieren und die in repräsentativen demokratischen Prozessen für ebendiese vermeintliche Selbstausbeutung gestimmt haben. Das ist jedenfalls das Verstörende an unserer Staatsferne: dass wir die Politiker als Sachwalter unserer Polis-Gemeinschaft selbst gewählt haben und das demokratische Prinzip der Mehrheitsentscheidung doch im Großen und Ganzen anerkennen.
»Da läuft aber verdammt viel schief bei euch«, würde unser griechischer Gesprächspartner aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. sagen. »Wie können sich Politen so weit von ihrer eigenen Polis distanzieren, dass sie sie eher als Gefahr für ihre individuelle Entfaltung wahrnehmen denn als Chance, ja als Gewährleisterin bürgerlicher Freiheit?«
Das einzige wirklich ernst zu nehmende Gegenargument wäre der Hinweis auf die gewaltige Diskrepanz in den Größenverhältnissen altgriechischer und moderner Bürgerschaften. Der Begriff »politisch« ist abgeleitet von pólis. Das ist die »Stadt«, der »Stadtstaat«. Die naturräumlichen Gegebenheiten des alten Griechenlands begünstigten die Entstehung kleiner staatlicher Einheiten, Berge und Meer waren natürliche Barrieren. Sie legten es nahe, dass die Menschen sich in geographisch abgeschlossenen Räumen organisierten. Ebendiese Organisation war die Polis.
Mitgestalten für die Gemeinschaft – Der Bürger als Politiker
Die Polis bestand aus einem zentralen Ort und einem ländlichen Territorium, das ihn umgab (pólis wird demnach meist zu Recht mit »Stadtstaat« übersetzt). Die meisten Inseln bildeten eine Polis; Kreta und Rhodos als größere Inseln waren in mehrere Poleis aufgeteilt. Die Zahl der Bürger lag meist bei einigen Tausend. Mit rund vierzigtausend Politen, »Bürgern« mit »politischen« Rechten, war Athen (mit Attika) im 5. Jahrhundert v. Chr. eine außergewöhnlich große Polis. Diese Bürger bildeten nicht nur den Staat, sie waren der Staat. Der staatsrechtliche Terminus für Athen hieß hoi Athenaíoi, »die Athener«. Nichts zeigt die Identifikation des einzelnen Politen mit seinem Gemeinwesen deutlicher als dieser Begriff; die Zugehörigkeit zu einer Bürgergemeinschaft bestimmte seine Identität viel stärker als das, was wir heute in erheblich größeren territorialen Einheiten als Nationalität bezeichnen.
Die griechische Polis ist eine face to face society. Zwar kennt nicht jeder jeden, aber viele kennen viele. Der Mittelpunkt des Zentralortes ist die agorá, der Marktplatz. Dort trifft man sich, spricht miteinander, tauscht sich über Neuigkeiten aus, kommentiert vergangene, gegenwärtige und bevorstehende Dinge. Das Leben – der Männer – vollzieht sich in der Öffentlichkeit, das mediterrane Klima ist der Kommunikation der Politen untereinander förderlicher als der nordische Himmel. Wenn Entscheidungen für die Polis zu treffen sind, so hat der griechische Polit ganz viele konkrete Menschen im Auge, andere Politen, auf die eine Entscheidung Auswirkungen haben wird. Der politische Raum ist durch persönliche Kontakte geprägt, nicht durch anonyme Strukturen. Politik hat in Hellas viel mit Nähe, mit Unmittelbarkeit, mit erlebter – und nicht nur rhetorisch beschworener – Gemeinschaft zu tun.
ta politiká, die »Dinge, die die Gesamtheit der Polis betreffen« – die Schicksalsgemeinschaft der Politen, die sich auch als Kultgemeinschaft mit einer Schutzgottheit der Polis versteht –, gehen jeden etwas an, der in irgendeiner Form Mitwirkungsrechte hat. Das muss keine weitgehende demokratische Partizipation sein, das kann sich im monarchisch oder aristokratisch regierten Staat auch auf die Anwesenheit und das bloße Zuhören in der Volks- und Heeresversammlung beschränken.1 Die Beschlüsse, die Volksversammlung, Rat, Beamte oder Gerichte fassen, sind stets politische Entscheidungen, weil sie die Gesamtheit oder jedenfalls einen großen Teil der Politen etwas angehen. Politikverdrossenheit, unpolitisches Beiseitestehen, Politikferne? Dämlicher kann ich meinen eigenen Interessen nicht schaden, als wenn ich an den Dingen, die die Polis betreffen, bewusst keinen Anteil nehme. Dann entscheiden eben die anderen, die politisch Denkenden, über mich, mein Geschick und das meiner Familie mit. Indem ich mich von ta politiká zurückziehe, begebe ich mich meiner Mitbestimmungs- und Mitgestaltungschancen.
»Er ist kein stiller, sondern ein schlechter Bürger«
Das ist die eine Seite. Die zweite betrifft meine Pflicht zur politischen Mitwirkung. Die Gemeinschaft kann von mir erwarten, dass ich mich einbringe, ihr mit meinem Rat helfe und die Legitimation der zu treffenden Entscheidungen durch meine Beteiligung tendenziell stärke. Was heute als freiwillig-ehrenamtliches »bürgerschaftliches Engagement« hochgepriesen wird, ist für den griechischen Politen im Grunde selbstverständliche Pflicht: der Einsatz für die Gemeinschaft, deren Teil er ist. Man könnte vielleicht sogar von einer großen Familie sprechen, das macht es für einen heutigen Staatsbürger einfacher, sich den erwarteten Grad der Anteilnahme an den öffentlichen Dingen in einer griechischen Polis klarzumachen.
Wer sich ta politiká entzieht, handelt gemeinschaftsschädlich, pflichtvergessen, selbstbezogen. »Er ist kein stiller, sondern ein schlechter Bürger«, sagt Perikles.2 Rechtes politisches Handeln besteht darin, mitzumachen und sich einzumischen, dabei aber den Nutzen für die Allgemeinheit nicht aus den Augen zu verlieren.3 Das ist staatsbürgerliche areté, »Tugend«, verantwortungsvolles Handeln. Wenn viele Bürger von diesem politischen, will sagen auf die Polis zielenden Ethos beseelt sind, wenn sie sich, wie wir heute sagen, politisch engagieren, so ist das auch ein guter Schutz vor dem Verlust der Freiheit und Unabhängigkeit. Die war nun allen, auch den trägen Politen, heilig; autárkeia, »Selbstgenügsamkeit«, Freisein von Not auch in wirtschaftlicher Hinsicht hieß das Zauberwort.
Das alles mag sich reichlich idealistisch anhören. Und in der Tat hat dieser Ruf der Gemeinschaft auch im alten Hellas nicht jeden Politen erreicht. Auch da gab es »schlechte Bürger« im Sinne des Perikles, die sich verweigerten, die zu Hause blieben, die lieber Geld verdienten, als an Diskussionen über die Staatsdinge mitzuwirken – wobei damit nicht diejenigen gemeint sind, die an der Peripherie eines Polisterritoriums lebten und sich die staatsbürgerliche Partizipation schlicht nicht leisten konnten. Denen half die athenische Demokratie schließlich, indem sie aktive Teilhabe mit Entschädigungszahlungen unterstützte. Dazu mehr im Kapitel über die Demokratie.
Aber es war doch deutlich schwieriger als heutzutage, sich in einer überschaubaren Polisgemeinschaft einfach so wegzuducken. Gesellschaftliche Kontrolle war das eine, die öffentliche Meinung, die das politische Mitmachen propagierte, das andere Druckmittel auf die Zurückhaltenden. Aber die meisten Politen brauchten diesen Druck nicht, sie nahmen von sich aus teil, mal mehr, mal weniger. Auch athenische Volksversammlungen waren je nach Tagesordnung unterschiedlich gut besucht. Motivation und Belohnung für die Teilnahme war eine an konkreten Ergebnissen erfahrbare Mitwirkung und Mitgestaltung. Jeder, der dabei gewesen war, wusste, an welchen Beschlüssen er mitgewirkt hatte. Da hatte es die direkte Demokratie deutlich leichter als die repräsentative, ihren Bürgern klare Ergebnisse zu präsentieren.
Alles, was sich auf die Polis bezog, war politisch im eigentlichen Wortsinne, nicht nur die großen Fragen von Krieg und Frieden, von der Verwendung der Steuern und Staatseinkünfte, von großen öffentlichen Investitionen. Es klingt so schrecklich nach Politikunterricht der 5. Klasse, aber es trifft zu: Politik fing im Kleinen an, beim Bau eines Gymnasions oder bei der Ehrung eines Mitbürgers, bei der Kontrolle eines Beamten und bei der Verabschiedung einer neuen Marktordnung. Bürgerinitiativen und Bürgerbegehren waren nicht nötig, die relevanten Themen standen alle auf der offiziellen Tagesordnung der Polis-Gremien. Politik kann man lernen, und die politische Praxis einer ständigen Bürgerbeteiligung war nicht die schlechteste Schule dafür.
Politisch waren auch die Feste mitsamt ihren öffentlichen Tischgesellschaften und ihrem Unterhaltungsprogramm. Das Theaterspiel gehörte in Athen zum gemeinschaftlichen Kult der Polis, es war formal wie inhaltlich alles andere als eine politikfreie Zone. Das Zuschauen und Zuhören war eine Art Bürgerpflicht, weil es zur Identitätsbildung, zur Selbstdarstellung, zum Gemeinschaftsgefühl und zur staatsbürgerlichen Erziehung beitrug. Im Theater wurden die Politen mit ethischen und politischen Fragen konfrontiert oder gar behelligt, die ihnen abverlangten, Stellung zu beziehen und das Ergebnis ihres Reflexionsprozesses womöglich bei ihren nächsten realen politischen Entscheidungen zu berücksichtigen. Wer heute »politisches Theater« als etwas anrüchiges, weil ideologielastiges Bühnenspektakel ablehnt, hat alles Recht dazu, aber auf die klassische Theatertradition darf er sich dabei nicht berufen. Das war zwar kein vordergründiges Agitproptheater, aber inhaltlich wurde den Zuschauern da einiges zugemutet. Theater war kein einlullendes, kreuzbraves Samstagabend-Wohlfühlprogramm, sondern häufig genug Provokation mit Tiefgang. Provokation auch im etymologischen Sinne eines »Nach-vorne-Rufens« (provocare): Auch hier waren Drückeberger nicht erwünscht.
Selbst das Rechtswesen war politisch – für modernes Empfinden, das sich am Prinzip der Gewaltenteilung orientiert, eher eine fragwürdige Sache, in griechischen Augen aber war es gewissermaßen systemkonform, dass in einer Bürgerschaft Bürger über die Vergehen anderer Bürger urteilten. Auch zivilrechtliche Auseinandersetzungen lassen sich ja, weil sie das Verhältnis von Politen untereinander betreffen und durchaus Auswirkungen auf (zunächst) unbeteiligte Politen haben können, als politisch definieren. In Gestalt der Schöffen als Laienrichter trägt ja auch die moderne Rechtsordnung diesem Gedanken noch Rechnung, doch ist uns schon wohler dabei, wenn das ganze Verfahren zumindest von einem juristischen Profi gesteuert wird.
Das Aufblühen der öffentlichen Rede, ja die Erfindung der Rhetorik wäre ohne ein umfassendes Verständnis des Politischen nicht möglich gewesen. Ihre Wirkung war wesentlich auf den politischen Raum abgestimmt, das heißt den Raum der Polis, in dem die Politen agierten. Dieses Agieren will das Wort mit seiner Macht und Suggestionskraft beeinflussen. Die öffentliche Rede ist darauf aus, als plausibel empfunden zu werden und damit den Beifall, lateinisch plausus, der Öffentlichkeit zu gewinnen – nicht in irgendwelchen Hinterzimmern oder elitären Zirkeln, sondern inmitten all derer, die die Polis sind.
Das zóon politikón: Logos, Leidenschaft und Lautstärke
Die überragende Bedeutung und ständige Präsenz des Politischen spiegelt sich in der berühmten aristotelischen Definition des Menschen als eines zóon politikón.4 Das meint zum einen ein »auf die Gemeinschaft hin angelegtes Wesen« im Sinne eines Daseinszwecks. Zum anderen bedeutet es, dass der Mensch seine Anlagen am besten in diesem von seinen Mitmenschen und den Gesetzen, die man sich gemeinsam gegeben hat, bestimmten Rahmen nutzen und, modern gesprochen, sich selbst verwirklichen kann. Das funktioniert aber nur, wenn er sich als animal sociale – so die lateinische Übersetzung – begreift und seinen politischen Obliegenheiten als Staatsbürger nachkommt. Nehmen, ohne zu geben, das kann auf Dauer nicht gut gehen, auch weil es Nachahmungseffekte heraufbeschwört, die den politischen Grundkonsens zu sprengen drohen. Eine Polis ohne Politen, das ist nicht denkbar; damit wäre die auf bürgerlicher Solidarität aufgebaute Geschäftsgrundlage überholt.
Diese Fixierung auf das Politische bedeutet beileibe nicht, einen zähen Konsensbrei über der Polis auszugießen. Auch wenn man gemeinsam in einem Boot sitzt, ist damit noch keine Entscheidung über den Kurs getroffen. Es gibt unterschiedliche Interessen, Wahrnehmungen und Temperamente, und die müssen im Polis-Rahmen, mithin politisch ausgetragen werden. Meinungsverschiedenheiten, Streit, ja Kampf sind Teil des politischen Prozesses. Leidenschaft und Lautstärke gehören dazu. Mit »Sachzwängen« brauchte man griechischen Politen nicht zu kommen. Wer so argumentierte, geriet in den Verdacht, die geradezu heilige Freiheit der Bürgerschaft einschließlich der individuellen Freiheit des Einzelnen bei der Zustimmung, der Ablehnung und gelegentlich der Nichtbeteiligung beschneiden zu wollen.
Das Risiko von Fehlentscheidungen, die sich durch spätere Erkenntnis, Meinungswandel oder im Lichte von Ergebnissen und Auswirkungen als solche herausstellten, ging man wohl oder übel ein. Der beste Schutz dagegen bestand darin, dass sich viele zu Wort meldeten und der Entscheidung eine intensive pluralistische Debatte voranging. Der Tat soll der beratende lógos vorangehen, das »Wort«, die »Aussprache«, die Ausdruck menschlicher »Vernunft« ist.5 So gefällt es der Stadtgöttin Athene, wenn Peitho, die Göttin der Überredung/Überzeugung, und Zeus Agoraios, der Schutzgott der Volksversammlung, das Regiment führen:
Wohl lob ich den Blick mir der Peitho sehr, Die so hold mir das Wort und die Lippe gelenkt, Dass ich sie erweicht, die unerweicht sonst; Doch gesiegt hat Zeus, der Beredenden Hort; So siege fortan stets unser Bemühn für das Gute!6
Willkür! Klüngel! Schlechtigkeit! – Das Ringen um die beste Verfassung
Das Engagement des Bürgers erschöpfte sich nicht im Polis-bezogenen Reden und Handeln, sondern es erstreckte sich auch auf das Nachdenken über die politiké téchne, die »Kunst der Staatsverwaltung«. Das konnte die Handhabung politischer Entscheidungen und Verfahrensabläufe sein, das konnte aber auch die grundsätzliche Reflexion über das Wesen von Politik und die beste politische Organisationsform sein. Welche war die beste Staatsform? Das war die harte theoretische Nuss, die die Intellektuellen zu knacken hatten. Teil ihrer politischen Verantwortung war es, darüber einen lebendigen Diskurs zu führen.
Dieser Aufgabe stellten sie sich in vorbildlicher Weise. Ein zentrales Anliegen der griechischen »Weisheitsliebe« des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. war die Staatsphilosophie. Wie lässt sich ein Höchstmaß an Gerechtigkeit in der Polis herstellen? Von dieser Frage gingen unter anderem Aristoteles und Platon aus. Ihre Antworten darauf gehören auch heute noch zu den Klassikern der Lehre, die wir mit einem – natürlich – griechischen Begriff die »Politologie« nennen, die »Wissenschaft von der Politik«. Es gibt wirkungsgeschichtlich keine einflussreicheren Werke der politologischen Reflexion als Platons Staat und die Politik des Aristoteles; sie waren zu allen Zeiten das geistige Fundament und Trainingsfeld zahlloser anderer Denker, auch wenn diese zu ganz anderen Ergebnissen kamen als die beiden griechischen Stammväter des politischen Denkens.
Das früheste Zeugnis einer intensiven öffentlichen Debatte über die beste Staatsform findet sich indes bei Herodot, dem »Vater der Geschichte«. Er verfremdet die Situation in gewisser Weise, indem er seine Verfassungsdebatte drei persischen Adligen in den Mund legt. Sie halten angeblich im September des Jahres 522 v. Chr. nach einer Palastrevolte Rat, wie es weitergehen solle und welche Verfassung künftig die beste für das Persische Reich sei. Manche Griechen würden wohl bezweifeln, dass diese Reden tatsächlich in Persien gehalten worden seien, räumt Herodot ein.7 Die Skepsis ist berechtigt. Herodot wollte aber offenbar Distanz aufbauen, seine grundsätzlichen Erwägungen vor einer vordergründigen Vereinnahmung in der regen tagespolitischen Diskussion Griechenlands schützen.
Die drei Wortführer erweisen sich als Befürworter der drei Staatsformen, die auch den weiteren staatsphilosophischen Diskurs der nächsten Jahrhunderte prägen sollte: Demokratie, hier noch als Isonomie, »Gleichheit vor dem Recht«, bezeichnet, Aristokratie und Monarchie. Am Ende setzt sich der Verteidiger der Monarchie durch; das Ergebnis der Beratung konnte angesichts der tatsächlichen geschichtlichen Entwicklung in Persien nicht anders ausfallen. Ob sie Herodots persönliche Favoritin war, daran kann man erhebliche Zweifel hegen, er neigte eher der Demokratie zu. Viel wichtiger aber sind die grundsätzlichen Ausführungen: Es gibt für alle drei Verfassungen gute Gründe, aber auch stichhaltige Gegengründe.
Der Monarch, so leitet der Verfechter der Demokratie sein Plädoyer ein, neigt zur Willkürherrschaft, er braucht sich vor niemandem zu verantworten, seine Stellung als solche verführt ihn zur Selbstüberschätzung. Auf die Besten ist er neidisch, ihnen gönnt er nichts, und er ist stets gern bereit, auf Verleumdungen zu hören. Ganz falsch, widerspricht ihm der Monarchist. Der gute Herrscher sorgt für sein Volk, er unterbindet die Rivalitäten der Adligen, die zu gefährlicher Lagerbildung im Volk führen können. Gegenüber der moralischen Minderwertigkeit (kakótes), die in der Demokratie droht, und den Umtrieben dieser »Schlechten«, »die die Köpfe zusammenstecken«, verkörpert er hohe Integrität. Nach einem solchen Monarchen sehnen sich die Menschen geradezu.8 Der Vertreter der Aristokratie stützt sich im Wesentlichen auf die sprachliche Empirie des traditionellen adligen Selbstverständnisses: »Wir sollten die Regierung aus den besten Männern bilden; die besten Männer werden auch die besten Entschlüsse fassen.« Die breite Masse ist ohne Einsicht, sie kennt das Gute nicht und tendiert zur Zügellosigkeit. Verstand beim Volk? Fehlanzeige. Und es folgt noch der Hinweis: »Zu den Besten gehören wir ja auch selbst.«9 Man kann sich manchen selbstgefälligen Aristokraten in Athen vorstellen, der so gedacht und gesprochen hat. Aber diesen Schluss konnten Herodots Leser ja auch selbst ziehen.
Was spricht für die Demokratie? Ihr Verfechter hat das erste Wort: Gleichberechtigung vor dem Gesetz – einen schöneren Begriff gibt es nicht. Das Losverfahren ist das genaue Gegenteil monarchischer Willkür. Wer ein Amt verwaltet, muss für seine Amtsführung geradestehen, sich verantworten. Und: »Alle Beschlüsse werden der Gesamtheit vorgelegt.«10
Drei Kapitel, die wir hier nur stichwortartig wiedergegeben haben, werden zu einer Jahrtausendvorlage, zu einem Text, der den politischen Diskurs weiter anfachen konnte und anfachte. Herodot mischte sich ein, ohne dass er unmissverständlich Stellung bezog. Er stellte Pro- und Contra-Argumente in knapper, dialogischer Form zusammen – ein Spiegel der zeitgenössischen Diskussion.
Platons Abrechnung mit der Demokratie
Mit Platon trat dann jemand in die verfassungspolitische Debatte ein, der einen sehr klaren Standpunkt vertrat. Er hielt nichts von der attischen Demokratie. Sein Schlüsselerlebnis war die Verurteilung seines Lehrers Sokrates zum Tode im Jahre 399 v. Chr. gewesen. Mit dem Schierlingsbecher hatte sich der athenische Demos in Platons Augen völlig diskreditiert. Wer einen unbequemen intellektuellen Frager, einen Querdenker vom Format des Sokrates, den das Delphische Orakel zum weisesten Mann seiner Epoche erklärt hatte, wegen »Gottlosigkeit« und »Verführung der Jugend« ermordete, der hatte den Beweis für seine Unvernunft und politische Unzurechnungsfähigkeit geliefert.
Gewiss, ein Ruhmesblatt des demokratischen Athen war die Verurteilung des Sokrates wahrhaftig nicht, auch nicht gerade ein Ausweis seiner sonst so selbstbewusst zur Schau getragenen Liberalität. Aber das Verfahren stand nicht unter dem Druck der Straße, es gab keinen aufgewühlten Mob, der die Geschworenen bedrängt und bedroht hätte, keinen Demos, der außer Rand und Band geraten wäre und sich blind vor Wut ein Opfer gesucht hätte. Es war nach den damals geltenden Kriterien ein formaljuristisch kaum zu beanstandender Prozess, an dessen Ende der Angeklagte seine Richter massiv provoziert hat, indem er auf die Frage, was er selbst glaube, verdient zu haben, die lebenslange Speisung im Prytaneion – eine der höchsten öffentlichen Ehren – vorschlug. In der Substanz der Anklage verdächtigte man Sokrates als systemgefährdenden Aufrührer, der mit seiner Kritik am Losverfahren die Axt an einen Grundpfeiler der demokratischen Ordnung lege. Damit wurde die Gefahr, die von Sokrates ausging, sicherlich maßlos überschätzt, doch muss man dabei berücksichtigen, dass das vorübergehende Terrorregiment der sogenannten Dreißig Tyrannen erst vier Jahre vorbei war. Vor diesem historischen Hintergrund mit der prägenden Erfahrung einer kurzzeitigen oligarchischen Schreckensherrschaft war es nicht völlig abwegig, Sokrates als Sicherheitsrisiko einzustufen und zu bestrafen.11
Platon arbeitet sein Sokrates-Trauma mithilfe seines Idealstaatsentwurfs in der Politeia ab. Die Demokratie hat aus seiner Sicht völlig abgewirtschaftet – und das ist systembedingt: Die Menge giert nach Freiheit, einer grenzenlosen, enthemmten Freiheit, die jede Form der Unterordnung aufzuheben trachtet. Die Jungen stellen sich den Alten gleich, der Lehrer fürchtet seine Schüler, der Vater seine Söhne, die im Lande lebenden Ausländer (Metöken) wollen den Bürgern gleichgestellt sein, am Ende fordern sogar Sklaven die Egalität ein. Das alles geschieht mit »schlechten Mundschenken als Beratern«, den Demagogen, die ihrem Volk ungemischten Freiheitswein servieren und es in den kollektiven Rausch treiben. Das Erwachen daraus aber wird furchtbar sein: Ein Übermaß an Freiheit wird in ein Übermaß an Knechtschaft umschlagen, das Ganze wird in einer Tyrannis enden, die jeder Freiheit den Garaus macht.12
Mit der athenischen Realität hat all das ebenso wenig zu tun wie mit den Umständen, die zum Tode des Sokrates geführt hatten. Aber das Zerrbild demokratischer Hemmungslosigkeit, das Schreckgespenst des Freiheitsrausches hat zu allen Zeiten als antidemokratische Vorlage gedient. Dem vermeintlichen Mord an Sokrates hat Platon den Rufmord an Athens Demokratie entgegengesetzt – wohl schon eine bewusste Rache, auf jeden Fall aber eine nachhaltige. Wer bei einem Klassiker des politischen Denkens geistige Munition gegen die Demokratie sucht, wird bei Platon fündig.
Welches positive Konzept hat Platon zu bieten? Es ist ein utopischer Entwurf. Das entscheidende Prinzip der Gerechtigkeit in einem Staatswesen lässt sich nicht mit einer Masse verwirklichen, die unfähig ist, politisch zu denken, sondern nur mit einer Herrschaft von Männern, die auf einem langen Erkenntnisweg zur Idee des Guten gefunden haben. Das aber sind die Philosophen. Und weil sie allein dem Guten und Gerechten verpflichtet sind, werden sie den Staat »notwendigerweise am besten und ohne inneren Zwist verwalten«.13 Philosophengezänk? Eifersüchteleien unter den Weisen? Kein Gedanke daran, jedenfalls nicht in Platons Idealstaat.
Die Philosophen also sollen es richten. Sie sollen die neuen Könige sein. Oder umgekehrt: Die Könige werden zu Philosophen. Es ist eine neue Form der Aristokratie, die Platon vor Augen hat: keine auf Geburt und Besitz, sondern eine auf Geist und Moralität gegründete »Herrschaft der Besten«. Das können übrigens, so viel Weitblick müssen wir Platon attestieren, auch Frauen sein. Wenn sie dieselbe gründliche Erziehung genießen, können auch sie als Philosophen-Königinnen an der Macht teilhaben.14
Das Modell funktioniert aber nur, wenn störende Einflüsse von außen und innen eliminiert werden. Dazu bedarf es einer strengen Überwachung des Kulturlebens. Homer und Hesiod müssen aus den Lehrplänen der Schulen gestrichen werden, denn sie sind voll von unsittlichen Erzählungen.15 Auch das Theaterspiel wird verboten, es wühlt die Menschen zu stark auf, und in einem Vernunftstaat ist dafür kein Platz. Außerdem ist jede literarische Fiktion streng genommen Lüge, und gelogen werden darf in einem gerechten Staat nicht. Mit einer Ausnahme: »Nur den Herrschern des Staates kommt es zu, die Lüge um der Feinde oder der Bürger willen zum Nutzen des Staates zu gebrauchen.«16
Es ist das Muster des wohlmeinenden totalitären Staates, das Platon hier entwirft – auch wenn sich vieles am real existierenden »Einheitsstaat« Sparta orientiert, ist es doch ein innovativer Entwurf, sicherlich ein leidenschaftlicher Gegenentwurf zur athenischen Demokratie, dessen Verdienst und Erfolgsgeheimnis in Sachen Rezeptionsgeschichte seine Radikalität und Konsequenz sind. Man muss keine Sympathie für Platons Staat hegen, der den freien Geist, wenn überhaupt, dann nur an der Spitze toleriert, man kann ketzerisch fragen, wie denn wohl dieser Staat mit einem Systemkritiker wie Sokrates umgegangen wäre, aber man kann seinem geistigen Gründer nicht absprechen, dass er sich auf seine Weise als Polit betätigt hat. Da lässt sich jemand vom demokratischen Zeitgeist nicht unterkriegen, sondern geht kühn in die Offensive. Hätte Platon sich nur brav auf die traditionelle politische Weise als athenischer Staatsbürger betätigt (was er kategorisch abgelehnt hat), der Menschheit wäre ein hochpolitischer, ein hochumstrittener, gerade in seinem utopischen Provokationspotential hochinteressanter Klassiker des politischen Denkens vorenthalten geblieben. Auch wenn uns vieles daran nicht passen mag: Wir rufen anders als Platons Herrscher nicht nach dem Zensor. Wohl aber verweisen wir auf die kraftvollste Abrechnung mit diesem »wirkungsmächtigen Klassiker des Totalitarismus«. Sie stammt aus der Feder Karl Poppers. Er schrieb sie unter dem schönen Titel Die offene Gesellschaft und ihre Feinde; Band I ist mit »Der Zauber Platons« überschrieben. Beide Werke – Platon und Anti-Platon – seien zur Lektüre empfohlen.
Aristoteles’ Plädoyer
Aristoteles hat in seiner Politik viele Berührungen mit seinem Lehrer Platon. Und doch atmet das Werk einen anderen Geist, den der Mitte und des Ausgleichs. Die Idealvorstellungen des Aristoteles sind näher an der Wirklichkeit. Das ist indes aus moderner Sicht nicht nur ein Vorteil. Die gesellschaftliche Realität seiner Zeit prägt auch die Realität des aristotelischen Staates: Sklaverei gehört ebenso dazu wie die Herrschaft des Mannes über die Frau und die Überlegenheit der Griechen gegenüber den Barbaren. Hier kommt Aristoteles nicht aus seiner historischen Haut heraus. Im Gegenteil, er zementiert den Status quo durch fragwürdige Beweise und wenig schlüssige Argumentationsketten.17 Eine seiner schwächsten Beweisführungen stützt die These von der Naturgemäßheit der Sklaverei – für spätere Verfechter der Institution natürlich ein gefundenes Fressen, konnten sie sich doch auf den großen Aristoteles berufen.18 Dass Aristoteles in diesen grundsätzlichen Fragen der gesellschaftlichen Hierarchie so wenig innovativ ist, mag auch auf seinen wissenschaftlichen Fleiß zurückgehen. Bevor er sich an die Niederschrift der Politik machte, hatte er 158 Verfassungen griechischer Poleis studiert.
Aristoteles unterscheidet wie Platon drei Grundformen der Herrschaft, die er mit drei Entartungsformen konfrontiert. Die gute Monarchie verkommt irgendwann zur Tyrannis, der schlechtesten Herrschaftsform überhaupt, und die gute Aristokratie hat die Neigung, zur Oligarchie zu entarten, eigentlich mehr zu einer Plutokratie, in der die Reichen sich die Taschen weiter vollstopfen. Die gute Demokratie heißt bei ihm Politie (politeía). In ihr hält eine bürgerliche Mitte den Staat in der Balance. Wenn aber die Armen zu stark an Einfluss gewinnen, dann wird die Politie zu einer Demokratie mit anarchischen Zügen: »So wird die Masse der Armen maßgebend im Staat, und nicht mehr das Gesetz.«19 Dessen Herrschaft aber ist die Voraussetzung für eine Bürgergemeinschaft, die diesen Namen verdient.20
Die Konsequenz aus diesem Befund liegt nahe: Am besten wäre eine siebte Form, in der die drei Elemente, das monarchische, das aristokratische und das demokratische, durch institutionelle Strukturen miteinander kombiniert sind; eine Mischverfassung, in der das schon angelegt ist, was man später ein System der checks and balances nennen wird. Diese aristotelische Theorie wird in hellenistischer und römischer Zeit weiterverfolgt werden. In De re publica preist Cicero sie als die stabilste Verfassung, die den Bestand des Staates am längsten zu garantieren verspricht.
Die Darstellungsweise des Aristoteles lässt sehr deutlich werden, wie intensiv sich die Griechen Gedanken über die beste Verfasstheit ihrer Poleis gemacht und welch lebendige Diskussion sie darüber geführt haben. Da werden zahlreiche Spielarten und Verständnisvarianten vor allem demokratischer Systeme nebeneinandergestellt, voneinander abgegrenzt und im Hinblick auf das Wesenhafte der Volksherrschaft erörtert. Dabei schälen sich für die Demokratie zwei Leitideen heraus: die der Freiheit und die der Gleichheit aller Bürger. Da der Staat indes gelenkt werden muss und man auf Hierarchien nicht gänzlich verzichten kann, empfiehlt sich das Rotationsprinzip: »Alle herrschen über jeden und jeder abwechslungsweise über alle.«21 Und: »Zur Freiheit gehört es, dass man abwechselnd regiert und regiert wird«,22 darin erweist sich »demokratische Gerechtigkeit«.
Aristoteles ist wie Platon kein Freund des Demos. Das erklärt sich auch aus seiner Definition des höchsten Staatszwecks. Das ist die eudaimonía, ein »Glück«, das sich in einem »möglichst guten Leben« für alle Politen erweist. Dieses Glück ist nicht vorrangig materiell definiert, es ist an die areté, das »sittlich gute Handeln«, gebunden – und das verträgt sich nicht mit dem Leben eines zur Erwerbsarbeit verurteilten »Banausen« oder »Krämers«.23 Von einer demokratischen Gleichheit kann demnach in der Konstruktion des besten Staates, wie Aristoteles sie im 7. und 8. Buch seiner Politik entwirft, keine Rede sein. Das hat das intellektuelle zóon politikón Aristoteles aber nicht daran gehindert, viele kluge Gedanken und Einsichten auch über die eher ungeliebte Demokratie zu formulieren. Seine Politik ist so gesehen auch ein Basistext Europas für das schwierige und kontroverse Ringen um die beste Verfassung.
Danke für die Politik!
Auch für den ganz anders dimensionierten modernen Territorialstaat mit zig Millionen Einwohnern? Was die Antike – über Platon und Aristoteles hinaus – an staatsphilosophisch grundlegendem Gedankengut bereithält, sind keine unmittelbar anwendbaren Rezepte oder direkt umzusetzenden Maßnahmenkataloge. Selbst zu ihrer Entstehungszeit waren diese Schriften schwerlich als konkretpraktische Vorschläge gedacht, so detailliert sie im Einzelnen auch formuliert sind. Sie waren Konzepte, Diskussionsbeiträge, Zusammenstellungen von Prinzipien und Grundgedanken, wie sich das als zóon politikón begriffene Wesen Mensch in einer möglichst allen gerecht werdenden Ordnung organisieren könne, und wie nicht. Darüber haben die Griechen wunderbar lebendig diskutiert und gestritten und dabei die Nachwelt mit geistigen Angeboten versorgt, die noch immer zu dem Besten gehören, was auf dem politologischen Markt so gehandelt wird – übrigens auch in einer sprachlich eleganten Form, die sich vom modernen Politologenjargon angenehm unterscheidet.
Dass sich die Partizipationsmöglichkeiten und vor allem -formen im modernen anonymen Staat fundamental von denen einer überschaubaren, persönlichen Polis-Welt unterscheiden müssen, ist evident. Was aber den politischen Geist angeht , das politische Engagement der modernen Politen für ihre Groß-Polis und ihr Bewusstsein, das auch diese Groß-Polis ihre Bürgergemeinschaft ist und sie der Staat sind, da können wir uns von den alten Griechen wohl einiges abschauen. Wir verdanken ihnen neben grundlegenden Termini wie »Monarchie«, »Aristokratie«, »Demokratie«, »Oligarchie«, »Plutokratie« und so weiter nicht nur den Zentralbegriff »politisch«, sondern auch ein historisches Vorbild, diesen mit Inhalt zu füllen und ihn damit im eigentlichen Sinne politisch ernst zu nehmen.
KAPITEL 2
Demokratie – Ein erfolgreiches Experiment der Weltgeschichte
Wie ein Gerechter sich selbst verbannt
Im Frühjahr 482 v. Chr. kam es auf der Agora, dem Marktplatz Athens, zu einer denkwürdigen Szene. Es war der Tag, an dem die Athener über die Verbannung eines führenden Politikers abstimmten. Etwa zwei Monate vorher hatte die Volksversammlung beschlossen, einen solchen Ostrakismós (nach óstrakon, »Scherbe«), ein sogenanntes Scherbengericht, zu veranstalten. Der südwestliche Teil der Agora war durch einen Holzzaun abgetrennt. Durch zehn Eingänge gelangten die Wähler zu den Stimmurnen, in die sie unter Aufsicht von Beamten und Ratsmitgliedern ihre Scherben warfen.
Solche Wahlscherben lagen bereit, man konnte aber auch eigene, schon beschriftete mitbringen. Jeder Bürger konnte jeden beliebigen Namen auf sein óstrakon schreiben, eine offizielle Vorschlagsliste gab es nicht. In dem Gedränge stand ein Kleinbauer etwas hilfesuchend mit der Scherbe in der Hand; er war Analphabet und musste nun jemanden finden, der seine Wahlscherbe beschriftete. Zufällig geriet er an Aristides, einen der führenden Politiker seiner Zeit – und als solcher ein durchaus heißer Kandidat für eine Verbannung.
Und worum bittet unser Bauer Aristides, den er selbstverständlich persönlich gar nicht kennt? Er möge doch in seinem Auftrag »Aristides« auf die Scherbe schreiben. Was er denn gegen den habe? Warum er ihn verbannt wissen wolle, erkundigt sich Aristides vorsichtig. Worauf der Bauer ohne Umschweife einräumt, er habe seinen Verbannungskandidaten noch nie zu Gesicht bekommen. »Aber ich ärgere mich, wenn ich immer von ›dem Gerechten‹ höre.« Diesen Beinamen hatte sich Aristides in der Tat wegen seiner außerordentlichen Integrität verdient. Und er handelt, wie nur Gerechte zu handeln pflegen: Ohne weiter nachzufragen, schreibt er seinen eigenen Namen auf die Scherbe, reicht sie seinem Mitbürger – und kassiert eine Verbannungsstimme.
Am Abend steht fest: Aristides ist gewählt. Binnen weniger Tage muss er Athen verlassen. Sein Exil ist nicht weit. Er wird die nächsten Jahre auf Ägina verbringen, einer Insel im Saronischen Golf, gewissermaßen vor der Haustür seiner Heimatstadt. Politischen Einfluss aber wird er aus dem nahe gelegenen Verbannungsort kaum ausüben können. Grund genug für ihn, beim Verlassen der Stadt die Hände zum Himmel zu strecken und die Götter um einen letzten politischen Gefallen zu bitten. Sie möchten verhindern, dass jemals eine Situation eintrete, in der sich das Volk seiner erinnere. Stilvoller kann ein »Gerechter« seinen erzwungenen Abschied nicht zelebrieren.1
Die Anekdote ist sicher unhistorisch. Aristoteles, der rund eineinhalb Jahrhunderte nach der Ostrakisierung des Aristides lebte, kennt sie noch nicht. Das »Strickmuster« ist recht schlicht. Es ging darum zu illustrieren, wie treffend der Beiname des »Gerechten« war. Welcher normale Politiker hätte sich dem für ihn abträglichen Willen eines anderen Bürgers so selbstlos gebeugt?
Ein Angriff auf das Selbstwertgefühl des Bürgertums
Aber das ist nicht die einzige Botschaft der erfundenen Geschichte, die auch und gerade in der Neuzeit zum ehernen Anekdotenschatz des Altertums zählte. Der Subtext ist eine Kritik an der demokratischen Verfassung Athens. Wie konnte man einfachen Bürgern, die nicht einmal lesen und schreiben konnten, nur so weitgehende Partizipationsrechte einräumen?
Dass sich eine solche Praxis mit Platons Philosophenkönigtum nicht verträgt, ist offensichtlich. Aber auch die bürgerliche Honoratiorenschicht, die zu Plutarchs Zeit im 2. Jahrhundert n. Chr. die Geschicke ihrer Heimatstädte lenkte, musste sich in ihrem Selbstverständnis und Selbstbewusstsein herausgefordert sehen, wenn man mit bildungsfernen Leuten wie dem schreibunkundigen Kleinbauern im wahrsten Sinne des Wortes Staat machen wollte. Und diese Skepsis war auch dem europäischen Bürgertum des 19. und frühen 20. Jahrhunderts nicht fremd: Demokratie ja, aber doch bitte ohne die Radikalität des klassischen Athens und unter Beachtung bürgerlicher Mindeststandards! Dass die ungebildete, zu heftigen Emotionen und unberechenbaren Spontanaktionen neigende Masse so weitgehende Mitspracherechte genoss, das schien doch sehr bedenklich. Diese Einschätzung der Masse war nicht frei von ideologischen Klischees und wurde von wenig demokratiefreundlichen Publizisten seit dem Altertum kräftig genährt.
Als besonders überzeugender Beleg für die vermeintlichen politischen Risiken, die sich mit dem allgemeinen Wahlrecht auch für Analphabeten verbinden, taugt die Aristides-Anekdote nicht nur deshalb wenig, weil weder politische Urteilsfähigkeit noch die Vertretung eigener Interessen zwangsläufig an die Fähigkeit des Lesens und Schreibens geknüpft sind. Und außerdem soll es ja durchaus vorgekommen sein, dass Hochintelligente sich dem Faszinationssog wenig rationaler extremistischer Ideologien nicht haben entziehen können. Was die athenische Demokratie angeht, fällt vielleicht noch mehr die Tatsache ins Gewicht, dass eine deutliche Mehrheit der Wahlberechtigten durchaus in der Lage war zu lesen und zu schreiben – viele sicher nur mit Mühe und wenig Begeisterung, aber ausreichend für den alltäglichen Gebrauch. Im Lichte dieser jüngsten Forschungsergebnisse gehörte der Bauer des Aristides also einer Minderheit an – kein guter Grund, um ausgerechnet ihn in den historischen Zeugenstand zu rufen.
Im Übrigen war der Ostrakismos keineswegs eine Erfindung dessen, was manche die »radikale« Phase der attischen Demokratie nennen. Sie begann erst mit den Reformen des Ephialtes im Jahre 462/61 v. Chr. Das Scherbengericht indes war damals schon mindestens zwei Generationen alt. Seine Einführung wird Kleisthenes zugeschrieben, jenem Reformer, der die Demokratie Athens nach dem Sturz der Tyrannen im Jahre 508/07 v. Chr. gewissermaßen auf den Weg gebracht hat. So jedenfalls steht es in der zuverlässigsten Quelle, der unter dem Namen des Philosophen Aristoteles überlieferten Darstellung der Verfassungsgeschichte Athens. Auch wenn Aristoteles diese Athenaion politeia nicht selbst verfasst haben sollte, stammt sie doch aus seinem geistigen Umfeld und dürfte seine Positionen weitgehend widerspiegeln. Seine Position zum Ostrakismos ist eindeutig: Mit dem Gesetz über das Scherbengericht habe Kleisthenes »auf die Gunst der Menge gezielt«.2
Verband sich mit dem Scherbengericht die Absicht, prominente Anhänger der gestürzten Tyrannenfamilie gewissermaßen prophylaktisch ins politische Abseits befördern zu können? Oder gar gefährliche Gegenspieler des Kleisthenes selbst? Aristoteles gibt keine Antwort auf diese Fragen. Zum ersten Mal eingesetzt wurde das potentiell scharfe Verbannungsschwert allerdings erst zwei Jahrzehnte später. Das ist auffällig und hat manche Historiker vermuten lassen, der Ostrakismos sei noch nicht Bestandteil der kleisthenischen Neuordnung gewesen.
In den achtziger Jahren des 5. Jahrhundert v. Chr. wurde er dann allerdings recht häufig angewandt. Kein Wunder, ging es doch damals um eminent wichtige Weichenstellungen der athenischen Politik. Wie sollte man auf die anhaltende persische Gefahr reagieren, nachdem die erste Invasion des Großkönigs im Jahre 490 v. Chr. erfolgreich zurückgeschlagen worden war? Wie sollte Athen mit seinem in diesem ersten Perserkrieg enorm gestärkten Renommee gegenüber Sparta, der bisherigen Vormacht in Hellas, umgehen? Wie auf die nach wie vor latente Bedrohung durch den Tyrannenclan und seine Gefolgsleute antworten, die ihre Usurpationspläne weiterverfolgten?
Ohne dass eine klare programmatische Linie in den Ostrakisierungen der achtziger Jahre erkennbar wäre, hatte man offenbar doch das Bedürfnis, das Scherbengericht als politisches Ausrufezeichen zu nutzen, indem man durch eine Personalentscheidung einen bestimmten politischen Kurs bestätigte und sich von einem anderen distanzierte. Die Abstimmung verlangte von den Bürgern, Farbe zu bekennen. Sie war ein hochpolitischer Akt mit ungewöhnlich großem individuellem Spielraum: Es gab keine Vorgabe für das, was der Einzelne auf sein óstrakon schrieb, keinen Wahlkampf und keine Parteien, die einem den richtigen Namen suggerierten. Die politische Meinungsbildung vollzog sich weniger organisiert und kanalisiert als heutzutage. Gewiss kam es zu Einflussnahmen bis hin zu von interessierter Seite schon ausgefüllt bereitgestellten óstraka und Aufrufen, den X oder Y zu ostrakisieren. Aber die Vielzahl der Namen auf den rund 11 000 ausgegrabenen óstraka zeigt doch, wie eigenständig die Bürger bei vielen Entscheidungen votiert haben. Da finden sich neben den aus der historischen Überlieferung bekannten großen Namen auch manche Nobodys, die wir nur von den Wahlscherben kennen.
In einigen der insgesamt rund zwanzig Ostrakisierungsverfahren aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. ging es sicher um grundlegende Richtungsentscheidungen in einem stark personalisierten Machtkampf. Die Ostrakisierung eines prominenten Politikers war insofern auch ein Barometer der politischen Stimmung in zentralen Sachfragen. Da wurde der eine oder andere auch für ein bestimmtes Programm – oder auch, wenn er sich durch ein bestimmtes Auftreten Sympathien verscherzt hatte – persönlich abgestraft. Über vieles wurde in der athenischen Volksversammlung leidenschaftlich diskutiert, darüber nicht: Das Scherbengericht kannte keine Anklage-oder Verteidigungsreden, es wurde ohne Aussprache durchgeführt.
Der Ostrakismos war ein originelles basisdemokratisches Element, das wie andere Mechanismen der athenischen Demokratie ein deutliches Gegengewicht zur Herausbildung einer Funktionärselite bildete. Dem Volk als Souverän stand auch gegenüber den etablierten Spitzenpolitikern einmal im Jahr ein effizientes Instrument zur Verfügung, das politische Karrieren abrupt beenden – oder zumindest für zehn Jahre unterbrechen – konnte.
Zehn Jahre Exil, darauf musste sich der Verbannte in der Regel einstellen. Eine Revision des Beschlusses auch im Rahmen allgemeiner Amnestien war möglich; Aristides etwa war Nutznießer einer solchen Entscheidung. Doch war das die Ausnahme. Wie sehr es bei der Verbannung um eine politische Entscheidung und nicht um eine Bestrafung ging, zeigen die Begleitumstände: Der Verbannte behielt sein ganzes Vermögen und seine bürgerlichen Rechte. Nach Ablauf seiner erzwungenen politischen Auszeit war es ihm unbenommen, sich wieder in der athenischen Politik zu engagieren und führende Staatsämter zu bekleiden. Ohne Zweifel, der Denkzettel – oder besser: die Denkscherbe – des Wählers tat weh, er war für die Betroffenen ein harter persönlicher Schlag und veränderte ihre Lebensplanung auf dramatische Weise. Aber er vernichtete nicht, weder physisch noch materiell noch moralisch. Er war eine Spielregel demokratischer Entscheidung, die das Mehrheitsprinzip stärker gewichtete als den Minderheitenschutz.
Die Ostrakisierung war indes an formale Spielregeln gebunden, die den Ausnahmecharakter des Verfahrens betonten und einer inflationären Verwendung einen Riegel vorschoben. Das Scherbengericht fand nur einmal im Jahr statt, es war im politischen Terminkalender der Volksversammlung fest verankert und wurde auch nur dann durchgeführt, wenn die Athener zu Jahresbeginn einen einschlägigen Beschluss gefasst hatten. Auch das Quorum der abgegebenen Stimmen stellte eine nicht unwesentliche Hürde dar. Gaben weniger als sechstausend Bürger ihre Scherbe ab, so endete das Verfahren ohne Ergebnis. Selbst wenn jemand mehr als fünftausend Stimmen erreicht hätte, wäre das ohne Konsequenzen für ihn geblieben. Anders im positiven Fall: Waren mehr als sechstausend Stimmen abgegeben worden, so galt derjenige als verbannt, auf den die relativ meisten Stimmen entfallen waren. Er hatte binnen zehn Tagen das Land zu verlassen.
»Gleicher Anteil am Recht!«
Ein wesentliches demokratisches Prinzip, auf dem das Scherbengericht beruhte, heißt in moderner Diktion one man, one vote. Es gibt bei der Abstimmung keinen Unterschied zwischen denen, die über das Wahlrecht verfügen; jede Stimme zählt gleich viel. Ebendieses Prinzip stand am Anfang der demokratischen Entwicklung Athens. Es hieß noch nicht demokratía, »Herrschaft des Volkes« (démos, »Volk«; krátos, »Macht«), sondern isonomía. Das war das gewissermaßen konzeptionelle Zauberwort, das bei den Reformen des Kleisthenes Pate stand. Übersetzt bedeutet es »gleicher Anteil« (ísos, »gleich«; nómos, »das Zugeteilte«, daraus auch »Gewohnheit«, »Gesetz«). Man könnte auch formulieren: »gleiche Teilhabe an der Politik«, und zwar unabhängig von der Abstammung und der gesellschaftlichen Stellung, von Einkünften, Besitz oder Bildungsstand. Diese Kriterien wurden nicht aufgegeben, aber sie wurden mehr und mehr aus dem politischen Raum verdrängt. Sie verloren ihren Einfluss auf den Grad der Mitsprache in politischen Entscheidungsprozessen.
Das ist das Neue und, wenn man so will, geradezu Revolutionäre und weltgeschichtlich Epochemachende an dieser Erfindung der Griechen: dass zum ersten Mal nicht Herkunft und Vermögen über den Grad an politischer Teilhabe entschieden, sondern die Tatsache, dass jemand Mitglied des Bürgerverbandes war und ihm in dieser Eigenschaft ein »gleicher Anteil« an der politischen Willensbildung und Entscheidung zustand. Dabei war der Anteil als Angebot und Chance definiert; wer nicht wollte, wurde nicht dazu gezwungen. Ein großes Vermächtnis der athenischen Demokratie ist es, dass sie dieses neue Konzept der Chancengleichheit auch durch praktische Angebote unterstützte und damit deutlich machte, dass das ideelle Konstrukt auch die Feuerprobe der politischen Realität bestand.
Dahin war es ein weiter Weg. Die Ausgestaltung der demokratischen Staatsform erstreckte sich über Jahrzehnte. Die Väter der
Erste Auflage
Copyright © 2012 by Siedler Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Rothfos + Gabler, Hamburg Satz: Ditta Ahmadi, Berlin
eISBN 978-3-641-08182-9
www.siedler-verlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe





























