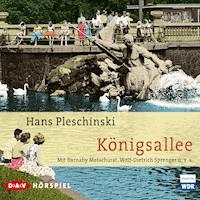9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
An einem Märzabend macht sich die Münchner Stadträtin Antonia Silberstein auf den Weg zu einer Ortsbesichtigung der besonderen Art. In ihrer Begleitung: die Schriftstellerin Ortrud Vandervelt und die Bibliothekarin Therese Flößer. Das Ziel des launigen Spaziergangs der drei Frauen: die hinter einer Mauer versteckt liegende einstige Villa eines großen Vergessenen. Antonia Silberstein hat verwegene Pläne für diese Villa, aber sie braucht den guten Rat eines Experten. Schon auf dem Spaziergang sind sich die Frauen, zwischen Autos, Passanten, Verkehrsinseln mäandernd, uneins über Rang, Werk und Vermächtnis des Mannes, dessen einstige Behausung sie in ein spektakuläres Kulturzentrum verwandeln könnten: Paul Heyse. Der erste echte deutsche Literaturnobelpreisträger (1830– 1914), hochgeehrt, liberal, ein schöner Mann mit einer liebenswerten Ausstrahlung, Autor von Romanen, Theaterstücken und nicht zuletzt 180 Novellen, ist so vergessen, dass in München vor allem eine Unterführung an ihn erinnert. Hat er das verdient?
In seinem neuen Roman erzählt Hans Pleschinski kenntnisreich, scharfzüngig und komisch von Heyses Leben und Werk, von Ruhm und Vergänglichkeit und dem stets bedrohten Reichtum der Kultur in einer sich verschleißenden Welt. Mit einem genauen Blick auf die Gegenwart entfachter in spritzigen Dialogen ein höchst unterhaltsames Feuerwerk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Hans Pleschinski
Am Götterbaum
Roman
C.H.Beck
Zum Buch
An einem Abend im April 2019 macht sich die Münchner Stadträtin Antonia Silberstein auf den Weg zu einer Ortsbesichtigung der besonderen Art. In ihrer Begleitung: die Schriftstellerin Ortrud Vandervelt und die Bibliothekarin Therese Flößer. Das Ziel des launigen Spaziergangs der drei Frauen: die hinter einer Mauer versteckt liegende, einstige Villa eines großen Vergessenen. Antonia Silberstein hat verwegene Pläne für diese Villa, aber sie braucht den guten Rat eines Experten.
Schon auf dem Spaziergang sind sich die Frauen, zwischen Autos, Passanten, Verkehrsinseln mäandernd, uneins über Rang, Werk und Vermächtnis des Mannes, dessen einstige Behausung sie in ein spektakuläres Kulturzentrum verwandeln könnten: Paul Heyse. Der erste echte deutsche Literaturnobelpreisträger (1830–1914), hochgeehrt, liberal, ein schöner Mann mit einer liebenswerten Ausstrahlung, Autor von Romanen, Theaterstücken und nicht zuletzt 180 Novellen, ist so vergessen, dass in München vor allem eine Unterführung an ihn erinnert. Hat er das verdient? In seinem neuen Roman erzählt Hans Pleschinski kenntnisreich, scharfzüngig und komisch von Heyses Leben und Werk, von Ruhm und Vergänglichkeit und dem stets bedrohten Reichtum der Kultur in einer sich verschleißenden Welt. Mit einem genauen Blick auf die Gegenwart entfacht er in spritzigen Dialogen ein höchst unterhaltsames Feuerwerk.
Über den Autor
Hans Pleschinski, geboren 1956, lebt als freier Autor in München. Er veröffentlichte bei C.H.Beck u.a. die Romane «Leichtes Licht» (2005), «Ludwigshöhe» (2008), «Königsallee» (2013) und «Wiesenstein» (2018), die Bestseller wurden, und gab die Briefe der Madame de Pompadour heraus, eine Auswahl aus dem Tagebuch des Herzogs von Croÿ und die Lebenserinnerungen der Else Sohn-Rethel. Zuletzt erhielt er u.a. den Hannelore-Greve-Literaturpreis (2006), den Nicolas-Born-Preis (2008) und wurde 2012 zum Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres der Republik Frankreich ernannt. 2014 erhielt er den Literaturpreis der Stadt München und den Niederrheinischen Literaturpreis. 2020 wurde ihm der Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung zuerkannt. Hans Pleschinski ist Mitglied der Bayerischen Akademie der Künste.
Inhalt
Im Tor
Aufbruch
Ins Abseits
Voran
Im Flammenschein
Rote Laterne
Das Hermelin
Königsplatz
Zulauf
An der Mauer
Stuckaturen
In der Häuserschlucht
Träume
Auf der Piste
Das Gewitter
VON&ZU
Invasion
Die Villa
Dank
Bildnachweis
Im Tor
Der Wind frischte auf.
Pappbecher rollten über das Pflaster.
Das Gold der Mariensäule leuchtete im Abendschein.
Aus den Passantenscharen blitzten Lichter der Smartphones.
Chinesische und japanische Touristen konnte ein Einheimischer kaum unterscheiden. Gewiss waren auch Koreaner darunter. Selfiestangen drohten sich zu verhaken. Das neugotische Rathaus hielten offenbar viele Angereiste für mittelalterlich und knipsten den Trugbau von früh bis in die Nacht. Was erzählten sie in Shanghai oder in Sapporo zu ihren Schnappschüssen? Nein, das ist nicht Versailles, das war, glaube ich, in Kopenhagen. Aber welche Freunde und Verwandten in Fernost wollten sich überhaupt Dutzende, Hunderte von abgelichteten Bauten Europas anschauen? Vielleicht nur die Großmutter, bis sie auf der Reismatte einschliefe.
Von vornherein Bildmüll.
Zeitalter des Mülls.
Überall, bis in die Bergwerksschächte und in die Tiefsee.
Späte Tage der Menschheit.
Verwüstung des Planeten, steigende Temperaturen, längst Wassermangel im übervölkerten Nildelta, Ressourcen verbraucht, vor der Versteppung und Entvölkerung wüchse in der Holledau Büffelgras; was bereits kräftiger wucherte, war Fanatismus jedweder Art; vielleicht fühlte sich mancher nur noch so lebendig: Ich hasse, also bin ich, ich hasse den Nachbarn, die anderen, den Kompromiss, die Demokratie, das Unklare, Europa, in dem es mir nie gut genug gehen kann, einfach dreinschlagen – dann hört man etwas –, Liebe und Zuversicht hatten wir, jetzt haben wir Grimm und Hass.
Wirkliche Unvorstellbarkeit, die Menschheit zerstörte sich selbst und ihr Zuhause.
Es lag am Föhn.
Bei den alpinen Fallwinden, die schlagartig eine perverse Wärme ins Voralpenland und in den Winter drückten, Märzstaub aufwirbelten, den möglicherweise tödlichen Feinstaub. Abgase, Reifenabrieb, das karzinogene Vanadium. Von Amts wegen kannte sie sich mit Schadstoffen und den städtischen Maßnahmen dagegen aus. Hoffentlich drohten nicht weitere Heimsuchungen.
Bei diesen Warmwindattacken wachte man morgens zerrüttet auf, wie in einem Waffeleisen, sah schwarz, kämpfte sich den Tag lang durch Zerfall, schluckte lustlos Pasta, sah Extremisten vereint mit Fundamentalisten, hinter ihnen die diversen Nationalisten, die Dauerwütenden mittendrin, in Straßburg das Europa-Parlament stürmen und das Gestühl zertrümmern.
Dann wäre alles kaputt.
Am Föhn lag es, wenn sie mit Kopfweh an so etwas dachte.
Antonia Silberstein strich sich das Haar aus der Stirn. Hamburgerinnen hatten mit dem dortigen Wetter vielleicht noch mehr Pech. In der böenreichen Feuchte im Norden klebte bald jede Frisur am Kopf. Eine Goldgrube für die Hairstylisten an der Alster, Binnen und Außen.
Chinesen trugen meist schlechtere Kleidung als Japaner und Koreaner und benahmen sich ruppiger. Vielleicht freundeten sich heute Abend an einem Wirtshaustisch Amerikaner und Neuseeländer miteinander an.
Eigentlich war ja rundum alles in Ordnung.
Volle Taschen, junge Leute. Büroangestellte erledigten nach Feierabend ihre Einkäufe. Die Schaufenster der Parfümerien und Telefonshops leuchteten. Zischlaute in der Nähe, wie Messerspitzen in der Luft; Spanier tauschten sich aus, wiesen auf das Glockenspiel am Rathausturm und knipsten es.
Ein paar Radfahrer, sogar ein rasender, kreuzten die Fußgängerzone. Polizei war ehedem sichtbarer oder furchtloser gewesen. Dagegen schickten sich die Bronzeputten der Mariensäule seit einer Pest energisch an, die empörten Drachen zu ihren Füßen mit dem Schwert zu durchbohren. Bei den Himmelsboten hatten Päpste gekniet, zumindest einer, und zur Mater Bavariae gebetet. Beim bis dato letzten Besuch des römischen Oberhirten hatten TV-Kameraleute fast verzweifelt nach dichten Haufen von jubelnden Gläubigen gespäht. Der Zuspruch für die alleinseligmachende Kirche ließ immer deutlicher nach.
Dabei war es wichtig, dass sie an Liebe deinen Nächsten wie dich selbst erinnerte, denn er ist dir gleich.
Doch Gott und Götter waren tot, hieß es, es existierte kein magischer Raum mehr.
Antonia Silberstein trat vom windigen Platz ein paar Schritte zurück ins Eingangsgewölbe. Steinernes Rankenwerk, hinter einer schmiedeeisernen Gitterpforte der pompöse Aufgang zum Ratssaal. Der Prunk des Bürgertums von vor gut einhundert Jahren. Welche Selbstgewissheit der Ahnen und was für immense Summen sie in die Darbietung ihrer Fähigkeiten, ihrer Macht, ihres Seins investiert hatten. Und dennoch waren an der Schauseite dieses Rathauses keine Bürgermeister, sondern so viele Fürsten wie sonst nirgendwo im Lande verewigt. Damit war klar, wer das letzte Wort gehabt hatte. – Alles, der Pomp, die Statuen aus der Zeit vor den Kriegen, die Blutbäder, Hunger, Tod, Chaos und Neufindung gebracht hatten. Einige Inschriften im Gemäuer hatte Silberstein und hatten gewiss auch Kollegen aus den anderen Fraktionen noch nie eingehend wahrgenommen. Für deutsches Volksthum, deutsche Einheit, Ehre und Freiheit. Zur Erinnerung an das 13. deutsche Turnerfest im Jahre 1923. Auf der gegenüberliegenden Gewölbewand: Den Mitgliedern der US-Streitkräfte, die München am 30. April 1945 von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft befreiten. Dafür ließ sich gar nicht genug danken, doch ungewöhnlich, dass Soldaten als Mitglieder bezeichnet wurden. Waren Mitglieder gefallen? Vielleicht zählte Zivilpersonal dazu. Egal, man wusste, was gemeint war. Und wieder linker Hand schwarz und in grauen Stein gemeißelt: Spiele der XX. Olympiade München 26. August bis 11. September 1972. Das große, bunte Weltfest. Dann das Attentat. Der stille Ausklang. – Seit dem Sportereignis gab es die U-Bahn und in Schweden eine Königin, die Gästebetreuerin gewesen war. IX. EuroGames München 2004. Gelockertere Zeiten, die Gegner dieser Inschrift an prominenter Stelle im Rathauseingang waren deutlich überstimmt worden. Das vielleicht beschwingteste Fest seit Menschengedenken, dreißigtausend Schwule und Lesben waren zu Volleyball, Ringen und Staffellauf angereist, Kaufhäuser durften erstmals nachts geöffnet haben, die Gäste galten als shoppingfreudig. – Nun, München spielte immer mit auf der Welt, wenn auch nicht stets in vorderster oder auch nur zweiter Reihe – Mailand, Budapest, Barcelona boten sich opulenter dar –, aber es war unverwechselbar vorhanden, auch mit allerlei Überraschungen und Besonderheiten. Das traditionelle Waschen von Geldbörsen am Aschermittwoch im Fischbrunnen, Madame de Pompadour und Dürers Apostel in der Pinakothek, ozapft is, auf einem Hügel ein Tempel im größten Stadtpark weltweit, Surfer auf Innenstadtbächen, Fußball, Autos und marmorne Promenadesäle in der Oper.
Die Stadträtin schaute auf ihre Uhr.
Wie immer zu früh.
Bereits als Schülerin hatte sie oft als Erste und allein im Klassenzimmer gesessen. Nicht aus Lerneifer, sondern aus Angst, zu spät zu kommen. Wie dumm. Urlaubsflüge hätte sie am liebsten einen Tag zuvor angetreten, um ganz sicher das Hotel auf Zakinthos zu erreichen. Ein bisschen verspannt das alles. Und beim Verlieben hatte sie gemeint, man müsse sich sofort küssen, ein Zögern würde Desinteresse signalisieren. Wahrscheinlich ein frühes Leistungssyndrom. Das steigerte sich mit dem Alter oder verlagerte sich. Zum Beispiel in die Schultermuskulatur.
«Du Arsch.»
Die Stadträtin schrak zusammen, erbleichte, was hatte sie verbrochen?
«Tomaten sind noch in der Schüssel!» Die junge Frau, die jetzt unters Gewölbe trat, sprach nicht sie an. «Scheiße, ich hab die Anchovis vergessen.»
«Typisch, Scheiße», antwortete leicht verzerrt eine Männerstimme aus dem Phone.
«Dann besorg du sie, fauler Sack.»
«Selber Sack», sagte er.
«Bin um sieben zurück. Hoffe, du hast dann alles.»
Natürlich kein Ohrschmuck, sondern ein weißer Stöpsel. Die vielleicht Dreißigjährige mit flauschigem Schal ging mit ihrem Open-air-Telefonset wieder fort. – Ein ungezwungenes Benehmen. Der neue Tonfall auch des jungen Mittelstands? Emanzipation gärte und spielte sich in vielen Bereichen und Variationen ab. Mindestens im Vulgären, das den Männern vorgeworfen wurde, hatte die Passantin mit ihrem Gefährten gleichgezogen. Menschliche Impulse änderten sich kaum. Bei viel verlangter und gebotener Korrektheit mochte es plötzlich umso rabiater zugehen. Gefährlich … Möglicherweise war die Telefoniererin in ihrem Umfeld sogar von Anfang an brutaler gewesen als er, sogar heimtückisch. Wer benutzte dieses Wort noch und kannte die Zuspitzung von bösartig, und wie viel Leid die Heimtücke hervorbrachte, durch Geltungssucht, das Wegbeißen von Konkurrenten? Widerwärtigst, gleich wann, gleich wo, gleich, durch wen.
Les jeux sont faits.
Warum fiel ihr jetzt ein Ruf vom Roulette ein? Französisch verstand, durch die Machtverschiebungen in der Geschichte, auch kaum jemand mehr.
Gelegentlich fauchte der Wind in der Zufahrt heftiger als draußen.
Eine Papierschlange, ein Faschingsüberbleibsel schlängelte sich wie lebendig herein, hielt inne, rollte tänzelnd weiter. Ein aparter Slowfox. Die einsame Schlange wollte wohl noch nicht aufgeben.
Die dreiundsechzigjährige Kommunalpolitikerin schlug den Kragen hoch. Den dunklen Mantel trug sie seit fast zehn Jahren. War es nur Unlust, dass sie sich so wenig Neues kaufte, oder schlich sich bei ihr schon der Altersgeiz ein? Immer öfter spürte sie in sich diese Regung: Das brauche ich nicht, oder sogar: Das brauche ich nicht mehr. Damit begann man, die eigene Lebensflamme zu löschen. Würde sie sich in ein paar Jahren abends nur noch einen Apfel schälen und ein paar Schritte ums Haus machen? Jedoch weiterhin sparen. Ihre Nichte würde sich über das Erbe freuen.
Es brauchte nach der Verrentung einen Neubeginn. Den durfte sie nicht verpassen, den musste sie selbst einleiten. Sonst begänne das Schrumpfen. Reisen! Ja. Alle reisten. Sie könnte nach Dalmatien fahren, offenbar herrliche Küstenorte, durch Kastilien und Aragon, nach Turku, einfach so. Und hier in der Stadt Konzertabonnements, einmal im Monat ins Lenbachhaus, um sich immer nur in ein Bild zu vertiefen, genau dafür hatten Gabriele Münter und Kandinsky doch gemalt. Kino. Oder ein erfreuliches Ehrenamt. Ja, weiter gebraucht werden, zumindest ein wenig.
Aber würde sie gesundheitlich noch lange durchhalten? Im Grunde fehlte ihr wohl nichts Ernstliches. Zwei Implantate saßen erfreulich fest, ein Unterschied zu den eigenen Zähnen war nicht zu bemerken. Beim Blick vom Monitor ins Büro hinein verschwamm manchmal zunächst alles. Star wurde ambulant operiert. Star auf beiden Augen? Doch dieses Zittern. Versiert in Symptomen legte sie ihre Hand flach auf den Schreibtisch und harrte, ob sich der Tremor zeigte oder nicht. Auf ihren geheimen, mehrmals täglich praktizierten Parkinsontest hatte sie sich mittlerweile derartig versteift, dass der mögliche Zuckwahn irgendwann das krankhafte Beben tatsächlich auslösen könnte. Manchmal, wenn es niemand sah, schlug sie sich sogar auf die Hand und befahl sich: Lass das, sie zittert nicht.
Man durfte sich über nichts lustig machen. Alles hatte einen tragischen Ursprung und endete bitterlich. Wenn auch vornehmlich in Deutschland. Nur in den slawischen Ländern – und im bekanntermaßen freitodgesättigten Ungarn – sah es man es aus nachvollziehbaren oder unklaren Gründen noch finsterer.
Als geübte Hypochonderin würde sie ein Wrack werden, ein geiziges, im braunen Mantel, bevor sie unwiderruflich organisch eines würde. Dabei lebten Hypochonder, eben wegen ihrer Umsicht, oft länger als weniger alarmierte, lustige Menschen, bis sie allerdings auch stürben. Endlich, dann hätte alles eine Ruh. Um Gottes willen, nur das nicht vor einem vielleicht erfreulichen Ereignis, das man verpassen würde. Und der Ruhe ginge das Ableben voraus.
«Basta», sagte Antonia Silberstein, «in Gottes Hand.» Sie hätte gut und gerne noch eine halbe Stunde im Baureferat arbeiten können, anstatt hier verfrüht zu harren. Zwei Anträge für die Sanierung von Turnhallen lagen noch auf dem Tisch. Vergeudete Zeit am Gewölbeportal, aber es gab keine vergeudete Zeit, jeder Moment besaß seine Fülle.
«Is this the Ratskeller?»
«No, next door … entrance to the left. Down into the basement, there you will find it.»
Das angelsächsische Paar dankte und entschwand. Der Mann trug noch eine traditionelle Kamera, womöglich also ein teures Gerät, an orangefarbenem Gurt um den Hals. Geradezu ein Ereignis, einmal nicht nach dem Weg zum Hofbräuhaus gefragt worden zu sein.
Wann kämen endlich die anderen?
Antonia Silberstein spähte über den Platz. Dort formierte sich eine Gruppe mit Transparenten im Halbkreis. Ältere Damen und junge Frauen, Hüte, Windjacken und bunte Strumpfhosen. Dazu einige orientalisch wirkende Herrn mit und ohne Bart, deren Begleiterinnen, Frauen, Töchter, Schwestern mit Hijab, teils schwarz, teils in schönen Farben. Ein Polizeiwagen hielt in der Nähe und blieb wie eingeschlafen stehen. Auf roter Stoffbahn flatterte das Anliegen der Demonstranten im Föhn: Mehr Wohnraum für Flüchtinge! – Seid barmherzig. – Stell Dir vor, Du bist auf der Flucht und keiner lässt Dich rein! – Das erdrückende Thema. Die Barmherzigkeit ging großteils zur Neige oder war schon ins Gegenteil umgeschlagen, in Wut auf den Zustrom. Manche Beobachter des kleinen Aufmarsches mochten sich daran erinnern, wie vor Jahren zahllose Münchner zum Bahnhof geströmt waren, um tagelang die Kriegsflüchtlinge aus Syrien, aus dem Irak und andere, die Rettung suchten, mit Kuchen, Kleidung und Spielzeug für die Kinder zu empfangen. Eine euphorische Hilfsbereitschaft. Eine innere massenhafte Aufwallung, endlich spürbar Sinnvolles zu tun, Menschen in Not beizustehen. In Zügen, in Bussen aus dem Süden trafen sie Tag und Nacht ein, die Grenzen blieben offen, es wurde nicht kontrolliert. Ein nie dagewesener Vorgang in einem Staat. Und das im strikten Deutschland. Gewiss, manche Jacke, mancher Pullover aus Schwabing waren herzlich an die Fremden verschenkt worden, um zwischendurch auch radikal den eigenen Kleiderschrank auszumisten. Wochen in einem schwindelerregenden Ausnahmezustand. Das Baureferat organisierte Containersiedlungen, Hallen wurden requiriert und in Unterkünfte mit Schlafabteilungen und Essensausgaben umfunktioniert. Berufstätige und pensionierte Lehrer meldeten sich zum Sprachunterricht für die Gestrandeten, die Überlebenden ferner, gar nicht so ferner Höllen. Sportvereine boten für Menschen, die wochenlange Fußmärsche, Durst, Hunger, Kälte, lebensgefährliche Seeüberquerungen hinter sich hatten, bald leichtes Jogging, Fußballtraining und sogar Yoga an. Gemeinschaftliche Übungen, Spiel und das behutsame Mitmachen bei einheimischen Verbindungen waren die besten Mittel, um Kriegstraumata zu dämpfen und das Einleben zu erleichtern. Es ging alles holterdiepolter und ins Ungewisse hinein. Aus welchem Grunde auch immer, Afghanen erwiesen sich als besonders sprachbegabt und beherrschten nach einigen Monaten recht gut Deutsch. Schlaksige Jungen aus Eritrea bummelten durch die Bahnhofsgegend, lachten, hatten herrliche Zähne, und deutsche Passanten legten ihre Furcht ab. Ja, arabische Flüchtlinge, sobald sie innerlich etwas zur Ruhe gekommen waren, sich im neuen Land und mit seinen Anforderungen zurechtzufinden schienen, setzten neue Maßstäbe in puncto Erscheinung. Im Vergleich zu einem perfekt frisierten Syrer mit feinmuskulösen Händen, einem Gesicht wie von einem assyrischen Relief, erschien so mancher Deutscher eher verwahrlost, ohne Stil, ohne dreitausend Jahre Kultur im Hintergrund. Wie das alles ausginge, der Zustrom, die Eingliederung, die Vermischung – das waghalsige, aber auch erfrischende Miteinander –, war noch offen, hing von jedem Einzelnen ab. Vom friedfertigen Willen, von der Offenheit. Mit vielen neuen Menschen konnte Deutschland eines der blühendsten und vielfältigsten Länder werden, produktiv.
Doch vieles war umgeschlagen. Niemand beschenkte mehr Zuwanderer.
Jetzt kümmerte sich anonymer der Staat. Korrekt, aber mit Unwillen. Einerseits war es sehr schmeichelhaft, dass Deutschland – das oft verrufene, harte Land – weltweit so verlockend war, dass fast ganze Völkerschaften sich für ein besseres Leben hierher aufmachen wollten, andererseits: Wann beruhigten sich die Krisenregionen und blieben die Menschen dort, um funktionierende Staaten aufzubauen oder wiederherzustellen?
Europäische Regierungen, welche die unkontrollierte Einwanderung durch Hindernisse, Zäune abwehren wollten, waren vor Jahren als inhuman abgestempelt worden; mittlerweile erwarteten wohl die meisten sichere, kontrollierte europäische Grenzen zu Lande und zu Wasser. Doch was hieße das im äußersten Fall? Schießen?
Antonia Silberstein hätte einige der Demonstranten gerne beraten. In einem Land mit Wohnungsnot mehr Wohnraum für Flüchtlinge zu fordern, mochte berechtigt sein, beschwor aber vielleicht auch Unverständnis und Ärger herauf.
In Ostdeutschland leerten sich Dörfer, ganze Regionen. Aber wer hatte den Mut und den Schwung, in Brandenburg ein kleines, alsbald vielleicht florierendes Neu-Damaskus ins Leben zu rufen, natürlich mit deutscher Gerichtsbarkeit und nicht mit der Scharia? Es könnte ein Ausflugsziel mit Spezialitätenrestaurants und Hamams werden. – Gingen alle Fremden wieder fort, in ihre irgendwann wieder beruhigten Heimatländer, welche vergreiste Öde würde sich in Deutschland ausbreiten.
Sie selbst hatte an Heiligabend Kriegsflüchtlinge eingeladen, über Religion, Politik und Erotisches war nicht gesprochen worden, sie hatten gemeinsam gekocht, erstaunlich viel gelacht, einer war Ingenieur aus Aleppo, ein anderer Student aus Mossul mit seiner Schwester. Über Beruf, Speisen und Gewürze hatten sie geredet, sich die Wohnung angeschaut, hatten allesamt ein hervorragendes, warmes Essen genossen, ohne Schwein. Als kleines kulturelles und angenehmes Statement hatte Antonia Silberstein Wein getrunken und nach dem Lamm einen Sliwowitz. Wer aus heimisch-religiöser Prägung mit Fanta und Wasser glücklich werden wollte, sollte es. Als die Gäste zu einer späten U-Bahn und in ihre Sammelunterkünfte aufbrachen, hatte sie in Kuverts ihre Gaben verteilt. So ging es, so war man sich nähergekommen, der Iraker hatte sich wieder gemeldet und studierte jetzt in Erfurt. Die Schwester hatte Krankenpflegerin werden wollen. Sie wurden gebraucht. Doch welche Lebensformen handelte man sich ein.
Das erdrückende Thema.
Keiner wurde ihm gerecht.
Reisen. Raus! Dalmatien … Kärnten.
Um Beklemmendes ging es heute Abend gottlob nicht. Ganz und gar nicht. Und im Büro hätte sie an anderes gedacht.
Schönes lockte.
Wunderbar Erregendes kündigte sich an. Animierendes. Strahlendes. Großes stand bevor, aber es begann klein und zugig.
Ja, ein historischer Abend konnte es werden.
Ließ man sie warten?
Der Wind schien abzuflauen.
«Noch im Amt, Frau Stadträtin?»
Die Frage klang desinteressiert. Der Mann, der hinter ihr aus dem Rathaus eilte, war einer der Pförtner und hatte wohl Dienstschluss. «Immer», rief sie ihm nach. Er winkte, was wohl Noch einen schönen Abend bedeuten sollte.
Bei einer kleinen Drehung ins Dunklere zog sie rasch den Fettstift über die Lippen.
Die Sache war verfahren.
Im Grunde hätte der Kulturreferent hier warten müssen. Der war jedoch zu einer Kulturreferentenkonferenz nach Greifswald gefahren. Da große Baumaßnahmen anstehen könnten, nicht nur Renovierung und Umbau, sondern etwas ganz Neues, das dann auch Ihr Ressort betreffen würde, könnten Sie doch gleich für mich hingehen, hatte der Kollege gebeten. Ich schalte mich später ein.
Hilfsbereit und neugierig, wie sie zumeist war, hatte sie gesagt: Gut, für eine erste Erkundung.
Der Fettstift verschwand wieder in der Tasche.
Da stand sie nun und hatte eigentlich wenig Fachkenntnis im Kulturellen.
Und den Termin hatte ein Mitarbeiter organisiert, der nicht recht bei Troste war.
Drei Damen – sie eingeschlossen – würden sich hier am Tor treffen. Zwei fehlten noch. Der auswärtige Experte, eine Koryphäe, wie es hieß, würde später dazustoßen. Doch wo? Sie spähte. Therese Flößer kannte sie vom Sehen und vom flüchtigen Gespräch auf einem Empfang. Schon länger her.
Vor ihr auf der Weite des Platzes öffneten sich Schirme, Regen konnte man dies zarte Sprühen wie aus einem Flakon nicht nennen. Der feuchte Hauch erfrischte dennoch.
Obwohl das Warten einen Rest altertümlicher Amtsehre berührte, wollte sie wegen ein paar Minuten Verspätung anderer auf den Termin nicht verzichten. Vielleicht würde sie sogar während ihrer letzten Arbeitsjahre mit dem Projekt befasst sein, es an ihren Nachfolger übergeben, aber namentlich für immer verbunden bleiben mit dieser Sensation. Nicht schlecht, für alle Zeit eine Genugtuung und Freude … Bauliche Planung und Koordination Stadträtin Antonia Silberstein … Irgendwo würde das vermerkt bleiben, wenn auch wohl nicht auf einer Gewölbewand. Abermals und deutlich verdient gemacht um die Stadt, ihr Flair, ihre Geltung.
Und der Termin konnte sogar noch gewichtiger, epochaler werden, als es ihr schwante.
Gegen Berlin hätte man etwas Neues aufzubieten. Der Moloch an der Spree verschlang eigentlich seit seiner Gründung endlos Fördergelder und brüstete sich damit, die Zentrifuge von Geist, Macht und Tat zu sein. Auf Pump. Regensburg war die historische Hauptstadt Deutschlands, dort hatte sich dreihundert Jahre lang der Reichstag versammelt, oder Frankfurt, wo noch länger die Kaiser gekrönt worden waren. Aber es wussten ja nur wenige etwas.
Mehr internationale Gäste konnten an die Isar gelockt werden. Nicht nur Pauschaltouristen und Oktoberfestbesucher, sondern geistige Eliten. Großzügig musste geplant werden, mit Grandezza und Aplomb. Für die Mit- und die Nachwelt. Wie es einst die Wittelsbacher mit ihren Prachtavenuen vorgemacht hatten. München, ein neuer, reger Brückenkopf zwischen den Völkern und Kontinenten. Ein hochmodernes Tagungszentrum, Suiten für Nobelpreisträger, ein Wohntrakt für Stipendiaten, etwas Gleißendes, Offenes, in bester abendländischer Lage, ein Kreativzentrum für die Zukunft.
Herrlich. Glorreich.
Der Oberbürgermeister hatte sich verhalten geäußert, aber schien sich mit dem Projekt zu beschäftigen.
Im Stadtrat wäre Überzeugungsarbeit zu leisten, doch mit sozialen Kulturinitiativen allein, Clowns in Kindertagesstätten, Schachecken in den Krankenhäusern, der ambulanten Töpferei – alles wichtig – konnte München nicht magnetischer werden.
Und etwas Großes strahlte in alle Richtungen aus.
Wo die Konzerte bester Orchester fast allabendlich ausverkauft waren, hier, fanden mehr Menschen zur Musik, zum Intensiven, Schönen, zum irdischen Glück.
Das war auch jetzt die Leitidee.
Mehr brauchte es nicht. Förderlicheres für Mensch, Geist und Wohlbefinden konnte eine Verwaltung in Friedenszeiten nicht leisten.
Nein, sie wartete gerne noch ein paar Minuten.
Es waren Überstunden mit Sinn.
Ein Dienst am Kommenden.
Das Glockenspiel, das Drehen und Wenden der Figuren am Turm, das sich hinzog und die Schaulustigen schließlich langweilte, klang aus. Zehn nach fünf. Die Demonstranten im Halbkreis, wodurch sich etliche mehr oder weniger gegenseitig anblickten, forderten still Wohnraum. Eine hochgewachsene Passantin mit puppenhaftem, ja übermodelliertem Gesicht griff sich an ihren High Heel, aber der Absatz hing schon in einer Pflasterritze. Für Lipofilling und Straffung musste sie einiges berappt haben. Die späte Rechnung folgte wohl noch. Hörbar italienische Schüler torkelten atemlos und lachend aus einem U-Bahn-Zugang. Sie waren die Rolltreppe, die hinabglitt, heraufgestürmt. Egal, in welche Richtung, die vielen Fahrtreppen, die meistens intakt waren, schienen mediterrane Gäste besonders zu begeistern. An einem Kiosk wurden die Zeitungsständer bereits ins Innere geschoben. Provinz.
Aufbruch
«Frau Silberstein?»
«Bin ich.»
«Ortrud Vandervelt. Ich komme gerade aus Sibirien.»
«Ach –»
«Entschuldigen Sie die Verspätung.»
«War es schön? Aufregend sicher.»
«Lesereise. Goethe-Institut. Termine, Termine. Omsk, Nowosibirsk, Krasnojarsk. Das heißt Schöner Hügel.»
«Nein, wirklich?»
«Ja. Aber ich hatte mich auf heute natürlich schon vorbereitet.»
Die Schriftstellerin kam wieder zu Atem. Grazil, hübsch war sie und musste eine Schönheit gewesen sein. Feine Gesichtszüge, fast knabenhaft, mit den Spinnweben reiferer Jahre vor allem um die Augen. Rot getöntes Haar lugte unter der roten Mütze, fast einem Turban, hervor.
«Ich bin ja als Sachverständige geladen», lachte sie ein wenig krampfhaft. Bei einem derartig reizvollen Gesicht ohne jedwede Fettmembran wirkte die Mimik schnell angespannt und forciert, ruhelos. Die Schauspielerinnen Corinna Harfouch, Maren Kroymann kamen einem in den Sinn. Kleine Pölsterchen zahlten sich im Alter mitunter aus.
«Als Ratgeberin», versuchte Antonia Silberstein eine mögliche Überforderung abzumildern, «als versierte literarische Stimme der Stadt. – Können Sie denn Russisch?»
«Nein, kaum. Es fand alles mit Dolmetscher statt. Auch der Auftritt im Mittelsibirischen Fernsehen. Wir haben weniger Zuschauer als Schweden, begrüßte mich der Moderator, dafür ist unser Sendegebiet größer als die Europäische Union.»
«Dimensionen.»
«Vom Matsch auf einem Trampelpfad zum Studio hatte ich bis obenhin verdreckte Stiefel und er klebrige Hosenbeine. Wir lachten. Sieht bei der Übertragung ja keiner. Sdrastwujte i dobro pashalowatj, und schon waren wir auf Sendung … Er sah übrigens blendend aus, blond, ein Sonnyboy, bis auf die verschlammten Beine. – Ratgeberin? Ja, das ist harmloser. Doch was soll ich raten, Frau Silberstein?»
«Das Richtige, Frau Vandervelt, es handelt sich um eine Millioneninvestition.»
Die Schriftstellerin wühlte in ihrer Umhängetasche, Gucci, kein Imitat, und zog eine Klarsichtfolie voller Blätter heraus, fand auch ihre Brille.
«Allein diese schnörkelige Schrifttype», ächzte Ortrud-Karen Vandervelt.
Die Stadträtin erkannte im Laternenschein altmodische Buchstaben, Verse auf dem Papier in den Händen der Beraterin.
«Das ist unmöglich. Von vornherein. Da hat man noch den Moskauer Flughafen im Kopf, Polen unter sich, unsere S-Bahn, die sogar fuhr, und nun dies:
Ich hab’ in strengem Musendienst mich redlich müd’ und
heiß gelebt
Und andachtsvoll mein Leben lang in hoher Meister Kreis
gelebt …»
«Zweimal gelebt hintereinander?» Die Stadträtin stutzte.
«Das sind Ghaselen, altpersisches Versmaß, die haben ein seltsames Reimschema», und die Schriftstellerin fuhr fort:
«Dem Wettlauf, dem banausischen, nach Gold und Ehren
blieb ich fern … »
«Das ist lobenswert.»
Ortrud Vandervelt blickte unwirsch:
«Und hab’ im Stillen, lauschend, auf des Genius Geheiß,
gelebt.
Der Schöpfung tausendstimm’gen Chor, in meiner Klause
hört ich ihn …»
«Klause?» Antonia Silberstein im braunen Mantel wunderte sich abermals: «Zwei Villen, soweit ich weiß, eine hier, die andere in Italien. Das nannte man auch früher schon nicht Klause.»
Ortrud Vandervelt hielt ihre Kopie mehr ins Licht:
«Und glaubte, wenn ich niederschrieb, was in mir klang,
so sei’s gelebt.
Doch jetzt, am Ziel der langen Bahn, beschleicht mich Sorge:
nicht genug
Hätt’ ich in freier Gotteswelt, zu viel nur schwarz auf
weiß gelebt.»
Die Schriftstellerin blickte auf und sah die Beamtin an: «Das ist Plunder, Frau Stadträtin. Ghaselischer Quark. Eine Banalität. Alter Dichter war von den Musen geküsst, aber möchte sich nachträglich furioser ausgelebt haben.»
«Dagegen ist doch nichts einzuwenden, Frau Vandervelte.»
«Ohne e, einfach -velt. – Verschmockt. Larmoyant. Formvollendete Leere. Ungefähr zur gleichen Zeit qualmte ein Fabrikschlot neben dem anderen, füllten Autos die Straßen, kämpfte Rosa Luxemburg für die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter, goss Krupp Kanonen für den Ersten Weltkrieg, erfasste Gottfried Benn die harte Wirklichkeit: Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt. Irgendeiner hatte ihm eine dunkelhellila Aster zwischen die Zähne geklemmt. – Und hier», sie tippte auf ihr Blatt, «andachtsvoll, Musendienst … hoher Meister Kreis und fünf Mal gelebt. Das ist ausgewrungener Goethe, knapp hundert Jahre, nachdem der tot war. Dichtung wie stockige Wäsche.»
«Sie sind von der Reise strapaziert.»
«Ich bin nie gestresst, beziehungsweise immer. Das ist mein Beruf.»
«Sie klingen nicht so begeistert.»
Die Russlandreisende mit altpersischem Reim in der Hand blickte fast verstört.
«Das Zentrum soll großartig werden», fuhr die Stadträtin fort, «ein Leuchtturm, wie man heute sagt. Da müssen wir behutsam urteilen.»
«Ein Leuchtturm, aus dem Müll plumpst. Sie können, verzeihen Sie mir, nicht Millionen von Steuergeldern für solch einen Leuchtturm verpulvern, Frau Silberstein. Lieber neue Fahrradwege. Mehr Zebrastreifen. Meinetwegen sogar ein Thomas-Mann-Zentrum.»
«Geht nicht. Das Grundstück seines ehemaligen Hauses ist zu klein. Außerdem hat München ihn 1936 ausgebürgert.»
«Höchste Zeit, ihm einen Leuchtturm zu widmen.»
«Verstehen Sie mich nicht falsch. Natürlich ist er unser namhaftester Nobelpreisträger.»
«Oder, wenn’s denn sein muss, ein Stefan-George-Zentrum.»
«Der hatte, soweit ich weiß, Frau Vandervelt, nur eine Wohnung. Außerdem gibt’s irgendwo in der Stadt wohl dieses GeCe, die George-Centrale, eine schwule Bar, man weiß nie, das könnte zu Verwechslungen führen.»
«Lenin. Der war bedeutend genug. Der hatte lange genug hier gebrütet und Bier im Hofbräuhaus genossen. Nennen Sie was nach dem.»
«Lenintreff, absurd. Wir können den Linksparteien doch keine Arena verschaffen, die Stadt muss neutral bleiben. Außerdem wurde der Mann zum Schlächter. Aber doch interessant, wer alles in unseren Mauern nachsann, sich regte und schlief.»
«Karl-Valentin- oder, wenn denn etwas gegründet werden soll, Enzensberger-Zentrum», erklärte gereizt die Autorin.
«Valentin ist mehr Film. Der andere ist noch zu frisch. Man muss sich am Nachruhm orientieren.»
«Oder nennen Sie’s nach mir. Ich hab schließlich vor Dutzenden von Zuhörern und Goethe-Angestellten in Krasnorjarsk gelesen.»
«Später einmal, gewiss, eine Vandervelt-Straße. Im Speckgürtel wird noch viel gebaut werden.»
«Aber nicht nach einem Mann, der im Musenkreis andächtig die Welt verpasste und mit was weiß ich noch die Sprache und das Denken verklebte.»
Die Münchner Literaturpreisträgerin war heftig geworden. Ein Plakatträger aus einer anderen Weltgegend wandte sich zu ihr um. Aber es konnte vielleicht nicht schaden, dass er mitbekam – falls er etwas verstand –, wie neben den subtilen und endlosen Koranauslegungen auch scharf und immerwährend um hiesige Kulturtraditionen gerungen wurde. Falls er sich auch nur mit «Reden immer gut» einschalten würde, wäre er ein löblicher Landsmann.
«Es wird ja noch ein Experte, ein Kenner kommen», erklärte die Stadträtin und bot der Schriftstellerin ein Pfefferminz an: «Los?», fragte sie, «man bekommt hier Käsefüße. Dann eben nur zu zweit.»
«Also gut. Los. Ich will’s sehen», Ortrud Vandervelt war einverstanden: «Taxi?»
«Ein paar Schritte täten mir gut. Ich hatte den ganzen Tag Sitzungen.» Antonia Silberstein ließ den Blick kurz über ihre Begleiterin streifen. Hüftlange Jacke aus geschmeidigstem Leder, passgenauer Rock um schmale Hüften, dunkle, kaum sichtbar gemusterte Strumpfhose. Einschließlich des schmalen Schuhs Eleganz ohne Übertreibung. Dabei umgab eine Tragödie die Schriftstellerin und durchdrang möglicherweise noch immer ihr Leben. Auch Zeitungen hatten den Sachverhalt angedeutet. Vor etlichen Jahren hatte Frau Vandervelt ihren Mann angerufen, wohl wegen eines schulischen Problems der Tochter. Der Mann, irgendwie gut in der Finanzbranche tätig, hatte sich auf der Rückfahrt von Frankfurt befunden. Er musste die Nummer seiner Frau erkannt haben, hatte sich am Handy gemeldet und binnen Sekunden im Platzregen auf der A 9 die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Als er ins Schleudern geriet, verkeilten sich hinter ihm mehrere Autos zur Massenkarambolage, die für ihn tödlich endete. Das pure Grauen, das gewiss nicht verjährte.
Es schlug viertel nach von den Turmuhren.
Sie bogen in die volle Theatinerstraße.
Keinen Geistlichen, auch in einem Menschenstrom, gewahrte man mehr ohne Nebengedanken an die enthüllten Übergriffe von Klerikern.
Im Sportgeschäft wurden Fenster mit Footballzubehör dekoriert.
Sogar mehrere Meter vor einer Parfümerie duftete es.
«He! Hallo! Die Heyse-Fans? … Wartet!»
Antonia Silberstein und Ortrud Vandervelt gingen weiter. Schirm ja oder nein, das war die Frage. Aber die Tröpfchen im Wind waren zu minimal. Allerdings mussten sie sich vor den Schirmen anderer in Acht nehmen, manche Weichlinge spannten ihn bereits beim Anblick einer Wolke auf.
«Heyse!», hallte es hinter ihnen.
Beide setzten ihren Weg fort.
«Mein Gott, Paul Heyse!» Die Stimme hatte längst ihr Ohr erreicht, aber erst jetzt erfassten beide, dass sie mit dem Namen gemeint sein mussten. Nie war eine von ihnen mit diesem Ausruf bedacht worden.
«Ortrud! … Frau …», klang es flehentlich und vertrauter.
Sie drehten sich um.
Therese Flößer. Atemlos, gehetzt schälte sie sich aus der Passantenschar. Wann war das passiert? Natürlich kürzlich. Zügig humpelte die Oberbayerin heran. Ihre Krücke handhabte die Diplom-Bibliothekarin und renommierte Mitarbeiterin des Münchner Literaturarchivs so gekonnt wie andere das Essstäbchen.
«Therese», bemerkte Ortrud Vandervelt anteilnehmend.
«Es ist doch Heyse-Tag», hechelte sie.
«Nur ein Ortstermin», fügte die Stadträtin an und streckte hilfreich die Hand aus, was instinktive Geste blieb.
«Dsie … habt lange gewartet. Dsu … müssen entschuldigen.»
Was haspelte die Flößer? Die Schriftstellerin hatte es im Nu entschlüsselt: Mit Therese duzte sie sich, mit der Stadträtin galt für beide das Sie. Eine Sammelanrede für Du und Sie gab es im Deutschen nicht, so war in der Hektik das Dsu oder Dsie oder sonst was über die Lippen gesprudelt. Interessant, spontan, sinnvoll erweiterte Grammatik. Die Tätigkeitswörter machten dabei allerdings nicht mit: Dsie musst ging nicht. Dsu müssen auch nicht. Eine Schwachstelle einer bewährten Sprache, einen nicht vorhandenen Sammelgruß aus Du und Sie nicht mit einem Verb im Singular oder Plural koppeln zu können. Wie verdammt einfach im Englischen: you will … oder im Französischen: Das Vous konnte Sie und ihr beide heißen und ließ Spielraum. Dagegen blieb das Deutsche in der prägnanten Begriffekomposition unübertrefflich. Russlandreisendememoiren.
«Ihr wisst, sonst bin ich pünktlich.»
«Darauf kommt es nicht mehr an», bekannte die Stadträtin.
«Und für Heyse schick i mi.»