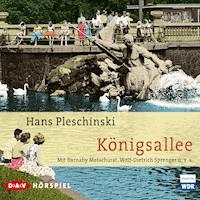19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag C.H. Beck oHG - LSW Publikumsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Im August 1756 überfällt Friedrich der Große ohne Kriegserklärung Sachsen. Vor der hochgerüsteten preußischen Armee flüchtet Friedrich August, Herrscher über Sachsen und Polen, zusammen mit seinem Premierminister Heinrich von Brühl, nach Warschau. Aber die Reichsgräfin von Brühl bleibt in Dresden und kapituliert nicht, während das Land geplündert wird. Sie schmiedet einen Plan... Getarnt durch ein Pseudonym, macht sie sich mit ihrer Kammerzofe auf den mühevollen Weg nach Leipzig, wo Friedrich der Große seine Audienzen hält. Kann man durch eine beherzte Tat die Geschichte verändern, einen barbarischen Krieg beenden? In seinem neuen ebenso unterhaltsamen wie kenntnisreichen Roman erzählt Hans Pleschinski von einem wenig bekannten Ereignis der deutschen Geschichte und von heimlichen Heldinnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Hans Pleschinski
Der Flakon
Roman
C.H.Beck
Zum Buch
Im August 1756 überfällt die Armee des preußischen Königs Friedrich II. ohne Kriegserklärung Sachsen, Friedrich August, Herrscher über Sachsen und Polen, und sein Premierminister Heinrich von Brühl, ein Intimfeind Friedrichs des Großen, setzen sich nach Warschau ab. Die sächsische Armee, dem hochgerüsteten Preußen weit unterlegen, muss kapitulieren. Aber eine, die Reichsgräfin von Brühl, die in Dresden geblieben ist, kapituliert nicht, während das Land geplündert wird. Sie schmiedet einen Plan …
Und so setzt sie sich, getarnt durch ein Pseudonym, mit ihrer Kammerzofe Luise von Barnhelm in die holprigen Kutschen der «Ordinären Post» und macht sich auf den Weg nach Leipzig, wo der Preußenkönig und Besatzer seine Audienzen abhält. Die Gräfin, die sich Friedrich selbst nicht nähern kann, macht sich kundig: Der preußische König wird die berühmten Gelehrten und Dichter Gellert und Gottsched empfangen und dann gibt es auch noch seinen hochverschuldeten Kammerdiener Glasow, der immer in seiner Nähe ist. Kann man einen der Herren zur patriotischen Tat anstiften, kann man durch einen beherzten Akt die Geschichte ändern, einen Krieg beenden?
Faszinierend, spannend und kenntnisreich erzählt Hans Pleschinski in seinem neuen Roman «Der Flakon» von einem wenig bekannten Ereignis der deutschen Geschichte, von heimlichen Heldinnen und den Möglichkeiten und Abgründen deutscher Mentalität.
Über den Autor
Hans Pleschinski, geboren 1956, lebt als freier Autor in München. Zuletzt erhielt er u.a. den Hannelore-Greve- Literaturpreis (2006), den Nicolas-Born- Preis (2008) und wurde 2012 zum Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres der Republik Frankreich ernannt. 2014 erhielt er den Literaturpreis der Stadt München und den Niederrheinischen Literaturpreis. 2020 wurde ihm der Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung zuerkannt. Hans Pleschinski ist Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste.
Inhalt
Sein oder Nichtsein
Böses Erwachen
Not
Wenzel
Kommen und Gehen
Louvre
Bekanntschaft
Die Verschwörung
Aufbruch
Bericht der Gräfin
Umspann
Stauchitz
Am Kamin
Bräker
Auf der Heide
Schrecken
Quartier
Oratio pro principe
Leere
Neuigkeiten
Pleiße-Athen
Blauer Engel
Die Muhme
Kleiner Auftrag
Allons enfants de la patrie
Durch die Gassen
Handel
Der Stich
Im Kabinett
Unterwegs
Hymnus
Im Osten
Epilog
Nachbemerkung
Karte
Bildnachweis
Ich sehe mir das Grüne Gewölbe an, dann den ganzen Garten und das Haus des Grafen Brühl, seine Bildergalerie, sein türkisches Haus, seine Bibliothek, kurz alle seine Schätze. Was mir aber am bemerkenswertesten und bewunderungswürdigsten erscheint, das ist die Gräfin Brühl selbst. Mein Gott, was ist die Frau liebenswürdig! Welche Intelligenz gehört dazu, diesen ganzen herrlichen Besitz mit allen seinen Schätzen zu erhalten …
Ernst Ahasverus Heinrich Reichsgraf von Lehndorff, Tagebücher, Dresden, 28. Februar 1756
Sein oder Nichtsein
Kanonendonner verhallte im Tal.
Es mochte nur ein Scharmützel mit wenigen Toten sein.
Hier oben befand man sich noch in Sicherheit.
Was bereitete sich da in der Tiefe vor?
Der Königstein war umzingelt. Aber die Festung selbst schien uneinnehmbar zu sein.
Von der Kirchturmuhr zwischen den Bollwerken und Bastionen schlug es elf.
Der Regen ließ nach. Die tagelangen Güsse hatten den Fels und die Gemäuer dunkelgrau gefärbt. Von den Dächern rann das Wasser und fand zwischen den Pflastersteinen hindurch seinen Weg in die Zisterne.
Am Burgtor wurde die Wache abgelöst.
Beim Wechsel der Mannschaften trat ein Garnisonsoffizier kurz neben den nachfolgenden Leutnant.
«Meldung von den Österreichern?»
Der Leutnant schüttelte den Kopf.
«Wir sind verloren.»
Wer mit geschultertem Gewehr Dienst am Tor, auf den Schanzen, hinter dem meilenlangen Kranz der Zinnen tat, der spähte oft nach Süden. Nur wenige Kuriere kamen durch. Andere wurden von den Belagerern abgefangen, die Depeschen beschlagnahmten und zu dechiffrieren versuchten. Von Süden her musste die Rettung kommen, aus Böhmen, aus den habsburgischen Erblanden. Vielleicht war das Entsatzheer, waren die Verbündeten unter dem kaiserlichen Feldmarschall Browne bereits im Anmarsch, sogar in Reichweite und würden binnen Kurzem die Umzingelung aufbrechen, den Angreifer in die Flucht schlagen und die alte Ordnung wiederherstellen.
Wald und Gebirge. Die Blicke hoch über dem Flusstal bohrten sich in den Dunst. Noch blieb es im Süden bedrückend ruhig. Keine Marschkolonnen, keine kaiserlichen Banner, die sich auf das Elbsandsteingebirge zubewegten.
Über den Ortschaften der Umgebung, Schandau, Pirna, ragte das Bergmassiv mit der Festung auf seinem Plateau auf. Der schroffe Königstein konnte von Dresdens Türmen aus erahnt werden. Allein der Bruderberg, der Lilienstein, menschenleer, nahm es an Größe und Wucht mit Sachsens Festungsbollwerk auf.
Kein fremdes Heer hatte die Steilwände je erklimmen, kein Beschuss die Artillerie auf den Bastionen treffen können, Trinkwasser und Wasser zum Löschen ließen sich reichlich im Brunnenhaus schöpfen. Nur genug Pulver, Munition und Proviant mussten in den Magazinen lagern.
Vor sechs Wochen, am 29. August, war der Feind ins Land einmarschiert. Ohne Vorwarnung, ohne Kriegserklärung, was beispiellos in der neuen Zeit war. Ein staatlicher Überfall. Und abermals ein Krieg Deutscher gegen Deutsche, eigentlich ein Bürgerkrieg. Siebzigtausend Preußen, Landeskinder und Söldner, waren in drei Kolonnen in Sachsen eingedrungen. Wie hätten nicht einmal halb so viele sächsische Soldaten ihnen an mehreren Fronten Widerstand leisten sollen? Die eigenen Regimenter waren in Richtung Dresden und Elbtal zurückgezogen worden. Sachsens Armee galt zwar als die einzige in Europa, die vollständig mit Perücken ausgestattet war, doch darüber hinaus war zugunsten anderer Prachtentfaltung und der Künste am Militär gespart worden. In der Dresdner Oper agierten und brillierten die exquisitesten und höchstbezahlten Sänger als Feldherren in den Rollen von Alexander und Caesar in Seidenstrümpfen, aber was eine übliche Gefechtsbereitschaft anging, so stand es um die Kursachsens schlecht. Das letzte Manöver, eher eine Schauveranstaltung für den Hof, hatte vor vier Jahren stattgefunden.
«So erkennt alle Welt, dass wir einzig den Frieden wollen», hatte Sachsens Premierminister Heinrich Reichsgraf von Brühl die militärische Schwäche erklärt oder zu beschönigen versucht. Und das, obwohl man mit Preußen einen eifersüchtigen, hochgerüsteten und habgierigen Nachbarn im Norden hatte.
Binnen sechs Wochen hatten die Truppen König Friedrichs II. das Land überrannt. Der gekrönte Eindringling ließ sofort die öffentlichen Kassen Sachsens beschlagnahmen. Er presste Städten Zwangsgelder ab, bevor er deren Ratsherren nach Hause schickte. In Leipzig war die preußische Soldateska sogar während des Gottesdienstes in die Nikolaikirche eingedrungen und hatte die Kollekte geraubt. Und ebenfalls in Leipzig war als Zeichen der preußischen Ordnung auf dem Marktplatz ein Galgen errichtet worden. Pleiße-Athen, die erste Messestadt Europas, nun eine Ödnis.
Die Wolken schoben sich dunkel über das Land.
Jeden Augenblick konnten sich die Regenschleusen wieder öffnen.
Im Tal waren die Äcker und Felder bereits überschwemmt.
Am späten Vormittag dieses Oktobertags 1756 wischte der Wachtmeister Johann Melchior Olbricht mit der Handkante über eine Steinbank der Festungsbrüstung. Er legte einen Lappen auf das Feuchte und setzte sich. Das Gewehr stellte er neben sich ab. Wieso das Bajonett aufgepflanzt sein musste, erschloss sich dem Wachtmeister nicht. Wen sollte er hier oben in Wind und Wetter aufspießen? Wenn man doch Feinde durch Abwarten und Ausharren besiegen könnte. Mit der Gicht in seinen Schultern konnte er den schweren Vorderlader ohnehin nur bis in Brusthöhe anheben und wäre schon vor dem Zustoßen in Atemnot geraten.
Sowohl das Sitzen wie das Abstellen der Flinte waren streng untersagt, aber es beachtete ihn im Moment wohl niemand außer dem Kameraden vom Garnisonsregiment, der ihm mit dem Dreispitz zuwinkte. Sie waren viele Friedensjahre lang eine verschworene Gemeinschaft hier oben auf dem kolossalen Burgberg gewesen, zweihundert, zweihundertfünfzig Mann. Sie waren Patrouille gegangen und hatten gekegelt, sie hatten die Geschütze instand gehalten und abends gewürfelt und gebechert. Dann und wann ein «Lang lebe unser Kurfürst!» hatte die Trinkrunden gewissermaßen staatstragend gemacht. Sie hatten die ledernen Uniformgurte abgelegt, ihre Perücken über die Stuhllehne gehängt und die Westen aufgeknöpft. Nach einer Weile hatte man im Schein der Fackeln an den Gewölbewänden und im Tabaksqualm kaum mehr die Zahnlücken und Pockennarben der Kameraden erkennen können. Alles war überm Bierschaum wohlig verschwommen. Dabei hatten sie an den langen Tischen zwischen den baumdicken Granitsäulen beileibe nicht nur ihre Kriegsanekdoten zum wiederholten Male zum Besten gegeben, sich ein Stelldichein mit den Töchtern des Kommandanten ausgemalt, über die Politik im Allgemeinen und den ausbleibenden Sold geflucht. Nein, insbesondere die Invaliden, die auf dem Königstein Dienst taten, waren mitunter belesen und hatten über das Leben gründlicher nachgedacht. Der einarmige melancholische Musketier Schröter aus Torgau hatte immer wieder kühn angesetzt: «Und ich sage euch, Gott gibt es nicht. Es hat keinen Sinn für die Schöpfung und für einen Heilsplan, dass ein guter Teil von mir im Laufgraben ausgeblutet ist.» Ein Infanterist, durch dessen Leib weiterhin die Zinksplitter eines Streugeschosses wanderten, zitierte gerne aus den Fabeln von Christian Fürchtegott Gellert, dem Lieblingspoeten der Deutschen: «Bei Gütern, die wir stets genießen, wird das Vergnügen endlich matt. Und würden sie uns nicht entrissen, wo fänd ein neu Vergnügen statt?»
Viel Vergnügliches bot das Festungsleben nicht, es sei denn, der Oberleutnant erfreute sich an einer Kirschblüte, die im Frühjahr im Burggarten ihren rosafarbenen Kelch öffnete. Viel Effekt beim abendlichen Zusammensitzen machte ein Franzose, der in sächsische Dienste geraten war. Der ehemalige Dragoner, der in der Schlacht von Kesselsdorf anno 45 mit einem glimpflichen Kopfschuss neben seinem getöteten Pferd liegen geblieben und mit viel Glück aus den Leichenhaufen gezogen worden war, kannte seinen Landsmann Voltaire, der geschrieben hatte, dass das Paradies auf Erden dort sei, wo der Mensch ist. Und zwar dann, wenn der Mensch sich benehme, wohltätig und friedlich sei. «Wenn der Mensch», sagte der Franzose, «das Leben genießt und andere Menschen ihre Leben genießen lässt, dann ist es das Paradies auf Erden. Voilà. Gott braucht es dafür nicht, wie der Kamerad sagt. Das Heil und der Frohsinn des Menschen kann nur der Mensch selbst sein.» – Das klang verführerisch, war allerdings starker Tobak: Sämtliche Religion war sinnlos, wenn man auch ohne Religion Glück empfinden und Glück verbreiten konnte. Wozu brauchte es dann die Kirche und die gottgesalbten Herrscher? Und warum waren einige Menschen durch ihre Herkunft bevorzugter als andere? Doch nur wenn alle gleichrangig waren, konnten die Menschen einander weniger bedrücken. – Irgendwann ließ der Kommandant die Bücher des Franzosen konfiszieren.
Ein paar dicke Tropfen schienen den nächsten Schauer anzukündigen.
Das Schwarzgelb Sachsens wellte sich in einem unmerklichen Windstoß am Fahnenmast über dem Zeughaus. Vielleicht war doch noch nicht alles verloren. Jederzeit konnten die Österreicher eintreffen und die preußischen Invasoren vertreiben. Ein Trommelwirbel vom Burgtor her, der zwischen den Bauten der Festung verklang, kündigte vielleicht das Eintreffen eines Kuriers von Feldmarschall Browne an, dem kriegskundigen Iren in Diensten der Kaiserin Maria Theresia.
Auf der Bank neben seiner Waffe sitzend, sog der Wachtmeister an seiner Pfeife ohne Tabak. Es gab fast nichts mehr auf dem Königstein, zumindest für die unteren Ränge. Einen halben Apfel zum Frühstück. Einen Kanten muffiges Brot zum Mittag und am Abend. Allerdings genug Wasser aus der Zisterne. Olbricht, zur Welt gekommen in Plauen und seit 1730 vereidigt auf Seine Majestät den Kurfürsten von Sachsen und König von Polen, rieb sich den Bauch. Nichts drin, aber vielleicht noch genug Fett für bange Stunden. Arme und Schultern bewegte er am besten gar nicht, um kein Stechen zu spüren. Würde er am Ende seiner Tage von preußischen Kürassieren in Stücke gehauen werden? Es ging um Leben und Tod. Er bekreuzigte sich, als Protestant womöglich in der falschen Richtung. Wachsam warten war die Devise.
«Bonjour!» Der französische Kamerad hinkte vorbei.
«Wo geht’s hin, Dragoner?»
Der schmucke Invalide pfiff fröhlich und stapfte, akkurat frisiert, im Uniformrock und mit Stulpenstiefeln der Georgenburg entgegen. In dem klotzigen Bau hinter den Zinnen hatte einige geflohene Prominenz des Dresdner Hofs Unterschlupf gefunden.
Vor den Preußen war halb Elbflorenz geflohen.
Wurden in dem sicheren Gemäuer auch nur Apfelhälften serviert?
Ein Schwarm von Sperlingen schwirrte zwischen den verstreuten, aus verschiedenen Jahrhunderten stammenden Gebäuden auf, der Magdalenenburg, dem Seigerturm, der Georgenburg, dem Zeughaus. Eine unbestimmte Unruhe herrschte überall. Katzen sprangen von ihren Ruheplätzen herunter. Die vertraute Hundeschar der Garnison beschnüffelte immer neue Berittene, die vor der Kommandantur ihre dampfenden Pferde den Stallburschen übergaben. Wachtmeister Johann Melchior Olbricht erkannte seinen Altersdienstsitz nicht wieder. Schlichte und prunkvolle Kutschen standen aufgereiht. Im Burggehölz wurden Bäume gefällt und zu Brennholz zersägt. Krähen kreisten und suchten nach einem neuen Platz. Unausgeschlafene, ausgemergelte Gesichter überall. Die Belagerung ging in die zweite Woche. An Uniformen fehlten längst Knöpfe, Gamaschen waren dreckbespritzt, feuchte Stiefelschäfte schoben sich wellig zusammen, Infanteristen und Marketenderinnen rührten wässrige Suppen über spärlichen Feuern. Durch deren Glimmen und Funken auch während der Nacht schienen sich sogar die Fledermäuse auf der mit Fußvolk, Flüchtlingen und Kavallerie überfüllten Festung nicht mehr orientieren zu können. So empfand es auch Olbricht. Am schlimmsten war der nicht abreißende Tross, der sich mit hastig angefertigten Tragen aus dem Elbtal die steile Auffahrt zum Tor hinauf- und zum Verbandsplatz vor dem Lazarett emporschleppte. Schreiende, blutende, von Gewehrsalven und Kanonentreffern halb zerfetzte, nicht selten auf dem Weg sterbende Kürassiere, Grenadiere, Majore und einfache Soldaten wurden von ihren ausgehungerten Kameraden einstweilen in Sicherheit gebracht. Die preußischen Angriffe mit Gewehr- und Kanonensalven im Tal waren verheerend. Die Belagerer versuchten über Pontonbrücken über die Elbe in die sächsischen Stellungen zu gelangen. Die Belagerten ihrerseits wollten mit eilig gezimmerten Schwimmbrücken aus dem Kessel ausbrechen. Was ging in den Abertausenden vor, die wahrscheinlich in den Tod stürmten? Für wen? Für was?
Olbricht stand mit der kalten Pfeife in der Hand auf. Auf Wache zu sitzen ziemte sich nicht. Er griff nach seinem Gewehr mit Bajonett. Zumindest war das Leben so viel länger gewesen, als es das Sterben sein würde. Familie hatte er nicht, nur einen Onkel in Plauen, einen Schneidermeister, der trotz seiner Erblindung noch immer zerrissene Hosen flicken und sogar Hemden nähen konnte.
Sperlinge ließen sich neben ihm auf der Brüstung nieder. Wo kein Samen, kein Krümel zu liegen schien, fanden sie noch immer etwas zum Picken. Er hätte der hüpfenden Schar, die gleichfalls in alle Richtungen spähte, stundenlang bei ihrem Treiben zuschauen können. Und die Vögel, frei auf der Mauer und in den Lüften, behielten auch ihn flink und beinahe anteilnehmend im Blick. Sie, leichter als ein Pfennig, er schwer und in Uniform; gleichwohl gehörten sie auf seltsame Weise zusammen, wer hatte das bessere Los?
Johann Melchior Olbricht nahm seinen Sitzlappen und wischte über das Bajonett und über seine Stiefel.
Nur noch drei Stunden bis zur Ablösung. Die Wachen waren verkürzt worden. Die Aufmerksamkeit sollte geschärft bleiben.
Er selbst sah ohnehin nicht mehr gut, ohne ausgeborgtes Augenglas entzifferte er keinen Tagesbefehl.
Wie verging jetzt der Tag direkt unter ihm, Dutzende von Klaftern tiefer im Gestein, in den Kasematten und Verliesen der Festung, die zugleich sächsisches Staatsgefängnis war? Die Kerkermeister versahen in den dunklen Gängen, zwischen den Zellen wahrscheinlich unverändert ihren Dienst. Mit den Kerkermeistern und ihren Gehilfen setzten sich die Soldaten abends zum Umtrunk nur ungern an einen Tisch. Die Aufseher der Kasematten plauderten nicht freiheraus. Sie bewahrten vermutlich schreckliche Geheimnisse, die sie bisweilen nur andeuten: «Er hat sich seine Kette um den Hals geschlungen … Mit aller Kraft gezerrt … Aber er schaffte es nicht.»
Als einfacher Soldat hatte man, offiziell, keinen Zugang zu den berüchtigten Verliesen des Königsteins. Wer darin auf höchsten Befehl verschwand, sah das Tageslicht nur selten wieder. Der berühmteste Gefangene war vor Jahrzehnten der Alchimist Johann Friedrich Böttger gewesen. Sein Ruf als Goldmacher war dermaßen überzeugend gewesen, dass August der Starke den ungewöhnlichen Wissenschaftler zwischenzeitlich auf der Festung unterbringen ließ. So konnte er weder fliehen noch vom gleichfalls goldgierigen ersten König in Preußen, auch ein Friedrich, in dessen Lande entführt werden. Böttger war bevorzugt behandelt worden, wie man sich noch erzählte. Er hatte mehrere Räume bewohnt, einige Bedienstete gehabt, nur die Freiheit nicht. Die Verwandlung von Mineralien und Pulvern bei idealer Hitze zu Gold war dem getriebenen oder besessenen Forscher nicht gelungen. Aber eines Tages hatte Böttger aus seinem Ofen August dem Starken das erste europäische Porzellan präsentieren können. Ein Nebenprodukt auf der Suche nach dem Stein der Weisen, doch ein Schatz ohnegleichen. Das bald in Meißen hergestellte Porzellan hatte über die Jahre immense Summen in die Kassen gespült.
«Wärm dich auf, Johann. Wird kalt genug im Grab.» Der Kamerad vom Nebenposten war mit geschultertem Gewehr herübergekommen, schaute sich kurz um und reichte dem Wachtmeister eine Bouteille mit Branntwein.
«Wird gebraucht, Johann, danke.» Olbricht nahm einen ordentlichen Schluck. Je billiger der Fusel, desto zackiger schoss er in die Glieder. Manchmal war es eine Krux, dass auf der Burg, unten im Land und überhaupt überall fast jeder Mann Johann hieß, Johann Friedrich, Johann Ferdinand, Johann Sebastian … Als existierte in Deutschland nur ein Taufname.
Sie tranken, wischten sich über die Lippen.
Sie traten an die Brüstung.
Unaussprechlich herrlich dehnte sich um sie unter schwerem Gewölk das Sandsteingebirge aus. Berge wie Tafelaufsätze über den Wäldern in Herbstfarben, Rot, Gelb, letztes Grün bis nach Böhmen, nach Norden bis ins ebene Land. Um den Lilienstein hielten sich die Nebelbänke. Die Affensteine meinte man zu sehen, die sich bei Schandau in die Höhe schraubten. Die Herkulessäulen wirkten noch abenteuerlicher, so, als hätte ein Riese im Vorbeigehen Felskegel ineinandergekeilt, die einen wie urzeitliche Gottheiten aus Steinfratzen anstarrten. Hinter Dunstschleiern in der Ferne die Bastei. Kaum ein Mensch wagte sich freiwillig auf das Felsgetürm, zwischen dessen Graten und Spitzen, Höhlen und Vorsprüngen es Hunderte von Klaftern in die Tiefe zu Geröllhalden und wilden Wassern hinabging.
Zwischen Geschützen, die zügig bemannt und geladen werden konnten, beugten sich Olbricht und Hallenser vorsichtig über den Rand der Bastion.
Dort unten am Fluss spielte sich die Tragödie ab. Fast so weit das Auge reichte, war die Elbe von Zelten gesäumt. Auf dem gegenüberliegenden Ufer lagerten die Preußen, unterhalb der Festung erstreckte sich das viel kleinere Heerlager der Sachsen. Unter Aststangen und Laubdächern kampierten die Truppen, gleichfalls durchnässt, schoben fröstelnd Wache, hungerten und wärmten sich um Feuerstellen. Weiterhin wurden auf beiden Ufern Palisaden in den Boden gerammt, Verteidigungsgräben im Erdmatsch ausgehoben. Frisch geschlagene Baumstämme stapelten sich hinter den Reihen der Kanonen. Ingenieure der Pionierbataillone dirigierten die Arbeiten. Alles geschah wie in Miniatur, aber bis zur Erschöpfung an den Ufern. Für die mutmaßlichen und vielleicht schon beschlossenen Angriffe beider Seiten – wer zuerst? – wurden Pontons gezimmert und zusammengefügt. Unter gelegentlichem Beschuss schleiften längst dezimierte Mannschaften die Kampfbrücken näher an den Fluss. Auch im Visier von Scharfschützen sollten die Regimenter übersetzen und die gestaffelten Abwehrlinien der Belagerer oder, andersherum, der Belagerten durchbrechen. Ein Versuch der Sachsen, zu stürmen und den Kessel zu durchbrechen, war bereits gescheitert. Die Leichen hatte der Fluss in Richtung Dresden geschwemmt. Und nicht mehr viele unter dem Königstein konnten sich überhaupt noch auf den Beinen halten. Sie lagen fiebernd auf ihren Uniformmänteln und der blanken Erde. Gegen die Schweißausbrüche, den quälenden Husten, schließlich das Schwinden der Sinne, gegen die grassierende Influenza wirkte die Chinarinde kaum, von der die Wundärzte nicht annähernd genug Vorrat hatten.
Schon sammelte sich und lauerte in den Gehölzen und Felshöhlen rundum armes Volk und streunendes Gesindel, das in der Nacht einem schlecht bewachten Leichnam oder sterbenden Soldaten die Stiefel von den Beinen, den Brustschild vom Hals reißen, Hemd und Hose vom Leib ziehen wollte. Ringe von Offizieren, manchmal noch mit dem abgeschnittenen Finger, galten als die beglückendste Beute.
Kurz zeigte sich die Sonne zwischen den Wolken.
Preußische Truppen waren von Sachsen aus nach Böhmen in die habsburgischen Erblande vorgedrungen. Sie sollten den Nachschub und die Entsatzarmee für die bedrängten Sachsen im Elbtal abwehren und zurückschlagen.
Nach der Schlacht bei Lobositz schickte der kaiserliche Feldmarschall Maximilian Ulysses Browne, in vorherigen Kriegen mehrmals Sieger über die Franzosen in Oberitalien, seine beiden erfahrensten Kuriere ab, die den Kampf gegen die preußischen Invasoren überlebt hatten. Der steierische Dragoner bekam die Order, über die Hauptwege des Gebirges möglichst rasch das sächsische Lager zu erreichen. Sicherheitshalber brach gleichzeitig der kroatische Ulan mit einer äußerst ungefähren Karte über versteckte Waldpfade auf. Gut zwanzig Stunden würden beide Reiter allemal brauchen. Sie spähten nach preußischen Patrouillen und behielten die morastigen Wege im Auge. Der Ulan führte sein Pferd über eine abschüssige Schotterschneise hinab. Er kam langsamer, aber ungefährdeter voran. Der Dragoner hatte seinen Rappen an einem Bach getränkt. Er sah ein abgeerntetes Feld vor sich, gab die Sporen und sprengte in gestrecktem Galopp nach Norden.
In den Kuriertaschen mit dem kaiserlichen Doppeladler der beiden Kavalleristen steckte in Geheimschrift und versiegelt die Eilnachricht, die ihnen der Adjutant des Feldmarschalls anvertraut hatte: «Wichtiger denn je. Zum Königstein. So schnell es geht.»
Nach scharfem Ritt sprang der Dragoner ab und musste eine Rast einlegen. In der Nähe einer Köhlerhütte führte er sein Pferd zum Abdampfen im Kreis und wischte den Schwarzen trocken.
Sein Kamerad war trotz Stock und Stein passabel vorangekommen. Als er es in der Gottverlassenheit unter Tannen, zwischen Fels und Farn verdächtig rascheln hörte, zog der Ulan seine Pistole.
«Habe ich noch Geld, Brühl?»
«Sehr wohl, Sire. Wenn es derzeit auch ein wenig schwer zu beschaffen ist.»
Die Gesellschaft, die sich aus dem engen Tor der Georgenburg schälte, umfasste ungefähr zwölf Herren, die Adjutanten und Lakaien nicht mitgerechnet. Auch eine Dame zeigte sich, die Witwe des Geheimen Rats von Friesen. Die weltgewandte Greisin hatte oder verschaffte sich fast überall Zutritt und wusste stets Neuigkeiten. Sie hatte sich nicht davon abhalten lassen, in schwarzem Kapuzenmantel ihren Monarchen in seiner Not zu begleiten. Und insgeheim führte sie Tagebuch über die erregenden Ereignisse.
Posaunen hätten erschallen, die Leibgarde hätte Spalier bilden müssen, der Oberhofmaler Louis de Silvestre hätte den Augenblick für eine Skizze nutzen können, als Friedrich August II. Kurfürst von Sachsen und als August III. zugleich König von Polen sich in der Öffentlichkeit zeigte. Doch nichts von alledem. Die Mehrzahl seiner Leibwache tat nun Dienst auf den Wällen, und als Zuschauer näherten sich ehrfürchtig einige Invaliden und Mägde. Kinder der Garnisonsfamilien rannten herbei.
Der Herrscher selbst, der Quartier im Georgenbau bezogen hatte, wirkte verwirrt. Er schien vom Tageslicht geblendet zu sein. Er bot seine Hand nicht zum Huldigungskuss dar, vielmehr tastete er nach Halt. Der sechzigjährige Wettiner, aus einem der ältesten regierenden Häuser Europas, der Sohn Augusts des Starken, mit Thronen in Dresden und in Warschau, hielt inne und verharrte gebeugt. Die puderweiße Perücke war meisterlich gelockt worden. Unter einem Zobelumhang, der bis zu den Waden in feinster Seide reichte, zeigte sich der dunkelblau samtene Rock mit goldenen Tressen. Nur wenige von Friedrich Augusts Orden, und die auch nur in ihren kleinen Ausführungen, als sogenannte Kleinodien, waren unter seinem Umhang zu erkennen und zu erahnen, der Militär-Sankt-Heinrichs-Orden, den er 1733 selbst gestiftet hatte, der polnische Weißer-Adler-Orden und obendrein ausgerechnet der Hohe Orden vom Schwarzen Adler. Mit dieser Auszeichnung hatte ihn einst der preußische König geehrt. Sollte der halb verdeckte Ordensstern darauf verweisen, dass Friedrich II. – den manche den Großen nannten – einen besonders niederträchtigen Verrat an einem vordem Gewürdigten und Umschmeichelten beging? Alle glitzernden Auszeichnungen waren nachrangig gegenüber dem Goldenen Vlies, das der König und Kurfürst täglich unter dem Spitzenjabot über der bestickten Weste trug, dem vornehmsten Orden der Christenheit. Das Goldene Vlies verband die gekrönten Häupter, zumindest als Vision, zu einer ritterlichen Bruderschaft.
«Nachricht von der Königin, von meinen Kindern?» Betrübt wandte sich der Monarch an den Kavalier dicht hinter ihm.
«Wir warten auf Post, Sire. Familiäre Mitteilungen wollen die Preußen passieren lassen.»
«Nachdem sie sie gelesen haben», der König ließ den Kopf sinken. – «Und deine Frau, Brühl?»
«Auch sie harrt in Dresden aus.»
«Wie tapfer.» Friedrich August seufzte. «Sind die Frauen couragierter als du und ich? Sie weichen dem Feind nicht, sie behaupten ihren Platz. Ach, die Königin. Sie kränkelte ohnehin.»
«Meine Frau wird ihr beistehen, Sire. Ihr Wille war stets unbeugsam.»
«Ja, sie ist eine stolze Frau, deine Frau, Brühl.»
«Und auch umsichtig und klug, Sire. Die Stütze meines Lebens.»
«Das hast du schön gesagt, Brühl. Was tun die beiden jetzt? Weinen? Wo? Im Schloss? Sollte ich nicht bei ihnen sein?»
«Sire, Euer Majestät müssen frei sein.»
«Frei?», der König lachte auf.
«Sie müssen als Staatsoberhaupt handlungsfähig bleiben. Entscheiden können.»
Mit seinem Gehstock bohrte der Herrscher im Erdstreif zwischen den Pflastersteinen des Festungswegs. Schreie von Verwundeten, die entfernt zum Verbandsplatz getragen wurden, erreichten sein Ohr.
«So kracht es zusammen, dein famoses Bündnissystem, Brühl.»
«Sire», Reichsgraf von Brühl, der Premierminister Sachsens und einflussreichster Mann des Landes seit Jahr und Tag, näherte sich der Schulter, dem Ohr seines Souveräns: «Nichts ist verloren. Das Bündnis entfaltet seine Kraft. Die Österreicher marschieren. Die Armeen Frankreichs werden bald den Rhein erreichen. Ich habe der Zarin geschrieben, dass sie schnell in Ostpreußen einrücken muss. Verloren ist Friedrich. Vor anderthalb Jahrzehnten hat er Schlesien geraubt. Nun versucht er es mit Sachsen. Diesem Nimmersatt und Brandstifter im empfindlichen Herzen Europas werden wir das Handwerk legen. Wir werden ihn wieder zum Markgrafen von Brandenburg degradieren. Dann mag er in seinem Sanssouci philosophieren, die Flöte spielen und Gott lästern.»
Der König zuckte zurück. «Ich glaube, Brühl, er lästert Gott nicht. Er erwähnt ihn nicht einmal.»
«Warum regiert er nicht ruhig, Sire? Tut seinen Untertanen Gutes? Im nun dritten Krieg um Schlesien führt er wieder seine eigenen Landeskinder auf die Schlachtbank. Mein Bündnissystem wird wirken. Wir domestizieren ihn.»
«Aber deine Pläne sind verraten worden.»
Heinrich von Brühl war unter seinem Puder bleich, wirkte erschöpft, die Wangenknochen traten nach Nächten ohne Schlaf hervor: «Wie das geschehen konnte?»
«Ja, wie, Brühl? Verrat in deinem Geheimen Kabinett.»
«Meine Sekretäre werden stets überprüft. Menzel muss ein besonders abgefeimter Schurke gewesen sein. Immer fleißig, immer still, ein Einzelgänger. Aber hat sich aus Berlin letztlich bestechen lassen. Mit Nachschlüsseln wird er nachts im Geheimarchiv gewesen sein. Und unsere Korrespondenzen mit Petersburg, Versailles und Wien abgeschrieben haben.»
«So ein …», Seine Majestät konnte sich in einen Spion nicht hineinversetzen, «nichtswürdig. Armer Brühl, wurdest betrogen. Du, der Gescheiteste.»
Der Minister verbeugte sich unmerklich.
«Der gehört ins Loch … gehängt.»
«Wir werden Menzel finden, Majestät. Und ihn seiner Strafe zuführen. Er mag sich mit seinem Judaslohn verstecken, wo er will.»
«Eine der übelsten Verrätereien in der Geschichte», der sächsische Herrscher wiegte den Kopf. «Der Schuft öffnete mit seinen verbotenen Schlüsseln dem blutigsten Durcheinander auf dem Kontinent Tür und Tor. Und wer ahnt schon alle Folgen? Wird Preußens Marschtritt in Deutschland nun den Ton angeben? Oder ein Dresdner Menuett?»
«Menuett, Sire, unser Menuett.»
«Wie schön. Aber zuerst müssen wir noch siegen.»
«Eine kleine Frage der Zeit, Sire. Und des Durchhaltens.» Der Minister lächelte und war erstaunt. So gesprächig, so politisch hatte er seinen Herrn selten erlebt.
«Ist Friedrich der bessere König? Oder bin ich es?»
«Sire, was für eine Frage.»
«Nun, die kann ein Untertan schlecht beantworten.»
Brühl zuckte zusammen.
«Darüber müsste ich mich mit Friedrich allein unterhalten. Was zählt? Sein Drill, seine Schlauheit? Oder meine Nachsicht?»
«Euer Majestät haben nach unendlichen Mühen, unter größten Kosten die Sixtinische Madonna erworben. Ganz im Sinne Eures seligen Vaters August des Starken ist Dresden zu einer der glanzvollsten Metropolen geworden.»
«Dafür hast du auch manches getan, Brühl. Meine Canalettos hast du dir für deine Galerie ein zweites Mal malen lassen.»
«Sire, was Euch und Eurem Kunstverstand gefällt, das sollte man selbst vor Augen haben.»
«Um sich darin zu vertiefen, ja, zu versenken. Man muss lange vor einem Rembrandt sitzen, um seine Schattierungen als eine Botschaft zu erkennen.»
«Sehr wohl, Sire. Auch das ist mehr als wahr.»
«Wahr? Wir wissen fast nichts, Brühl.»
«Solch höchste Erkenntnis, Sire, darf ich mir als Euer leitender Minister nicht leisten.»
Herr und Ratgeber lächelten.
Von Festungsbäumen troff Regenwasser.
«Es tut wohl, mit dir zu plaudern, Brühl. In diesem schrecklichen Idyll.»
«Kann ein Idyll schrecklich sein, Sire?»
«Will Er mich belehren?»
«August der Nachsichtige ist auch August der Weise.»
Nach jahrzehntelanger Gewöhnung glitt manche Schmeichelei am König wie unbemerkt ab.
«Ich kann nicht ohne Orchester leben!» Friedrich August ging ein paar Schritte. «Es ist ein Hundeleben ohne Musik. Kein Pillnitz, kein Moritzburg. Mein Tizian, Veroneses Venus nicht da. Statt auf die Jagd zu gehen, nun selbst gejagt. Unerhört.» Friedrich August wankte fast vor Empörung. «Keine Bordoni in der Nähe, die mir einen Hasse oder meinetwegen einen Händel singt … Hasse ist galant und hat Schmelz. Händel mag kühnere Einfälle haben, aber klingt oft spröder. Der eine gleicht einem Italiener. Der andere ist deutscher, wilder … Nichts zu lauschen. Was soll das alles noch? Wann schlagen deine Russen und Franzosen oder sonst wer zu?»
«Eilen herbei, Sire. Und für Musik ist gesorgt. Zumindest ein kleines Amüsement zu schwerer Stunde. Für alle.» Graf Brühl wies auffordernd geradeaus.
Nun doch ein wenig neugierig setzte der Monarch seinen Weg über das Festungsplateau fort.
Das Gefolge hinter ihm und seinem Minister hatte sich längst formiert. Adjutanten und die Leibwachen mit ziselierten Hellebarden hatten sich als Eskorte in Bewegung gesetzt. Kammerherren und Kammerjunker fröstelten. Vom polnisch-litauischen Hochadel harrte vornehmlich Karol Stanisław Radziwiłł auf dem Königstein aus und bekundete seinem König die Treue. Als Schwertträger von Litauen und als Patriot verpönte der junge Mann westliche Kleidung. Über seinem reich bestickten Żupan trug Radziwiłł zu roten Stiefeln aus Saffianleder den purpurfarbenen, bodenlangen Kontusz mit Silbergurt. Der Pole wusste, dass am augusteischen Hof die Tracht der östlichen Magnaten beeindruckte. Radziwiłł interessierte sich jetzt aber weitaus mehr für das Militärische, für den preußischen Aufmarsch, die sächsische Verteidigung und was die nächsten Stunden und Tage brächten. Einen siegreichen oder einen von den Preußen gefangen genommenen König von Polen? Den sie dann als Geisel nach Warschau verkauften. Unausdenkbar, aber was war in diesen Zeiten nicht vorstellbar? Würde der polnische Kronrat für Friedrich August ein Lösegeld zahlen? Gold aus Polen? Das bekam selten jemand in die Hand. Andersherum war es üblicher. Durch keinerlei Erbrecht, sondern überwiegend durch Bestechung – wie von alters her – war der Deutsche zum König von Polen gekürt worden. Dort besaß er über die Großen mit ihren eigenen unverbrüchlichen Rechten und über das riesige Land, das sich fast bis zum Schwarzmeer ausdehnte, wenig Macht. In Polen taten die Fürsten, Senatoren und Bischöfe nebst ihrem Anhang weitgehend das, was sie wollten. Allerdings zeichnete ein Amt am Warschauer Hof aus, machte nobler. Und in Dresden, der anderen Residenz Friedrich Augusts, erwarb sich der Nachwuchs der Czetwertyńskis, Potockis, Sapiehas und Radziwiłłs den letzten gesellschaftlichen Schliff. Die Gesetze der polnischen Adelsrepublik, die zugleich eine Monarchie war, erlaubten es nicht, jenseits ihrer Grenzen dem bedrängten Halbherrscher Hilfstruppen zu schicken. Das war für den König jetzt misslich.
Karol Radziwiłł wollte für ihn kämpfen.
Friedrich August bürgte immerhin für eine gewisse Ruhe und Ordnung in Polen. Seine Herrschaft war eine Friedensherrschaft gewesen. Und hatte durch viele Bauten Warschau verschönert.
Friedrich August stand für das vor Jahren aufgekommene Sprichwort: Unter den Sachsen iss und trink und schnall den Gürtel locker. So hatten sich Deutsche im Ausland, hatten sich Fremde in fremden Landen nicht durchwegs verewigt. Die Devise galt zumindest für die Wohlhabenden.
Zum Teufel mit den ruppigen Preußen.
Der höfische Zug passierte das Brunnenhaus. Die Garde du Corps hatte die Hellebarden geschultert. Barfüßige Kinder liefen voraus und hinterdrein. «Vivat!», rief ein Kanonier. Andere noch korrekt uniformierte oder schon zerlumpte Kämpfer zogen den Dreispitz und verbeugten sich. Rossknechte führten Pferde zur Schmiede. Jenseits des Obstgartens, der zum Gutteil schon zu Brennholz geworden war, erhob sich das Turmdach der Friedrichsburg. Dieses Gebäude, das direkt an der Schanze errichtet worden und wie über dem Elbtal schwebte, hatte August der Starke für seine Visiten auf der Festung zum Lustpavillon umgestalten lassen.
«Was hast du denn vor, Brühl?»
«Die Leute haben sich wahrscheinlich schon alle versammelt. Sie wollen bei Laune bleiben.»
«Aha. Es sei.»
Trotz einer angedeuteten kleinen Zerstreuung im schrecklichen Idyll bewegte sich der beleibte Monarch nicht schneller. Vielmehr verharrte er alle paar Schritte und schüttelte den Kopf.
Ein Offizier im Brustharnisch hinter Seiner Majestät stach besonders ins Auge. Seine hohen Stiefel glänzten blank. Trotz der Erschöpfung, die ihm ins Gesicht geschrieben stand, konnte er noch immer den Blick auf sich ziehen. Sein Teint war dunkel, geradezu exotisch. Generalfeldmarschall Friedrich August Graf von Rutowski war ein Halbbruder des Königs. Er entstammte der langlebigen Leidenschaft des gemeinsamen Vaters, des starken Augustus Rex, für Fatima, eine Türkin, die nach den Balkankriegen in Dresden gestrandet war und in Elbflorenz Karriere gemacht hatte. Parallel und zwischenzeitlich hatte Fatima neben den Favoritinnen, der Gräfin Esterle, dann der Gräfin Cosel, die Freuden und Pflichten einer Mätresse durchlebt. Ein Kind aus dieser Beziehung hatte der König als rechtmäßigen Sohn anerkannt und zum Grafen erhoben. Durch eine spätere Ehe seiner Mutter war er ein Rutowski geworden und hatte die militärische Laufbahn eingeschlagen. Der Generalfeldmarschall galt als der fähigste Mann im sächsischen Heer.
Rutowski vernahm den fernen vereinzelten Kanonendonner aus dem Tal und wusste ihn einer feindlichen oder einer eigenen Batterie zuzuordnen.
Entgegen allen Usancen hielt der Offizier den Minister Brühl kurz am Umhang fest. «Sie müssen ihm reinen Wein einschenken. Unsere Soldaten beginnen zu desertieren.»
«Aus der preußischen Knechtschaft laufen doch viel mehr Männer davon.»
«Brühl!», insistierte der Oberbefehlshaber: «Sie haben meine Armee zu Tode gespart. Sie haben uns wehrlos gemacht. Nun droht das Resultat, die Katastrophe.»
«Wir haben, Rutoswki, unsere Friedfertigkeit bewiesen.»
«Nein, Dummheit und Bankrott.» Den erregten Halbbruder des Monarchen durfte der Premierminister nicht scharf rügen, schon gar nicht jetzt dessen Entlassung betreiben. Man brauchte jeden und musste zusammenstehen.
«Ausbruch, Brühl, heute Nacht. Oder es ist aus.»
«Nachher, Rutowski, im Kriegsrat. Sie legen es ihm dar.»
«Bei guten Nachrichten Sie. Aber jetzt ich?» Der Befehlshaber schäumte vor Wut, bezwang sich jedoch.
Immer mehr Volk, Militär und Fuhrknechte, elend oder noch passabel bei Kräften, das getreue Ehepaar von Vitzthum, einige sorbische, elsässische Söldner, Hunde, Feldschere, Bader, Verwundete, die gestützt wurden, strömten in Richtung des Lustpavillons.
Das letzte Fest Sachsens?
«Ballett wird es wohl nicht geben?», fragte der König. «Ich mag solche Ausflüge ins Ungewisse eigentlich nicht.»
Abermals musste die Eskorte neben ihm verharren.
«Brühl, ich habe heute Nacht nachgedacht.»
«Sire.» Der Lenker des Staats stand wieder neben ihm und lächelte aufmunternd. So, wie es immer sinnvoll war und wie es sich über Jahrzehnte bewährt hatte. Heinrich von Brühl hatte es stets vermocht, verbindlich zu werden. Seine Miene bewies auch jetzt jedermann Leutseligkeit und die größte, wohlwollende Aufmerksamkeit. Zur Kunst des Diplomaten und Politikers, der in Europa bisweilen maßgeblich war, Bündnisse schmiedete, Gegner in eine Falle lockte, der Sachsen und Polen zu einer Großmacht vereinigen wollte und der in seinem Palais die Welt empfing, zu eben dieser Kunst des kultivierten Staatsmanns gehörte es auch, trotz des Lächelns sämtliche Unwägbarkeiten des Schicksals in Rechnung zu stellen. Einmal war der Herrscher nicht geneigt, sich auf Politik zu konzentrieren. Dann wieder zeigte das Kaiserhaus in Wien sich störrisch, Zollfreiheit für sächsische Waren in Böhmen und Mähren zu bewilligen. Plötzlich machte sich wiederum in Versailles Madame de Pompadour dafür stark, den französischen Dauphin mit einer sächsischen Prinzessin zu vermählen. Sachsen spielte, auch durch ihn, Brühl, eine erhebliche Rolle in der Gemengelage Europas. Und zwischen den endlosen Herausforderungen, Frieden mit Macht und Wohlstand zu verbinden, war es das Beste, sich zu vergnügen. Bis wieder mehr Licht am Horizont erschien. Ja, dies durfte man die Brühlsche Methode nennen: Sondieren, abwarten, gelegentlich handeln, zu einem Maskenball raten und auch noch jetzt nicht vollends zu verzagen.
«Ich habe doch heute Nacht, Brühl, tatsächlich ganz und gar nicht zusammenbekommen, mit welchen Titeln und Ämtern, mitsamt ihren Einkünften, ich dich über die Jahre bedacht habe. Du hattest immer einige Vorschläge dafür.»
Was war das nun für ein nächtlicher Einfall gewesen? Gewiss, auch der König schlief in diesem Notquartier schlecht. Aber konnte er nicht an die Jagd in Moritzburg denken, eine Melodie von Johann Adolf Hasse summen? Das Gesicht des Reichsgrafen verschattete sich jetzt doch.
«Nun, Brühl?»
«Premierminister Eurer Majestät.»
«Das weiß jeder. Aber sind doch noch viel mehr Posten, die dir andere ankreiden. Friedrich soll dich für deine schönen Titel geradezu hassen. Nennt er nicht sein Reitpferd Brühl?»
«Der König von Preußen hat nur gute Rösser.»
«Ich will’s mal hören!»
«Geheimer Kabinett- und Konferenzminister Eurer Majestät.»
«Schön. Dann?»
«Obersteuer-Kammerdirektor der Stifte Naumburg und Merseburg.»
«Damit bist du fast schon geistlich.»
Mit zwei Fingern winkte der König auffordernd.
«Kapitular des Hochstifts Meißen und Propst zu Budissin, Euer Majestät.» Der vielfach Geehrte musste selbst nachsinnen, und das im Zustand der Belagerung. «Obersteuereinnehmer von Zeitz, glaube ich. Direktor der Meißner Manufaktur.»
«Du bekommst die Kostbarkeiten gewiss etwas preiswerter. Es sei. Da war doch noch etwas besonders Klangvolles, hatte mit der Weichselmündung bei Danzig zu tun.»
«Majestät, ein Verhör?»
«Aber nein. Interesse.»
«Generalkommissarius der Baltischen Meerpforten.»
«Hui. Ich bin nur König und Kurfürst. Insgesamt?»
«Ich weiß es zur Stunde und hier nicht exakt, Sire. Es sind ungefähr dreißig Ämter, mit denen Euer Majestät mich huldvoll betraut haben. Die Einnahmen sind jederzeit einzusehen.»
«So soll es sein, Brühl. Ich will keinen Hungerleider als meinen wichtigsten Mann. Und bis jetzt sind wir doch gut zurechtgekommen, nicht wahr, Brühl?»
«Mein Leben für Euch.»
Die Hutfedern Seiner Majestät hingen feucht. Nun summte Friedrich August doch. Aber welche Melodie? Sie schien ihm zu gefallen. Mit dem Stock gab sich der Herrscher immer präziser den Takt vor. Brühl lächelte zustimmend, aber ratlos. So wandte sich der Monarch um. Der Tross der Belagerten hinter ihm war beachtlich und wuchs noch an. Hofmeister, Geheime Räte, Heiducken, Pagen. Ja, der Leibkoch mit dem Leibkonditor. Summend prüfte der König seine Begleitung zu einem Amüsement. Der prangende Premier dicht hinter ihm, auch nicht mehr so schlank wie früher, kannte sich besser mit Rittergütern aus, die er günstig erwerben konnte, als mit Kompositionen in D-Dur. Auch der geliebte Halbbruder, Generalfeldmarschall Rutowski, kam für musikalische Fragen nicht in Betracht. Der König summte lauter, fand den Fortgang des jubelnden Chores. Wie war es mit der alten Friesen, die sich an jeden und alles erinnerte? Er winkte die Witwe heran. Beglückt beeilte sich die bewährte Hofdame und machte ihren Knicks. «Friesen … Damals in Leipzig. Zu meinem Geburtstag. Auf dem Markt, da wurde doch eine Kantate aufgeführt.»
Frau von Friesen musste sich nicht lange besinnen. «1734. Einem Trompeter, Sire, ging die Luft für die klingende Pracht aus. Er sank mit dem Schlagfluss tot um.»
«Was war denn das noch? Jetzt will mir die Melodie nicht mehr aus dem Kopf.»
«Wohl ein Werk des Thomaskantors, Sire. Johann …», sie sann nach, «… Bach. Er hat dieselbe Musik dann noch einmal für einen Weihnachtschor benutzt.»
«Jauchzet, frohlocket», wusste an Rutowksis Harnisch vorbei der Hofkämmerer von Dieskau zu ergänzen.
«Aber damals wurde ich mit anderen Worten besungen.»
Dieskau und Friesen sahen sich an, grübelten. Die nächtliche Festmusik lag gut zwanzig Jahre zurück. «Prr… Preise.» «Dein Glücke …» Die Anwesenden trieben die Zeugen von damals mit Blicken geradezu an.
«Ja», die Witwe unter ihrer Umhangkapuze und der Kämmerer nickten. Gemeinsam schöpften sie die Leipziger Kantatenverse aus ihrem doch fabelhaften Gedächtnis und sprachen, ja intonierten ungeschult, doch geradezu im Duett:
«Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen,
Weil Gott den Thron deines Königs erhält.
Fröhliches Land,
Danke dem Himmel und küsse die Hand,
Die deine Wohlfahrt noch täglich lässt wachsen
Und deine Bürger in Sicherheit stellt.»
Heinrich von Brühl räusperte sich, er applaudierte.
Die Polen, der Koch und einige Höflinge taten es ihm gleich.
Von einem Läufer wurde Oberbefehlshaber Rutowski zum Generalstab gebeten. Mit einem Schwenken seines Huts entschuldigte er sich. Hoffentlich war ein Kurier der Österreicher eingetroffen. Ein gemeinsames Angriffssignal hatte mit ihnen immerhin vereinbart werden können: Ein Kanonenschuss von der Festung. Wenn nur nicht wieder Regen, Gewitter, vor allem Donnergrollen die Mitteilung an Browne übertönten.
Das behelfsmäßige Amüsement, das unter Federführung Brühls und einiger Hofbeamter arrangiert worden war, verblüffte den Monarchen und jedermann. Vor dem Pavillon mit seinen beiden geschwungenen Freitreppen hatte sich das Gros der Garnison versammelt. In einem Halbrund vor dem Lusthaus standen und hockten Kompagnien, stützten Unversehrte leicht Verwundete, zwischen ausgemergelten Offizieren suchten Marketenderinnen und Tagelöhner einen Platz, Hunde strolchten durch die Menge und schnüffelten an Beinen und schmutzigen Stiefeln.
«Nach langen Tagen der Not soll sich jeder ein wenig erfreuen», erklärte der Minister.
Der König nickte, straffte sich und schritt durch seine Kämpfer und Getreuen voran. Wer es vermochte, erhob sich. Friedrich August II. grüßte nach links und rechts. Es war nicht die Stunde, die Lage und der Ort, um in lauten Jubel auszubrechen. So nah waren sich der Herrscher und die Seinen noch nie gekommen. Mit Blicken ermunterten der König und die Königsteiner Besatzung einander, versicherten sie sich ihres Zusammenhalts. Gehöriger Abstand war jedoch vonnöten. Überall in der Menge wurde gehustet und waren Gesichter fiebrig von der Influenza, die unter den Belagerten grassierte. Eine Waschfrau ergriff den Umhangsaum des Monarchen, küsste ihn und fiel in Ohnmacht. Ein Hauptmann fing sie auf.
Vor dem gemeinen Volk und zu Füßen der Treppen waren Bänke aufgestellt, welche einer Prinzessin von Sachsen-Gotha-Altenburg, den von Vitzthums und weiterem Adel vorbehalten waren. In der Mitte der Sitzgelegenheiten nahm der König auf dem großen Lehnstuhl aus dem Festungsgewölbe Platz. Die Hellebardiere postierten sich zu beiden Seiten des Baldachins.
Der Hausmarschall klatschte in die Hände.
Aus den Fenstertüren des Pavillons trat eine merkwürdige Schar und nahm Aufstellung auf der Empore. Seite an Seite postierten sich Militärmusikanten mit Schellenbaum und Pauke, andere Gestalten, Spielleute mit Dudelsack, Fidel, Tamburin und Drehleier.
«Brühl?», fragte der König.
«Sie haben tüchtig geprobt.»
Der Schellenbaum gab den Einsatz. Eines der erstaunlichsten Konzerte begann. Zuerst ein Bläsersignal, die Drehleier setzte mit durchdringendem Ton ein, Schalmei, Tamburin, Dudelsack und Fidel erklangen, der Tambourmajor gab den Takt vor. Was zuerst als infernalisches Getöse den Burggarten erfüllte, in den Ohren schmerzte wie eine aus den Fugen geratene Jahrmarktsmusik, verband sich – in unvergleichlicher Besetzung – zu einem lebhaften, alsbald forschen Tanz. Zuhörer lachten und applaudierten in den Rabatz hinein. Die Altenburger Prinzessin wischte sich eine Träne von der Wange: «Nein, wie viel echter und beaucoup plus charmant als die Bauernmaskeraden bei Hof.» Einige rundum hakten sich unter, johlten und wünschten sich einen Freitrunk oder wenigstens ein Stück Brot.
Eine getragene Melodie, doch mit kräftigen Schüben begann.
Bewegt umarmte Karol Stanisław Radziwiłł einen Landsmann.
Die Polen weinten.
«Ah», rief der König, «eine Polonaise.»
Alle wirkten bezaubert.
«Als mein Vater König von Polen wurde», Friedrich August wandte sich um zur Freifrau von Friesen, «hörte er in Warschau erstmals eine Polonaise. Der Tanz gefiel ihm so gut, dass er ihn auf dem Dresdner Fasching wiederholen ließ. Seither hat die Polonaise die Welt erobert. Vielleicht einer der schönsten sächsischen Triumphe.»
Der Himmel bewölkte sich regenschwer.
Musik und Donner vermischten sich.