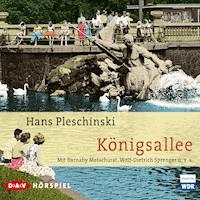11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Die drei Geschwister Berg – Clarissa, Monika und Ulrich – machen ein vertracktes Erbe. Ihr Onkel Robert bedenkt sie mit gewaltigen und weit verzweigten Vermögenswerten, allem voran mit einer Villa am Starnberger See. All dies könnte sie auf einen Schlag von ihrem ermüdenden, nicht unbedingt aussichtsreichen Existenzkampf befreien. Aber er macht ihnen eine Auflage: Sie müssen dieses Haus als Hort und Zufluchtsort für Lebensmüde betreiben und ihnen auch das eine oder andere nützliche Utensil bereithalten; nicht nur rechtlich eine Gratwanderung. Voller Skrupel und Ängste, aber auch scharf aufs Erbe öffnen die Geschwister die Villa an der Ludwigshöhe für eine stetig wachsende Zahl von „Finalisten“. Da findet sich eine verzweifelte Verkäuferin neben dem Bühnenbildner mit gewissen körperlichen Defiziten ein, eine ausgebrannte Lehrerin neben einer vereinsamten Schauspielerin, eine medikamentenabhängige Witwe neben der liebeskranken Domina, ein bankrotter Verleger, aber auch eine erst 17jährige syrische Immanitin, die Angst hat, Opfer eines Ehrenmords zu werden. Während die Geschwister den Keller des Hauses mit praktischen Kühltruhen füllen, machen die Moribunden fast gar keine Anstalten mehr, ihrem dunklen Drang zu folgen. Die alte Villa erlebt ein Fest des Lebens – der kuriosen Beziehungen, Gespräche, Annäherungen und Abstoßungen, neuer Liebe und Lebensmutes – wie es als frisches, zeitgemäßes Panorama und in brillant-unterhaltsamer Form nur Hans Pleschinski inszenieren kann.
Ein großer Roman, der ein ebenso präzises wie farbiges Bild des gegenwärtigen Lebens bietet, der Versagungen, Überforderungen und Zwänge, aber auch der Wünsche, Sehnsüchte und der Möglichkeiten, die dem Dasein auch abzugewinnen sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Hans Pleschinski
Ludwigshöhe
Roman
C.H.Beck
Zum Buch
Die drei Geschwister Berg – Clarissa, Monika und Ulrich – machen ein vertracktes Erbe. Ihr Onkel Robert bedenkt sie mit gewaltigen und weit verzweigten Vermögenswerten, allem voran mit einer Villa am Starnberger See. All dies könnte sie auf einen Schlag von ihrem ermüdenden, nicht unbedingt aussichtsreichen Existenzkampf befreien. Aber er macht ihnen eine Auflage: Sie müssen dieses Haus als Hort und Zufluchtsort für Lebensmüde betreiben und ihnen auch das eine oder andere nützliche Utensil bereithalten; nicht nur rechtlich eine Gratwanderung. Voller Skrupel und Ängste, aber auch scharf aufs Erbe öffnen die Geschwister die Villa an der Ludwigshöhe für eine stetig wachsende Zahl von „Finalisten“. Da findet sich eine verzweifelte Verkäuferin neben dem Bühnenbildner mit gewissen körperlichen Defiziten ein, eine ausgebrannte Lehrerin neben einer vereinsamten Schauspielerin, eine medikamentenabhängige Witwe neben der liebeskranken Domina, ein bankrotter Verleger, aber auch eine erst 17jährige syrische Immanitin, die Angst hat, Opfer eines Ehrenmords zu werden. Während die Geschwister den Keller des Hauses mit praktischen Kühltruhen füllen, machen die Moribunden fast gar keine Anstalten mehr, ihrem dunklen Drang zu folgen. Die alte Villa erlebt ein Fest des Lebens – der kuriosen Beziehungen, Gespräche, Annäherungen und Abstoßungen, neuer Liebe und Lebensmutes – wie es als frisches, zeitgemäßes Panorama und in brillant-unterhaltsamer Form nur Hans Pleschinski inszenieren kann.
Ein großer Roman, der ein ebenso präzises wie farbiges Bild des gegenwärtigen Lebens bietet, der Versagungen, Überforderungen und Zwänge, aber auch der Wünsche, Sehnsüchte und der Möglichkeiten, die dem Dasein auch abzugewinnen sind.
Über den Autor
Hans Pleschinski, geboren 1956, lebt als freier Autor in München. Er veröffentlichte u.a. die Romane „Leichtes Licht“ (C.H.Beck, 2005), „Ludwigshöhe“ (C.H.Beck, 2008) und „Königsallee“ (C.H.Beck, 2013), der ein Bestseller wurde, und gab die Briefe der Madame de Pompadour, eine Auswahl aus dem Tagebuch des Herzogs von Croÿ und die Lebenserinnerungen von Else Sohn-Rethel heraus. Zuletzt erhielt er u.a. den Hannelore-Greve-Literaturpreis (2006), den Nicolas-Born-Preis (2008) und wurde 2012 zum Chevalier des Arts et des Lettres der Republik Frankreich ernannt. 2014 erhielt er den Literaturpreis der Stadt München und den Niederrheinischen Literaturpreis. Hans Pleschinski ist Mitglied der Bayerischen Akademie der Künste.
I. Buch
1.
«Waren Sie schon Patient bei uns?» Die Sprechstundenhilfe fand die Antwort auf ihre Frage in ihrer PC-Kartei. «Nehmen Sie bitte im Wartezimmer Platz.»
Ulrich Berg griff eine Illustrierte und setzte sich. Junge Menschen waren offenbar auch in der Zahnarztpraxis von Dr. Gessler rar. Zwei ältere Damen und zwei junge Türkinnen mit Kopftuch vertieften sich wieder in ihre Lektüre, wisperten in ihrer Sprache. Ein Rentner in hellblauem Sakko starrte auf ein gerahmtes Foto von einem Wasserfall.
Für Ulrich Berg war es kein Problem, unbemerkt die schwarzen Karten aus seiner Jackentasche zu ziehen. Unauffällig schob er sie beim Durchblättern der Zeitschrift für Segelsport zwischen die Hochglanzseiten. Mit einem Räuspern legte er Sail & Cruise zurück und nahm sich vom Stapel die Postille der AOK. Noch drei seiner Kärtchen, im Format von Visitenkarten, opferte er für dieses Druckerzeugnis und diesen Ort. Nun konnte auch bei Dr. Gessler ein späterer Patient beim Warten und Blättern das stabile schwarzglänzende Kärtchen in Händen halten und in freundlich geschwungener goldener Schrift lesen:
Es folgte die Telefonnummer.
Lange hatten sie über den Wortlaut gestritten. Wenn Du verstehst, verstehst Du, hatte Monika vorgeschlagen. Doch Clarissa hatte sich durchgesetzt: «Wir haben kein Zeltlager aufgeschlagen. Je distanzierter der Ton, desto wohltuender für alle.» – Beim Gewicht der Mitteilung konnte der Wortlaut niemals angemessen geraten. Letztendlich waren die Fragen und Andeutungen ebenso dezent wie eindringlich formuliert. Wenn Sie verstehen … Frau Fontanelli hatte verstanden und lebte nicht mehr.
Bei Zahnärzten war auf alle Fälle Trostlosigkeit versammelt. Natürlich auf ganz andere Weise als in Arbeitsagenturen. Doch in der Kapuzinerstraße war er bereits um acht Uhr früh gewesen. Im Grunde hätte er für sich selbst dort eine Wartenummer ziehen können.
«Nur den Zahnstein?» fragte von der Tür die Helferin. Ulrich Berg war aufgestanden: «Ich werde nachmittags wiederkommen. Ich hätte fast einen wichtigen Termin vergessen.» Er blickte sich noch einmal um. Eine Muslima im Keller – das hätte gerade noch gefehlt.
Der Mittvierziger war seit einer Woche darin geübt, mit freundlichem Lächeln an Praxispersonal vorbei wieder in Treppenhäuser und ins Freie zu verschwinden. Nur in Garmisch, bei einem Internisten, war ihm eine Praktikantin nachgelaufen. «Ihr Schlüsselbund ist rausgefallen.»
Die Aprilsonne wärmte kaum. Er klappte den Fellkragen hoch und zog die Cordjacke zu. Ein Wind ging. Er hätte es genossen, wenn ihm die dicken blonden Locken vor Stirn und Augen geweht wären. Tempi passati. Das Haar war längst dünner geworden und nur noch wellig. Die Erschlaffung paßte zu den umknitterten Augen, den dünner gewordenen Lippen und den Schulterverspannungen. Im Zusammenspiel machten diese Spuren der Zeit männlicher, jedenfalls hatte Robert Redford diese Deutungsrichtung vorgelebt. Frühere Detaileitelkeiten, die bei selbstgewisser Jugendlichkeit, guten Zähnen, munterem Blick gar nicht nötig gewesen wären, wandelten sich vor dem weiteren Schrumpfen und Vergrauen womöglich zu einer defensiven Gesamteitelkeit.
So weit war es wohl noch nicht.
Die Jeans saß gut.
Ulrich Berg bog in die Maximilianstraße. Die Staatsoper war mit grünvioletten Phantasiefahnen beflaggt. Rechter Hand auf dem Isarhochufer breitete der Bayerische Landtag seine steinernen Arme aus. Die Goldmosaiken schimmerten schwach. Die gesamte Prachtmeile, auch wenn man es nur flüchtig wahrnahm, blieb der beeindruckende Willensakt eines Königs, etwas Imposantes, Schönes und Einmaliges zu hinterlassen. Mitunter konnten Fassaden, Kolonnaden, Illusionen das Leben zusammenhalten, wenn es im Inneren wackelig wurde. Aus dem Schein konnte wieder ein Sein erwachsen. Das war zumindest ein spätmonarchistischer Vorschlag der Wittelsbacher, die Prunkschneisen in Gehölz, Äcker, Dumpfheit und Unwillen geschlagen hatten. Im nachhinein war jeder froh, daß die Steuergelder unerbittlich zu Säulen und Statuen geworden waren.
Ulrich Berg gewahrte die Auslagen bei Vuitton. Einige der Hemdenstoffe, erkannte er, stammten aus den toskanischen Webereien in Prato. Vom Schnitt her waren sie Konfektionsware zum dreißigfachen Preis. Nicht weit davon entfernt hatte Moshammer gewirkt, der schneidernde Wiedergänger des Märchenkönigs. Im Schaufenster, zwischen Schlipsen und Blazern, hatte Ulrich vorzeiten auf einem neobarocken Schemel Daisy, den gleichfalls medienerprobten Yorkshire des erdrosselten Couturiers, schlummern sehen. Der Bayer, der schließlich auch noch Schlager hatte trällern wollen, hatte Mut zu sich selbst bewiesen. Neuere Paradiesvögel erschienen flügellahmer, wurden für immer kürzere Starphasen noch öfter abgelichtet und endeten oft genug in Reihenhäusern. Wo blühte noch belebender Wahnsinn?
Streusplitt der vergangenen Wochen knirschte unter den Stiefelsohlen. Gekehrt wurde offenbar monatlich. Müßiggänger, Kunden, die bei Bulgari, Vuitton und Pralinen-Cordes für ihre Lebensbelohnungen das Geld ließen, waren am Montagmorgen kaum zu sehen. Angestellte an Kassen und vor Regalen ordneten bereits geordnete Zettel und Blusen.
Der Schlag traf ihn in die Kniekehle. Schon schlenkerte der Stockschirm einer Passantin ein Stück vor ihm. Die Frau im Schottenponcho wandte sich nicht einmal um. «Blöde Kuh», zischte er und rieb sich das Gelenk. Vorm Einbiegen ins Kosttor hupte ein Volvo eine Radfahrerin aus dem Weg, die ins Trambahngleis geriet, sich aber wieder fing. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite schaute vor den Vier Jahreszeiten ein Taxifahrer zu, wie eine alte Dame mit Hut und Gehstock in den Fond einzusteigen versuchte.
War es der Wochenanfang?
Kündigte sich Föhn an? Bereits in der S-Bahn hatten einige Fahrgäste so gewirkt, als würden sie es, wenn man ihnen ein Stilett in die Hand drückte, dem Mann oder der Frau gegenüber sofort in den Bauch rammen. Natürlich war die Stimmung im tiefen Winter in den öffentlichen Verkehrsmitteln noch geladener. Dann wußte man oft nicht mehr, was in vielen Gesichtern überwog. Haß oder Selbsthaß. Die Gründe konnte keiner so recht benennen. Freudlosigkeit, Übersättigung, eine neuartige Geschundenheit? Ein so tiefer Grimm trat zutage, daß man fürchten mußte, mit hineingezogen zu werden.
Er wandte sich um. Einige der Lackkärtchen konnte er in der Kulisse deponieren.
Der Modedesigner, mit ein paar Heimaufträgen für Strickwaren von H&M und Escada bedacht, betrat das Café, das den Kammerspielen vorgelagert war. An einem Fenstertisch saß ein TV-Krimikommissar, der mit seinem jüngeren Kripokollegen, beide leger und verständnisvoll, da und dort in München dem Gesetz zu einem Sieg verhalf. Neben einer Tasse, aus der das Teebeuteletikett baumelte, unterstrich der Schauspieler mit Schwung Zeilen auf den Blättern eines zerfledderten Papierstapels. Ein Drehbuch, der Text für eine abendliche Lesung? Auf irgendeine prominente Gestalt stieß man hier immer. In eine rothaarige Frau, natürlich faltiger als auf dem Bildschirm, hatte er einmal unwillkürlich Senta Berger projiziert. Als sie mit ihrem Begleiter ging, hatte sie jedoch spanisch gesprochen und ein Bein nachgezogen. Weiter hinten, am Gang zum Theaterfoyer, frühstückte eine auch durch Interviews mit Fotos bekannte Schriftstellerin. Sie war wegen ihrer sinnlichen Geschichten beliebt. Furiose Jahre in Mexiko wurden ihr nachgesagt, eine schwankende Zahl von Ehen und Liaisons. Jetzt tunkte sie, mit einem Lächeln wie für sich selbst, ein Croissant in den Milchkaffee. Ein pompöser roter Pulli mit weitem Umschlagkragen.
Nach dem frühen Aufstehen trank Ulrich Berg einen Espresso an der Bar. Hunger spürte er nicht. Er schob einige der Kärtchen mit den goldenen Lettern in die Speisekarte neben sich. Reicht es? Reicht es wirklich? … Besonders Künstler, Theaterpublikum, Intellektuelle, empfindsame Menschen waren anfällig und hilfsbedürftig.
Ihnen konnte in diesem harten, schweren, oft unerträglichen Leben geholfen werden. In gewisser Weise. Ulrich Berg wollte nicht über Konsequenzen seines gefährlichen Tuns nachdenken. Verdrängung war ein Göttergeschenk. Und selbst heikelste Zeiten gingen vorüber. Strafrechtlich war er nicht zu belangen. Zumindest wollte er es hoffen. Er starrte auf seine Hände. Entsetzlich! Aber es waren nur Werkzeuge. Er zerkaute das Anisplätzchen, bevor es nach einem Schluck Kaffee unter den Tassenboden rutschte. Gemocht hatte er die Italokiesel noch nie. Hinter der Theke wurde geschäumt, gequirlt und gemixt. Ganz Deutschland schien einem Cappuccino–, Schümli- und Latte-Macchiato-Rausch verfallen zu sein, wobei man nie wußte, ob diese Schlabbergetränke wach oder müde machten.
Egal, völlig. Und auch nicht.
Sein Blick löste sich von dem mollig dickwolligen Rot der Autorin, die mit dem Messer anscheinend einen Klacks Marmelade von ihrer Zeitung entfernte.
Bald würde er wohlhabend, ja reich genug sein, um sich in Brasilien – oder wo auch immer – das Frühstück im Bett servieren zu lassen. In modernem Silbergeschirr. An Trüffelpastete auf dem Toast, frische Langustenteile am Morgen würde er sich sicher rasch gewöhnen. Er müßte dann aufpassen, nicht träge zu werden. Nach einigen Fitnessübungen, Schwimmzügen im Meer könnte er unterm Sonnensegel auf einer Terrasse frühstücken. Es würden sich – in Bahia, Acapulco, auf den Seychellen – Bekannte, Freunde finden, mit denen wechselweise der Brunch verabredet würde. Zwanglos, vor Ausflügen, mit dem Boot.
Eine Kolonne schwarzer BMWs passierte das Café. Wahrscheinlich war der Ministerpräsident mit einem Gast auf dem Weg von der Staatskanzlei, seinem Isar-Kreml, zu einem Landtagsempfang. Zumindest innerhalb des Freistaats, des heldenhaft minimalsouveränen, der aber tatsächlich erheblich größer war als Sachsen oder Rheinland-Pfalz, meinten manche, daß auf solchen Fahrten auch Weltpolitik betrieben würde. In jedem Falle betraf sie mit diesem oder jenem Beschluß den einen oder anderen, und man mußte – was die Unversehrtheit der Person, ihre Würde, die staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten anging – als Wähler immer allerorten wachsam bleiben.
Nein, es war wirklich nicht Senta Berger, die hereinkam. Es war die Spanierin, mit einem orthopädischen Schuh, die offenbar in der Nähe wohnte.
Ulrich legte drei Münzen auf den Thekenmarmor. Einige der Lackkärtchen behielt er für Rückfahrt, Bahnhof und S-Bahn in Reserve. Clarissa hatte alles im Griff. Besonders in diesem Fall war es gut, Macht an die Frauen abzutreten. Sie konnten drakonischer sein. Den Joppenverschluß wieder zu. Köstliche Tafelsülze mit Zwiebelringen wurde an ihm vorbeigetragen. Beim Überziehen der Handschuhe kam es ihm vor, als wären die Stadtteile bereits von Kärtchen überschwemmt.
2.
Schäftlarn-Ebenhausen, im Süden Münchens, wurde bundesweit nicht nur durch sein Forum Wissenschaft und Politik bekannt. Als Teil der Ortschaft Schäftlarn gehörte auch die gleichnamige Benediktinerabtei zu dieser oberbayerischen Doppelgemeinde. Wohlerhalten und gepflegt, beherrschte das Klostergeviert mit prächtiger Basilika und dazugehörigem Biergarten das Isartal und lockte an Schönwettertagen die Ausflügler an, die ihre City-Räder, Mountainbikes, Kawasakis, manchmal Tandems und sogar rikschaähnliche Vehikel vor der Maß oder Apfelschorle mit dicken Ketten am Autoparkplatz abschlossen.
Im Tal, unter den bewaldeten Hochufern und in der Nähe von Fluß und Kieselstränden, lag ein Stück Paradies auf Erden. Wer im Freundeskreis, zu zweit oder auch allein bei Wurstsalat, Krustenbraten, Brez’n und Weizenbier im Schatten von Kastanien ins explodierende Grün schaute und sich dem Alltag entwunden hatte, brach nur widerwillig und immer leicht trunken zur Weiterfahrt oder Heimkehr auf. Wenn man neuerlich in die Pedale trat und schlenkernd steil bergauf radelte, nahm man schon unter Schweiß Abschied. Manche gaben nach Hopfen und Malz und einer halben Ente in Schäftlarn das Strampeln auf und schoben erst einmal. Andere, plötzlich von Sonne, Luft und Weißweinschorlen ermattet, schlugen sich neben der Straße aufs Geratewohl in die Büsche, ließen sich ins Gras sinken und schliefen, oftmals noch mit Fahrradhelm auf dem Kopf. Über die seligen Sommerschlummerer zwischen bayerischem Holunder tönte der Stundenschlag der Benediktinerglocke.
Oberhalb des kleinen Elysiums, wo Eltern nicht mehr ihre tobenden Kinder bändigten, Katzen auf die Bänke sprangen, aus vorbeifahrenden Autos Musik verhallte, oberhalb der Haarnadelkurven und schon jenseits der S-Bahn-Gleise wuchs Ebenhausen ins hügelige Land hinein. Die Zahl der Alteingesessenen war klein. Im oberen Ortsteil hatten sich Manager, Banker und Professoren angesiedelt, die in ihre Konzernzentralen und Universitätsbüros pendelten. Ein energisch-moderner Opernregisseur hatte sich mit seinem Lebensgefährten in Ebenhausen niedergelassen, empfing im früheren Bauernhaus berühmte Dirigenten und Sänger zwischen Inszenierungsmodellen in den Kellerräumen, feierte mit den Künstlern bis ins Morgengrauen. Die Fensterläden waren verriegelt, wenn sein Mieter in London La Traviata, Woyzeck an der Met oder Salome im Mariinski-Theater von Petersburg in Szene setzte. Einmal, nach einem musikalischen Zechgelage, zu dem auf Einladung auch zwei, drei junge Taxifahrer als Liebesengel dageblieben waren, war eine der famosesten Schubertinterpretinnen den Gartenhang hinabgetaumelt und im Frühtau neben einer mittelmäßigen Stahlskulptur wieder aufgewacht. Die Milch wurde von einem Gehöft nebenan morgens vor die Tür gestellt.
Im Ort wirtschafteten weiter einige Landwirte, die Eier- und Gemüsedirektverkauf betrieben, so daß neben Porsches Hennen scharrten und Frühsportler in einem Bogen um eine ehrwürdige Kuh liefen. Bei insgesamt vielleicht dreitausend Einwohnern waren gerade die neueren Anwesen so angelegt, daß die Jogger oder Passanten keinerlei Einblick ins Hausinnere nehmen konnten. Föhrenreihen hinter Jägerzäunen versperrten jede Sicht. Um Terrassen sproß hoher Bambus. Die Metalljalousien mancher Doppelhaushälfte öffneten sich monatelang nicht. Was hinter dem Aluminium stattfand, konnte man gelegentlich nur mutmaßen, und jede Mutmaßung mochte stimmen. Hinter Geranienkästen lebte, verheiratet mit einem Gefäßchirurgen, die Tochter des letzten DDR-Notenbankpräsidenten. Vor Jahren hatte die Polizei einen Mann in seinem vermüllten Haus gefunden, wo er von einem Turm Neue Revue, die er seit 1960 gesammelt hatte, erschlagen worden war.
An der Hailafinger Leite vernahm man an manchem klaren Morgen Richard Strauss’ Alpensinfonie oder Streicherwogen von Anton Bruckner und durfte sich sicher sein, daß hinter der Giebelverglasung beim Anblick der fernen Alpenkette jemand träumte. Im dunklen Berggezack leuchteten noch im Sommer Schneefelder. Und selbst für denjenigen, der diese gewaltige Gesteinsformation im Süden nicht schätzte, für den die Alpen eine abweisende, dumpfe Schluchtenansammlung waren – deren Schroffheit jahrhundertelang nur gefürchtet gewesen war –, selbst für denjenigen, der Bergsport mit verletzungsträchtiger Zeitverschwendung im Naßkalten gleichsetzte, grüßten die Karwendelgipfel schon als Vorposten Italiens. Hinter den Graten und Gletschern lagen Verona, Mantua, spiegelte der Lago Maggiore Palmen. Vielleicht war es ebenso betrüblich wie sinnvoll, daß es Sperren zwischen dem einen und dem anderen Daseinsgebiet gab. Die Felsgrenze brachte Ziele, Wünsche und Selbstbesinnung hervor. Fern oben fauchte ganzjährig ein Wind.
Libellen flimmerten über letzten Pfützen. Ein makelloser Maitag kündigte sich an. Es mochte sechs Uhr sein.
Das Anwesen auf der Ludwigshöhe war sicherlich eines der malerischsten und verschwiegensten am Ort. Sogar wißbegierige Frühaufsteher, die ihren Hund zum Spaziergang geweckt hatten, konnten von der schmalen Asphaltstraße aus kaum abschätzen, ob der Garten sich hinter dem Haus fortsetzte, ob hinter Bäumen die noch feucht schimmernde Teerpappe zum Dach eines Nebengebäudes oder bereits zum Nachbargrundstück gehörte. Die Buchsbaumhecke der Ludwigshöhe 3 gedieh dicht und mannshoch. Kastanienäste und Lärchenzweige ragten, wahrscheinlich gegen die öffentliche Maßgabe, über die Straße.
Bekannt war die Liegenschaft am Ortsrand unter dem Namen Ungarisches Haus. Die Bezeichnung, wenn sie denn irgendwo fiel, rührte von dem ungewöhnlichen Gartenzugang her. Das Tor war aus eng gefügten Latten gezimmert und braun lackiert. Über den hohen geschwungenen Flügeln spannte sich, aus nur einem Balken gearbeitet, ein dunkler Bogen, der durch bunte Schnitzereien die Blicke auf sich zog. Links und rechts der Jahreszahl 1911 sprangen Paare in Trachten Polka oder Csárdás. Die Beine flogen und Bänder wehten. Falls die naive Gestaltung nicht kunstvoll beabsichtigt gewesen war, handelte es sich wohl um einen munteren Schreinerentwurf. Daß es sich bei den Gestalten, die Hände an Hut und Hüfte, um ungarische Mägde und Hirten handelte, ließ sich aus den üppigen Paprikagarben und Sonnenblumen schließen.
Vielleicht hatte ein bayerischer Fabrikant vor dem Ersten Weltkrieg seine ungarische Gemahlin aus dem Süden der k.u.k.-Monarchie durch dieses Tor in ihr neues Heim geleitet. Doch es hatte im Isartal zu jener Zeit auch manches Künstlerrefugium gegeben, sommerliche Unterschlüpfe voller Schaffensdrang, kosmischen Visionen, Amouren mit Dauergästen, Leidenschaften, Hinwendung zum Archaischen, plötzlichen Todfeindschaften, Suff, Verbrüderung und Ernüchterung bei revolutionärem Nacktbaden. Lugte man zwischen Lattenpforte und Ungarntanz hindurch, war am Haus selbst kein fremdartiger Einfluß erkennbar. Gelb leuchtete es durch den alten Baumbestand. Wein umrankte Fenster. Da und dort wucherte er über die Dachschindeln. Das Ungarische Haus wäre nur ein viereckiger Klotz gewesen, hätten der Bauherr und sein Architekt den Fassadenecken nicht zwei Zwiebelhauben aufgesetzt. Spitz endete die linke Haube in einem Blitzableiter, der Wetterhahn auf der zweiten wies bei jeder Witterung festgerostet nach Westen.
Ein Wiesel huschte am Kellereingang vorbei.
«Aaaangst.» Das Schluchzen drang durch einen der grünen Fensterläden ins frühe Grün: «Aangst. Ich habe Angst …» Die Stimme aus dem Innern verlor sich in Wimmern und Stöhnen: «Laßt mich … Helft mir. Schlafen … Aaangst. Ruhe … Aaah.»
Die Wehklage verstummte. Tauben ließen sich auf der Dachrinne nieder, gurrten. Nach kurzer Weile wurde ein Fensterladen aufgestoßen. Ein verschlafenes Gesicht lugte heraus. Eine Hand mit einem Stock wurde sichtbar. Nach einem dröhnenden Schlag gegen die Regenrinne schwirrte die Taubenplage zwischen den Wipfeln auf und davon. Der Haustürflügel war angelehnt. Eine Katze glitt über die Schwelle. Sie fand die gefüllte Milchschüssel auf dem obersten Treppenhalbrund. Beim Schlecken und Putzen im ersten Sonnenschein behielt sie beide Gestalten im Vorgarten im Auge.
Links vom Mittelweg kniete ein Mann unter der Blutbuche. Er trug einen dunklen Mantel und Schal. Reglos starrte er auf den Boden. Schließlich beugte er sich vornüber. Er stützte sich mit beiden Händen ab und ließ Kopf und Stirn langsam aufs Erdreich sinken. Seine Finger griffen, krallten sich ins feuchte Dunkle. Er sog den Duft des Humus ein. «Zu dir, zu dir, Mutter.» Er preßte seine Lippen auf Krumen und Gras. «Gute – Friedliche – Fürsorgliche …» Er streckte sich der Länge nach aus, umfaßte einige Buchenwurzeln und drückte, mit einem Lächeln, seine Wange auf die Erde. Liebkosend verharrte er.
Auf der gegenüberliegenden Seite des holprigen Gartenwegs, neben der alten Remise, plätscherte im Sonnenlicht ein Wasserstrahl ins Rund des Beckens. Vor seinem bemoosten Granitrand hockte eine Frau in langem roten Kleid auf einem Tuch. Langsam senkte sie mit geschlossenen Augen ihr Gesicht ins Wasser. Lange hielt sie es, ohne daß Luftblasen aufstiegen, zwischen die Seerosen getaucht. Mit einem Keuchen, bei dem sie ihr nasses blondes Haar nach hinten strich, zog sie ihr Gesicht wieder aus dem Nass. Wasser rann und perlte von der Haut. In stiller Ekstase murmelte die knapp Vierzigjährige: «Ich bin alles … Ich bin nichts … Alles löst sich auf. Wie gut. Selig!» Nach einem kräftigen Durchatmen tauchte sie ihren Kopf, das Haar im Nacken, erneut ins Becken.
Der Vogelgesang wurde vielstimmiger.
Die Katze räkelte sich auf der abgewetzten Fußmatte. Mit einem Satz war sie auf den Pfoten, fauchte und machte einen Buckel.
«Guten Morgen, Chouchou. Schon gefrühstückt?» Der Buckel entspannte sich, das Tier schnurrte um ein Bein. Eine Frau im weißen Morgenmantel und in Pantoffeln sprach nach hinten ins Hausdunkel: «Furchtbar. – Herr Lehmann hat es gewagt. Das hätte ich nicht gedacht.»
«Die Stillsten sind oft die Entschlossensten», vernahm man von innen.
«Auch auffällige Fröhlichkeit verbirgt Abgründe. Ich kenne das von einer Kollegin.»
«Herr Lehmann war Steuerberater», sagte die männliche Stimme aus dem Unsichtbaren.
«Das bedeutet gar nichts, Herr Deutler. Wer ahnt, was sich in ihm abspielte.» Die Frau in notdürftiger Gewandung winkte in den Hausflur: «Sind Sie soweit? Kommen Sie.»
«Schulden? – Melancholie? – Die Frau weggelaufen? – Betrügereien?» Die Stimme klang knabenhaft.
«Er sprach nicht mehr», die Frau hob die Hände, «das ist es ja. Das Verstummen ist der Vorbote. Manchmal sind es aber auch die Worte, auf die keiner achtet … Als ich gegen drei die Schritte, das Knacken hörte, dachte ich mir nichts dabei. – Kommen Sie endlich? Es ist jetzt hell.»
«Wir sollten warten, Frau Hoffmeister, wir sollten die anderen wecken.» Barfuß tappte Olaf Deutler aus dem Haus. Er trug nur Jeans. Sein magerer Oberkörper war unbehaart. Groß und tief lagen die Augen unter einem geschorenen Schädel. Seine Nasenflügel bebten. Der junge Mann hatte unruhig geschlafen.
«Nein, nicht gleich noch mehr Panik stiften.» Die Frau, die seine Mutter hätte sein können und sich ein weißes Handtuch zum Turban gewunden hatte, faßte ihren Begleiter bei der Hand: «Lassen Sie schlafen, wer schlafen kann. Es könnte die letzte Nacht sein.»
«Entsetzlich.»
«Das ist ein bißchen unpassend, Herr Deutler.»
«Arzt holen?»
«Dürfen wir nicht.»
«Was nun, Frau Hoffmeister? – Abschneiden?»
Für einen Moment blieben die Frau in Weiß und ihr Zimmernachbar, den sie – nach ihrem Spähen in den dämmerigen Obstgarten – wach geklopft hatte, unter der Türlaterne stehen. Bei der Blutbuche erkannten sie Herrn Kipphard, der die Wange ans Erdreich schmiegte. An der Fontäne übte sich Ute Wimpf in ihrer finalen Wassersymbiose.
Die Realschullehrerin aus Augsburg hatte sich Hilde Hoffmeister gegenüber in wenigen gehaspelten Worten als «leer» und «ausgebrannt» bezeichnet. Schüler hätten ihr nicht nur «mit Pfefferspray» aufgelauert, sondern ein «verkommener Zehntkläßler mit ebensolchen Eltern hat mir mit einer Schere ins Bein gestochen … Aus Leidenschaft» sei sie Pädagodin geworden, nun habe sie Lust, «Zehn- bis Sechzehnjährige zu erschießen, einige, die einfach eine Glastür eintreten, auf dem PC Pornofotos des Kollegiums herstellen, beim Schulabgang Go to hell Schaiss Knahst in den Korridor schmieren», war es zornesrot aus ihr herausgepoltert. «Natürlich ist Augsburg-Oberhausen ein brenzliges Viertel.» Verrottet seien aber vor allem die Seelen. «Als eine Kollegin sich gegen den späteren Scherenstecher zur Wehr gesetzt hat, ist sie von dessen Eltern angezeigt und dann verhört worden. Bei solcher Verrohung und allgemeinem Desinteresse, die auch die Gutwilligen mit ins Tiefe und Blöde drücken», habe es keinen Sinn gehabt, als Geschichtslehrerin … «die Idee eines einigen Europas auch nur anzudeuten. Nur noch mit Herzflattern und Tranquilizern» habe sie die Klassen betreten. Eine andere Kollegin sei nach privaten und schulischen Fiaskos «vor den Zug gesprungen». Keinesfalls würde sie, Ute Wimpf, alle Schüler in einen Topf werfen, «nie und nimmer. Es gibt die freundlichen Gemüter und ein paar willensstarke», insgesamt aber hätten die Unfähigkeit zur Konzentration und die Neigung zu Gewalt ein Ausmaß erreicht, «vor dem ich kapituliere … Sie werden im Unterricht einfach angerülpst.» Eine Schere in der Wade. Itallien mit Doppel-L. Eltern, die an Saumseligkeit und Trägheit ihre Kinder noch überböten. – «Niedersachsen hat in Grundschulen Schlummerecken für Schüler eingerichtet, die sich überfordert fühlen.» – Wie solle da die Zukunft noch gemeistert werden? Hilde Hoffmeister und Olaf Deutler sahen, wie die nun ganz ruhige Lehrerin ihren Kopf im Zeitlupentempo wieder ins Naß des Granitbeckens senkte. Beinahe lustig plätscherte über dem Nacken das Wasser aus dem Rohr.
«Alles schon sehr extrem, Frau Hoffmeister.»
«Darauf kommt es nicht mehr an, Herr Deutler.»
«Wir leben noch.»
«Ein bißchen.»
Die Zimmernachbarn stiegen in Pantoffeln und barfuß die Steinstufen hinab.
«Ich meinerseits schaff’s nicht, Frau Hoffmeister.»
«Das Leben? Oder das andere?»
«Sie sind eine willensstarke Frau.»
«Keine drei Monate ist es her, daß ich in die Klapse eingeliefert wurde. Eine lange Geschichte. Plötzlich, nein, nach und nach kannte ich mich selbst nicht mehr. Ich habe auf dem Geburtstag meiner Schwiegertochter das Geschirr zertrümmert. Ich habe die Gläser aus dem Wandschrank geschnappt und an die Wand geworfen. Eines nach dem anderen. Alle saßen erstarrt da. Ich habe zu Hause weitergewütet. Die Hormone? Aber sie hat mir vor zwanzig Jahren meinen Sohn weggenommen und einen Waschlappen aus ihm gemacht, der für jeden Schritt ihre Erlaubnis braucht. Soll die Niete doch. Ich habe alles satt.»
«Alles?»
«Ein Abenteuer bleibt mir noch.»
«Ein wunderschöner Morgen. Ein Geschenk des Himmels. Ist das ein Wiedehopf, Frau Hoffmeister? Mit rotem Schopf.»
«Da kenne ich mich nicht aus.» Die recht kräftig gebaute Frau schritt voran, der um einen halben Kopf kleinere Olaf Deutler lief ihr hinterdrein. Sie wandten sich in Richtung Obstgarten und passierten die Regentonne. Die Gehplatten lagen schief und erzwangen Schritte durchs feuchtkühle Gras. Hilde Hoffmeister wich Nacktschnecken aus. Hinter ihrer Schulter zuckten Olaf Deutlers Gesichtszüge.
«Vielleicht war er krank.»
«Er war verstummt. Er hat sich aufgegeben.»
«Freiwillig, Frau Hoffmeister, nicht.»
«Sie krabbeln so hinter mir her.»
«Ich krabble nicht. Ich bin ein Mensch.» Der dürre halbnackte Bühnenbildner mit hochgekrempelten Hosenbeinen mußte auf blinkende Glassplitter achtgeben. Weinlaub strich über sein helles Stoppelhaar. Wer genauer hinblickte, konnte an seinen Handgelenken zwei längliche rote Striche erkennen.
«Ich werde den Anblick nicht mehr loswerden.»
«Stellen Sie sich dem Menschlichen, um so eher werden Sie es bewältigen. Ich gehe jedenfalls nicht allein nach hinten, Herr Deutler.»
«Das ist fortwährend die Frage … Türmt man? … Oder stellt man sich?» Der junge Mann schlang kurz die Arme um sich.
«Auch dafür gibt es kein Rezept. Vorwärts … am Birnbaum.»
«Ich folge.»
Aus einem Instinkt heraus bewegten beide sich nicht mehr frontal auf den Nutzgarten zu. Sie schlichen seitlich an Wand und Wein entlang. Hilde Hoffmeister stieß sich am Gartenschlauchroller.
«Noch bin ich da», murmelte Olaf Deutler.
«Gott sei Dank», hörte er von vorn.
«Furchtbar. Ich hatte immer Lampenfieber … Es hat mich umgebracht. Ich habe, selbst bei kleinstem Etat, vorzügliche Bühnenbilder entworfen. Ab den Bauproben war ich aber nicht mehr ansprechbar. Ab den Beleuchtungsproben mußte ich zum Arzt … Durchfall, Fieber, alles. Doch, es begann viel früher», hechelte er, «ich war der Prügelknabe der Klasse … Ich konnte mich nie durchsetzen. Vielleicht fühlen sich viele Bühnenbildner nur mittelmäßig oder schlecht … Ich weiß nicht, was richtig ist. Nie! Alles beeinflußt mich, in entgegengesetzte Richtungen. Ich platze. Ich zerfalle. Alles ist falsch, oder auch nicht?»
«Jedenfalls sind wir noch nicht ganz verstummt», vernahm der zappelige Begleiter vor sich. Sie kamen unter dem vergitterten Speisekammerfenster vorbei.
«Mein letzter Auftrag war Der Hauptmann von Köpenick in Koblenz, ich habe nur noch die Entwürfe für den ersten Akt fertigbekommen … ‹Ob das gut wird?› hat die Intendantin gefragt. Nach jeder Kritik hab’ ich Magenkrämpfe bekommen. Weil ich’s doch blendend machen wollte! – Vielleicht hat sie’s gar nicht böse gemeint? – Vielleicht ist mein Schwanz zu klein, daß ich mich nie durchsetzen konnte…»
«Herr Deutler, nicht jetzt!» wurde er angeherrscht.
«Sie sind so entschieden.»
«Und außerdem glaube ich das nicht.»
«Doch, er ist nicht groß. Und wenn man Angst hat, daß er zu klein ist, wird er immer kleiner. Und man selber gleich mit.»
«Besinnen Sie sich!»
«Eine Tragödie. Wegen ein paar Zentimetern. Jedenfalls war er, als wir uns beim Schulsport unsere Schwänze zeigten, weil ich so nervös war, ganz klein. Ich hab’ schnell die Hände davorgehalten. Ein günstigerer Moment, und alles wäre anders gekommen oder auch nicht. Verstehen Sie die Misere? … Ich kann nicht weiter.»
Die Luft im Schatten war kühl. Aber sie zitterten jetzt nicht wegen der Kälte. Hilde Hoffmeister umfaßte Olaf Deutlers Hand so fest, daß sein Gesicht schmerzhaft zuckte.
«Abschneiden und dann verbuddeln», flüsterte er: «Das war’s dann. Entsetzlich. Er hat’s hinter sich. Er ist im Dunklen, im Sanften. Gott wollte ihn zurück.»
«Herrn Lehmann?»
«Stop. Nicht weiter. Wir reden. Aber es wird übermächtig, Frau Hoffmeister. Ich habe ihm gestern noch ein Kissen gebracht. Er saß am Fenster. Ein feiner Mensch.»
«Was wissen wir schon?»
«Er saß reglos, im Anzug. Mit weißem Hemd und Krawatte. Überraschend zarten Händen.» Olaf Deutler ließ sich gegen die Hauswand ins Weinlaub sinken. Er schloß die Augen, er bibberte, die Zähne knirschten. Frau Hoffmeister wagte die letzten Schritte allein. Vor ihr breitete sich das Obstgehölz aus. Es war ehedem mit Bedacht gepflanzt worden. Neben Pflaumenbäumen begannen Reihen von Schattenmorellen, Mirabellen und anderer Fruchtbäume zu grünen und zu knospen. Mattgraufeucht schimmerten betagte Stämme. Scheiben eines Gewächshauses waren schmutzig blind oder zerbrochen. Die knorrigen Birnbäume gediehen mehr dem Wald zu.
Ein Gartenstuhl lag umgekippt im Gras. Der Steuerberater, den Frau Hoffmeister von ihrem Fenster aus schemenhaft erahnt hatte, war auch jetzt kaum zu erkennen. Karl Lehmann war gleichsam das Gesprengsel der Morgensonne zwischen Zweigen und Ästen. Das Einstecktuch ragte aus der Jackettasche. Die Schuhe glänzten geputzt, einen Meter über dem Boden. Frau Hoffmeister neigte den Kopf und faltete die Hände. Hinter ihr sang eine Stimme von der Wand – aber nur auf einem Ton, brüchig und unsicher, mit Schluchzen –, was vielleicht aus Kindertagen, dem Konfirmandenunterricht im Gedächtnis haften geblieben war:
«O Jerusalem, du schöne,
ach wie helle glänzest du!
Ach wie lieblich Lobgetöne
hört man da in sanfter Ruh!
O der großen Freud und Wonne,
jetzo gehet auf die Sonne,
jetzo gehet an der Tag,
der kein Ende nehmen mag.»
3.
Da klimperte er.
Unter der französischen Butter, demi-sel, dem Bel Paese, dem Karton ertastete sie den Schlüsselbund. Sie zog ihn an den neuen Schuhen vorbei aus der Tasche. Fast schon täglich mußte sie sich etwas Neues kaufen. Das erfrischte.
Voller Widerwillen weigerte sie sich, zur Seite zu blicken und zu grüßen. Das dumme alte Weib in der Erdgeschoßwohnung hing Tag und Nacht aus dem Küchenfenster und verfolgte jeglichen Schritt und Tritt. So verglotzte und vermampfte sie ihre Rente. Und immer ein Anwehen von Uringeruch aus dem Fenster. Kein Zweifel, sie war dement.
Christine Perlacher schloß die Haustür in der Connollystraße 44 im Olympiazentrum auf. Nach dem zähen Bürotag – der 700.000ste? – ärgerte es sie, daß sie sich ärgerte, daß ein armes Geschöpf, die Frau Heinz, den lieben langen Tag aus dem Fenster hängen und umherspionieren konnte und abends freundlich gegrüßt werden wollte. Wofür? Immerhin war Frau Heinz ein abendlicher Fixpunkt, ein sicheres Haßobjekt. Sie nickte nicht zum Fenster hin, zur Zumutung, zur Überzähligen, zum lebenden Tod. Gewiß, wenn Frau Heinz eines Tages abtransportiert, wirklich tot wäre, empfände sie eine Schuld, die alte Hexe in ihrem Kittel jeden zweiten Abend geflissentlich übersehen zu haben. Je nun, es belebte leider auch, brutal zu sein, auf Widerwärtigkeit mit Ekelhaftigkeit zu antworten.
Bewegung tat gut. Die ADAC-Sachbearbeiterin für Auslandsunfälle stieg die Treppen hinauf. Sie mußte lächeln. Die Geschichte, die ein Bereichsleiter in der Kantine erzählt hatte, war reizend. Bei einem Italiener in Görlitz hatte er sich über den wässerigen Landwein beschwert. «Mi dispiace», hatte sich der Wirt entschuldigt, «wer den nicht runterkriegt, verdient was Besseres», und hatte zum selben Preis einen vorzüglichen Montepulciano aus dem Keller geholt.
Christine Perlachers Stimmung verfinsterte sich wieder. Wem konnte sie heute abend die Anekdote unterbreiten? Mit der Schultertasche verharrte sie zwischen den Wohnungen im zweiten Stock. Manchmal begegneten sich Mieter im Treppenhaus. Sie konnte nicht einfach beim geschiedenen Herrn Kramer oder den lustigen Svetlawskis klingeln, einen guten Abend wünschen und sich zum Plaudern in eine Küchenecke schieben. Besonders in französischen Filmen waren die Leute entsprechend enthemmt, und es wurde aufgetischt. Aber – hier nicht! Ein Überraschungsbesuch würde kolossal irritieren und im Hause die Runde machen: «Die ist irre. Macht nicht auf, wenn’s klingelt.»
Der neue weiße Teppichboden war eine Pracht. Und die Aussicht einmalig. Die Olympiahalle leuchtete durchs transparente Dach. Auf den Tennisplätzen wurde im Flutlicht gekämpft.
Sie mußte vor ihrem Fläschchen Médoc noch einen Happen essen. Sie konnte ins Kino gehen, das erste Eis des Jahres auf der Leopoldstraße löffeln oder einen Spaziergang bis zur Russischen Kapelle unternehmen. Ach, vieles war möglich. Die Rückengymnastik würde erst wieder nach den Pfingstferien beginnen.
Christine Perlacher stellte Urkornbrot und Cornichons auf den Eßtisch.
«Ich bin müde.» Sie drehte das Glas auf. «Nein, ich habe alle Kraft.» Sie wußte es nicht mehr, wie sie es bewerkstelligen sollte, als Endvierzigerin abends ohne Peinlichkeit in ein Lokal zu gehen und einen Flirt zu beginnen. Nur nicht allein mit verhangenem Blick in einer Ecke sitzen. Natürlich besser zwangslos auf einem Thekenhocker. Bedürftigkeit oder gar Kummer um keinen Preis erkennen lassen. Manchmal ins Haar greifen, es hinters Ohr schieben. Haar hatte auf Männer Signalwirkung. Die Anschmiegsame und nicht die zu Selbständige hervorkehren. Dumme Vorausgedanken. An einer Bar saßen viele Gleichgestimmte. Einfach als erste das Wort ergreifen, «Waren Sie schon öfter hier?», um Mauern zu durchbrechen. Es sollte doch jetzt muntere … Metrosexuelle? … geben, die irgendwie irgendwas…, die sich nicht um alte Rollen scherten, witzig waren und in Betten stiegen, ohne daß Beängstigendes drohte. Waren Metrosexuelle Frauen oder Männer? Da hatte sie wohl den Anschluß verloren. Sie wollte sich nicht von einem Mann, den sie abschleppte, ausrauben lassen. Gar Schlimmeres. – Lesbisch werden, das war eine Chance, doch das hätte sie vielleicht früher einleiten sollen, wenn überhaupt, – Fleisch bliebe in gewisser Weise Fleisch, Nähe würde zu Vertrautheit. In welchen Lokalen sammelten sich die Nachtschwärmer? Die Pilsstuben um den Wedekindplatz waren garantiert keine gute Adresse mehr.
Der Bel Paese duftete, der Gorgonzola war von vorgestern. Sie würde ihn nicht mehr verzehren. Sie hatte die neuen Riemenschuhe auf den Couchtisch gestellt und freute sich an ihnen.
Eine karitative Aufgabe, für den Abend. Das wäre es! Rollstuhlfahrern helfen, während sie Frau Heinz nicht grüßte? Dubios. Aber sich Pflichten auferlegen. Ja. In der Zukunft. Bekanntschaften würden sich daraus ergeben.
Das Fernsehen hatte sie sich fast ganz abgewöhnt. Die Nachrichten waren, zumal man nicht handeln konnte, unerträglich geworden. Im Chinesischen Meer war nach einer Explosion ein russisches Atom-U-Boot gesunken. In dem Stahlsarg lebten vielleicht noch hundert Seeleute, die man aus der Tiefe nicht retten konnte. Sie erstickten langsam im Stockfinsteren. Auch das war schlimmer als alles um sie herum. Was sollte sie tun? Morgen wollte sie eine Kerze für die lebendig Begrabenen anzünden.
Mußte sie ihr Leben an Katastrophen messen? Wohin waren aller Schwung, das Unbedachte, die vergnügliche Seele verschwunden? Vielleicht nur ein paar Millimeter unter die Oberfläche und konnten im Nu wachgeküßt werden.
Das Restaurant auf dem Olympiaturm drehte sich kaum wahrnehmbar. Sie würde noch ausgehen, und zwar an diesem Montag! Erst draußen, in Aktion, ein bißchen wie im Urlaub, würde sie merken, daß sie völlig lebenstauglich war. «Das mach’ ich. Und den Geschirrspüler räum’ ich jetzt nicht aus.» Sie erinnerte sich, daß sie sich Selbstgespräche verboten hatte. «Bloß keine Tragödie konstruieren!»
Den Balkon hatte sie mit Grasmatten ausgelegt. Die Kästen mußten bepflanzt werden. Christine Perlacher lehnte sich gegen die Brüstung. Mit leicht geöffnetem Mund blickte sie über die Sportanlagen, wo Spieler zum Schlag ausholten. Sie beugte sich weiter vor. Unterhalb des Fensters von Frau Heinz war ein Lichtquadrat. Etwas hatte sich grundfalsch entwickelt, daß sie so hier stand. Es lag an ihr … an den Zeiten … auch an Rudolf, der jetzt in Hamburg lebte. Neben dem Windlicht sah sie das Kärtchen, das sie gestern in der U-Bahn gefunden hatte. – Reicht es? … Aber prüfen Sie sich … Eine Psychogruppe würde Nöte enthüllen, aber vielleicht nicht helfen.
«Lie – be!» schrie sie plötzlich aus Leibeskräften ins Dunkel hinaus und sprang von der Betonbrüstung ins Wohnzimmer zurück, wo sie sofort das Licht löschte und sich, mit dem Mantel unterm Arm, auf die Couch setzte.
4.
«Haben Sie Rei in der Tube, Frau Wimpf? Guten Morgen.» Herr Kipphard kam in die Küche geschlurft. «Mein Hemd ist schmutzig.»
«Falls Sie noch was waschen wollen, bringen Sie’s ins Badezimmer. Vielleicht erbarmt sich jemand. Machen Sie ein Zeichen mit Kuli rein. Dann gibt’s kein Durcheinander.»
«Durcheinander?» Erwin Kipphard schaute sich in der fremden Küche um. Am langen Tisch hätten zwei Familien Platz finden können. Die Stühle wirkten genauso betagt und abgenutzt wie die teils rissigen Wandkacheln. Der Schiebetürenlack von Hängeschränken über der steinernen Spüle, dem Gasherd und einem zusätzlichen Kohleherd der Firma Gutbrand war stumpf.
«Wollen Sie grünen Tee?» Die Augsburger Lehrerin trug noch das Kleid, in dem sie im Morgengrauen am Gartenbassin ihre Übungen vollzogen hatte. Ihr langes Haar war gleichsam wasserblond. Ein wenig hinkte sie.
«Trinken? Wozu? Ich habe mich schon an die Erde gewöhnt. Staub zu Staub.»
«Erde ist so … hart, krude. Krumen. Aber das Wasser nimmt uns sanft auf. Alles fließt. Also. – Es wird eine Verwandlung geben oder vielleicht eine bessere Wiederkehr.»
«Ich will gar nicht zurückkehren. Dann könnte ich gleich bleiben. Nein, ich bin’s satt. Und dann die zukünftige Welt. Die lockt nicht.»
Erwin Kipphard wußte angesichts der zehn, zwölf Stühle nicht, auf welchen er sich setzen sollte.
«Begrabt mich. Es ist nur die Hülle.»
«Das wird sich zeigen.» Ute Wimpf stand neben einer Kasserolle, aus der es zu dampfen begann.
«Wir wissen gar nichts übers Jenseits. Somit noch weniger als über das Leben.» Der Sechsundsechzigjährige hockte sich auf die Stuhlkante, als wäre er nur flüchtig zugegen.
«Es gibt Theorien, Mutmaßungen, Visionen, Herr Kipphard. Ich halte mich gerne an die ägyptischen. Daß wir nach Westen aufbrechen. Über den Fluß ins Licht. In die Sonne, in die ewige Helligkeit. Kein Paradies, keine Hölle, sondern einzig: lichter Westen. Eine dreitausendjährige Kultur kann nicht völlig geirrt haben.»
Herr Kipphard hob im Tweedmantel die Achseln, ließ sie wieder sinken und sann in der kühlen Küche nach: «Bräuchten Sie dann nicht Brot, Getränke, Geld, Grabbeigaben, um den weiten Weg zur Sonne zu schaffen? In den Pyramiden hatte man alles dabei. Vielleicht kann sich jemand darum kümmern? Wenigstens etwas Obst.»
Ute Wimpf hielt im Eingießen des kochenden Wassers inne: «Oder es kommt doch das Nichts. Vorher waren wir im Nichts. Im Erinnerungslosen. Danach könnte es wieder so sein. Man wird nichts über das Nichts meinen können.»
«Oder es ist doch etwas, das wir uns nicht vorstellten? Ein blauer Strand? Der Schoß der Zeitenkönigin? Ein Treffen mit allen Verblichenen? Wir haben keinen Einfluß darauf. Ich habe immer gern in Ackerschollen gegriffen, feuchte, schwere, duftige. Die Erde ist die gute Mutter. Sie hat mich hervorgebracht, ernährt, geduldet. Ich gehe heim in sie. Alle Not hat ein Ende.»
«Wann?» Die Frage von Ute Wimpf, die in Heidelberg Geschichte und Pädagogik studiert hatte, wirkte auf den Hausmitgast weniger schroff, als sie befürchtet hatte. Vorgebeugt blieb er sitzen und hielt beide verschmutzten Knie umfaßt. «In der Erde rumort der Mai.» Durch zwei Fenster fiel Licht über die Bodenfliesen und die Wachstuchdecke. Darauf stand nur ein Salzfaß aus Bunzlauer Steinzeug mit rotem Löffel. Herr Kipphard blickte nachdenklich auf: «Und Sie?»
«Ich muß innerlich erst abschließen. Es darf keinen Funken Hoffnung, Lebenslust mehr geben. Das Schwarze muß so endgültig schwarz sein, daß das Helle ruft.»
«Jaja. Bloß nichts mehr wollen. Angeekelt sein. Weinen, weil man atmet. Schwierig. Bald.» Erwin Kipphard legte einen Arm auf das Tischtuch. «Semmeln gibt es hier wohl nicht? Oder einen Keks?»
«Hier gibt’s fast nichts.»
«Klar. – Wozu auch?»
«Aber trinken Sie einen Schluck frischen Gun-Powder. Ich habe ihn gestern abend in Schäftlarn besorgt. Grüner Tee belebt, regt an, aber nicht auf. Aber warten Sie …», Ute Wimpf öffnete den mannshoch-bauchigen Bosch-Kühlschrank, «Joghurt und Honig habe ich entdeckt.»
«Solch einen Tee und Joghurt. Scheußlich. Ich will zu Käthe.»
«Sie ist schon … drüben?»
«Meine Frau ist vor neun Jahren gestorben.»
«Das tut mir leid.»
Der Rentner blickte irritiert dankbar auf. Wo hockte er hier? Zu welcher Stunde und mit verschmutzten Schuhen? «Zu Käthe. Nicht, daß ich mir das immer wünsche. Aber wenn’s wie in unseren guten Stunden wird.»
«Das wird bald. Und dann ist alles gut.»
«So habe ich noch nie geredet.»
«Ich weiß auch nicht, wie lebende Leichen reden, Herr Kipphard. Aber wir sind ja fast schon frei.»
Der Mann brummelte.
«Das Leben war unerträglich. Zuviel gefordert, zuwenig Kraft. Viel Pech. Leiden.»
«Genau.»
«Licht.»
«Dunkel.»
Die Schatten der Gitterstäbe waren unmerklich über den Steinboden gewandert. Da man nicht so recht wußte, wie man sich noch verhalten sollte, beobachtete Erwin Kipphard, wie die jüngere Frau, die er gestern zum ersten Mal im Garten getroffen hatte, mit ihrem Teebecher am anderen Tischende Platz nahm und geistesabwesend trank. Bald. – Der Witwer und pensionierte Bahnbeamte musterte seine knochige Hand. Er trommelte leise auf die Decke. «Nicht wieder zurück in die Stadt», murmelte er. Er mochte an die Wohnung und seine Zustände dort denken. Nachdem Erwin Kipphard vor zwei Jahren mit Kollegen im Augustinerkeller üppig seinen Ruhestand gefeiert hatte, war es unversehens, aber rapide mit ihm bergab gegangen. Da ihn keine Pflichten mehr gerufen hatten, hatte er morgens ausgeschlafen, immer länger geruht und war, nach einem ausgiebigen Mittagsdösen, abends immer später ins Bett gegangen. Nach einigen Monaten hatte er sich nicht erholter, sondern erheblich matter gefühlt. Einige Mal hatte er der Bahndirektion einen Besuch abgestattet, war mit Exkollegen in die Kantine gegangen. Doch an Gesprächen über neue Betriebsvorkommnisse, frische Intrigen im Büro hatte er sich im Nu kaum mehr beteiligen können – und wenige wollten Ratschläge eines nun Außenstehenden hören, der seine Rente genoß. Mit nervösem Schlucken, Zittern der Hände hatte er auf seinem Mittagsplatz gesessen und sich – überzählig gefühlt. Neue Auszubildende wandten sich mit Fragen nicht an ihn, sondern an Schorlemmer, der auf den leitenden Posten nachgerückt war. Erwin Kipphard war auf den Gedanken verfallen, seine Kinder zu besuchen. Schon am zweiten Morgen hatte er nicht mehr gewußt, was er in Aschaffenburg sollte, und war in der Wohnung auch spürbar lästig geworden. Es schien ihm, als wolle seine Tochter keinen alten Mann im Gästebett schlafen haben. Nach herzlichen Umarmungen war er drei Tage später wieder abgereist. Eine Busreise nach Verona – dergleichen hatte er früher nie unternommen – war wegen des Regens zum Reinfall geworden. Und was sollte er allein auf Gran Canaria?
«Nicht mehr zurück.»
Selbst seine legendäre Modelleisenbahn hatte ihn schließlich im Stich gelassen. Die Verfeinerung der Signalanlagen, die Union-Pacific-Dampfloks, die Zahnradbahn, die auf die Miniaturberge hinaufführte, hatten jahrelang Freude bereitet. Als er jedoch Tag und Nacht, ganz nach Belieben, den Kalifornienexpreß mit neuem Paketwagen über Brücken und am Stausee vorbei sausen lassen konnte, war es nur um so erschreckender gewesen, daß es ihn langweilte. Einmal hatte er mit Tränen in den Augen neben der immensen Spanplatte gesessen. Er hatte selbst den Flur tapezieren wollen, aber dann doch einen Maler kommen lassen müssen. Den Handwerker hatte er geradezu genötigt, langsam zu arbeiten und mit ihm in der Küche Bier zu trinken. Das Grab seiner Frau hatte Erwin Kipphard bereits zu dieser Zeit zweimal täglich besucht. Das war nicht gut. Zwischendurch hatte er sich, manchmal allerdings für Stunden, auf eine Bank vor den Ostbahnhof gesetzt und abgewartet. Je nachdrücklicher er ein Gespräch mit jemandem, der kurz Platz nahm, gesucht hatte, desto brüsker waren manche Abweisungen gewesen. Schien es ihm. «Natürlich nehm’ ich die S-Bahn. Aber das geht Sie doch nichts an.» Einige fremdländische Jungs, die auf dem Rondell in einer Dauerturbulenz gestikulierten und in ihre Handys redeten, hatten ihn freundlich um Zigaretten angeschnorrt, die er nicht hatte. Eine verpaßte Chance, etwas über diesen Nachwuchs zu erfahren. Die Burschen wirkten vital, ein bißchen ruppig, aber auch herzlich. Er hätte über fremdartige Leben im Land etwas erfahren, sich einbringen können. Er hatte sich überlegt, im Bahnhof Bier zu besorgen und sich höflich neben, allmählich zwischen die Penner am Orleansplatz zu stellen. Seine Angst war stärker gewesen. Wenig später hatte er einen ganzen, dann drei Tage im Bett zugebracht, war aber nachts durch Haidhausen gewandert. Mit der Spitze seines Stockschirms hatte er Papierfetzen aufgespießt und zu den Mülleimern getragen. Gegen drei Uhr früh hatte er einen jungen Mann am Ärmel festgehalten, der eine Kippe weggeschnippt hatte: «Willst du dir eine fangen, alter Depp? Ab in die Urne», hatte der gebrüllt und sich losgemacht. «Ja», hatte Erwin Kipphard geantwortet, war heimgekehrt und hatte sich übergeben. Danach war er zwei Wochen nicht auf die Straße gegangen, hatte fast nichts mehr zu sich genommen und getrunken und alte Illustrierte gelesen.
«Nicht geschafft … Ich hab’s nicht gemeistert», die Fingerkuppen strichen übers Wachstuch, «und ich verdiene kein Mitleid … das Leben muß doch nicht leer sein.»
Der Tee, den Ute Wimpf dem Morgenbegleiter zuschob, roch wie gebrauchte Unterhosen. Was in dieser Endzeitküche jedoch einen wesentlich intensiveren Geruch verströmte, war der riesige Topf, der auf dem Herd köchelte. Von dem Vorrat an Rotkohl mit Würsten konnte man sich zur Not wohl jederzeit bedienen. Wer in diesem Hospiz mit seinen seltsamen Regeln und der leicht maroden Anmutung nicht zügig den Strick nahm – wie Herr Lehmann –, verstarb an Blähungen und Verstopfung.
«Ihre dritte Nacht, Herr Kipphard?» Die Lehrerin brütete über ihrem Becher.
«Bin vorgestern eingetroffen. Wollen Sie mich antreiben?»
«Um Gottes willen.»
«Sollten Sie vielleicht.»
Herr Kipphard musterte die Frau im Frühlicht. Es war nur das Aufflackern einer Regung. Plötzlich verdroß den Müden die Vorstellung, daß diese freundliche beschädigte Frau im roten Gewand ihren Entschluß noch revidieren könnte und abwechslungsreiche Jahre unter Sonne und Mond verbringen würde, während er selbst sich ins Endgültige durchgerungen hätte.
Die Blicke der Selbstmordkandidaten kreuzten sich. Leise ertönte aus dem Radio unter den Hängeschränken zum zweiten Mal das Zeitzeichen der Nachrichten. Meldungen über den sinkenden Hochwasserpegel der Elbe bei Riesa, vom Sprung des DAX über die Zigtausendermarke rangierten vor Informationen über das Schicksal der eingeschlossenen 118 Seeleute im russischen Unterseeboot. Diese Reihenfolge wirkte barbarisch.
«Tja, da hockt man», sinnierte Ute Wimpf, «wartet auf den richtigen Moment, den Absprung.»
«Man muß Schluß machen. Ich habe abgeschlossen. Nur nichts mehr spüren wollen.»
Kurz fürchtete der Pensionär, daß Frau Wimpf mit einem Mal beginnen könnte, ihre eigene Leidensgeschichte zu offerieren. Die kleinste Nachfrage mochte die Sturzflut eines Elendsberichts auslösen. Er würde fremde Schrecklichkeiten kaum ertragen. Es sei denn, das Niederdrückende, das Frau Wimpf widerfahren war, würde sich erheblich von seinen Erfahrungen unterscheiden. Hätte die Lehrerin massiver gelitten als er, wäre er über sein Los ein wenig getröstet. Wäre sie leichtfertiger zum Freitod vorgestoßen, würde seiner um so berechtigter. Das war gewiß ein etwas verschrobenes, krankhaftes Denken.
«Ich …»
«Ja», horchte er abwehrend.
«Ich fahre», und sie hob langsam den Kopf, «an den Starnberger See. Wollen Sie mitkommen? Es könnte unser letzter Tag werden, Herr Kipphard.»
«Ich?»
«Ist doch alles egal», sie strich ihr Haar zurück.
«An den See?»
«Mit dem Bus.»
«Was soll ich am See?»
«Wir können noch ein Eis essen. Ich werde schwimmen. Sie können ja auch ins Wasser gehen. Der See ist nicht weit.»
«Ich bade nicht.»
Sie trat auf ihn zu, legte ihm die Hand auf die Schulter: «Ich werde nichts tun, was Sie in Schwierigkeiten bringt. Sie warten am Ufer. Ist doch gleichgültig, wer jetzt noch mit wem einen Ausflug unternimmt. Mit dem Bus ohne Umsteigen. Ganz einfach.»
Der Witwer blieb reserviert.
«Zu zweit. Das wäre gut.» Beide blickten unvermittelt zum Topf, aus dem es nach Rotkohl und Wurst stank. Dem mußte man entrinnen.
Ein gänzlich anderer Duft erfüllte das Glaszimmer. Der Raum nahm einen großen Teil des hinteren Erdgeschosses ein. Das lichte Zimmer ließ sich beinahe als riesiger Wintergarten bezeichnen, falls nur irgendeine Pflanze darin gegrünt hätte. Zum Flur und Treppenhaus hin bestand die Innenwand aus einer Glaskonstruktion mit Tür und Binnenfenstern. Durch die bunten Scheiben fiel Tageslicht auch ins Hausinnere. Ein Nachteil dieser nicht nur sinnvollen, sondern auch schönen Architektur war es, daß bei jedem Luftzug die Tür und einige Glaskarrees in ihren Bleifassungen leise schepperten.
Die Kaffeemaschine gurgelte. Aus dem Filter tropfte aromatisches Schwarz in die Glaskanne. Um dem großen Raum eine Frische zu verleihen, hatte Ulrich Berg ein Poster mit karibischen Palmen an diamantfarbener Bucht an die Wand geheftet. Daneben hing über dem Sofa ein Barometer.
«Und Lehmann?»
«Im Keller.»
Die drei Geschwister Berg waren seit früher Stunde auf den Beinen. Frau Hoffmeister und der diffuse Bühnenbildner hatten sie wach geklopft. Ulrich Berg saß mit angewinkelten Beinen und in brauner Lederhose, darüber ein grünes Sweatshirt, auf dem Fensterbrett und spähte zum Birnbaum. Zweige, Knospen, eine Amsel. Er griff sich in den Rücken. «Warum werden Menschen plötzlich derartig schwer?»
Auf dem Sofa begann eine dunkle Frauenstimme zu wimmern. «Das halte ich nicht aus … Ich habe einiges erlebt, aber das … Das ist widernatürlich! Widerlich … Ich muß mich übergeben.»
«Tu’s doch.»
«Wir landen alle im Knast.»
«Ich hab’ dabei die Sonnenbrille aufgesetzt», merkte Ulrich in Richtung Sofa an. «Was man schlecht sieht, ist fast nicht da.»
«Aber Herr Lehmann ist da. Und zwar unter uns», klagte es vom Polstermöbel.
«Was meinst du, Monika, wie es im Krieg nach den Bombennächten in unseren Straßen aussah! Da mußten die Leute – und es ist gar nicht lange her – ganz anderes, entstellte Nachbarn, verbrannte Flüchtlinge, halbierte Blockwarte, wegschaffen.»
«Es ist aber kein Krieg.»
«Herr Lehmann hat seinen Willen bekommen. Und nun wird nicht weiter darüber gebrütet.» Trotz dieses Entschlusses blieb auch Ulrichs Kehle wie zugeschnürt. An einen Imbiß, den kleinsten Happen mochte er nicht denken. Und in den vergangenen Tagen – den rundum abscheulichsten seines Lebens – hatte er bereits ein, zwei Kilo abgenommen.
«Fährst du heute noch in die Stadt?» fragte die hellere Frauenstimme aus der anderen Zimmerecke.
«Nein. Ich muß pausieren. Ich hab’ vor einem halben Jahr noch Skipullis entworfen. Und ich bin nicht der Glöckner von Notre-Dame oder Frankenstein. – Er roch und war kalt», brach es aus dem Vierundvierzigjährigen heraus, «ich werd’s nicht mehr allein machen!»
Monikas Wimmern wollte nicht verstummen. Clarissa sagte: «Okay.»
Aus mehreren Gründen war dem Designer unbehaglich zumute. Der Tod und die Gefahr setzten ihm zu. Außerdem hatte er seit Kindertagen noch nie soviel Zeit mit seinen Schwestern zugebracht. Beide waren Fremde und zugleich die Nächsten. Diese Verwobenheit blieb unheimlich. Frei war man nicht, solange man Blutsverwandte hatte. Andererseits konnten sie immer die letzte Zuflucht sein, sogar nach Lebensbahnen, die sich selten gekreuzt hatten. Ulrich schürzte die Lippen und schlang die Arme um die ledernen Knie. Nun waren sie zum dreisamen Gelingen verdammt.
«Fühlst du dich alt?» fragte Monika.
«Heute ja.»
Beide folgten Clarissa mit Blicken. Die Älteste goß sich Sahne in den Kaffee und kehrte mit pickenden Absätzen zu ihrem Cocktailsessel zurück. Drei der bunten Plüschmöbel – gleichfalls Überbleibsel früherer Mieter – standen wie hingewürfelt um einen niedrigen Glastisch.
«Sonne. Fetter Boden. Nirgendwo gedeiht Cannabis besser als in Oberbayern.» In der Frühjahrsluft, die von Waldsaum und Garten durch die Fenster strich, fuhr Clarissa mit der Zungenspitze über das Jointpapier. Die Fünfundvierzigjährige sah blendend aus, kaum müde. Die Jahre in London hatten Clarissas angeborene Grazie noch um Sicherheit ergänzt. Beides, geschmeidige Gesten und Souveränität, gehörte gewiß zu den Voraussetzungen, um erfolgreich in der berühmten School of Economics voranzukommen. In diesem Institut, das maßgebliche Prognosen über die Weltzukunft erstellte, hatte es Clarissa, bei erstaunlich bescheidener Bezahlung, bis in die Leitung des Department of Oriental Studies geschafft. Es war noch der große Altliberale Dahrendorf gewesen, inzwischen längst Lord Ralf und mit Sitz im Oberhaus, der die Volkswirtschaftlerin an seinem Haus angestellt hatte.
Clarissa schlug ein Bein übers andere und zündete den entspannenden Aufmunterer an. Nach einer harten Eingewöhnungsphase ohne jegliches Privatleben hatte sie an der Themse über die Jahre Verhältnisse mit einem Schotten, dann mit einem Jerôme aus Montreux gehabt und wurde seit längerem von einem Pakistani zurückgeliebt. Einem Kreateur von Luxusseifen. Nach dem ersten Zug streckte sie den Joint in Ulrichs Richtung: «Palliativ. Lindert auch Rückenschmerz.» Er hob ablehnend die Hand.
«Immer noch Angst, die Kontrolle zu verlieren? Du probierst dich nicht genug aus. Nutzt deine Fähigkeiten nicht. Das Leben ist kurz. Tauch optimistisch in den Strudel ein.»
«Ich trinke abends.»
Clarissa fixierte Monika: «Du magst wohl auch nicht?»
Die Jüngste und Halbschwester aus der zweiten Ehe Simon Bergs stemmte sich ein paar Zentimeter aus ihren Polstern: «Im Eiskeller …»
«Immerhin nicht auf dem Dachboden», warf Clarissa ein.
«Ein Toter.»
«Zwei», berichtigte Ulrich von seinem Fensterplatz.
«In drei Tagen. Ich will weg. Ich kann schon jetzt nicht mehr.» Neben der klobigen Kommode, auf der eine violette Vase aus Murano-Glas dem Blick weh tat, sank Monika ins Sofa zurück: «Frau Fontanelli war reizend. Nun der andere. Ich kann noch nicht mal in einem Kaufhaus klauen und soll nun Leichen verstecken?»
«Wir haben hier unsere Aufgabe zu bewältigen.» Ulrich wandte den Blick ins Grüne.
«Kleine Nervensäge.» Clarissa frühstückte bereits die dritte Praline, die ihrer Figur auch nicht zusetzen würde. Ein Fuß wippte: «Kein Mensch hat sie dazu gezwungen. Bewahre! Never. Du weißt, wir haben keine Wahl.» Clarissa zupfte am Saum ihres langen Leinenrocks, der, wie ihr Bolero, mit einem mauvefarbenen Blumenmuster bestickt war. Landhausstil. «Es ist gut, es ist beinahe eine moralische Pflicht, Monika, sich um Menschen zu kümmern, die keinen … Ausweg sehen.» Ulrich vernahm, daß die Londonerin denn doch auch ein wenig verlegen, beklommen schluckte, sich aber, geradezu gleichzeitig, räusperte: «In diesen Zeiten muß jeder dankbar für alles sein, was ihm ein bißchen Geborgenheit und Zuflucht verspricht.»
«Geborgenheit?» schrie Monika auf: «Leichenstarre auf Brauerei-Eis.»
«Seien wir froh, daß der Penzinger Luitpoldsbräu uns das noch liefern konnte», merkte Ulrich an und entsann sich der Umständlichkeiten, um die frostdampfenden Balken über eine Rutsche ins Untergeschoß zu verfrachten. «Gehört das jetzt zur Biohauswirtschaft?» hatten die Brauereiarbeiter gefragt. «Stimmt», hatte er geantwortet.
«Wenn ich das vorausgeahnt hätte», jammerte Monika.
«Das hast du, denn du bist raffiniert genug.»
Monika schluchzte. Neu war das Gegreine bei ihr nicht. Bereits als Kind hatte sie zur Weinerlichkeit geneigt. Damit war sie oft nicht schlecht gefahren. Denn während andere sich um ein bißchen Tapferkeit bemühten, hatte sie ihrer Fassungslosigkeit freien Lauf gelassen und sich gedrückt.
«Trink einen heißen Schluck», empfahl Clarissa. Die Jüngere rührte in ihrer Tasse. Die enge Verwandtschaft hätte man zwischen den beiden Halbschwestern nicht vermutet. Erinnerte Clarissa in ihrer Schlankheit, mit dem hellen schwingenden Haar, vor allem dem sinnlichen Mund von fern her an eine Eva von Lukas Cranach, so war Monika nicht nur kleiner und fülliger. Die Jüngste hatte überdies leicht hervorquellende Augen, fleischige Lippen, eine Stupsnase, was – zusammen mit der Strähnenfrisur – bei ihrem Anblick unwillkürlich an eine gewissermaßen zusammengestauchte Liza Minelli denken ließ. Sie selbst ahnte manchmal die nicht allzu vorteilhafte Vergleichbarkeit.
Clarissa malte mit dem Joint Kreise in die Luft: «Die Vereinzelung, die Einsamkeit», fuhr sie in Richtung der neun Jahre Jüngeren fort, «ist allerorten dermaßen im Vormarsch, daß jeder für Zuwendung, Aufnahme und ein bißchen Wärme dankbar ist. – Hier bei uns ist es», und sie sah sich nur verhalten skeptisch um, «gediegen, ruhig. Hier kann jeder ungestört seinem innigsten Drang nach Frieden nachkommen. Ein Unterschlupf ist völlig legitim und von hoher Moral. Wir dürfen nur nicht aktiv eingreifen. Der Schritt von der Humanität zum Rechtsbruch …»
«Skandal!» zischte Monika zurück.
«Ist ein kleiner.»
«In seiner Brieftasche hatte er 200 Euro. Ich hab’s dringelassen», bemerkte Ulrich.
«Totengräber, Opportunistin und … ich Mitschuldige», faßte Monika zusammmen, trank und schluchzte, «und nur aus Raffgier. Ich fahre nach Ludwigshafen zurück.»
«Pah!», entfuhr es Clarissa laut: «Und da? Zurück in dein Kabuff? Wieder in den Hotline-Service der Telekom? Wieder zusammengesparter Urlaub in der Nachsaison auf Djerba? – Vor dir, Mädel, breitet sich eine ganz andere Zukunft aus. – Faß dir doch mal ein Herz. Und obendrein hast auch du nur das Ende aller Dinge aus deinem Leben verdrängt. Der Tod ist unser Begleiter.»
Monika schaute verblüfft.
«Erst durch den Tod wird das Leben zu einem befristeten Wunder. Das kannst du dir hier vor Augen führen. Du hast wahrscheinlich nur verkrampft in den Tag gelebt, wie wir», gestand Clarissa zu, «durch Herrn Lehmann lernen auch wir, nebenbei, neu, daß wir Spreu sind.»
«Ich brauche den Tod nicht, um zu leben», stellte Monika fest und schaute zu Ulrich, der Clarissa weiterreden ließ.
«Wer sich die Gedanken ans Vergängliche verbietet, der würdigt das Lebendige, die Vielfalt und das Werden, in all seinen Formen, nicht. Nebenher kommen wir hier einer fundamentalen Fürsorge nach. Wir akzeptieren, im Lichte, die dunkle Seite. Lasset die Gequälten zu uns kommen.»
«Ich mag das nicht», munkelte Monika, und Clarissa war froh, daß das Nesthäkchen nicht schärfer auf ihre Weisheitslehren reagierte.
«Hast du, liebe Moni», Clarissas Stimme wurde einschmeichelnd, «nicht noch eine letzte Stunde lang an Frau Fontanellis Bett gesessen? Hat sie dir nicht, wenn auch vergebens, ihr Herz ausgeschüttet? Einen Liebesdienst hast du ihr erwiesen, vielleicht erstmals im Leben. Du bist jetzt aufgewühlt, weil es dir naheging. Und so nett hast du ihr noch die Wasserkaraffe gebracht.» Monika heulte auf. «Und Herr Lehmann … Vielleicht hätte er monatelang in seiner Wohnung … Du weißt schon. Hier hatte er den schönen Garten. Wunderbar.»
«Es reicht, Clarissa», unterbrach Ulrich seine eloquente Schwester: «Da müssen wir jetzt durch. Bis zum Winter. Das stemmt man, das kann man hinterher verdrängen. Machen wir kein Spektakel draus. In der Welt spielen sich andere Tragödien ab.»
«Exakt», befand Clarissa. «Durchhalten. Wir sollten endlich, gerade du, Moni, aus der Defensive heraus. Bedenkt, was uns erwartet!»
«Unglaublich. Ich kann es niemandem erzählen», schüttelte Ulrich sachte den Kopf.
«Um so besser. Und falls du’s tust, wer sollte dir glauben? Aber: So kann es sich wenden. Fabelhaft. Ich verstand mich immer mit ihm. Bestens. Für manche war er ein Idol.»
«Ro-ber-to», flüsterte Ulrich langsam. «Trug er immer weiße Anzüge? Ich kann mich nicht erinnern. Aber Onkel Roberto hat oft auf seine Taschenuhr geschaut. Gold. «
Clarissa fischte sich ein Praliné aus der Schachtel. Als der Name des Onkels fiel, hatte Monika sich nervös den Pony aus der Stirn gewischt, doch das Haar fiel sofort wieder zurück. Ihr Kleid mußte sie aus Tunesien mitgebracht haben. Es changierte braunsamten, war hochtailliert und besaß einen blauen Brustlatz. Das maghrebinische Gewand ließ über den Latschen nur die Knöchel frei.
«Wir hatten Glück mit Onkel Roberto. Schon als Kinder.» Mit Schwung war Clarissa aufgestanden und ging mit der Kaffeekanne vom Fenster zum Sofa, um auch dort nachzuschenken. «Ein herrlicher Tag», sie warf einen Blick ins duftige Freie. «Warum nicht heute abend in den Biergarten? Ich habe seit Jahren keinen Krustenbraten mehr genossen.»
Die nächsten Ausflugslokale und diesen Hinterraum, das Klirren seiner Butzenscheiben, den verstaubten Lüster kannten natürlich alle drei Berg-Geschwister seit Kindertagen. Seinerzeit, um 1970, hatten sie hin und wieder ihre Schulferien im Haus von Onkel Roberto und seinen wechselnden, doch immer freundlichen Lebensgefährtinnen verbringen dürfen. Monika als Nachkömmling hatte wahrscheinlich die verschwommensten Erinnerungen. Niemand hatte sie hier beaufsichtigt. Nach dem Frühstück, mit Honigsemmeln und anfangs unangenehm warmer Kuhmilch, waren sie in den Garten verschwunden und zum Mittagessen wie die Erdferkel wieder aufgetaucht. Gummitwist hatten sie vor der Garage gehopst. Ulrich war mit einem Bauernbengel auf und davon, um ein Isarfloß zu bauen. In seinem großen Borgward-Cabrio mit roten Ledersitzen hatte der spendable Onkel mit ihnen Ausflüge hinauf zum Walchensee und sogar ins Ausland – nach Kufstein – unternommen. Eigentlich hieß Onkel Roberto nur Robert. Aber dank seines südländischen Aussehens und der weißen Anzüge hatte ihm eine seiner Verflossenen das schmissige ‹o› angehängt. Der Paradiesvogel der Familie – ziemlich elend in einem Internat aufgewachsen – liebte Brillantine im Haar und genoß Brandy aus Schwenkern, die zuvor mit kochendem Wasser vorgewärmt wurden. Irgendwo mochte noch Kristall verstaut sein. Zu keiner Familienfeier in Worms war Onkel Roberto je erschienen.
Hauptsächlich durch seine letzte Frau Elena, die ihm kaum mehr von der Seite gewichen war, hatte er ein Vermögen angehäuft, oder es war ihm vielmehr zugefallen. Doch schon vor dieser späten Liaison, abermals ohne Kinder, waren Robert Berg im Familienkreis nebulöse «Beratertätigkeiten» in einer Grauzone zwischen Industrie und Politik nachgesagt worden. Auch auf der Ludwigshöhe hatte er manchmal Herren empfangen, denen ein Chauffeur die Aktentasche hinterhertrug und mit denen er sich ins Glaszimmer zurückgezogen hatte. Dann war Mokka gereicht worden. Während des kalten Krieges war Mutters Cousin immer wieder nach Prag, Bukarest, sogar Nordkorea gereist. Über seine Geschäfte war nicht offen gesprochen worden. Vielleicht war das besser so gewesen. Zumindest Clarissa ahnte, womit er gehandelt hatte. Auf einem Photo war er hinter dem späteren bayerischen Ministerpräsidenten Strauß zu sehen gewesen.