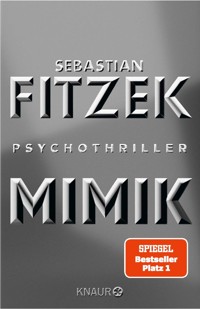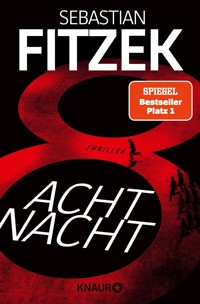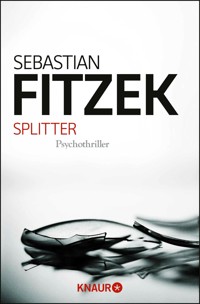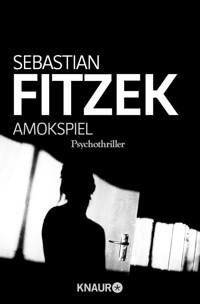
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein packender Psychothriller bis zur letzten Seite »Romane, die man wegen ihrer Spannung nicht aus der Hand legen kann [...] nennt man Reißer. Sebastian Fitzeks 'Amokspiel' ist ein solches Buch - packend in jedem Kapitel.« Focus Online Heute ist ein guter Tag zum Sterben: Dieser Tag soll ihr letzter sein. Die Kriminalpsychologin Ira Samin hat ihren Selbstmord sorgfältig vorbereitet – zu schwer lastet der Tod ihrer Tochter auf ihrem Gewissen. Doch dann wird sie in einen Radiosender gerufen, zu einem brutalen Geiseldrama: Ein Psychopath spielt ein makabres Spiel: er legt das Leben der Geiseln in die Hände wahllos angerufener Zuhörer. Und er verlangt, dass seine Verlobte zu ihm ins Studio kommt – doch die ist seit Monaten tot. Ira beginnt mit einer aussichtslosen Verhandlung, bei der ihr Millionen Menschen zuhören … Überraschende Wendungen und Suspense vom Feinsten In seinem zweiten Buch »Amokspiel« lässt Sebastian Fitzek die Leser gemeinsam mit Ira Samin immer tiefer in die Hintergründe des Geiseldramas eintauchen. Ein Plot voll überraschender Enthüllungen und packender Wendungen entfaltet sich – das perfekte Buch für alle, die clever konstruierte Psychothriller lieben. »Dieses Buch geht einfach unter die Haut, doch der Schluss ist einfach verblüffend. Ein Psychothriller vom Feinsten.« Der Nordschleswiger
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Sebastian Fitzek
Amokspiel
Psychothriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Dieser Tag soll ihr letzter sein. Die renommierte Kriminalpsychologin Ira Samin hat ihren Selbstmord sorgfältig vorbereitet. Zu schwer lastet der Tod ihrer ältesten Tochter auf ihrem Gewissen. Doch dann wird sie zu einem brutalen Geiseldrama in einem Radiosender gerufen. Ein Psychopath spielt ein makabres Spiel: Bei laufender Sendung ruft er wahllos Menschen an. Melden die sich am Telefon mit einer bestimmten Parole, wird eine Geisel freigelassen. Wenn nicht, wird eine erschossen. Der Mann droht, so lange weiterzuspielen, bis seine Verlobte zu ihm ins Studio kommt. Doch die ist seit Monaten tot. Ira beginnt mit einer aussichtslosen Verhandlung, bei der ihr Millionen Menschen zuhören ...
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Prolog
I. Teil
Acht Monate später. Heute.
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
II. Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
III. Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
Epilog
Danksagung
Das Quiz für dein nächstes Fitzek-Abenteuer
Leseprobe »Der Nachbar«
Für C.F.,
in liebevoller Erinnerung.
Du warst dir so sicher,
dass du das Finale gar nicht mehr
abgewartet hast.
»Eine willkürliche, anscheinend nicht provozierte
Episode mörderischen oder erheblich
(fremd)zerstörerischen Verhaltens.
Dabei muss diese Gewalttat mehrere Menschen
gefährden, verletzen oder gar töten.«
Definition von »Amok« nach der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Das Schicksal mischt die Karten, wir spielen.
Arthur Schopenhauer
Prolog
Der Anruf, der sein Leben für immer zerstörte, erreichte ihn exakt um 18.49 Uhr. Bei den nachfolgenden Befragungen wunderten sich alle, dass er die genaue Uhrzeit im Gedächtnis behalten hatte. Die Polizei, sein unfähiger Anwalt und auch die beiden Männer vom Bundesnachrichtendienst, die sich erst als Journalisten vorstellten und dann das Kokain in seinem Kofferraum versteckten. Alle fragten, weshalb er sich so gut an den Zeitpunkt erinnern konnte. An etwas so Nebensächliches, verglichen mit alldem, was danach noch passieren sollte. Die Antwort darauf war ganz einfach. Er hatte kurz nach Beginn des Telefonats auf die rhythmisch blinkende Digitaluhr seines Anrufbeantworters gestarrt. Das tat er immer, wenn er sich konzentrieren wollte. Seine Augen suchten sich einen Ruhepunkt. Einen Fleck auf der Fensterscheibe, eine Falte der Tischdecke oder den Zeiger einer Uhr. Einfach einen Anker, an dem sie sich festhalten konnten. So, als ob dadurch sein Verstand wie ein Schiff im Hafen sicher vertäut und in eine Ruheposition gebracht würde, die es ihm ermöglichte, besser zu denken. Wenn ihn früher, lange bevor das alles passiert war, seine Patienten mit komplizierten psychologischen Problemen konfrontierten, war der Fixpunkt seiner Augen stets ein zufälliges Muster in der Holzmaserung der wuchtigen Praxistür gewesen. Je nachdem, wie das Licht durch die getönten Scheiben seiner Privatpraxis in den gediegenen Behandlungsraum fiel, hatte es ihn an ein Sternbild, ein Kindergesicht oder eine frivole Aktzeichnung erinnert.
Als er um 18.47 Uhr und 52 Sekunden den Telefonhörer in die Hand nahm, waren seine Gedanken weit entfernt von einer möglichen Katastrophe. Und deshalb war er in den ersten Sekunden nicht bei der Sache. Seine Blicke wanderten ruhelos durch das untere Stockwerk seines Maisonette-Appartements am Gendarmenmarkt. Alles war perfekt. Luisa, seine rumänische Haushälterin, hatte ganze Arbeit geleistet. Noch bis letzte Woche dachte er, seine Zweitwohnung in Berlins neuer Mitte wäre eine reine Geldverschwendung, die ihm ein geschickter Investment-Banker aufgeschwatzt hatte. Heute war er froh, dass es den Maklern bisher nicht gelungen war, dieses Luxusobjekt in seinem Auftrag zu vermieten. So konnte er Leoni heute hier mit einem Vier-Gänge-Menü überraschen, das sie auf der Dachterrasse mit Blick auf das illuminierte Konzerthaus genießen würden. Und dabei würde er ihr die Frage stellen, die sie ihm bislang verboten hatte.
»Hallo?«
Er lief mit dem Hörer am Ohr in die geräumige Küche, die erst vorgestern geliefert und eingebaut worden war. So wie fast alle anderen Möbel und Einrichtungsgegenstände auch. Sein eigentlicher Wohnsitz lag in der Berliner Vorstadt, in einer kleinen Villa mit Seeblick nahe der Glienicker Brücke zwischen Potsdam und Berlin.
Der Wohlstand, der ihm dieses Leben ermöglichte, beruhte auf einem spektakulären Behandlungserfolg, den er bemerkenswerterweise noch vor Beginn seines Studiums erzielt hatte. Mit einfühlsamen Gesprächen hielt er eine verzweifelte Schulfreundin vom Selbstmord ab, nachdem diese durch das Abitur gefallen war. Ihr Vater, ein Unternehmer, bedankte sich mit einem kleinen Aktienpaket seiner damals fast wertlosen Softwarefirma. Nur wenige Monate später schoss der Kurs über Nacht in schwindelerregende Höhen.
»Hallo?«, fragte er noch einmal. Eigentlich wollte er gerade den Champagner aus dem Kühlschrank holen, doch jetzt hielt er inne und versuchte, sich ganz auf die Worte zu konzentrieren, die am anderen Ende der Leitung gesprochen wurden. Vergeblich. Die Hintergrundgeräusche waren so stark, dass er nur abgehackte Silben verstehen konnte.
»Schatz, bist du das?«
»… tu …eid …«
»Was sagst du? Wo bist du denn?«
Er ging mit schnellen Schritten zur Akkuladestation des Telefons zurück, die im Wohnzimmer auf einem kleinen Tisch stand, direkt vor den großen Panoramafenstern zum Schauspielhaus.
»Hörst du mich jetzt besser?«
Natürlich nicht. Mit seinem Telefon hatte er im gesamten Haus gleichmäßig guten Empfang. Er könnte damit sogar in den Fahrstuhl steigen, die sieben Stockwerke nach unten fahren und gegenüber in der Hotellobby des Hilton einen Kaffee bestellen, ohne dass dabei die Verständigung abreißen würde. Der schlechte Empfang lag unter Garantie nicht an seinem Handy, sondern an dem von Leoni.
»… heute … nie mehr …«
Die weiteren Worte gingen in einem Zischlautstakkato unter, ähnlich dem eines alten Analogmodems bei der Einwahl ins Internet. Dann hörten diese Geräusche so abrupt auf, dass er dachte, die Leitung wäre abgerissen. Er nahm den Hörer vom Ohr und sah auf das grünlich schimmernde Display.
Aktiv!
Er riss den Apparat wieder hoch. Gerade noch rechtzeitig, um ein einziges, deutliches Wort zu verstehen, bevor die Kakophonie aus Wind- und Störgeräuschen wieder einsetzte. Ein Wort, an dem er eindeutig erkannte, dass es wirklich Leoni war, die gerade mit ihm sprechen wollte. Dass es ihr nicht gut ging. Und dass es keine Freudentränen waren, unter denen sie die drei Buchstaben herauspresste, die ihn in den kommenden acht Monaten jeden Tag verfolgen würden: »tot«.
Tot? Er versuchte, dem Ganzen einen Sinn zu geben, indem er sie fragte, ob sie damit sagen wolle, die Verabredung sei gestorben? Gleichzeitig machte sich in ihm ein Gefühl breit, das er sonst nur von Autofahrten in unbekannten Gegenden kannte. Ein Gefühl, das ihn an einer leeren Ampel instinktiv die Fahrertür verriegeln ließ, wenn ein Fußgänger sich seinem Saab näherte.
Doch nicht das Baby?
Es war erst einen Monat her, dass er die leere Verpackung des Schwangerschaftstests im Mülleimer gefunden hatte. Sie hatte es ihm nicht gesagt. Wie immer. Leoni Gregor war das, was er anderen gegenüber liebevoll als »schweigsam« und »geheimnisvoll« beschrieb. Weniger wohlmeinende Menschen würden sie »verschlossen« oder einfach nur »merkwürdig« genannt haben.
Von außen betrachtet, wirkten er und Leoni auf andere wie ein Paar, das man problemlos für eine dieser Fotos ablichten könnte, die häufig zur Verkaufsförderung als Attrappe in neuen Fotorahmen steckten. Motiv: »Frischvermähltes Glück«. Sie, die sanfte Schönheit mit rohrzuckerbraunem Teint und dunkel gelockten Haaren, daneben der jungenhafte Mittdreißiger mit der etwas zu korrekt geschnittenen Frisur, in dessen humorvollen Augen ein Funke Ungläubigkeit darüber aufzublitzen schien, eine so gutaussehende Frau an seiner Seite zu haben. Äußerlich harmonierten sie. Aber charakterlich trennten sie Welten.
Während er ihr bereits beim ersten Date sein gesamtes Leben offenbarte, gab Leoni kaum das Nötigste von sich preis. Nur, dass sie noch nicht lange in Berlin lebte, in Südafrika aufgewachsen und ihre Familie dort bei einem Brand in einer Chemiefabrik ums Leben gekommen war. Davon abgesehen, präsentierte sich ihm ihre Vergangenheit wie ein zerfleddertes Tagebuch mit losen Seiten. Einige Blätter waren flüchtig beschrieben, doch teilweise fehlten ganze Abschnitte. Und wann immer er darauf zu sprechen kommen wollte – auf die fehlenden Kinderfotos, die nicht vorhandene beste Freundin oder die kaum sichtbare Narbe über ihrem linken Jochbein –, wechselte Leoni sofort das Thema oder schüttelte einfach nur leicht den Kopf. Auch wenn daraufhin jedes Mal die Alarmglocken in seinem Kopf schrillten, wusste er, dass diese Geheimniskrämerei ihn nicht davon abhalten würde, Leoni zur Frau zu nehmen.
»Was willst du mir damit sagen, Süße?« Er nahm den Hörer ans andere Ohr. »Leoni, ich verstehe dich nicht. Was tut dir denn leid? Was ist ›nie mehr‹?«
Und wer oder was ist tot?, traute er sich nicht zu fragen, obwohl er nicht davon ausging, dass sie ihn am anderen Ende der Leitung überhaupt verstehen konnte. Er fasste einen Entschluss.
»Pass auf, Liebling. Die Leitung ist so mies – wenn du mich jetzt hörst – dann leg bitte auf. Ich ruf dich gleich wieder an. Vielleicht ist ja dann …«
»Nein, nicht! NICHT!«
Die Verbindung war plötzlich glasklar.
»Na endlich…«, lachte er kurz, stockte dann aber. »Du klingst komisch. Weinst du?«
»Ja. Ich habe geweint, aber das ist nicht wichtig. Hör mir einfach zu. Bitte.«
»Ist etwas passiert?«
»Ja. Aber du darfst ihnen nichts glauben!«
»Wie bitte?«
»Glaub nicht, was sie dir sagen. Okay? Egal, was es ist. Du musst dir …« Der Rest des Satzes ging wieder in einem knarrenden Störgeräusch unter. Gleich darauf zuckte er erschreckt zusammen, drehte sich ruckartig um und sah zur Eingangstür.
»Leoni? Bist du das?«
Er sprach gleichzeitig in den Hörer und in Richtung Tür, an der es laut und kräftig geklopft hatte. Jetzt hoffte er im Stillen, seine Freundin würde endlich davorstehen und der schlechte Empfang hätte nur am Fahrstuhl gelegen. Sicher. Das würde Sinn ergeben. »Es tut mir leid, Schatz, ich komme zu spät. Berufsverkehr, die Route nehme ich nie wieder. Bin völlig tot.«
Aber was soll ich nicht glauben? Warum weint sie? Und weshalb klopft sie an der Tür?
Er hatte ihr heute Vormittag den Wohnungsschlüssel per Boten in die Steuerkanzlei geschickt, in der sie als Aushilfssekretärin arbeitete. Zusammen mit dem Hinweis, sie möge die Frankfurter Allgemeine auf Seite zweiunddreißig aufschlagen. Dort war eine Anzeige abgedruckt, die er aufgegeben hatte: die Wegskizze zu seinem Appartement.
Aber selbst wenn sie den Schlüssel vergessen haben sollte. Wie konnte sie – wie konnte irgendjemand – nach oben gelangt sein, ohne dass der Portier vom Empfang ihm Bescheid gab?
Er öffnete die Tür, und die Antworten blieben aus. Stattdessen kam eine weitere Frage hinzu, denn der Mann, der vor ihm stand, war ein völlig Fremder. Seiner äußeren Erscheinung nach schien er keine große Zuneigung zu Fitnessstudios zu haben. Sein Bauch blähte ein weißes Baumwollhemd so weit nach vorne, dass man nicht sehen konnte, ob er einen Gürtel trug oder ob die fadenscheinige Flanellhose von seinen Speckrollen getragen wurde.
»Entschuldigen Sie die Störung«, begann dieser und fasste sich dabei verlegen mit Daumen und Mittelfinger seiner linken Hand an beide Schläfen, als stünde er kurz vor einer Migräneattacke.
Später konnte er sich nicht mehr erinnern, ob sich der Unbekannte überhaupt vorgestellt oder sogar eine Marke gezeigt hatte. Doch schon dessen allererste Worte klangen so routiniert, dass er sofort verstand: Dieser Mann drang aus beruflichen Gründen in seine Welt, als Polizist. Und das war nicht gut. Gar nicht gut.
»Es tut mir sehr leid, aber …«
O Gott. Meine Mutter? Mein Bruder? Bitte lass es nicht meine Neffen sein. Er ging im Geiste alle möglichen Opfer durch. »Sind Sie bekannt mit einer Leoni Gregor?«
Der Kriminalpolizist rieb sich mit kurzen, dicken Fingern seine buschigen Augenbrauen, die im starken Kontrast zu seinem fast kahlen Schädel standen.
»Ja.«
Er war zu verwirrt, um seine wachsende Angst zu spüren. Was hatte das Ganze hier mit seiner Freundin zu tun? Er sah auf den Hörer, dessen Display ihm versicherte, dass die Verbindung weiterhin gehalten wurde. Aus irgendeinem Grund kam es ihm vor, als ob sein Telefon in den letzten Sekunden schwerer geworden wäre.
»Ich bin so schnell wie möglich gekommen, damit Sie es nicht aus der Abendschau erfahren müssen.«
»Was denn?«
»Ihre Lebensgefährtin … nun, sie hatte vor einer Stunde einen schweren Autounfall.«
»Wie bitte?« Eine unglaubliche Erleichterung durchströmte seinen Körper, und er merkte erst jetzt, wie sich die Furcht in ihm aufgestaut hatte. So also musste sich jemand fühlen, der vom Arzt angerufen wird und die Mitteilung bekommt, man habe sich geirrt. Alles wäre in Ordnung. Man hätte die HIV-Teströhrchen nur vertauscht.
»Soll das ein Scherz sein?«, fragte er halb lachend, worauf der Polizist ihn verständnislos ansah.
Er hob den Hörer ans Ohr. »Schatz, da will jemand mit dir sprechen«, sagte er. Doch kurz bevor er dem Polizisten den Hörer reichen wollte, hielt er noch einmal inne. Irgendetwas stimmte nicht mehr. Etwas war anders.
»Schatz?«
Keine Antwort. Das störende Zischen war plötzlich wieder genauso stark wie zu Beginn des Telefonats.
»Hallo? Süße?« Er drehte sich um, steckte den Zeigefinger seiner freien Hand in sein linkes Ohr und durchquerte mit schnellen Schritten sein Wohnzimmer in Richtung der Fenster.
»Hier ist der Empfang besser«, sagte er zu dem Polizisten, der ihm langsam in die Wohnung gefolgt war.
Doch das erwies sich wieder als Irrtum. Im Gegenteil. Jetzt hörte er gar nichts mehr. Kein Atmen. Keine sinnentleerten Silben. Keine Satzfetzen. Noch nicht einmal mehr ein Rauschen. Nichts.
Und zum ersten Mal begriff er, dass Stille Schmerzen hervorrufen kann, wie es der größte Lärm nicht vermag.
»Es tut mir sehr, sehr leid für Sie.«
Die Hand des Polizisten lastete auf seiner Schulter. Im Spiegelbild der Panoramafenster sah er, dass der Mann bis auf wenige Zentimeter an ihn herangetreten war. Wahrscheinlich hatte er damit Erfahrung. Mit Menschen, die bei der Überbringung der Nachricht zusammenklappten. Und deshalb stellte er sich so unmittelbar in seine Nähe, damit er ihn auffangen konnte. Buchstäblich für den Fall des Falles. Doch dazu würde es nicht kommen.
Nicht heute.
Nicht bei ihm.
»Hören Sie«, sagte er und drehte sich um. »Ich erwarte Leoni in zehn Minuten zum Abendessen. Ich habe gerade eben, kurz bevor Sie an meine Tür klopften, mit ihr telefoniert. Eigentlich telefoniere ich noch in diesem Moment mit ihr und …«
Während er den letzten Satz sprach, reflektierte er bereits darüber, wie er sich anhören musste. Schock, wäre seine eigene Diagnose, würde man ihn als neutralen Psychologen fragen. Aber er war heute kein Neutrum. Er war in diesem Augenblick die unfreiwillige Hauptperson des Schauspiels. Der Blick in die Augen des Polizeibeamten raubte ihm schließlich die Kraft zum Weitersprechen.
Glaub nicht, was sie dir sagen …
»Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihre Lebensgefährtin, Leoni Gregor, vor einer Stunde auf dem Weg zu Ihnen von der Fahrbahn abgekommen ist. Sie prallte gegen eine Ampel und eine Häuserwand. Wir wissen noch nichts Genaueres, aber offenbar fing der Wagen sofort Feuer. Es tut mir leid. Die Ärzte konnten nichts mehr für sie tun. Sie war sofort tot.«
Später, als die Beruhigungsmittel langsam ihre Wirkung verloren, kämpfte sich die Erinnerung an eine frühere Patientin in sein Bewusstsein, die einst ihren Kinderwagen vor der Tür einer Drogerie abgestellt hatte. Sie wollte schnell eine Tube Sekundenkleber kaufen. Für den lockeren Absatz ihrer hochhackigen Schuhe. Da es kalt war, deckte sie ihren fünf Monate alten David gut zu, bevor sie das Geschäft betrat. Als sie drei Minuten später wieder herauskam, stand der Kinderwagen noch vor dem Schaufenster. Doch er war leer. David war verschwunden und blieb es für immer.
Während seiner Therapiegespräche mit der seelisch gebrochenen Mutter hatte er sich oft gefragt, was in ihm selbst wohl vorgegangen wäre. Was er empfunden hätte, wenn er damals die Decke vom Kinderwagen zurückgeschlagen hätte, unter der es so merkwürdig ruhig war.
Er war immer davon ausgegangen, dass er den Schmerz der Frau niemals im Leben würde nachvollziehen können. Seit heute wusste er es besser.
I. Teil
Acht Monate später. Heute.
Im Spiel verraten wir,
wes Geistes Kind wir sind.
Ovid
1.
Salzig. Der Lauf der Pistole in ihrem Mund schmeckte unerwartet salzig.
Komisch, dachte sie. Ich bin früher nie auf die Idee gekommen, mir einmal meine Dienstwaffe in den Mund zu stecken. Nicht mal zum Spaß.
Nachdem die Sache mit Sara passiert war, hatte sie oft darüber nachgedacht, bei einem Einsatz einfach loszulaufen und ihre Deckung preiszugeben. Einmal war sie ohne Schutzweste, völlig ungesichert auf einen Amokläufer zumarschiert. Aber noch nie hatte sie sich ihren Revolver zwischen die Lippen gesteckt und wie ein kleines Kind daran genuckelt, während ihr rechter Zeigefinger zitternd auf dem Abzug lag.
Nun, dann war heute eben die Premiere. Hier und jetzt in ihrer verdreckten Kreuzberger Wohnküche in der Katzbachstraße. Sie hatte den ganzen Morgen den Fußboden mit alten Zeitungen abgedeckt, so, als ob sie renovieren wollte. In Wahrheit wusste sie, welche Sauerei eine Kugel anrichten konnte, die einem den Schädel zerschmettert und Knochen, Blut sowie Teile des Gehirns in einem vierzehn Quadratmeter großen Raum verteilt. Wahrscheinlich würden sie für die Spurensuche sogar jemanden schicken, den sie kannte. Tom Brauner oder Martin Maria Hellwig vielleicht, mit dem sie vor Jahren auf der Polizeischule gewesen war. Egal. Für die Wände besaß Ira keine Kraft mehr. Außerdem waren ihr die Zeitungsseiten ausgegangen, und eine Plastikplane besaß sie nicht. Also saß sie jetzt im Reitersitz auf dem wackligen Holzstuhl mit dem Rücken zur Spüle. Die laminierte Schrankwand und die Metallspüle konnten nach der Spurensicherung leicht mit einem Schlauch abgespritzt werden. Und viel zu sichern gab es sowieso nicht. Alle Kollegen konnten sich an drei Fingern abzählen, warum sie heute einen Schlussstrich zog. Der Fall war eindeutig. Nach dem, was ihr passiert war, würde niemand ernsthaft auf die Idee kommen, hier läge ein Verbrechen vor. Daher machte sie sich gar nicht erst die Mühe, einen Abschiedsbrief zu schreiben. Sie kannte auch niemanden, der Wert darauf legen würde, ihn zu lesen. Der einzige Mensch, den sie noch liebte, wusste ohnehin besser Bescheid als alle anderen und hatte das im letzten Jahr überdeutlich zum Ausdruck gebracht. Durch Schweigen. Seit der Tragödie wollte ihre jüngste Tochter sie weder sehen, sprechen noch hören. Katharina ignorierte Iras Anrufe, ließ ihre Briefe zurückgehen und würde wahrscheinlich die Straßenseite wechseln, wenn sie ihrer Mutter begegnete.
Und ich könnte es dir nicht einmal verübeln, dachte Ira. Nach dem, was ich getan habe.
Sie öffnete die Augen und sah sich um. Da es eine offene amerikanische Küche war, konnte sie von ihrem Platz aus das gesamte Wohnzimmer überblicken. Würden die warmen Sonnenstrahlen des Frühlings nicht so unsagbar fröhlich auf die ungeputzten Fensterscheiben knallen, hätte sie sogar noch einen Blick auf den Balkon und den dahinter liegenden Viktoriapark werfen können. Hitler, schoss es Ira Samin durch den Kopf, als ihre Augen im Wohnzimmer an ihrer kleinen Bücherwand hängen blieben. Sie hatte während der Ausbildung bei der Hamburger Polizei ihre Doktorarbeit über den Diktator geschrieben. »Die psychologische Manipulation der Massen«.
Wenn der Irre eine Sache richtig gemacht hat, dachte sie, dann seine Selbsthinrichtung im Führerbunker. Er hatte sich ebenfalls in den Mund geschossen. Doch aus Angst, dabei etwas falsch zu machen und den Alliierten am Ende als Krüppel in die Hände zu fallen, biss er kurz vor dem Todesschuss noch auf eine Zyankalikapsel.
Vielleicht sollte ich es genauso anstellen? Ira zögerte. Aber es war nicht das Zögern einer Selbstmörderin, die eigentlich bloß einen Hilferuf an ihre Umwelt richtet. Ganz im Gegenteil. Ira wollte auf Nummer sicher gehen. Und ein ausreichender Vorrat an Giftkapseln lag ja griffbereit in dem Gefrierfach ihres Kühlschranks. Digoxin, hochkonzentriert. Sie hatte den Beutel bei dem wichtigsten Einsatz ihres Lebens neben der Badewanne gefunden und niemals in der Asservatenkammer abgegeben. Aus gutem Grund.
Andererseits, Ira schob den Lauf im Mund fast bis an die Würgegrenze vor und hielt ihn völlig zentriert. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir nur den Kiefer zerstöre und die Kugel an den lebenswichtigen Adern vorbei durch irrelevante Teile des Gehirns jage?
Klein. Sehr klein. Aber nicht völlig ausgeschlossen!
Erst vor zehn Tagen hatte man an einer Ampel im Tiergarten einem Mitglied der Hells Angels in den Kopf geschossen. Der Mann sollte schon im nächsten Monat aus dem Krankenhaus entlassen werden.
Die Wahrscheinlichkeit aber, dass sich so etwas wiederholte, war …
Peng!
Ira erschrak so heftig durch den plötzlich einsetzenden Krach, dass sie sich mit der Waffe den Gaumen blutig schabte. Verdammt.Sie zog den Lauf wieder aus ihrem Mund.
Es war kurz vor halb acht, und sie hatte den idiotischen Radiowecker vergessen, der jeden Tag um diese Uhrzeit lautstark losschlug. Im Augenblick heulte sich eine junge Frau die Augen aus dem Kopf, weil sie bei einem dieser bescheuerten Radiospiele verloren hatte. Ira legte ihre Waffe auf den Küchentisch und schlurfte träge in ihr abgedunkeltes Schlafzimmer, aus dem das Gejammer bis in die Küche drang:
»… wir haben Sie per Zufall aus dem Telefonbuch ausgewählt, und Ihnen würden jetzt fünfzigtausend Euro gehören, wenn Sie sich mit der Kohle-Parole gemeldet hätten, Marina.«
»Hab ich doch – ›Ich höre 101Punkt5 und jetzt her mit dem Zaster‹.«
»Zu spät. Sie haben leider zuerst Ihren Namen gesagt. Die Kohle-Parole muss aber sofort nach dem Abheben kommen, und deshalb …«
Ira zog entnervt den Stecker aus der Wand. Wenn sie sich schon umbringen wollte, dann sicherlich nicht unter dem hysterischen Gekreische einer verzweifelten Bürokauffrau, die gerade einen Hauptgewinn verspielt hatte.
Ira setzte sich auf das ungemachte Bett und starrte in ihren geöffneten Kleiderschrank, in dem es aussah wie in einer halb gefüllten Waschmaschine. Irgendwann hatte sie beschlossen, die durchgebrochene Kleiderstange nicht mehr auszutauschen.
So ein Mist!
Sie war noch nie eine gute Organisatorin gewesen. Nicht, wenn es um ihr eigenes Leben ging. Und erst recht nicht bei ihrem eigenen Tod. Als sie heute Morgen aufgewacht war, auf dem gekachelten Fußboden, direkt neben der Kloschüssel, da wusste sie, dass es jetzt so weit war. Dass sie nicht mehr konnte. Nicht mehr wollte. Dabei ging es ihr weniger um das Aufwachen als um den ewig gleichen Traum, der sie seit einem Jahr heimsuchte. Den, in dem sie immer wieder die gleiche Treppe hinaufging. Auf jeder Stufe lag ein Zettel. Nur nicht auf der letzten. Wieso nicht?
Ira stellte fest, dass sie beim Nachdenken die Luft angehalten hatte, und atmete schwer aus. Nachdem das kreischende Radio verstummt war, kamen ihr die Nebengeräusche in der Wohnung jetzt doppelt so laut vor. Das gluckernde Brummen ihres Kühlschranks drang von der Küche bis ins Schlafzimmer. Für einen Moment hörte es sich an, als ob sich das altersschwache Gerät an seiner eigenen Kühlflüssigkeit verschluckte.
Wenn das mal kein Zeichen ist.
Ira stand auf.
Also schön. Dann eben die Tabletten.
Aber die wollte sie nicht mit dem billigen Wodka von der Tankstelle hinunterspülen. Das Letzte, was sie im Leben genoss, sollte ein Gesöff sein, das sie wegen des Geschmacks und nicht nur wegen seiner Wirkung in sich reinkippte. Eine Cola light. Am besten die neue mit Zitronengeschmack.
Genau. Das war eine gute Henkersmahlzeit.Eine Cola light Lemon und eine Überdosis Digoxin zum Nachtisch.
Sie ging in den Flur, griff sich ihre Haustürschlüssel und warf einen Blick in den großen Wandspiegel, an dessen linker oberer Ecke bereits die Beschichtung vom Glas abblätterte.
Schlimm, wie du aussiehst, dachte sie. Heruntergekommen. Wie eine ungekämmte Allergikerin, deren Augen vom Heuschnupfen feuerrot und aufgequollen sind.
Egal. Sie wollte keinen Schönheitspreis mehr gewinnen. Nicht heute. Nicht an ihrem letzten Tag.
Sie nahm ihre abgewetzte schwarze Lederjacke vom Haken, die sie früher so gerne zu engen Jeans getragen hatte. Wenn man sie genau ansah, konnte man trotz der tiefen dunklen Augenringe erahnen, dass sie einmal für den Jahreskalender der Polizei hatte posieren dürfen. Damals, in einem anderen Leben. Als ihre Fingernägel noch gefeilt und die hohen Wangenknochen dezent geschminkt waren. Heute versteckte sie ihre Füße in halbhohen Leinen-Turnschuhen und die schlanken Beine in einer blassgrünen, ausgeleierten Cargo-Hose. Sie ging schon seit Monaten nicht mehr zum Friseur, aber ihr langes, schwarzes Haar wies noch keine einzige graue Strähne auf, und die geraden Zähne waren schneeweiß, trotz der unzähligen Tassen schwarzen Kaffees, die sie täglich in sich reinkippte. Überhaupt hatte ihre Arbeit als Kriminalpsychologin, bei der sie als Verhandlerin einige der gefährlichsten SEK-Einsätze der Republik durchgestanden hatte, nur wenig äußerlich sichtbare Schäden nach sich gezogen. Ihre einzige Narbe verlief kaum sichtbar knapp zehn Zentimeter unter ihrem Bauchnabel. Kaiserschnitt. Sie verdankte sie ihrer Tochter Sara. Ihrer Erstgeborenen.
Vielleicht war es auch ihr Glück, dass Ira nie mit dem Rauchen angefangen hatte und sich deshalb eine faltenfreie Haut bewahrte. Oder ihr Pech, weil sie stattdessen der Ersatzdroge Alkohol verfallen war.
Doch damit ist jetzt Schluss, dachte sie sarkastisch. Mein Mentor wäre stolz auf mich. Ab sofort werde ich keinen Schluck mehr trinken und es sogar durchhalten. Denn jetzt gibt es nur noch Cola light.Vielleicht sogar mit Zitrone, wenn Hakan dieses Getränk führt.
Sie ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen und atmete den typischen Geruch von Reinigungsmitteln, Straßenstaub und Küchendüften ein, den Berliner Altbau-Treppenhäuser regelmäßig verströmen. Ähnlich intensiv wie das Gemisch aus Dreck, Zigarettenqualm und Schmieröl, der einem aus U-Bahnhöfen entgegenschlägt.
Das werde ich vermissen, dachte Ira. Viel ist es nicht, aber die Gerüche werden mir fehlen.
Sie hatte keine Angst. Nicht vor dem Tod. Eher, dass es danach doch noch nicht vorbei sein könnte. Dass die Schmerzen nicht aufhörten, weil das Bild ihrer toten Tochter sie auch nach dem letzten Herzschlag noch verfolgte.
Das Bild von Sara.
Ira ignorierte ihren überquellenden Aluminiumbriefkasten im Hausflur und trat fröstelnd in die warme Frühlingssonne. Sie zog ihr Portemonnaie hervor, nahm das letzte Geld heraus und warf die Brieftasche in einen offenen Baucontainer am Straßenrand. Mitsamt Ausweis, Führerschein, Kreditkarten und dem Fahrzeugschein für ihren altersschwachen Alfa. In wenigen Minuten würde sie das alles nicht mehr benötigen.
2.
»Herzlich willkommen zu Ihrer Führung durch Berlins erfolgreichste Radiostation: 101Punkt5.«
Die zierliche Volontärin zupfte nervös an einer Falte ihres Jeansrocks, pustete sich eine blonde Strähne aus der Stirn und begrüßte lächelnd die Besuchergruppe, die fünf Stufen weiter unten erwartungsvoll zu ihr hinaufsah. Ihr scheues Lächeln entblößte eine kleine Zahnlücke zwischen den oberen Schneidezähnen.
»Ich bin Kitty und das unterste Glied in der Nahrungskette hier im Sender«, scherzte sie passend zu ihrem figurbetonten T-Shirt mit dem Aufdruck »Miss Erfolg«. Sie erläuterte, was die Hörerclubmitglieder in den kommenden zwanzig Minuten alles erleben sollten. »… und zum krönenden Abschluss werden Sie dann Markus Timber und das Team seiner Morgensendung im Studio persönlich kennen lernen. Markus ist mit seinen zweiundzwanzig Jahren nicht nur der jüngste, sondern auch der erfolgreichste Moderator der Stadt, seitdem er bei 101Punkt5 vor anderthalb Jahren auf Sendung ging.«
Jan May verlagerte das Gewicht auf seinen Alukrücken, bückte sich zu der Aldi-Tüte am Boden, in der er die zusammengewickelten Leichensäcke und die Ersatzmunition verstaut hatte. Dabei musterte er verächtlich die begeisterten Gesichter der Gruppenmitglieder. Eine kindliche Frau neben ihm mit bunt bemalten Krallenfingernägeln trug ein billiges Kaufhauskostüm, das sicherlich zu den besten Stücken in ihrem Kleiderschrank zählte. Ihr Freund hatte sich für die Führung ebenfalls herausgeputzt und war in einer gebügelten Bundfaltenjeans erschienen, die er zu neuen Turnschuhen trug. Plattenbau-Couture, dachte Jan abfällig.
Neben dem Pärchen stand ein speckiger Buchhaltertyp mit hufeisenförmigem Haarkranz und aufgeschwemmtem Bürobauch, der sich die letzten fünf Minuten mit einer rothaarigen Frau unterhalten hatte, die sich ganz offensichtlich in anderen Umständen befand. Momentan telefonierte die Schwangere etwas abseits von der Gruppe hinter einem überdimensionalen Pappaufsteller, der den dümmlich grinsenden Star-Moderator in Lebensgröße zeigte.
Siebenter Monat, schätzte Jan. Wahrscheinlich sogar schon weiter.Gut, dachte Jan. Alles in bester Ordnung. Alles …
Seine Nackenmuskeln verkrampften sich, als sich plötzlich hinter ihm die elektrische Empfangstür öffnete.
»Ah, da kommt ja unser Nachzügler«, begrüßte Kitty den kräftigen Paketzusteller lächelnd, der der Volontärin missmutig zunickte, als trüge sie die Schuld an seiner Verspätung.
Verdammt.Jan überlegte fieberhaft, welchen Fehler er gemacht haben könnte. Der Kerl in der braunen, uniformierten Arbeitskleidung stand nicht auf der Liste der Hörerclubgewinner. Er war entweder direkt von der Arbeit gekommen oder wollte den Rundgang noch vor der Frühschicht erledigen. Jan fuhr nervös mit seiner Zunge über seine Zahnattrappe, die sowohl sein Gesicht als auch seine Stimme komplett entstellte. Dann rief er sich die Grundregel ins Gedächtnis, die sie bei ihren Vorbereitungen immer wiederholt hatten: »Es passiert stets etwas Unerwartetes.« Manchmal sogar in den ersten Minuten. Mist. Nicht nur, dass er über den Mann keine Informationen besaß. Der bärtige UPS-Bote mit den lieblos zurückgegelten Haaren sah zudem noch verdammt nach Ärger aus. Entweder sein Oberhemd war in der Wäsche eingelaufen, oder er hatte sich an einer Hantelbank aus ihr heraustrainiert. Jan wog kurz ab, ob er alles abbrechen sollte. Doch dann verwarf er den Gedanken. Dazu waren die Vorbereitungen zu intensiv gewesen. Nein! Jetzt gab es kein Zurück mehr, auch wenn das fünfte Opfer so nicht einkalkuliert war.
Jan wischte sich seine Hände an dem fleckigen Sweatshirt mit der eingenähten Bierbauchattrappe ab. Er schwitzte, seitdem er vor zehn Minuten im Fahrstuhl seine Verkleidung angelegt hatte.
»… und Sie sind der Herr Martin Kubichek?«, hörte er, wie Kitty seinen Tarnnamen laut von der Besucherliste ablas. Offensichtlich musste sich jeder der Truppe hier erst mal vorstellen, bevor’s endlich losging.
»Ja, und ihr solltet mal eure Behinderteneinrichtungen überprüfen, bevor ihr Gäste einladet«, spie er ihr als Antwort entgegen und humpelte auf die Stufen zu. »Wie soll ich denn die Dreckstreppe hier hochkommen?«
»Oh!« Kittys Zahnlückenlächeln wurde noch unsicherer. »Sie haben Recht. Wir wussten nicht, dass Sie, äh …«
Ihr wisst auch nicht, dass ich zwei Kilo Plastiksprengstoff an meinem Körper trage, fügte er in Gedanken hinzu.
Der UPS-Fahrer sah ihn verächtlich an, trat aber einen Schritt zur Seite, als Jan unbeholfen nach vorne humpelte. Das Pärchen und der Büromensch taten einfach so, als ob sein beleidigendes Auftreten mit seiner Behinderung zu entschuldigen sei.
Herrlich, dachte Jan. Zieh dir einen billigen Trainingsanzug an, schnapp dir eine ungepflegte Proletenperücke, und führ dich einfach auf wie ein Irrer – sofort bekommst du alles, was du willst. Selbst Zugang zum erfolgreichsten Radiosender Berlins.
Die Besucher folgten ihm langsam die schmalen Stufen nach oben.
Kitty ging allen voran in Richtung der Redaktionsräume und Studios.
»Nein, mein Liebling. Ich hab’s doch versprochen, ich frag ihn. Ja, ich liebe dich auch ganz dolle …«
Die rothaarige Schwangere eilte als Letzte hinterher und entschuldigte sich, während sie ihr Handy in die Hosentasche steckte.
»Das war Anton«, erklärte sie. »Mein Sohn.« Sie öffnete ihr Portemonnaie und zeigte wie zum Beweis ein abgegriffenes Foto des vierjährigen Knirpses herum. Trotz seiner offensichtlichen geistigen Behinderung hatte Jan selten einen so glücklichen Jungen gesehen.
»Zu wenig Sauerstoff. Die Bauchnabelschnur hat ihn fast erdrosselt«, erklärte sie und schaffte es, dabei gleichzeitig zu lächeln und zu seufzen. Ohne es auszusprechen, wussten alle, welche Angst die Hochschwangere vor einer Wiederholung des Geburtstraumas haben musste. »Antons Vater hat uns noch im Kreißsaal verlassen«, sie verzog ihre Unterlippe. »Nun, dadurch verpasst er jetzt das Beste in seinem Leben.«
»Das glaube ich auch«, bestätigte Kitty und gab ihr das Foto zurück. Ihre Augen glänzten, und sie sah so aus, als lese sie gerade das Ende eines wunderschönen Buches.
»Eigentlich sollte mein kleiner Schatz ja heute mitkommen, aber er hatte gestern Abend wieder einen Anfall.« Die werdende Mutter zuckte mit den Achseln. Anscheinend war das keine Seltenheit bei Anton. »Ich wollte natürlich bei ihm bleiben, aber ich durfte nicht. ›Mama‹, sagte er zu mir, ›du musst für mich gehen und Markus Timber fragen, was er für ein Auto fährt‹«, imitierte sie eine niedliche Kinderstimme.
Alle lachten gerührt, und selbst Jan musste aufpassen, dass er nicht aus seiner Rolle fiel.
»Wir werden es gleich für ihn herausfinden«, versprach Kitty. Sie wischte sich eine Wimper aus dem Augenwinkel, dann führte sie die Gruppe einige Meter weiter in die Großraumredaktion hinein. Beruhigt stellte Jan May fest, dass die Raumaufteilung mit dem Grundriss übereinstimmte, den der entlassene Wachmann für ein Viertelgramm und eine Spritze aus der Erinnerung heraus für ihn aufgezeichnet hatte.
Der gesamte Radiosender befand sich im neunzehnten Stock des Medien-Centers Berlin, einem neumodischen Glashochhaus am Potsdamer Platz, mit einem atemberaubenden Panoramablick über Berlin. Für den Hauptsitz der Redaktion hatte man sämtliche Zwischenwände des Stockwerkes herausgerissen und stattdessen mit Hilfe cremefarbener Raumteiler und einer Unmenge monatlich wechselnder Mietpflanzen eine Kreuzberger Loftatmosphäre geschaffen. Die weißgrauen Massivholzdielen und der dezente Zimtduft, den man der Klimaanlage beimischte, verliehen dem Privatsender etwas Seriöses. Das sollte vielleicht von dem doch eher schrillen Programm ablenken, vermutete Jan und ließ seinen Blick in die rechte Ecke des Stockwerks wandern. Sie war dem »Aquarium« vorbehalten, jenem gewaltigen, gläsernen Dreieck, in dem sich die beiden Sendestudios und die Nachrichtenzentrale befanden.
»Was machen die denn da drüben?«, fragte der übergewichtige Buchhaltertyp mit der Hufeisenfrisur und zeigte auf eine Gruppe von drei Redakteuren in der Nähe der Studios. Sie standen um einen Schreibtisch herum, vor dem ein Mann saß, auf dessen Unterarm ein gelbrotes Flammeninferno tätowiert war.
»Spielen die Schiffe-Versenken?«, witzelte er.
Okay, Mr. Verwaltungsheini übernimmt also die Rolle des Clowns in der Gruppe, registrierte Jan. Kitty lächelte höflich.
»Das sind die Autoren der Show. Unser Chefredakteur schreibt noch höchstpersönlich an einem Beitrag, der in wenigen Minuten fertig sein muss.«
»Der da ist Ihr Chefredakteur?«, fragte das Pärchen fast gleichzeitig. Die junge Frau zeigte dabei völlig ungeniert mit ihrem langen Fingernagel auf den Mann, von dem Jan wusste, dass er von allen Kollegen wegen seiner pyromanischen Neigungen nur »Diesel« genannt wurde.
»Ja. Lassen Sie sich von seinem Aussehen nicht täuschen. Er wirkt etwas exzentrisch«, sagte Kitty, »aber er gilt als einer der genialsten Köpfe der Branche und arbeitet fürs Radio, seit er sechzehn Jahre alt ist.«
»Aha.« Ein kurzes, ungläubiges Raunen ging durch die Gruppe, die sich wieder in Bewegung setzte.
Ich hab noch nie fürs Radio gearbeitet, werde euch aber gleich an meinem ersten Arbeitstag eine Einschaltquote bescheren wie bei einem WM-Endspiel im Fernsehen, dachte Jan, während er langsam hinter der Gruppe zurückblieb, um seine Waffe zu entsichern.
3.
Der abgetrennte Kopf des Hundes lag in einer schwarzroten Blutlache, etwa einen halben Meter vom Kühltresen entfernt. Ira blieb keine Zeit, sich in dem kleinen Gemischtwarenladen nach den sonstigen Überresten des toten Pitbulls umzuschauen. Die beiden Männer, die sich gerade in einer unverständlichen Sprache anschrien und ihre Waffen aufeinander richteten, nahmen ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. Für einen Moment wünschte sie, sie hätte die Warnung des Halbstarken am Eingang ernst genommen.
»Ey, Tusse, bist du irre?«, hatte der Deutschtürke ihr zugerufen, als sie sich an ihm vorbei in den Laden drängen wollte. »Die machen dich aus!«
»Und wenn schon«, war ihr einziger Kommentar gewesen, mit dem sie den perplexen Jugendlichen stehen ließ. Zwei Sekunden später befand sie sich im Zentrum einer Standardsituation: ein Konflikt wie aus dem Lehrbuch des Mobilen Einsatzkommandos, das ihr am ersten Tag ihrer Ausbildung in die Hand gedrückt worden war und das für lange Zeit zu ihrer Bibel wurde. Zwei rivalisierende Ausländer standen kurz davor, sich den Kopf wegzuschießen. Den Mann mit dem hassverzerrten Gesicht und der Schusswaffe in der Hand kannte sie. Es war der türkische Ladenbesitzer Hakan. Der andere sah aus wie das Klischee eines russischen Schlägers. Bulliger Körper, gedrungenes Gesicht mit einer plattgeprügelten Nase, weit auseinanderstehenden Augen und ein Kampfgewicht von mindestens einhundertfünfzig Kilo. Er trug Badelatschen, eine Jogginghose und ein dreckiges Feinrippunterhemd, das seine üppige Ganzkörperbehaarung nur spärlich verdeckte. Das Auffälligste an ihm aber waren die Machete in seiner linken Hand und die Pistole in der rechten. Ganz sicher stand er auf der Gehaltsliste von Marius Schuwalow, dem Oberhaupt des organisierten osteuropäischen Verbrechens in Berlin.
Ira lehnte sich an den gläsernen Kühlschrank mit den Softdrinks und fragte sich, warum ihre Waffe zu Hause auf dem Küchentisch lag. Doch dann fiel ihr ein, dass es heute sowieso nicht mehr darauf ankam.
Zurück zum Handbuch, dachte sie. Kapitel Deeskalation, Absatz2: Krisenintervention. Während die beiden Männer sich weiter anbrüllten, ohne von Ira Notiz zu nehmen, ging sie mechanisch ihre Checkliste durch.
Unter normalen Bedingungen müsste sie die nächsten dreißig Minuten damit verbringen, die Situation einzuschätzen, den Tatort absperren zu lassen, um zu verhindern, dass aus der stationären eine mobile Einsatzlage wurde, etwa indem der Russe wild um sich schießend in den Viktoriapark rannte. Normal? Ha!
Unter normalen Bedingungen würde sie hier gar nicht stehen. Eine direkte Konfrontation, Auge in Auge und in unmittelbarer Nähe, ohne dass man zuvor auch nur eine Spur Vertrauen zu den Eskalationsparteien aufgebaut hatte, war ein Selbstmordkommando. Und sie wusste ja noch nicht einmal, worum es hier ging. Bei zwei Männern, die sich in verschiedenen Sprachen gleichzeitig anbrüllten, brauchte sie dringend den besten Dolmetscher, den das LKA zu bieten hatte. Und sie müsste sofort durch einen männlichen Verhandlungsführer ausgewechselt werden. Denn auch wenn sie ihr Psychologiestudium und die daran anschließende Ausbildung bei der Polizei mit Auszeichnung bestanden hatte, auch wenn sie seitdem zahlreiche Einsätze als Verhandlungsführerin bei Sondereinsatzkommandos im ganzen Bundesgebiet geleitet hatte, hier, in diesem Moment, konnte sie mit ihren Diplomen und Urkunden den Boden des Kramladens aufwischen. Weder der Türke noch der Russe würden auf eine Frau hören. Das verbot ihnen wahrscheinlich schon die Religion. Und das Motiv.
Meistens ging es in diesem Viertel um irgendeine Machoangelegenheit, und auch das hier sah nicht nach einer Schutzgelderpressung aus. Sonst wäre der Ukrainer nicht alleine gekommen, und Hakan läge bereits von mehreren Gewehrsalven durchsiebt mit dem Gesicht in der Kühltheke mit dem Feta. Als Ira hörte, wie der Russe den Hahn seines Trommelrevolvers spannte und die Machete fallen ließ, damit er beim Schießen beide Hände zur Verfügung hatte, warf sie einen Blick durchs Schaufenster nach draußen. Bingo. Da haben wir ja das Motiv. Dort stand ein tiefergelegter weißer BMW mit verchromten Felgen und einem kleinen Schönheitsfehler. Sein rechter Front-Scheinwerfer war zersplittert, und die Stoßstange hing auf Halbmast. Ira notierte auf einem imaginären Flipchart die Tatort-Puzzlesteine.
Türke. Russe. Machete. Kaputtes Zuhälterauto.Toter Hund.Offenbar war Hakan mit dem Wagen des Russen zusammengeprallt, und der war hier, um das nach »seiner Methode« zu regeln, indem er zur Begrüßung erst mal Hakans Kampfhund den Kopf abschlug.
Die Situation ist aussichtslos, dachte Ira. Das einzig Gute war: Außer ihr befand sich kein anderer Kunde in Schussweite, wenn die Ballerei in wenigen Sekunden losgehen würde. Und dass es zu einem Kugelwechsel kommen würde, stand völlig außer Frage. Immerhin ging es hier um einen Schaden von mindestens achthundert Euro. Fraglich war nur, wer den ersten Schuss abgab. Und wie lange es dauerte, bis ein Querschläger sie traf.
Also gut. Hier würde keiner einfach klein beigeben. Es war auch für keinen der beiden Männer ratsam. Der Erste, der die Waffe senkte, hätte eine Neun-Millimeter-Patrone im Kopf. Und dazu die Schmach. Weil er selbst keinen Schuss abgegeben hatte, würden ihn bei seinem Begräbnis alle für einen Feigling halten.
Gleichzeitig wollte hier aber auch keiner seine Ehre verlieren und als Erster rumballern. Das war der einzige Grund, warum sie nicht schon längst ein Blutbad angerichtet hatten, wenn man mal von dem Pitbull auf den Fußbodenfliesen absah.
Ira nickte zustimmend, als sie eine weitere Eskalationshandlung des Russen beobachtete, der einen Schritt auf den Kühltresen zuging und voller Wucht auf dem abgeschlagenen Hundekopf herumtrampelte, so hart es seine Badelatschen eben erlaubten. Hakan, fast wahnsinnig vor Wut, schrie so laut, dass Iras Trommelfelle knackten.
Noch zehn Sekunden vielleicht. Allenfalls zwanzig, dachte sie. Mist. Ira hasste Suizidverhandlungen. Sie war auf Geiselnahme und Kidnapping spezialisiert. Dennoch wusste sie: Die sicherste Chance bei Lebensmüden hatte man, wenn man ihre Aufmerksamkeit ablenkte. Weg von dem eigenen Tod. Hin zu etwas weniger Wichtigem. Etwas Banalem. Etwas, bei dem nicht so viel auf dem Spiel stand, wenn es misslang.
Natürlich, dachte Ira und machte die Kühlschranktür auf.
Ablenkung.
»Hey«, rief sie, ihren Rücken den Duellanten zugewandt, »hey«, brüllte sie lauter, als keiner der beiden Männer von ihr Notiz zu nehmen schien.
»Ich hätte gern eine Cola!«, schrie sie noch einmal und drehte sich um. Und jetzt hatte sie es geschafft. Ohne die Waffen runterzunehmen, sahen beide Männer zur ihr hinüber. In ihren Blicken lag eine Mischung aus Fassungslosigkeit und blankem Hass.
Was wollte die Irre?
Ira lächelte.
»Und zwar light. Am besten eine Cola light Lemon.«
Atemlose Stille. Nur kurz. Dann fiel der erste Schuss.
4.
Kitty eilte ins A-Studio und stolperte dort fast über Markus Timber, der im Schneidersitz auf dem Fußboden saß und gelangweilt in einem Männermagazin blätterte. »Verflucht, pass doch auf!«, schnauzte er und rappelte sich umständlich hoch.
»Wie viel Zeit noch, Flummi?«, raunzte er seinen schlaksigen Produzenten an.
Benjamin Flummer sah vom Mischpult hoch auf den Studiomonitor, dessen Digitalanzeige ihm die Restlaufzeit von Madonna mitteilte.
»Noch vierzig Sekunden.«
»Okay.« Timber fuhr sich mit seinen langen Fingern durch seine blassblonden Haare.
»Und was machen wir jetzt?«
Wie immer hatte er keinen Überblick über den Sendeablauf und vertraute seinem Showproduzenten blind, wenn dieser ihn über das nächste Highlight seiner eigenen Sendung aufklärte.
»Es ist 7.28 Uhr. Der erste Cash Call ist gerade gelaufen. Wir können noch einen Song spielen, und danach haben wir was fürs Herz. Der dreijährige Felix stirbt in vier Wochen, wenn sich kein Knochenmarkspender findet.«
Timber verzog angewidert sein Gesicht, während Flummi unbeirrt fortfuhr: »Du rufst die Hörer dazu auf, sich typisieren zu lassen, ob sie als Spender in Frage kommen. Wir haben alles organisiert: Im großen Konferenzsaal stehen Liegen bereit, und drei Ärzte werden ab 12.00 Uhr jedem, der in den Sender kommt, einen halben Liter Blut abnehmen.«
»Hmm.« Timber grunzte widerwillig. »Haben wir wenigstens das Gör am Telefon, wie es sich die Augen vor Dankbarkeit aus dem Kopf heult?«
»Der Junge ist erst drei und hat Krebs. Du sprichst mit der Mutter«, antwortete Flummi knapp und prüfte mit der Vorhörtaste, ob der erste Spot des Werbecomputers richtig platziert war.
»Ist sie heiß?«, wollte Timber jetzt wissen und warf das Magazin in den Mülleimer.
»Wer?«
»Die Mutter!«
»Nein.«
»Dann ist Felix gestorben.« Timber rappelte sich auf und grinste als Einziger über seine geschmacklose Zweideutigkeit.
»Hast du damit ein Problem?«, fauchte er Kitty an, als er sah, dass sie immer noch vor ihm stand. »Eine Knochenmarkspende? Leben retten? Das ist doch bestimmt deine kitschige Idee gewesen, was?«
Kitty hatte große Mühe, die Fassung nicht zu verlieren.
»Nein.«
»Und warum atmest du mir dann hier im Studio die Luft weg?«
»Es geht um die Gruppe«, sagte sie schließlich.
»Die was?«
»Ich hab vergessen, dir zu sagen, dass heute eine Besuchergruppe kommt.«
»Wer?« Timber schaute sie an, als ob sie den Verstand verloren hätte.
»Die Hörerclubmitglieder?« Sie stellte die Antwort als Frage, so als ob sie sich selber nicht mehr sicher wäre, wer gerade im Nachbarstudio stand und darauf wartete, ins Allerheiligste vorgelassen zu werden. Normalerweise wäre es Kittys Job gewesen, Timber schon am Vortag über dieses Ereignis zu informieren. Da sie es nicht getan hatte, stand er jetzt in wenigen Augenblicken seinen treuesten Anhängern unrasiert und in zerrissenen Jeans gegenüber. Er hatte in seiner kurzen Zeit beim Sender Mitarbeiter schon für weniger gefeuert, und dieses Mal würde sie vermutlich das nicht retten können, weshalb sie überhaupt von ihm eingestellt worden war: ihr Dekolleté.
»Wann kommen die?«, fragte Timber völlig entgeistert.
»Jetzt!«
Sobald der Krückenmann endlich wieder vom Klo runterkam. Wenigstens hatte es etwas Gutes, dass der unangenehme Prolet gerade jetzt die restlichen Besucher noch etwas aufhielt.
Der Moderator blickte seitlich an Kitty vorbei durch die getönte, schalldichte Glasscheibe, die das Sendestudio A vom dahinter liegenden Service-Bereich trennte. Tatsächlich. Eine Gruppe von vier Hörern klatschte dem Nachrichtenchef Beifall für irgendetwas, was dieser gerade zu ihnen gesagt hatte.
»In etwa drei Minuten.«
»Hol sofort meine Autogrammkarten!«, befahl er und nickte mit dem Kopf nach links in Richtung einer Seitentür neben dem Regal mit den Archiv-CDs.
Wenigstens steckt noch ein Rest Professionalität in ihm, dankte Kitty ihrem Schöpfer, während sie losrannte. Es hätte sie auch nicht weiter gewundert, wenn er unmittelbar vor den Gästen ausfallend geworden wäre. Kitty riss die kleine Tür zum »Erlebnisbereich« auf. Die Moderatoren hatten dem kleinen, fensterloser Aufenthaltsraum, in dem man essen, rauchen und sich frisch machen konnte, den ironischen Spitznamen gegeben. Letztlich bestand sein Inventar nur aus einer Küchenzeile und einem wackligen Esstisch. Der Bereich war ausschließlich vom A-Studio aus begehbar. Über ihn war ein Technikschaltraum erreichbar und der Notausstieg für Brandfälle. Letzterer war ein Meisterwerk architektonischer Fehlplanung. Im Ernstfall lief man hier in eine Falle. Hinter der Tür führte eine Aluminium-Wendeltreppe an der Außenwand entlang, ein halbes Stockwerk hinunter auf einen begrünten Dachvorsprung und endete genau dort. Im Nichts. Irgendwo zwischen dem achtzehnten und neunzehnten Stock.
Kitty sah sich um. Timber hatte seinen schwarzen Designerrucksack neben die Spüle zwischen einem Aschenbecher und einem halbvollen Kaffeebecher abgestellt. Sie wühlte fieberhaft darin herum, um die verdammten Autogrammkarten zu finden. Gerade, als sie erleichtert einen kleinen Stapel mit Timbers retuschiertem Hochglanzgesicht herauszog, fuhr ihr der Schreck in die Glieder.
»Herzlich willkommen!«
Sie drehte sich um und sah durch einen eingelassenen Glasstreifen in der Tür zum Erlebnisbereich ins A-Studio, wo Timber gerade irgendjemandem zur Begrüßung die Hand reichte. Oh, bitte nicht! Kubichek musste von der Toilette zurück sein, und der Nachrichtenchef führte die Gruppe entgegen der Absprache bereits jetzt ins Studio. Timber würde ausrasten, so viel war sicher. Ein weiterer Punkt auf ihrer Abschussliste.
»Schön, dass Sie hier sind!«
Die Stimme des Star-Moderators drang aus dem Studio dumpf durch die geschlossene Tür. Diese war hinter Kitty zugefallen, als sie den »Erlebnisbereich« betreten hatte. Da sie nur nach außen geöffnet werden konnte, musste Kitty jetzt abwarten, bis sich alle Hörer an der Tür vorbeigezwängt und an der »Theke« Platz genommen hatten.
Die »Theke« schwang sich in einer leichten U-Form wie ein Hufeisen um das große Sendemischpult, vor ihr standen Barhocker für die Studio-Gäste. Kitty ging zurück zur Tür und spähte angespannt in das Studio hinein. Mittlerweile saßen fast alle Besucher auf ihren Stühlen. Alle, bis auf einen.
Was macht der Idiot da so lange am Eingang?, fragte sie sich. Wieso kommt er nicht rein, wie die anderen? Aha. Gut.
Jetzt humpelte er endlich auch nach vorne. Aber wieso zog er die schwere Studiotür hinter sich zu? Man konnte in dem kleinen Sendestudio sowieso kaum atmen.
O Gott. Kitty hielt sich unwillkürlich die Hand vor den Mund. Was hat er vor?
Zehn Sekunden später sah sie es und begann zu schreien.
5.
Für Jan gab es nur eine einzige Möglichkeit, wenn er das Überraschungsmoment in dieser kritischen Phase für sich ausnutzen wollte: Er musste jemanden verletzen, so schnell und so spektakulär wie möglich. Er benötigte eine eindrucksvolle Inszenierung. Etwas Schockierendes, das einen unbeteiligten Zuschauer sofort paralysierte. Also reichte er Timber die Hand zur Begrüßung, doch bevor der Moderator sie ergreifen konnte, zog Jan sie wieder weg, hob den Alugriff seiner Krücke an und hieb ihn mit Brachialgewalt auf dessen Nase.
Der Blutstrahl, der sich aus Timbers Gesichtsmitte auf das Mischpult vor ihm ergoss, und der damit verbundene, entsetzliche Aufschrei des Moderators erzielten die gewünschte Wirkung. Niemand im Raum unternahm irgendetwas. Genau wie erwartet. Vor allem am Gesicht des Showproduzenten konnte Jan ablesen, wie dessen Gehirn vergeblich versuchte, das Geschehene zu verarbeiten. Flummi war auf eine harmlose Begrüßungsszene mit oberflächlichem Smalltalk eingestellt gewesen. Der Anblick des Moderators, der sich wimmernd beide Hände vors Gesicht hielt, passte einfach nicht in diese Erwartungshaltung. Ebendiese Verwirrung hatte Jan einberechnet. Sie verschaffte ihm Zeit. Mindestens anderthalb Sekunden.
Mit einem Handkantenschlag zertrümmerte er die kleine Scheibe des Notrufkastens an der Wand und aktivierte den Alarmknopf. Augenblicklich übertönte eine schrille Sirene die letzten Töne des neuesten Hits von U2. Gleichzeitig fiel eine schwere Metalljalousie von außen vor dem großen Studiofenster herunter und nahm der Außenwelt die Sicht auf das Chaos im Inneren des A-Studios.
»Was zum Teufel …?« Der UPS-Fahrer hatte, wie erwartet, als Erster seine Stimme wiedergefunden. Er hockte am Ende der Theke, am weitesten von Jan entfernt. Zwischen ihnen saßen die Schwangere, das junge Pärchen und der übergewichtige Behördenwitzbold.
Jan riss sich mit der linken Hand die Perücke vom Kopf und zog mit der anderen die Pistole aus der Tasche seiner Jogginghose.
»Um Himmels willen, bitte …« Er konnte in dem ohrenbetäubenden Lärm nur ahnen, was die Schwangere zu ihm sagen wollte. Doch sie schaffte es nicht, ihren Satz zu vollenden. Sie erstarrte, als er die Pistole auf Timbers blutverschmiertes Gesicht richtete und dabei kurz auf die Studiouhr sah. 7.31 Uhr.
Er hatte zehn Minuten, sieben Geiseln und drei Türen. Eine zum B-Studio. Eine zum News-Bereich. Die dritte direkt hinter ihm führte zu einer Art Küche. Davon hatte ihm der Junkie-Wachmann zwar nichts gesagt, aber wenn er sich richtig an den Grundriss des Gebäudes erinnerte, konnte sie zu keinem Ausgang führen. Um sie würde er sich also später kümmern. Jetzt musste er erst einmal seine Geiseln daran hindern, durch eine der beiden anderen Türen das Studio zu verlassen. Der Wachschutz war wegen des Alarms bereits auf dem Weg und würde in weniger als sechzig Sekunden von außen Stellung beziehen. Aber das bereitete ihm überhaupt keine Sorgen. Eben deshalb war er ja als Letzter reingegangen und hatte das Keycodeschloss an der Studiotür manipuliert. Das elektronische Schloss war ein sicherheitstechnischer Witz. Sobald dreimal hintereinander der falsche Nummerncode eingetippt wurde, kam niemand mehr in den Studiobereich hinein. Die Tür wurde automatisch verriegelt, und eine Zeitschaltuhr sorgte dafür, dass man zehn Minuten warten musste, bevor ein neuer Versuch möglich war.
Wie zur Bestätigung rüttelten in diesem Moment die Wachmänner von außen an der Klinke. Da sie wegen der heruntergelassenen Jalousien keine Sicht ins Studio hatten, wussten die schlecht ausgebildeten Aushilfskräfte nicht, was sie jetzt tun sollten. Auf so eine Situation waren sie nicht vorbereitet.
Jan freute sich gerade, dass so weit alles nach Plan verlief, als die Dinge außer Kontrolle gerieten.
Er hatte es geahnt: der UPS-Fahrer! Später machte er sich große Vorwürfe, weil er nicht bedacht hatte, dass er in Berlin nicht der Einzige war, der eine Waffe bei sich trug. Gerade wenn jemand als Paketbote täglich bei wildfremden Menschen an der Haustür klingelte, wusste er natürlich die beruhigende Wirkung einer Pistole zu schätzen. In dem winzigen Moment, als Jan seinen Geiseln ein erstes Mal den Rücken zudrehen musste, um hinter die Theke und vor das Mischpult zu gelangen, hatte der Bote seine Schusswaffe gezogen.
Okay, du willst also den Helden spielen, dachte Jan und ärgerte sich, dass er bereits in diesem frühen Stadium eine Geisel opfern musste.
»Waffe runter!«, rief der Paketbote, so wie er es aus den Tatortkrimis im Fernsehen her kannte, doch Jan ließ sich nicht beirren. Stattdessen riss er den stöhnenden Timber zu sich hoch.
»Sie machen einen großen Fehler«, sagte Jan und hielt Timber seine Beretta an die Schläfe. »Noch können Sie ihn korrigieren.«
Der Fahrer begann zu schwitzen. Er wischte sich die rechte Schläfe mit dem Ärmel seiner braunen Uniform ab.
Noch sieben Minuten. Vielleicht nur sechs, wenn die Wachleute draußen schnell waren und etwas von ihrem Job verstanden.
Also gut. Jan sah die Panik in den verängstigten, blassgrauen Augen des Paketzustellers, und er war sich sicher, dass dieser nicht schießen würde. Aber er konnte in dieser frühen Phase kein zu großes Risiko eingehen. Doch kurz bevor er dazu ansetzte, Timber wegzustoßen, damit ihm genügend Bewegungsspielraum für einen sicheren Schuss blieb, sah er den zentralen Netzschalter am Mischpult. Ihm kam eine noch viel bessere Idee. Er nahm Timber wieder fester in den Schwitzkasten und zog ihn einen halben Meter zurück zur Wand, die Pistole immer noch an dessen Kopf gepresst.
»Keinen Schritt weiter!«, schrie der Fahrer aufgeregt. Doch Jan lächelte nur müde.
»Okay, okay. Ich bleib ja schon, wo ich bin.«
Und dann hatte er wieder das Überraschungsmoment auf seiner Seite. Einfach indem er den großen Schalter an der Wand hinter sich umlegte. Das Licht ging schlagartig aus. Bevor sich die Augen seiner Geiseln an das plötzliche Dämmerlicht gewöhnen konnten, schaltete Jan mit seiner freien linken Hand das Studiomischpult mitsamt allen angeschlossenen Flat-Screen-Monitoren ab. Jetzt war das Studio nahezu in völlige Finsternis getaucht. Nur das rote Licht zweier Not-LEDs zuckte wie Glühwürmchen durch die Dunkelheit.
Wie erwartet erstarrten die Geiseln durch diesen einfachen Trick und waren erneut wie gelähmt. Der UPS-Fahrer konnte sein Gegenüber nicht mehr genau sehen, also zögerte er mit weiteren Maßnahmen.
»Du verfluchter Bastard, was soll das?«, schimpfte er.
»Ruhig bleiben«, befahl Jan in die Dunkelheit hinein. »Wie heißen Sie?«
»Manfred, aber das geht dich einen Scheißdreck an.«
»Aha, Ihre Stimme flattert. Sie haben Angst«, stellte Jan fest.
»Ich knall dich ab. Wo bist du?«
Für einen kurzen Moment wurde das künstliche Dunkel von einer kleinen gelben Feuerzeugflamme erhellt. Danach sah man das rot glühende Ende einer Zigarette mitten in der Luft schweben.
»Hier. Aber schießen Sie besser nicht in meine Richtung.«
»Verdammt, wieso nicht?«
»Weil Sie wahrscheinlich nur meinen Oberkörper erwischen.«
»Na und? Was wäre daran falsch?«
»Gar nichts. Aber Sie würden den schönen Plastiksprengstoff zerstören, den ich mir um den Bauch gebunden habe.«
»O mein Gott«, stöhnten der Verwaltungsbeamte und die Schwangere gleichzeitig auf. Jan hoffte, dass die anderen Geiseln sich die nächsten Sekunden nicht aus ihrer inneren Erstarrung befreien würden. Einen einzelnen Aufständischen konnte er vielleicht noch beherrschen. Die gesamte Gruppe nicht.
»Du verarschst uns!«
»Meinen Sie? Ich an Ihrer Stelle würde es nicht darauf ankommen lassen.«
»Scheiße!«
»Sie sagen es. Jetzt werfen Sie Ihre Pistole zu mir nach vorne über das Mischpult. Und zwar ein bisschen plötzlich. Wenn in fünf Sekunden das Licht wieder angeht und ich immer noch die dämliche Waffe in Ihrer Hand sehe, dann jage ich unserem Star-Moderator hier eine Kugel in den Schädel. Ist das klar?«
Da der Fahrer keine Antwort gab, hörte man für einen Augenblick nur das Rauschen der Klimaanlage.
»Also schön, dann mal los.« Jan klopfte Timber auf die Schulter. »Zählen Sie von fünf an rückwärts!«, kommandierte er.
Nach kurzem Schnauben und dumpfem Stöhnen begann Timber mit nasaler und ungewohnt zittriger Stimme mit dem makabren Countdown: »Fünf, vier, drei, zwei, eins.«
Dann polterte es. Und als das Licht wieder anging, sahen die restlichen Geiseln etwas, das sie in ihrem Leben nie wieder vergessen würden.
Der Paketfahrer hing bewusstlos über der Theke. Der vom eigenen Blut völlig besudelte Markus Timber umklammerte ängstlich seinen Produzenten, dem wiederum Jan seine Zigarette in den Mund gesteckt hatte, bevor er seelenruhig um die Theke herumspaziert war, um Manfred von hinten bewusstlos zu schlagen.
Jan registrierte zufrieden das Entsetzen in den Gesichtern seiner Opfer. Jetzt, nachdem er das einzige Alpha-Tier im Raum ausgeschaltet und dabei trotzdem alle Geiseln behalten hatte, verlief für ihn alles wieder ganz nach Plan. Er ließ sich von Flummi und Timber deren Schlüssel geben und schloss zuerst die Tür zum Nachrichtenbereich ab. Dann verriegelte er das B-Studio und knickte anschließend den Schlüssel im Schloss um.
»Was wollen Sie von uns?«, fragte ihn Timber ängstlich. Jan gab keine Antwort, sondern verscheuchte ihn mit einem Wink seiner Pistole auf einen Besucherplatz hinter der Theke. Flummi hingegen musste bei ihm bleiben. Jetzt, wo sie wussten, dass er eine lebende Bombe war, würde niemand mehr die Hand gegen ihn erheben, und so konnte er die dürre Bohnenstange ohne Gefahr neben sich dulden. Zumal er jemanden brauchte, der sich mit der Technik auskannte. Er befahl dem Show-Produzenten, alles Erforderliche zu tun, damit sie wieder auf Sendung gehen konnten.
»Wer sind Sie?«, stellte Timber eine weitere Frage, diesmal von der anderen Seite des Mischpultes. Wieder ohne eine Antwort zu erhalten.
Zufrieden registrierte Jan, dass die Monitore und das Mischpult wieder funktionierten, und zog den Mikrophongalgen zu sich heran. Dann drückte er auf den roten Signalschalter auf dem Touchscreen-Keypad vor sich, so wie er es zu Hause an der Attrappe wieder und wieder geübt hatte. Er war so weit. Es konnte losgehen.
»Wer zum Teufel sind Sie?«, fragte Timber noch einmal, und dieses Mal konnte ihn die ganze Stadt dabei hören. 101Punkt5 war wieder auf Sendung.
»Wer ich bin?«, antwortete Jan endlich, während er die Pistole erneut auf Timber richtete. Und dann wurde seine Stimme ganz sachlich und ernst. Er sprach direkt in das Mikrophon:
»Hallo Berlin. Es ist 7.35 Uhr. Und Sie hören gerade Ihren größten Albtraum.«
6.
Ira saß im Schneidersitz auf dem gräulich gemusterten Fliesenboden des Gemischtwarenladens und starrte nunmehr seit über zwanzig Minuten in die Waffe des Russen. Seine erste Kugel hatte sie um mehrere Meter verfehlt und ein münzgroßes Loch in die Plexiglasscheibe des Kühlschranks gerissen. Seitdem zielte er auf ihre Brust, während Hakan seinerseits die Waffe auf den Kopf des Schlägers richtete.
»Lass sie in Ruhe!«, forderte er, was der Russe mit einem unverständlichen Wortschwall kommentierte. Die Situation war endgültig hoffnungslos verfahren. Soweit Ira das unaufhörliche Kauderwelsch des Russen verstehen konnte, wollte er jetzt statt Rache doch lieber das Geld aus der Kasse von Hakan nehmen, sonst sollte der zweite Schuss sein Ziel treffen.
Und das tat er dann auch.
Die erste Patrone durchschlug das Schulterblatt, das zweite Projektil zerfetzte die Kniescheibe samt Meniskus. Der Russe ließ seine Waffe fallen, während er vor der Theke einknickte. Erst als er am Boden aufschlug und realisierte, wie unnatürlich sein Bein abgewinkelt war, begann er zu schreien. Wie Iras Gehirn hatte auch das seine ganz offensichtlich erst mit Zeitverzögerung die veränderte Sachlage registriert.
»Waffe runter und Hände hoch«, brüllte eine Stimme vom Eingang in Hakans Richtung. Ira stand auf und drehte sich etwas benommen zu dem kräftig gebauten SEK-Mann herum, der in voller Montur die Tür des Gemischtwarenladens ausfüllte.
»Was machst du denn hier?«, fragte sie ihn überrascht.
An der Art, wie er mit dem Handrücken das Visier seines titanlegierten Schutzhelmes hochklappte, hatte sie ihn erkannt. Seine wachen Augen musterten sie, und in seinem Blick lag wie immer jene ungewöhnliche Mischung aus Entschlossenheit und Melancholie.
»Dasselbe könnte ich dich fragen, Schätzchen.«
Oliver Götz hielt die Maschinenpistole weiterhin auf Hakan gerichtet, der seiner Anweisung bedingungslos gefolgt war und in diesem Moment seine unbewaffneten Hände zur Ladendecke streckte. Er fingerte mit der linken Hand zwei Plastikfesseln aus einer Brusttasche und warf sie Ira zu.
»Du weißt ja, wie es geht.«
Sie sammelte zunächst die Waffen am Boden ein und gab sie Götz. Danach band sie erst Hakan und dann dem Russen die Hände hinter dem Rücken zusammen, was Letzteren zu lauten Schmerzensschreien brachte.
»Wo sind denn die anderen?« Ira sah durch das Schaufenster, konnte aber niemanden entdecken. Normalerweise arbeitete das SEK Berlin wie jedes Sondereinsatzkommando der Polizei immer im Team. Bei einem Einsatz wie diesem rückten mindestens sieben Mann gleichzeitig aus. Doch Götz stand ganz allein vor ihr. Zudem war ihr völlig schleierhaft, wie es das SEK so schnell zum Tatort hatte schaffen können.