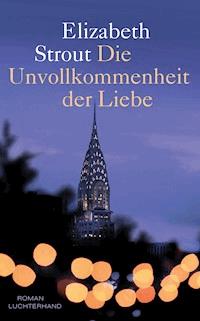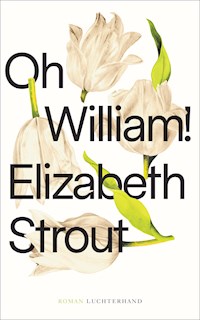2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein drückend heißer Sommer in der Kleinstadt Shirley Falls, New England: Der allseits beliebte Mathematiklehrer Mr. Robertson verlässt die Stadt, Isabelle schneidet ihrer sechzehnjährigen Tochter Amy wutentbrannt die langen blonden Locken ab, und Amy wünscht sich weit weg. Sie hält es kaum noch aus, mit ihrer verhassten und doch geliebten Mutter unter einem Dach zu leben. Und Isabelle, die Amy ganz allein großgezogen hat und stets um Anerkennung kämpfte – Isabelle muss sich eingestehen, dass ihre Wut auf die Tochter nicht nur wegen Mr. Robertson so groß ist; sie ist auch neidisch …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Über das Buch
In der Kleinstadt Shirley Falls in New England herrscht ein drückend heißer Sommer, der die Menschen träge und gereizt macht. Die sechzehnjährige Amy arbeitet mit ihrer Mutter Isabelle im Büro der Holzfabrik und lauscht errötend Fat Bevs anzüglichen Klatschgeschichten. Fat Bev ist so ganz anders und so viel interessanter als ihre spröde Mutter, mit der sie kaum noch ein Wort wechselt. In vielerlei Hinsicht lieben und hassen sich Amy und Isabelle wie alle Mütter und Töchter. Aber seit die bis über beide Ohren verliebte Amy mit ihrem Mathematiklehrer Mr. Robertson hinter beschlagenen Autofenstern ertappt wurde, scheint die Distanz unüberbrückbar. Damals, im Juni, verließ
Mr. Robertson die Stadt, und Isabelle schnitt ihrer Tochter voller Wut die langen blonden Haare ab. Der Skandal, den Isabelle so fürchtet, reißt alte Wunden auf und konfrontiert sie mit ihrer eigenen Vergangenheit. Während Amy woanders nach Zuneigung sucht, stellt sich Isabelle ihren Ängsten und lernt, wie man Freundschaft schließt. Und endlich finden auch Mutter und Tochter wieder zueinander …
Über die Autorin
ELIZABETH STROUT wurde 1956 in Portland, Maine, geboren und lebt heute in New York. Nach dem Jurastudium begann sie zu schreiben. Ihr erster Roman »Amy & Isabelle« wurde für die Shortlist des Orange Prize und den PEN / Faulkner Award nominiert und wurde ein Bestseller. Für den Roman »Mit Blick aufs Meer« erhielt Elizabeth Strout den Pulitzerpreis.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalausgabe erschien 1998 unter dem Titel »Amy and Isabelle« bei Random House, Inc., New York.
Genehmigte Taschenbuchausgabe Mai 2011 btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München,
Neumarkter Str. 28, 81673 München Copyright © der Originalausgabe 1998 Elizabeth Strout Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2011 Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der deutschen Übersetzung Piper Verlag GmbH, München 1998
Umschlaggestaltung: semper smile München
Umschlagmotiv: © Walter Bibikow / AG E / F1 online
CP · Herstellung: SK
ISBN 978-3-641-05955-2
V003
www.btb-verlag.de
www.randomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
FÜR ZARINA
Danksagung
Ich danke Marty Feldman, Daniel Menaker und Kathy Chamberlain für ihre unschätzbare Unterstützung
1
Der Sommer, in dem Mr. Robertson die Stadt verließ, war furchtbar heiß, und lange Zeit wirkte der Fluß wie tot. Nichts als ein totes, braunes schlangenartiges Etwas, das sich flach mitten durch die Stadt zog und an dessen Rand sich schmutziggelber Schlamm sammelte. Fremde, die auf der Schnellstraße vorüberfuhren, kurbelten wegen des widerwärtigen Schwefelgeruchs ihre Autoscheiben hoch und fragten sich, wie man nur leben konnte mit diesem Gestank, der vom Fluß und von der Fabrik kam. Aber die Menschen in Shirley Falls waren daran gewöhnt, und selbst in der furchtbaren Hitze nahmen sie ihn nur beim ersten Aufwachen wahr; nein, der Gestank störte sie nicht sonderlich.
Hingegen störte es die Menschen in jenem Sommer, daß der Himmel nie blau war, sondern daß ein schmutziger Gazeverband über die Stadt gestülpt zu sein schien, der jeden hellen Sonnenstrahl ausschloß, der hereinsickern wollte, der alles abwehrte, was den Dingen ihre Farbe gab, so daß eine nebelhafte Stumpfheit in der Luft hing – dies machte den Menschen in jenem Sommer zu schaffen und ließ sie sich nach einer Weile beklommen fühlen. Und da war noch mehr: Weiter flußaufwärts wollte die Ernte nicht recht gedeihen – die Stangenbohnen waren klein und verschrumpelt, die Karotten hörten auf zu wachsen, als sie kaum die Größe von Kinderfingern erreicht hatten, und im Norden des Staates sollten zwei UFOs gesichtet worden sein. Man munkelte, die Regierung habe sogar Leute zur Untersuchung geschickt.
Im Großraumbüro der Fabrik, wo ein paar Frauen ihre Tage damit zubrachten, Rechnungen zu trennen, Durchschläge abzuheften und mit der Faust Briefmarken auf Umschläge zu drücken, herrschte für eine Weile besorgtes Tuscheln. Einige glaubten, das Ende der Welt sei womöglich nahe, und auch die Frauen, die so weit nicht gehen wollten, mußten zugeben, daß es vielleicht keine gute Idee war, Menschen in den Weltraum zu schicken, daß es uns wirklich nicht zukam, auf dem Mond herumzuspazieren. Aber die Hitze war unbarmherzig, und die Ventilatoren, die in den Fenstern rappelten, schienen absolut nichts zu bewirken, und schließlich verloren alle Frauen den Schwung; sie saßen leicht breitbeinig an ihren hölzernen Schreibtischen, die Haare im Nacken hochgesteckt. »Ist das zu glauben«, war am Ende alles, was gesprochen wurde.
Einmal hatte sie der Bürovorsteher, Avery Clark, zeitiger nach Hause geschickt, doch es folgten noch heißere Tage, ohne daß je wieder von Heimschicken die Rede war, also würde das wohl kein zweites Mal geschehen. Offensichtlich war es ihnen bestimmt, zu sitzen und zu leiden, und sie litten sehr – der Raum konservierte die Hitze. Es war ein großer Raum mit hoher Decke und knarzendem Holzfußboden. Die Schreibtische standen sich paarweise gegenüber. Metallene Aktenschränke säumten die Wände; auf einem stand ein Philodendron, dessen Ranken Ringel bildeten und sich verhakten, doch einige hatten sich gelöst und hingen fast bis auf den Boden. Dies war das einzige Grün im Raum. Die Begonien und ein hängendes Ampelkraut an der Fensterseite waren braun geworden. Gelegentlich fegte die von einem Ventilator bewegte heiße Luft ein totes Blatt auf den Boden.
An diesem Schauplatz der Ermattung gab es eine Frau, die abseits von den übrigen stand. Genauer gesagt, sie saß abseits von den übrigen. Ihr Name war Isabelle Goodrow, und weil sie Avery Clarks Sekretärin war, hatte ihr Schreibtisch kein Gegenüber. Er stand vielmehr dem verglasten Büro von Avery Clark zugewandt, einer eigenartigen Konstruktion aus Holztäfelung und großen Glasscheiben (die eindeutig dazu gedacht waren, daß er seine Angestellten im Auge behalten konnte, wenngleich er selten von seinem Schreibtisch aufsah) – gemeinhin als »Goldfischglas« bezeichnet. Als Chefsekretärin hatte Isabelle Goodrow einen anderen Status als die übrigen Frauen im Raum, aber sie war ohnehin anders. Sie war zum Beispiel tadellos gekleidet; sogar bei dieser Hitze trug sie Nylonstrumpfhosen. Auf den ersten Blick mochte sie hübsch wirken, aber bei näherem Hinsehen erkannte man, daß es dazu nicht ganz reichte, daß ihr Äußeres fast schon unscheinbar zu nennen war. Ihr Haar war ganz gewiß unscheinbar – dünn und dunkelbraun, zurückgekämmt und zu einem Knoten geschlungen. Diese Frisur ließ sie älter aussehen, auch ein wenig lehrerinnenhaft, und ihre dunklen kleinen Augen hatten ständig einen Ausdruck der Verwunderung.
Während die anderen Frauen dazu neigten, ausgiebig zu seufzen oder sich wiederholt zum Wasserhahn zu begeben, über Kopfweh und geschwollene Füße zu klagen und sich gegenseitig zu warnen, nicht aus den Schuhen zu schlüpfen, weil man sie nicht wieder anbekäme, verhielt sich Isabelle Goodrow ziemlich still. Isabelle Goodrow saß aufrecht an ihrem Schreibtisch, die Knie zusammengepreßt, und tippte in gleichmäßigem Tempo vor sich hin. Ihr Hals war etwas eigenartig. Für eine kleine Frau war er übermäßig lang, und er erhob sich aus ihrem Kragen wie der Hals des Schwans, den man in jenem Sommer auf dem wie tot wirkenden Fluß vollkommen still am schaumgesäumten Ufer entlangschwimmen sah.
Jedenfalls kam Isabelles Hals ihrer Tochter Amy so vor, die in jenem Sommer sechzehn Jahre alt war und neuerdings eine Abneigung gegen den Anblick des Halses ihrer Mutter hegte (gegen den Anblick ihrer Mutter, Punktum) und die sich nie etwas aus dem Schwan gemacht hatte. In vielerlei Hinsicht sah Amy ihrer Mutter nicht ähnlich. Während das Haar ihrer Mutter stumpf war und dünn, war Amys Haar dicht und blond gesträhnt. Selbst so, wie es jetzt geschnitten war, aufs Geratewohl unterhalb der Ohren abgesäbelt, war es bemerkenswert gesund und kräftig. Und Amy war groß. Ihre Hände waren groß, ihre Füße waren lang. Aber ihre Augen, die größer waren als die ihrer Mutter, zeigten oft denselben Ausdruck zögernder Verwunderung, und dieser erschrockene Blick konnte bei der Person, auf die er gerichtet war, ein gewisses Unbehagen auslösen. Dabei war Amy schüchtern und hielt ihren Blick selten länger auf jemanden gerichtet. Es entsprach eher ihrer Art, einem Menschen einen raschen Blick zuzuwerfen und dann den Kopf abzuwenden. Auf alle Fälle wußte sie nicht, welchen Eindruck sie machte, falls überhaupt, obwohl sie sich früher insgeheim in jedem verfügbaren Spiegel betrachtet hatte.
Doch in jenem Sommer blickte Amy nicht in Spiegel. Sie ging ihnen vielmehr aus dem Weg. Sie wäre gern auch ihrer Mutter aus dem Weg gegangen, aber das war unmöglich – sie arbeiteten beide im Großraumbüro. Dieses Arrangement für den Sommer war vor Monaten von ihrer Mutter und Avery Clark getroffen worden, und obwohl man Amy gesagt hatte, sie solle dankbar sein für die Arbeit, war sie es nicht. Die Arbeit war äußerst stumpfsinnig. Amy hatte auf einer Rechenmaschine die letzte Zahlenspalte aller orangefarbenen Rechnungen, die auf ihrem Schreibtisch gestapelt lagen, zu addieren, und das einzig Gute dabei war, daß ihr Verstand manchmal einzuschlafen schien.
Das eigentliche Problem freilich lag darin, daß sie und ihre Mutter den ganzen Tag zusammen waren. Amy schien es, als verbinde sie eine schwarze Linie, nicht breiter vielleicht als mit einem Bleistift gezogen, eine Linie jedoch, die immer da war. Selbst wenn eine von ihnen den Raum verließ, um, sagen wir, zur Toilette oder zum Wasserspender im Flur zu gehen, konnte das der schwarzen Linie nichts anhaben; sie durchschnitt einfach die Wand und verband Mutter und Tochter weiterhin. Sie taten ihr Bestes. Wenigstens waren ihre Schreibtische weit voneinander entfernt.
Amy saß in einer hinteren Ecke an einem Schreibtisch gegenüber von Fat Bev. Gewöhnlich war das der Platz von Dottie Brown, aber Dottie Brown war zu Hause und erholte sich diesen Sommer von einer Gebärmutterentfernung. Jeden Morgen beobachtete Amy, wie Fat Bev Flohsamen abmaß, in eine Halbliterpackung Orangensaft gab und heftig schüttelte. »Du hast es gut«, sagte Fat Bev. »Jung und gesund und alles. Ich wette, du machst dir nie Gedanken über deine Verdauung.« Amy drehte verlegen den Kopf weg.
Fat Bev zündete sich jedesmal eine Zigarette an, sobald ihr Orangensaft alle war. Jahre später sollte ein Gesetz ihr dies am Arbeitsplatz untersagen – was dazu führen würde, daß sie noch einmal zehn Pfund zunahm und sich zur Ruhe setzte –, doch noch stand es ihr frei, kräftig zu inhalieren und langsam auszuatmen, bis sie die Zigarette in dem gläsernen Aschenbecher ausdrückte und zu Amy sagte: »Das hat gewirkt, es hat den Apparat zum Laufen gebracht.« Sie zwinkerte Amy zu, als sie schwerfällig aufstand und ihre Massen zur Toilette schleppte.
Es war wirklich interessant. Amy wußte bisher nicht, daß man von Zigaretten aufs Klo mußte. Das war nicht der Fall, wenn sie und Stacy Burrows im Wald hinter der Schule rauchten. Und sie wußte nicht, daß eine erwachsene Frau so unbefangen über ihre Verdauung sprechen konnte. Gerade dies ließ Amy erkennen, wie anders als andere Leute sie und ihre Mutter waren.
Fat Bev kam von der Toilette zurück, setzte sich seufzend hin, zupfte winzige Fusseln von ihrer übergroßen ärmellosen Bluse. »So«, sagte sie und griff zum Telefon, wobei ein feuchter Halbmond auf dem hellblauen Stoff unter ihren Achselhöhlen sichtbar wurde, »denke, ich ruf die liebe Dottie mal an.« Fat Bev rief Dottie Brown jeden Morgen an. Jetzt wählte sie mit dem Ende eines Bleistifts die Nummer und klemmte sich den Hörer zwischen Schulter und Hals.
»Blutest du noch?« fragte sie, während sie mit ihren rosa Fingernägeln auf den Schreibtisch klopfte, pinkfarbene Scheiben, fast ganz in Fleisch eingebettet. Sie waren wassermelonenrosa lackiert – sie hatte Amy das Fläschchen gezeigt. »Willst du einen Rekord aufstellen oder was? Macht nichts, brauchst dich nicht zu beeilen. Hier vermißt dich sowieso keiner.« Fat Bev nahm einen Avon-Katalog zur Hand und fächelte sich damit, ihr Stuhl knarrte, als sie sich zurücklehnte. »Im Ernst, Dot. Ist viel netter, Amy Goodrows niedliches Gesicht anzugucken, als dich über deine Krämpfe quatschen zu hören.« Sie zwinkerte Amy zu.
Amy sah fort und drückte eine Ziffer auf der Addiermaschine. Es war nett von Fat Bev, das zu sagen, aber es stimmte natürlich nicht. Fat Bev vermißte Dottie sehr. Und warum auch nicht? Sie waren seit einer Ewigkeit Freundinnen, sie hatten schon zusammen in diesem Raum gesessen, als Amy noch gar nicht auf der Welt war, auch wenn Amy bei dieser Vorstellung schwindlig wurde. Außerdem galt es zu bedenken, daß Fat Bev nur zu gern redete. Das gab sie selbst zu. »Ich kann keine fünf Minuten den Mund halten«, sagte sie, und als Amy eines Tages die Uhr im Auge behielt, hatte sie festgestellt, daß es stimmte. »Ich muß einfach reden«, erklärte Fat Bev. »Es ist so eine Art körperlicher Drang.« Es schien etwas dran zu sein. Ihr Drang zu reden schien so hartnäckig wie ihr Drang, Drops der Marke Life Savers und Zigaretten zu konsumieren, und Amy, die Fat Bev liebte, bedauerte, daß ihre eigene Zurückhaltung für Enttäuschung sorgen mußte. Ohne den Gedanken weiter zu verfolgen, gab sie ihrer Mutter die Schuld. Auch ihre Mutter war nicht besonders gesprächig. Man mußte sie nur ansehen, wie sie den ganzen Tag dasaß und tippte, nie bei jemandem am Schreibtisch stehenblieb, um sich nach dem Befinden zu erkundigen, über die Hitze zu klagen. Sie wußte bestimmt, daß man sie für einen Snob hielt. Da Amy ihre Tochter war, hielt man sie wohl gleichfalls für einen Snob.
Aber Fat Bev schien nicht im mindesten enttäuscht, daß sie ihre Ecke mit Amy teilen mußte. Sie legte den Hörer auf und beugte sich vor, erzählte Amy mit leiser, vertraulicher Stimme, daß Dottie Browns Schwiegermutter die selbstsüchtigste Frau der Stadt sei. Dottie hatte ein Verlangen nach Kartoffelsalat gehabt, was freilich ein sehr gutes Zeichen war, und als sie dies ihrer Schwiegermutter sagte, die bekanntlich den besten Kartoffelsalat weit und breit machte, hatte Bea Brown Dottie empfohlen, aus dem Bett zu steigen und selbst Kartoffeln zu schälen.
»Das ist ja schrecklich«, erklärte Amy aufrichtig.
»Kann man wohl sagen.« Fat Bev lehnte sich zurück und gähnte, beklopfte ihren fleischigen Hals, und ihre Augen wurden feucht. »Herzchen«, sagte sie und nickte, »heirate du einen Mann, der keine Mutter mehr hat.«
Die Kantine der Fabrik war ein außerordentlicher, heruntergekommener Raum. Verkaufsautomaten säumten eine Wand, ein gesprungener Spiegel nahm die ganze Länge einer anderen ein; Tische, von deren Platte das Linoleum abblätterte, standen aufs Geratewohl zusammengeschoben und verrutschten, wenn die Frauen sich niederließen, ihre Pausenpakete, ihre Wasserdosen und Aschenbecher ausbreiteten, in Wachspapier gepackte Butterbrote auswickelten. Amy setzte sich wie jeden Tag weit weg von dem gesprungenen Spiegel.
Isabelle saß an demselben Tisch und schüttelte den Kopf, als sie die Geschichte von Bea Browns unerhörter Bemerkung zu Dottie vernahm. Arlene Tucker sagte, das liege vermutlich an den Hormonen, wenn man Bea Browns Kinn genau ins Auge fasse, würde man sehen, daß sie einen Bart habe, und Arlene war überzeugt, daß solche Frauen zu Boshaftigkeit neigten. Rosie Tanguay sagte, das Problem mit Bea Brown sei, daß sie keinen einzigen Tag in ihrem Leben gearbeitet habe, und danach splitterten sich die Gespräche in kleine Gruppen auf, wirre Stimmen überschnitten sich. Kurzes bellendes Lachen unterstrich einen Bericht, bedenkliches Zungenschnalzen begleitete einen anderen.
Amy genoß das. Alles, was sie hörte, war interessant für sie, sogar die Geschichte von einem defekten Kühlschrank: Eine Zweiliterpackung Schokoladeneis war im Spülstein geschmolzen, war sauer geworden und hatte am nächsten Morgen bestialisch gestunken. Die Stimmen waren angenehm und tröstlich; Amy sah schweigsam von einem Gesicht zum anderen. Sie war von nichts ausgeschlossen, doch die Frauen waren höflich genug, nicht zu versuchen, sie in ihre Gespräche einzubeziehen, oder vielleicht wollten sie es auch nicht. Dies alles lenkte Amy ab. Natürlich hätte sie es noch mehr genossen, wenn ihre Mutter nicht im Raum gewesen wäre, aber das sachte Surren verschaffte ihnen eine gewisse Erholung, obwohl die schwarze Linie zwischen ihnen ständig vorhanden war.
Fat Bev drückte auf einen Knopf am Getränkeautomaten, und eine Dose Tab fiel klappernd heraus. Sie beugte ihren massigen Körper vor, um sie an sich zu nehmen. »Noch drei Wochen, dann kann Dottie Sex haben«, sagte sie. Die schwarze Linie zwischen Amy und Isabelle straffte sich. »Sie wünscht, es wären noch drei Monate«, und an dieser Stelle wurde die Dose Sodawasser mit einem Plop geöffnet. »Aber wie ich höre, wird Wally langsam ungeduldig. Er kann’s nicht erwarten, wieder zu reiten.«
Amy schluckte die Kruste ihres Butterbrots hinunter.
»Sag ihm, er soll sich’s selbst besorgen«, sagte eine, was mit Lachen quittiert wurde. Amys Herzschlag beschleunigte sich, Schweiß bildete sich auf ihrer Oberlippe.
»Wißt ihr, man vertrocknet nach einer Gebärmutterentfernung. « Arlene Tucker äußerte dies mit einem bedeutungsvollen Kopfnicken.
»Ich bin nicht vertrocknet.«
»Weil sie dir die Eierstöcke nicht rausgenommen haben.« Arlene nickte wieder – sie war eine Frau, die glaubte, was sie sagte. »Bei Dot haben sie alles rausgerupft.«
»Oh, meine Mutter ist verrückt geworden von der fliegenden Hitze«, sagte eine, und dankenswerterweise — Amy fühlte, wie ihr Herzschlag langsamer, ihr Gesicht in der Hitze kühler wurde – ließ man von dem ungeduldigen Wally ab; statt dessen war von fliegender Hitze und Heulkrämpfen die Rede.
Isabelle wickelte den Rest ihres Butterbrots ein und steckte es zurück in den Pausenbeutel. »Es ist wirklich zu heiß zum Essen«, murmelte sie Fat Bev zu, und das war das erste Mal, daß Amy ihre Mutter die Hitze erwähnen hörte.
»Herrje, das wäre schön.« Bev kicherte, ihre große Brust hob sich. »Für mich ist es nie zu heiß zum Essen.«
Isabelle lächelte und nahm einen Lippenstift aus ihrer Handtasche.
Amy gähnte. Sie war plötzlich todmüde; sie hätte den Kopf auf den Tisch legen und sofort einschlafen können.
»Herzchen, ich bin neugierig«, sagte Fat Bev. Sie hatte sich eben eine Zigarette angezündet und sah Amy durch den Rauch an. Sie pflückte sich einen Tabakkrümel von der Lippe und betrachtete ihn, bevor sie ihn auf den Boden schnippte. »Warum hast du beschlossen, dir die Haare abzuschneiden ?«
Die schwarze Linie vibrierte und surrte. Ohne es zu wollen, sah Amy ihre Mutter an. Isabelle schminkte sich in einem Handspiegel die Lippen, den Kopf leicht zurückgeneigt; die Hand mit dem Lippenstift hielt inne.
»Es ist hübsch«, fügte Bev hinzu. »Sehr hübsch sogar. Ich bin bloß neugierig, weiter nichts. Bei deinem vollen Haar.«
Amy wandte das Gesicht dem Fenster zu und griff sich ans Ohrläppchen. Die Frauen warfen das Butterbrotpapier in den Abfall, wischten sich Krümel von den Kleidern, gähnten, die Fäuste am Mund, und standen auf.
»Ist vermutlich kühler so«, sagte Fat Bev.
»Stimmt. Viel kühler.« Amy sah Bev an, dann sah sie zur Seite.
Fat Bev seufzte vernehmlich. »Okay, Isabelle«, sagte sie. »Komm. Auf geht’s, zurück in die Tretmühle.«
Isabelle preßte die Lippen zusammen und ließ ihre Handtasche zuschnappen. »Sehr richtig«, sagte sie, ohne Amy anzusehen. »Keine Rast für die Ermatteten.«
Aber Isabelle hatte ihre Geschichte. Und als sie vor Jahren erstmals in der Stadt aufgetaucht war und das alte Crane-Haus an der Route 22 gemietet hatte, wo sie ihre wenigen Habseligkeiten und ihre kleine Tochter (ein ernst blickendes Kind mit vollem hellem Lockenhaar) einquartierte, hatte das bei den Mitgliedern der Kongregationskirche und auch bei den Frauen, zu denen sie sich im Großraumbüro der Fabrik gesellte, eine gewisse Neugierde geweckt.
Doch die junge Isabelle Goodrow war schon damals nicht mitteilsam. Sie antwortete einfach, daß ihr Mann tot sei, ebenso ihre Eltern, und daß sie flußabwärts nach Shirley Falls gezogen sei, um eine bessere Chance zu haben, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Mehr wußte eigentlich niemand. Allerdings war einigen aufgefallen, daß sie, als sie neu in der Stadt war, einen Ehering getragen hatte, daß sie ihn nach einer Weile aber nicht mehr trug.
Sie schien sich keine Freunde zu machen. Sie machte sich auch keine Feinde, wenngleich sie eine gewissenhafte Arbeiterin war und ihr infolgedessen etliche Beförderungen zuteil wurden. Jedesmal wurde im Großraumbüro ein bißchen gemurrt, besonders letztens, als sie sich weit über die anderen erhob, da sie die Chefsekretärin von Avery Clark wurde, aber keine wünschte ihr etwas Schlechtes. Hinter ihrem Rücken wurden zuweilen Scherze, Bemerkungen gemacht, etwa, daß sie mal gründlich durchgebumst werden müßte, um lockerer zu werden, aber diese Anspielungen wurden mit den Jahren seltener. Unterdessen war sie eine Altgediente. Amys Befürchtungen, daß ihre Mutter als Snob galt, waren nicht gerechtfertigt. Sicher, die Frauen klatschten untereinander, aber Amy war zu jung, um zu verstehen, daß die familienähnliche Anerkennung, die sie füreinander hegten, auch ihre Mutter einbezog.
Dennoch würde keine behaupten, Isabelle zu kennen. Und gewiß ahnte keine, daß die Ärmste gerade jetzt durch die Hölle ging. Falls sie dünner aussah als sonst, ein bißchen blasser, nun ja, es war entsetzlich heiß. So heiß, daß sogar jetzt, gegen Ende des Tages, als Amy und Isabelle über den Parkplatz gingen, noch die Hitze vom Teer aufstieg.
»Schönen Abend, ihr beiden«, rief Fat Bev hinüber, als sie sich in ihr Auto hievte.
Die Geranien auf der Fensterbank über dem Spülbecken hatten leuchtendrote Blütenköpfe, groß wie Tennisbälle, aber wieder waren zwei Blätter gelb geworden. Als Isabelle die Schlüssel auf den Tisch warf, bemerkte sie es sofort und zupfte sie ab. Hätte sie gewußt, daß der Sommer so schrecklich würde, hätte sie sich gar nicht erst die Mühe gemacht, Geranien zu kaufen. Sie hätte die Blumenkästen an den vorderen Fenstern nicht mit lavendelfarbenen Petunien gefüllt und hinter dem Haus keine Tomaten, Ringelblumen und kein Springkraut gepflanzt. Als die Blumen nun ganz leicht die Köpfe hängen ließen, überkam Isabelle das Gefühl eines drohenden Verhängnisses. Sie drückte die Finger in die Blumentopferde, fühlte, ob sie feucht war, und fand sie zu naß, denn Geranien brauchten strahlende Sonne und nicht diese klamme Hitze. Sie warf die Blätter zum Abfall unter dem Spülbecken und trat zurück, um Amy vorbeizulassen.
Amy war es, die das Abendessen machte. In den alten Zeiten (diesen Ausdruck benutzte Isabelle in Gedanken, wenn sie sich auf ihr Leben vor diesem Sommer bezog) hatten sie sich abgewechselt, aber jetzt war es allein Amys Aufgabe. Eine stillschweigende Übereinkunft: Es war das mindeste, was Amy tun konnte – eine Dose rote Bete aufmachen und ein paar Hamburger in der Pfanne braten. Jetzt stand sie da, öffnete langsam Schränke, bohrte träge einen Finger in das Hackfleisch für die Hamburger. »Wasch dir die Hände«, sagte Isabelle und ging an ihr vorbei zur Treppe.
Aber dann klingelte das Telefon, das akkurat in der Ecke der Anrichte untergebracht war, und Isabelle und Amy bekamen beide einen gehörigen Schrecken. Aber es löste auch Hoffnung aus: Manchmal vergingen Tage, ohne daß es einen Ton von sich gab.
»Hallo?« sagte Amy, und Isabelle blieb stehen, den Fuß auf der Treppe.
»Oh, hi«, sagte Amy. Sie legte die Hand über den Hörer und sagte, ohne ihre Mutter anzusehen: »Ist für mich.«
Isabelle ging langsam die Treppe hinauf. »Ja«, hörte sie Amy sagen. Und kurz darauf fragte Amy schneller: »Und wie geht’s eurem Hund?«
Isabelle ging leise in ihr Schlafzimmer. Wen kannte Amy, der einen Hund hatte? Ihr Schlafzimmer unter dem Dach war um diese Tageszeit stickig, dennoch schloß Isabelle die Tür, und sie tat es geräuschvoll, damit Amy es hörte: Schau, ich lasse dir deinen Privatbereich.
Und Amy, die sich die Telefonschnur um den Arm wickelte, hörte die Tür zugehen und verstand, doch sie wußte, daß ihre Mutter nur für einen Augenblick nett erscheinen wollte, um mühelos ein, zwei Punkte gutzumachen. »Ich kann nicht«, sagte Amy ins Telefon, während sie die Handfläche auf das Hackfleisch drückte. Und einen Augenblick später: »Nein, ich hab’s ihr noch nicht gesagt.«
Isabelle, die an ihrer Schlafzimmertür lehnte, fühlte sich nicht als Lauscherin. Es war eher so, daß sie zu abgespannt war, um die Mühe auf sich zu nehmen, sich das Gesicht zu waschen oder sich umzuziehen, solange Amy noch telefonierte. Aber Amy schien nicht viel zu sagen, und nach wenigen Augenblicken hörte Isabelle, daß sie auflegte. Darauf ertönte das Klappern von Töpfen und Pfannen, und Isabelle ging ins Badezimmer, um zu duschen. Danach wollte sie ihre Gebete sprechen und dann zum Essen hinuntergehen.
Doch im Grunde machte Isabelle das Beten mutlos. Sie war sich der Tatsache bewußt, daß Jesus sich in ihrem Alter schon tapfer hatte ans Kreuz nageln lassen und geduldig dort hing, Essig an die Lippen gedrückt, nachdem er sich zuvor bei einer Wanderung durch den Olivenhain Mut gemacht hatte. Sie aber, die sie hier in Shirley Falls lebte (wenngleich auch sie durch ihre judasgleiche Tochter einen Verrat erlitten hatte, dachte sie, während sie sich Babypuder auf die Brüste stäubte), hatte keine Olivenbäume, um zwischen ihnen zu wandeln, und auch keinen nennenswerten Mut. Vielleicht auch keinen Glauben. Sie zweifelte in diesen Tagen, ob Gott ihre Misere überhaupt kümmerte. Er war ein schwer faßbarer Bursche, einerlei, was andere behaupteten.
Der Reader’sDigest behauptete, daß sich, wenn man beständig betete, die Fähigkeit zum Beten steigere, doch Isabelle fragte sich, ob der Reader’sDigest nicht dazu neigte, die Dinge etwas zu vereinfachen. Sie hatte sich an den Artikeln »Ich bin Joes Gehirn« oder »Ich bin Joes Leber« ergötzt, aber der Aufsatz: »Beten: Übung macht den Meister« war, wenn man es recht bedachte, doch ein wenig profan.
Immerhin, sie hatte es versucht. Sie hatte jahrelang versucht zu beten, und sie wollte es eben jetzt wieder versuchen, als sie auf ihrem weißen Bettüberwurf lag, die Haut feucht vom Duschen, und die Augen unter der niedrigen weißen Zimmerdecke schloß, um SEINE Liebe zu erflehen.
Bittet, und ihr werdet empfangen. Das war eine verzwickte Angelegenheit. Man wollte nicht um das Falsche bitten, nicht an den Unrechten geraten. Man wollte nicht, daß Gott einen für selbstsüchtig hielt, weil man um Sachen bat, wie es die Katholiken taten. Arlene Tuckers Mann war eigens zur Messe gegangen, um ein neues Auto zu erbitten, und Isabelle fand das abstoßend. Sollte Isabelle konkret werden, würde sie nicht so ordinär sein, um ein Auto zu bitten – sie würde um einen Ehemann beten oder um eine bessere Tochter. Nur, sie würde es natürlich nicht tun. (Bitte lieber Gott, schick mir einen Ehemann oder wenigstens eine Tochter, die ich ertragen kann.) Nein, sie wollte vielmehr hier auf dem Bettüberwurf liegen und nur um Gottes Liebe und Geleit beten und versuchen, IHN wissen zu lassen, daß sie für diese Dinge empfänglich war, wenn ER sich herbeiließe, ihr ein Zeichen zu geben. Aber sie spürte nichts, nur die Schweißtropfen, die sich in der Hitze des kleinen Schlafzimmers wieder auf ihrer Oberlippe und unter ihren Armen bildeten. Sie war müde. Gott war vermutlich gleichfalls müde. Sie setzte sich auf, zog ihren Bademantel über und ging in die Küche hinunter, um mit ihrer Tochter zu essen.
Es war schwierig.
Sie vermieden es, einander anzusehen, und Amy schien es nicht für notwendig zu erachten, aus eigenem Antrieb ein Gespräch in Gang zu bringen. Diese Fremde, meine Tochter. Das könnte eine Überschrift für einen Artikel in Reader’sDigest werden, falls das Thema nicht schon abgehandelt war, und vermutlich war es das, denn es kam Isabelle bekannt vor. Aber sie wollte jetzt nicht mehr nachdenken, konnte es nicht mehr ertragen, weiter nachzudenken. Sie befühlte das Milchkännchen aus Belleek-Porzellan auf dem Tisch, das zierliche, muschelgleiche, schimmernde Milchkännchen, das ihrer Mutter gehört hatte. Amy hatte es für Isabelles Tee gefüllt; Isabelle trank bei heißem Wetter gern Tee zu den Mahlzeiten.
Isabelle, die außerstande war, ihre Neugierde zu zügeln, und sich sagte, sie habe jedes Recht, über alle Angelegenheiten Bescheid zu wissen, fragte schließlich: »Mit wem hast du telefoniert?«
»Stacy Burrows.« Das wurde tonlos mitgeteilt, unmittelbar bevor Amy sich einen Bissen Hamburger in den Mund schob.
Isabelle schnitt eine von den eingelegten roten Beten auf ihrem Teller in Scheiben und versuchte, sich das Gesicht von Stacy zu vergegenwärtigen.
»Blaue Augen?«
»Was?«
»Ist sie das Mädchen mit den großen blauen Augen und den roten Haaren?«
»Nehm ich an.« Amy runzelte leicht die Stirn. Es war ihr zuwider, wie ihre Mutter das Gesicht am Ende ihres langen Halses schief hielt, gleich einer Vipernatter. Und sie haßte den Babypudergeruch.
»Du nimmst es an?«
»Ich meine, ja, das ist sie.«
Das leise Klappern von Besteck auf den Tellern war zu hören; beide kauten so ruhig, daß sie kaum die Münder bewegten.
»Womit verdient ihr Vater sein Geld?« fragte Isabelle schließlich. »Hat er etwas mit dem College zu tun?« Sie wußte, daß er gewiß nichts mit der Fabrik zu tun hatte.
Amy zuckte mit vollem Mund die Achseln. »Mmmnicht. «
»Du mußt doch eine Ahnung haben, womit der Mann sein Geld verdient.«
Amy trank einen Schluck Milch und wischte sich mit der Hand den Mund ab.
»Bitte.« Isabelle senkte angewidert die Augenlider, und Amy nahm diesmal eine Serviette zum Abwischen.
»Er unterrichtet dort, nehm ich an«, räumte Amy ein.
»Unterrichtet was?«
»Psychologie, glaube ich.«
Darauf gab es nichts zu sagen. Wenn es stimmte, dann hieß das für Isabelle schlicht und einfach, daß der Mann verrückt war. Sie verstand nicht, warum Amy sich die Tochter eines Verrückten als Freundin aussuchen mußte. Sie stellte sich ihn mit einem Bart vor, und dann fiel ihr ein, daß das Scheusal Mr. Robertson auch einen Bart hatte, und darauf begann ihr Herz so schnell zu klopfen, daß sie beinahe außer Atem geriet. Der Babypudergeruch stieg von ihrer Brust auf.
»Was?« sagte Amy und blickte auf, hielt aber den Kopf noch über den Teller gesenkt, im Begriff, ein Stück Toast, das vom Bratfett durchweicht war, in den Mund zu schieben.
Isabelle schüttelte den Kopf und sah an ihr vorbei auf die weiße Gardine, die sich leicht im Fenster blähte. Es war wie ein Autounfall, dachte sie. Hinterher sagte man sich ständig, wenn der Lastwagen doch schon über die Kreuzung gewesen wäre, als ich dort hinkam. Wenn Mr. Robertson doch durch die Stadt gekommen wäre, bevor Amy auf die High-School ging. Aber man steigt ins Auto, hat andere Dinge im Kopf, und zur gleichen Zeit rattert der Lastwagen aus der Ausfahrt, fährt in die Stadt, und man selbst fährt auch in die Stadt. Und dann ist es vorbei, und das Leben wird nie mehr sein wie vorher.
Isabelle rieb sich Krümel von den Fingerspitzen. Schon fiel es ihr schwer, sich zu erinnern, wie ihr Leben vor diesem Sommer war. Es hatte Ängste gegeben – daran konnte Isabelle sich gewiß erinnern. Es war nie genug Geld da, und sie schien immer eine Laufmasche im Strumpf zu haben (Isabelle zogniemals Strümpfe mit Laufmaschen an, und wenn es doch einmal vorkam, dann log sie und sagte, es sei eben erst passiert), und Amy hatte Schulaufgaben zu erledigen, eine dämliche Reliefkarte, für die sie Ton und Schaumgummi brauchte, eine Näharbeit in Hauswirtschaftslehre – auch diese Dinge kosteten Geld. Aber als sie jetzt ihrer Tochter (dieser Fremden) gegenübersaß und ihren Hamburger auf Toast aß, während das dunstige Sonnenlicht des frühen Abends auf den Herd und über den Fußboden fiel, war Isabelle erfüllt von Sehnsucht nach jenen Tagen, nach dem Vorrecht, sich wegen normaler Dinge Sorgen zu machen.
Sie sagte, weil die Stille beim Essen erdrückend war und weil sie irgendwie nicht wagte, auf das Thema Stacy zurückzukommen : »Diese Bev. Sie raucht wirklich zuviel. Und sie ißt auch zuviel.«
»Ich weiß«, antwortete Amy.
»Benutze bitte deine Serviette.« Sie konnte nicht dagegen an: Der Anblick, wie Amy Ketchup von ihren Fingern schleckte, machte sie fast wahnsinnig. Plötzlich hob der Zorn bereitwillig sein Haupt und erfüllte Isabelles Stimme mit Kälte. Nur, es könnte mehr darin gewesen sein als Kälte, offen gestanden. Um ganz ehrlich zu sein, könnte man sagen, daß ein Anflug von Haß in ihrer Stimme schwang. Und jetzt haßte Isabelle auch sich selbst. Sie würde die Bemerkung zurücknehmen, wenn sie könnte, doch es war zu spät, und während sie mit ihrer Gabel in einer Rote-Bete-Scheibe stocherte, sah sie zu, wie Amy ihre Papierserviette in der Hand zusammenknüllte und auf ihren Teller warf.
»Aber sie ist nett«, sagte Amy. »Ich finde Fat Bev nett.«
»Niemand hat gesagt, daß sie nicht nett ist.«
Der Abend erstreckte sich endlos vor ihnen; das dunstige Sonnenlicht auf dem Fußboden hatte sich kaum bewegt. Amy saß mit den Händen im Schoß, den Hals nach vorn geschoben wie so ein alberner Spielzeughund, den man manchmal hinten in einem Auto sah und dessen Kopf hin und her wackelte, wenn der Wagen hielt. »Oh, sitz gerade«, wollte Isabelle sagen, doch statt dessen sagte sie matt: »Du bist entschuldigt. Ich spüle heute abend.«
Amy schien zu zögern.
In den alten Zeiten war keine vom Tisch aufgestanden, bevor die andere fertig war. Diese Gepflogenheit, diese Höflichkeit rührte aus den Tagen, als Amy ein Kleinkind war, stets eine langsame Esserin; sie hatte auf zwei Versandhauskatalogen auf einem Stuhl gehockt, ihre dünnen Beinchen baumelten herab. »Mommy«, sagte sie ängstlich, wenn sie sah, daß Isabelle schon fertig war, »bleibst du noch bei mir sitzen?« Und Isabelle war immer sitzen geblieben. An vielen Abenden war Isabelle müde und unruhig gewesen, und eigentlich hätte sie es vorgezogen, zur Entspannung in einer Illustrierten zu blättern oder wenigstens aufzustehen und mit dem Spülen anzufangen. Und doch mochte sie dem Kind nicht sagen, es solle sich beeilen, sie wollte den kleinen Verdauungsapparat nicht durcheinanderbringen. Das war die Zeit, die sie zusammen hatten. Sie war bei Amy sitzen geblieben.
Damals wurde die Kleine bei Esther Hatch untergebracht, wenn Isabelle arbeitete. Das Haus war gräßlich – ein heruntergekommenes Bauernhaus am Stadtrand, voll von Babys und Katzen und dem Geruch nach Katzenpisse. Aber es war das einzige Arrangement, das Isabelle sich leisten konnte. Was hätte sie tun sollen? Es war ihr verhaßt, Amy dort abzugeben, es war ihr verhaßt, daß Amy nie auf Wiedersehen sagte, daß sie vielmehr sofort ans Fenster rannte und auf die Couch kletterte, um ihre Mutter wegfahren zu sehen. Manchmal hatte Isabelle gewinkt, ohne zum Fenster zu schauen, wenn sie rückwärts aus der Zufahrt setzte, weil sie es nicht ertrug, hinzuschauen. Es war, als sei ihr etwas im Hals steckengeblieben, wenn sie Amy dort sah mit dem blassen, ernsten Gesicht. Esther Hatch sagte, daß sie nie weinte.
Aber es gab eine Zeit, als Amy nur auf einem Stuhl saß und Esther Hatch sich beschwerte, ihr würde ganz unbehaglich, weil Amy nicht aufstehen und herumlaufen wollte wie ein normales Kind, und sie sei sich nicht sicher, ob sie sie weiter bei sich aufnehmen könne. Darauf war Isabelle in Panik geraten. Sie kaufte Amy bei Woolworth eine Puppe aus Plastik mit widerspenstigen, borstigen platinblonden Haaren. Der Kopf fiel sofort ab, aber Amy schien das Ding zu lieben. Nicht so sehr die Puppe selbst, als vielmehr den Kopf der Puppe. Sie trug den Kopf mit sich herum, wohin sie auch ging, und malte die Plastiklippen rot an. Und anscheinend hörte sie auf, sich bei Esther Hatch auf einen Stuhl zu beschränken, denn die Frau beklagte sich nicht wieder bei Isabelle.
Doch damals war es klar, weshalb Isabelle jeden Abend am Tisch in ihrer Küche bei dem Kind sitzen blieb. »Itty Bitty Spider singen?« bat die Kleine lieb, während sie eine Limabohne zwischen den Fingerchen zerdrückte. Und Isabelle – es war schrecklich – hatte nein gesagt. Sie sagte nein, sie sei zu müde. Aber Amy war so ein süßes kleines Ding – sie war so froh, ihre Mutter bei sich zu haben, nur auf Armeslänge entfernt gegenüber am Tisch. Sie ließ vor Glück die Beinchen baumeln, ihr kleiner feuchter Mund war zu einem Lächeln geöffnet, die winzigen Zähne steckten wie weiße Kieselsteine in ihrem rosa Zahnfleisch.
Isabelle schloß die Augen, ein vertrauter Schmerz machte sich unter ihrem Brustbein bemerkbar. Aber sie war dort sitzen geblieben, oder? Das hatte sie immerhin getan.
»Bitte«, sagte sie jetzt und öffnete die Augen. »Du bist entschuldigt.« Amy stand auf und ging.
Die Gardine bewegte sich wieder. Es war ein gutes Zeichen, sofern es Isabelle möglich gewesen wäre, so darüber zu denken, daß die Abendluft sich rührte, genug, um die Gardine zu bewegen, eine Brise, die ausreichte, um die Gardine leicht zu blähen, so daß sie sich ein wenig über der Fensterbank wölbte, als sei sie das Kleid einer schwangeren Frau, und dann schnell wieder zurückfiel, so daß ein paar Falten das Fliegengitter berührten. Aber Isabelle dachte nicht, daß endlich eine Brise wehte. Sie dachte vielmehr, daß die Gardinen gewaschen werden mußten, sie hatte sie schon eine ganze Weile nicht mehr gewaschen.
Als sie einen Blick durch die Küche warf, sah sie erfreut, daß wenigstens die Wasserhähne glänzten und die Arbeitsflächen nicht streifig aussahen wie manchmal, wenn Reste des Putzmittels darauf getrocknet waren. Und da war das Milchkännchen aus Belleek-Porzellan, das ihrer Mutter gehört hatte, das zierliche, muschelgleiche, schimmernde Ding. Es war Amy, die es vor ein paar Monaten aus dem Schrank geholt und vorgeschlagen hatte, es jeden Abend zu benutzen. »Es hat deiner Mutter gehört«, hatte Amy gesagt, »und du hast es so gern.« Isabelle hatte zugestimmt, ist gut. Aber jetzt schien es mit einemmal gefährdet; ein Gegenstand, der so leicht von einem Ärmel, einem bloßen Arm umgestoßen werden und auf dem Fußboden zerschellen konnte.
Isabelle stand auf, wickelte das übriggebliebene Stück Hamburger in Wachspapier und legte es in den Kühlschrank. Sie spülte die Teller, das von den Beten rotgefärbte Wasser wirbelte in den weißen Abfluß. Erst als das Geschirr gespült und weggeräumt war, wusch sie das Belleek-Milchkännchen ab. Sie spülte es vorsichtig und trocknete es vorsichtig ab, dann stellte sie es weit hinten in den Schrank, wo man es nicht sehen konnte.
Sie hörte Amy aus ihrem Schlafzimmer kommen und zum oberen Treppenabsatz gehen. Isabelle wollte eben sagen, sie wünsche nicht mehr, daß das Milchkännchen benutzt werde, daß es etwas ganz Besonderes sei und zu leicht kaputtgehen könne, als Amy von der Treppe aus rief: »Mom, Stacy ist schwanger. Ich wollte nur, daß du es weißt.«
2
Der Fluß teilte die Stadt in zwei Hälften. Die prächtige Main Street auf der Ostseite wand sich am Postamt und am Rathaus vorbei bis zu einer Stelle, wo der Fluß nur vierhundert Meter breit war. Dort ging die Straße in eine Brücke über, mit einem geräumigen Fußweg auf jeder Seite. Wenn man in westlicher Richtung über die Brücke fuhr oder ging und flußaufwärts blickte, sah man die Rückseite der Fabrik und auch einen Teil ihres dunklen Fundaments, das auf den Granitplatten schaumbesprühter Felsen errichtet war. Von der Brücke gelangte man in einen kleinen Park am Flußufer, und hier konnte die Sonne im Winter überaus spektakulär untergehen, wenn sie den Horizont mit rosig angehauchten Goldtönen durchschnitt und die kahlen Ulmen am Uferrand streng, düster und tapfer erscheinen ließ. Doch kaum jemand hielt sich lange im Park auf. Der Park selbst war nicht sehenswert, es gab dort wenig mehr als eine kaputte Schaukel und ein paar Bänke, vielen Sitzen fehlte ein Brett. Meistens waren hier Jugendliche anzutreffen, die verkrampft auf den Kanten der Bänke hockten, die Schultern hochgezogen gegen die Kälte, die bloßen Hände um Zigaretten gewölbt; manchmal ließen junge Leute in der Dämmerung einen Joint herumgehen, sie inhalierten und warfen wiederholt Blicke zur Mill Road hinüber, der Fabrikstraße.
Die Mill Road war die Verlängerung der Main Street, sobald diese die Brücke überquert hatte, und bevor die Mill Road schließlich zur Fabrik führte, wand sie sich durch ein Viertel mit Geschäften, darunter ein alter A&P-Laden mit Sägemehl auf dem Boden, ein Möbelgeschäft mit ausgeblichenen Sofas in den Schaufenstern, ein paar Bekleidungsgeschäfte und Cafés, eine Apotheke, die seit Jahren dieselbe Auslage mit einem verstaubten Usambaraveilchen auf einer Wärmflasche zeigte.
Gleich dahinter war die Fabrik. Der Fluß zeigte sich hier von seiner häßlichsten Seite – aufgewühlt, gelb und schäumend – , die Fabrik selbst jedoch, vor einem Jahrhundert aus roten Ziegeln erbaut, stellte eine gewisse gefällige Eleganz zur Schau, als verstehe sie sich seit langem als Mittelpunkt dieser Stadt. Für die Arbeiter, deren Familien vor einer Generation aus Kanada gekommen waren, bedeutete die Fabrik tatsächlich den Mittelpunkt der Stadt; sie war der Mittelpunkt ihres Lebens, und ihre Häuser waren nicht weit entfernt, verstreut in der Gegend an schmalen Straßen gelegen, wo kleine Lebensmittelgeschäfte in den Schaufenstern mit blinkernden blauen Lichtern Bier anpriesen.
Dieses Stadtviertel wurde Basin genannt, Becken, doch konnte sich anscheinend niemand mehr besinnen, weshalb, und die Häuser hier, die oft heruntergekommen aussahen, waren groß, mit drei Stockwerken, einer Wohnung auf jeder Etage, und gewöhnlich einer abfallenden vorderen Veranda. Aber es gab auch etliche Einfamilienhäuser, mit Schindeln gedeckt und klein, die Garagentüren stets offen, so daß ein Sammelsurium von Reifen, Fahrrädern, Angelruten zu sehen war. Eine Anzahl dieser Häuser war türkis oder lavendelfarben oder sogar rosarot gestrichen, und den einen oder anderen Vorgarten schmückte eine Muttergottesstatue oder eine Badewanne mit Erde und Petunien, die sich im Winter in einen heiteren Schneeberg verwandelte. Im Winter stellten manche Leute Plastikrentiere oder -engel in den Schnee und dekorierten sie mit blinkenden Lichtern. Ein draußen angeketteter Hund bellte manchmal die ganze Nacht die Rentiere an, doch niemandem fiel es ein, den Besitzer oder die Polizei anzurufen, wie man es gewiß auf der anderen Flußseite getan hätte, wo die Leute Nachtruhe erwarteten oder verlangten.
Auf dieser anderen Flußseite, Oyster Point genannt, wohnten die wenigen Ärzte, Zahnärzte und Rechtsanwälte von Shirley Falls. Hier befanden sich die öffentliche Schule und das städtische College, das vor fünfzehn Jahren draußen bei Larkindale’s Field erbaut worden war, und hier war auch die Kongregationskirche. Eine schlichte weiße Kirche mit einem schlichten weißen Turm, ganz anders als die riesige katholische Kirche mit ihren Buntglasfenstern, die sich im Basin-Viertel auf einem Hügel erhob. Diese protestantische Seite des Flusses, Oyster Point, hatte sich Isabelle Goodrow mit Bedacht als Wohnsitz gewählt. Wäre sie, aus welchem Grund auch immer, gehalten gewesen, einen Umzug in eine Wohnung im oberen Stockwerk eines lavendelfarbenen Hauses mit der ausdruckslos blickenden Muttergottes im Vorgarten in Erwägung zu ziehen, Isabelle hätte sich geweigert. Sie wäre einfach zurückgegangen, flußaufwärts in die Stadt, aus der sie gekommen war. Doch das Glück (anfangs hatte sie manchmal gedacht: Gott) hatte es gefügt, daß das Kutschhaus auf dem Crane-Anwesen zu vermieten war, und so kam es, daß sie mit ihrer kleinen Tochter dorthin gezogen war, an die Peripherie von Oyster Point unterhalb der bewaldeten Hügel und Felder an der Route 22.
Es stellte sich heraus, daß das Haus, klein und schlecht isoliert, im Sommer heiß war und im Winter kalt, doch ansonsten genügte es ihren Ansprüchen. Um die Jahrhundertwende als kleiner Stall für ein paar Pferde errichtet, war es später zu einer Hausmeisterwohnung umgebaut worden, und dann war das Feuer ausgebrochen – das Haupthaus des Crane-Anwesens war abgebrannt. Es wurde nie genau geklärt, was das Feuer verursacht hatte. Eine schadhafte Leitung vermutlich. Aber man tuschelte, daß der ehrenwerte Richter Crane eine Geliebte hatte, die eines Nachts sein Haus in Brand steckte. Eine andere Version besagte, der Richter habe das Feuer selbst gelegt, nachdem er seine Frau umgebracht hatte, dann sei er, mit ihrer aufrecht sitzenden Leiche an seiner Seite, einen Hut auf ihrem Kopf, die Schnellstraße entlanggefahren.
Jedenfalls etwas in der Art. Es war lange her, und inzwischen interessierte es die Leute nicht mehr. Auf alle Fälle hatte ein Großneffe (mittlerweile selbst ein alter Mann) den Besitz – die Pappelschößlinge waren nachgewachsen – und auch das ehemalige Stallgebäude geerbt. Er hatte es im Laufe der Jahre mehrmals vermietet – ein Professor aus Boston hatte dort einen Sommer verbracht und ein Buch geschrieben, eine Bibliothekarin mit kurzen Haaren hatte das Haus eine Weile mit einer Kindergärtnerin geteilt (allerdings war dem alten Mr. Crane dabei nie ganz wohl gewesen, und er war froh, als sie auszogen). Ein paar Kanadier, die flußabwärts gekommen waren, hatten dort kurze Zeit gewohnt, als sie in der Fabrik arbeiteten, doch Mr. Crane vermietete ungern an Fabrikarbeiter, und zeitweise hatte das Haus leergestanden.
Es war unbewohnt, als Isabelle Goodrow ihre erste Erkundungsfahrt nach Shirley Falls unternahm, um die Möglichkeiten abzuschätzen, ihre Tochter dort aufzuziehen – und einen Ehemann zu finden, was sie sich eigentlich erhofft hatte. Das kleine weiße Haus war ihr sofort als idealer »vorläufiger Wohnsitz« erschienen. Dies waren exakt die Worte, die sie zu Mr. Crane sagte, als er, die Hände in den Taschen, im Wohnzimmer stand und mit dem altersfleckigen Glatzkopf nickte. Er hatte sich erboten, die Wände für sie zu streichen, und sie durfte die Farbe bestimmen. Sie hatte ein helles, schimmerndes Beige gewählt, weil sie von dem Namen in der Farbenhandlung so angetan war: Himmelstor. Sie hatte die Gardinen genäht, die noch heute an den Fenstern hingen, hatte hinter dem Haus einen Garten angelegt, die Blumenkästen mit purpurroten Petunien und rosa Geranien bepflanzt, und der alte Mr. Crane war zufrieden. Einige Male hatte er angeboten, ihr das Haus zu einem sehr günstigen Preis zu verkaufen, doch obwohl Isabelle vom Erbe ihrer Mutter einen kleinen Notgroschen besaß, hatte sie jedesmal abgelehnt. Es war ein vorläufiger Wohnsitz.
Nur war er es offensichtlich nicht; sie lebten nun schon seit vierzehn Jahren hier. Das machte Isabelle zuweilen körperlich krank, als hätte sie stehendes Wasser aus einem Teich geschluckt. Ihr Leben verging, wie es das Leben eben tat, und doch war sie nicht verwurzelter als ein Vogel, der auf einem Zaun hockte. Und eines Tages würde sie vielleicht sogar ohne den Zaun dastehen; denn irgendwann würde Mr. Crane vermutlich sterben. Ihr war noch keine höfliche Form eingefallen, um zu fragen, was in diesem Fall aus ihrer Mietvereinbarung werden sollte. Doch sie konnte es nicht ertragen, das Haus zu kaufen, konnte es nicht ertragen, den Gedanken aufzugeben, daß sich ihr wirkliches Leben anderswo abspielen werde.
Indessen war das Haus, das weder einen Dachboden noch einen Keller hatte, im Sommer unerträglich heiß, und dieser Sommer war der schlimmste von allen. Es gab kein Entkommen vor der Hitze oder voreinander. Selbst die beiden Schlafzimmer unter dem Dach boten kaum Abgeschiedenheit, da nur eine dünne Gipswand sie trennte. Isabelle, die sich vor Kabelbränden fürchtete, erlaubte nicht, daß die Ventilatoren liefen, wenn sie schliefen, und so waren die heißen Nächte still und leise; durch die dünne Wand konnte jede hören, wenn die andere sich im Bett umdrehte.
Heute abend hörte Amy, die in T-Shirt und Unterhose dalag, ein nacktes Bein über der Bettkante, ihre Mutter furzen – ein kurzer, trockener Laut, als sei ein Versuch unternommen worden, höflich zu sein. Amy hielt sich eine Hand vors Gesicht und verdrehte im Dunkeln die Augen. Als sie sich nach dem Abendessen in ihr Schlafzimmer zurückgezogen hatte, nahm sie ein kleines Tagebuch aus der Schreibtischschublade – ihre Mutter hatte es ihr letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt – und schrieb die Worte Wieder ist ein himmlischer Tag vergangen. Ihre Mutter würde es natürlich lesen. Sie hatte alles von Anfang an gelesen. Als Amy das Geschenk an Weihnachten auspackte, wußte sie sogleich, daß es so sein würde. »Ich dachte mir, du bist in einem Alter, in dem du so etwas gern hättest«, hatte ihre Mutter gesagt, und als sie verlegen aneinander vorbeisahen, stand die Wahrheit fest. »Es gefällt mir sehr«, hatte Amy gesagt. »Vielen Dank.«
Deswegen war sie stets vorsichtig. Sie schrieb: Ich hatte heute mit Stacy eine lustige Mittagspause, was bedeutete, daß jede von ihnen im Wald hinter der Schule zwei Zigaretten geraucht hatte. Doch in diesem Sommer schrieb sie Abend für Abend dieselbe Zeile und hielt dabei den Stift wie eine Besessene: Wieder ist ein himmlischer Tag vergangen. Dieselbe Zeile, dreizehnmal jetzt, sorgfältig unter das Datum gesetzt. Danach legte sie das Tagebuch neben ihrem Bett auf den Fußboden und lehnte sich zurück, doch als sie jetzt unten die letzte Schranktür zufallen hörte und wußte, daß ihre Mutter ins Wohnzimmer gehen und Reader’sDigest durchblättern würde, während sie mit dem Fuß wippte, als sie fühlte, daß die schwarze Linie noch (und immer) da war, daß sie von ihrem Bett direkt hinunter zu ihrer Mutter verlief, da war Amy unvermittelt aufgestanden und hatte von der Treppe aus gerufen: »Mom, Stacy ist schwanger. Ich wollte nur, daß du es weißt.«
So. Das hatte sie getan.
Und jetzt war es dunkel, und ihre Mutter hatte gefurzt, und keine von beiden hatte einen Ort, um sich zurückzuziehen. Nur einschlafen konnten sie, und das würde in dieser Hitze nicht so bald geschehen. Amy starrte an die Decke. Das Licht von der Veranda, das nachts anblieb, schien durchs Fenster herein, und Amy konnte schwach den verwischten Fleck an der Decke ausmachen, von der Größe eines Eßtellers. Es war nichts weiter als die Folge einer heftigen Schneeschmelze auf dem Dach letzten Winter (was allerdings eine Katastrophe war. »O verdammt«, hatte Isabelle gerufen, als sie an jenem Abend in der Tür von Amys Zimmer stand. »O verdammt, verdammt, verdammt«, als würde der Anblick sie vernichten.).
Aber für Amy war es ein Gedenk-Fleck, eine Art gramvoller Freund; denn in Amys Erinnerung war er letzten Winter erschienen, im Januar, an dem Abend, bevor sie Mr. Robertson begegnete.
Sie war nicht gern in die Schule gegangen: bemüht, in dem freischwebenden Plankton von Körpern ringsum ihren Platz zu finden. Aber sie wußte, daß sie nicht zu den albernen, kuriosen Leuten gehörte, die sich abhoben, wenngleich sie dies vor ein paar Jahren, als die Pubertät die Unverschämtheit besaß, sie früher heimzusuchen als die anderen, für eine Tatsache hielt. Es war vielmehr so, daß sie gütigerweise übergangen wurde, abgesehen von der überraschenden Freundschaft Stacy Burrows’, die zu der Gruppe der beliebten Mädchen gehörte und Amy dennoch letzten Herbst zu ihrer ersten Zigarette ermutigt hatte und sich von da an offenbar an ihre mittäglichen Streifzüge gebunden fühlte, die oft der einzige Lichtblick von Amys Tag waren. Wenn Amy durch die Flure ging, war ihr Gesicht oft hinter der Fülle ihrer langen, lockigen blonden Haare verborgen, die ihr einziger Vorzug zu sein schienen; sogar die beliebten Mädchen sagten zuweilen leichthin im Waschraum: »Gott, Amy, wie ich dich um deine Haare beneide.« Aber sie führte ein stilles Leben, und oft überkam sie ein unbestimmtes, rätselhaftes Schamgefühl.
An jenem gewissen Tag im Januar, als Mr. Cranes Hausdiener Schnee vom Dach des Kutschhauses schaufelte, war Amy in die Mathestunde gegangen und hatte natürlich erwartet, daß nichts Interessantes geschehen würde. Sie haßte Mathe, und sie haßte Miss Dayble, die Lehrerin. Alle haßten sie. Miss Dayble war alt und wohnte bei ihrem Bruder, der ebenfalls alt war, und jahrelang hatten die Schüler Witze darüber gemacht, daß Doughy Dayble mit ihrem Bruder schlief. Ein herrlich schauerlicher Gedanke. Die Frau hatte starke Schuppen, und man konnte stellenweise die rosa Kopfhaut sehen, die glänzte wie eine Wunde. Sie trug selbst im Winter ärmellose Blusen, und wenn sie den Arm hob, um etwas an die Tafel zu schreiben, sah man eine wirre Masse grauweißer Haare, an denen geklumpte Deodorantkügelchen hafteten.
Aber Miss Dayble war nicht da. An jenem gewissen Tag im Januar stand statt ihrer ein Mann vor der Tafel. Der Mann war klein, mit lockigen Haaren, zuckersirupbraun, und er hatte einen Vollbart von derselben Farbe, der seinen Mund vollkommen verdeckte. Er stand da und beobachtete durch seine braungerahmte Brille die nach und nach eintreffenden Schüler, während er leicht an seinem Bart zupfte. Sein Anblick, diese Überraschung, gab Amy für einen Augenblick das Gefühl, Teil der Gruppe ringsum zu sein; sie wechselte einen Blick mit der beliebten Karen Keane. Die Klasse nahm außergewöhnlich leise die Plätze ein. Schon schien das Klassenzimmer ohne die Anwesenheit von Miss Dayble verändert, die Tafel, eine weite Fläche in ernstem Grün, die große Uhr an der Tür, die genau zehn Uhr zweiundzwanzig anzeigte. Eine allgemeine Erwartung hing im Raum. Elsie Baxter stolperte über ihren Stuhl und kicherte albern, aber der Mann verzog keine Miene. Er wartete ein paar Minuten, bevor er sagte: »Mein Name ist Thomas Robertson.«
Niemand hatte ihn zuvor gesehen.
Leicht vorgebeugt, die Hände auf dem Rücken, fügte er in freundlichem Ton hinzu: »Ich werde euch für den Rest des Jahres unterrichten.«
Im entlegensten Bereich ihres Verstandes spürte Amy, daß eine große, stille Veränderung in ihrem Leben stattfand, und sie fragte sich, wie alt der Mann sei. Man konnte ihn nicht jung nennen, aber er war auch nicht alt-alt. So um die Vierzig vielleicht.
»Nun, bevor wir anfangen«, sagte Mr. Robertson mit tiefer, ernster Stimme (er hatte wirklich eine wunderbare Stimme, verschiedene gemeinsam schwingende Töne), »möchte ich gern« – und hier hielt er inne, um die Klasse forschend anzusehen –, »ich möchte gern etwas von euch hören.« Durch seine braunen lockigen Barthaare war das Rosa seines Mundes zu sehen, und im Lächeln zeigte er kurz kräftige gelbe Zähne, während sich in seinen Augenwinkeln Falten bildeten. »Das möchte ich gern. Etwas von euch hören.« Er senkte die Lider, als wolle er diesen Punkt unterstreichen.
»Was denn hören?« Elsie Baxter machte sich nicht die Mühe, die Hand zu heben.
»Wer ihr seid, wie ihr euch seht.« Mr. Robertson ging an ein freies Pult und setzte sich obendrauf, die Füße stellte er auf den Sitz. »Bevor wir uns mit Zahlen befassen« (er sprach mit einem Akzent wie die Leute in Massachusetts), »möchte ich wissen, wie ihr euch selbst in zehn Jahren seht.« Er hob freundlich die Augenbrauen und blickte über die Klasse, verschränkte die Arme und rieb sich die Hände an den Ärmeln seines Sakkos. »Also, denkt nach. Wie seht ihr euch in zehn Jahren?«
Noch nie hatte ein Lehrer so etwas gefragt, und einige rutschten hippelig-vergnügt auf ihren Sitzen herum, während andere reglos überlegten. Der Winterhimmel draußen war weit fort. Das Klassenzimmer schien ein bedeutsamer Ort zu sein, der geölte Holzfußboden trug etwas Gewichtiges, der Geruch nach Kreide und schwitzenden Körpern enthielt einen Hinweis auf Erregung, Verheißung.
»Was ist mit Miss Dayble?« fragte Elsie Baxter plötzlich, abermals, ohne die Hand zu heben.
Mr. Robertson nickte. »Oh, natürlich«, sagte er. »Das möchtet ihr freilich wissen.« Amy, die sich nicht gerührt hatte, seit sie auf ihrem Platz saß, legte jetzt die Hände in den Schoß und fragte sich, ob die alte Frau gestorben war, sie würde es nicht bedauern, falls es zuträfe.
Es war nicht der Fall. Miss Dayble war die Kellertreppe hinuntergefallen und hatte sich offenbar den Schädel gebrochen. Sie war im Krankenhaus, ihr Zustand war stabil, aber es würde lange dauern, bis der Bruch geheilt war. »Wenn jemand ihr eine Karte schicken möchte, wird sie sich sicher darüber freuen«, sagte Mr. Robertson. Niemand wollte. Doch etwas an der besorgten Art, wie Mr. Robertson die Augenbrauen hob und zusammenzog, als er das sagte, machte die Klasse bedrückt, und diejenigen, die ansonsten vielleicht eine höhnische Bemerkung gemacht hätten von wegen, was sie Miss Dayble gern schicken möchten, hielten sich zurück.
Mr. Robertson schwieg noch einen Moment und blickte auf den Fußboden, als erfordere die Erinnerung an Miss Daybles Zustand eine respektvolle Pause, dann sah er zur Klasse auf und sagte leise: »Ich würde immer noch gern etwas über euch wissen.«
Flip Rawley, beliebt und hübsch, mit einem gutmütigen Gesicht, hob die Hand. Er räusperte sich und sagte: »Ich möchte Profi-Basketball spielen.«
»Schön.« Mr. Robertson klatschte einmal in die Hände. »Ein schönes Spiel. Fast wie Ballett, finde ich – wie ein wunderbarer Tanz.«
Amy warf Flip einen Blick zu, um zu sehen, wie er auf die Ballettidee reagierte, aber Flip nickte nur. Mr. Robertson sprang von seinem Pult, leichtfüßig, schwungvoll. An der Tafel sagte er: »Seht her«, und er zeichnete das Diagramm eines bestimmten Basketballspiels. »Na, ist das vielleicht nichts – ein schönes Spiel«, schloß er und warf die Kreide zurück in die Kreideablage. »Wenn’s gut gemacht ist jedenfalls. « Er staubte seine Hände an seiner Kordhose ab und nickte Flip zu. »Viel Glück für die Erfüllung deines Wunsches. «
Danach schossen viele Hände in die Höhe. Maryanne Barmble wollte Krankenschwester werden. Sie wolle »Menschen helfen«, sagte sie, aber Mr. Robertson zupfte nur an seinem Bart und nickte. Enttäuschung zeigte sich in Maryannes Gesicht; sie hatte gedacht, es würde ihn freuen, er würde von der Schönheit ihres Wunsches sprechen.
»Wer kommt als nächstes?« fragte Mr. Robertson.
Amy, die hinter ihren Haaren hervorlugte, betrachtete den Mann eingehend. Er war klein, sicher, aber er war auf robuste Art gedrungen; Brustkorb und Schultern vermittelten den Eindruck von kraftvoller Stärke, und das, obwohl er ein rosa Hemd trug. Seine Haare waren länger, als man es bei einem Mann mittleren Alters gewohnt war; wäre er jünger, hätte er als Hippie drüben vom College durchgehen können. Aber er trug einen kastanienbraunen Schlips zu seinem rosa Hemd und ein braunes Sportsakko von derselben Farbe wie seine Kordhose. Er war unverkennbar erwachsen, mit Autorität ausgestattet. Allein schon seine Stimme bewies das.
»Laßt euch von mir sagen« – Mr. Robertson hielt die Hand in die Höhe –, »daß ihr einen kritischen Punkt in eurem Leben erreicht habt. Ihr seid keine Kinder mehr.« Er schritt durch den Gang zwischen einer Pultreihe; Köpfe drehten sich um, Blicke folgten ihm. »Ihr solltet alles in Frage stellen«, sagte er und ballte eine Faust, um die Schwere des Gesagten zu unterstreichen. Diejenigen, die die Hände gehoben hatten, ließen sie jetzt langsam wieder auf ihre Pulte sinken, ungewiß, worauf er hinauswollte.
»Ihr seid jetzt junge Erwachsene«, fuhr er fort. »Es ist niemand in diesem Raum« – und hier hielt er inne, trat ans Fenster, hob die Schultern, während seine Hände in den Taschen seiner Kordhose mit Kleingeld klimperten –, »der sich jemals wieder für ein Kind halten muß.«
Die Klasse war nicht vollständig erobert, trotz der wunderbaren Stimme des Mannes. Sie hielten sich schon eine ganze Weile nicht mehr für Kinder, und sie fragten sich, ob er sich einschmeicheln wollte – wenngleich dies nicht das Wort war, das ihnen durch die Köpfe ging.
»Ihr seid an einem Punkt in eurem Leben angelangt«, fuhr er fort, »wo ihr alles in Frage stellen müßt.«
Amy überlegte, ob der Mann vielleicht Kommunist war. Mit dem Bart und den langen Haaren könnte er womöglich auf das Thema Marihuana hinauswollen, auf die Forderung, es zu legalisieren.
»Alles in Frage stellen«, wiederholte er und rückte einen freien Stuhl zur Seite. Er hatte große Hände, als hätte die Natur ihn als einen größeren, dickeren Mann vorgesehen, und die Art, wie er den Stuhl rückte, hatte etwas unerhört Sanftes. »Lediglich als Geistesübung. Das ist alles. Bloß, um euren Verstand auf Touren zu bringen.«
Vielleicht war er doch kein Kommunist.
»Wolltet ihr heute morgen wirklich Cheerios zum Frühstück? « fragte er und sah sich in der Klasse um.
Vielleicht war er einfach plemplem.
»Oder habt ihr die Cheerios aus Gewohnheit gegessen? Weil eure Mütter es so wollten?«
Elsie Baxter, die hinter Amy saß, flüsterte hörbar, daß sie heute morgen keine Cheerios gegessen habe, aber Amy achtete nicht auf sie, und Flip Rawley machte ein finsteres Gesicht und verdrehte die Augen, um Elsie zu bedeuten, sie solle den Mund halten, und auf diese Weise wurden Pluspunkte für Mr. Robertson gesammelt.
»So«, sagte Mr. Robertson in einem anderen Tonfall, heiter, wieder freundlich, und rieb sich die Hände. »Wo waren wir? Ich war dabei, von euren Wünschen zu hören. Ich möchte von euren Wünschen hören.«
Kevin Tompkins gedachte Rechtsanwalt zu werden. Stotternd sprach er mehr, als irgend jemand ihn je hatte sagen hören: Seine Cousine sei als kleines Mädchen vergewaltigt worden, und der Kerl sei ungestraft davongekommen. Deshalb wolle er Rechtsanwalt werden. Mr. Robertson stellte eine Menge Fragen und hörte Kevin aufmerksam zu, der stotternd antwortete und sich dabei die Lippen leckte. »Ist das Leben nicht interessant«, sagte Mr. Robert-son schließlich. Der schwarze Zeiger der Wanduhr klickte leise und rückte auf die nächste Ziffer.
Mr. Robertson zeigte mit dem Finger auf Amy.
»Ich?«
»Ja, du. Was möchtest du gern werden?«
Ihr war beinahe schwindlig. »Ich möchte Lehrerin werden«, antwortete sie, aber ihre Stimme war verkrampft und zitterte wahrhaftig; entsetzlich, ihre Verzagtheit allen hörbar zu machen. Ihm.
Mr. Robertson sah sie lange an. Sie errötete, blickte auf ihr Pult, aber als sie durch ihre Haare hochsah, betrachtete er sie immer noch gleichmütig. »Wirklich?« sagte er schließlich.
Eine Hitzewelle überspülte ihre Kopfhaut. Sie sah, wie er mit den Fingern langsam über seinen Bart strich, an einer Stelle, die von fast rötlicher Farbe war, direkt unter seinem Mund. »Aber weißt du«, sagte er und sah sie nachdenklich an, »ich hätte auf Schauspielerin getippt.«
Aus dem Augenwinkel merkte Amy, daß Flip Rawley sie mit neugierigem Interesse ansah. Möglich, daß die ganze Klasse sie so betrachtete. Mr. Robertson lehnte sich an die Fensterbank, als hätte er alle Zeit der Welt, hierüber nachzudenken. »Oder vielleicht eine Dichterin.«
Das ließ ihr Herz schneller schlagen. Woher wußte er von den Gedichten im Schuhkarton unter ihrem Bett? Wie konnte er wissen, daß sie vor Jahren die Gedichte von Edna St. Vincent Millay auswendig gelernt hatte, daß sie im Herbst morgens voller Hoffnung zur Schule – O Welt, nicht fest genug kann ich dich halten!