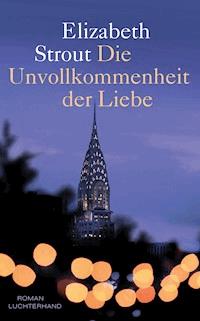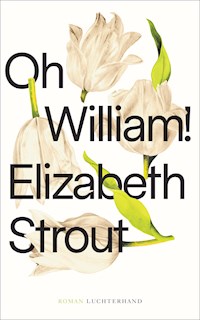
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Lucy-Barton-Romane
- Sprache: Deutsch
Elizabeth Strout ist eine scharfsinnige und mitfühlende Chronistin des Alltags, all der kleinen und großen Dramen, die man Leben nennt. In ihrem neuen Roman erzählt Lucy Barton (die Heldin aus den Romanen »Die Unvollkommenheit der Liebe« und »Alles ist möglich«) von der komplexen und innigen Beziehung zu ihrem ersten Mann William, von den Anfängen, als sie noch studierten, von ihren beiden Töchtern und vom schmerzvollen Ende ihrer Ehe. Doch obwohl sie neue Partner, neue Liebe finden, bleiben sie einander jahrzehntelang verbunden. Und als William Hilfe braucht, ist es Lucy, an die er sich wendet …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch
Elisabeth Strout gehört zu den amerikanischen Schriftstellerinnen, die von Kritik und Publikum gleichermaßen verehrt werden. Sie ist eine scharfsinnige und zugleich mitfühlende Chronistin des Alltags, all der kleinen und großen Dramen, die man Leben nennt. In ihrem neuen Roman nimmt sie die unverwechselbare Stimme von Lucy Barton wieder auf, ihrer Heldin aus den Romanen »Die Unvollkommenheit der Liebe« und »Alles ist möglich«.
Lucy erzählt von der komplexen und innigen Beziehung zu ihrem ersten Mann William, der ihr auch nach der Scheidung Vertrauter und Freund blieb. Mit ihm wurde sie erwachsen, löste sich von ihrer Kindheit in bitterarmen Verhältnissen in dem kleinen Kaff Amgash, Illinois, und versuchte, in New York City Fuß zu fassen; sie erzählt von den Anfängen, als sie noch studierten, von ihren beiden Töchtern und vom schmerzvollen Ende ihrer Ehe. Doch obwohl sie neue Partner, neue Liebe finden, bleiben sie einander jahrzehntelang verbunden. Und als William Hilfe braucht, ist es Lucy, an die er sich wendet …
Lucys Geschichte ihrer beider Leben erzählt, wie es ist, eine Familie zu haben, wie es ist, zu lieben, zu leben, zu verlieren, zu hoffen, zu staunen. Und wie sich alles verändern kann, wenn einen Geschehnisse aus der Vergangenheit einholen, von denen niemand auch nur etwas ahnte. »Wie typisch für das Leben«, sagt Lucy. »Über so vieles werden wir uns erst klar, wenn es zu spät ist.«
»Elizabeth Strout ist eine meiner Lieblingsschriftstellerinnen … Es ist bewundernswert, wie viel Tiefe, Komplexität und Liebe auf diesen Seiten versammelt sind.« Ann Patchett
»Das intime Porträt einer jahrzehntelangen Beziehung, die sich durch die Scheidung zwar verändert, aber nicht auseinanderbricht.« Oprah Magazine
Zur Autorin
Elizabeth Strout wurde 1956 in Portland, Maine, geboren und wuchs in Kleinstädten in Maine und New Hampshire auf. Nach dem Jurastudium begann sie zu schreiben. Inzwischen hat sie mehrere Romane veröffentlicht, die alle Bestseller waren. Für ihren Roman »Mit Blick aufs Meer« bekam sie 2009 den Pulitzerpreis, »Die Unvollkommenheit der Liebe« wurde für den Man Booker Prize 2016 nominiert, »Alles ist möglich« 2018 mit dem Story Prize ausgezeichnet. »Die langen Abende« war New York Times-Bestseller, SPIEGEL-Bestseller und kam auf die SWR-Bestenliste. Elizabeth Strout lebt in Maine und in New York City.
Zur Übersetzerin
Sabine Roth, geb. 1963 in München, Literaturstudium in München, Toronto, Canterbury und Oxford, hat Werke von u. a. Jane Austen, John le Carré, Hilary Mantel und V.S. Naipaul übersetzt.
Elizabeth Strout
OH, WILLIAM!
ROMAN
Aus dem Amerikanischen vonSabine Roth
Luchterhand
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel Oh William! bei Random House, einem Imprint von Penguin Random House LLC, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf den Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2021 Elizabeth Strout
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe
2021 Luchterhand Literaturverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Die Veröffentlichung der Übersetzung wurde vereinbart
mit Random House, einem Imprint von
Penguin Random House LLC, New York
Umschlaggestaltung: buxdesign | München, nach einer Vorlage von Anna Kochman
Covermotiv: © Bridgeman Images/The Stapleton Collection
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-19805-3V001
www.luchterhand-literaturverlag.de
facebook.com/luchterhandverlag
Ich widme dieses Buch meinem Mann, Jim Tierney
Aber geschrieben ist es für alle,
die es vielleicht brauchen können
Ich muss noch etwas über meinen ersten Mann sagen, William.
William hat in jüngster Zeit sehr Schmerzliches durchmachen müssen. Das müssen viele, ich weiß, trotzdem würde ich gern davon sprechen – ich kann gar nicht anders, habe ich fast das Gefühl; er ist jetzt einundsiebzig.
Mein zweiter Mann, David, starb letztes Jahr, und in meine Trauer um ihn hat sich auch Trauer um William gemischt. Trauern ist etwas, ja, etwas so Einsames, das ist vielleicht das Schlimmste daran. Als würde man an der Außenseite eines gläsernen Wolkenkratzers herunterrutschen, und keiner merkte es.
Aber hier soll es um William gehen.
* * *
Er heißt William Gerhardt, und als wir heirateten, nahm ich seinen Namen an, obwohl das damals sehr unmodern war. Meine Zimmergenossin aus dem College sagte: »Du nimmst seinen Namen an, Lucy? Ich dachte, du bist Feministin.« Und ich sagte ihr, dass es mir egal sei, ob ich Feministin war oder nicht; ich wolle nicht länger ich sein, sagte ich ihr. Zu der Zeit war ich es schlicht müde, ich zu sein, ich hatte mein ganzes Leben damit verbracht, nicht ich sein zu wollen – so empfand ich es jedenfalls –, also nahm ich seinen Namen an und war elf Jahre lang Lucy Gerhardt, aber ganz richtig fühlte es sich nie an, und fast unmittelbar nach dem Tod von Williams Mutter ging ich zur Kfz-Zulassungsstelle, um den Namen auf meinem Führerschein wieder zurückändern zu lassen, wobei das schwieriger war, als ich gedacht hatte, ich musste mehrmals hingehen und beglaubigte Dokumente vorlegen, aber ich zog es durch.
Ich wurde wieder Lucy Barton.
Wir waren fast zwanzig Jahre verheiratet, bevor ich mich von ihm trennte, wir haben zwei Töchter, und inzwischen sind wir schon lang wieder Freunde – wie das geht, weiß ich selbst nicht recht. Es gibt viele furchtbare Scheidungsgeschichten, aber bis auf die Trennung als solche gehört die unsrige nicht dazu. Zeitweise dachte ich, ich sterbe, so weh tat es, mich zu trennen und meine Töchter leiden zu sehen, aber ich starb nicht, ich habe es überlebt, und William auch.
Da ich Schriftstellerin bin, gehe ich auch dies mehr oder weniger wie einen Roman an, aber es ist wahr – so wahr, wie ich es wiederzugeben vermag. Und ich möchte sagen – ach, es ist schwer zu wissen, was ich sagen will. Aber alles, was ich von William berichte, habe ich entweder von ihm erzählt bekommen, oder ich habe es selbst miterlebt.
Also setze ich mit dieser Geschichte zu der Zeit ein, als William neunundsechzig war, was jetzt knapp zwei Jahre her ist.
* * *
Für den optischen Eindruck:
Williams Laborassistentin nennt ihn neuerdings »Einstein«, und William fühlt sich offenbar sehr geschmeichelt dadurch. Für mich sieht er kein bisschen wie Einstein aus, auch wenn ich verstehe, was die junge Frau meint. Er hat einen sehr üppigen Schnauzbart, weiß mit Grau dazwischen, aber es ist kein wilder Schnauzbart, und auch sein volles weißes Haar ist ordentlich geschnitten, obwohl es zugegebenermaßen etwas vom Kopf absteht. Er ist ein großer Mann, und er kleidet sich sehr gut. Und ihm fehlt dieses leicht Irre im Blick, das Einstein für mein Gefühl hatte. Williams Gesicht ist oft hinter einem Visier eiserner Liebenswürdigkeit verborgen, außer bei den ganz seltenen Gelegenheiten, wenn er den Kopf zurückwirft und lauthals lacht; es ist lange her, dass ich das erlebt habe. Seine Augen sind braun, und sie sind groß geblieben; nicht jedermanns Augen bleiben im Alter groß, aber die von William schon.
* * *
Jetzt also:
Morgen für Morgen stand William in seiner weitläufigen Wohnung am Riverside Drive auf – schlug die leichte Steppdecke mit dem dunkelblauen Baumwollbezug zurück, ohne seine Frau neben ihm in dem großen Ehebett zu wecken, und ging ins Bad. Seine Glieder waren, jeden Morgen wieder, steif. Aber er hatte seine Übungen, die er regelmäßig machte, er ging ins Wohnzimmer dazu, wo er sich auf dem großen, rot-schwarz gemusterten Teppich unter dem antiken Kronleuchter auf den Rücken legte und mit den Beinen in der Luft Fahrrad fuhr und sie dehnte und streckte. Dann zog er in den ochsenblutfarbenen Lehnsessel am Fenster um, wo er einen Blick auf den Hudson River hatte, und las dort auf seinem Laptop die Nachrichten. Irgendwann tauchte aus dem Schlafzimmer Estelle auf und winkte ihm verschlafen zu, bevor sie ihre Tochter Bridget weckte, die zehn war, und nachdem William geduscht hatte, frühstückten die drei zusammen an dem runden Küchentisch; William mochte das Gleichbleibende daran, und seine Tochter war ein redefreudiges Mädchen, auch das gefiel ihm, es sei, als hörte man einem Vogel zu, sagte er einmal, und ihre Mutter redete ebenfalls gern.
Wenn er danach das Haus verließ, nahm er den Weg durch den Central Park und stieg dann in die U-Bahn zur 14th Street, von wo er die restliche Strecke bis zur New York University zu Fuß zurücklegte; er genoss diesen täglichen Spaziergang, auch wenn er feststellen musste, dass er nicht mehr so schnell war wie die jungen Leute, die an ihm vorbeizogen mit ihren Doppelkinderwagen, ihren Tüten voller Lebensmittel, ihren glänzenden Leggings, Ohrstöpseln und Yogamatten, die ihnen an Gummistrippen über der Schulter hingen. Er tröstete sich damit, dass er seinerseits viele Leute überholte – den alten Mann mit dem Rollator, die Frau mit dem Gehstock oder auch einfach eine Person in seinem Alter, die langsamer vorankam als er –, und das gab ihm das Gefühl, gesund und lebendig und nahezu unverwundbar zu sein in einer Welt permanenten Getriebes. Es machte ihn stolz, dass er jeden Tag mehr als zehntausend Schritte ging.
William fühlte sich (nahezu) unverwundbar, das will ich damit sagen.
Bei diesen Morgengängen dachte er manchmal, o Gott, ich könnte dieser Mann da sein!, in seinem Rollstuhl in der Sonne des Central Park, neben ihm auf der Bank eine Pflegerin, die auf ihrem Handy tippte, während sein Kopf immer tiefer auf die Brust herabsank, oder jener Mann dort!, mit seinem vom Schlaganfall verkrümmten Arm und dem humpelnden Gang … Doch dann dachte William jedes Mal: Nein, das bin ich nicht.
Und das war er auch nicht. Er war, wie ich schon gesagt habe, ein großer Mann, der im Alter nicht dick geworden war (bis auf einen kleinen Bauch, den man im bekleideten Zustand aber kaum sah), ein Mann, der noch immer Haare hatte, weiß inzwischen, aber voll, und er war – William. Und er hatte eine Frau, seine dritte, die zweiundzwanzig Jahre jünger war als er. Alles in allem keine schlechte Bilanz.
* * *
Aber nachts befiel ihn oftmals die Angst.
Das gestand mir William eines Vormittags – vor nicht ganz zwei Jahren –, als wir uns an der Upper East Side zum Kaffee trafen. Wir saßen in einem Diner Ecke 91st Street, Lexington Avenue. William hat viel Geld, und er spendet viel; eine der Einrichtungen, die er unterstützt, ist eine Klinik für Jugendliche ganz in meiner Nähe, und wenn er dort in der Vergangenheit einen Morgentermin hatte, rief er mich an, und dann tranken wir in diesem Diner einen schnellen Kaffee. An dem Tag – es war März, wenige Monate vor Williams siebzigstem Geburtstag – saßen wir an einem Ecktisch; auf die Fensterscheiben waren für den St.-Patrick-Tag Kleeblätter gemalt, und ich dachte – doch, das dachte ich –, dass William müder als sonst wirkte. Ich habe oft festgestellt, dass William mit fortschreitendem Alter immer besser aussieht. Das dichte weiße Haar gibt ihm etwas Distinguiertes; er trägt es eine Spur länger als früher, so dass es leicht vom Kopf wegsteht, mit dem großen, hängenden Schnauzbart als Ausgleich, und seine Backenknochen treten stärker hervor; seine Augen sind immer noch dunkel, und das kann einen merkwürdigen Effekt haben, denn er richtet den Blick voll auf sein Gegenüber – einen freundlichen Blick, der jedoch ab und zu etwas Bohrendes bekommt. Was durchbohrt er mit diesem Blick? Ich habe es nie gewusst.
Als ich ihn an dem Tag im Diner fragte: »Und? Wie geht es dir, William?«, da erwartete ich, dass er mir antworten würde wie immer, mit einem leicht ironischen »Mir geht es blendend, danke, Lucy«, aber an diesem Morgen sagte er nur: »Ganz gut.« Er trug einen langen schwarzen Mantel, den er auszog und über den Nachbarstuhl legte, bevor er Platz nahm. Sein Anzug war maßgeschneidert; seit er Estelle kannte, trug er nur Maßanzüge, und das Jackett saß perfekt; der Anzug war dunkelgrau, das Hemd dazu hellblau und die Krawatte rot, was sehr gediegen wirkte. Er verschränkte die Arme vor der Brust, eine Geste, die er häufig macht. »Gut siehst du aus«, sagte ich, und er sagte: »Danke.« (Ich kann mich nicht erinnern, dass William mir bei all den Malen, die wir einander über die Jahre gesehen haben, je gesagt hätte, dass ich schick oder hübsch oder auch nur nett aussehe, und um ehrlich zu sein, habe ich immer gehofft, dass er es doch irgendwann tut.) Er bestellte unseren Kaffee und ließ den Blick in dem Lokal umherschweifen, und dabei zupfte er an seinem Schnauzbart. Er redete eine Weile über unsere Töchter – er fürchtete, Becka, die jüngere, könnte wütend auf ihn sein, sie war – im weitesten Sinne – ruppig zu ihm gewesen, als er sie vor kurzem angerufen hatte, um ein wenig mit ihr zu schwatzen, und ich sagte ihm, dass er ihr einfach Zeit geben müsse, sie müsse erst in ihrer Ehe ankommen, über solche Themen sprachen wir eine Zeitlang, und dann schaute William mich an und sagte: »Button, ich muss dir etwas sagen.« Er lehnte sich kurz ein Stück vor. »Ich habe nachts seit einer Weile so schreckliche Angstzustände.«
Wenn er meinen Kosenamen aus unserer Vergangenheit verwendet, heißt das, er ist auf eine Art anwesend, die bei ihm selten geworden ist, und ich bin immer gerührt, wenn er mich so nennt.
Ich sagte: »Meinst du Alpträume?«
Er legte den Kopf zur Seite, als würde er darüber nachdenken, und sagte: »Nein. Ich wache auf. Ich liege im Dunkeln, und dann kommt es.« Er fügte hinzu: »Ich hatte so etwas noch nie. Aber es macht mir Angst, Lucy. Wahnsinnige Angst.« Wieder lehnte er sich nach vorn und setzte seine Kaffeetasse ab.
Ich sah ihm zu, und dann fragte ich: »Nimmst du irgendwelche Medikamente, die du vorher nicht genommen hast?«
Er verzog leicht das Gesicht. »Nein.«
Also sagte ich: »Dann versuch’s doch mal mit einem Schlafmittel.«
Und er sagte: »Ich hab in meinem ganzen Leben noch kein Schlafmittel genommen«, was mich nicht überraschte. Seine Frau sei da anders, sagte er, Estelle schlucke alle möglichen Tabletten, er habe es aufgegeben, bei dem Sammelsurium von Pillen durchblicken zu wollen, die sie abends nahm. »Ich nehme jetzt meine Mittel«, sagte sie fröhlich, und eine halbe Stunde später schlief sie auch schon. Das störe ihn nicht, sagte er. Aber für ihn seien Tabletten nichts. Nach vier Stunden wache er dann allerdings oft wieder auf, und dann setzten diese Ängste ein.
»Erzähl mir davon«, sagte ich.
Und er erzählte es mir, die meiste Zeit, ohne mich anzusehen, als hielte ihn die Angst noch immer gefangen.
* * *
Eine dieser Ängste: Benennen ließ sie sich nicht, aber sie hatte mit seiner Mutter zu tun. Williams Mutter – Catherine hieß sie – war schon viele, viele Jahre tot, doch während dieser Zustände spürte er ihre Gegenwart, die aber keine gute Gegenwart war, und das verstand er nicht, denn er hatte sie geliebt. William war ein Einzelkind, und er hatte mit der (verkappt) exzessiven Liebe seiner Mutter zu ihm nie Probleme gehabt.
Um dieser Angst zu entrinnen, während er neben seiner schlafenden Frau wachlag – auch das erzählte er mir an dem Tag, und es warf mich regelrecht um –, dachte er an mich. Er sagte sich, dass ich in meiner Wohnung war, jetzt, und dass ich lebte – ich lebte! –, und dieser Gedanke beruhigte ihn. Denn er wusste, wenn es nicht anders ginge (er legte seinen Löffel sorgfältig auf der Untertasse ab, als er das sagte) – wobei er das mitten in der Nacht natürlich niemals tun würde –, aber falls es gar nicht anders ginge, das wusste er, würde ich ans Telefon gehen, wenn er anrief. Mich in der Welt zu wissen sei ihm in solchen Momenten der größte Trost, und irgendwann schlafe er dann wieder ein.
»Natürlich kannst du mich jederzeit anrufen«, sagte ich.
Und William verdrehte die Augen. »Ich weiß. Davon rede ich doch«, sagte er.
Eine andere dieser Ängste hatte mit Deutschland und mit seinem Vater zu tun, der gestorben war, als William vierzehn war. Sein Vater war deutscher Kriegsgefangener gewesen – im Zweiten Weltkrieg – und zum Arbeiten auf die Kartoffelfelder in Maine abkommandiert worden, und dort hatte er Williams Mutter kennengelernt; sie war die Frau des Kartoffelfarmers. Das war vielleicht Williams schlimmste Angst, denn sein Vater hatte auf der Seite der Nazis gekämpft, und in manchen Nächten suchte dieses Wissen William heim und quälte ihn – in plastischer Deutlichkeit sah er die Konzentrationslager (die wir auf einer Deutschlandreise besucht hatten), er sah die Gaskammern, und dann musste er aufstehen und hinüber ins Wohnzimmer gehen, wo er Licht anmachte, sich aufs Sofa setzte und durchs Fenster hinaus auf den Fluss schaute, und kein Gedanke an mich oder irgendetwas anderes konnte ihm aus dieser Angst heraushelfen. Sie kam nicht so oft wie die Angstzustände wegen seiner Mutter, aber wenn sie kam, war sie schlimm.
Und noch eine dritte. Sie hatte mit dem Tod zu tun, mit einem Gefühl der Loslösung, als wäre er kurz davor, aus der Welt zu scheiden, und an ein Leben nach dem Tod glaubte er nicht, deshalb erfüllte ihn die Vorstellung in manchen Nächten mit Schrecken. Aber normalerweise konnte er im Bett bleiben, nur ab und zu stand er auf und ging ins Wohnzimmer und setzte sich in den ochsenblutfarbenen Lehnsessel am Fenster, um zu lesen – er las gern Biographien –, bis er das Gefühl hatte, wieder einschlafen zu können.
»Seit wann hast du diese Zustände?«, fragte ich ihn. Den Diner, in dem wir saßen, gab es schon viele Jahre, und um diese Tageszeit füllte er sich; kaum stand unser Kaffee vor uns, waren schon vier weiße Papierservietten auf den Tisch geklatscht worden.
William sah aus dem Fenster, wo eine alte Frau ihren Rollator vor sich herschob. Es war einer von diesen Rollatoren mit eingebautem Sitz, sie ging langsam und gebückt, und der Wind blähte ihren Mantel. »Seit ein paar Monaten, würde ich sagen.«
»Und sie kamen aus heiterem Himmel, oder wie?«
Daraufhin sah er mich an, seine Augenbrauen über den dunklen Augen wurden langsam ein wenig struppig, und er sagte: »Ich glaube schon.« Eine Pause, dann lehnte er sich zurück. »Wahrscheinlich komme ich einfach in dieses Alter.«
»Vielleicht.« Aber ich fragte mich, ob es wirklich am Alter lag. Vieles an William war mir schon immer ein Rätsel – unseren Töchtern übrigens auch. Vorsichtig sagte ich: »Willst du vielleicht mit jemandem darüber sprechen?«
»Bloß nicht«, sagte er, und diese Seite von ihm war mir keineswegs rätselhaft. Ich hatte mir schon gedacht, dass er so reagieren würde. »Aber es ist furchtbar«, setzte er hinzu.
»Ach, Pillie.« Das war früher mein Kosename für ihn gewesen. »Das tut mir so leid.«
»Wären wir nur damals nicht nach Deutschland gefahren«, sagte er. Er nahm eine Serviette vom Tisch und wischte sich die Nase. Dann fuhr er sich mit der Hand – fast reflexartig, das macht er oft – über seinen Schnauzbart. »Oder wenigstens nicht nach Dachau. Ich sehe immerzu diese – diese Krematorien vor mir.« Er begegnete kurz meinem Blick. »Es war sehr schlau von dir, da nicht reinzugehen.«
Es überraschte mich, dass William das noch wusste – dass ich in dem Sommer in Deutschland weder in die Gaskammer noch in das Krematorium gegangen war. Ich war nicht mit hineingegangen, weil ich selbst da schon wusste, dass es mir nicht guttun würde, und so wartete ich draußen. Williams Mutter war ein Jahr vorher gestorben, und unsere Mädchen waren neun und zehn, sie waren beide für zwei Wochen im Sommerlager, und in der Zeit flogen wir nach Deutschland – ich hatte auf getrennten Flügen bestanden, so sehr fürchtete ich, wir könnten beide abstürzen und die Kinder elternlos zurücklassen, eine absurde Angst, wie ich dann erkannte, denn viel leichter hätten wir in dem rasenden Verkehr auf den Autobahnen umkommen können –, und wir machten die Reise deshalb, weil wir mehr über Williams Vater herausfinden wollten, der, wie gesagt, starb, als William vierzehn war; er starb in einem Krankenhaus in Massachusetts an Bauchfellentzündung; ihm wurde ein Darmpolyp entfernt, es kam zu einem Durchbruch, und so starb er. Ein weiterer Grund war, dass William einige Jahre davor zu sehr viel Geld gekommen war; sein Großvater hatte am Krieg verdient, wie sich herausstellte, und mit Williams fünfunddreißigstem Geburtstag war das Geld von einem Treuhandkonto auf ihn übergegangen, was ihn sehr belastete, und so fuhren wir zusammen hin, um den alten Mann zu besuchen, er war wirklich uralt, und um zwei Tanten von William kennenzulernen, die höflich zu uns waren, aber kalt, wie ich fand. Der alte Mann, sein Großvater, hatte kleine glitzrige Augen, und gegen ihn fasste ich eine besondere Abneigung. Wir kehrten beide mit einem schlechten Gefühl von der Reise zurück.
»Weißt du, was ich glaube?«, sagte ich. »Diese Ängste nachts gehen bestimmt von selber weg. Das ist nur so eine Phase – irgendetwas, was du gerade verarbeitest.«
William sah mich wieder an und sagte: »Am meisten setzt mir das mit Catherine zu. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt.« Für William war seine Mutter immer nur Catherine, er redete sie auch so an; ich wüsste nicht, dass er sie je »Mom« genannt hätte. Und dann legte er seine Serviette auf den Tisch und stand auf. »Ich muss los«, sagte er. »Immer schön, dich zu sehen, Button.«
Ich sagte: »William! Wie lange trinkst du jetzt schon Kaffee?«
»Jahre«, sagte er. Er bückte sich und gab mir einen Kuss, und sein Gesicht fühlte sich kalt an; sein Schnauzbart kratzte mich ganz leicht an der Wange.
Ich sah ihm durchs Fenster nach, wie er mit schnellen Schritten zur U-Bahn ging; er ging nicht so aufrecht, wie ich es von ihm kannte. Ein klein wenig brach mir der Anblick das Herz. Aber an das Gefühl war ich gewöhnt – es überkam mich nach fast jedem Treffen mit ihm.
Tagsüber arbeitete William in seinem Labor. Er ist Parasitologe und war jahrelang Dozent für Mikrobiologie an der New York University, und auch jetzt hat er dort noch sein Labor und eine wissenschaftliche Hilfskraft; er unterrichtet schon länger nicht mehr. Wobei ihm die Lehre zu seiner Überraschung nicht abgeht, das hat er mir erst kürzlich erzählt; es hatte ihn jedes Mal große Überwindung gekostet, vor seinen Studenten zu stehen, aber vollauf bewusst wurde ihm das erst, als er mit dem Unterrichten aufhörte.
Warum berührt mich das so? Vermutlich deshalb, weil ich davon nie etwas geahnt hatte, und er selbst ja auch nicht.
Also ging er nun jeden Tag von zehn Uhr morgens bis vier Uhr nachmittags zur Arbeit, und er schrieb Aufsätze, forschte und leitete die Assistentin an, die ihm im Labor zur Hand ging. Gelegentlich – vielleicht zwei-, dreimal im Jahr – nahm er an einer Tagung teil und hielt vor anderen Wissenschaftlern seines Fachs einen Vortrag.
* * *
Zwei Dinge passierten William nach unserem Treffen im Diner, zu denen ich gleich kommen werde.
Aber erst ein paar Worte zu seinen Frauen.
Ich, Lucy.
William betreute als Doktorand den Biologiekurs, den ich im zweiten Studienjahr an meinem College bei Chicago belegte; so lernten wir uns kennen. Er war – und ist natürlich immer noch – sieben Jahre älter als ich.
Ich kam aus bitterarmen Verhältnissen. Das ist Teil der Geschichte, auch wenn ich wünschte, es wäre nicht so. Ich kam aus einem winzigen Haus mitten in Illinois; bevor wir in dieses winzige Haus zogen, hatten wir in einer Garage gewohnt, bis ich elf war. In der Garage hatten wir eine kleine Chemietoilette, die aber oft kaputt war, was meinen Vater rasend machte; es gab auch ein Plumpsklo am Ende der Wiese; meine Mutter hatte mir einmal eine Geschichte von einem ermordeten Mann erzählt, dessen Kopf abgehackt und in einem Plumpsklo entsorgt worden war. Die Vorstellung ängstigte mich unsagbar, ich konnte den Deckel von diesem Plumpsklo nie hochheben, ohne mir einzubilden, die Augäpfel des Mannes starrten mich an, und ich verrichtete mein Geschäft oft auf der Wiese, wenn niemand es sah, wobei das im Winter nicht einfach war. Einen Nachttopf gab es auch.
Unser Haus lag inmitten endlos weiter Weizen- und Sojabohnenfelder. Ich habe einen älteren Bruder und eine ältere Schwester, und unsere Eltern hatten wir damals natürlich auch noch. Aber in der Garage und später in dem Häuschen spielte sich Entsetzliches ab. Über einiges davon habe ich geschrieben, und noch mehr möchte ich darüber eigentlich nicht schreiben. Auf jeden Fall waren wir bettelarm. Also sage ich nur so viel: Als ich siebzehn war, bekam ich ein Stipendium an diesem College bei Chicago, das alles abdeckte; niemand aus meiner Familie war je weiter als bis zur Highschool gekommen. Die Vertrauenslehrerin, die Mrs Nash hieß, brachte mich hin; sie holte mich an einem Samstag Ende August um zehn Uhr ab.
Am Abend vorher hatte ich meine Mutter gefragt, was ich packen sollte, und sie hatte gesagt: »Es ist mir scheißegal, was du packst.« Letzten Endes nahm ich zwei große Papiertüten, die ich unter der Spüle fand, und einen Karton aus dem Pick-up meines Vaters und stopfte meine wenigen Kleider in die Tüten und den Karton. Am nächsten Morgen fuhr meine Mutter um halb zehn weg, und ich rannte hinaus auf die lange Schottereinfahrt und schrie hinter ihr her: »Mom! Mommy!« Aber sie fuhr einfach weiter, bis sie bei dem handgemalten Schild SCHNEIDER- UND ÄNDERUNGSARBEITEN auf die Landstraße bog. Meine Geschwister waren nicht da; warum sie weg waren, weiß ich nicht mehr. Kurz vor zehn, als ich zur Tür ging, sagte mein Vater: »Hast du alles, was du brauchst, Lucy?« Und als ich ihn ansah, hatte er Tränen in den Augen, und ich sagte: »Ja, Daddy.« Aber ich hatte keine Ahnung, was man im College braucht. Mein Vater umarmte mich und sagte: »Ich glaube, ich bleibe lieber drin«, und das verstand ich. »Ist gut«, sagte ich, »ich warte draußen«, und so stand ich mit den Einkaufstüten und dem Karton mit meiner Handvoll Sachen darin in der Einfahrt, bis Mrs Nash kam.
Von dem Augenblick an, als ich zu Mrs Nash ins Auto stieg, änderte sich mein Leben. Von Grund auf änderte es sich!
Und dann lernte ich William kennen.
Eins noch vorweg: Mir macht bis heute sehr vieles Angst. Das muss wohl mit dem zusammenhängen, was ich in meiner Kindheit erlebt habe, jedenfalls ängstige ich mich sehr leicht. Zum Beispiel wird mir abends, wenn die Sonne untergeht, fast immer das Herz schwer, nach wie vor. Und manchmal beschleicht mich eine Furcht, als würde mir etwas Schreckliches bevorstehen. Nur war mir all das, als ich William kennenlernte, so nicht bewusst, es fühlte sich – oh, ich glaube, es fühlte sich einfach normal an.
Aber im Zuge meiner Trennung von William ging ich zu einer Therapeutin, einer wunderbaren Frau, die mir bei unserer ersten Sitzung etliche Fragen stellte, und als ich sie beantwortete, schob sie sich die Brille ins Haar hoch, bevor sie mir einen Namen für das nannte, was mit mir los war: »Lucy, Sie leiden an einem handfesten posttraumatischen Stresssyndrom.« Bis zu einem gewissen Grade half mir das. Soweit die Dinge zu benennen eben helfen kann.
Ich verließ William, als unsere Töchter aufs College kamen. Ich wurde Schriftstellerin. Ich meine, eine Schriftstellerin war ich natürlich schon vorher, aber ich begann, Bücher zu veröffentlichen – eins hatte ich bereits veröffentlicht, aber ab da wurden es mehr, darum geht es mir.
Joanne.
Etwa ein Jahr nach dem Ende unserer Ehe heiratete William eine Frau, mit der er sechs Jahre lang eine Affäre gehabt hatte. Vielleicht waren es auch mehr als sechs Jahre, ich weiß es nicht. Diese Frau, die Joanne hieß, war mit uns beiden seit dem Studium befreundet. Äußerlich war sie das Gegenteil von mir, groß und mit langen dunklen Haaren, und sie war ein eher stiller Mensch. Nachdem sie und William geheiratet hatten, wurde sie sehr bitter, was er so nicht erwartet hatte (all das weiß ich erst seit kurzem von ihm), weil sie plötzlich fand, sie hätte ihre gebärfähigen Jahre als sein »Verhältnis« verschwendet – nicht, dass sie oder er von »Verhältnis« sprachen, das ist mein Wort –, weshalb sie als Williams Frau mit der Tatsache zu hadern begann, dass er zwei Töchter hatte, und zwar mit mir, obwohl sie die beiden von klein auf kannte. Sie schleppte ihn zur Paartherapie, was er degoutant fand. Er erlebte die Therapeutin als intelligent, Joanne dagegen als nur mäßig intelligent, wobei ihm das erst bei den Sitzungen in dieser Praxis mit der tristen graubezogenen Couch auffiel – die Frau in einem Drehstuhl ihnen gegenüber, in einem Raum ohne Tageslicht, das einzige Fenster mit Reispapier abgeklebt, um den Bauschacht zu verdecken, auf den es hinausblickte –, erst dort in der Praxis erkannte er, dass Joannes Intelligenz begrenzt war und dass ihre Anziehung in all den Jahren schlicht in der Tatsache bestanden hatte, dass sie nicht seine Ehefrau war. Lucy. Ich.
Er machte die Paartherapie acht Wochen lang mit. »Du willst nur das, was du nicht haben kannst«, hatte Joanne an einem ihrer letzten gemeinsamen Abende gedämpft zu ihm gesagt, und er – die Arme vor der Brust verschränkt, stelle ich mir vor – war stumm geblieben. Die Ehe hatte sieben Jahre gedauert.
Ich hasse sie. Joanne. Ich hasse sie.
Estelle.
In dritter Ehe ist er mit einer umgänglichen (viel jüngeren) Frau verheiratet, und mit ihr hat er ein Kind, obwohl er ihr, als sie sich kennenlernten, wiederholt versichert hatte, er wolle nicht noch mehr Kinder. Als Estelle ihm eröffnete, dass sie schwanger war, sagte sie: »Du hättest dich ja sterilisieren lassen können«, und das vergaß er nie. Denn sie hatte recht. Er hätte es machen können. Ihm wurde klar, dass sie vorsätzlich schwanger geworden war, und er unterzog sich auf der Stelle einer Vasektomie – ohne ein Wort davon zu Estelle. Als das kleine Mädchen geboren war, lernte er, was es hieß, im vorgerückten Alter Vater zu werden: Er liebte seine Tochter. Er liebte sie sehr, doch ihr Anblick, gerade als sie klein war, und umso mehr, je größer sie wurde, erinnerte ihn fast unausgesetzt an die beiden Töchter, die er mit mir hatte, und wenn er von Männern mit zwei Familien hörte – zu denen er ja auch gehörte –, die mehr Zeit für ihre kleineren Kinder hatten, weswegen die älteren Kinder eifersüchtig auf die jüngeren waren, alles das, dann dachte er insgeheim immer: Aber für mich gilt das nicht. Denn seine kleine Bridget, Tochter von Estelle, sprengte ihm zeitweise fast das Herz, solch ein Übermaß an Liebe setzte sie in ihm frei, nostalgische Liebe zu seinen zwei großen Töchtern, die beide schon weit über dreißig waren.
Wenn er untertags mit Estelle telefonierte, konnte es ihm passieren, dass er sie Lucy nannte, und Estelle lachte jeweils nur und nahm es nicht krumm.
* * *
Das nächste Mal sah ich William bei der Feier, die ihm Estelle zu seinem siebzigsten Geburtstag in ihrer Wohnung ausrichtete. Es war Ende Mai, ein klarer Abend, aber kalt. David, mein Mann, war auch eingeladen, aber er war Cellist bei den Philharmonikern und hatte an diesem Abend ein Konzert, darum ging ich allein hin; unsere Töchter Chrissy und Becka waren mit ihren Männern gekommen. Ich war schon zweimal bei William daheim gewesen, zu Beckas Verlobungsfeier und zu einer Geburtstagsparty für Chrissy, und ich hatte mich in der Wohnung nie wohlgefühlt. Sie hat etwas Höhlenartiges, ein Zimmer öffnet sich in das nächste, aber ich fand sie sehr dunkel und auch zu bombastisch (wozu bei mir freilich nicht viel gehört). Ich kenne andere Leute aus armen Verhältnissen, und viele kompensieren ihre Herkunft mit besonders prunkvollen Wohnungen, aber meine und Davids Wohnung war – ist – eine sehr schlichte Angelegenheit; auch Davids Eltern waren arm.
Estelle dagegen kam aus Larchmont, New York, ihre Familie war reich, und miteinander hatten Estelle und William sich ein Zuhause geschaffen, das mich im Stillen immer wieder verblüffte, weil es so gar nichts Heimeliges hatte, es war einfach eine lange Flucht von Räumen, alle mit Parkett – Parkett mit edlen Teppichen darauf – und Türlaibungen aus Holz, überall dieses tiefdunkle Holz, und dazwischen hingen Kronleuchter. Die Küche war so groß wie unser Schlafzimmer, für eine New Yorker Küche war sie gigantisch, alles verchromt, aber trotzdem holzlastig, Schränke aus dunklem Holz, solches Zeug. Ein runder Tisch aus Holz, und im Esszimmer stand gleich der nächste Holztisch, lang und sehr viel größer. Er war von Spiegeln umgeben. Ich wusste, dass die Einrichtung kostspielig war, der ochsenblutfarbene Sessel am Fenster, dieses Riesenmöbel, war opulent gepolstert und die Couch schokoladenbraun mit Kissen aus Samt.
Ich kann mit ihrer Art zu wohnen nichts anfangen, das will ich damit sagen.
Auf dem Weg zu Williams Geburtstagsfeier machte ich bei einem Blumenstand halt und kaufte drei Bund weiße Tulpen, und im Rückblick denke ich wieder, wie wahr das doch ist: Wir schenken das, was wir uns selber wünschen. Die Wohnung war voller Menschen, wenn auch nicht so vielen, wie ich erwartet hätte; anstrengend fand ich es dennoch. Man beginnt ein Gespräch mit jemandem, und jemand Drittes kommt hinzu, so dass man sich unterbrechen muss, und während man redet, sieht man ihre Blicke schon weiterwandern – jeder kennt solche Situationen. Mich macht das nervös, aber die Mädchen – unsere Mädchen – waren wirklich lieb, und auch zu Bridget waren sie lieb, das fiel mir auf, und ich war froh darüber, denn wenn sie mir von ihr erzählen, urteilen sie manchmal recht harsch über sie, und natürlich gebe ich ihnen recht, sie ist oberflächlich und nicht allzu schlau, alles richtig, aber sie ist nur ein kleines Mädchen, ein niedliches kleines Mädchen, was sie sehr gut weiß. Und sie ist reich. Für alles das kann sie nichts, sage ich mir jedes Mal, wenn ich sie sehe. Sie ist nicht mit mir verwandt. Aber sie ist mit unseren Töchtern verwandt, daran führt kein Weg vorbei.