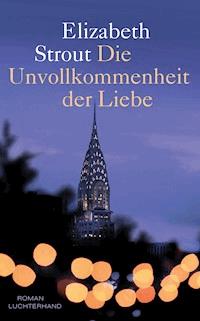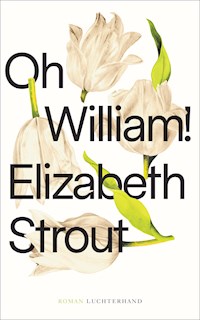9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Leben könnte so einfach sein – doch die Menschen sind es nicht
In einer Kleinstadt in Maine zu leben, mag romantisch klingen, aber die Wirklichkeit sieht meist anders aus. Die Brüder Jim und Bob Burgess sind deswegen so bald wie möglich nach New York gezogen. Als ihre Schwester Susan, die zu Hause geblieben ist, ihre Hilfe braucht, kehren ihre Brüder widerstrebend in die Heimatstadt zurück. Mit ungeahnter Macht holt sie dort jedoch die Vergangenheit wieder ein … Eine aufwühlende Familiengeschichte, vollkommen unsentimental und dabei tief berührend – eine echte Strout eben.
Shirley Falls ist eine typische Kleinstadt in Maine: hohe Arbeitslosigkeit, viele Alte, wenige Junge, wirtschaftlicher Niedergang, in neuester Zeit auch noch Aufnahmeort für muslimische Flüchtlinge aus Somalia. Als einzige der drei Burgess-Geschwister ist Susan hiergeblieben, ihr Mann hat sie schon lang verlassen, der 19-jährige Sohn Zachary wohnt bei ihr in dem eiskalten, ungemütlichen Häuschen. Als der verschlossene, einsame Junge eines Tages einen halb aufgetauten Schweinekopf in die behelfsmäßige Moschee rollen lässt, ist die kleine Gemeinde erschüttert. Ein rassistisches Verbrechen? Auf jeden Fall ein Skandal, mit dem Susan allein nicht fertig wird. Und so bittet sie ihre Brüder Jim und Bob um Hilfe, die als Anwälte in New York arbeiten. Unterschiedlicher könnten diese beiden Brüder nicht sein: Jim, der reiche Karriere-Jurist, lebt mit seiner Frau Helen in einem schönen großen Haus. Bob hingegen war noch nie besonders erfolgreich, ist geschieden, und seine beste Freundin ist immer noch die Exfrau. Nichts zieht die Brüder mehr nach Shirley Falls zurück. Aber natürlich folgen sie dem Hilferuf der Schwester, nicht ahnend, dass ihre Rückkehr nach Maine ihr bisheriges Leben vollkommen umkrempeln wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Elizabeth Strout
Das Leben,natürlich
Roman
Aus dem Amerikanischen von Sabine Roth und Walter Ahlers
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel The Burgess Boys bei Random House, New York.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2013 Elizabeth Strout
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2013
Luchterhand Literaturverlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Die Veröffentlichung der Übersetzung wurde vereinbart mit Random House, einem Imprint der Random House Publishing Group, Random House Inc., New York
Satz und Ebook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-10805-2V003
www.luchterhand-literaturverlag.de
Unser LiteraturBlog www.transatlantik.de
facebook.com/luchterhandverlag
twitter.com/LuchterhandLit
Für Jim Tierney, meinen Mann
Prolog
Wir redeten oft von den Burgess-Geschwistern, meine Mutter und ich. »Die Burgess-Kinder«, so hießen sie bei ihr. Für gewöhnlich redeten wir am Telefon über sie, weil ich in New York lebte und meine Mutter in Maine. Aber wir sprachen über sie auch, wenn ich zu Besuch kam und im Hotel wohnte. Meine Mutter ging nicht oft ins Hotel, und das war immer etwas ganz Besonderes für uns: in einem Hotelzimmer zu sitzen – die Wände grün mit rosa Rosenborte – und über die Vergangenheit zu reden, darüber, wer aus Shirley Falls weggegangen und wer geblieben war. »Gerade musste ich wieder an die Burgess-Kinder denken«, sagte sie dann und schob den Vorhang zur Seite, um auf die Birken hinauszuschauen.
Die Burgess-Kinder beschäftigten sie vor allem deshalb so, glaube ich, weil alle drei am Pranger gestanden hatten; dazu kam, dass meine Mutter sie vor Jahren als Viertklässler in der Sonntagsschule unterrichtet hatte. Die Jungen waren ihr lieber. Jim, weil er schon damals diesen Zorn in sich hatte, den er aber im Zaum hielt, und Bob, weil er so gutherzig war. Für Susan hatte sie nicht viel übrig. »Aber das ging allen so.«
»Als kleines Mädchen war sie sehr hübsch«, erinnerte ich mich. »Mit ihren Locken und den großen Kulleraugen.«
»Und dann hat sie diesen gestörten Sohn bekommen.«
»Traurig«, sagte ich.
»Vieles im Leben ist traurig«, sagte sie. Meine Mutter und ich waren da schon beide verwitwet, und der Feststellung folgte regelmäßig ein Schweigen. Dann fügte meist eine von uns hinzu, wie sehr es uns freute, dass Bob Burgess am Ende doch eine nette Frau gefunden hatte. Die Frau, Bobs zweite und, so hofften wir, letzte, war eine unitarische Pastorin. Meine Mutter hielt nicht viel von den Unitariern; für sie waren es Atheisten, die trotzdem Weihnachten feiern wollten, aber Margaret Estaver stammte aus Maine, das machte es wieder wett. »Schließlich hätte es auch eine New Yorkerin werden können, so lange, wie Bob da gewohnt hat. Denk nur an Jim mit seiner hochnäsigen Miss aus Connecticut«, sagte meine Mutter.
Denn Jim war natürlich schon immer Thema zwischen uns gewesen – Jim, der nach seiner Zeit bei der Generalstaatsanwaltschaft aus Maine weggegangen war, Jim, den wir schon alle als Gouverneur gesehen hatten, aber dann hatte er aus irgendeinem Grund doch nicht kandidiert –, und erst recht redeten wir über ihn in dem Jahr, als der Prozess gegen Wally Packer lief und Jim jeden Abend in den Nachrichten zu sehen war. Der Packer-Prozess wurde als einer der ersten im Fernsehen übertragen; ein knappes Jahr später sollte ihn O.J. Simpson aus dem Gedächtnis der Mehrheit verdrängen, aber damals schauten Jim-Burgess-Fans landesweit voller Faszination zu, wie er einen Freispruch für den rehäugigen Soulsänger Wally Packer erwirkte, dessen schmelzende Stimme (Take this burden from me, the burden of my love) so viele aus unserer Generation ins Erwachsenenalter begleitet hatte. Wally Packer, dem vorgeworfen wurde, den Mord an seiner weißen Freundin in Auftrag gegeben zu haben. Jim beließ den Prozess in Hartford, wo die Hautfarbe eine entscheidende Rolle spielte, und seine Auswahl der Geschworenen, das sagten alle, war brillant. Dann legte er wortgewaltig und mit gnadenloser Geduld dar, wie brüchig das Gewebe sein konnte, das die beiden Komponenten kriminellen Handelns, Vorsatz und Durchführung, miteinander verknüpfte – oder in diesem Fall, so er, eben nicht verknüpfte. In den großen Zeitschriften erschienen sogar Cartoons darüber; bei einem starrte eine Frau auf ihr chaotisches Wohnzimmer, und darunter stand: »Ich hatte mir doch so doll gewünscht, dass es hier ordentlich wird!« Den Umfragen zufolge glaubten die meisten so wenig an Wally Packers Unschuld wie meine Mutter und ich. Aber Jim machte seine Sache großartig und wurde dadurch berühmt. (Ein paar Magazine wählten ihn unter die Sexiest Men of1993, und selbst meine Mutter, der jede Erwähnung von Sex ein Gräuel war, lastete es ihm nicht an.) Angeblich fragte O.J. Simpson ihn für sein »Dream-Team« an, was in den Medien kurzzeitig für Wirbel sorgte, bevor ohne Kommentar aus dem Burgess-Lager das Fazit gezogen wurde, dass Jim sich »auf seinen Lorbeeren« ausruhe. Der Packer-Prozess hatte mir und meiner Mutter zu einer Zeit Gesprächsstoff geliefert, als zwischen uns nicht alles zum Besten stand. Aber das war Vergangenheit. Wenn ich jetzt aus Maine wegfuhr, küsste ich meine Mutter zum Abschied und sagte ihr, dass ich sie liebte, und sie sagte mir das Gleiche.
»Seine Mutter hat Bob zu diesem Therapeuten geschickt, erinnerst du dich?«, fragte ich sie eines Abends am Telefon. Ich saß in meiner Wohnung im sechsundzwanzigsten Stock und sah durchs Fenster zu, wie sich die Dämmerung über New York herabsenkte und auf den weiten Häuserwiesen, die sich vor mir ausbreiteten, Lichter zu glimmen begannen wie Glühwürmchen. »Die Kinder haben auf dem Pausenhof darüber geredet: ›Bobby Burgess muss zum Irrenarzt.‹«
»Kinder sind grässliche Geschöpfe«, sagte meine Mutter. »Bei aller Liebe.«
»Es ist ewig her«, wandte ich ein. »Damals ging bei uns kein Mensch zum Psychiater.«
»Das hat sich geändert«, sagte meine Mutter. »Die Leute bei mir in der Square-Dance-Gruppe – da sind die Kinder alle beim Therapeuten und nehmen irgendwelche Pillen. Und glaub nicht, dass jemand was dabei findet.«
»Erinnerst du dich denn an den Vater?« Es war nicht das erste Mal, dass ich sie das fragte. Wir wärmten gern alte Geschichten auf.
»Doch, ja. So ein Großer war das. Hat in der Ziegelei gearbeitet. Als Aufseher, glaube ich. Und dann saß sie plötzlich allein da.«
»Und sie ist allein geblieben.«
»Ja, sie ist allein geblieben«, sagte meine Mutter. »Die besten Chancen hatte sie sicher nicht, damals. Drei kleine Kinder. Jim, Bob und Sue.«
Das Haus der Burgess lag nur eine Meile vom Stadtzentrum entfernt. Ein kleines Haus, aber die meisten Häuser in diesem Teil von Shirley Falls waren klein oder jedenfalls nicht groß. Das Haus war gelb und stand auf einem Hügel, und die Wiese daneben leuchtete im Frühling in einem so satten Grün, dass ich mir als Kind immer wünschte, eine Kuh zu sein und den ganzen Tag dieses feuchte Gras mampfen zu dürfen, so köstlich sah es aus. Kühe gab es keine auf der Wiese neben dem Burgess-Haus, nicht einmal Gemüsebeete, dennoch überkam einen bei dem Anblick dieses Gefühl von Land. Im Sommer war im Vorgarten manchmal Mrs. Burgess zu beobachten, wie sie einen Schlauch zwischen den Büschen herumschleifte, aber da das Haus auf einem Hügel lag, wirkte sie immer weit weg und klein, und sie erwiderte auch das Winken meines Vaters nicht, wenn wir unten vorbeifuhren; wahrscheinlich sah sie es einfach nicht.
Die Menschen stellen sich Kleinstädte gern als Gerüchteküchen vor, aber als Kind hörte ich die Großen selten über andere Familien reden, und das Burgess-Drama wurde aufgenommen wie alle anderen Tragödien, die arme Bunny Fogg etwa, die ihre Kellertreppe hinunterfiel und erst nachdrei Tagen gefunden wurde, oder Mrs. Hammond, bei der man einen Gehirntumor feststellte, kaum dass die Kinder aus dem Haus waren, oder die verrückte Annie Day, die vor den Jungs den Rock hochzog, dabei war sie schon fast zwanzig und immer noch in der Schule. Die Kinder waren es – vor allem wir Kleineren –, die sich die Mäuler zerrissen. Die Erwachsenen griffen in solchen Fällen hart durch, und wenn einer von ihnen mitbekam, wie ein Kind auf dem Pausenhof einem anderen zutuschelte, Bobby Burgess habe »seinen Vater auf dem Gewissen« oder müsse »zum Irrenarzt«, wurde der Übeltäter zum Direktor zitiert, die Eltern wurden verständigt, und es gab Nachtischentzug. Sehr oft kam das nicht vor.
Jim Burgess war zehn Jahre älter als ich, was ihn so unerreichbar erscheinen ließ wie eine Berühmtheit, und in gewisser Weise war er auch eine, selbst damals schon. Er spielte Football, und er war Klassensprecher und ein gutaussehender Bursche mit seinen dunklen Haaren, aber er wirkte auch ernst, ich kann mich nicht erinnern, dass seine Augen je lächelten. Bobby und Susan waren jünger und kamen manchmal zum Babysitten zu uns. Susan kümmerte sich nicht groß um meine Schwestern und mich, nur einmal war sie der Meinung, wir würden uns über sie lustig machen, und konfiszierte die Zoo-Kekse, die meine Mutter uns immer hinlegte, wenn meine Eltern ausgingen. Daraufhin schloss sich eine von meinen Schwestern aus Protest im Bad ein, und Susan schrie durch die Tür, dass sie die Polizei holen würde. Mehr passierte nicht, jedenfalls kam keine Polizei, und meine Mutter wunderte sich, dass die Zoo-Kekse noch da waren, als sie heimkam. Ein paarmal passte auch Bobby auf uns auf, und er trug uns abwechselnd huckepack durch die Gegend. Man merkte gleich, dass man auf dem Rücken von jemand Nettem, Gutmütigem saß, so wie er ständig den Kopf nach hinten reckte und fragte: »Sitzt du gut? Alles in Ordnung?« Als eine von meinen Schwestern einmal in der Einfahrt hinfiel und sich das Knie aufschlug, war Bobby ganz unglücklich. Er wusch die Wunde mit seinen großen Händen sauber. »So ein tapferes Mädchen. Gleich hast du’s überstanden.«
Als Erwachsene zogen meine Schwestern nach Massachusetts. Aber ich ging nach New York, und das war bitter für meine Eltern: Sie sahen es als Verrat an unserer neuenglischen Abstammung, die bis ins siebzehnte Jahrhundert zurückreichte. Meine Vorfahren waren harte Hunde, so mein Vater, die einiges überlebten, aber in den Sündenpfuhl New York hatte keiner je einen Fuß gesetzt. Ich heiratete einen New Yorker, einen extrovertierten, wohlhabenden Juden, und das war ihnen noch suspekter. Meine Eltern besuchten uns nicht oft. Ich glaube, New York machte ihnen Angst. Ich glaube, mein Mann wirkte ausländisch auf sie, und auch das machte ihnen Angst, und meine Kinder waren ihnen erst recht unheimlich; frech und verzogen müssen sie ihnen vorgekommen sein mit ihren unaufgeräumten Kinderzimmern voller Plastikspielzeug und später mit ihren Nasenpiercings und blauen und lila Haaren. Entsprechend angespannt war unser Verhältnis lange Zeit.
Aber als mein Mann im selben Jahr starb, in dem mein jüngstes Kind aufs College ging und wegzog, kam meine Mutter, die schon ein Jahr vorher Witwe geworden war, zu mir nach New York und strich mir über die Stirn wie früher, wenn ich als kleines Mädchen krank im Bett lag, und sagte, wie leid es ihr tue, dass ich in so kurzer Zeit meinen Vater und meinen Mann verloren hatte. »Kann ich dir irgendwie helfen?«
Ich lag auf meinem Sofa. »Erzähl mir eine Geschichte«, sagte ich.
Sie setzte sich in den Sessel am Fenster. »Hmm, mal überlegen. Susan Burgess’ Mann hat sie verlassen und ist nach Schweden gezogen – dem Ruf seiner Vorfahren gefolgt, was weiß ich. Er kam doch aus dieser winzigen Stadt ganz im Norden, New Sweden, erinnerst du dich? Bevor er dann auf die Universität ging. Susan lebt noch in Shirley Falls, mit diesem einen Sohn.«
»Ist sie noch so hübsch?«, fragte ich.
»Überhaupt nicht.«
Und so fing es an. Wie bei einem Fadenspiel, das meine Mutter mit mir verband und mich mit Shirley Falls, reichten wir Erinnerungen, Neuigkeiten und Tratsch über die Burgess-Kinder zwischen uns hin und her. Wir berichteten und wiederholten. Ich erzählte meiner Mutter nochmals von meiner einzigen Begegnung mit Helen Burgess, Jims Frau, damals in unserer Zeit in Park Slope; die Burgess waren nach dem Packer-Prozess von Hartford nach Park Slope in Brooklyn gezogen, und Jim hatte bei einer Großkanzlei in Manhattan angeheuert.
Mein Mann und ich hatten zufällig im selben Café in Park Slope zu Abend gegessen wie Helen, die mit einer Freundin da war, und beim Gehen blieben wir an ihrem Tisch stehen. Ich hatte Wein getrunken – sonst hätte ich sie wohl kaum angesprochen –, und ich sagte ihr, dass ich in derselben Stadt aufgewachsen war wie Jim. Ein Ausdruck huschte über Helens Gesicht, den ich nicht wieder vergaß. Etwas wie Furcht. Sie fragte nach meinem Namen, und ich sagte ihn ihr, und sie sagte, Jim habe mich nie erwähnt. Nein, ich war jünger, sagte ich. Und mit einem kleinen Schütteln strich sie ihre Stoffserviette glatt und sagte: »Ich war ewig nicht mehr dort. Nett, Sie beide kennenzulernen. Schönen Abend noch.«
Meine Mutter war empört über Helens Reaktion. »Geldadel, was erwartest du? Natürlich hält sie sich für was Besseres als jemand aus Maine.« Ich hatte gelernt, über solche Spitzen hinwegzugehen; der Eifer, mit dem meine Mutter über ihr Maine wachte, regte mich mittlerweile nicht mehr auf.
Aber nach der Sache mit Susan Burgess’ Sohn – nachdem in den Zeitungen, selbst der New York Times, darüber berichtet worden war und im Fernsehen auch – sagte ich bei einem unserer Telefonate zu meiner Mutter: »Ich glaube, ich schreibe die Geschichte der Burgess-Kinder auf.«
»Gut ist sie«, stimmte sie zu.
»Die Leute werden wahrscheinlich sagen, es gehört sich nicht, über jemanden zu schreiben, den man kennt.«
Meine Mutter war müde an diesem Abend. Sie gähnte. »Du kennst sie doch gar nicht«, sagte sie. »Wen kennt man schon richtig.«
ERSTES BUCH
1
Es war ein windiger Oktobernachmittag in Park Slope im Westen von Brooklyn, und Helen Farber Burgess packte für ihren Urlaub. Ein großer blauer Koffer lag aufgeklappt auf dem Bett, die Kleider, die ihr Mann am Abend zuvor herausgesucht hatte, warteten sauber zusammengelegt auf dem Clubsessel gleich daneben. Das Sonnenlicht, das sich immer wieder zwischen den schnell ziehenden Wolken hindurch ins Zimmer stahl, blitzte auf den Messingknäufen des Bettes und ließ den Koffer tiefblau aufstrahlen. Helen ging zwischen dem Ankleideraum – riesige Spiegel, weiße Rosshaartapete, hohes, dunkel gerahmtes Fenster– und dem Schlafzimmer hin und her, dessen gläserne Flügeltüren auf eine Terrasse mit Blick über den Garten führten. Jetzt waren sie geschlossen. Helen empfand diese seltsame Lähmung, die sie beim Packen fast immer befiel, darum kam ihr das Klingeln des Telefons gar nicht ungelegen. UNBEKANNT, meldete das Display, also konnte es nur die Frau eines der Firmenpartner ihres Mannes sein– er arbeitete in einer renommierten Kanzlei mit lauter berühmten Anwälten – oder ihr Schwager Bob, der seit Jahren eine unterdrückte Nummer hatte, aber nicht berühmt war und es auch niemals sein würde.
»Gut, dass du’s bist«, sagte sie. Sie zog einen bunten Schal aus der Kommodenschublade, hielt ihn hoch, ließ ihn aufs Bett fallen.
»Ja?« Bob klang überrascht.
»Ich hatte schon Angst, es ist Dorothy.« Helen stellte sich ans Fenster und sah hinaus in den Garten. Der Pflaumenbaum bog sich im Wind, und vom Bittersüß rissen sich gelbe Blätter los und trieben über den Boden.
»Was ist so schlimm an Dorothy?«
»Ich finde sie zurzeit ein bisschen anstrengend«, sagte Helen.
»Und da fahrt ihr eine Woche mit ihnen in Urlaub?«
»Zehn Tage. Ich weiß.«
Kurze Pause, dann ein »Tja« von Bob, in einem Ton so prompten, so restlosen Verstehens … Das war Bobs ganz große Stärke, dachte Helen, diese Punktgenauigkeit, mit der er es immer wieder schaffte, in irgendeiner kleinen Nische eines anderen Lebens zu landen. Es hätte ihn zu einem guten Ehemann machen müssen, genügte aber offenbar nicht: Bobs Frau hatte ihn schon vor Jahren verlassen.
»Wir waren schon öfter mit ihnen im Urlaub«, erinnerte Helen ihn. »Es wird sicher ganz harmlos. Alan ist eigentlich eine Seele von Mensch. Ein Langweiler eben.«
»Und Seniorpartner der Kanzlei«, sagte Bob.
»Das auch.« Helen trällerte die Worte spielerisch. »Ein bisschen schwer, da zu sagen: ›Ach, wir fahren diesmal lieber allein.‹ Jim sagt, ihre Älteste baut gerade ziemlichen Mist – sie geht auf die Highschool –, und die Familientherapeutin hat Dorothy und Alan geraten, mal wegzufahren. Ich weiß zwar nicht, warum man wegfährt, wenn ein Kind Probleme hat, aber bitte …«
»Komisch, ja«, sagte Bob aufrichtig. Dann: »Helen, was ich gerade erlebt habe …«
Sie hörte zu, faltete dabei eine Leinenhose. »Komm doch einfach rüber«, unterbrach sie ihn. »Dann gehen wir was essen, wenn Jim heimkommt.«
Danach packte sie ganz souverän fertig. Der bunte Schal wanderte in den Koffer, zusammen mit drei weißen Leinenblusen, schwarzen Ballerinas und der Korallenkette, die ihr Jim letztes Jahr geschenkt hatte. Wenn sie mit Dorothy auf der Terrasse einen Whiskey Sour trank, während ihre Männer nach dem Golf duschten, würde Helen sagen: »Bob ist schon ein komischer Heiliger.« Vielleicht würde sie sogar den Unfall erwähnen – dass es der vierjährige Bob gewesen war, der mit den Gängen herumgespielt hatte, so dass das Auto ihren Vater überrollt und getötet hatte; der Mann war die abschüssige Einfahrt hinuntergegangen, um etwas am Briefkasten zu reparieren, und hatte seine drei kleinen Kinder so lange im Auto gelassen. Eine schreckliche Geschichte. Und ein absolutes Tabuthema. Jim hatte in den dreißig Jahren nur ein einziges Mal darüber gesprochen. Aber Bob war ein Mann voller Ängste, Helen beschützte ihn gern ein bisschen.
»Du hättest als Engel zur Welt kommen sollen«, würde Dorothy möglicherweise sagen und sich zurücklehnen, die Augen von ihrer riesigen Sonnenbrille verdeckt.
Helen würde den Kopf schütteln. »Ich kümmer mich einfach gern. Und jetzt, wo die Kinder groß sind …« Nein, die Kinder würde sie nicht erwähnen. Nicht, wenn die Tochter der Anglins die Schule schwänzte und sich bis zum Morgen herumtrieb. Wie sollten sie zehn Tage miteinander verbringen, ohne die Kinder zu erwähnen? Sie musste Jim fragen.
Helen ging nach unten, steckte den Kopf in die Küche. »Ana«, sagte sie zu ihrer Haushälterin, die mit der Gemüsebürste Süßkartoffeln abschrubbte. »Ana, wir essen heute auswärts, Sie können heimgehen.«
Die Herbstwolken, grandios in ihrer vielfach abgestuften Schwärze, wurden vom Wind auseinandergezerrt, so dass breite Sonnenstreifen auf die Gebäude der Seventh Avenue herabschossen. Hier waren die Chinarestaurants, die Papeterien, die Juweliergeschäfte, die Lebensmittelläden mit ihren Obst- und Gemüseauslagen, den Reihen von Schnittblumen. Bob Burgess ging an allem vorüber und weiter zum Haus seines Bruders.
Bob war ein großer Mann, einundfünfzig Jahre alt, und das wohl Bezeichnendste an ihm: Es war leicht, ihn gern zu mögen. Bei ihm fühlte sich jeder sofort angenommen. Wäre Bob das klar gewesen, hätte sein Leben möglicherweise anders ausgesehen. Aber es war ihm nicht klar, und oft ergriff ihn eine unbestimmte Furcht. Außerdem mangelte es ihm an Konstanz. Seine Freunde waren sich einig, dass er die Herzlichkeit in Person sein konnte, und beim nächsten Mal wirkte er in Gedanken weit weg. Darüber war Bob sich im Klaren, seine Exfrau hatte es ihm gesagt. Sich im Kopf davonstehlen, hatte Pam es genannt.
»Das passiert Jim aber auch«, hatte Bob sich verteidigt.
»Von Jim reden wir nicht.«
Während er jetzt am Bordstein auf Grün wartete, erfasste ihn eine Welle der Dankbarkeit für seine Schwägerin, die gesagt hatte: »Wir gehen was essen, wenn Jim heimkommt.« Denn eigentlich wollte er zu Jim. Was er vorhin aus seinem Fenster im dritten Stock beobachtet hatte, was er aus der Wohnung unter seiner gehört hatte – es verstörte ihn, und als er weiterging, über die Straße und vorbei an einem Coffeeshop, in dessen höhlenartigem Dämmer junge Leute auf Sofas saßen und gebannt in ihre Laptops starrten, fühlte Bob sich all dem Vertrauten rings um ihn entfremdet. Als würde er nicht sein halbes Leben schon in New York leben und es lieben, wie man einen Menschen liebt, als wäre er nie fortgegangen von den weiten struppigen Wiesen Neuenglands, hätte nie etwas anderes gekannt und ersehnt als den düsteren Himmel dort.
»Eure Schwester hat angerufen«, sagte Helen, als sie Bob die Gittertür vor dem Backsteinhaus öffnete. »Wollte Jim sprechen und klang recht grimmig.« Sie hängte Bobs Jacke in den Garderobenschrank und fügte dann hinzu: »Ich weiß. Das ist einfach ihre Art. Obwohl, einmal habe ich Susan tatsächlich lächeln sehen.« Helen setzte sich aufs Sofa und zog die schwarzbestrumpften Beine unter sich. »Das war, als ich mit Mainer Akzent zu sprechen versucht habe.«
Bob saß im Schaukelstuhl. Seine Knie wippten auf und ab.
»Niemand sollte jemals versuchen, vor jemandem aus Maine mit Mainer Akzent zu sprechen«, fuhr Helen fort. »Ich weiß nicht, warum die Südstaatler da so viel netter sind, aber es ist so. Wenn man zu einem Südstaatler ›Hi, ya’ll‹ sagt, erntet man nicht diesen süßsäuerlichen Blick. Bobby, du hältst keine Sekunde still.« Sie beugte sich vor, tätschelte die Luft. »Nein, egal. Du brauchst nicht stillzuhalten, solange es dir dabei gut geht. Geht’s dir gut?«
Sein Leben lang hatte Freundlichkeit Bob schwach gemacht, und auch jetzt spürte er es fast körperlich, dieses seltsam flüssige Gefühl in der Brust. »Nicht besonders«, gab er zu. »Aber das mit dem Akzent stimmt schon. Wenn Leute sagen, ›Hey, du kommst aus Maine, you can’t get they-ah from he-yah‹, dann tut das weh. Richtig weh.«
»Das habe ich gemerkt«, sagte Helen. »Jetzt erzähl, was passiert ist.«
Bob sagte: »Adriana und ihr Schnösel hatten mal wieder Streit.«
»Moment«, sagte Helen. »Ach so, ja. Das Ehepaar unter dir. Mit diesem übergeschnappten kleinen Hund, der immer so kläfft.«
»Genau.«
»Erzähl weiter«, sagte Helen, zufrieden, dass sie sich erinnert hatte. »Nein, warte eine Sekunde. Weißt du, was ich gestern in den Nachrichten gesehen habe? Diesen Beitrag, der ›Starke Männer mögen kleine Hunde‹ hieß. Da wurden lauter irgendwie – pardon – tuntig aussehende Männer interviewt, die alle diese winzig kleinen Hunde in karierten Regenmäntelchen und Gummistiefelchen auf dem Arm hatten, und ich dachte: Das nennen die Nachrichten? Der Irakkrieg dauert jetzt schon fast vier Jahre, und so was nennen die Nachrichten? Das kommt, weil sie keine Kinder haben. Deshalb ziehen die ihre Hunde so an. Bob, bitte entschuldige. Erzähl deine Geschichte weiter.«
Helen nahm ein Kissen auf den Schoß und streichelte es. Ihr Gesicht war ganz rosa, und Bob, der es für eine Hitzewallung hielt, sah taktvoll auf seine Hände hinab und merkte gar nicht, dass Helen deshalb errötete, weil sie über Leute sprach, die keine Kinder hatten – wie Bob.
»Sie streiten«, sagte Bob. »Und wenn sie streiten, brüllt der Schnösel immer dasselbe. ›Du hast wohl den Arsch offen, Adriana!‹ In einer Tour brüllt er das.«
Helen schüttelte den Kopf. »Was für ein Leben. Möchtest du einen Drink?« Sie stand auf und trat an den Mahagonischrank, wo sie Whiskey in ein Kristallglas goss. Sie war eine kleine Frau; in ihrem schwarzen Rock und beigefarbenen Pullover machte sie immer noch eine gute Figur.
Bob nahm einen großen Schluck. »Wurscht«, sagte er und sah Helen das Gesicht verziehen. Sie hasste es, wenn er »wurscht« sagte, aber das vergaß er jedes Mal; auch jetzt hatte er es wieder vergessen, weil er nur daran dachte, dass er es nicht schaffte. Dass er ihr nicht deutlich machen konnte, wie traurig das Ganze gewesen war. »Sie kommt heim«, sagte Bob. »Und schon geht das Gezanke los. Er lässt sein übliches Gebrüll vom Stapel. Dann geht er mit dem Hund raus. Aber diesmal holt sie die Polizei, während er weg ist. Das hat sie vorher noch nie gemacht. Er kommt zurück, und sie nehmen ihn fest. Seine Frau hätte gesagt, er hätte sie geschlagen. Das konnte ich die Cops sagen hören. Und er hätte ihre Kleider aus dem Fenster geschmissen. Also haben sie ihn festgenommen. Und er war absolut baff.«
Helen schien nicht recht zu wissen, was sie sagen sollte.
»Er ist so ein schnieker Typ, ganz cool in seinem Reißverschlusspulli, und er stand da und weinte. ›Baby, ich hab dich doch nie geschlagen, Baby, in sieben Jahren Ehe nicht, was tust du da, Baby, bitte!‹ Aber sie haben ihm Handschellen angelegt und ihn am helllichten Tag über die Straße zu ihrem Streifenwagen geführt, und jetzt darf er die Nacht im Knast verbringen.« Bob stemmte sich aus dem Schaukelstuhl hoch, trat an den Mahagonischrank und schenkte sich Whiskey nach.
»Was für eine traurige Geschichte«, sagte Helen. Sie war enttäuscht. Sie hatte sich etwas Dramatischeres erhofft. »Aber das hätte er sich überlegen sollen, bevor er sie schlägt.«
»Ich glaube nicht, dass er sie geschlagen hat.« Bob kehrte zum Schaukelstuhl zurück.
»Ob sie wohl verheiratet bleiben?«, sagte Helen nachdenklich.
»Ich kann’s mir nicht vorstellen.« Bob war jetzt müde.
»Was hat dir daran so zugesetzt, Bobby?«, fragte Helen. »Die zerrüttete Ehe oder die Verhaftung?« Sie nahm es persönlich – dieses Unerlöste in seinem Blick.
Bob wippte vor und zurück. »Alles.« Er schnippte mit den Fingern. »Dass so was einfach so passieren kann. Ich meine, es war doch ein ganz normaler Tag, Helen.«
Helen schüttelte das Kissen auf, schob es wieder an seinen Platz. »Ich weiß nicht, was normal an einem Tag sein soll, an dem man seinen Mann verhaften lässt.«
Bob wandte den Kopf und sah durch die Gitterfenster seinen Bruder den Weg entlangkommen, und ein Hauch von Furcht befiel ihn bei dem Anblick: der forsche Schritt seines älteren Bruders, sein langer Mantel, die dicke Ledermappe. Der Schlüssel drehte sich im Schloss.
»Hallo, Schatz«, sagte Helen. »Dein Bruder ist da.«
»Das sehe ich.« Jim zog den Mantel aus und hängte ihn in den Garderobenschrank. Bob hatte es nie gelernt, seinen Mantel aufzuhängen. Was ist das bei dir?, hatte Bobs Frau, Pam, ihn immer gefragt. Was ist das, was ist das, was ist das? Ja, was war es? Bob konnte es selbst nicht sagen. Aber wann immer er irgendwo hereinkam und keiner ihm den Mantel abnahm, erschien ihm die Vorstellung, ihn aufzuhängen, überflüssig und … ja, zu schwierig.
»Ich sollte gehen«, sagte Bob. »Ich muss noch einen Schriftsatz fertig machen.« Bob war Rechtshelfer am Berufungsgericht, wo er Akten für die Verhandlung bearbeitete. Irgendeine Berufung, für die ein Schriftsatz fertig gemacht sein wollte, gab es immer.
»Unsinn«, sagte Helen. »Ich habe gesagt, wir gehen zusammen was essen.«
»Runter von meinem Stuhl, Goofy.« Jim winkte vage in Bobs Richtung. »Lange nicht gesehen. Wie viele Tage waren das jetzt – vier?«
»Hör auf, Jim. Dein Bruder musste vorhin zuschauen, wie dieser Nachbar aus der Wohnung unter ihm in Handschellen abgeführt wurde.«
»Randale im Studentenwohnheim?«
»Jim, nicht.«
»Mein großer Bruder kann nicht anders«, sagte Bob. Er wechselte aufs Sofa hinüber, und Jim ließ sich in den Schaukelstuhl fallen.
»Dann schieß los.« Jim verschränkte die Arme. Er war groß und muskulös, und wenn er die Arme verschränkte, was er oft tat, ließ ihn das massig erscheinen, angriffslustig. Er hörte reglos zu. Dann lehnte er sich vor, um seine Schuhe aufzubinden. »Hat er ihre Kleider aus dem Fenster geworfen?«, fragte er.
»Ich habe nichts gesehen«, sagte Bob.
»Familien«, sagte Jim. »Ohne sie wäre die Hälfte aller Strafrechtler arbeitslos. Ist dir klar, Helen, dass du einfach nur die Polizei holen und behaupten müsstest, ich hätte dich geschlagen, und schon säße ich bis morgen früh hinter Gittern?«
»Ich habe nicht vor, dich einsperren zu lassen.« Helen sagte es im Plauderton. Sie stand auf und zog den Bund ihres Rocks glatt. »Aber wenn du dich noch umziehen willst, dann mach. Ich habe Hunger.«
Bob beugte sich nach vorn. »Jimmy, irgendwie hat mich das fertiggemacht. Wie sie ihn abgeführt haben. Keine Ahnung, wieso.«
»Werd erwachsen«, sagte Jim. »Mann! Was erwartest du von mir?« Er zog einen Schuh aus, rieb seinen Fuß. »Wenn du willst«, fügte er hinzu, »kann ich nachher ja mal anrufen. Mich vergewissern, dass ihm nichts fehlt. Dem hübschen weißen Knaben im Knast.«
Nebenan klingelte das Telefon, mitten hinein in Bobs: »Ja? Würdest du das tun, Jim?«
»Das wird deine Schwester sein«, sagte Helen. »Sie hat’s vorhin schon probiert.«
»Sag, ich bin noch nicht da, Hellie.« Jim warf seine Socke vor sich auf den Parkettboden. »Wann hast du das letzte Mal mit Susan gesprochen?«, fragte er Bob und zog auch den anderen Schuh aus.
»Vor Monaten«, sagte Bob. »Als wir diese Diskussion über die Somali hatten, von der ich dir erzählt hab.«
»Warum sind überhaupt Somalier in Maine?«, fragte Helen, während sie nach drüben ging. Und über die Schulter: »Warum geht irgendwer nach Shirley Falls, es sei denn in Fesseln?«
Es überrumpelte Bob jedes Mal, wenn Helen so redete, als sei es unnötig, aus ihrer Abneigung gegen die Herkunft der Burgess ein Hehl zu machen. Aber Jim rief zurück: »Sie sind in Fesseln. Armut ist eine Fessel.« Er warf die zweite Socke der ersten hinterher; sie blieb an der Ecke des Couchtischs hängen.
»Susan hat gesagt, es wäre eine richtige Invasion«, fuhr Bob fort. »Die Somali würden in Schwärmen einfallen. Vor drei Jahren wären nur ein paar Familien da gewesen, und inzwischen wären es zweitausend, und kaum dreht man sich um, wird schon die nächste Busladung herangekarrt. Ich habe gesagt, sie soll nicht hysterisch sein, und sie sagte, Frauen bekämen immer gleich Hysterie unterstellt, und bei den Somali könnte ich sowieso nicht mitreden, weil ich schließlich seit Ewigkeiten nicht mehr in Shirley Falls war.«
»Jim.« Helen kam ins Wohnzimmer zurück. »Sie muss dich unbedingt sprechen. Sie klingt völlig aufgelöst. Ich konnte nicht lügen. Ich habe gesagt, du bist gerade erst heimgekommen. Tut mir leid, Liebling.«
Jim berührte im Vorbeigehen ihre Schulter. »Schon gut.«
Helen bückte sich und hob Jims Socken auf, und Bob, der ihr zusah, fragte sich, ob Pam, wenn er wie Jim seinen Mantel aufgehängt hätte, vielleicht weniger wütend über die Socken gewesen wäre.
Nach einem langen Schweigen hörten sie Jim in ruhigem Ton Fragen stellen. Worte konnten sie keine verstehen. Darauf noch ein langes Schweigen, noch mehr ruhige Fragen, Kommentare. Immer noch war nichts zu verstehen.
Helen fingerte an ihrem zierlichen Ohrring herum und seufzte. »Schenk dir noch einen Drink ein. Da es ja offenbar länger dauern wird.« Aber die Anspannung blieb. Bob lehnte sich auf dem Sofa zurück und beobachtete durchs Fenster die Leute, die draußen von der Arbeit heimgingen. Das Haus lag nur sechs Straßen von Bobs Wohnung entfernt, auf der anderen Seite der Seventh Avenue, aber Witze über Studentenwohnheime verboten sich hier von selbst. In Jims und Helens Straße lebten Erwachsene. Banker und Ärzte und Reporter, Menschen, die Aktenmappen und eine erstaunliche Vielfalt an schwarzen Taschen bei sich trugen, besonders die Frauen. Die Bürgersteige hier waren gepflegt und die kleinen Vorgärten mit Ziersträuchern bepflanzt.
Helen und Bob wandten beide den Kopf, als sie Jim auflegen hörten.
Jim stand in der Tür. Die rote Krawatte hing lose um seinen Hals. »Wir können nicht fahren«, sagte er. Helen setzte sich gerader hin. Mit einem wütenden Ruck riss Jim sich die Krawatte ganz herunter und sagte zu Bob: »Unser Neffe wird verhaftet.« Er war blass im Gesicht, seine Augen waren schmale Schlitze. Er ließ sich aufs Sofa fallen und legte den Kopf in die Hände. »O Mann. Das wird für Schlagzeilen sorgen. Neffe von Jim Burgess unter Anklage …«
»Hat er jemanden umgebracht?«, fragte Bob.
Jim schaute auf. »Hast du sie nicht mehr alle?«, fragte er im selben Moment, als Helen vorsichtig sagte: »Eine Prostituierte?«
Jim schüttelte den Kopf, heftig, als wäre ihm Wasser ins Ohr gekommen. Er sah Bob an und sagte: »Nein, er hat niemanden umgebracht.« Er sah Helen an und sagte: »Nein, die Person, die er nicht umgebracht hat, war keine Prostituierte.« Dann richtete er den Blick zur Decke, schloss die Augen und sagte: »Unser Neffe Zachary Olson hat einen tiefgefrorenen Schweinekopf durch die Tür einer Moschee geworfen. Zur Gebetszeit. Mitten im Ramadan. Susan sagt, Zach hätte keine Ahnung, was Ramadan ist, was ich ihr unbesehen glaube – Susan wusste es auch nicht, bevor sie es in der Zeitung gelesen hat. Der Schweinekopf war blutig, halb aufgetaut, er hat ihnen den Teppich besudelt, und sie haben kein Geld, um einen neuen zu kaufen. Sie müssen ihn siebenmal reinigen lassen, so schreibt es das heilige Gesetz vor. Noch Fragen?«
Helen sah Bob an. Verwirrung schlich sich in ihre Züge. »Warum soll das für Schlagzeilen sorgen, Jim?«, fragte sie schließlich leise.
»Kapierst du’s nicht?«, fragte Jim genauso leise, indem er sich zu ihr drehte. »Es fällt unter Hassverbrechen, Helen. Genauso gut könntest du am Sabbat rüber nach Borough Park gehen, in eine jüdisch-orthodoxe Synagoge eindringen und alle dort zwingen, Eiscreme und Speckschwarten zu essen.«
»Ach so«, sagte Helen. »Das war mir nicht klar. Das wusste ich nicht über die Moslems.«
»Sie verfolgen es als Hassverbrechen?«, fragte Bob.
»Sie wollen es offenbar in jeder nur denkbaren Weise verfolgen. Das FBI ist schon eingeschaltet. Die Generalstaatsanwaltschaft erwägt eine Klage wegen Verletzung der Bürgerrechte. Susan sagt, es kommt landesweit in den Nachrichten, aber sie ist so durch den Wind, dass ich darauf nicht unbedingt viel gebe. Offenbar war irgendein CNN-Reporter zufällig in der Stadt, hat die lokale Berichterstattung gehört und fand die Geschichte so prickelnd, dass er sie aufgegriffen hat. Wie kommt jemand zufällig nach Shirley Falls?« Jim nahm die Fernbedienung, richtete sie auf den Fernseher, warf sie dann neben sich aufs Polster. »Das hat mir jetzt grade noch gefehlt. O Mann, das hat mir noch gefehlt.« Er fuhr sich mit beiden Händen übers Gesicht, durch die Haare.
»Behalten sie ihn in U-Haft?«, fragte Bob.
»Sie haben ihn noch gar nicht festgenommen. Sie wissen nicht, dass es Zach war. Sie fahnden nach irgendwelchen Rowdys, dabei war es nur der hirnamputierte kleine neunzehnjährige Zach. Zach, Sohn von Susan.«
»Wann ist es passiert?«, fragte Bob.
»Vorgestern Abend. Laut Zach, also laut Susan, hat er es allein gemacht, als ›Gag‹.«
»Als Gag?«
»Als Gag. Nein, entschuldige, als ›blöder Gag‹. Ich berichte nur, Bob. Er rennt weg, keiner sieht ihn. Angeblich. Dann hört er es heute in sämtlichen Nachrichten, kriegt es mit der Angst und beichtet es Susan, als sie von der Arbeit heimkommt. Sie ist ausgerastet, verständlicherweise. Ich habe ihr gesagt, sie soll jetzt gleich mit ihm zur Polizei, er muss sich auch zu nichts äußern, aber sie traut sich nicht. Sie hat Angst, dass sie ihn über Nacht einsperren. Sie sagt, sie unternimmt gar nichts, bevor ich nicht da bin.« Jim ließ den Oberkörper nach hinten sacken, beugte sich dann gleich wieder vor. »Mann, Mann, Mann. So eine Scheiße.« Er sprang auf die Füße, fing an, vor den vergitterten Fenstern auf und ab zu laufen. »Der Polizeichef heißt Gerry O’Hare. Nie gehört. Susan sagt, sie ist in der Highschool mal mit ihm gegangen.«
»Er hat sie nach dem zweiten Date abserviert«, sagte Bob.
»Gut. Dann ist er jetzt vielleicht nett zu ihr. Immerhin überlegt sie, ob sie ihn morgen früh anruft und ihm sagt, dass sie mit Zach kommt, sobald ich da bin.« Jim hieb im Vorbeigehen mit der Faust auf die Armlehne des Sofas. Er setzte sich wieder in seinen Schaukelstuhl.
»Hat er schon einen Anwalt?«, fragte Bob.
»Ich muss einen suchen.«
»Kennst du denn niemanden bei der Generalstaatsanwaltschaft?«, fragte Helen. Sie zupfte eine Fluse von ihrer schwarzen Strumpfhose. »Die Fluktuation da oben wird ja wohl kaum sehr stark sein.«
»Den Generalstaatsanwalt selbst kenne ich.« Jims Stimme war laut, er schaukelte heftig vor und zurück, die Hände sehr fest auf den Armlehnen. »Wir waren vor Jahren zusammen Ankläger bei der Staatsanwaltschaft. Du hast ihn mal auf einer Weihnachtsfeier kennengelernt, Helen. Dick Hartley. Ein ziemlicher Trottel, fandest du, völlig zu Recht. Und ich werde den Teufel tun und mich an ihn wenden. Er hat seine Nase schon in dem Fall drin. Ein Interessenkonflikt hoch zehn. Und strategischer Selbstmord. Ein Jim Burgess trampelt da nicht einfach rein, Herrgott noch mal.« Helen und Bob wechselten Blicke. Gleich darauf hörte Jim zu schaukeln auf und sah Bob an. »Eine Prostituierte umgebracht? Wie kommst du auf so was?«
Bob hielt entschuldigend die Hand hoch. »Zach ist einfach ein bisschen undurchschaubar, mehr hab ich nicht gemeint. Ein Stiller.«
»Zach ist ein Arsch und sonst gar nichts.« Jim sah zu Helen. »Entschuldige, Schatz.«
»Das mit der Prostituierten kam von mir«, erinnerte Helen ihn. »Kein Grund also, wütend auf Bob zu werden. Außerdem hat er völlig recht, Zach war schon immer ein Außenseiter, und offengestanden ist das genau so eine Geschichte, wie sie in Maine passiert, so ein ganz Stiller, der bei seiner Mutter wohnt und Prostituierte umbringt und sie in irgendeinem Kartoffelacker verscharrt. Und da er das alles nicht gemacht hat, sehe ich nicht ein, dass wir deshalb unseren Urlaub absagen müssen, tut mir leid.« Helen schlug die Beine übereinander und faltete die Hände um die Knie. »Und warum er sich mit aller Gewalt selbst anzeigen soll, weiß ich auch nicht. Besorgt ihm doch einen Anwalt in Maine und lasst den darüber entscheiden.«
»Hellie, du bist sauer, und das kann ich verstehen«, sagte Jim geduldig. »Aber Susan dreht fast durch. Und ja, ich besorge ihm einen Anwalt in Maine. Aber Zach muss sich stellen, weil …« Jim hielt inne und sah im Zimmer umher. »Weil er es getan hat. Das ist der Hauptgrund. Und außerdem, wenn er gleich hingeht und sich an die Brust schlägt, fassen sie ihn wahrscheinlich sanfter an. Aber die Burgess sind keine Drückeberger. Das ist nicht unser Stil. Wir laufen nicht davon.«
»Aha«, sagte Helen. »Wenn das so ist.«
»Ich hab ihr das erklärt und noch mal erklärt: Sie erledigen die Formalitäten, setzen eine Kaution fest, und dann darf er wieder nach Hause. Es ist ein Vergehen, mehr nicht. Aber stellen muss er sich. Der öffentliche Druck auf die Polizei ist enorm.« Jim wölbte die Hände vor sich, als umfassten sie einen Basketball. »Das Wichtigste ist jetzt, die Sache kleinzuhalten.«
»Ich fahre hin«, sagte Bob.
»Du?«, sagte Jim. »Mr. Flugangst?«
»Ich nehme euer Auto. Ich breche gleich morgen früh auf. Und ihr zwei fliegt … wohin fliegt ihr gleich wieder?«
»St. Kitts«, sagte Helen. »Jim, warum kann das nicht Bob machen?«
»Weil …« Jim schloss die Augen, senkte den Kopf.
»Weil ich’s vermurkse?«, vollendete Bob. »Sicher, dich mag sie lieber, aber jetzt komm schon, Jimmy, lass mich fahren. Ich möchte es.« Schlagartig fühlte er sich betrunken, als zeigte der Whiskey von vorhin seine Wirkung erst jetzt.
Jim ließ die Augen geschlossen.
»Jim«, sagte Helen. »Du brauchst diesen Urlaub. Du bist völlig überarbeitet.« Es war eine Dringlichkeit in ihrer Stimme, die Bob mit einem frischen Einsamkeitsgefühl erfüllte: Für Helen stand Jim an erster Stelle, da blieb kein Raum für die Bedürfnisse einer Schwägerin, die Helen nach all den Jahren kaum kannte.
»Also gut«, sagte Jim. Er nahm den Kopf wieder hoch, sah Bob an. »Du fährst. Gut.«
»Wir sind schon ein verkrachter Haufen, was, Jimmy?« Bob setzte sich neben seinen Bruder und legte ihm den Arm um die Schulter.
»Lass das«, sagte Jim. »Lässt du das bitte? Himmelarsch!«
Bob ging durch die dunklen Straßen heimwärts. Als er sich seinem Haus näherte, sah er, dass in der Wohnung unter seiner der Fernseher lief. Undeutlich machte er den Umriss von Adriana aus, die allein vor dem Bildschirm saß. Hatte sie niemanden, der die Nacht bei ihr verbringen konnte? Sollte er bei ihr klopfen, sie fragen, ob sie etwas brauchte? Aber dann sah er sich bei ihr auf der Türschwelle stehen, der große grauhaarige Mann aus dem oberen Stock, und dachte, dass ihr das wahrscheinlich nicht recht wäre. Er stieg die Treppe bis zu seiner Wohnung hinauf, warf seinen Mantel auf den Boden und griff zum Telefon.
»Susie«, sagte er. »Ich bin’s.«
Sie waren Zwillinge.
Jim hatte von klein auf seinen eigenen Namen gehabt, aber Susie und Bob waren die Zwillinge. Geh die Zwillinge suchen. Sag den Zwillingen, wir essen jetzt. Die Zwillinge haben Windpocken, die Zwillinge können nicht schlafen. Aber Zwillinge sind auf ganz eigene Weise verbunden. Zwischen sie passt, mit etwas Glück, kein Blatt. »… ihn umbringen«, sagte Susan gerade am Telefon. »Ihn an den Zehennägeln aufhängen.«
»Komm, komm, Susan, er ist doch dein Sohn.« Bob hatte die Schreibtischlampe angeknipst; er stand da und sah auf die Straße hinaus.
»Ich rede von dem Rabbiner. Und dieser komischen Trulla von den Unitariern. Die haben eine Erklärung abgegeben. Nicht nur die Stadt ist durch diese Sache beschädigt, sondern der ganze Staat. Nein, was sage ich da, das ganze Land.«
Bob rieb sich den Nacken. »Hör mal, Susan. Wieso macht Zach so was?«
»Warum er so was macht? Wann hast du zum letzten Mal ein Kind großgezogen, Bob? O ja, ich weiß, wir müssen taktvoll sein und deine trägen Spermien oder nicht-existenten Spermien oder was auch immer nicht erwähnen, und ich hab’s ja auch nie gemacht, nicht ein Wort hab ich drüber verloren, dass Pam dir vielleicht den Laufpass gegeben hat, um mit einem anderen Kinder zu kriegen … Mist, jetzt bringst du mich auch noch dazu, solche Sachen zu sagen, wo ich weiß Gott andere Sorgen hab!«
Bob wandte sich vom Fenster ab. »Susan, hast du irgendwelche Tabletten, die du nehmen kannst?«
»Zyankali, meinst du?«
»Valium.« Bob fühlte eine bodenlose Traurigkeit in sich aufwallen, und er ging mit dem Telefon ins Schlafzimmer zurück.
»Ich nehme nie Valium.«
»Dann fang jetzt damit an. Dein Arzt kann dir telefonisch welches verschreiben. Damit du heute Nacht wenigstens schläfst.«
Susan antwortete nicht, und Bob wurde klar, dass seine Traurigkeit in Wahrheit Sehnsucht nach Jim war. Denn letztlich (und Jim wusste das ganz genau) hatte Bob keine Ahnung, was er tun sollte. »Dem Jungen kann nichts passieren«, sagte Bob. »Niemand will ihm etwas anhaben. Oder dir.« Bob setzte sich aufs Bett, stand wieder auf. Er hatte wirklich nicht die leiseste Ahnung, was er tun sollte. Für ihn würde es heute Nacht keinen Schlaf geben, nicht mal mit Valium, und er hatte reichlich. Nicht, während sein Neffe in der Tinte saß und diese arme Frau unter ihm einsam vor ihrem Fernseher und ihr Schnösel im Kittchen. Und Jimmy sich davonmachte auf irgendeine Insel. Bob wanderte wieder in den vorderen Teil seiner Wohnung, knipste die Schreibtischlampe aus.
»Eine Frage«, hörte er seine Schwester sagen.
In der Dunkelheit draußen hielt auf der anderen Straßenseite ein Bus. Eine alte schwarze Frau sah mit steinerner Miene aus dem Fenster, ein Mann weiter hinten wippte mit dem Kopf, vielleicht zu irgendwelchen Rhythmen aus seinen Ohrstöpseln. Sie wirkten unfassbar arglos und fern …
»Bildest du dir ein, das hier ist ein Film?«, fragte seine Schwester. »So ein gottverlassenes Nest am Arsch der Welt, wo die Farmer zum Gefängnis marschieren und seinen Kopf auf einer Stange fordern?«
»Was redest du da?«
»Ich bin ja so froh, dass Mommy nicht mehr da ist. Sie würde gleich noch mal sterben, das sag ich dir.« Susan weinte jetzt.
Bob sagte: »Der Sturm legt sich auch wieder.«
»Verflixt und zugenäht, wie kannst du das sagen? Es kommt auf allen Sendern.«
»Schalt die Kiste aus«, riet Bob ihr.
»Hältst du mich für verrückt, oder was?«, wollte sie wissen.
»Ein bisschen. Vorübergehend.«
»Sehr hilfreich, danke. Hat Jimmy dir erzählt, dass ein kleiner Junge in der Moschee umgekippt ist, so hat der Schweinekopf ihn erschreckt? Er fing schon an aufzutauen, deshalb war er blutig. Ich weiß genau, was du jetzt denkst. Was ist das für eine Mutter, die nicht mal merkt, wenn ihr Sohn ihr einen Schweinekopf in die Gefriertruhe steckt und dann so was macht? Das denkst du, Bob, streite es gar nicht erst ab. Und das macht mich verrückt. Wie du selber gerade festgestellt hast.«
»Susan, du hast doch …«
»Man rechnet mit allem Möglichen bei seinen Kindern, weißt du? Nein, weißt du natürlich nicht. Autounfälle. Die falsche Freundin. Schlechte Noten, alles. Aber doch nicht so ein Rambazamba wegen irgendwelchen bescheuerten Moscheen.«
»Morgen bin ich da, Susan.« Das hatte er ihr gleich zu Anfang gesagt. »Wir bringen ihn zusammen hin. Wir halten das klein, mach dir keine Sorgen.«
»Nein, worum auch«, sagte sie. »Gute Nacht.«
Wie Hund und Katze! Bob öffnete das Fenster einen Spalt, klopfte eine Zigarette aus der Packung, schenkte sich ein Wasserglas mit Wein voll und setzte sich auf den metallenen Klappstuhl beim Fenster. In dem Haus gegenüber brannte in mehreren Wohnungen Licht. Er bekam seine ganz private Vorführung geboten hier oben: das junge Mädchen, das nur mit der Unterhose bekleidet im Zimmer herumlief. Die Möbel in dem Zimmer standen so, dass er nie ihre Brüste sah, immer nur ihren nackten Rücken, aber ihm gefiel dieses Unbekümmerte, Freie an ihr. Es war einfach da – wie eine Glockenblumenwiese im Juni.
Zwei Fenster weiter war das Paar, das so viel Zeit in seiner weißen Küche verbrachte. Der Mann langte gerade zu einem der Schränke hoch; er schien derjenige zu sein, der kochte. Bob kochte nicht gern. Er aß gern, aber – Pam hatte ihn darauf aufmerksam gemacht – lauter Sachen, wie Kinder sie mochten, farblosen Pampf wie Kartoffelbrei oder Käsenudeln. Die New Yorker interessierten sich sehr für Essen. Essen war eine ernste Angelegenheit für sie. Essen war wie Kunst. Köche wurden in New York gefeiert wie Rockstars.
Bob schenkte sich Wein nach, kehrte an seinen Platz am Fenster zurück. Geschenkt, wie man heutzutage so gern sagte.
Ob jemand Chefkoch war oder Bettler oder millionenfach geschieden, danach fragte in dieser Stadt keiner. Und wenn man sich am offenen Fenster zu Tode rauchte, wenn man seine Frau erschreckte und dafür ins Gefängnis wanderte – geschenkt. Es war das Paradies, hier zu leben. Susie hatte das nie begriffen. Arme Susie.
Bob wurde langsam betrunken.
Im Stockwerk unter ihm ging die Tür auf, Schritte erklangen auf der Treppe. Er spähte aus dem Fenster. Adriana stand unter einer Straßenlaterne, die Leine in der Hand; ihre hochgezogenen Schultern zitterten, und das winzige Hündchen stand neben ihr und zitterte mit. »Ach, ihr armen Dinger«, sagte Bob leise. Niemand, so schien ihm in seinem betrunkenen Überschwang, niemand – egal wo – hatte auch nur den blassesten Schimmer.
Sechs Straßen weiter lag Helen neben ihrem Mann und hörte ihm beim Schnarchen zu. Durchs Fenster sah sie am schwarzen Nachthimmel die Flugzeuge im Anflug auf La Guardia, alle drei Sekunden eins (ihre Kinder hatten mitgezählt, als sie klein waren), wie Sternschnuppen in unendlicher Folge. Heute Nacht schien das Haus erfüllt von Leere, und sie dachte an früher, als ihre Kinder noch in ihren Zimmern schliefen, an diese Sicherheit, die sanfte Leichtigkeit der Nächte damals. Sie dachte an Zachary in Maine, aber sie hatte ihn seit Jahren nicht mehr gesehen und hatte nur ein dünnes blasses Bübchen vor Augen, ein mutterlos wirkendes Kind. Und eigentlich mochte sie nicht an ihn denken, und auch nicht an tiefgefrorene Schweineköpfe oder ihre grimmige Schwägerin; schon jetzt beeinträchtigte der Vorfall den Familienfrieden, und sie spürte die kleinen Nadelstiche der Unruhe, die die Vorboten der Schlaflosigkeit sind.
Sie stemmte die Hand gegen Jims Schulter. »Du schnarchst«, sagte sie.
»’tschuldige.« Das konnte er im Schlaf sagen. Er wälzte sich auf die Seite.
Helen, hellwach, hoffte, dass die Blumen ihre Abwesenheit überleben würden. Ana hatte keine glückliche Hand bei Blumen. Es war ein Gespür, das man entweder besaß oder nicht. Einmal, Jahre vor Ana, war die Familie in Urlaub gefahren, und die Lesben von nebenan hatten die violetten Petunien in Helens Blumenkästen vertrocknen lassen. Helen hatte diese Petunien gehegt und gepflegt, hatte jeden Tag die klebrigen welken Blüten abgeschnitten, sie gewässert, sie gedüngt; wie ein Wasserfall hatten sie sich von den vorderen Fenstern des Hauses ergossen, und Leute auf der Straße hatten ihr dafür Komplimente gemacht. Helen hatte den Frauen erklärt, wie viel Zuwendung blühende Pflanzen im Sommer brauchten, und sie hatten gesagt, ja, das wüssten sie. Und dann, bei ihrer Rückkehr: nur noch verdorrtes Gestrüpp! Helen hatte geweint. Die Frauen waren bald darauf weggezogen, und Helen war froh gewesen. Sie hatte nicht mehr freundlich zu den beiden sein können, nicht von Herzen, nachdem sie ihre Petunien getötet hatten. Zwei Lesben, Linda und Laura. Die dicke Linda und Lindas Laura, so hatten sie bei ihnen geheißen.
Die Burgess wohnten im letzten einer Reihe von Backsteinhäusern. Das Gebäude links von ihnen war ein hoher Kalksteinbau, das einzige Mehrfamilienhaus in diesem Abschnitt der Straße, inzwischen Eigentumswohnungen. Die Linda-Lauras hatten in der Erdgeschosswohnung gewohnt und sie dann an eine Bankerin verkauft, Deborah-mit (kurz für Deborah-mit-dem-Durchblick, im Unterschied zu Debra-ohne im selben Haus, die nicht durchblickte), und an Deborahs Mann William, der so nervös war, dass er sich als »Billiam« vorgestellt hatte. Die Kinder nannten ihn manchmal so, aber dann bat Helen sie, netter zu sein, weil Billiam seinerzeit in Vietnam gedient hatte und auch, weil seine Frau, Deborah-mit, eine furchtbare Nervensäge war und Helen sich vorstellte, dass es schrecklich sein musste, mit ihr zusammenzuleben. Nie konnte man in seinen Garten hinausgehen, ohne dass Deborah-mit in ihrem erschien, und innerhalb von zwei Minuten hatte sie einen darüber belehrt, dass die Stiefmütterchen, die man gerade pflanzte, auf dieser Seite des Gartens keine Chance hatten, dass die Lilien mehr Sonne brauchten, dass der Fliederbusch, den Helen einsetzte, eingehen würde (leider wahr), weil der Boden nicht kalkhaltig genug war.
Debra-ohne dagegen war eine liebenswerte Frau, schlaksig und bemüht, eine Psychiaterin, leicht konfus in ihrer Art. Aber, und das war das Traurige: Ihr Mann betrog sie. Das hatte Helen entdeckt, als sie tagsüber allein zu Hause gewesen war und durch die Wand das haarsträubendste Lustgestöhne gehört hatte. Sie hatte durch das Dielenfenster hinausgespitzt, und da war Debras Mann zur Haustür herausgekommen, gefolgt von einer Frau mit lockigen Haaren. Später hatte sie die beiden zusammen in einer Bar ganz in der Nähe gesehen. Und einmal hatte sie Debra-ohne ihren Mann fragen hören: »Warum hackst du denn heute so auf mir rum?« Debra-ohne fehlte es also tatsächlich an Durchblick. Diese Dinge fand Helen immer ein bisschen problematisch am Stadtleben. Bei Basketballübertragungen brüllte Jim wie ein Irrer. »Du blöde Drecksau!«, brüllte er den Fernseher an, und Helen hatte jedes Mal Angst, die Nachbarn könnten denken, er meinte damit Helen. Sie hatte schon überlegt, ob sie es irgendwann mit einem Lachen ins Gespräch einflechten sollte, sich dann aber gesagt, dass man sich auf solch dünnes Eis besser nicht begab. Obwohl es ja nur die Wahrheit wäre.
Trotzdem.
Ihre Gedanken rasten und rasten. Was hatte sie zu packen vergessen? Es wäre zu dumm, wenn sie sich irgendwann fürs Essen mit den Anglins umzog und plötzlich feststellte, dass sie nicht die richtigen Schuhe dabeihatte – ihr ganzes Outfit wäre verdorben. Sie zog die Decke fester um sich; sie meinte Susans Anruf noch immer im Haus zu spüren, dunkel, gestaltlos, drohend. Sie setzte sich auf.
Mit so etwas musste man rechnen, wenn man nicht schlafen konnte und einem das Bild eines tiefgefrorenen Schweinekopfs durch die Hirnwindungen spukte. Sie ging ins Bad und nahm eine Schlaftablette, und das Bad war sauber und vertraut. Wieder im Bett, rückte sie dicht an ihren Mann heran, und schon nach wenigen Minuten fühlte sie die Schläfrigkeit wie einen sanften Sog, und sie war so froh, dass sie nicht Deborah-mit oder Debra-ohne war, so froh, dass sie Helen Farber Burgess war, so froh, dass sie Kinder hatte und Freude am Leben …
Aber am Morgen dann, welche Hektik!
Bei all dem bunten Treiben, mit dem sich der Samstag in Park Slope anließ – Kinder mit Fußbällen in Netzen auf dem Weg zum Park, von ihren Vätern bei Grün über die Straßen gescheucht, junge Liebespaare, die in den Coffeeshops eintrudelten, die Haare noch nass vom Duschen, Leute, die für den Abend Essenseinladungen planten und auf dem Bauernmarkt auf der Grand Army Plaza am Ende des Parks nach den besten Äpfeln und Backwaren und Schnittblumen suchten, die Arme beladen mit Körben und papierumwickelten Sonnenblumen –, bei allem Trubel war man nicht gefeit vor Kümmernissen, wie sie überall im Land vorkamen, selbst in diesem Viertel, wo nahezu jeder seinen Platz in der Welt für genau den richtigen zu halten schien. Da war die Mutter, deren kleine Tochter sich so dringend eine Barbiepuppe wünschte, und die Mutter sagte, nein, die Barbiepuppen sind schuld, dass so viele Mädchen abgemagert und krank sind. Auf der Eighth Street versuchte ein Stiefvater verbissen, einem linkischen Jungen das Fahrradfahren beizubringen, hielt den Gepäckträger fest, während das Kind, bleich vor Angst, Schlangenlinien fuhr und auf ein Lob wartete. (Die Frau des Mannes bekam ihre letzte Chemotherapie gegen Brustkrebs, ihnen blieb nichts erspart.) In der Third Street stritt ein Paar darüber, ob sie ihren pubertierenden Sohn an diesem sonnigen Herbsttag aus seinem Zimmer scheuchen sollten oder nicht. Verstimmungen allerorten, und auch bei den Burgess lief nicht alles nach Plan.
Das Auto, das Helen und Jim zum Flughafen bringen sollte, war nicht gekommen. Ihre Koffer standen auf dem Gehsteig, und Helen wurde zu ihrer Bewachung abgestellt, während Jim zwischen ihr und dem Haus hin- und herrannte und mit dem Autoverleih telefonierte. Deborah-mit kam aus ihrer Tür und fragte, wo es denn hingehen solle an diesem schönen sonnigen Morgen, es müsse wunderbar sein, so oft in den Urlaub fahren zu können. Helen blieb keine Wahl, als zu sagen: »Seien Sie nicht böse, aber ich muss schnell noch jemand anrufen« und ihr Handy aus der Handtasche zu holen und einen Anruf bei ihrem Sohn vorzutäuschen, der (in Arizona) unter Garantie noch tief und fest schlief. Aber Deborah-mit wartete auf Billiam, und so musste Helen immer weiter in ihr stummes Handy sprechen, weil Deborah in einem fort in ihre Richtung lächelte. Endlich erschien Billiam, und die beiden wanderten davon, händchenhaltend, was Helen übertrieben fand.
Derweil fiel dem in der Diele auf- und abtigernden Jim auf, dass am Schlüsselbrett neben der Haustür noch beide Autoschlüssel hingen. Bob hatte den Schlüssel nicht mitgenommen! Wie wollte er nach Maine kommen ohne den Scheißschlüssel? Diese Frage brüllte Jim Helen entgegen, als er wieder auf die Straße herauskam, und Helen sagte in beherrschtem Ton, wenn er weiter so herumbrülle, werde sie nach Manhattan ziehen. Jim wedelte mit dem Schlüssel vor ihrem Gesicht. »Wie will er hinkommen?«, zischte er.
»Wenn du deinem Bruder einen Schlüssel zu unserem Haus geben würdest, hätten wir dieses Problem nicht.«
Um die Ecke bog in gemessenem Tempo eine schwarze Limousine. Jim schwenkte den Arm wie ein Rückenschwimmer beim Anschlag, und wenig später saß Helen wohlbehalten auf dem Rücksitz, wo sie ihr Haar glattzupfte, und Jim rief vom Handy aus Bob an. »Nun geh schon ran, Bob …« Dann: »Wie klingst du denn? Du bist jetzt erst aufgewacht? Du solltest längst auf dem Weg nach Maine sein. Wie, du warst die ganze Nacht wach?« Jim beugte sich vor und sagte zu dem Fahrer: »Halten Sie kurz Ecke Sixth und Ninth.« Er lehnte sich wieder zurück. »Dreimal darfst du raten, was ich hier in der Hand halte. Rat einfach, Goofy. Meinen Autoschlüssel, bingo! Und hör zu – hörst du zu? Charlie Tibbetts. Der Anwalt für Zach. Montagvormittag bei ihm im Büro. Natürlich kannst du den Montag dranhängen, tu doch nicht so. Die Rechtshilfe tangiert das einen feuchten Furz. Charlie ist das Wochenende über nicht da, aber er fiel mir gestern noch ein, und wir haben schon telefoniert. Er ist der Richtige. Guter Mann. Alles, was du bis dahin zu tun hast, ist, die Sache kleinhalten, kapiert? Und jetzt bequem dich runter, unser Flieger wartet nicht.«
Helen ließ das Fenster nach unten gleiten und hielt das Gesicht in die frische Luft.
Jim lehnte sich zurück, griff nach ihrer Hand. »Wir werden einen fabelhaften Urlaub haben, Schatz. Genau wie diese Kitschpaare in den Prospekten. Es wird großartig.«
Bob wartete in Trainingshose, T-Shirt und schmutzigen Sportsocken vor seinem Haus. »Achtung, Spasti«, rief Jim. Er warf den Autoschlüssel durchs offene Fenster, und Bob fing ihn mit einer Hand.
»Viel Spaß.« Bob winkte einmal.
Helen war beeindruckt, wie mühelos Bob den Schlüssel gefangen hatte. »Und dir viel Erfolg«, rief sie.
Die Limousine bog um die Ecke und entschwand dem Blick, und Bob wandte das Gesicht Richtung Hauswand. Als Junge war er in den Wald gelaufen, um dem Auto, das Jim ins College brachte, nicht nachsehen zu müssen, und am liebsten hätte er es jetzt genauso gemacht. Stattdessen stand er auf dem rissigen Asphalt, neben sich die eisernen Müllcontainer, und Sonnenscherben stachen ihm in die Augen, während er mit seinen Schlüsseln herumstocherte.
Vor Jahren, in Bobs erster Zeit in New York, hatte er eine Therapeutin namens Elaine gehabt, eine grobknochige Frau mit schlaksigen Bewegungen, etwa so alt wie er jetzt, was ihm damals natürlich uralt vorgekommen war. Eingebettet in ihre wohlwollende Aufmerksamkeit, hatte er an einem Loch in der Armlehne ihrer Ledercouch herumgebohrt und immer wieder zu dem Feigenbaum in der Ecke hinübergeschielt (der künstlich aussah, sich aber mit ans Herz gehender Zielgerichtetheit zu dem schmalen Lichtstreif des Fensters hinneigte und in sechs Jahren immerhin ein neues Blatt hervorgebracht hatte). Wenn Elaine jetzt neben ihm gestanden hätte, dann hätte sie ihn ermahnt: »In der Gegenwart bleiben, Bob.« Denn vage war sich Bob ja bewusst, was in ihm ablief, als Jims Auto um die Ecke verschwand, ihn zurückließ, vage wusste er es, aber – oh, arme Elaine, inzwischen an irgendeiner furchtbaren Krankheit gestorben, sie hatte sich solche Mühe mit ihm gegeben, war so lieb gewesen – es half nichts. Das Sonnenlicht gab ihm den Rest.
Bob, der vier war, als sein Vater starb, erinnerte sich an nichts als an die Sonne auf der Kühlerhaube und an die Decke, die sie über seinen Vater gebreitet hatten, und – immer – Susans anklagende Kleinmädchenstimme: »Alles nur wegen dir, du Dummer.«
Und jetzt stand er in Brooklyn, New York, auf dem Gehsteig, sah wieder den Autoschlüssel durch die Luft geflogen kommen, sah die Limousine mit seinem Bruder darin um die Ecke verschwinden, dachte an die Aufgabe, die vor ihm lag, und alles in ihm schrie: Lass mich nicht allein, Jimmy.
Adriana trat aus der Tür.
2
Susan Olson bewohnte ein schmales zweistöckiges Haus nicht weit vom Zentrum. Seit ihrer Scheidung vor sieben Jahren vermietete sie die oberste Etage an eine alte Frau namens Drinkwater, die dieser Tage eher selten aus dem Haus ging, sich nie über die Musik aus Zachs Zimmer beschwerte und immer pünktlich die Miete bezahlte. An dem Abend, bevor Zach sich der Polizei stellen sollte, stieg Susan die Treppe hinauf, klopfte bei der alten Dame und erzählte ihr, was passiert war. Mrs. Drinkwater, die auf dem Stuhl vor ihrem kleinen Schreibtisch saß, nahm es erstaunlich gelassen. »So was, so was«, sagte sie. Sie trug einen Bademantel aus rosa Kunstseide und hatte sich die Nylonstrümpfe bis zum Knie heruntergerollt; ihre grauen Haare waren nach hinten gesteckt, aber zum Großteil aus den Nadeln gerutscht. So sah sie aus, wenn sie daheimblieb, was jetzt meistens der Fall war. Ihre Arme und Beine waren dürr wie Stöcke.
»Ich wollte es Ihnen doch lieber sagen« – Susan setzte sich aufs Bett –, »weil die Reporter Sie ab morgen vielleicht fragen werden, was für ein Mensch er ist.«
Die alte Dame schüttelte bedächtig den Kopf. »Ein Stiller ist er.« Sie sah Susan an. Ihre Brille hatte riesige Trifokalgläser, hinter denen ihr Blick nicht recht zu orten war; er waberte herum. »Immer höflich zu mir«, fügte sie hinzu.
»Ich kann Ihnen nicht vorschreiben, was Sie antworten.«
»Nett, dass Ihr Bruder kommt. Ist das der berühmte?«
»Nein. Der berühmte macht Urlaub mit seiner Frau.«
Ein langes Schweigen folgte. Mrs. Drinkwater sagte: »Zacharys Vater – weiß er Bescheid?«
»Ich hab ihm eine E-Mail geschickt.«
»Lebt er immer noch in … Schweden?«
Susan nickte.
Mrs. Drinkwater sah auf ihren kleinen Schreibtisch, dann an die Wand darüber. »Wie sich’s da wohl lebt, in Schweden?«
»Ich hoffe nur, Sie können jetzt schlafen«, sagte Susan. »Es tut mir leid.«
»Ich hoffe, Sie können schlafen, Kindchen. Haben Sie was, was Sie einnehmen können?«
»Ich nehme keine Schlafmittel.«
»Ja, dann …«
Susan stand auf, fuhr sich über ihr kurzes Haar, sah um sich, als wäre noch etwas zu tun, und sie wüsste nicht, was.
»Gute Nacht, meine Liebe«, sagte Mrs. Drinkwater.
Susan ging einen Stock tiefer und klopfte leise an Zachs Tür. Er lag auf dem Bett, riesige Kopfhörer über den Ohren. Sie tippte an ihr eigenes Ohr, damit er sie abnahm. Sein Laptop lag neben ihm auf der Bettdecke. »Hast du Angst?«, fragte sie.
Er nickte.
Es war fast völlig dunkel im Zimmer. Nur über einem Bücherbrett, auf dem sich Zeitschriften stapelten, brannte ein Lämpchen. Darunter lagen ein paar verstreute Bücher. Die Jalousien waren heruntergelassen, und an den Wänden, die seit mehreren Jahren schwarz gestrichen waren– Susan war eines Tages von der Arbeit heimgekommen und hatte sie so vorgefunden –, hing kein einziges Poster oder Foto.
»Hat sich dein Vater gerührt?«
»Nein.« Seine Stimme war belegt und tief.