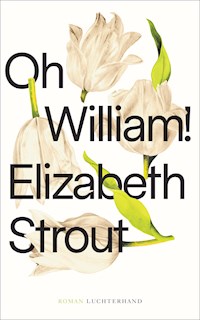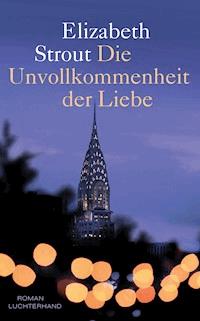
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Lucy-Barton-Romane
- Sprache: Deutsch
Leben, denke ich manchmal, heißt Staunen.
Als die Schriftstellerin Lucy Barton längere Zeit im Krankenhaus verbringen muss, erhält sie Besuch von ihrer Mutter, die sie jahrelang nicht mehr gesehen hat. Zunächst ist sie überglücklich. Doch mit den Gesprächen werden Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend wach, die sie längst hinter sich gelassen zu haben glaubte …
Der neue Roman von Elizabeth Strout ist ein psychologisches Meisterstück, zutiefst menschlich und berührend. Er erzählt die Geschichte einer Frau, die trotz aller Widrigkeiten ihren Weg geht, eine Geschichte über Mütter und Töchter und eine Geschichte über die Liebe, die, so groß sie auch sein mag, immer nur unvollkommen sein kann.
Lucy Barton erzählt ihre Geschichte. Sie muss sie erzählen, weil sie auf der Suche nach der Wahrheit ist, als Schriftstellerin wie als Mensch. Und es gibt zu vieles, was ihr Leben geprägt hat und ihr immer noch keine Ruhe lässt. Das wird ihr klar, als sie wegen einer unerklärlichen, lebensbedrohenden Infektion nach einem Routineeingriff längere Zeit im Krankenhaus bleiben muss und plötzlich ihre Mutter an ihrem Bett sitzt. Ihre Mutter, die sie nicht mehr gesehen hat, seit sie ihr Zuhause in einem kleinen Kaff in Illinois verlassen hat. Während sie erschöpft und glücklich der Stimme ihrer Mutter lauscht, die ihr Geschichten von den Leuten aus ihrer Heimat erzählt und was aus ihnen geworden ist, während Mutter und Tochter ein neues Band zu formen scheinen, auch wenn sie nur schweigend aus dem Fenster auf das beleuchtete Chrysler Building gegenüber schauen, kommt alles wieder hoch: die bettelarme Kindheit, die Schwierigkeiten in der Familie, der Mangel an Zärtlichkeit und Zuneigung. Wie der Wunsch, Schriftstellerin zu werden, ihr half, ihre Ängste zu bekämpfen, wie fremd sie sich dennoch manchmal in New York vorkommt. Ihre Ehe mit einem Mann aus einem wohlbehüteten Elternhaus und die vielen Abgründe, die sich zwischen ihnen auftun, trotz des gemeinsamen Lebens und der zwei heißgeliebten Töchter …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Zum Buch
Lucy Barton erzählt ihre Geschichte. Sie muss sie erzählen, weil sie auf der Suche nach der Wahrheit ist, als Schriftstellerin wie als Mensch. Und es gibt zu vieles, was ihr Leben geprägt hat und ihr immer noch keine Ruhe lässt. Das wird ihr klar, als sie wegen einer unerklärlichen, lebensbedrohenden Infektion nach einem Routineeingriff längere Zeit im Krankenhaus bleiben muss und plötzlich ihre Mutter an ihrem Bett sitzt. Ihre Mutter, die sie nicht mehr gesehen hat, seit sie ihr Zuhause in einem kleinen Kaff in Illinois verlassen hat. Während sie erschöpft und glücklich der Stimme ihrer Mutter lauscht, die ihr Geschichten von den Leuten aus ihrer Heimat erzählt und was aus ihnen geworden ist, während Mutter und Tochter ein neues Band zu formen scheinen, auch wenn sie nur schweigend aus dem Fenster auf das beleuchtete Chrysler Building gegenüber schauen, kommt alles wieder hoch: die bettelarme Kindheit, die Schwierigkeiten in der Familie, der Mangel an Zärtlichkeit und Zuneigung. Wie der Wunsch, Schriftstellerin zu werden, ihr half, ihre Ängste zu bekämpfen, wie fremd sie sich dennoch manchmal in New York vorkommt. Ihre Ehe mit einem Mann aus einem wohlbehüteten Elternhaus und die vielen Abgründe, die sich zwischen ihnen auftun, trotz des gemeinsamen Lebens und der zwei heißgeliebten Töchter … Jahre nach ihrem Krankenhausaufenthalt trägt Lucy Barton all diese Aspekte ihres Lebens zusammen und erzählt ihre Geschichte, eine aufrüttelnde, wahrhaftige, unvergessliche Geschichte.
Zur Autorin
ELIZABETH STROUT wurde 1956 in Portland, Maine, geboren und wuchs in Kleinstädten in Maine und New Hampshire auf. Nach dem Jurastudium begann sie zu schreiben. Inzwischen hat sie mehrere Romane veröffentlicht, alles Bestseller, und für ihren dritten Roman »Mit Blick aufs Meer« bekam sie 2009 den Pulitzerpreis. Elizabeth Strout lebt in Maine und in New York City.
Zur Übersetzerin
SABINE ROTH, geb. 1963 in München, Literaturstudium in München, Toronto, Canterbury und Oxford, hat Werke von u. a. Jane Austen, John le Carré, Hilary Mantel und V. S. Naipaul übersetzt.
Elizabeth Strout
Die Unvollkommenheit der Liebe
Roman
Aus dem Amerikanischen
Für meine Freundin
Vor Jahren, und zwar vor sehr vielen Jahren inzwischen, lag ich einmal fast neun Wochen im Krankenhaus. Das war in New York, und nachts konnte ich von meinem Bett aus das Chrysler Building mit seinen geometrischen Lichtbögen sehen. Tagsüber verlor sich die Schönheit des Gebäudes, bis es nur ein Hochhaus unter vielen vor einem blauen Himmel war, die alle unnahbar wirkten, stumm, weit weg. Es war Mai, später dann Juni, und ich weiß noch, wie ich am Fenster stand und hinunterblickte auf den Gehsteig, zu den jungen Frauen – in meinem Alter –, die dort unten in ihren Frühlingskleidern Mittag machten; ich konnte ihre nickenden Köpfe sehen und ihre Blusen, die sich im leichten Wind bauschten. Ich sagte mir, wenn ich erst aus dem Krankenhaus entlassen wäre, dann würde ich nie wieder einen Gehsteig entlanggehen, ohne dem Schicksal zu danken, dass ich zu den Menschen hier unten gehörte, und viele Jahre lang war das auch so – ich dachte an den Blick aus dem Krankenzimmer und war froh um den Gehsteig, auf dem ich stand.
Begonnen hatte es als reine Routinesache: Ich wurde am Blinddarm operiert. Nach zwei Tagen durfte ich wieder essen, aber ich konnte nichts bei mir behalten. Dann kam Fieber dazu. Es ließ sich kein Erreger oder sonst eine Ursache bestimmen; niemand fand je eine Erklärung dafür. Über einen Infusionsschlauch wurde mir Flüssigkeit zugeführt, über einen zweiten ein Antibiotikum. Die Schläuche waren an einer Metallstange auf eiernden Rädchen befestigt, die ich mit mir herumschob, aber ich wurde schnell müde. Was immer das Problem war, Anfang Juli verschwand es plötzlich. Aber bis dahin war ich in einer sehr merkwürdigen Verfassung – ein buchstäblich fiebriges Warten – und stand echte Qualen aus. Ich hatte einen Mann und zwei kleine Töchter zu Hause; ich vermisste meine Kinder schrecklich und sorgte mich so um sie, dass ich das Gefühl hatte, dadurch noch kränker zu werden. Mein Arzt, den ich sehr mochte – ein Jude mit dicklichen Hängebacken, den eine so sanfte Traurigkeit einhüllte; seine Großeltern und drei Tanten, das hörte ich ihn einer Schwester erzählen, waren im Konzentrationslager umgekommen, und er hatte eine Frau und vier erwachsene Kinder hier in New York –, dieser herzensgute Mensch hatte offenbar Mitleid mit mir und setzte durch, dass mich meine Mädchen – die fünf und sechs waren – besuchen durften, solange sie selber nicht krank waren. Eine Freundin der Familie brachte sie zu mir, und ich sah, wie schmutzig ihre kleinen Gesichter und auch die Haare waren, und ich ging samt meinem Tropf mit ihnen in die Dusche, aber sie riefen: »Mommy, du bist so dünn!« Es machte ihnen richtig Angst. Sie saßen bei mir auf dem Bett, während ich ihnen die Haare trockenrubbelte, und danach malten sie, aber sie waren die ganze Zeit angespannt, brachen nicht wie sonst alle halbe Minute ab, um zu rufen: »Mommy, Mommy, wie findest du das? Mommy, schau das Kleid, das ich meiner Prinzessin gemalt habe!« Sie sagten fast nichts, vor allem die Jüngere brachte kaum ein Wort heraus, und als ich sie in den Arm nahm, sah ich, wie sie die Unterlippe vorschob und wie ihr Kinn bebte; sie war so klein, und sie gab sich solche Mühe, tapfer zu sein. Als sie gingen, schaute ich nicht aus dem Fenster; ich mochte sie nicht fortgehen sehen mit der Freundin, die sie hergebracht hatte und die selbst kinderlos war.
Mein Mann hatte natürlich viel zu tun, er musste neben der Arbeit den Haushalt am Laufen halten, darum fand er nicht oft die Zeit, mich zu besuchen. Er hatte mir gleich zu Beginn unserer Beziehung gesagt, dass er Krankenhäuser hasste – mit vierzehn hatte er seinen Vater im Krankenhaus sterben sehen –, und jetzt merkte ich, dass das keine Übertreibung gewesen war. In dem ersten Zimmer, das ich zugewiesen bekam, lag im Nachbarbett eine alte Frau im Sterben; sie rief in einem fort um Hilfe – es erschreckte mich, wie wenig die Schwestern auf das klägliche Jammern dieser Frau eingingen. Mein Mann hielt es nicht aus, ich meine, er hielt es nicht aus, mich dort zu besuchen, und er ließ mich in ein Einzelzimmer verlegen. Ein solcher Luxus war durch unsere Versicherung nicht abgedeckt, und jeder Tag fraß ein tieferes Loch in unsere Ersparnisse. Ich war dankbar, die arme Frau nicht mehr jammern zu hören, aber hätte irgendjemand geahnt, wie verlassen ich mich fühlte, hätte ich mich geschämt. Sooft eine der Schwestern zum Fiebermessen kam, versuchte ich sie zum Bleiben zu bewegen, ein paar Minuten wenigstens, aber die Schwestern hatten zu tun, sie konnten nicht einfach herumstehen und schwatzen.
Ich hatte vielleicht drei Wochen im Krankenhaus gelegen, als ich eines späten Nachmittags den Blick vom Fenster wandte, und auf einem Stuhl am Fußende des Bettes saß meine Mutter. »Mom?«, sagte ich.
»Grüß dich, Lucy«, sagte sie. Ihre Stimme klang scheu und doch drängend. Sie beugte sich vor und drückte mir durch die Decke hindurch den Fuß. »Grüß dich, Wizzle.« Ich hatte meine Mutter viele Jahre nicht gesehen, und ich musste sie immerzu anschauen; sie sah so verändert aus, aber ich hätte nicht sagen können, warum.
»Mom, wie bist du hierhergekommen?«, fragte ich.
»Ach, mit dem Flugzeug.« Sie wackelte mit den Fingern, und ich wusste, dass die Situation für uns beide zu emotional war. Also winkte ich zurück und legte mich wieder flach hin. »Eigentlich sollte es nichts Ernstes sein bei dir«, sagte sie in dem gleichen scheu klingenden, aber drängenden Ton. »Ich hatte keine Träume.«
Sie zu sehen, meinen Kindernamen zu hören, mit dem mich eine Ewigkeit niemand mehr angeredet hatte, erfüllte mich mit einem warmen, flüssigen Gefühl, als wäre die Anspannung in mir eine feste Masse gewesen, die sich nun auflöste. Für gewöhnlich wurde ich gegen Mitternacht wach und dämmerte dann unruhig vor mich hin oder starrte mit weit offenen Augen durch die Fensterscheibe hinaus auf die Lichter der Stadt. Aber in dieser Nacht schlief ich durch, und als ich am Morgen aufwachte, saß meine Mutter am selben Platz wie zuvor. »Egal«, sagte sie, als ich sie fragte. »Ich schlafe ja nie viel.«
Die Schwestern boten an, ein Zustellbett für sie zu holen, aber sie schüttelte den Kopf. Jedes Mal, wenn eine Schwester ihr ein Bett anbot, schüttelte sie nur den Kopf. Nach einer Weile fragten die Schwestern nicht mehr. Meine Mutter blieb fünf Nächte bei mir, und die ganze Zeit schlief sie, wenn überhaupt, auf dem Stuhl.
An dem ersten ganzen Tag, den wir miteinander verbrachten, redeten meine Mutter und ich nur sporadisch; ich glaube, wir fühlten uns beide gleich unsicher. Sie stellte ein paar Fragen nach meinen Töchtern, und ich spürte, wie heiß mein Gesicht wurde, als ich antwortete. »Sie sind großartig«, sagte ich. »Es sind einfach so großartige Kinder.« Nach meinem Mann fragte meine Mutter nicht, dabei war er es gewesen – das sagte er mir am Telefon –, der sie angerufen und gebeten hatte, zu mir zu kommen, der ihr den Flug bezahlt hatte und sie auch vom Flughafen abgeholt hätte – meine Mutter, die noch nie in ihrem Leben geflogen war. Und obwohl sie stattdessen im Taxi kam, obwohl sie die direkte Begegnung mit ihm verweigerte, hatte er sie zu mir gelotst. Und hier war sie nun, auf dem Stuhl am Fußende meines Bettes, und erwähnte auch meinen Vater mit keiner Silbe, also fragte ich lieber nicht nach ihm. Ich hoffte so sehr, sie würde sagen: »Dein Vater wünscht dir gute Besserung«, aber sie sagte nichts dergleichen.
»War das nicht unheimlich, im Taxi herzukommen, Mom?«
Sie zögerte, und ich meinte etwas von der Panik zu ahnen, die sie nach der Landung befallen haben musste. Aber sie sagte: »Der liebe Gott hat mir eine Zunge gegeben, und ich habe sie benutzt.«
Nach einer Weile sagte ich: »Ich bin froh, dass du da bist.«
Sie lächelte kurz und schaute zum Fenster.
Das war Mitte der Achtzigerjahre, vor der Zeit der Handys, und wenn das beige Telefon auf meinem Nachttisch klingelte und mein Mann anrief – wie meine Mutter vermutlich schon an dem weinerlichen Tonfall erkannte, in dem ich ihn begrüßte –, stand sie leise von ihrem Stuhl auf und ging aus dem Zimmer. Das müssen die Gelegenheiten gewesen sein, bei denen sie sich in der Cafeteria etwas zu essen holte oder von dem Münzfernsprecher auf dem Korridor meinen Vater anrief, denn ich sah sie nie essen, und bestimmt wollte mein Vater ab und zu von ihr hören (soviel ich wusste, war zwischen ihnen alles so weit in Ordnung), und wenn ich dann auch noch beide Kinder gesprochen und den Hörer dutzendmal geküsst hatte und mich zurück auf mein Kissen legte und die Augen schloss, schlüpfte meine Mutter wieder ins Zimmer; sobald ich die Augen aufschlug, saß sie da.
An diesem ersten Tag sprachen wir über meinen Bruder, den Ältesten von uns dreien, der unverheiratet war und mit seinen sechsunddreißig noch zu Hause wohnte, und über meine ältere Schwester, die vierunddreißig war und mit ihrem Mann und fünf Kindern zehn Meilen von meinen Eltern entfernt lebte. Ich wollte wissen, ob mein Bruder eine Arbeit hatte. »Er hat keine Arbeit«, sagte meine Mutter. »Er schläft bei den Tieren, die geschlachtet werden sollen.« Ich fragte sie, was sie gerade gesagt hatte, und sie wiederholte es. Sie fügte hinzu: »Er geht zu Pedersons in den Stall und übernachtet bei den Schweinen, bevor sie zum Schlachten abgeholt werden.« Ich wunderte mich darüber und sagte das meiner Mutter, und sie zuckte die Achseln.
Dann redeten meine Mutter und ich über die Krankenschwestern. Meine Mutter hatte für sie alle Namen parat: »Reiswaffel« für die Magere, die so zackig auftrat, »Zahnweh« für die vergrämte Ältere, »Stilles Kind« für die Inderin, die wir beide nett fanden.
Aber ich war erschöpft, darum fing meine Mutter an, mir Geschichten über Leute zu erzählen, die sie vor langer Zeit gekannt hatte. Sie sprach in einem Ton, an den ich mich von früher her nicht erinnerte, als hätten sich in ihr über Jahre hinweg Gefühle und Worte und Beobachtungen angestaut, und ihre Stimme hatte etwas Atemloses, Unbedecktes. Zwischendurch döste ich ein, und jedes Mal, wenn ich wieder aufwachte, wollte ich, dass sie weitererzählte. Aber sie sagte: »Wizzle-dee, du musst dich ausruhen.«
»Aber ich ruh mich doch aus. Bitte, Mom! Erzähl mir was. Irgendetwas. Erzähl mir von Kathie Nicely. Den Namen fand ich immer so hübsch.«
»Ach ja, Kathie Nicely. Gott, mit der hat’s kein gutes Ende genommen.«
Wir waren Außenseiter, unsere Familie, selbst in dem winzigen Ort Amgash im ländlichen Illinois, wo auch andere Häuser heruntergekommen waren und gestrichen gehörten und keine Fensterläden hatten, keine Gärten, nichts fürs Auge. Diese anderen Häuser standen beisammen und bildeten die Stadt, aber unser Haus lag abseits. Es heißt von Kindern ja, sie würden die Umstände, in denen sie leben, als die Norm ansehen, aber weder Vicky noch ich fühlten uns je normal. Auf dem Pausenhof riefen die Kinder: »Die Bartons stinken!« und rannten mit zugehaltener Nase weg; als meine Schwester in der zweiten Klasse war, erklärte ihr die Lehrerin vor sämtlichen Mitschülern, dass Armut keine Entschuldigung für Schmutz hinter den Ohren sei: Zu arm zum Seifekaufen sei niemand. Mein Vater reparierte landwirtschaftliche Maschinen, wobei sein Boss ihn regelmäßig wegen Aufsässigkeit rausschmiss und dann wieder einstellte – weil er gut arbeitete, nehme ich an, und man ihn auf Dauer eben doch brauchte. Meine Mutter erledigte Näharbeiten; SCHNEIDER- UND ÄNDERUNGSARBEITEN stand auf dem handgemalten Schild am unteren Ende unserer langen Einfahrt. Und obwohl mein Vater uns, wenn er vor dem Schlafengehen mit uns betete, Gott stets für das Essen auf unserem Tisch danken ließ, muss doch gesagt sein, dass ich oft völlig ausgehungert war und dass es abends häufig nur Brot mit Sirup bei uns gab. Lügen und Essen verschwenden, dafür wurden wir immer bestraft. Gelegentlich kam es auch vor, dass uns meine Eltern – und zwar meist meine Mutter und meist im Beisein unseres Vaters – verprügelten, heftig und ohne Vorwarnung, was manche Leute, wie ich inzwischen glaube, an unserer fleckigen Haut und unserer verstockten Art gemerkt haben müssen.
Dazu kam die Isolation.
Wir wohnten in der Sauk Valley Area, wo man weite Strecken zurücklegen kann, ohne mehr als ein oder zwei Häuser inmitten von Äckern zu sehen, und wie ich schon sagte, unser Haus lag sowieso abseits. Wir lebten umgeben von Maisfeldern und Sojabohnenfeldern, die bis zum Horizont reichten; gleich dahinter aber kam Pedersons Schweinefarm. Zwischen all den Feldern stand ein einzelner Baum, der etwas Verblüffendes hatte in seiner Absolutheit. Viele Jahre lang empfand ich diesen Baum als meinen Freund; er war mein Freund. Unser Haus lag an einer sehr langen Schotterstraße nicht weit vom Rock River, gleich neben einer Baumreihe, die als Windschutz für die Maisfelder diente. Das heißt, Nachbarn gab es keine. Und wir hatten kein Fernsehen und weder Zeitungen noch Zeitschriften, noch Bücher im Haus. In ihrem ersten Ehejahr hatte meine Mutter in der örtlichen Bibliothek gearbeitet und – das erzählte mir mein Bruder später – Bücher geliebt. Aber dann teilte man ihr in der Bibliothek mit, dass die Vorschriften sich geändert hätten und sie nur noch jemanden mit entsprechender Ausbildung einstellen könnten. Meine Mutter glaubte diese Begründung nicht. Sie hörte auf zu lesen, und viele Jahre vergingen, bevor sie zu einer anderen Bibliothek in einer anderen Stadt fuhr und wieder Bücher mit nach Hause brachte. Ich erwähne das, weil mich die Frage beschäftigt, wie Kinder ihr Bild von der Welt bekommen, von den Regeln, die in der Welt gelten.
Wie lernt man zum Beispiel, dass es unhöflich ist, ein Ehepaar zu fragen, warum es keine Kinder hat? Wie deckt man einen Tisch richtig? Woher weiß man, dass man mit offenem Mund kaut, wenn man es von niemandem gesagt bekommt? Woher weiß man überhaupt, wie man aussieht, wenn der einzige Spiegel im Haus winzig klein ist und in der Küche hoch über der Spüle hängt und kein Mensch einem je ein Kompliment gemacht hat und die eigene Mutter den Busen, der einem wächst, mit der Bemerkung kommentiert, dass man langsam aussieht wie eine von Pedersons Kühen?
ENDE DER LESEPROBE
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel My Name Is Lucy Barton bei Random House, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 2016 Elizabeth Strout
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016 Luchterhand Literaturverlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Die Veröffentlichung der Übersetzung wurde vereinbart mit Random House, einem Imprint von Penguin Random House LLC, New York
Umschlaggestaltung: buxdesign /München,
unter Verwendung eines Motivs von © ullstein bild – Prisma /Heeb Christian
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-19801-5 V001
www.luchterhand-literaturverlag.de