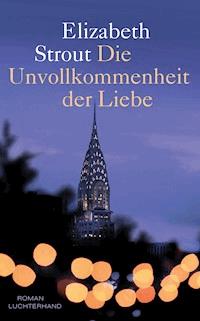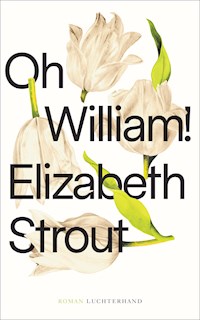16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die ersten beiden Lucy-Barton-Romane der Pulitzer-Preisträgerin Elizabeth Strout.
»Die Unvollkommenheit der Liebe«: Lucy Barton ist Schriftstellerin und Mutter zweier Töchter. Seit vielen Jahren lebt sie schon in New York, weit weg von der Kleinstadt Amgash im Mittleren Westen, wo sie aufgewachsen ist. Als Lucy längere Zeit im Krankenhaus verbringen muss, erhält sie überraschend Besuch von ihrer Mutter, die sie jahrelang nicht mehr gesehen hat. Zunächst ist sie überglücklich. Doch während sie der Stimme ihrer Mutter lauscht, die ihr Geschichten von den Leuten aus der Heimat erzählt, während Mutter und Tochter ein neues Band zu formen scheinen, kommen Erinnerungen an ihre Kindheit wieder hoch, die sie längst hinter sich gelassen zu haben glaubte …
»Unglaublich anrührend.« Volker Weidermann / ZDF - Das Literarische Quartett
»Alles ist möglich«: »Es gibt ganz einfach Dinge im Leben, die wir keinem Menschen erzählen.« Nach siebzehn Jahren kehrt Lucy Barton zum ersten Mal in ihre Heimatstadt Amgash in Illinois zurück, um ihre Geschwister zu besuchen. Elizabeth Strout erzählt in ihrem international gefeierten Roman unvergessliche Geschichten über die Menschen einer amerikanischen Kleinstadt, die sich nach Liebe und Glück sehnen, aber oft Kummer und Schmerz erleben. Geschichten über die Natur des Menschen in all seiner Verletzlichkeit und Stärke – und über die Sehnsucht, verstanden zu werden.
»Mit ›Alles ist möglich‹ hat sich die Bestsellerautorin endgültig in die Reihe der großen amerikanischen Literaten eingeschrieben.« SPIEGEL ONLINE
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Elizabeth Strout
Die Unvollkommenheit der LiebeAlles ist möglich
Die ersten beiden Lucy-Barton-Romane in einem Band
»Die Unvollkommenheit der Liebe«
Lucy Barton ist Schriftstellerin und Mutter zweier Töchter. Seit vielen Jahren lebt sie schon in New York, weit weg von der Kleinstadt Amgash im Mittleren Westen, wo sie aufgewachsen ist. Als Lucy längere Zeit im Krankenhaus verbringen muss, erhält sie überraschend Besuch von ihrer Mutter, die sie jahrelang nicht mehr gesehen hat. Zunächst ist sie überglücklich. Doch während sie der Stimme ihrer Mutter lauscht, die ihr Geschichten von den Leuten aus der Heimat erzählt, während Mutter und Tochter ein neues Band zu formen scheinen, kommen Erinnerungen an ihre Kindheit wieder hoch, die sie längst hinter sich gelassen zu haben glaubte … »Unglaublich anrührend.« Volker Weidermann / ZDF - Das Literarische Quartett
»Alles ist möglich«
»Es gibt ganz einfach Dinge im Leben, die wir keinem Menschen erzählen.« Nach siebzehn Jahren kehrt Lucy Barton zum ersten Mal in ihre Heimatstadt Amgash in Illinois zurück, um ihre Geschwister zu besuchen. Elizabeth Strout erzählt in ihrem international gefeierten Roman unvergessliche Geschichten über die Menschen einer amerikanischen Kleinstadt, die sich nach Liebe und Glück sehnen, aber oft Kummer und Schmerz erleben. Geschichten über die Natur des Menschen in all seiner Verletzlichkeit und Stärke – und über die Sehnsucht, verstanden zu werden. »Mit ›Alles ist möglich‹ hat sich die Bestsellerautorin endgültig in die Reihe der großen amerikanischen Literaten eingeschrieben.« SPIEGEL ONLINE
Die Autorin:
Elizabeth Strout wurde 1956 in Portland, Maine, geboren. Sie zählt zu den großen amerikanischen Erzählstimmen der Gegenwart. Ihre Bücher sind internationale Bestseller. Für ihren Roman »Mit Blick aufs Meer« erhielt sie den Pulitzerpreis. »Oh, William!« und »Die Unvollkommenheit der Liebe« waren für den Man Booker Prize nominiert. »Alles ist möglich« wurde mit dem Story Prize ausgezeichnet. 2022 wurde sie mit dem Siegfried Lenz Preis ausgezeichnet. Elizabeth Strout lebt in Maine und in New York City.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
»Die Unvollkommenheit der Liebe«
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel My Name Is Lucy Barton bei Random House, New York.
Copyright © der Originalausgabe 2016 Elizabeth Strout
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016
Luchterhand Literaturverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Die Veröffentlichung der Übersetzung wurde vereinbart mit Random House, einem Imprint von Penguin Random House LLC, New York
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotive: ©Shutterstock/oneinchpunch; Eddie J. Rodriquez
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
»Alles ist möglich«
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel Anything Is Possible bei Random House, New York.
Copyright © der Originalausgabe 2017 Elizabeth Strout
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018
Luchterhand Literaturverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Die Veröffentlichung der Übersetzung wurde vereinbart mit Random House, einem Imprint von Penguin Random House LLC, New York
Umschlaggestaltung: buxdesign | München, unter Verwendung von Motiven von © 2008 Holly Day/Photocase
Elizabeth Strout
Die Unvollkommenheit der Liebe
Roman
Aus dem Amerikanischen von Sabine Roth
Für meine Freundin Kathy Chamberlain
1
Vor Jahren, und zwar vor sehr vielen Jahren inzwischen, lag ich einmal fast neun Wochen im Krankenhaus. Das war in New York, und nachts konnte ich von meinem Bett aus das Chrysler Building mit seinen geometrischen Lichtbögen sehen. Tagsüber verlor sich die Schönheit des Gebäudes, bis es nur ein Hochhaus unter vielen vor einem blauen Himmel war, die alle unnahbar wirkten, stumm, weit weg. Es war Mai, später dann Juni, und ich weiß noch, wie ich am Fenster stand und hinunterblickte auf den Gehsteig, zu den jungen Frauen – in meinem Alter –, die dort unten in ihren Frühlingskleidern Mittag machten; ich konnte ihre nickenden Köpfe sehen und ihre Blusen, die sich im leichten Wind bauschten. Ich sagte mir, wenn ich erst aus dem Krankenhaus entlassen wäre, dann würde ich nie wieder einen Gehsteig entlanggehen, ohne dem Schicksal zu danken, dass ich zu den Menschen hier unten gehörte, und viele Jahre lang war das auch so – ich dachte an den Blick aus dem Krankenzimmer und war froh um den Gehsteig, auf dem ich stand.
Begonnen hatte es als reine Routinesache: Ich wurde am Blinddarm operiert. Nach zwei Tagen durfte ich wieder essen, aber ich konnte nichts bei mir behalten. Dann kam Fieber dazu. Es ließ sich kein Erreger oder sonst eine Ursache bestimmen; niemand fand je eine Erklärung dafür. Über einen Infusionsschlauch wurde mir Flüssigkeit zugeführt, über einen zweiten ein Antibiotikum. Die Schläuche waren an einer Metallstange auf eiernden Rädchen befestigt, die ich mit mir herumschob, aber ich wurde schnell müde. Was immer das Problem war, Anfang Juli verschwand es plötzlich. Aber bis dahin war ich in einer sehr merkwürdigen Verfassung – ein buchstäblich fiebriges Warten – und stand echte Qualen aus. Ich hatte einen Mann und zwei kleine Töchter zu Hause; ich vermisste meine Kinder schrecklich und sorgte mich so um sie, dass ich das Gefühl hatte, dadurch noch kränker zu werden. Mein Arzt, den ich sehr mochte – ein Jude mit dicklichen Hängebacken, den eine so sanfte Traurigkeit einhüllte; seine Großeltern und drei Tanten, das hörte ich ihn einer Schwester erzählen, waren im Konzentrationslager umgekommen, und er hatte eine Frau und vier erwachsene Kinder hier in New York –, dieser herzensgute Mensch hatte offenbar Mitleid mit mir und setzte durch, dass mich meine Mädchen – die fünf und sechs waren – besuchen durften, solange sie selber nicht krank waren. Eine Freundin der Familie brachte sie zu mir, und ich sah, wie schmutzig ihre kleinen Gesichter und auch die Haare waren, und ich ging samt meinem Tropf mit ihnen in die Dusche, aber sie riefen: »Mommy, du bist so dünn!« Es machte ihnen richtig Angst. Sie saßen bei mir auf dem Bett, während ich ihnen die Haare trockenrubbelte, und danach malten sie, aber sie waren die ganze Zeit angespannt, brachen nicht wie sonst alle halbe Minute ab, um zu rufen: »Mommy, Mommy, wie findest du das? Mommy, schau das Kleid, das ich meiner Prinzessin gemalt habe!« Sie sagten fast nichts, vor allem die Jüngere brachte kaum ein Wort heraus, und als ich sie in den Arm nahm, sah ich, wie sie die Unterlippe vorschob und wie ihr Kinn bebte; sie war so klein, und sie gab sich solche Mühe, tapfer zu sein. Als sie gingen, schaute ich nicht aus dem Fenster; ich mochte sie nicht fortgehen sehen mit der Freundin, die sie hergebracht hatte und die selbst kinderlos war.
Mein Mann hatte natürlich viel zu tun, er musste neben der Arbeit den Haushalt am Laufen halten, darum fand er nicht oft die Zeit, mich zu besuchen. Er hatte mir gleich zu Beginn unserer Beziehung gesagt, dass er Krankenhäuser hasste – mit vierzehn hatte er seinen Vater im Krankenhaus sterben sehen –, und jetzt merkte ich, dass das keine Übertreibung gewesen war. In dem ersten Zimmer, das ich zugewiesen bekam, lag im Nachbarbett eine alte Frau im Sterben; sie rief in einem fort um Hilfe – es erschreckte mich, wie wenig die Schwestern auf das klägliche Jammern dieser Frau eingingen. Mein Mann hielt es nicht aus, ich meine, er hielt es nicht aus, mich dort zu besuchen, und er ließ mich in ein Einzelzimmer verlegen. Ein solcher Luxus war durch unsere Versicherung nicht abgedeckt, und jeder Tag fraß ein tieferes Loch in unsere Ersparnisse. Ich war dankbar, die arme Frau nicht mehr jammern zu hören, aber hätte irgendjemand geahnt, wie verlassen ich mich fühlte, hätte ich mich geschämt. Sooft eine der Schwestern zum Fiebermessen kam, versuchte ich sie zum Bleiben zu bewegen, ein paar Minuten wenigstens, aber die Schwestern hatten zu tun, sie konnten nicht einfach herumstehen und schwatzen.
Ich hatte vielleicht drei Wochen im Krankenhaus gelegen, als ich eines späten Nachmittags den Blick vom Fenster wandte, und auf einem Stuhl am Fußende des Bettes saß meine Mutter. »Mom?«, sagte ich.
»Grüß dich, Lucy«, sagte sie. Ihre Stimme klang scheu und doch drängend. Sie beugte sich vor und drückte mir durch die Decke hindurch den Fuß. »Grüß dich, Wizzle.« Ich hatte meine Mutter viele Jahre nicht gesehen, und ich musste sie immerzu anschauen; sie sah so verändert aus, aber ich hätte nicht sagen können, warum.
»Mom, wie bist du hierhergekommen?«, fragte ich.
»Ach, mit dem Flugzeug.« Sie wackelte mit den Fingern, und ich wusste, dass die Situation für uns beide zu emotional war. Also winkte ich zurück und legte mich wieder flach hin. »Eigentlich sollte es nichts Ernstes sein bei dir«, sagte sie in dem gleichen scheu klingenden, aber drängenden Ton. »Ich hatte keine Träume.«
Sie zu sehen, meinen Kindernamen zu hören, mit dem mich eine Ewigkeit niemand mehr angeredet hatte, erfüllte mich mit einem warmen, flüssigen Gefühl, als wäre die Anspannung in mir eine feste Masse gewesen, die sich nun auflöste. Für gewöhnlich wurde ich gegen Mitternacht wach und dämmerte dann unruhig vor mich hin oder starrte mit weit offenen Augen durch die Fensterscheibe hinaus auf die Lichter der Stadt. Aber in dieser Nacht schlief ich durch, und als ich am Morgen aufwachte, saß meine Mutter am selben Platz wie zuvor. »Egal«, sagte sie, als ich sie fragte. »Ich schlafe ja nie viel.«
Die Schwestern boten an, ein Zustellbett für sie zu holen, aber sie schüttelte den Kopf. Jedes Mal, wenn eine Schwester ihr ein Bett anbot, schüttelte sie nur den Kopf. Nach einer Weile fragten die Schwestern nicht mehr. Meine Mutter blieb fünf Nächte bei mir, und die ganze Zeit schlief sie, wenn überhaupt, auf dem Stuhl.
An dem ersten ganzen Tag, den wir miteinander verbrachten, redeten meine Mutter und ich nur sporadisch; ich glaube, wir fühlten uns beide gleich unsicher. Sie stellte ein paar Fragen nach meinen Töchtern, und ich spürte, wie heiß mein Gesicht wurde, als ich antwortete. »Sie sind großartig«, sagte ich. »Es sind einfach so großartige Kinder.« Nach meinem Mann fragte meine Mutter nicht, dabei war er es gewesen – das sagte er mir am Telefon –, der sie angerufen und gebeten hatte, zu mir zu kommen, der ihr den Flug bezahlt hatte und sie auch vom Flughafen abgeholt hätte – meine Mutter, die noch nie in ihrem Leben geflogen war. Und obwohl sie stattdessen im Taxi kam, obwohl sie die direkte Begegnung mit ihm verweigerte, hatte er sie zu mir gelotst. Und hier war sie nun, auf dem Stuhl am Fußende meines Bettes, und erwähnte auch meinen Vater mit keiner Silbe, also fragte ich lieber nicht nach ihm. Ich hoffte so sehr, sie würde sagen: »Dein Vater wünscht dir gute Besserung«, aber sie sagte nichts dergleichen.
»War das nicht unheimlich, im Taxi herzukommen, Mom?«
Sie zögerte, und ich meinte etwas von der Panik zu ahnen, die sie nach der Landung befallen haben musste. Aber sie sagte: »Der liebe Gott hat mir eine Zunge gegeben, und ich habe sie benutzt.«
Nach einer Weile sagte ich: »Ich bin froh, dass du da bist.«
Sie lächelte kurz und schaute zum Fenster.
Das war Mitte der Achtzigerjahre, vor der Zeit der Handys, und wenn das beige Telefon auf meinem Nachttisch klingelte und mein Mann anrief – wie meine Mutter vermutlich schon an dem weinerlichen Tonfall erkannte, in dem ich ihn begrüßte –, stand sie leise von ihrem Stuhl auf und ging aus dem Zimmer. Das müssen die Gelegenheiten gewesen sein, bei denen sie sich in der Cafeteria etwas zu essen holte oder von dem Münzfernsprecher auf dem Korridor meinen Vater anrief, denn ich sah sie nie essen, und bestimmt wollte mein Vater ab und zu von ihr hören (soviel ich wusste, war zwischen ihnen alles so weit in Ordnung), und wenn ich dann auch noch beide Kinder gesprochen und den Hörer dutzendmal geküsst hatte und mich zurück auf mein Kissen legte und die Augen schloss, schlüpfte meine Mutter wieder ins Zimmer; sobald ich die Augen aufschlug, saß sie da.
An diesem ersten Tag sprachen wir über meinen Bruder, den Ältesten von uns dreien, der unverheiratet war und mit seinen sechsunddreißig noch zu Hause wohnte, und über meine ältere Schwester, die vierunddreißig war und mit ihrem Mann und fünf Kindern zehn Meilen von meinen Eltern entfernt lebte. Ich wollte wissen, ob mein Bruder eine Arbeit hatte. »Er hat keine Arbeit«, sagte meine Mutter. »Er schläft bei den Tieren, die geschlachtet werden sollen.« Ich fragte sie, was sie gerade gesagt hatte, und sie wiederholte es. Sie fügte hinzu: »Er geht zu Pedersons in den Stall und übernachtet bei den Schweinen, bevor sie zum Schlachten abgeholt werden.« Ich wunderte mich darüber und sagte das meiner Mutter, und sie zuckte die Achseln.
Dann redeten meine Mutter und ich über die Krankenschwestern. Meine Mutter hatte für sie alle Namen parat: »Reiswaffel« für die Magere, die so zackig auftrat, »Zahnweh« für die vergrämte Ältere, »Stilles Kind« für die Inderin, die wir beide nett fanden.
Aber ich war erschöpft, darum fing meine Mutter an, mir Geschichten über Leute zu erzählen, die sie vor langer Zeit gekannt hatte. Sie sprach in einem Ton, an den ich mich von früher her nicht erinnerte, als hätten sich in ihr über Jahre hinweg Gefühle und Worte und Beobachtungen angestaut, und ihre Stimme hatte etwas Atemloses, Unbedecktes. Zwischendurch döste ich ein, und jedes Mal, wenn ich wieder aufwachte, wollte ich, dass sie weitererzählte. Aber sie sagte: »Wizzle-dee, du musst dich ausruhen.«
»Aber ich ruh mich doch aus. Bitte, Mom! Erzähl mir was. Irgendetwas. Erzähl mir von Kathie Nicely. Den Namen fand ich immer so hübsch.«
»Ach ja, Kathie Nicely. Gott, mit der hat’s kein gutes Ende genommen.«
2
Wir waren Außenseiter, unsere Familie, selbst in dem winzigen Ort Amgash im ländlichen Illinois, wo auch andere Häuser heruntergekommen waren und gestrichen gehörten und keine Fensterläden hatten, keine Gärten, nichts fürs Auge. Diese anderen Häuser standen beisammen und bildeten die Stadt, aber unser Haus lag abseits. Es heißt von Kindern ja, sie würden die Umstände, in denen sie leben, als die Norm ansehen, aber weder Vicky noch ich fühlten uns je normal. Auf dem Pausenhof riefen die Kinder: »Die Bartons stinken!« und rannten mit zugehaltener Nase weg; als meine Schwester in der zweiten Klasse war, erklärte ihr die Lehrerin vor sämtlichen Mitschülern, dass Armut keine Entschuldigung für Schmutz hinter den Ohren sei: Zu arm zum Seifekaufen sei niemand. Mein Vater reparierte landwirtschaftliche Maschinen, wobei sein Boss ihn regelmäßig wegen Aufsässigkeit rausschmiss und dann wieder einstellte – weil er gut arbeitete, nehme ich an, und man ihn auf Dauer eben doch brauchte. Meine Mutter erledigte Näharbeiten; SCHNEIDER- UND ÄNDERUNGSARBEITEN stand auf dem handgemalten Schild am unteren Ende unserer langen Einfahrt. Und obwohl mein Vater uns, wenn er vor dem Schlafengehen mit uns betete, Gott stets für das Essen auf unserem Tisch danken ließ, muss doch gesagt sein, dass ich oft völlig ausgehungert war und dass es abends häufig nur Brot mit Sirup bei uns gab. Lügen und Essen verschwenden, dafür wurden wir immer bestraft. Gelegentlich kam es auch vor, dass uns meine Eltern – und zwar meist meine Mutter und meist im Beisein unseres Vaters – verprügelten, heftig und ohne Vorwarnung, was manche Leute, wie ich inzwischen glaube, an unserer fleckigen Haut und unserer verstockten Art gemerkt haben müssen.
Dazu kam die Isolation.
Wir wohnten in der Sauk Valley Area, wo man weite Strecken zurücklegen kann, ohne mehr als ein oder zwei Häuser inmitten von Äckern zu sehen, und wie ich schon sagte, unser Haus lag sowieso abseits. Wir lebten umgeben von Maisfeldern und Sojabohnenfeldern, die bis zum Horizont reichten; gleich dahinter aber kam Pedersons Schweinefarm. Zwischen all den Feldern stand ein einzelner Baum, der etwas Verblüffendes hatte in seiner Absolutheit. Viele Jahre lang empfand ich diesen Baum als meinen Freund; er war mein Freund. Unser Haus lag an einer sehr langen Schotterstraße nicht weit vom Rock River, gleich neben einer Baumreihe, die als Windschutz für die Maisfelder diente. Das heißt, Nachbarn gab es keine. Und wir hatten kein Fernsehen und weder Zeitungen noch Zeitschriften, noch Bücher im Haus. In ihrem ersten Ehejahr hatte meine Mutter in der örtlichen Bibliothek gearbeitet und – das erzählte mir mein Bruder später – Bücher geliebt. Aber dann teilte man ihr in der Bibliothek mit, dass die Vorschriften sich geändert hätten und sie nur noch jemanden mit entsprechender Ausbildung einstellen könnten. Meine Mutter glaubte diese Begründung nicht. Sie hörte auf zu lesen, und viele Jahre vergingen, bevor sie zu einer anderen Bibliothek in einer anderen Stadt fuhr und wieder Bücher mit nach Hause brachte. Ich erwähne das, weil mich die Frage beschäftigt, wie Kinder ihr Bild von der Welt bekommen, von den Regeln, die in der Welt gelten.
Wie lernt man zum Beispiel, dass es unhöflich ist, ein Ehepaar zu fragen, warum es keine Kinder hat? Wie deckt man einen Tisch richtig? Woher weiß man, dass man mit offenem Mund kaut, wenn man es von niemandem gesagt bekommt? Woher weiß man überhaupt, wie man aussieht, wenn der einzige Spiegel im Haus winzig klein ist und in der Küche hoch über der Spüle hängt und kein Mensch einem je ein Kompliment gemacht hat und die eigene Mutter den Busen, der einem wächst, mit der Bemerkung kommentiert, dass man langsam aussieht wie eine von Pedersons Kühen?
Wie Vicky sich durchgebissen hat, weiß ich bis heute nicht. Wir standen uns nicht so nahe, wie man meinen könnte; wir wurden beide gleichermaßen gemieden und verachtet und beäugten einander mit demselben Misstrauen wie den Rest der Welt. Es gibt inzwischen Zeiten (denn mein Leben hat sich so von Grund auf verändert), da ertappe ich mich bei dem Gedanken: So schlimm war es gar nicht. Und vielleicht stimmt das ja. Aber es kommt auch vor – völlig unverhofft –, dass ich einen sonnigen Gehsteig entlanggehe oder einen Baumwipfel im Wind schwanken sehe oder zuschaue, wie der Novemberhimmel sich auf den East River herabsenkt, und plötzlich tut sich in mir eine Dunkelheit auf, die so bodenlos ist, dass ich einen kleinen Japser ausstoße und mich in das erstbeste Kleidergeschäft flüchte und mit Wildfremden ein Gespräch über den Schnitt der neu eingetroffenen Pullover anfange. Vermutlich schlingern die meisten so durch ihr Leben, halb wissend und halb blind, bedrängt von Erinnerungen, die unmöglich wahr sein können. Aber wenn ich Menschen voll Selbstvertrauen die Straße entlanggehen sehe, als wären sie gänzlich frei von Ängsten, wird mir klar, dass ich keine Ahnung habe, was in anderen vorgeht. So vieles auf der Welt ist Spekulation.
3
Die Sache mit Kathie«, sagte meine Mutter, »die Sache mit Kathie war …« Meine Mutter beugte sich vor und legte den Kopf schief, Kinn in die Hand gestützt. Sie schien mir zugenommen zu haben in den Jahren, in denen ich sie nicht gesehen hatte, gerade nur so viel, dass es ihre Züge eine Spur weicher machte; ihre Brille war nicht schwarz wie früher, sondern beige, und das Haar um ihr Gesicht war heller geworden, aber nicht grau, so dass sie wie eine leicht vergrößerte, unschärfere Version ihres jüngeren Ichs wirkte.
»Die Sache mit Kathie«, sagte ich, »war, dass sie nett war.«
»Ich weiß nicht«, sagte meine Mutter. »Ich weiß nicht, wie nett sie war.« Wir wurden durch Reiswaffel unterbrochen, die mit ihrem Klemmbrett ins Zimmer trat, etwas darauf notierte, dann mein Handgelenk nahm und mir den Puls fühlte, ohne mich dabei anzuschauen, ihre blauen Augen in die Ferne gerichtet. Sie maß Fieber bei mir, blickte flüchtig auf das Thermometer, notierte wieder etwas und ging hinaus. Meine Mutter, die Reiswaffel beobachtet hatte, sah jetzt aus dem Fenster. »Kathie Nicely wollte immer mehr. Ich habe oft gedacht, der Grund, warum sie mit mir befreundet war – nein, befreundet ist wahrscheinlich zu viel gesagt, ich habe für sie genäht, und sie hat mich bezahlt – aber ich habe oft gedacht, der Grund, warum sie gern noch ein bisschen blieb und sich unterhielt – gut, einmal war ich auch bei ihr zu Besuch, damals, als ihre Schwierigkeiten anfingen – aber worauf ich hinauswill: Ich hatte immer den Eindruck, dass es ihr gefiel, dass ich in so viel ärmlicheren Verhältnissen lebte als sie. Ich hatte nichts, worum sie mich beneiden musste. Kathie wollte immer das, was sie nicht hatte. Sie hatte diese bildhübschen Töchter, aber das war ihr nicht genug, sie wollte einen Sohn. Sie hatte dieses schöne Haus in Hanston, aber es war ihr nicht schön genug, sie wollte mehr Anbindung an eine Großstadt. Welche Großstadt? So war sie nun mal.« Und dann zupfte meine Mutter etwas von ihrem Schoß, machte die Augen schmal und fügte leiser hinzu: »Sie war ein Einzelkind, das hatte auch was damit zu tun, glaube ich, so viele Einzelkinder sehen nur sich selbst.«
Genauso gut hätte sie mich ohrfeigen können; mein Mann war ein Einzelkind, und meine Mutter hatte mir vor langer Zeit gesagt, so ein »Handicap«, wie sie es ausdrückte, führe letztlich immer zu selbstsüchtigem Verhalten.
Meine Mutter fuhr fort: »Sie war einfach neidisch. Nicht auf mich natürlich. Aber Kathie wollte zum Beispiel gern reisen. Und ihr Mann war da anders. Er wollte, dass Kathie zufrieden daheimsaß und sie von seinem Gehalt lebten. Er hat gut verdient, er war Verwalter auf einer Farm, die Futtermais anbaute. Sie hatten ein wunderbares Leben, man hätte sofort mit ihnen tauschen mögen. Sogar zu Tanzabenden sind sie gegangen, in einen Club! Ich war seit der Schule nicht mehr beim Tanzen. Und manchmal hat sie sich von mir extra für so einen Tanzabend ein neues Kleid nähen lassen. Ab und zu hat sie auch ihre Töchter mitgebracht, wunderhübsche kleine Mädchen, und so artig und brav. Ich habe nie vergessen, wie sie sie das erste Mal mitbrachte. Kathie sagte zu mir: ›Darf ich vorstellen: die drei Nicely-Prinzesschen.‹ Und als ich sagte, ja, sie sehen wirklich wie Prinzessinnen aus, sagte sie: ›Nein, so werden sie in ihrer Schule in Hanston genannt, die drei Nicely-Prinzesschen.‹ Was das wohl für ein Gefühl ist, habe ich mich immer gefragt. Als Nicely-Prinzesschen tituliert zu werden. Aber einmal«, sagte meine Mutter mit ihrer drängenden Stimme, »habe ich die eine ihren Schwestern zuflüstern hören, bei uns würde es so komisch riechen.«
»Das sind eben Kinder, Mom«, sagte ich. »Kinder entdecken ständig irgendwelche komischen Gerüche.«
Meine Mutter nahm die Brille ab, hauchte rasch auf beide Gläser und rieb sie mit ihrem Rocksaum sauber. Ihr Gesicht kam mir plötzlich nackt vor; ich konnte nicht aufhören, dieses nackte Gesicht anzustarren. »Und dann, eines Tages, wendete sich das Blatt. Angeblich waren es ja die Sechzigerjahre, als alle plötzlich zu spinnen anfingen, aber in Wahrheit passierte das erst in den Siebzigern.« Sie setzte die Brille wieder auf – vervollständigte ihr Gesicht wieder – und fuhr fort: »Oder vielleicht hat es auch nur so lange gedauert, bis diese neuen Moden bei uns auf dem Land angekommen waren. Jedenfalls kam Kathie eines Tages zu mir, und sie war kicherig und seltsam, ganz backfischhaft, weißt du. Du warst damals schon …« Meine Mutter hob den Arm und wackelte mit den Fingern. Sie sagte nicht auf dem College. Sie sagte nicht studieren. Also sagte ich es auch nicht. Meine Mutter sagte: »Kathie hatte jemanden kennengelernt, das war mir klar, auch wenn sie nicht mit der Sprache herausrückte. Ich hatte eine Vision, eine Heimsuchung, muss man es wohl eher nennen; es kam über mich, als ich dasaß und sie ansah. Und ich sah es, und ich dachte: Oje, das geht nicht gut aus.«
»Und so war’s auch«, sagte ich.
»Und so war’s auch.«
Kathie Nicely hatte sich in den Lehrer eines ihrer Kinder verliebt – die zu der Zeit schon alle drei auf die High School gingen –, und sie begann sich heimlich mit diesem Mann zu treffen. Dann eröffnete sie ihrem Ehemann, dass sie sich selbst verwirklichen wolle und das Familienleben sie zu sehr einenge. Also zog sie daheim aus, verließ ihren Mann, ihre Töchter, ihr Haus. Meine Mutter erfuhr die Einzelheiten erst, als Kathie weinend bei ihr anrief. Meine Mutter fuhr zu ihr. Kathie hatte eine kleine Wohnung gemietet, und sie saß auf einem Knautschsessel, ganz abgemagert im Vergleich zu früher, und sie gestand meiner Mutter, dass sie sich verliebt hatte, aber kaum war sie von zu Hause ausgezogen, hatte der Mann die Beziehung beendet. Er könne nicht so weitermachen, hatte er gesagt. Diesen Teil der Geschichte erzählte meine Mutter mit hochgezogenen Brauen, als erstaunte er sie immer wieder, und zwar auf nicht unangenehme Weise. »Aber ihr Mann, der wütend und gedemütigt war, wollte sie nicht wieder zurück.«
Ihr Mann wollte sie auch später nicht zurück. Über zehn Jahre lang sprach er nicht mal mit ihr. Als die älteste Tochter, Linda, gleich nach der High School heiratete, lud Kathie meine Eltern zur Hochzeit ein, weil sie – vermutete meine Mutter – dort sonst niemanden gehabt hätte, der mit ihr sprach. »Das Mädchen hatte es derart eilig mit dem Heiraten«, sagte meine Mutter, und ihre Worte überstürzten sich, »alle dachten, sie muss schwanger sein, aber ich weiß jedenfalls nichts von einem Kind, und ein Jahr später ließ sie sich scheiden und ging nach Beloit, wenn ich mich nicht irre, um sich dort einen reichen Mann zu angeln, und ich glaube, es hieß, sie hat einen gefunden.« Bei der Hochzeit, so meine Mutter, blieb Kathie keine zwei Sekunden auf einem Fleck, so hektisch und nervös war sie. »Man konnte es gar nicht mitansehen. Wir kannten natürlich keinen Menschen, es war sonnenklar, dass Kathie uns rein ihretwegen herbestellt hatte. Wir saßen auf unseren Stühlen, und weißt du, an der einen Wand – es war im Club, diesem albernen, überteuerten Lokal in Hanston – da hatten sie diese ganzen indianischen Pfeilspitzen hinter Glas, wozu macht man so was, dachte ich, wer braucht so viele Pfeilspitzen – und nach jedem Gespräch, das Kathie mit irgendwem anzufangen versuchte, kam sie gleich wieder zu uns zurück. Nicht mal Linda in ihrem piekfeinen weißen Brautkleid – das sie im Laden gekauft hatte, kein Kleid von mir –, nicht mal ihre eigene Tochter hatte mehr als einen Blick für sie übrig. Inzwischen wohnt sie seit bald fünfzehn Jahren in diesem Häuschen, nur ein paar Meilen von ihrem Mann, Exmann, entfernt. Ganz allein. Die Mädchen haben alle zum Vater gehalten. Eigentlich ein Wunder, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass Kathie bei der Hochzeit überhaupt dabei sein durfte. Aber er hat nie eine andere Frau gefunden.«
»Er hätte sie zurücknehmen sollen«, sagte ich mit Tränen in den Augen.
»Er war eben in seinem Stolz verletzt.« Meine Mutter zuckte die Achseln.
»Und jetzt ist er allein, und sie ist allein, und irgendwann sterben sie.«
»Anzunehmen«, sagte meine Mutter.
Das Schicksal von Kathie Nicely wühlte mich richtiggehend auf an diesem Tag im Krankenhaus, während meine Mutter am Fußende meines Bettes saß. Zumindest habe ich es so im Gedächtnis. Ich weiß, dass ich meiner Mutter mit zugeschnürter Kehle und brennenden Augen erklärte, dass ihr Mann sie hätte zurücknehmen sollen. Und ich meine, ich sagte auch: »Es wird ihm noch leidtun, glaub mir, irgendwann tut es ihm leid.«
Und meine Mutter sagte: »Ich glaube eher, dass es ihr leidtut.«
Aber vielleicht täusche ich mich da.
4
Bis ich elf war, wohnten wir in einer Garage. Die Garage gehörte meinem Großonkel, der das Haus nebenan bewohnte, und hatte nur ein kleines Handwaschbecken mit einem dünnen Rinnsal kalten Wassers. Aus der Isolierung an den Wänden quoll etwas hervor, das wie rosa Zuckerwatte aussah, aber es war Glaswolle, und man konnte sich daran schneiden, wie uns eingeschärft wurde. Das verwirrte mich, und ich musste es immer wieder anstarren, dieses hübsche rosa Zeug, das ich nicht anfassen durfte, und wunderte mich, warum es Glas hieß; seltsam im Rückblick, welchen Raum das in meinem Kopf einnahm, das Rätsel dieser hübsch anzusehenden und gefährlichen Glaswolle, mit der wir in so enger Nachbarschaft lebten. Meine Schwester und ich schliefen auf zwei Liegen aus Zeltstoff, die an Metallstangen übereinandergehängt waren. Das Bett meiner Eltern stand unter dem einzigen Fenster, aus dem man hinaus über die Maisfelder sah, und mein Bruder hatte eine Pritsche hinten in der Ecke. Nachts lauschte ich dem an- und abschwellenden Brummen des kleinen Kühlschranks. In manchen Nächten fiel Mondlicht durch das Fenster herein, in anderen war es stockfinster. Im Winter wurde es so kalt, dass ich oft nicht einschlafen konnte, und dann machte meine Mutter manchmal auf der Kochplatte Wasser heiß und goss es in die rote Gummiwärmflasche und legte sie mir ins Bett.
Als mein Großonkel starb, zogen wir ins Haus um, wo es Warmwasser und ein Spülklosett gab, aber im Winter war es auch hier eiskalt. Wie ich diese Kälte immer gehasst habe! Eine Vielzahl von Dingen entscheidet darüber, welche Wege wir einschlagen, und nur selten können wir sie mit Gewissheit benennen, aber ich denke noch heute daran, wie ich nach dem Unterricht in der warmen Schule blieb, einfach um im Warmen zu sein. Der Hausmeister ließ mich mit einem stummen, gutmütigen Nicken in ein Klassenzimmer, in dem die Heizkörper noch zischten, und dann machte ich dort meine Hausaufgaben. Oft hörte ich aus der Turnhalle ein schwaches Stampfen, wenn die Cheerleader probten, oder das Auftippen von einem Basketball, und dazu probte im Musiksaal vielleicht die Band, aber ich saß allein in der Wärme des Klassenzimmers, und dabei lernte ich, dass Arbeit erledigt wird, einfach indem man sie tut. Die Logik hinter meinen Hausaufgaben erschloss sich mir hier auf eine Weise wie daheim nie. Und wenn alle Hausaufgaben geschafft waren, las ich – bis es endgültig Zeit zum Gehen war.
Unsere Schule war nicht groß genug für eine eigene Bücherei, aber es gab Bücher in den Klassenzimmern, die wir lesen und mit nach Hause nehmen durften. In der dritten Klasse las ich ein Buch, das mich dazu brachte, selber eines schreiben zu wollen. Das Buch handelte von zwei Mädchen, zwei fröhlichen Mädchen mit einer netten Mutter, die den Sommer in einer anderen Stadt verbringen. In dieser neuen Stadt treffen sie ein Mädchen namens Tilly – Tilly! –, das sie seltsam und abstoßend finden, weil es schmutzig und arm ist, und die Mädchen sind erst nicht nett zu Tilly, aber dann sorgt die nette Mutter dafür, dass sie es doch sind. Das blieb mir von dem Buch in Erinnerung: Tilly.
Meine Lehrerin sah, dass ich Spaß am Lesen hatte, und sie lieh mir Bücher, auch Erwachsenenbücher, und ich las sie alle. Und später, in der High School, las ich immer noch Bücher in der warmen Schule, wenn ich mit den Hausaufgaben fertig war. Aber die Bücher gaben mir etwas. Darum geht es mir. Ich fühlte mich weniger einsam durch sie. Darum geht es mir. Und ich dachte mir: Eines Tages schreibe ich auch Bücher, und dann fühlen die Menschen sich weniger einsam! (Aber das war mein Geheimnis. Selbst als ich meinen Mann kennenlernte, gestand ich es ihm nicht sofort. Ich konnte mich nicht ernst nehmen. Und gleichzeitig doch. Insgeheim – tief, tief drinnen – nahm ich mich ganz und gar ernst! Ich wusste, dass ich eine Schriftstellerin war. Ich wusste nicht, wie schwer es werden würde. Aber so etwas weiß niemand, und es zählt auch nicht.)
Weil ich so viele Stunden im warmen Klassenzimmer saß, weil ich so viel las, weil ich begriffen hatte, dass Hausaufgaben einen Sinn ergaben, wenn man sie nur vollständig machte – durch all das wurden meine Noten vorbildlich. In meinem letzten Schuljahr rief mich die Vertrauenslehrerin in ihr Büro und teilte mir mit, dass ein College außerhalb von Chicago mir einen Studienplatz anbot, bei dem alle Kosten abgedeckt waren. Meine Eltern sagten nicht viel dazu, vermutlich aus Loyalität zu meinem Bruder und meiner Schwester, die keine vorbildlichen oder auch nur besonders guten Noten heimbrachten; keines meiner Geschwister studierte.
Die Vertrauenslehrerin war es, die mich an einem sengend heißen Tag zum College fuhr. Oh, mir verschlug es den Atem, als ich es sah! Es schien mir so riesig, ein Gebäude am anderen, der See unendlich weit, und es wimmelte von Menschen, alles Studenten, die von einem Seminarraum zum nächsten schlenderten. Ich fürchtete mich fast zu Tode, aber noch größer war das Hochgefühl, das mich erfasste. Ich lernte rasch, mich so zu geben wie die Leute um mich herum und das Ausmaß meiner Unwissenheit in allem, was mit Populärkultur zu tun hatte, möglichst gut zu verschleiern – wobei Letzteres nicht einfach war.
Aber vor allem eins weiß ich noch: Als ich an Thanksgiving heimfuhr, konnte ich in der ersten Nacht nicht einschlafen, und zwar deshalb, weil ich Angst hatte, ich könnte mein Leben im College nur geträumt haben. Ich hatte Angst davor, aufzuwachen und zu entdecken, dass ich wieder hier war, in diesem Haus, für immer, und der Gedanke schien mir unerträglich. Ich dachte: nein. Und das dachte ich lange Zeit, bis der Schlaf irgendwann doch kam.
Ich fand einen Job nicht weit weg vom College und kaufte meine Kleider im Secondhandladen; das war Mitte der Siebzigerjahre, als Secondhandkleider nicht zwingend ein Zeichen von Armut waren. Soweit ich weiß, stieß sich nie jemand an meiner Art, mich zu kleiden, nur einmal, bevor ich meinen Mann kennenlernte, verliebte ich mich in einen Professor, und wir hatten eine kurze Beziehung. Er war Künstler, und ich mochte seine Werke, obwohl mir klar war, dass ich sie nicht verstand, aber ich liebte ja ihn, seine Strenge, seinen Intellekt, die Radikalität, mit der er auf bestimmte Dinge verzichtete, um das Leben führen zu können, das er wollte – Kinder zum Beispiel, auf sie musste verzichtet werden. Aber ich halte das alles nur aus einem Grund fest: Er war nach meiner Erinnerung der einzige Mensch in meiner Jugend, der meine Kleidung erwähnte, und zwar verglich er mich mit einer Kollegin an der Fakultät, die sich teuer kleidete und die groß und üppig war – anders als ich. Er sagte: »Du hast mehr Substanz, aber Irene hat mehr Stil.« Ich sagte: »Aber Stil ist Substanz.« Ich wusste damals noch nicht, dass das stimmte, ich hatte es nur irgendwann in meinem Shakespeare-Kurs mitgeschrieben, weil der Shakespeare-Dozent es gesagt hatte und es überzeugend klang. Der Künstler erwiderte: »Gut, dann hat Irene mehr Substanz.« Ich schämte mich ein bisschen für ihn, dafür, dass er denken konnte, ich hätte keinen Stil, denn die Kleider, die ich trug, waren ja ich, und dass es keine Schneiderkostüme, sondern Sachen aus dem Secondhandladen waren, konnte keine Rolle spielen, so schien mir, es sei denn für jemand sehr Oberflächliches. Und eines Tages sagte er: »Wie findest du dieses Hemd? Ich habe mir dieses Hemd bei Bloomingdale’s gekauft, als ich einmal in New York war. Ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, wenn ich es trage.« Und auch da schämte ich mich. Denn offenbar waren ihm solche Dinge wichtig, und ich hatte ihn für tiefgründiger gehalten, für klüger; er war Künstler! (Ich liebte ihn aufrichtig.) Er muss auch der erste Mensch gewesen sein, der sich Gedanken über meine Herkunft machte – obgleich ich von so etwas wie gesellschaftlichen Schichten damals noch keinen Begriff hatte –, denn er fuhr mit mir durch die verschiedenen Wohngegenden und fragte: Sieht euer Haus so aus? Und die Häuser, auf die er zeigte, hatten nichts gemein mit den Häusern aus meiner Kindheit, nicht dass sie so besonders groß oder vornehm waren, sie glichen nur in nichts der Garage, in der ich aufgewachsen war und von der ich ihm erzählt hatte, und auch nicht dem Haus meines Großonkels. Ich grämte mich nicht wegen dieser Garage – nicht auf die Art, wie er es offenbar erwartete –, aber er meinte anscheinend, das würde noch kommen. Trotzdem liebte ich ihn. Er wollte wissen, was wir gegessen hätten, als ich ein Kind war. Ich sagte nicht: »Meistens Brot mit Sirup.« Ich sagte: »Es gab ziemlich oft Dosenbohnen bei uns.« Und er sagte: »Und dann habt ihr alle um die Wette gefurzt, oder wie?« Und da wurde mir klar, dass ich ihn nie heiraten würde. Seltsam, wie ein Satz ausreichen kann, um einem so etwas klarzumachen. Man kann bereit sein, auf die Kinder zu verzichten, die man sich eigentlich wünscht, man kann bereit sein, Kommentare über seine Vergangenheit, seine Kleidung an sich abprallen zu lassen, und dann – eine kleine Bemerkung, und die Seele fällt in sich zusammen und sagt: Oh.
Seitdem habe ich viele Freundschaften geschlossen, mit Männern wie mit Frauen, und alle bestätigen sie es: immer das eine verräterische Detail. Was ich damit sagen will: Es geht nicht nur Frauen so. Sehr viele von uns haben das schon erlebt, wenn sie das Glück hatten, dieses eine Detail herauszuhören und ernst zu nehmen.
Im Rückblick scheint mir, dass ich sehr sonderbar gewirkt haben muss – mit zu lauter Stimme sprach und verstummte, sobald es um irgendwelche Aspekte der Populärkultur ging; ich glaube auch, dass ich merkwürdig auf landläufige Arten von Humor reagierte, die ich nicht kannte. Ironie war mir gänzlich fremd, und das verwirrte die Leute. Als ich meinen Mann kennenlernte, hatte ich das Gefühl – völlig überraschend –, dass er etwas ganz Grundlegendes an mir verstand. William war Laborassistent bei meinem Biologieprofessor im zweiten Jahr und hatte seine eigene, sehr eigenständige Sicht auf die Welt. Mein Mann kam aus Massachusetts und war der Sohn eines deutschen Kriegsgefangenen, der auf den Kartoffeläckern von Maine gearbeitet hatte. Nur Haut und Knochen, wie so viele es damals waren, hatte dieser Mann das Herz der Farmersgattin gewonnen, und als er nach Kriegsende zurück nach Deutschland kam, konnte er sie nicht vergessen und schrieb an sie; Deutschland und alles, was die Deutschen getan hatten, erfülle ihn mit Abscheu, schrieb er ihr. Er kehrte nach Maine zurück und brannte mit der Farmersfrau durch, und sie zogen nach Massachusetts, wo er sich zum Bauingenieur ausbilden ließ; die Frau zahlte für ihre Ehe natürlich einen sehr hohen Preis. Mein Mann hatte seine typisch deutsche Blondheit von seinem Vater geerbt, wie ich auf Familienfotos sehen konnte. Sein Vater sprach oft Deutsch, als William klein war; als William vierzehn war, starb der Vater. Die Briefe zwischen Williams Eltern sind nicht erhalten; ob der Vater tatsächlich einen solchen Abscheu vor Deutschland empfand, weiß ich nicht. William glaubte es, also glaubte ich es viele Jahre lang auch.
William hatte im Mittleren Westen studiert, weil ihm seine verwitwete Mutter zu anhänglich war, strebte aber zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennenlernten, bereits mit aller Macht wieder an die Ostküste zurück. Dennoch wollte er, dass wir meine Eltern besuchten. Wir würden zusammen nach Amgash fahren, beschloss er, und er würde ihnen erklären, dass wir heiraten und nach New York City ziehen wollten, wo eine Habilitationsstelle an der Universität auf ihn wartete. Auch ich war nicht auf die Idee gekommen, dass es Probleme geben könnte; ich plante nicht, irgendwelche Brücken hinter mir abzubrechen. Ich war verliebt, bereit für die nächste Phase meines Lebens, nichts hätte natürlicher sein können. Wir fuhren an Äckern mit Sojabohnen und Mais entlang; es war Anfang Juni, und die Sojabohnen wuchsen auf einer Seite der Straße, ein so stechendes Grün, dass die sacht ansteigenden Felder regelrecht strahlten, und der Mais auf der anderen Seite war gerade erst kniehoch, ein zartes Hellgrün, das in den kommenden Wochen nachdunkeln würde, die Blättchen noch biegsam, ganz ohne ihre spätere Ledrigkeit (wie habe ich sie geliebt, die Maisfelder meiner Jugend, wenn ich zwischen den Reihen dahinrannte, rannte, wie nur ein Kind, allein, im Sommer rennen kann, zu dem Baum rannte, diesem einsamen Baum mitten im Feld!). In meiner Erinnerung war der Himmel während unserer Fahrt grau, und er schien sich zu heben – nicht aufzuklaren, sondern sich zu heben –, und das war wunderschön, dieser Eindruck des Sich-Hebens, Sich-Lichtens, das Grau eine Spur bläulich schimmernd über den Bäumen mit ihrem saftigen Laub.
Ich weiß noch, wie mein Mann sagte, so klein habe er sich unser Haus nicht vorgestellt.
Wir blieben keinen Tag bei meinen Eltern. Mein Vater trug seinen Mechaniker-Overall, und er warf einen Blick auf William, und als sie sich die Hand gaben, bemerkte ich, wie es im Gesicht meines Vaters arbeitete, ein Grimassieren, wie es häufig dieser Sache vorauszugehen pflegte, wie ich das als Kind bei mir genannt hatte – seltsame Zustände der Beklemmung und Erregung, in denen mein Vater jede Kontrolle über sich verlor. Ich kann mich täuschen, aber ich glaube nicht, dass mein Vater William danach noch ein zweites Mal ansah. William wollte meine Eltern und meinen Bruder und meine Schwester gern zum Essen einladen, in ein Restaurant ihrer Wahl. Mein Gesicht glühte wie die Sonne, als er das vorschlug; wir waren nie, kein einziges Mal, als Familie in einem Restaurant essen gewesen. Mein Vater sagte zu ihm: »Ihr Geld ist hier nichts wert«, und William schaute verdattert zu mir herüber, und ich schüttelte ganz leicht den Kopf und murmelte, dass wir wohl besser gehen sollten. Meine Mutter kam zu mir heraus, als ich allein neben dem Auto stand, und sie sagte: »Dein Vater hat ein Problem mit Deutschen. Du hättest uns das sagen müssen.«
»Euch was sagen müssen?«
»Du weißt doch, dass dein Vater im Krieg war, und da hätten ihn irgendwelche Deutschen um ein Haar umgebracht. Ihn muss fast der Schlag getroffen haben, als er William gesehen hat.«
»Ich weiß, dass Daddy im Krieg war«, sagte ich. »Aber davon hat er nie etwas erzählt.«
»Es gibt zwei Sorten von Männern mit Kriegserlebnissen«, sagte meine Mutter. »Die, die darüber reden, und die, die nicht darüber reden. Dein Vater gehört zu denen, die nicht darüber reden.«
»Und warum?«
»Weil es ungehörig wäre«, sagte meine Mutter. Und fügte hinzu: »Wo hast du bloß deine Manieren gelernt?«
Erst viel später – Jahre später – erfuhr ich von meinem Bruder, dass mein Vater in einer deutschen Stadt zwei junge Männer erschossen hatte; sie hatten ihn erschreckt, und er schoss ihnen in den Rücken, er hielt sie nicht für Soldaten, sie waren nicht gekleidet wie Soldaten, aber er erschoss sie, und als er den einen mit dem Fuß umdrehte, sah er, wie jung er war. Mein Bruder sagte, William sei meinem Vater wie eine ältere Ausgabe dieses Jungen erschienen, ein junger Mann, der ihm zum Hohn zurückgekommen war, um ihm seine Tochter wegzunehmen. Mein Vater hatte zwei junge Deutsche umgebracht, und als er im Sterben lag, sagte er meinem Bruder, es sei kein Tag vergangen, an dem er nicht an die beiden gedacht und den Impuls verspürt hätte, ihren Tod mit seinem eigenen zu sühnen. Was mein Vater im Krieg außerdem erlebt hat, weiß ich nicht, aber er hat bei der Ardennenschlacht und bei der Schlacht im Hürtgenwald mitgekämpft, und das waren zwei der schlimmsten Schlachten im Zweiten Weltkrieg.
Meine Familie kam nicht zu meiner Hochzeit und nahm auch sonst keine Notiz davon, aber als meine erste Tochter geboren wurde, rief ich meine Eltern aus New York an, und meine Mutter sagte, sie habe es geträumt und wisse schon, dass ich ein kleines Mädchen bekommen hatte, nur wie es hieß, wusste sie nicht, und als ich ihr den Namen sagte, Christina, klang sie erfreut. Danach rief ich an ihren Geburtstagen und an Feiertagen bei ihnen an und auch nach der Geburt meiner jüngeren Tochter Becka. Wir sprachen freundlich miteinander, aber nie ohne ein gewisses Unbehagen, so schien mir, und ich hatte niemanden aus meiner Familie je wiedergesehen bis zu dem Tag, an dem meine Mutter plötzlich am Fußende meines Bettes saß, in dem Krankenhauszimmer, zu dessen Fenster das Chrysler Building hereinleuchtete.
5
In der Dunkelheit fragte ich meine Mutter leise, ob sie wach war.
O ja, antwortete sie. Leise. Obwohl wir allein waren in dem Krankenzimmer mit dem leuchtenden Chrysler Building vor dem Fenster, flüsterten wir, als hätten wir Angst, jemanden zu stören.
»Was glaubst du, warum dieser Typ von Kathie einen Rückzieher gemacht hat, sobald sie von ihrem Mann weg war? Hat er kalte Füße bekommen?«
Nach kurzem Zögern sagte meine Mutter: »Ich weiß es nicht. Aber Kathie sagte, er hätte ihr gebeichtet, dass er ein Homo war.«
»Er war schwul?« Ich setzte mich auf und sah sie auf ihrem Stuhl am Fußende sitzen. »Er hat ihr erzählt, er ist schwul?«
»Ja, so nennt man das heute wohl. Damals haben wir ›Homo‹ gesagt. Er hat ›Homo‹ gesagt. Oder Kathie hat es gesagt. Ich weiß nicht, wer ›Homo‹ gesagt hat. Aber er war einer.«
»Mom, oh, Mom, das ist zum Lachen«, und ich konnte hören, dass sie selbst zu lachen anfing, obwohl sie sagte: »Wizzle, ich weiß nicht, was daran so komisch sein soll.«
»Du!« Mir rollten die Lachtränen aus den Augen. »Diese Geschichte! Das ist eine furchtbare Geschichte!«
Immer noch lachend – und in demselben unterdrückten und doch drängenden Ton, in dem sie auch tagsüber gesprochen hatte – sagte sie: »Ich weiß wirklich nicht, was daran komisch ist, wenn man seinen Mann wegen einem schwulen Homo verlässt und es dann erst erfährt, wo man doch dachte, man hätte einen echten Mann abgekriegt.«
»Es ist zum Schreien, Mom.« Ich legte mich wieder hin.
Meine Mutter sagte nachdenklich: »Ich habe manchmal gedacht, dass er vielleicht gar nicht wirklich schwul war. Dass Kathie ihm vielleicht Angst gemacht hat. So, wie sie für ihn alles aufgegeben hatte. Vielleicht hat er es nur behauptet.«
Ich überlegte. »Ich weiß nicht, ob das damals etwas war, was ein Mann ohne Not von sich behauptet hätte.«
»Oh«, sagte meine Mutter. »Ja, da hast du wohl recht. Und eigentlich weiß ich gar nichts über ihn. Ich kann dir nicht mal sagen, ob es ihn überhaupt noch gibt, oder irgendwas sonst.«
»Aber gemacht haben sie’s ja wohl?«
»Das weiß ich nicht«, sagte meine Mutter. »Woher soll ich das wissen? Und was gemacht? Verkehr gehabt? Wie um alles in der Welt soll ich das wissen?«
»Sie müssen Verkehr gehabt haben«, sagte ich, weil ich die Wortwahl so drollig fand und ich außerdem davon überzeugt war. »Man verlässt drei Töchter und einen Ehemann nicht wegen einem bloßen Flirt.«
»Vielleicht ja doch.«
»Gut. Vielleicht ja doch.« Und dann fragte ich: »Und Kathies Mann – Mr Nicely – hatte er seitdem wirklich keine Beziehung mehr?«
»Exmann. Hat sich von ihr scheiden lassen, so schnell konntest du gar nicht gucken. Nein, ich glaube nicht. Jedenfalls hat niemand etwas mitgekriegt. Aber andererseits weiß man natürlich nie.«
Vielleicht war es die Dunkelheit im Zimmer – nur der blasse Lichtstreif unter der Tür und das grandiose Sternbild des Chrysler Building draußen –, die es uns möglich machte, auf diese ganz neue Art miteinander zu reden.
»Schon verrückt«, sagte ich.
»Schon verrückt«, stimmte meine Mutter mir zu.
Ich war so glücklich. Oh, war ich glücklich, wie ich da lag und mit meiner Mutter schwatzte!
6
Damals – und es war, wie gesagt, Mitte der Achtzigerjahre – wohnten William und ich im West Village, in einer kleinen Wohnung nicht weit vom Fluss. Das Haus hatte keinen Fahrstuhl, was anstrengend war mit den zwei kleinen Kindern und ohne Waschmaschine, und einen Hund hatten wir auch noch. Ich schnallte mir meine jüngere Tochter in einem Tragegurt auf den Rücken – bis sie zu groß dafür wurde – und führte so den Hund aus und bückte mich, Schultern durchgedrückt, mit dem Plastiktütchen steif nach seinen Haufen, wie die Schilder es anmahnten: DER GEHSTEIG IST KEIN HUNDEKLO. Und immerzu musste ich hinter meiner größeren Tochter herrufen, damit sie auf mich wartete, damit sie auf dem Bürgersteig blieb. Warte, warte!
Ich hatte zwei Freunde, und für den einen, Jeremy, schwärmte ich direkt ein wenig. Er wohnte im obersten Stock unseres Hauses, und er war fast, aber nicht ganz so alt wie mein Vater. Ursprünglich kam er aus Frankreich, aus dem französischen Adel, und er hatte all das aufgegeben, um nach Amerika auszuwandern, als junger Mann noch. »Alle, die anders waren, wollten damals nach New York«, sagte er. »Es war der Ort schlechthin. Ist es wahrscheinlich immer noch.« Als er dann älter wurde, beschloss er, Psychoanalytiker zu werden. Inzwischen behandelte er nur noch ein paar wenige Patienten, aber darüber erzählte er mir nichts. Er hatte eine Praxis gegenüber der New School, und dreimal die Woche ging er dorthin. Manchmal begegnete er mir unterwegs, und wenn ich ihn sah – groß, dünn, mit dunklen Haaren, seinem dunklen Anzug und dem melancholischen Gesicht –, wurde mir immer warm ums Herz. »Jeremy!«, sagte ich dann, und er lächelte und zog den Hut auf eine Art, die galant und altmodisch und europäisch war – in meinen Augen jedenfalls.
In seiner Wohnung war ich nur einmal, und zwar, als ich mich ausgesperrt hatte und auf den Hausmeister warten musste. Jeremy fand mich mit beiden Kindern und dem Hund auf den Eingangsstufen, völlig aufgelöst, und er nahm uns mit zu sich. Die Kinder waren sofort still und mustergültig brav, als sie in seine Wohnung kamen, so als wüssten sie, dass dies kein Ort für Kinder war, und tatsächlich hatte ich noch nie erlebt, dass Kinder zu ihm kamen. Nur Männer, allein oder paarweise, seltener auch eine Frau. Die Wohnung war sehr sauber und karg; vor einer weißen Wand stand eine Glasvase mit einer einzelnen Schwertlilie darin, und an den Wänden hing Kunst, die mir erst bewusst machte, wie groß die Kluft zwischen uns war. Ich sage das deshalb, weil ich die Kunst nicht verstand; es waren dunkle, längliche Objekte, Konstruktionen, die nahezu abstrakt, aber nicht gänzlich abstrakt waren, und ich verstand nur, dass sie Manifestationen einer Kultiviertheit waren, die ich niemals würde verstehen können. Ganz wohl fühlte Jeremy sich nicht mit meinen Kindern und mir in der Wohnung, das spürte ich, aber er war ein vollendeter Gentleman, auch deshalb mochte ich ihn so.
Drei Dinge zu Jeremy:
Eines Tages stand ich auf unserer Eingangstreppe, und als er aus dem Haus kam, sagte ich zu ihm: »Jeremy, manchmal, wenn ich hier stehe, kann ich es gar nicht fassen, dass ich wirklich und wahrhaftig in New York bin. Ich stehe hier und denke: Unglaublich! Ich, ausgerechnet ich, wohne in New York City!«
Und über sein Gesicht huschte – ganz rasch, ganz spontan – ein angewiderter Ausdruck. Das war etwas, was ich erst mit der Zeit lernte: wie tief der Abscheu der Stadtmenschen vor echter Provinzialität ist.
Und die zweite Begebenheit: Meine erste Geschichte wurde kurz nach meiner Ankunft in New York veröffentlicht, und dann dauerte es eine Weile, und meine zweite Geschichte erschien. Und das verkündete ihm Chrissie eines Tages auf der Eingangstreppe: »Mommy hat eine Geschichte in einer Zeitschrift!« Er wandte sich zu mir um und sah mich an; er sah mich durchdringend an; ich musste wegschauen. »Nein, nein«, sagte ich. »Bloß eine kleine unbedeutende Literaturzeitschrift.« Er sagte: »Dann sind Sie also Schriftstellerin. Sie sind Künstlerin. Ich arbeite mit vielen Künstlern, ich weiß, wovon ich rede. Eigentlich hätte ich mir das bei Ihnen gleich denken können.«
Ich schüttelte den Kopf. Ich dachte an den Künstler im College, an sein Selbstverständnis, seine Fähigkeit, auf Kinder zu verzichten.
Jeremy setzte sich neben mich auf die Stufe. »Künstler sind anders als andere Menschen.«
»Nein. Überhaupt nicht.« Das Blut schoss mir ins Gesicht. Ich war mein ganzes Leben anders gewesen, ich wollte es nicht noch auf neue Weise sein!
»Doch.« Er tippte mir aufs Knie. »Sie müssen rabiat sein, Lucy.«
Chrissie hüpfte auf und ab. »Es ist eine traurige Geschichte«, meldete sie. »Ich kann noch nicht lesen – also, ein paar Wörter schon –, aber es ist auf jeden Fall eine traurige Geschichte.«
»Darf ich sie lesen?«, wollte Jeremy wissen.
Ich schlug es ihm ab.
Ich sagte ihm, dass ich es nicht ertragen könnte, wenn sie ihm nicht gefiele. Er nickte und sagte: »Gut, dann frage ich nicht noch einmal. Aber, Lucy«, sagte er, »wir reden viel miteinander, und ich kann mir nicht vorstellen, etwas von Ihnen zu lesen, das mir nicht gefällt.«
Ich erinnere mich deutlich, dass er »rabiat« sagte. Er wirkte nicht rabiat auf mich, und ich hielt auch mich nicht für rabiat oder glaubte, dass ich es sein konnte. Ich liebte ihn; er war ein sanfter Mensch.
Er trug mir auf, rabiat zu sein.
Und noch etwas zu Jeremy: Die AIDS-Epidemie war damals ganz neu. Hagere, ausgemergelte Männer gingen durch die Straßen, und man sah ihnen an, dass sie mit dieser jäh hereingebrochenen, fast biblisch anmutenden Plage geschlagen waren. Und als ich eines Tages mit Jeremy auf unserer Eingangstreppe saß, sagte ich etwas, das mich selbst überraschte. Ich sagte, nachdem wieder zwei solche Männer langsam an uns vorbeigegangen waren: »Ich weiß, das ist furchtbar von mir, aber ein bisschen beneide ich sie. Weil sie einander haben, weil sie diese Gemeinschaft haben, in die sie eingebettet sind.« Und daraufhin sah er mich an, mit einem so milden Blick, und heute ist mir klar, dass er erkannte, was ich selbst gar nicht begriff: dass ich trotz des guten Lebens, das ich hatte, einsam war. Einsamkeit war der erste Geschmack gewesen, den ich gekostet hatte, und sie blieb mir, ein Nachgeschmack ganz hinten im Mund, der immer da war. Das verstand Jeremy an diesem Tag, glaube ich. Und er war milde mit mir. »Ja«, sagte er nur. Dabei hätte er so leicht sagen können: »Sind Sie verrückt, die sterben doch!« Aber das sagte er nicht, weil er diese Einsamkeit an mir wahrnahm. So möchte ich gern denken können. So denke ich.
7
In einem dieser Kleidergeschäfte, für die New York so berühmt ist, einem dieser Läden, die privat geführt werden und mehr von einer Kunstgalerie in Chelsea haben als von einer Boutique, traf ich eine Frau, die mich im weiteren Verlauf sehr stark beeinflusst hat, die möglicherweise – wie, das durchschaue ich selbst nicht ganz – der Grund dafür ist, dass ich dies schreibe. Das liegt jetzt etliche Jahre zurück, meine Mädchen können nicht viel älter als elf und zwölf gewesen sein. Jedenfalls sah ich diese Frau in dieser Boutique, und es war klar, dass sie mich nicht sah. Sie hatte diesen weltfernen Ausdruck, den man heute nicht mehr oft bei Frauen sieht, und er stand ihr gut, er machte sie apart, sehr sogar; ich schätzte sie auf fast fünfzig. Sie war auf vielerlei Art attraktiv, elegant, und ihrem Haar – aschblond sagte man dazu damals – sah man an, dass es nicht selbstgefärbt war, mit Färbemittel aus einer Packung, sondern von jemandem, der dafür ausgebildet war. Aber das Anziehendste war für mich ihr Gesicht. Ich beobachtete es im Spiegel, während ich eine schwarze Jacke anprobierte, und schließlich fragte ich sie: »Geht das zusammen, finden Sie?« Sie schaute ganz erstaunt, als fiele sie aus allen Wolken, dass jemand ihr Urteil in Kleiderfragen einholte. »Oh, aber ich arbeite nicht hier, tut mir leid«, sagte sie. Und ich sagte, dass ich das auch gar nicht gedacht hatte, mich interessiere nur ihre Meinung. Mir gefalle die Art, wie sie sich kleide, sagte ich.
»Ach, tatsächlich? Wie nett von Ihnen, danke sehr. Ja, dann … doch« – erst jetzt sah sie mich offenbar am Aufschlag der Jacke zupfen, zu der ich ihre Meinung wissen wollte –, »das geht gut, sehr hübsch sieht das aus, wollen Sie sie zu diesem Rock tragen?« Wir fachsimpelten über den Rock, darüber, ob ich eventuell noch einen längeren Rock hätte, nur für den Fall, dass ich, wie sie es ausdrückte, »doch mal Absätze« tragen wollte, »etwas ein klein bisschen Schickeres, wissen Sie?«
Sie war so schön wie ihr Gesicht, dachte ich, und auch das liebte ich so an New York: diese unzähligen Begegnungen mit Menschen. Vielleicht spürte ich auch ihre Traurigkeit. Zumindest schien es mir so, als ich heimkam und mir ihre Züge vergegenwärtigte; man registrierte es nicht bewusst, wenn sie vor einem stand, denn sie lächelte viel, und ihr ganzes Gesicht leuchtete dann. Sie wirkte wie eine Frau, in die sich immer noch viele Männer verliebten.
Ich fragte: »Und was machen Sie?«
»Beruflich, meinen Sie?«
»Ja«, sagte ich. »Sie sehen aus, als müssten Sie einen interessanten Beruf haben. Sind Sie vielleicht Schauspielerin?« Ich hängte die Jacke auf den Bügel zurück; ich hätte mir etwas so Teures nie leisten können.
O nein, nein, sagte sie, und dann, und ich könnte schwören, dass sie dabei rot wurde: »Ich schreibe nur, weiter nichts.« Als wollte sie es – schien mir – lieber gleich zugeben, weil Leugnen ja doch keinen Zweck hatte. Oder als sähe sie ihr Schreiben wirklich für so gering an. Ich fragte sie, was sie denn schrieb, und diesmal errötete sie ganz unverkennbar, und sie winkte ab und sagte: »Ach, Bücher, Romane, solche Sachen, nichts Großartiges.«
Darauf fragte ich natürlich nach ihrem Namen, und wieder hatte ich den Eindruck, dass sie das furchtbar verlegen machte – sie sagte es eilig und atemlos, »Sarah Payne« –, und da ich nicht schuld an ihrer Verlegenheit sein wollte, dankte ich ihr für die Kleiderberatung, und ihre Anspannung ließ nach, und wir unterhielten uns darüber, wo man am besten Schuhe kaufte – sie trug hochhackige schwarze Lackschuhe –, und dabei fühlte sie sich sichtlich wohler, und dann trennten wir uns und versicherten uns gegenseitig, was für eine nette Begegnung es gewesen war.
Zu Hause in unserer Wohnung (wir waren mittlerweile nach Brooklyn Heights umgezogen), während die Kinder herumtobten und durcheinanderriefen, wo denn der Föhn sei und wo die Bluse, die in der Wäsche gewesen war, ging ich an unseren Bücherschrank und stellte fest, dass Sarah Payne ihrem Umschlagfoto nur entfernt ähnlich sah; ich hatte ihre Romane gelesen. Und dann erinnerte ich mich an eine Party, auf der auch ein Mann gewesen war, der sie kannte. Er sprach über ihre Bücher, die er gut fand, nur hätten sie so etwas »Weiches, Mitleidiges«, das ihn abstieß und das ihre Leistung schmälere, sagte er. Aber mir gefiel, was sie schrieb. Ich mag Schriftsteller, die sich beim Schreiben um Wahrhaftigkeit bemühen. Und was sie schrieb, gefiel mir auch deshalb so, weil sie auf einer heruntergewirtschafteten Apfelplantage in der Nähe einer kleinen Stadt in New Hampshire aufgewachsen war und ihre Bücher dort spielten, auf dem Land, unter Menschen, die hart arbeiteten und viel Schweres erlebten, aber eben nicht nur Schweres. Und dann ging mir plötzlich auf, dass sie auch in ihren Büchern nicht exakt die Wahrheit schrieb, dass da immer etwas war, dem sie auswich. Sie bekam ja kaum ihren Namen über die Lippen! Und ich hatte das Gefühl, auch das zu verstehen.
8
Am nächsten Morgen im Krankenhaus – vor so vielen Jahren mittlerweile – sagte ich meiner Mutter, es mache mir Sorgen, dass sie so gar nicht schlief, und sie sagte, ich bräuchte mich deswegen nicht zu sorgen, sie hätte es im Laufe ihres Lebens gelernt, mit kurzen Nickerchen zwischendurch auszukommen. Und das setzte wieder einen jener kleinen Wortschwalle in Gang, ein Stau von Gefühlen schien sich Bahn zu brechen, als sie an diesem Morgen plötzlich von ihrer Kindheit zu sprechen begann, davon, wie sie schon als Kind mit kurzen Nickerchen zwischendurch ausgekommen war. »Das lernt man, wenn man sich nicht sicher fühlt«, sagte sie. »Im Sitzen kann man immer mal kurz schlafen.«
Ich weiß sehr wenig über die Kindheit meiner Mutter. Nicht, dass das etwas so Ungewöhnliches wäre – wenig über die Kindheit der eigenen Eltern zu wissen. Wenig Konkretes, meine ich. Ahnenforschung wird heutzutage ja großgeschrieben, und das heißt Namen und Orte und Fotos und Registerauszüge, aber wie erfahren wir, aus welchem Stoff der Alltag gemacht war? Wenn die Zeit kommt, dass uns solche Fragen interessieren, meine ich. Bei meinen puritanischen Vorfahren wurde Erzählen nicht als Vergnügen eingestuft, wie einige andere Kulturen das tun. Aber an diesem Morgen im Krankenhaus schien meine Mutter mehr als bereit, von ihren Sommern auf einer Farm zu erzählen. Dass es diese Sommer gegeben hatte, wusste ich schon; aus irgendwelchen Gründen hatte meine Mutter als Kind fast jeden Sommer auf der Farm ihrer Tante Celia verbracht, einer Frau, die ich nur als dünn und blass in Erinnerung habe und die für meine Geschwister und mich Tante Seal hieß – zumindest dachte ich, sie hieße so, und das verwirrte mich, weil Kinder die Welt wörtlich nehmen und ich »Cel« als seal verstand, Seehund, und nicht begriff, warum sie wie ein Meerestier hieß, obendrein eines, das ich noch nie gesehen hatte. Sie war mit Onkel Roy verheiratet, der nach allem, was ich wusste, ein sehr netter Mann war. Mutters Cousine Harriet war ihr einziges Kind, und ihr Name gehörte zu den wenigen, von denen in meiner Jugend hin und wieder die Rede war.