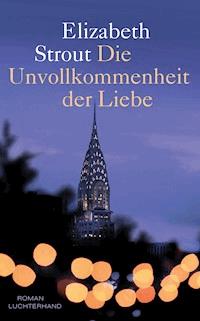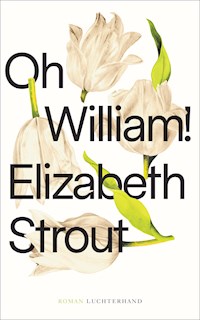9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Mir fehlt die Küste von Maine auch«, sagte Olive zu Jack. Und ab da war alles gut.
In Crosby, einer kleinen Stadt an der Küste von Maine, ist nicht viel los. Und doch enthalten die Geschichten über das Leben der Menschen dort die ganze Welt. Da ist Olive Kitteridge, pensionierte Lehrerin, die sich auch mit siebzig noch in alles einmischt, so barsch wie eh und je. Da ist Jack Kennison, einst Harvardprofessor, der ihre Nähe sucht. Beide vermissen ihre Kinder, die ihnen fremd geworden sind, woran Olive und Jack selbst nicht gerade unschuldig sind … Ein bewegender Roman, der von Liebe und Verlust erzählt, vom Altern und der Einsamkeit, von Momenten des Glücks und des Staunens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zum Buch
In Crosby, einer kleinen Stadt an der Küste von Maine, ist nicht viel los. Und doch enthalten die Geschichten über das Leben der Menschen dort die ganze Welt. Da ist Olive Kitteridge, pensionierte Lehrerin, die sich auch mit siebzig noch in alles einmischt, so barsch wie eh und je. Da ist Jack Kennison, einst Harvard-Professor, der ihre Nähe sucht. Beide vermissen ihre Kinder, die ihnen fremd geworden sind, woran Olive und Jack selbst nicht gerade unschuldig sind. Und da gibt es einige alte und auch neue Bekannte aus Crosby und Umgebung, deren Lebenswege sich mit Olives kreuzen, was zu überraschenden Begegnungen führt, manchmal zu schmerzhaften Erkenntnissen und oft zu erfrischenden neuen Erfahrungen … Ein bewegender Roman, der von Liebe und Verlust erzählt, vom Altern und der Einsamkeit, von Momenten des Glücks und des Staunens.
»Liebe, Verlust, Reue, die Wirren der Ehe, das Verstreichen der Zeit und die erstaunliche Schönheit der Natur, darum geht es. Ein absolutes Muss.« Booklist
»Grandios geschrieben und voller Mitgefühl, manchmal geradezu unerträglich nahegehend. In jeder Hinsicht ein aufregendes Buch.« Kirkus Reviews
Zur Autorin
ELIZABETH STROUT wurde 1956 in Portland, Maine, geboren und wuchs in Kleinstädten in Maine und New Hampshire auf. Nach dem Jurastudium begann sie zu schreiben. Inzwischen hat sie mehrere Romane veröffentlicht, die alle Bestseller waren. Für ihren Roman »Mit Blick aufs Meer« bekam sie 2009 den Pulitzerpreis, »Die Unvollkommenheit der Liebe« wurde für den Man Booker Prize 2016 nominiert, »Alles ist möglich« 2018 mit dem Story Prize ausgezeichnet. Ihr neuer Roman »Die langen Abende« erscheint in 17 Ländern. Elizabeth Strout lebt in Maine und in New York City.
Zur Übersetzerin
SABINE ROTH, geb. 1963 in München, Literaturstudium in München, Toronto, Canterbury und Oxford, hat Werke von u. a. Jane Austen, John le Carré, Hilary Mantel und V. S. Naipaul übersetzt.
Elizabeth Strout
Die langen Abende
Roman
Aus dem Amerikanischen von Sabine Roth
Luchterhand
Noch einmal für Zarina
Zusammenstoß
An einem Samstag im Juni, kurz nach Mittag, setzte Jack Kennison die Sonnenbrille auf, ließ das Verdeck seines Sportwagens herunter, spannte den Gurt über seinen nicht eben kleinen Bauch und fuhr von Crosby, Maine, hinüber ins fast eine Stunde entfernte Portland, um sich seinen Whiskey dort zu kaufen, weil ihm nicht danach war, im hiesigen Lebensmittelladen Olive Kitteridge in die Arme zu laufen. Oder dieser anderen Frau, die ihn schon zweimal, während er mit seiner Flasche in der Hand dastand, in ein Gespräch übers Wetter verwickelt hatte. Über das Wetter! Wie sie hieß, wusste er jetzt nicht mehr, aber sie war auf jeden Fall auch eine Witwe.
Beim Fahren kam fast eine Art Ruhe über ihn, und in Portland angelangt, parkte er und ging hinunter ans Wasser. Langsam wurde es Sommer, und auch wenn es noch kühl war für Mitte Juni, war der Himmel doch blau, und über dem Hafen kreisten die Möwen. Überall waren Leute unterwegs, viele junge Paare mit Kindern oder Kinderwagen, und alle unterhielten sie sich. Das machte auf ihn den größten Eindruck. Wie selbstverständlich sie es offenbar fanden, zusammen zu sein, jemanden zum Reden zu haben! Niemand streifte ihn auch nur mit einem Blick, und so wenig neu die Erkenntnis an sich war, traf sie ihn nun doch auf neue Weise: Er war nur ein alter Mann mit einem Hängebauch, niemand mehr, den man wahrnahm. Fast hatte das etwas Befreiendes. Viele Jahre seines Lebens hindurch war er ein großer, gutaussehender Mann mit straffem Körper gewesen, der über das Universitätsgelände in Harvard schlenderte, und die Leute hatten ihn bemerkt, all diese Jahre war er es gewohnt gewesen, dass ihm die Studenten scheu nachsahen, und auch Frauen – auch von ihnen erntete er Blicke. Bei den Institutsversammlungen war er als einschüchternd herübergekommen, Kollegen hatten ihm das gesagt, und es wunderte ihn nicht, denn genau das war seine Absicht gewesen. An dem Kai, den er entlangbummelte, waren Wohnanlagen entstanden; vielleicht sollte er hierherziehen, ging es ihm durch den Kopf, Wasser ringsherum, Wasser und Menschen. Er zog das Handy aus der Tasche, sah rasch darauf und steckte es wieder weg. Seine Tochter, wie lange hatte er schon nicht mehr mit ihr gesprochen?
Aus einer der Wohnungen trat ein Paar etwa in seinem Alter, der Mann hatte auch einen Bauch, allerdings keinen so dicken wie Jack, und die Frau sah besorgt aus, aber aus der Art ihres Miteinanders schloss er, dass sie seit vielen Jahren verheiratet waren. »Das war’s jetzt«, hörte er die Frau sagen, und der Mann erwiderte etwas, und die Frau sagte: »Doch, das war’s.« Sie gingen an ihm vorbei (ohne ihn wahrzunehmen), und als er sich gleich darauf noch einmal umdrehte, sah er verblüfft – ein bisschen zumindest –, dass die Frau sich bei dem Mann eingehakt hatte, während sie davongingen, auf das kleine Stadtzentrum zu.
Jack stand am Ende des Kais und schaute aufs Meer hinaus; er sah in die eine Richtung, dann in die andere. Ein Wind, den er jetzt erst spürte, trieb schmale Schaumkronen vor sich her. Von hier aus ging die Fähre nach Nova Scotia, er und Betsy waren einmal damit gefahren. Drei Nächte waren sie in Nova Scotia geblieben. Er versuchte sich zu erinnern, ob Betsy sich bei ihm eingehakt hatte; möglich schien es. So dass ihm nun ein Bild von ihnen beiden vor Augen stand, wie sie von der Fähre herunterkamen, der Arm seiner Frau in seinem …
Er wandte sich zum Gehen.
»Hornochse.« Das sagte er laut, und ein kleiner Junge sah erstaunt zu ihm herüber. Was hieß, er war ein alter Mann, der an einem Anleger in Portland im Staate Maine laut Selbstgespräche führte, und er hatte keine Ahnung – er, Jack Kennison, mit seinen zwei Doktortiteln, hatte keine Ahnung, wie es so weit hatte kommen können. »Mannomann!« Auch das sagte er laut, weit genug entfernt von dem kleinen Jungen jetzt. Ein paar Bänke standen da, und er setzte sich auf eine, die frei war. Er zog sein Handy heraus und rief seine Tochter an; in San Francisco, wo sie wohnte, war jetzt noch Vormittag. Zu seiner Überraschung hob sie ab.
»Dad?«, sagte sie. »Alles in Ordnung?«
Er sah zum Himmel hinauf. »Ach, Cassie«, sagte er. »Ich wollte nur wissen, wie’s dir geht.«
»Mir geht’s gut, Dad.«
»Ah, gut. Sehr gut. Das freut mich.«
Ein kurzes Schweigen trat ein, dann fragte sie: »Wo bist du?«
»Oh. Ich bin in Portland am Hafen.«
»Warum?«, wollte sie wissen.
»Ich dachte einfach, ich fahre nach Portland. Um mal rauszukommen, weißt du.« Jack blinzelte auf das Wasser hinaus.
Wieder Schweigen. Dann sagte sie: »Ah ja.«
»Hör zu, Cassie«, sagte Jack, »ich wollte nur sagen, ich weiß, dass ich ein Arschloch bin. Das weiß ich. Nur dass du es weißt. Ich weiß, dass ich ein Arschloch bin.«
»Daddy«, sagte sie. »Also bitte, Daddy. Was soll ich denn jetzt sagen?«
»Nichts«, antwortete er verträglich. »Da gibt’s nichts zu sagen. Du sollst einfach nur wissen, dass ich es weiß.«
Sie schwieg wieder, länger diesmal, und Furcht beschlich ihn.
Sie sagte: »Meinst du, wegen der Art, wie du mich behandelt hast, oder wegen deiner Affäre mit Elaine Croft diese ganzen Jahre?«
Er sah hinab auf die Bretter des Anlegers, auf seine Altmännerturnschuhe auf dem aufgerauten Holz. »Beides«, sagte er. »Oder such’s dir aus.«
»Ach, Daddy«, sagte sie. »Ach, Daddy, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Was erwartest du denn jetzt von mir?«
Er schüttelte den Kopf. »Gar nichts, Kind. Ich erwarte gar nichts von dir. Ich wollte bloß deine Stimme hören.«
»Dad, wir sind eigentlich gerade am Aufbrechen.«
»Ach ja? Wohin denn?«
»Zum Bauernmarkt. Es ist Samstag, und am Samstag gehen wir immer auf den Bauernmarkt.«
»Ist gut«, sagte Jack. »Dann schau zu, dass du loskommst. Keine Sorge. Wir sprechen ein andermal. Bis bald.«
Er meinte, sie seufzen zu hören. »Okay«, sagte sie. »Tschüs.«
Und das war alles. Das war alles!
Jack blieb lange auf der Bank sitzen. Leute gingen an ihm vorbei, oder vielleicht ging auch zeitweise niemand vorbei, aber er dachte an seine Frau, Betsy, und er hätte heulen mögen. Klar schien nur eines: Er hatte es verdient. Er hatte es verdient, dass er hier mit einer Einlage in der Unterhose saß, wegen der Prostataoperation; er verdiente es, so wie er es auch verdiente, dass seine Tochter keinen Kontakt zu ihm wollte, denn über Jahre hinweg hatte er keinen Kontakt zu ihr gewollt – sie war lesbisch; eine Lesbe war sie, und bei dem Gedanken überkam ihn nach wie vor ein leichtes Unbehagen. Betsy dagegen verdiente es nicht, tot zu sein. Er hätte den Tod verdient gehabt, aber nicht Betsy. Und trotzdem packte ihn plötzlich eine Riesenwut auf seine Frau. »Verflixt«, murmelte er mit zusammengebissenen Zähnen.
Als seine Frau im Sterben lag, war sie die Wütende gewesen. »Ich hab einen derartigen Hass auf dich«, hatte sie gesagt. Und er hatte gesagt: »Ich kann’s dir nicht verdenken.« Und sie sagte: »Oh, komm mir jetzt nicht mit so was.« Aber er hatte es völlig aufrichtig gemeint. Er konnte es ihr nicht verdenken, natürlich nicht. Und ihre letzten Worte zu ihm waren gewesen: »Ich hab einen Hass auf dich, weil du leben darfst und ich nicht.«
Er sah einer Möwe nach, und er dachte: Aber ich lebe nicht, Betsy. Was für eine erbärmliche Farce das alles ist.
Die Bar des Regency Hotel lag im Souterrain, die Wände hier waren dunkelgrün, und die Fenster gingen auf den Gehsteig hinaus, aber der Gehsteig verlief so hoch oben, dass Jack hauptsächlich Beine vorbeimarschieren sah. Er setzte sich an den Tresen und bestellte einen Whiskey pur. Der Barmann war ein leutseliger junger Bursche. »Gut«, antwortete Jack auf seine Frage, wie es ihm heute gehe.
»So soll’s sein«, sagte der Barmann; seine Augen waren dunkel und klein unter den halblangen dunklen Haaren. Als er ihm einschenkte, sah Jack, dass der Mann älter war, als er anfangs gewirkt hatte, wobei es Jack dieser Tage ohnehin schwerfiel, Leute altersmäßig einzuschätzen, gerade die Jüngeren. Und dann dachte Jack: Wenn ich einen Sohn gehabt hätte … Das hatte er schon so oft in seinem Leben gedacht, dass es ihn wunderte, dass die Überlegung ihn immer aufs Neue umtrieb. Und wenn er Betsy nicht aus enttäuschter Liebe geheiratet hätte … Er hatte über eine unglückliche Liebe hinwegkommen müssen, und sie auch, zu diesem Tom Groger, dem sie nach dem College so nachgetrauert hatte. Aber wenn nicht? Was wäre dann gewesen? Bedrückt, aber auch befreit, weil er jemanden zur Gesellschaft hatte, den Barmann, rollte Jack diese Gedanken vor sich aus wie eine große Stoffbahn. Er sah sich selbst, einen alten Mann von vierundsiebzig Jahren, der auf sein Leben zurückblickte, voll Staunen darüber, dass es so verlaufen war und nicht anders, und zerfressen von Reue über all die Fehler, die er gemacht hatte.
Und dann dachte er: Wie lebt man ein anständiges Leben?
Es war nicht das erste Mal, dass er sich die Frage vorlegte, aber heute fühlte sie sich anders an, objektiver; es beschäftigte ihn wirklich.
»Und was bringt Sie nach Portland?«, erkundigte sich der Barmann, während er den Tresen mit einem Tuch abwischte.
Jack sagte: »Nichts.«
Der Bursche sah kurz hoch, bevor er sich halb abwandte, um das andere Ende des Tresens zu wischen.
»Ich wollte einfach mal rauskommen«, sagte Jack. »Ich wohne in Crosby.«
»Hübsche Stadt, Crosby.«
»Stimmt.« Jack trank von seinem Whiskey und stellte das Glas behutsam wieder hin. »Meine Frau ist vor sieben Monaten gestorben«, sagte er.
Jetzt sah der Junge wieder zu Jack hoch und schob sich die Haare aus den Augen. »’tschuldigung? Hatten Sie gesagt …?«
»Ich habe gesagt, meine Frau ist vor sieben Monaten gestorben.«
»Ach je«, sagte der Junge. »Das muss hart für Sie sein.«
»Ja, ist es auch. Doch, ja.«
An dem Ausdruck des jungen Mannes veränderte sich nichts, als er sagte: »Mein Dad ist vor einem Jahr gestorben, und meine Mom hält sich super, aber ich weiß, dass es echt schwer für sie war.«
»Natürlich.« Jack zögerte und sagte dann: »Und wie war es für Sie?«
»Ach, traurig, klar. Aber er war auch ziemlich krank, wissen Sie.«
Jack spürte das langsame innere Brennen, das er inzwischen schon kannte, das gleiche Brennen, das er gespürt hatte, als diese Witwe im Lebensmittelladen vom Wetter angefangen hatte. Lass den Blödsinn!, wollte er sagen. Erzähl mir, wie es dir wirklich damit gegangen ist! Er lehnte sich zurück, schob sein Glas vor. Aber so war es nun mal. Die Leute wussten entweder schlicht nicht, wie es ihnen mit etwas ging, oder sie lehnten es ab, darüber zu sprechen.
Und deshalb fehlte ihm Olive Kitteridge.
Vorsicht, sagte er zu sich. Vorsicht, mein Freund. Immer sachte.
Mit einer gezielten Anstrengung lenkte er seine Gedanken zurück zu Betsy. Und dann erinnerte er sich an etwas – merkwürdig, dass ihm das gerade jetzt einfiel: Als ihm vor vielen Jahren die Gallenblase entfernt worden war, hatte im Aufwachraum seine Frau neben ihm gestanden, und als er später erneut wach wurde, hatte der Patient im Nachbarbett zu ihm gesagt: »Ihre Frau hat Sie so liebevoll angeschaut, das ist mir richtig zu Herzen gegangen, wie liebevoll sie Sie angeschaut hat.« Jack hatte es geglaubt; er hatte sich fast ein bisschen schuldbewusst gefühlt deswegen, das wusste er noch, und dann – Jahre später – hatte er es bei einem Streit aufs Tapet gebracht, und Betsy hatte gesagt: »Ich habe gehofft, dass du stirbst.«
Ihre Unverblümtheit hatte ihn schockiert. »Du hast gehofft, dass ich sterbe?« In der Erinnerung hatte er verwundert die Arme ausgebreitet, während er das fragte.
Worauf sie, etwas betreten, sagte: »Es hätte für mich alles viel leichter gemacht.«
Da hatte er es.
Oh, Betsy! Betsy, Betsy, Betsy, wir haben es versiebt – wir haben unsere Chance versiebt. Wann genau, konnte er nicht sagen, vielleicht, weil es eine echte Chance nie gegeben hatte. Betsy war schließlich Betsy gewesen, und er war er. In der Hochzeitsnacht hatte sie sich ihm nicht verweigert, aber auch nicht so hingegeben wie die Monate zuvor. Das hatte er nicht vergessen, wie auch? Und ganz ohne Rückhalt hingegeben hatte sie sich ihm nie wieder nach dieser Nacht, die inzwischen dreiundvierzig Jahre zurücklag.
»Wie lange wohnen Sie schon in Crosby?« Der Barmann hatte ihn das gefragt.
»Sechs Jahre.« Jack schachtelte seine Beine auf die andere Seite des Barhockers. »Ich wohne seit nunmehr sechs Jahren in Crosby, Maine.«
Der Barmann nickte. Ein Paar kam herein und setzte sich ans Ende des Tresens; sie waren jung, und die Frau hatte langes Haar, das sie über eine Schulter zurückwarf – eine selbstsichere Person. Der Barmann ging zu ihnen.
Jetzt gestattete Jack es sich doch, an Olive Kitteridge zu denken. Groß, wuchtig; mein Gott, war sie eine seltsame Frau. Aber es hatte gepasst zwischen ihnen, sehr sogar, sie hatte eine Ehrlichkeit – war es Ehrlichkeit? – irgendetwas hatte sie an sich. Verwitwet auch sie, hatte sie ihm (so fühlte es sich für ihn an) praktisch das Leben gerettet. Sie waren ein paarmal essen gegangen, ins Konzert; er hatte sie auf den Mund geküsst. Er hätte laut auflachen können, wenn er nun daran dachte. Auf den Mund. Olive Kitteridge. Als würde man einen seepockenverkrusteten Wal küssen. Sie hatte einen Enkel, der schon eins oder zwei war, Jack kümmerte das nicht groß, sie aber natürlich schon, weil der Junge nach seinem Großvater Henry getauft war, Olives verstorbenem Mann. Jack hatte sie gefragt, ob sie denn nicht nach New York fahren und sich den kleinen Burschen einmal anschauen wollte, und sie hatte gesagt, mit Sicherheit nicht. Weiß der Geier, warum. Zwischen ihr und ihrem Sohn stand es nicht zum Besten, das wusste er. Aber zwischen ihm und seiner Tochter ja auch nicht. Das hatten sie gemeinsam. Und gleich zu Anfang hatte sie ihm erzählt, dass ihr Vater sich umgebracht hatte, als sie dreißig war. Sich daheim in der Küche erschossen. Vielleicht war sie deshalb so; irgendetwas musste das ja mit einem machen. Und dann war sie eines Vormittags vorbeigekommen und hatte sich wider alles Erwarten zu ihm gelegt, auf das Bett im Gästezimmer. Gott, war er erleichtert gewesen. Eine richtige Flut der Erleichterung hatte ihn durchströmt, als er ihren Kopf an seiner Brust spürte. »Bleib hier«, hatte er schließlich gesagt, aber sie war aufgestanden; sie müsse jetzt heim, sagte sie. »Mir wäre es lieber, du bleibst«, hatte er gesagt, aber sie blieb nicht. Und sie war nie wiedergekommen. Und wenn er sie anzurufen versuchte, hob sie nicht ab.
Ein einziges Mal war er ihr im Lebensmittelladen begegnet – ein paar Tage, nachdem sie bei ihm gelegen war; er hatte mit seinem Whiskey in der Hand dagestanden. »Olive!«, hatte er gerufen. Aber sie war ganz aufgelöst gewesen: Ihr Sohn in New York bekam ein neues Kind, es konnte jeden Tag so weit sein! »Er hat doch gerade erst eins bekommen«, sagte Jack, und sie sagte, doch, die Frau sei schon wieder hochschwanger, und sie hätten es ihr eben erst gesagt! Olive hatte einen Enkel, wozu brauchten sie noch mehr Kinder, schließlich hatte die Frau schon zwei mit in die Ehe gebracht. Mindestens dreimal hatte Olive das gesagt. Er hatte sie am Tag darauf angerufen, und das Telefon klingelte und klingelte, und er merkte, dass ihr Anrufbeantworter nicht lief. War das möglich? Bei Olive war alles möglich. Er nahm an, dass sie endlich nach New York gefahren war, um ihr neues Enkelkind zu sehen, denn als er es einen Tag später nochmals probierte, hob wieder niemand ab. Er schickte ihr eine E-Mail mit fünf Fragezeichen in der Betreffzeile. Und dann eine ohne Betreff. Auch darauf hatte er keine Reaktion bekommen. Über drei Wochen war das jetzt her.
Der Barmann kam zurück und machte die Drinks für das Paar fertig. »Und Sie?«, sagte Jack. »Sind Sie von hier?«
»Nee«, sagte der Bursche, »ich komme aus der Gegend von Boston. Hier bin ich nur wegen meiner Freundin. Sie lebt hier.« Er warf den Kopf ein Stück zurück, schlenkerte sich das dunkle Haar aus den Augen.
Jack nickte und trank von seinem Whiskey. »Meine Frau und ich haben viele Jahre in Cambridge gewohnt«, sagte er, »bevor wir hierhergezogen sind.«
Er hätte schwören können, dass er in dem Gesicht des Barmanns etwas sah, eine Art Grinsen, bevor er sich abwandte und dem Paar die Getränke servierte.
Als er zurückkam, sagte er zu Jack: »Ein Harvardianer? Dann sind Sie ein Harvardianer?« Er holte einen Drahtkorb mit sauberen Gläsern hinterm Tresen hervor und fing an, sie mit dem Stiel nach oben in das Gestell über ihm zu hängen.
»Ich hab da die Klos geputzt«, sagte Jack. Und der kleine Idiot schaute rasch zu ihm hin, ob er Witze machte. »Nein, Unsinn, ich hab keine Klos geputzt. Ich war Dozent dort.«
»Gute Sache. Und für Ihren Ruhestand haben Sie sich dann Maine ausgesucht?«
Jack hatte sich den Ruhestand generell nicht ausgesucht. »Wie viel schulde ich Ihnen?«, fragte er.
Auf der Heimfahrt dachte er an Schroeder, was für ein Volltrottel der Mann doch immer gewesen war, was für ein beschissener Dekan. Als Elaine dann vor Gericht gegangen war, als sie tatsächlich Ernst machte und wegen sexueller Belästigung klagte, weil es mit ihrer Entfristung nichts geworden war, hatte sich Schroeder auch als menschliches Arschloch entpuppt. Er verhielt sich bizarr, wollte nicht einmal mit Jack sprechen. Jetzt sind die Anwälte am Zug, sagte er. Und Jack hatte ein Forschungssemester verordnet bekommen. Drei Jahre hatte es gedauert, bis die Angelegenheit vom Tisch war, bis Elaine ihren Batzen kassiert hatte, und bis dahin waren Jack und Betsy schon nach Maine übersiedelt, und Jack war im Ruhestand. Nach Maine waren sie gezogen, weil Betsy das wollte – sie wollte weit weg von allem, und bei Gott, das waren sie hier. Crosby war ein hübsches Küstenstädtchen, das Betsy übers Internet ausgekundschaftet hatte, und man war hier so weit ab vom Schuss, wie ein Mensch es nur sein konnte, obwohl man nur ein paar Stunden die Küste hochfuhr. Sie waren hergezogen, ohne irgendwen zu kennen. Aber Betsy fand schnell Anschluss, das hatte sie immer gekonnt.
Fahren Sie bitte rechts ran.
Fahren Sie an den rechten Fahrbahnrand.
Die Worte wurden mehrmals wiederholt, bevor sie in Jacks Bewusstsein drangen; sie kamen aus einem Megaphon, und ihr fremder Klang – fremd im Vergleich zu dem monotonen Reifenschlurren auf dem Asphalt – verwirrte ihn, aber noch mehr verwirrten ihn das blitzende Blaulicht und das Polizeiauto so dicht an seinem Heck. Fahren Sie an den rechten Fahrbahnrand. »Geht’s noch«, sagte Jack laut und hielt auf dem Seitenstreifen des Highways. Er stellte den Motor ab, nicht ohne einen raschen Blick hinunter in den Fußraum vor dem Beifahrersitz, zu der Plastiktüte mit dem Whiskey, den er in einem Laden kurz hinter Portland gekauft hatte. Im Rückspiegel sah er, wie der junge Polizist auf ihn zukam – so ein aufgeblasener kleiner Pisser mit Spiegelbrille –, und sagte höflich: »Womit kann ich dienen?«
»Sir, Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere bitte.«
Jack öffnete das Handschuhfach, fand nach einigem Suchen die Papiere, zog dann den Führerschein aus der Brieftasche und überreichte alles dem Polizisten.
»Ihnen ist schon klar, dass Sie in einer Fünfundfünfziger-Zone siebzig gefahren sind?« Jack fand den Ton des Mannes unnötig grob.
»Nein, Sir, das war mir leider nicht klar. Schande über mich!« Der Sarkasmus war seine große Schwäche, hatte Betsy immer gesagt, aber dieser Polizist hatte für so etwas offenbar keine Antennen.
»Aber dass die Inspektion überfällig ist, wissen Sie?«
»Nein.«
»Seit letzten März schon.«
»Im Ernst?« Jack spähte um seine Rückenlehne. »Tja, jetzt wo Sie’s sagen … Meine Frau ist gestorben, wissen Sie. Sie ist gestorben.« Jack sah zu dem Polizisten hoch. »Tot.« Er sagte es mit Betonung.
»Nehmen Sie die Sonnenbrille ab, Sir.«
»Wie bitte?«
»Ich habe gesagt, nehmen Sie die Sonnenbrille ab, Sir. Jetzt.«
Jack setzte die Brille ab und lächelte den Polizisten übertrieben breit an. »Und jetzt Sie«, sagte Jack. »Zeig mir deinen, dann zeig ich dir meinen.« Er grinste zu dem Mann empor.
Nachdem er Jacks Führerschein hochgehalten und dann Jack angesehen hatte, sagte der Polizist: »Warten Sie, ich frage die Daten kurz ab.« Und er ging zurück zu seinem Auto, auf dessen Dach noch immer das Blaulicht blinkte. Im Gehen sprach er in sein Funkgerät. Binnen Sekunden kam ein zweiter Streifenwagen angefahren, auch er mit eingeschaltetem Blaulicht.
»Müssen Sie jetzt auch noch Verstärkung anfordern?«, rief Jack dem Mann nach. »Bin ich derart gefährlich?«
Der zweite Polizist stieg aus und kam zu Jack herüber. Dieser Mann war riesig und nicht jung. Ihm machte keiner was vor, das besagten sein Gang und auch die Augen, die ausdruckslos waren und keine Sonnenbrille brauchten. »Was ist in der Tüte da unten?«, fragte der Riese mit dröhnender Stimme.
»Das ist Alkohol. Whiskey. Möchten Sie ihn sehen?«
»Aussteigen.«
Jack blinzelte zu ihm hinauf. »Was?«
Der Riese trat einen Schritt zurück. »Aussteigen, hab ich gesagt.«
Jack stieg aus seinem Wagen – langsam, weil er sich plötzlich kurzatmig fühlte. Der Riese sagte: »Legen Sie die Hände aufs Fahrzeugdach«, und darüber musste Jack lachen. »Da ist kein Dach«, sagte er. »Sehen Sie? So etwas nennt man ein Cabriolet, und im Moment ist das Dach heruntergeklappt.«
Der Riese sagte: »Sie legen jetzt die Hände aufs Fahrzeugdach.«
»So?« Jack stützte die Hände auf die Fensterkante.
»So stehen bleiben.« Der Mann ging zu dem Auto, das Jack gestoppt hatte, und sprach mit dem anderen Polizisten, der auf dem Fahrersitz saß.
Jack fiel ein, dass die heutigen Streifenwagen alles auf Video aufzeichneten – das hatte er irgendwo gelesen –, und er zeigte den beiden Autos hinter ihm blitzschnell den Finger. Dann legte er die Hand wieder auf die Fensterkante. »So eine Scheiße«, sagte er.
Nun stieg der erste Polizist wieder aus und stiefelte zu Jack herüber, Holster am Schenkel. Jack mit seinem über die Hose hängenden Bauch und den sinnlos auf das Cabriofenster gestützten Händen musterte den Kerl und sagte: »Gut bestückt sind Sie.«
»Was haben Sie gesagt?« Der Polizist schaute angesäuert.
»Nichts.«
»Möchten Sie mit aufs Revier?«, fragte der Polizist. »Möchten Sie das?«
Jack fing zu lachen an und biss sich dann auf die Lippe. Er schüttelte den Kopf, den Blick zu Boden gesenkt. Und da sah er die Ameisen wuseln. Seine Wagenräder hatten sie aufgestört, und er starrte hinab auf all die vielen, winzig kleinen Ameisen, die durch einen Riss im Pflaster wimmelten, Sandkorn für Sandkorn wegschleppten von der Stelle, wo sein Reifen so viele von ihnen zermalmt hatte, fort zu – ja, wohin? Einem neuen Nest?
»Drehen Sie sich um und nehmen Sie die Hände hoch«, befahl der Polizist, also drehte sich Jack mit erhobenen Händen um, mit dem Gesicht zu den Autos, die auf dem Highway vorbeifuhren. Was war, wenn jemand ihn erkannte? Jack Kennison neben zwei Streifenwagen mit blinkendem Blaulicht, die Hände überm Kopf wie ein Krimineller. »Und jetzt hören Sie gut zu«, sagte der Polizist. Er schob die Sonnenbrille hoch, um sich das Lid zu reiben, und für diesen kurzen Moment konnte Jack seine Augen sehen, die irgendwie merkwürdig wirkten, wie Fischaugen. Der Polizist deutete mit dem Finger auf Jack. Er zielte damit auf ihn, aber er sagte nichts, als wüsste er nicht mehr, was er hatte sagen wollen.
Jack legte den Kopf schief. »Ich höre«, sagte er. »Ich bin ganz Ohr.« Das sagte er so sarkastisch, wie er nur konnte.
Fischauge ging um Jacks Auto herum, öffnete die Beifahrertür und holte den Whiskey in seiner Plastiktüte heraus. »Was ist das?«, fragte er, während er zu Jack zurückkam.
Jack ließ die Arme sinken und sagte: »Ich habe das Ihrem Freund schon gesagt, das ist Whiskey. Wie Sie ja wohl sehen können, Himmel, Arsch und Zwirn.«
Daraufhin stellte sich Fischauge ganz dicht vor Jack, der zurückweichen wollte, was aber nicht ging, weil das Auto im Weg war. »Wiederholen Sie das, was Sie da gerade gesagt haben«, verlangte Fischauge.
»Ich habe gesagt, dass das Whiskey ist und dass Sie das ja wohl sehen können. Und dann habe ich den Himmel als Zeugen angerufen.«
»Sie haben getrunken«, sagte Fischauge. »Sie haben getrunken, Sir.« Und in seiner Stimme schwang ein so hässlicher Ton mit, dass Jack schlagartig nüchtern wurde. Fischauge ließ die Tüte mit dem Whiskey auf den Fahrersitz von Jacks Wagen fallen.
»Das ist richtig«, sagte Jack. »Ich war auf einen Drink in der Regency-Bar in Portland.«
Daraufhin zog Fischauge etwas aus seiner Gesäßtasche, etwas so Kleines, dass es in einer Hand Platz hatte, aber grau und irgendwie viereckig, und Jack sagte: »Guter Gott, wollen Sie mich tasern?«
Fischauge lächelte, er lächelte! Er trat auf Jack zu, das Ding in der Hand, und Jack sagte: »Ich bitte Sie.« Er verschränkte die Arme vor der Brust; er hatte echte Angst.
»Blasen Sie da rein«, sagte Fischauge, und aus dem Ding in seiner Hand kam ein kleiner Schlauch zum Vorschein.
Jack schloss die Lippen um den Schlauch und blies.
»Noch mal.« Fischauge rückte noch dichter an Jack heran.
Wieder stieß Jack den Atem aus und nahm den Schlauch dann aus dem Mund. Fischauge musterte das Gerät mit scharfem Blick und sagte: »Grade noch unter der Promillegrenze.« Und er schob es zurück in seine Tasche. »Mein Kollege stellt Ihnen einen Strafzettel aus, und wenn Sie den haben, würde ich vorschlagen, Sie setzen sich in Ihren Wagen und fahren auf direktem Weg in die Werkstatt, haben Sie mich verstanden, Sir?«
Jack sagte: »Ja.« Dann fragte er: »Darf ich jetzt wieder einsteigen?«
Fischauge beugte sich nahe an ihn heran. »Ja, jetzt dürfen Sie wieder einsteigen.«
Also setzte sich Jack auf den Fahrersitz, der sehr tief lag, weil sein Auto ein Sportwagen war, und stellte den Whiskey in seiner Tüte auf den Sitz daneben und wartete darauf, dass der Riese ihm seinen Strafzettel brachte, aber Fischauge rührte sich nicht von der Tür weg, als bestünde bei Jack Fluchtgefahr.
Und dann sah Jack – aus dem Augenwinkel – etwas, dessen er sich nie ganz sicher sein und das er nie vergessen würde. Der Hosenstall des Polizisten war exakt auf Höhe von Jacks Augen, und Jack meinte – er meinte, es zu sehen, aber er schaute ganz schnell wieder weg –, dass der Kerl einen Ständer hatte. Eine Beule war da, größer als … Jack sah hastig hoch in das Gesicht des Mannes, der durch seine Sonnenbrille auf ihn herunterstarrte.
Der Riese kam zurück und händigte Jack seinen Strafzettel aus, und Jack sagte: »Allerbesten Dank, die Herren. Ich pack’s dann mal.« Und in langsamem Tempo fuhr er davon. Aber Fischauge blieb auf dem Highway hinter ihm, den ganzen Weg bis zur Ausfahrt nach Crosby, und erst als Jack dort herunterfuhr, ließ der Kerl von ihm ab und fuhr weiter geradeaus, und Jack schrie ihm nach: »Kauf dir gefälligst einen Slip, wie jeder andere Mann in diesem Staat auch!«
Dann atmete er tief durch und sagte: »Okay. Okay. Alles gut.« Er fuhr die acht Meilen nach Crosby, und unterwegs sagte er: »Betsy, Betsy! Warte, bis ich dir erzähle, was mir grade passiert ist. Das glaubst du nicht, Betts.« Das genehmigte er sich, diese Unterhaltung mit ihr über sein Erlebnis. »Danke, Betsy«, sagte er, und er meinte, danke dafür, dass sie bei der Prostatageschichte so lieb reagiert hatte. Denn das hatte sie, keine Frage. Sein Leben lang war Jack der Boxershorts-Typ gewesen. Mit Feinrippslips konnte man ihn jagen, aber in Crosby, Maine, gab es keine Boxershorts zu kaufen. Er hatte es nicht fassen können. Und Betsy war für ihn nach Freeport gefahren und hatte ihm dort Boxershorts besorgt. Dann, fast ein Jahr war das jetzt her, hatte ihn die Prostata-OP gezwungen, die Boxershorts aufzugeben. Er brauchte Unterwäsche, in der die schwachsinnigen Einlagen hielten. Wie er sie hasste! Und wie aufs Stichwort spürte er – kein Tröpfeln, nein, es war ein kleiner Schwall, der da aus ihm herauskam. »Himmelarsch«, sagte er laut. Der ganze Staat, so schien es, trug Feinripp; erst neulich war Jack zu dem Walmart am Stadtrand gefahren, um eine Packung nachzukaufen, und hatte gesehen, dass auch der Walmart keine Boxershorts führte. Nur Stapel von Feinrippunterhosen in allen Größen bis XXXL, für all diese armen dicken Männer, all diese Fettsäcke hier in Maine. Aber Betsy war nach Freeport gefahren und hatte dort Boxershorts für ihn aufgetrieben. Ach, Betsy, Betsy!
Wieder daheim, konnte Jack nur den Kopf schütteln über das, was ihm da passiert war, es schien alles so lächerlich und irgendwie – beinahe – vernachlässigbar. Lange Zeit saß er in seinem großen Sessel und betrachtete das Wohnzimmer; es war großzügig geschnitten, mit einer L-förmigen blauen Couch auf Metallfüßen, deren Längsteil dem Fernseher zugewandt war, während der Querteil zusammen mit einem gläsernen Couchtisch, ebenfalls mit Metallgestell, den Sitzbereich bildete. Dann drehte er sich mitsamt dem Stuhl um und blickte durch die Fenster auf die große Wiese und dahinter die Bäume mit ihrem hellgrünen Laub. Er und Betsy waren sich einig gewesen, dass ihnen die Aussicht auf diese Wiese lieber war als jeder Meerblick, und als er daran dachte, flirrte eine Wärme durch ihn. Schließlich stand er auf, goss sich einen Whiskey ein und machte sich vier Würstchen heiß. Während er eine Dose Baked Beans öffnete, schüttelte er immer noch den Kopf. »Betsy«, sagte er mehrere Male laut. Nachdem er gegessen und das Geschirr abgespült hatte – er räumte es nicht in die Spülmaschine, das war ihm zu viel Aufwand –, trank er noch einen Whiskey und musste wieder an diesen Tom Groger denken, den Betsy so geliebt hatte. Mann, Mann, Mann, was für eine seltsame Sache das Leben war …
Aber aus einem versöhnlichen Impuls heraus – der Tag war fast um, und der Whiskey tat seine Wirkung – setzte sich Jack an den Computer und googelte den Knaben, Tom Groger. Er fand ihn schnell; anscheinend unterrichtete er nach wie vor an dieser privaten Mädchenschule in Connecticut; er musste an die acht Jahre jünger als Jack sein. Aber eine reine Mädchenschule? Heute? Jack scrollte weiter und stellte fest, dass sie seit etwa zehn Jahren auch Jungen aufnahmen. Dann stieß er auf ein kleines Bild von Tom Groger; er war grau geworden, aber er war schlank, das sah man an seinem Gesicht, das nicht unsympathisch war, aber furchtbar nichtssagend, fand Jack. Auch eine E-Mail-Adresse war angegeben. Also schrieb er an Grogers Schuladresse: »Meine Frau Betsy (Arrow, wie Sie zu Ihrer Zeit noch mit Nachnamen hieß) ist vor sieben Monaten gestorben, und ich weiß, dass sie Sie in ihrer Jugend einmal sehr geliebt hat. Ich dachte, ich sollte Sie von ihrem Tod wissen lassen.« Er drückte auf SENDEN.
Jack lehnte sich zurück und sah hinaus in das Abendlicht über den Bäumen. Diese langen, langen Abende; sie waren so lang und schön, es konnte einen verrückt machen. Die Wiese lag schon großteils im Dämmer, die Bäume dahinter schienen wie Flecken aus schwarzer Leinwand, aber der Himmel schickte noch immer einzelne Strahlen herab, die sanft das Gras am hinteren Wiesenrand strähnten. Im Geist ließ er noch einmal den Tag Revue passieren, und irgendwie ergab nichts einen Sinn. Hatte der Kerl allen Ernstes einen Ständer gehabt? Eigentlich kaum denkbar, aber Jack kannte – auf eine Art zumindest – diese Mischung aus Wut und Machtgefühl, die dazu geführt haben konnte. Falls er sich nicht doch verschaut hatte. Und dann dachte Jack an die Ameisen, die vermutlich noch immer emsig dabei waren, den Sand dahin zu schaffen, wo sie ihn brauchten. Sie zerrissen ihm regelrecht das Herz, so winzig waren sie, so beharrlich.
Zwei Stunden später rief Jack noch einmal seine Mails ab, für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihm seine Tochter geschrieben hatte oder dass Olive Kitteridge in sein Leben zurückgekehrt war. Immerhin hatte sie ihm zuerst gemailt, das von ihrem Sohn, und er hatte ihr mit der Mail über seine Tochter geantwortet. Irgendwann hatte er Olive gegenüber sogar seine Affäre mit Elaine Croft erwähnt, und Olive schien ihn dafür nicht zu verurteilen. Sie hatte von einem Lehrer erzählt, in den sie vor vielen Jahren verliebt gewesen war – eine Beinahe-Affäre nannte sie es – und der eines Nachts tödlich mit dem Auto verunglückt war.
Was ihm kurzfristig entfallen war (entfallen, ha!), war Tom Groger, aber im Posteingang wartete eine Antwort von [email protected] auf ihn. Jack blinzelte durch seine Lesebrille. »Vom Tod Ihrer Frau hatte ich schon gehört. Betsy und ich standen über viele Jahre in Verbindung. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das sagen soll oder besser nicht, aber sie hat mir von Ihrer Liebelei erzählt, und vielleicht sollte ich es gar nicht erwähnen – wie gesagt, ich bin mir nicht sicher –, aber über eine gewisse Zeit hinweg haben Betsy und ich uns in einem Hotel in Boston getroffen, und später auch in New York. Aber vielleicht wussten Sie das ja sowieso.«
Jack stieß seinen Schreibtischstuhl zurück; die Räder wummerten über die Dielen. Er zog sich wieder an den Tisch heran und las die Nachricht ein zweites Mal. »Betsy«, murmelte er, »du alte Schlawinerin.« Er nahm die Brille ab, fuhr sich mit dem Arm übers Gesicht. »Ich glaub, ich spinn«, sagte er. Nach ein paar Minuten setzte er die Brille wieder auf und las die Mail nochmals. »Liebelei?«, sagte er laut. »Wer sagt heute noch ›Liebelei‹? Was bist du, Groger, eine Schwuchtel?« Er drückte auf LÖSCHEN, und die Nachricht verschwand.
Jack fühlte sich so nüchtern wie eine Kirchenmaus. Er wanderte durchs Haus und bemerkte all die Dinge, in denen sich die Hand seiner Frau zeigte, die Lampenschirme mit ihren Rüschenborten, die Mahagonischale, die sie von irgendwo mitgebracht hatte und die nach wie vor auf dem Couchtisch stand, jetzt mit Plunder aller Art gefüllt: Schlüsseln, einem alten Telefon, das nicht mehr ging, Visitenkarten, Büroklammern. Er versuchte sich zu erinnern, wann seine Frau in New York gewesen war; eher früh in ihrer Ehe, meinte er. Sie war Vorschullehrerin gewesen, und sie hatte von Fortbildungen in New York gesprochen, an denen sie teilnehmen musste. Er hatte nicht groß darauf geachtet; er hatte damit zu tun gehabt, sich seinen Lehrstuhl zu sichern, und später dann hatte er einfach zu tun.
Jack setzte sich in seinen Sessel und stand sofort wieder auf. Er wanderte weiter durchs Haus, blickte hinaus auf die inzwischen ganz dunkle Wiese, ging dann nach oben und wanderte auch dort herum. Sein Bett, ihr Ehebett, war ungemacht wie immer, bis auf die Tage, an denen die Putzfrau kam, und es schien ihm symbolisch für seinen eigenen desolaten Zustand oder den ihrer Beziehung in all der Zeit. »Betsy«, sagte er laut, »Herrgott noch mal, Betsy.« Er setzte sich vorsichtig auf die Bettkante, fuhr sich mit der Hand über den Nacken. Vielleicht legte es Groger ja nur darauf an, ihn zu ärgern, spielte ein bisschen Katz und Maus mit ihm? Nein. So einer war Groger nicht; er war, nach allem, was Jack wusste, ein ernsthafter Mensch, Englischlehrer auch noch, unterrichtete seit all den Jahren diese verzogenen kleinen Gören. Obwohl, halt – hatte Betsy deshalb gesagt, es hätte »alles einfacher gemacht«, wenn Jack bei seiner Gallenoperation gestorben wäre? So früh schon? Wie früh war das gewesen? Höchstens zehn Jahre, nachdem sie geheiratet hatten. »Du hast meine Frau gevögelt?«, sagte Jack laut. »Du kleiner Wichser.« Er stand auf und nahm seine Wanderschaft durch das Obergeschoss wieder auf. Es gab noch ein zweites Schlafzimmer und dann den Raum, den seine Frau als Arbeitszimmer benutzt hatte; Jack ging in beide hinein und drehte sich um die eigene Achse, als würde er etwas suchen. Dann stieg er die Treppe wieder hinunter und ging durch die beiden Gästezimmer, das mit dem Doppelbett und das mit dem Einzelbett. In der Küche schenkte er sich noch einen Whiskey aus der Flasche ein, die er am Nachmittag gekauft hatte; das schien ihm jetzt Tage her zu sein.
Seine eigene Affäre mit Elaine Croft hatte er erst nach fünfundzwanzig Jahren Ehe begonnen. Diese Begierde, die ihn und Elaine getrieben hatte. Mein Gott, hatten sie es nötig gehabt. Grauenvoll. War es Betsy auch so gegangen? Ausgeschlossen, Betsy war keine Frau, die es nötig hatte. Aber woher wollte er wissen, was für eine Art Frau Betsy war?
»He, Cassie«, sagte Jack, »deine Mutter war eine Schlampe.«
Aber noch während er die Worte aussprach, wusste er, dass es nicht stimmte. Cassies Mutter war – gut, irgendwo war sie natürlich doch eine Schlampe, wenn sie es mit Groger in Hotels in Boston und New York getrieben hatte, während daheim die kleine Cassie saß, aber Betsy war eine wunderbare Mutter gewesen, so sah es aus. Jack schüttelte den Kopf. Jetzt fühlte er sich plötzlich betrunken. Und er wusste, nie, niemals würde er Cassie etwas davon sagen; sollte sie ihr Bild von ihrer Mutter behalten dürfen, das der Heiligen, die es mit einem homophoben Vater aushielt, einem egozentrischen Arschloch.
»Okay«, sagte Jack. »Okay.«
Er setzte sich wieder an den Computer. Er holte die gelöschte Mail aus dem Papierkorb, las sie noch einmal und schrieb dann – wobei er höllisch aufpasste, sich nicht zu vertippen, damit er auch ja nicht betrunken wirkte: »Lieber Tom, ganz recht, ich weiß von Ihren Treffen mit ihr. Deshalb dachte ich ja, dass Sie von ihrem Tod erfahren sollten.« Er schickte die Nachricht ab und fuhr den Computer herunter.
Danach saß er lange Zeit in seinem Lehnstuhl. Die Ameisen fielen ihm wieder ein, die er heute gesehen hatte, während Fischauge ihn gegen das Auto drängte. Diese Ameisen. Die einfach das machten, wozu sie auf der Welt waren: leben, bis sie starben, völlig unbekümmert um Jacks Auto. Er konnte nicht aufhören, an sie zu denken. Jack Kennison, der das menschliche Verhalten seit dem Mittelalter studiert hatte und die K.u.k.-Zeit bis hin zur Ermordung von Erzherzog Franz Ferdinand und dem nachfolgenden Gemetzel quer durch Europa – Jack dachte an diese Ameisen.
Dann dachte er, dass morgen Sonntag war, und wie endlos sich dieser Tag hinziehen würde.
Und dann dachte er – als würde sich vor seinen Augen ein Farbkaleidoskop drehen – an sein eigenes Leben, daran, wie es einmal gewesen war und wie es jetzt war, und er sagte laut: »Mit dir ist es nicht mehr weit her, Jack Kennison.« Das überraschte ihn, aber es fühlte sich wahr an. Wer hatte das neulich von jemandem gesagt? Olive Kitteridge. Sie hatte es über eine Frau in der Stadt gesagt. »Mit der ist es nicht weit her«, hatte Olive bemerkt, und das war’s mit der Frau, aus, erledigt.
Schließlich nahm Jack ein Blatt Papier und schrieb mit Füller: »Liebe Olive Kitteridge, Du fehlst mir, und wenn Du Dich dazu verstehen könntest, mich anzurufen oder mir zu mailen oder Dich mit mir zu treffen, wäre das sehr schön.« Er setzte seinen Namen darunter und steckte das Blatt in einen Umschlag. Er klebte ihn nicht zu. Er würde am Morgen entscheiden, ob er den Brief abschickte oder nicht.
Geburtswehen
Zwei Tage zuvor hatte Olive Kitteridge bei einer Geburt geholfen.
Die Geburt hatte auf dem Rücksitz von Olives Auto stattgefunden, das auf der Grasfläche vor dem Haus von Marlene Bonney parkte. Olive war zu einer Babyparty für Marlenes Tochter eingeladen, und sie wollte sich nicht hinter die übrigen Autos auf den Schotterweg stellen, aus Angst, jemand könnte sie zuparken, und dann käme sie nicht weg; Olive war es wichtig wegzukönnen. Also hatte sie vorn auf dem Gras geparkt, was ein Glück war, denn bei diesem hohlköpfigen Mädel – Ashley hieß sie, eine Freundin von Marlenes Tochter, blond – hatten die Wehen eingesetzt, was aber von den anderen niemand merkte; sie saßen alle auf Klappstühlen im Wohnzimmer, und Ashley, die den Platz neben Olive hatte und die schwanger bis zum Bersten war und ein rotes Stretchtop trug, um diesen Umstand noch zu betonen, war aus dem Zimmer gegangen, und in dem Moment hatte Olive Bescheid gewusst.
Sie war aufgestanden und hatte das Mädchen in der Küche gefunden, wo sie über der Spüle lehnte und »O Gott, o Gott!« murmelte, und Olive hatte zu ihr gesagt: »Das sind Wehen«, und dieses spatzenhirnige Ding hatte gesagt: »Ja, ich glaub auch. Aber mein Termin ist erst in einer Woche.«
Spatzenhirniges junges Ding.
Und überhaupt diese Babyparty! Auch jetzt noch, während sie daheim im Wohnzimmer saß und hinaussah auf das Wasser, machte es Olive fassungslos, was für eine schwachsinnige Veranstaltung das gewesen war. Sie sagte laut: »Schwachsinn, Schwachsinn, Schwachsinn, Schwachsinn.« Und dann stand sie auf und ging in die Küche und setzte sich dort hin. »Meine Herren«, sagte sie.
Sie wippte mit dem Fuß.
Die große Armbanduhr ihres verstorbenen Mannes, Henry, die sie seit seinem Schlaganfall vor vier Jahren am Handgelenk trug, zeigte vier Uhr an. »Na dann«, sagte sie. Und sie nahm ihre Jacke – es war Juni, aber kein warmer Tag – und ihre große schwarze Handtasche und stieg in ihr Auto – dessen Rückbank immer noch mit einem Rest Glibberzeugs von dem spatzenhirnigen Mädel verschmiert war, obwohl Olive geschrubbt hatte, was das Zeug hielt – und fuhr zu Libby’s, wo sie sich ein Hummer-Sandwich kaufte, und dann fuhr sie weiter zur Landspitze und aß im Auto sitzend, mit Blick auf den Halfway Rock.
Ein Mann in einem Pick-up parkte ganz in der Nähe, und Olive winkte durchs Fenster zu ihm hinüber, aber er winkte nicht zurück. »Blödmann«, sagte sie, und ein Stückchen Hummer landete auf ihrer Jacke. »Heiliger Strohsack!«, murmelte sie, weil sie jetzt Mayonnaise an der Jacke hatte, ein kleiner dunkler Fleck zeichnete sich ab, und wenn sie ihn nicht schnell mit heißem Wasser wegtupfte, war die Jacke ruiniert. Es war eine neue Jacke, sie hatte sie gerade gestern auf ihrer alten Nähmaschine genäht, ein gesteppter Stoff mit blauen und weißen Schnörkeln, extra so lang, dass sie ihr übers Gesäß reichte.
Was regte sie sich bloß so auf?
Der Mann in dem Pick-up war am Telefonieren, und auf einmal lachte er, sie sah ihn den Kopf zurückwerfen, sogar seine Zähne konnte sie sehen, so weit öffnete er beim Lachen den Mund. Dann ließ er den Motor an und stieß zurück, immer noch mit dem Handy am Ohr, und Olive blieb allein mit dem Blick über die Bucht, die sich vor ihr ausbreitete mit ihren sonnenglitzernden Wellen und der kleinen Insel, auf der die Bäume strammstanden wie die Soldaten; die Felsen glänzten nass, das Wasser zog sich zurück. Sie hörte ihre kleinen Kaugeräusche, und eine bodenlose Einsamkeit überkam sie.
Es war Jack Kennison. Sie wusste, es war der Gedanke an ihn, an diesen grässlichen alten Großkotz von einem Mann, mit dem sie sich im Frühling ein paar Wochen lang getroffen hatte. Sie hatte ihn gemocht. Sie hatte sich sogar einmal zu ihm aufs Bett gelegt, einen Monat war das jetzt her, ganz dicht neben ihn, den Kopf an seiner Brust, so dass sie sein Herz schlagen hörte. Und eine solche Erleichterung war in ihr aufgewallt – und dann, wie Donnergrummeln, die Angst. Angst war nichts für Olive.
Und so hatte sie sich nach einer Weile aufgesetzt, und er hatte gesagt: »Bleib, Olive.« Aber sie blieb nicht. »Ruf mich an«, hatte er gesagt. »Ich fände es schön, wenn du anrufst.« Sie hatte ihn nicht angerufen. Er konnte sich schließlich auch melden, wenn er wollte. Und er hatte sich nicht gemeldet. Aber sie waren sich wenig später über den Weg gelaufen, im Lebensmittelladen, und sie hatte ihm von ihrem Sohn erzählt, von dem neuen Kind, das jetzt jeden Moment geboren werden musste, da unten in New York City, und Jack hatte nett reagiert, aber er hatte nichts davon gesagt, dass sie ihn wieder besuchen sollte, und kurz darauf hatte sie ihn im selben Laden gesehen (aber er sie nicht), er hatte mit diesem blöden Weib geredet, Bertha Babcock, die auch Witwe war und die, soweit Olive wusste, die Republikaner wählte wie er, und wer weiß, vielleicht war ihm diese dumme Gans ja lieber als Olive. Ein einziges Mal hatte er ihr gemailt, mit einem Haufen Fragezeichen als Betreff und sonst nichts. So etwas sollte eine E-Mail sein? Das konnte er jemand anderem erzählen.
»Blödmann«, sagte sie jetzt und aß den letzten Bissen von ihrem Hummer-Sandwich. Sie rollte das Papier zusammen, in dem es eingewickelt gewesen war, und warf es auf die Rückbank, wo es neben dem Fleck von diesem spatzenhirnigen Mädel landete.
»Ich habe heute bei einer Geburt geholfen«, hatte sie ihrem Sohn am Telefon erzählt.
Schweigen.
»Hast du gehört?«, fragte Olive. »Ich habe gesagt, ich habe heute bei einer Geburt geholfen.«
»Wo?« Seine Stimme klang misstrauisch.
»Bei mir im Auto, vor dem Haus von Marlene Bonney. Eins von den Mädchen da …« Und sie erzählte ihm die Geschichte.
»Hmm. Sehr gut, Mom.« Und dann sagte er mit sarkastischem Unterton: »Du kannst herkommen und dein nächstes Enkelkind auf die Welt bringen helfen. Ann bekommt es in einem Pool.«
»Einem Pool?« Olive begriff nicht, wovon er redete.
Christopher sagte gedämpft etwas zu jemandem.
»Ist Ann denn schon wieder schwanger? Christopher, warum hast du mir das nicht gesagt?«
»Noch ist sie nicht schwanger. Wir arbeiten dran. Aber es wird schon klappen.«
Olive sagte: »Wie meinst du das, sie bekommt es in einem Pool? Einem Swimmingpool?«
»Ja. So eine Art. Ein Babybecken. So ähnlich wie das, das wir hinten im Garten hatten. Nur größer, klar, und eben absolut keimfrei.«
»Warum?«
»Warum? Weil es natürlicher ist. Das Baby flutscht einfach ins Wasser. Die Hebamme ist dabei. Es ist vollkommen sicher. Beziehungsweise noch besser als sicher, eigentlich sollten alle Geburten so ablaufen.«
»Verstehe«, sagte Olive. Sie verstand rein gar nichts. »Und wann kommt dieses Baby?«
»Sobald wir wissen, dass sie schwanger ist, fangen wir zu zählen an. Im Moment sagen wir niemandem, dass wir es versuchen, wegen dieser Sache beim letzten Mal. Aber dir habe ich es jetzt gesagt. Da siehst du mal.«
»Na dann«, sagte Olive. »Macht’s gut.«
Christopher – sie hätte es schwören können – stieß einen angeekelten Laut aus, bevor er sagte: »Du auch, Mom.«
Wieder zu Hause, sah Olive befriedigt, dass der kleine Mayonnaisefleck auf ihrer neuen Jacke mit heißem Wasser und Seife wegging, und sie hängte die Jacke im Bad auf, damit sie trocknen konnte. Dann kehrte sie zurück zu ihrem Sessel und schaute auf die Bucht hinaus. Die Sonne schien schräg aufs Wasser, ein Meer aus glitzernden Pünktchen, nur eine Hummerboje oder zwei ließen sich ausmachen, so grell war das seitlich einfallende Licht um die Tageszeit. Olive kam nicht darüber hinweg, wie blöd diese Babyparty gewesen war. Lauter Frauen. Warum kamen zu einer Babyparty nur Frauen? Hatten die Männer mit dem Kinderkriegen etwa nichts zu tun? Olive mochte Frauen nicht besonders, so sah es aus.
Sie mochte Männer.
Ihr waren Männer schon immer lieber gewesen. Sie hatte sich fünf Söhne gewünscht. Bis heute wünschte sie sich die, denn Christopher … Jetzt fühlte Olive das Gewicht echter Traurigkeit herabsinken, wie immer, seit Henry seinen Schlaganfall gehabt hatte, vor vier Jahren, und erst recht seit seinem Tod, der nun zwei Jahre her war; sie spürte richtig, wie ihre Brust schwer wurde davon. Christopher und Ann hatten ihr erstes gemeinsames Kind Henry genannt, nach Christophers Vater. Henry Kitteridge. Was für ein wunderbarer Name. Ein wunderbarer Mann. Olive hatte ihren Enkelsohn noch nie gesehen.
Sie verlagerte ihr Gewicht, stützte das Kinn in die Hand und dachte wieder an diese Babyparty. Auf einem Tisch war Essen hergerichtet gewesen; von ihrem Platz aus hatte Olive einen gelegentlichen Blick auf kleine Kanapees, russische Eier und winzige Stückchen Kuchen erhascht. Als Marlenes schwangere Tochter an ihr vorbeiging, zupfte Olive sie an ihrem Umstandskleid und sagte: »Kannst du mir ein bisschen was zu essen bringen?« Das Mädchen machte ein überraschtes Gesicht und sagte dann: »Ja, Mrs Kitteridge, natürlich.« Aber ihre Gäste hielten sie immer wieder auf, und es dauerte ewig, bis Olive schließlich ein Papptellerchen mit zwei russischen Eiern und einem Happen Schokoladenkuchen auf den Knien balancierte. Keine Gabel, keine Serviette, kein gar nichts. »Danke«, sagte sie.
Sie steckte sich den Kuchen in einem Bissen in den Mund und schob den Teller mit den russischen Eiern unauffällig unter ihren Stuhl. Wenn sie etwas hasste, dann russische Eier.
Marlenes Tochter nahm in einem weißen Korbsessel Platz, von dessen Rückenlehne Bänder herabwallten wie bei einem Königsthron. Als schließlich alle saßen – niemand setzte sich neben Olive, bis diese schwangere Ashley es tat, notgedrungen, weil sonst kein Stuhl mehr frei war –, als sie alle saßen, sah Olive den vollgehäuften Geschenketisch, und da erst kam es ihr: Sie hatte kein Geschenk mitgebracht. Ihr wurde siedend heiß vor Schreck.
Marlene Bonney blieb auf ihrem Weg nach vorn bei ihr stehen und fragte leise: »Olive, wie geht es Christopher?«
Olive sagte: »Sein neues Kind ist gestorben. Herzstillstand, ein paar Tage vor dem Termin. Ann musste es tot zur Welt bringen.«
»Olive!« Marlenes hübsche Augen füllten sich mit Tränen.
»Weinen bringt auch nichts«, sagte Olive. (Olive hatte geweint. Sie hatte Rotz und Wasser geheult, als sie nach Christophers Anruf den Hörer aufgelegt hatte.)
»Ach, Olive, das tut mir so leid.« Marlene wandte den Kopf und ließ den Blick durch das Zimmer wandern, bevor sie leise sagte: »Hier sollten wir das besser nicht erzählen, was meinen Sie?«
»Wie Sie wollen«, sagte Olive.
Marlene drückte noch einmal Olives Hand und sagte: »Dann kümmere ich mich jetzt mal um die Mädchen.« Damit trat sie in die Zimmermitte, klatschte in die Hände und rief: »Also, wollen wir loslegen?«
Sie nahm eins der Päckchen vom Tisch und gab es ihrer Tochter, die die Karte las und sagte: »Von Ashley!«, und alle Köpfe drehten sich der schwangeren Blondine neben Olive zu. Ashley winkte kurz; sie war rot geworden. Marlenes Tochter begann das Geschenk auszupacken; die Bänder trennte sie ab und klebte sie mit Tesafilm auf einen Pappteller. Erst dann brachte sie eine kleine Schachtel zum Vorschein, und aus der Schachtel ein winziges Pullöverchen. »Nein, schaut nur«, sagte sie.
Überall im Zimmer waren anerkennende Ahs und Ohs zu hören. Und zu Olives Entsetzen wurde der Pullover von einer zur anderen gereicht. Als er zu ihr kam, sagte sie: »Sehr hübsch«, und gab ihn an Ashley weiter, die sagte: »Ich kenne ihn schon«, und alle lachten, und Ashley gab ihn der Frau auf ihrer anderen Seite, die sehr viel über den Pullover zu sagen hatte, bevor sie ihn dem Mädchen zu ihrer Linken gab. All das nahm viel Zeit in Anspruch. Jemand fragte: »Hast du den selbst gestrickt?« Und Ashley sagte ja. Ein anderes Mädchen sagte, ihre Schwiegermutter stricke auch, aber nichts so Hübsches wie diesen Pullover. Ashley erstarrte ganz leicht, und ihre Augen wurden groß. »Wie lieb«, sagte sie.
Endlich war das nächste Geschenk an der Reihe, und Marlene brachte es ihrer Tochter. Die Tochter sah auf die Karte und sagte: »Von Marie.« Eine junge Frau am anderen Ende das Zimmers winkte in die Runde. Marlenes Tochter klebte die Bänder von der Verpackung umständlich auf dem Pappteller fest, und Olive begriff, dass das bei jedem Geschenk so gemacht werden würde, bis zum Schluss ein Teller voller Bänder entstanden war. Wozu sollte das gut sein? Sie saß da und wartete, und dann hielt Marlenes Tochter eine Garnitur Plastikfläschchen mit kleinen grünen Blättern darauf hoch. Dieses Geschenk fand nicht so viel Anklang, bemerkte Olive. »Aber du stillst doch?«, fragte jemand, und Marlenes Tochter sagte: »Doch, versuchen werden wir es auf jeden Fall.« Und dann fügte sie munter hinzu: »Aber die sind sicher auch so sehr praktisch.«
Marie sagte: »Ich dachte einfach, man weiß ja nie. Man kann gut ein paar Fläschchen dahaben, auch wenn man stillt.«
»Ja, natürlich«, sagte jemand, und auch die Fläschchen wurden herumgereicht. Olive dachte, bei ihnen würde es schneller gehen, aber wie es schien, hatte jede Frau, die die Fläschchen anfasste, eine Stillgeschichte zu erzählen. Olive hatte Christopher selbstredend nicht gestillt – niemand stillte damals, außer Leuten, die etwas Besonderes sein wollten.
Ein drittes Geschenk wurde Marlenes Tochter zum Öffnen gereicht, und Olives Beklemmung wuchs. Es war nicht abzusehen, wie lange es dauern würde, bis das Mädchen jedes einzelne Geschenk auf diesem gottverfluchten Tisch ausgewickelt und die Bänder so liebevoll auf dem gottverfluchten Teller festgeklebt hatte, und bei jedem Geschenk mussten alle warten – einfach warten –, während es die Runde machte. Etwas so Hirnrissiges hatte sie in ihrem ganzen Leben noch nicht erlebt.
Ein Paar gelbe Babyschühchen wurde in ihre Hände gelegt, sie starrte darauf und reichte sie dann an Ashley weiter, die sagte: »Oh, wie niedlich.«
Und unvermittelt ging Olive auf, dass sie auch vor Henrys Schlaganfall nicht glücklich gewesen war. Warum sie das ausgerechnet jetzt dachte, hätte sie nicht sagen können. Dieses spezielle Unglück kam ihr öfter einmal zu Bewusstsein, aber meist dann, wenn sie allein war.
Dabei verstand Olive ja selber nicht recht, warum das Älterwerden bei ihr eine solche Hartherzigkeit gegen ihren Mann hervorgebracht hatte. Aber sie hatte es nicht zu ändern vermocht, es war, als wäre die Steinmauer, die sich während ihrer langen Ehe zwischen ihnen dahingeschlängelt hatte – eine Mauer, die sie trennte, aber in der es auch unerwartete Durchbrüche gab, warme, moosbewachsene Breschen, durch die das Sonnenlicht blitzte –, mit einem Mal hoch und undurchlässig geworden, und die Ritzen, aus denen früher Blumen gewachsen waren, hätte nun ein Eissturm überkrustet. Mit anderen Worten, etwas war zwischen sie getreten, das nicht mehr überwindbar schien. An manchen Tagen sah sie ganz klar einen Steinbrocken hier, ein paar Kiesel da, die das Bollwerk verstärkt hatten (Christophers Pubertät, ihre Empfindungen, vor all den Jahren, für Jim O’Casey, der ihr Kollege an der Schule gewesen war, Henrys Gefühlsduselei um die kleine Thibodeau, der Alptraum dieses Verbrechens, in das sie und Henry hineingeraten waren und im Zuge dessen Unsägliches gesagt worden war, und dann Christophers Scheidung und sein Wegzug aus der Stadt), aber sie verstand dennoch nicht, wie es sein konnte, dass sich im Alter diese hohe, hässliche Mauer zwischen ihnen erhob. Und die Schuld lag bei ihr. Ihr Herz hatte sich im gleichen Maß verhärtet, in dem das von Henry liebebedürftiger wurde, und wenn er im Haus manchmal zu ihr gekommen war, um von hinten die Arme um sie zu legen, hatte sie an sich halten müssen, um nicht sichtbar zusammenzuschaudern. Lass das!, hätte sie ihn anherrschen mögen. (Aber warum? Welches Verbrechen hatte er begangen außer dem, Liebe von ihr zu wollen?)
»Das ist eine Milchpumpe«, sagte Ashley zu ihr. Denn Olive hielt eine Plastikvorrichtung in der Hand und drehte sie hin und her, außerstande, einen Sinn darin zu erkennen. »Ah ja«, sagte Olive und gab das Ding Ashley. Sie sah zu dem Tisch mit den Geschenken und dachte, dass in dem Berg noch nicht einmal eine Delle sichtbar war.
Eine zartgrüne Babydecke kam des Weges. Sie fühlte sich schön an, Olive behielt sie auf ihrem Schoß und strich mit den Händen darüber. Jemand sagte: »Mrs Kitteridge, andere wollen auch mal«, und Olive reichte sie eilig an Ashley weiter. Ashley sagte: »Ach, ist die hübsch«, und da sah Olive, dass ihr Schweißtropfen die Schläfen hinabrannen. Und dann meinte Olive – sie war sich fast sicher –, ein geflüstertes »O Gott« zu hören. Als die grüne Decke bei Marie am anderen Ende des Zimmers angekommen war, stand Ashley auf und sagte: »Entschuldigung, ich müsste mal wohin.« Und Marlene sagte: »Du weißt, wo, oder?« Und Ashley nickte.
Eine Garnitur Babybadetücher machte die Runde, und Ashleys Stuhl war immer noch leer. Olive gab sie dem Mädchen auf der anderen Seite des leeren Stuhls, und dann stand sie auf und sagte: »Ich komme gleich wieder.« In der Küche stand Ashley über die Spüle gebeugt. »O Gott«, sagte sie, »o Gott.«
»Alles in Ordnung?«, fragte Olive laut. Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Das sind Wehen«, sagte Olive.
Das Mädchen sah sie an, ihr Gesicht glänzte vor Nässe. »Ja, ich glaub auch«, sagte sie. »Heute früh dachte ich schon, ich hätte vielleicht eine gehabt, aber dann war nichts mehr, und jetzt … O Gott«, und sie krümmte sich vornüber, die Hände um den Rand der Spüle gekrampft.
»Sie müssen ins Krankenhaus«, sagte Olive.
Nach ein paar Sekunden richtete Ashley sich auf, gefasster nun. »Ich kann ihr doch nicht ihre Party verderben, das war ihr so wichtig. Wissen Sie« – das im Flüsterton –, »ich weiß gar nicht, ob Rick sie überhaupt heiratet.«
»Egal«, sagte Olive. »Sie haben Wehen. Da ist doch jetzt diese Party egal. Die werden gar nicht merken, dass Sie weg sind.«
»Doch. Und dann stehe ich im Mittelpunkt. Und dabei sollte doch sie im Mit…« Ashleys Gesicht verzerrte sich, und sie klammerte sich wieder an die Kante der Spüle. »O Gott, o Gott«, sagte sie.
»Ich hole jetzt meine Tasche, und dann fahren wir ins Krankenhaus.« Das war ihre Lehrerinnenstimme, sie merkte es selbst. Sie ging zurück ins Wohnzimmer und nahm ihre große schwarze Tasche.
Die Leute lachten über irgendetwas; lautes Gelächter schlug an Olives Ohr. »Olive?« Das war Marlene.
Olive schwenkte kurz die Hand überm Kopf und ging wieder in die Küche, wo Ashley stand und keuchte. »Hilfe«, sagte Ashley; sie weinte jetzt.
»Kommen Sie.« Olive drängte das Mädchen in Richtung Tür. »Das da ist mein Auto, gleich vorn auf dem Gras. Steigen Sie ein.«
Marlene erschien und fragte: »Was ist denn los?«
»Ihr Kind kommt«, sagte Olive, »und ich fahre sie ins Krankenhaus.«
»Aber ich wollte doch die Party nicht verderben«, sagte Ashley zu Marlene; sie stand da, ihr nasses Gesicht unschlüssig.
»Jetzt«, sagte Olive. »Jetzt sofort. Ins Auto. Auf dem Gras.«
»Ach, Olive, rufen wir doch lieber einen Krankenwagen. Was ist, wenn sie das Kind bekommt, während Sie fahren? Bleiben Sie hier, Olive. Ich rufe an.« Marlene griff nach dem Telefon an der Wand, und es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis die Verbindung zustande kam.
Olive sagte: »Wir fahren jetzt, sagen Sie dem Notarzt, wie mein Auto aussieht, dann kann er mir ja nachfahren, wenn er will.«
»Aber wie sieht Ihr Auto denn aus?« Marlene jaulte es regelrecht.
»Schauen Sie halt hin«, blaffte Olive sie an. Ashley war schon am Auto und hievte sich auf die Rückbank. »Die sollen mich einfach stoppen, wenn sie da sind.«
In dem Moment, als sie die Tür aufzog, sah Olive Ashleys Gesicht und wusste: Es war so weit. Dieses Mädchen bekam ihr Kind hier und jetzt. »Ziehen Sie die Hose runter«, kommandierte sie. »Jetzt. Ziehen Sie sie aus.« Ashley versuchte es, aber sie krümmte sich vor Schmerz, und Olive suchte mit zitternden Händen in ihrer Tasche und fand die Schere, die sie immer dabeihatte. »Legen Sie sich hin.« Olive beugte sich zu ihr hinein, aber sie hatte Angst, dem Mädchen in den Bauch zu stechen, also ging sie ums Auto herum auf die andere Seite und schaffte es von dort, Ashleys Hose aufzuschneiden. Dann lief sie wieder zurück und zog ihr die Hose von den Beinen. »Liegen bleiben«, befahl sie mit strenger Stimme, o ja, da sprach die Lehrerin.
Das Mädchen spreizte die Knie, und Olive staunte. Sie konnte nicht anders als hinstarren. Das Wort Scham