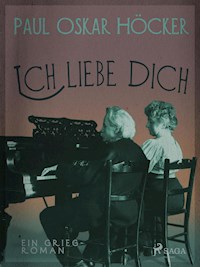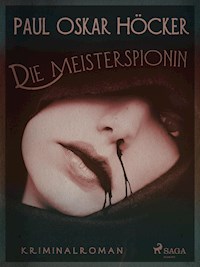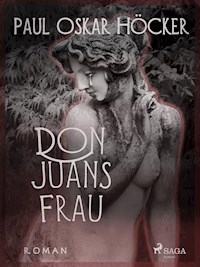Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Noch ganz aus der anfänglichen Kriegsbegeisterung geschrieben, vermittelt der Autor ein getreues Bild seiner Erlebnisse der Fronterfahrung und seines damaligen Empfindens. Aus den Kapiteln: Abschied – Einmarsch in Belgien – Auf dem Marsch zur Maas – In Tongern und Hasselt – Durch das brennende Löwen – Mein Berliner Jungen – Hurra, die Feldpost ist da! – Offizierspatrouille nach Maubeuge – Verlassene Häuser – Französische Soldatenbriefe – Auf Etappen-Kommando – Meine märkische Landwehrkompanie in der Feuertaufe – Gefechtstage bei Lille – Grüße aus der Heimat – Auf der Zitadelle von Lille – Das schöne Mädchen von Lille – Neun Tage im Schützengraben – Ich hatt' einen Kameraden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Oskar Höcker
An der Spitze meiner Kompagnie
Drei Monate Kriegserlebnisse
Saga
Abschied
Das Schwerste ist überstanden: der Abschied. Frau und Kinder standen im Garten und winkten dem Auto nach, das von Westend nach dem Anhalter Bahnhof eilte. Man hat die Zähne zusammengebissen und hat das Taschentuch noch ein Weilchen flattern lassen und hat ein fröhliches Gesicht gemacht. In der Villenstrasse alles noch ganz still. Aber vorn, am Reichskanzlerplatz, stehen die Frauen vor den Läden und sprechen über die Mobilmachung. Dem Friseur sind seine Gehilfen genommen, dem Kaufmann seine Austräger, dem Blumenhändler seine Binder. Das Butterfräulein winkt mir zu, als das Auto um die Ecke biegt.
Ich bin noch nie mit so wenig Handgepäck auf so grosse Fahrten ausgezogen. Immer ist mir’s, als müsst’ ich etwas vergessen haben. Aber das ist wohl nur der innere Draht, der einen noch mit seiner Heimat verbindet und auf dem Depeschen hin und her gesandt werden, innige Friedensdepeschen im hellen Kriege, die ihr Ziel ohne abstempelnde Beamte finden müssen.
Nur keine Bahnhofsabschiede! Sie tun mir leid, die Pärchen, die Gruppen mit den nassen Augen, mit den letzten schmerzenden Küssen. Noch fünf Minuten, noch drei... Einsteigen!... Ich schnalle den Säbel ab, den gestern der Waffenmeister geschliffen hat, nehme Platz, und der endlose Militär-Lokalzug rollt langsam aus der Halle hinaus in die blendende Sonne.
Ja, der Abschied war doch das Schwerste. Die ungeheuerliche Vorstellung, dass man etwa mit Zehntausenden, Hunderttausenden zusammen zerschmettert am Boden liegen sollte, dass man an all den dringenden Geschäften der Familie, des Hauses, der Arbeit niemals mehr irgendwelchen Anteil haben sollte. Noch so viel Pläne birgt der Kopf, noch so viel Wärme das Herz, noch so viel Kraft der ganze Kerl ...
Aber ein einziger Blick auf den Bahnsteig beim ersten Halten des Zuges — und wir halten oft, weil überall noch Leute aufgenommen werden — macht uns bescheiden. Wir sehen Freunde, Bekannte. Ein fröhlicher Zuruf. Und blitzschnell der Gedanke: Der braucht für die Seinen sein Leben genau so dringend wie du. Und keiner ist wichtiger als der andere. Und von dieser Stunde ab sind wir alle Brüder. Und die wichtigen, dringenden, unaufschiebbaren Geschäfte des Berufes haben alle, alle Zeit. Es gibt nichts Wichtiges mehr unter der Sonne, ausser diesem furchtbaren, welterschütternden Ereignis des uns aufgezwungenen Krieges nach drei Fronten.
„Hallo, Paul Oskar!“ ruft’s aus dem Nachbarwagen.
„Tovote!“ — Richtig, es ist Heinz Tovote, der zu seiner bayerischen Landwehrbrigade fährt. In den Dolomiten hat ihn die Kunde von der Mobilmachung überrascht. In dreissigstündiger Fahrt hat er Berlin erreicht — und das Wichtigste, was es jetzt für uns Wehrleute gibt: seine Feldausrüstung.
Auf der nächsten Station entdecken wir den Bildhauer Hans Dammann. Er ist Kompagnieführer in demselben Landwehrregiment wie ich. Und da ist ein Geheimrat, ein Landgerichtsdirektor, ein Bürgermeister, ein Oberlehrer, die ich öfters auf Festen der Landwehrinspektion traf. „Auch Wittenberger?“ Man schüttelt sich die Hand, freut sich, und die Schrecken des Krieges sind schon fast vergessen, man sieht nur noch famose Kameraden.
Nach vier Stunden landen wir in der alten Lutherstadt. Es geht zum Regimentsgeschäftszimmer. „Hauptmann der Landwehr ersten Aufgebots Höcker vom Bezirkskommando I Berlin meldet sich ganz gehorsamst...“
Und dann treffen am Nachmittag die endlosen Züge mit den dreitausend Wehrleuten ein. Immer neue Transporte. Wittenberg ist ein einziges Heerlager. Das stampft auf neuempfangenen Nagelschuhen über das Pflaster, das singt und schwatzt, ruft alte Kompagniekameraden an. Drollige Bilder gibt’s dabei. Auf den Kammern hat sich der Zivilist in einen halben Soldaten verwandelt. Der Helm schmückt schon das Haupt; aber der Uniformrock, der erst beim Regimentsschneider verpasst werden muss, ist noch durch die Ziviljacke ersetzt. Hunderte wandern so durch die Strassen ihren Bürgerquartieren zu. Es wird zehn Uhr abends, bevor die Lastenbündel mit Stiefeln, Lederzeug, Tornister, Mantel, Wäsche, Büchsen und Patronentaschen aus dem Strassenbild verschwinden.
In der Kavalierkaserne treffen die Autos ein, die vor der Brücke angehalten wurden. Eine junge Frau in grosskariertem Reisekleid beteuert mit überraschend ausdrucksvollem Mienenspiel, sie sei wahrhaftig keine Russin, sie sei Dänin, und ihr Name sei...
Sie braucht ihn gar nicht erst zu nennen. Ein Trüpplein Offiziere, im Begriff, den Kasernenhof zu verlassen, erkennt sie sofort. Es ist die Asta Nielsen. Mit Mann und Schwester will sie nach der Schweiz ausrücken. Sie hat grosse Bange vor den Gewehren mit den aufgepflanzten Bajonetten. Der Bataillonsadjutant und der Verpflegungsoffizier nehmen sich der Reisenden an und geleiten sie nach dem Hotel, wo sie bei einem Glase Sekt der liebenswürdigen neutralen Macht allerlei Auskünfte auf neugierige Fragen geben. Wohin unser Regiment zieht? Das wissen wir freilich selber nicht; und wüssten wir’s, so dürften wir es nicht verraten. Aber die Herren bemühen sich, der schwarzäugigen Filmkönigin einen möglichst guten Begriff von der hohen Kultur unserer Wehrleute beizubringen: In keinem Tornister fehle eine Nagelpflege, ein Fläschchen Odol und Pariser Hautcreme. — „Das ist Vorschrift?“ — „Unnachsichtig wird darauf gehalten!“
Nun sind auch die Pferde feldmarschmässig ausgerüstet. Satteltaschen mit Putzzeug, Reserveeisen, Marschhalfter, Woilach usw. lassen die beiden munteren Stuten, die mich und meine Frau oder meine Töchter tagtäglich durch den Grunewald trugen, bedeutend weniger elegant erscheinen. Die Tiere blicken gespannt um sich, spitzen die Ohren, mustern den neuen Pfleger. Es ist ein prächtiger junger Landwirt, der Bursche, den ich mir aus meinen zweihundertfünfzig Mann herausgesucht habe. Dass er tierlieb ist, merke ich schon beim ersten Futtern. Ich frage ihn nach seiner Heimat. Eine Frau und zwei Kinder lässt er daheim. „War’s Ihnen traurig, Günther?“ Er lächelt ein bissel wehmütig. „Ach, Herr Hauptmann, traurig war nur der Abschied. Jetzt ist’s überstanden.“ Ich nicke und lache ihm zu. „Wir werden sogar noch lustig werden, Günther! Was? Und wenn wir erst in der Bahn sitzen, werden wir’s kaum erwarten können, über die Grenze zu kommen, gleichviel ob’s nach Ost oder West geht.“
Und die Arbeit nimmt uns in ihren tröstlichen Schutz. Ja, ja, der Abschied war doch das Schwerste.
Die Fahrt ins Aufmarschgelände
So schön war Deutschland nie zuvor. Vom Fenster des Militärtransportzuges ans hat man die deutsche Landschaft aufs neue innig lieben gelernt. Der Zug ist zusammengesetzt aus Sekundärbahnwagen, Stadtbahnwagen, Viehwagen und offenen Loren. Er benutzt hier ein Stück der D-Zug-Linie, dort ein fast unbekanntes Kanonenbähnchen. Auf der Karte erscheint die Strecke wie im Zickzack geführt. Und das Tempo atmet Ruhe. Alle paar Stunden gibt’s einen Halt, die Mannschaften dürfen aussteigen, werden gespeist durch Feldverpflegung oder doch erquickt durch Liebesgaben der Bevölkerung. In wunderbarer Ordnung vollzieht sich das alles. Es gibt keine Minute Verspätung. Es ist, als habe der Generalstab diese Truppentransporte hundertmal geübt und veranstalte jetzt eine Parade seiner Schlagfertigkeit vor dem deutschen Volk.
Am Abend, in tiefer Nacht und im ersten Morgengrauen hat unser Landwehrregiment die Garnison verlassen. Meine Kompagnie rückt nachts um zwei Uhr vom Kasernenhof ab. Überall blitzen kleine Scheinwerfer auf: die Korporalschastsführer, die Zugführer mustern ihre Leute mit elektrischen Taschenlämpchen. Hat jeder Mann alles mit? Noch ist Zeit, Vergessenes heranzuschleppen. In einer Stunde entführt uns der Zug, und Nachsendungen erreichen uns vielleicht erst nach Wochen. In dem Zwielicht der mondbeglänzten Sommernacht sehen die feldgrauen Ungetüme mit den spitzen Helmkappen und hochbepackten Tornistern wie Fabelwesen aus. Und wir Offiziere gleichen Beuteltieren: an Riemen und Feldbinde tragen wir die kleine Kofferlast von Armeerevolver und Feldstecher, Kartentasche, Brotbeutel und Feldflasche.
„Stillgestanden! Die Augen links!“ Der Oberleutnant meldet mir die Kompagnie. Ich atme auf: trotz aller Abkommandierungen, Verschiebungen und Ausgleiche in den letzten Stunden stimmt die Zahl, wir haben die etatsmässige Stärke. „Guten Morgen, Leute!“ Und aus 251 Männerkehlen schallt es forsch zurück: „Guten Morgen, Herr Hauptmann!“
Vor der Kaserne erwartet uns die Jugendwehrkapelle. „Jung-Deutschland“ hat um die Erlaubnis gebeten, das Bataillon mit Musik zum Bahnhof abbringen zu dürfen. So jubelt uns denn der Preussenmarsch voran, und durch die nächtlichen Strassen dröhnt der Gleichschritt der Kompagnien.
Am Bahnhof Meldung an den Transportführer, den Oberstleutnant, der unser Bataillon in den Feldzug führt. Und in Ruhe, fast lautlos, nehmen auf seinen Befehl die tausend Mann die Plätze ein. Nur jenseits des Bahnhofgitters ist noch Bewegung: Frauen, Bräute, Schwestern und Mütter der Wehrleute.
Das Offizierkorps des Bataillons hat’s gut getroffen. Die altertümlichen, gemischten Wagen mit 1., 2. und 3. Klasse lassen verschiedentlich eine Belegung mit nur zwei Köpfen zu. Der Stabsarzt und ich knobeln die beiden Bänke aus, die lange und die kurze, und halten 36 Stunden lang gute Coupéfreundschaft.
Aus dem ersten Schlaf rüttelt uns nach zwei Stunden ein unsanfter Ruck. Die armen Pferde! ist unser erster Gedanke. An die Wagentüren kommen Helferinnen vom Roten Kreuz und bieten Kaffee an. Wir überlegen. „Wenn ich Kaffee trinke, kann ich nicht schlafen“, sagt der Stabsarzt. „Mir geht’s umgekehrt,“ sagt der Adjutant, der aus dem Nebenabteil eingtreten ist, „wenn ich schlafe, kann ich nicht Kaffee trinken.“ Wir beschliessen zu warten. In Güsten gibt’s die warme Kost für alle.
Und das wird dann eine Morgenschlemmerei von gutem Umfang. Für die Mannschaften Reis in Fleischbrühe, belegte Butterbrote, Kakao, Kaffee, Tee nach Verlangen; für die Offiziere ist im Wartesaal der Tisch gedeckt. Es ist die uns auf der Fahrt zustehende erste Mittagsverpflegung. Sie tut uns auch schon früh um 9 Uhr wohl.
Man steht dann noch ein Viertelstündchen in der Sonne und instruiert oder schreitet den endlosen Zug ab, sieht nach den Pferden, nimmt sich die „Sorgenkinder“ vor, deren jede Kompagnie einige besitzt, erhält aber die tröstliche Versicherung: „Ich schaff’s, Herr Hauptmann!“
Den guten Mut und die fröhliche Zuversicht des Bataillons beweisen die Aufschriften auf den Eisenbahnwagen. Und lustige Zeichnungen gibt’s in Menge. „Von wem ist denn die hier?“ fragt mich der Bataillonsführer überrascht. Ich berichte ihm stolz, wie viel Talente sich unter meinen Leuten befinden. Dem Unteroffizierkorps gehört sogar der bekannte Sezessionist Waldemar Rösler an.
Unter den Aufschriften belustigen uns am meisten: „Sitzungszimmer für die Eingemeindung von Frankreich und Belgien.“ — „Französischer Hackepeter, ¼ Pfund 15 Pfennig.“ — „Hier werden noch weitere Kriegserklärungen entgegengenommen.“ — „Schlafwagen nach Paris.“ — „Zum Witwenball in Paris!“ — Der böse Nikolaus kommt sehr schlecht weg. Man entdeckt ihn oftmals am Galgen; noch häufiger aber auf einem gewissen Örtchen, während draussen seine wildbärtigen Berater stehen, mit Brownings bewaffnet.
Durch gesegnetes deutsches Land führt uns der Zug. Alles scheint in tiefem Sommerfrieden zu liegen. Sollen Hass und Neid und Eifersucht der Nachbarn uns all die Schönheit unserer lieben Heimat verwüsten? Es ist, als habe man sein Vaterland noch nie zuvor so heiss geliebt wie in diesen schweren Tagen.
Der Harz kommt. Es geht durch einen langen Tunnel. Viele meiner Märker sind noch nie durch einen Tunnel gefahren. Wir sehen das Kloster Walkenried. In Bad Sulza steht das Landsturmaufgebot einer Schützenkapelle und spielt die „Wacht am Rhein“, während unser Zug vorüberrollt. Ach wie oft sind die alten kernigen Lieder gesungen worden. Dann kommt der Abend und mit ihm eine weichere Stimmung. Aus den Fenstern klingt es: „Die Vöglein im Walde, die singen so wunder — wunderschön — In der Heimat, in der Heimat, da gibt’s ein Wiedersehn!“ Es dämmert, es dunkelt, Sternschnuppen fallen. „Haste jesehn, Mensch?“ fragt ein bärtiger Wehrmann den andern von Fenster zu Fenster. — „Na, ick wer’ nich!“ — „Wat haste dir jewünscht?“ — „Dresche sollen se kriegen!“ — „Akkurat mein Fall!“... Dann Stille. Der Zug hält auf freiem Feld. Aus dem Fenster des Coupés, in dem mein Unteroffizier Sandkuhl, der Kabarettsänger, sitzt, lässt sich ein weicher Bariton vernehmen: „O du mein holder Abendstern!“ — Im Rattern und Schütteln des Zuges versinkt der Rest. „Ein famoses Material!“ meint Leutnant Holberg, der meinen dritten Zug führt. Er muss es wissen, denn er ist im Nebenamt der Leiter des Bruno Kittelschen Chors.
Mitten in der Nacht gibt es eine unerwartete Verpflegungsstation. Beim Bahnhof Paderborn sind ausgedehnte Baracken aufgebaut. Die Mannschaften bekommen warme Getränke, Butterbrote. Aber ihr Interesse ist jetzt noch stärker anderen Ereignissen zugewandt. — Da drüben zieht es endlos, endlos, in dunklen Reihen zwischen blitzenden Bajonetten dem Sennelager zu: Kriegsgefangene sind’s. — Wie die Augen unserer Wehrleute aufleuchten!
„Wenn mer bloss erscht dort wären!“ sagt mein Entfernungsschätzer Schultze II mit tz, der Feuerwehrmann aus Berlin NO. Und ein Leutnant bringt von drüben die in gebrochenem Deutsch gegebene Versicherung eines Kriegsgefangenen: „Franzos kaputt, Deutsche schiesst zu gutt!“
Auch Damengesellschaft bekommen wir, d. h. der Bataillonsstab. Eine Hauptmannsfrau, die ihren erkrankten Gatten in Wesel besuchen will, ist auf die Liebenswürdigkeit unseres Transportführers angewiesen, sonst käme sie vor zwei Tagen kaum an ihr Ziel. Es ist wie ein Gruss aus einer Welt, die wir verlassen — wer weiss, für wie lange.
Die Soldateska wird sanft, friedlich entschlummert alles. Aber am andern Morgen, in Dortmund, gibt’s wieder ein echtes Feldlagerbild: alles eilt in Hemdsärmeln zu den prächtigen Waschstationen, die neben dem Bahnsteig errichtet sind. Das prustet, spritzt, gurgelt, frottiert, stöhnt und grunzt vor Behagen.
Und wie ich eben das vielbenutzte Handtuch kameradschaftlich dem Gefreiten Gebauer überlasse, der stündlich ein neues Gedicht vom Stapel lässt, tritt eine junge Rote-Kreuz-Helferin auf mich zu. „Ach verzeihen Sie, der Soldat da drüben sagt. Sie wären“ — Der Soldat da drüben, der gerade die Ärmel seines Seidenhemdes aufkrempelt, ist der Führer der 7. Kompagnie. Und kurz und gut: ich soll der jungen Dame und ihren Freunden je ein Autogramm geben. Das blonde „Erfrischungsmädel“ liest auf meiner Erkennungsmarke meinen Namen nebst den Vornamen, Charge, Kompagnie, Bataillon, Regiment. Und jetzt glaubt sie. Sie lacht. Eigentlich hatte sie sich den Romanschriftsteller ganz anders vorgestellt. Zwei Tage nicht rasiert. Schön sind wir nicht.
Das Hornsignal „Sammeln“. Alles steigt ein.
Und bald sehen wir den Rhein.
Die Bevölkerung empfängt uns fast jubelnd. Sie haben hier doch wohl ein wenig Bange gehabt so nah der Grenze. Und freuen sich, die „Wacht am Rhein“ zu hören — von immer neuen durchziehenden Bataillonen.
Einmarsch in Belgien
In der Frühdämmerung ist das Regiment aus Aachen abmarschiert. Die Nachtruhe war kurz. Das Bataillon war erst am späten Abend eingetroffen, die Befehle der Brigade und des Regiments erreichten uns erst nach Mitternacht. Da hiess es also, rasch die Befehle an die Kompagnie weitergeben (ein besonderes Kunststück, wenn es Nacht ist und die Kompagnie auf hundert kleine Bürgerquartiere in einer fremden Stadt verteilt liegt) und schleunigst das Bett aufsuchen. Die hübschen Hotels sind Massenquartiere der durchziehenden Offiziere geworden. Die Tanzsäle hat man zu Lazaretten umgewandelt. Ich bin für diese Nacht, die allerdings nur noch drei Stunden zählt, im Rosenbad einquartiert. Himmlisch. Es ist zweibettig, und ich habe Schränke, Kommoden, einen Riesenwaschtisch zur Verfügung. Allerdings: mein Gepäck habe ich erst gar nicht kommen lassen können, denn es muss schon zwei Stunden vor Abmarsch auf dem Alarmplatz des Bataillons zur Stelle sein. Etwas beschämt entnehme ich meinem Brotbeutel das winzige Zahnbürstchen, die Miniaturtube Albin und das talergrosse Stück Seife, das seidene Reservehemd und die federleichten Pantoffeln und den von mir unzertrennlichen Wecker. ... Und das kleine Luder weckt mich auch schon, kaum dass ich im Bett liege...
Unser Auftrag ist schwer und ernst. Wir sollen das Gebiet bis zur Maas von Franktireurs säubern. Alle Tage wird aus dem Hinterhalt auf unsere durchziehenden Truppen, besonders auf kleinere Abteilungen, auf Meldereiter, Radfahrerunteroffiziere, Militärkraftwagen geschossen. Da gilt es nun endlich, scharf durchzugreifen. In einer klar und energisch abgefassten Proklamation ist den Einwohnern der von uns besetzten belgischen Gebietsteile kundgetan worden, dass alle Waffen, alle Munition, alle Sprengstoffe innerhalb der nächsten Stunden abzuliefern sind. In breiter Front bewegen sich nun mehrere Landwehrbrigaden westwärts, um das Land von solchen Marodeuren zu säubern. Jedem Bataillon ist sein Gebiet zugewiesen. Von meinem Kommandeur — einem prächtigen Feldsoldaten, einem Oberstleutnant, der 32 Jahre in der Front gestanden hat — habe ich den besonderen Marschbefehl für meine Kompagnie. Ein paar hundert Meter vor der belgischen Grenze machen wir einen Halt. Meine Leute wissen, um was es sich handelt. Wir wollen nicht wie die Barbaren hausen, aber es gilt, mit aller Strenge vorzugehen. Ich werde in jedem Gehöft, das ich auf Waffen usw. zu durchsuchen habe, dem Besitzer noch eine letzte Möglichkeit geben, mir die bei ihm auch jetzt noch verborgenen Waffen abzuliefern. Erklärt er, keine zu besitzen, und werden welche bei ihm gefunden, so muss er auf der Stelle füsiliert werden. Häuser, aus denen Angriffe erfolgen oder in denen der Durchsuchung Widerstand entgegengesetzt wird, werden sofort niedergebrannt.
Schweren Herzens vorwärts. Rechts liegt noch neutrales Gebiet, bei Moresnet, in dem „Das Heiratsdorf“, der hübsche Roman von Nanny Lambrecht, spielt, dann beginnt rechts der von Franktireurs viel belästigten Strasse nach Lüttich belgisches Gebiet; deutsches Gebiet begleitet die Strasse noch eine Strecke weit links. Nicht weit von Moresnet liegen mehrere Gehöfte: Jungbusch, Hoof und zwei Abbauten. Ich entsende dahin meine vier Offiziere mit je drei Gruppen zur Durchführung und reite mit der ersten Abteilung nach Jungbusch mit. Eine schwarzweissrote Flagge weht von der grossen Linde vor dem Haus. Kein Haus ist hier ohne deutsche Flagge. Im Augenblick, da wir das Zauntor öffnen, nimmt ein junger Bursche nach dem nahen Wäldchen hin Reissaus. Ich sprenge ihm nach, aber die hier üblichen übermannshohen Weissdornhecken machen eine Verfolgung unmöglich. Eine Frau erscheint auf unser Rufen. Ob sie allein im Hause sei? Allein? Nein, sie habe eine Tochter von 15 Jahren. Sonst niemand? Zögernd setzt sie hinzu: Ja, ihr Mann sei auch daheim. Die Wehrleute dringen ein und holen ihn. Der Leutnant lässt die Gewehre fertig machen, die Zivilisten müssen vor den Zaun des Gemüsegartens treten, und ich ermahne die Hausbewohner, so eindringlich ich kann, alle Waffen abzuliefern, die sie noch im Hause haben. Der Alte schwört, er habe nie eine Waffe besessen. Sein Sohn sei seit mehreren Tagen unterwegs. Ob der eine Schusswaffe besitze? Alle drei heben beschwörend die Hand hoch: Nein, er sei ein friedfertiger Mensch, habe nie, niemals eine Waffe in der Hand gehabt. Aber in dieser Gegend ist häufig aus den Hecken heraus geschossen worden. Wir müssen das Haus von oben bis unten durchsuchen. Ein letztes Mahnwort: „Sie wissen, dass jeder Zivilist, der jetzt noch im Besitz einer Waffe betroffen wird, mit dem Tode bestraft werden muss?“ — „Wir haben keine Waffen!“ beteuern sie noch einmal. Und die Mannschaften verteilen sich auf Keller- und Wohnräume, Geräteschuppen und Stall, durchforschen den Garten und das Umland nach frischen Grabestellen. Vor den Gewehrläufen mit den aufgepflanzten Seitengewehren stehen die drei Leute und halten meinen Blick ruhig aus. „Wer war der Bursche, der da vorhin aus Ihrem Hause echappiert ist?“ frage ich den Alten. „Haben Sie mir in letzter Sekunde noch ein Geständnis zu machen?“ Der Alte faltet die Hände. „Nein, Herr Offizier, als Mann von 72 Jahren schwöre ich Ihnen zu“... Und da geschieht das Grässliche. Ein Unteroffizier und ein Wehrmann schleppen einen jungen Burschen aus dem Haus. Sie haben ihn auf dem Boden im Stroh versteckt entdeckt. Er hatte ein mit fünf Patronen geladenes belgisches Gewehr in der Hand. Aus der Dachluke mag er manch ehrlichem Deutschen nach dem Schädel oder der Brust gezielt haben. Der Bursche hat die Hände emporheben müssen. Schlotternd, käsebleich steht er da. „Wer ist dieser Bursche?“ frage ich den Alten. Sie sind alle drei auf die Knie gefallen, wie vom Blitz gefällt, und lamentieren. Die Frau kreischt: „Es ist mein Sohn! Um Gottes willen. Sie wollen ihm doch nicht ans Leben?!“ ... Und die Fünfzehnjährige heult herzbrechend. Der Festgenommene will entwischen und wird von den Mannschaften an die Hausmauer gestellt.
Ich muss mir gewaltsam das Bild ausmalen von den diensteifrig in die Nacht hinausreitenden deutschen Patrouillen, um deren Helme die Kugeln heimtückischer Franktireurs sausen, muss mir so recht eindringlich die sehnigen Gestalten und leuchtenden Augen unserer guten deutschen Jungen vorstellen, um diesem Jammer gegenüber Herr meiner Nerven zu bleiben und dem Befehl nachzukommen. „Er wird erschossen. Drei Mann. Fertig.“
Und von den drei Wehrleuten — es sind Familienväter, zwei Berliner und ein Landwirt — zuckt auch nicht einer mit der Wimper. Diese Sache ist gerecht. Hier ist ein Schurke gefasst, der kein Mitleid verdient. Die Salve kracht. Der schlotternde Körper sinkt in sich zusammen und rührt sich nicht mehr. In der blauen Bluse sind drei winzige Öffnungen zu sehen. Die Augen sind geschlossen, das Gesicht hat den Ausdruck überhaupt nicht gewechselt. Der Tod durch unser Gewehr ist schmerzlos. Aber auf belgischen Strassen sind deutsche Soldaten von bübischem Gesindel wie diesem am Boden liegenden Strauchräuber angeschossen und, als sie wehrlos zusammenbrachen, grausam verstümmelt worden.
„Man müsste dem Halunken, dem Alten, die ganze Bude überm Kopf anstecken!“ meint der Flügelmann.
„Abmarschiert!“ befehle ich.
Die drei Leute liegen noch immer auf den Knien, der Tote liegt an der Mauer.
Im Verlauf des Tages habe ich noch zweiundzwanzig Gehöfte abzusuchen, die zu den Fermen Weisshaus, Chapelle, Hockelbach und Haut Vent gehören. In neun Häusern liefern die Besitzer ihre bis jetzt verborgen gehaltenen Schusswaffen noch gutwillig ab. Es befinden sich alle Sorten darunter: Pistolen, Doppelpistolen, Revolver, Jagdflinten, Teschings, Infanteriegewehre, Karabiner.
Abends treffe ich mit meiner Kompagnie in Thimister ein. Hier harren meiner auf dem Markt schon der Maire, der Curé und der Vicaire, um mir zu versichern, dass sie die Einwohnerschaft eindringlichst ermahnt haben. Die abgelieferten Waffen, die im Rathaus liegen, übernehme ich, um sie vernichten zu lassen.
Ein schwerer Tag ist herum.
Auf dem Marsch zur Maas
Die Mannschaften meiner Kompagnie bezogen Massenquartiere: im Rathaus von Thimister, in der Schulstube, in ein paar Scheunen. Ich ging von Quartier zu Quartier und ermahnte die Leute, auf der Hut zu sein, stundenweise einen Mann zum Wachbleiben zu bestimmen und die geladenen Gewehre für alle Fälle bereit zu halten. Überfälle von Franktireurs seien hier an der Tagesordnung, auch in den Häusern untergebrachte Mannschaften seien in diesem Gebiet, das von Lütticher Gesindel überschwemmt ist, ihres Lebens nicht sicher. Sie sollten auch nichts trinken, von dem der Quartiergeber nicht vor ihren Augen selbst getrunken habe.
Und dann sass ich mit meinem ältesten Zugführer, dem Professor der orientalischen Sprachen, bei unserem Wirt, dem jungen Vicaire; wir hatten eine angeregte französische Konversation über die Präraffaeliten, über türkische Dialekte und über neue Rosensorten, die Lyonrose, die Juliette, die Soleil d’or, und es war gar nicht, als ob man in Feindesland sei. Erst als ich gegen Mitternacht in dem unheimlich grossen Schlafzimmer mich auszog und entdeckte, dass die drei Türen unverschliessbar waren, graulte ich mich ein bisschen.
Aber ich erwachte unter dem Schutz der zahlreichen Heiligenbilder, die den Raum schmückten, beim Sonnenaufgang völlig unbeschädigt, und um 6 Uhr verliess ich mit meiner Kompagnie und den vier Meldereitern den Ort, um meinen Auftrag auszuführen: über Battice vorzugehen, verschiedene Ortschaften abzusuchen und abends zum Bataillon zu stossen.
Für einen feldmarschmässig ausgerüsteten Infanteristen ist es ein Ding der Unmöglichkeit, enge Boden- und Kellertüren zu passieren, verborgene Behälter durchzustöbern, in jeden Winkel zu kriechen. Meine erste Sorge war also die: für jeden Zug ein Fuhrwerk zu requirieren, das die gepackten Tornister befördert. Meine Leute nahmen ihren schweren Auftrag mit doppeltem Eifer wahr, als sie von der Halbzentnerlast befreit waren. Und das Ergebnis des Tages gab meiner Fürsorge recht: in mehreren Orten entdeckten wir eine weit ausgedehnte Hausindustrie zur Fabrikation von Waffenteilen! Während in den Schlossereien und Schmieden dieser Ortschaften nur an ganz harmlosen Dingen gearbeitet wurde, ging die Waffenfabrikation in den Bodenkammern und Wohnstuben vor sich. In einem kleinen Wohnhaus stiessen wir auf ein ungeheures Lager fast vollendeter Gewehrschlösser. Es war ein grosses Arsenal. Meine Sachverständigen in der Kompagnie erklärten sich bereit, aus dem vorhandenen Material binnen weniger Tage 20 000 Gewehre fertigzustellen. Ich liess alle Einwohner zusammentrommeln und untersagte ihnen jede weitere Arbeit. Sie mussten — Männer, Weiber und Kinder — die Materialien in Säcken und Kisten aus den Häusern herbeischleppen. Alle Werkzeuge wurden vernichtet, die Schraubstöcke auf einen Wagen verladen; ein Haus, dessen Bewohner Widerstand leisteten, liess ich in Brand stecken. Unter Androhung der Todesstrafe für jeden Versuch, von dem beschlagnahmten Material etwas wegzuholen, verliess ich das Dorf — kehrte aber noch einmal zurück, da mir der lebhafte Taubenverkehr in dieser Ortschaft verdächtig vorkam. Mein baumlanger Freund Adam, der der ersten Gruppe angehört, freute sich, mir seine Erfahrung zur Verfügung stellen zu können: er ist selbst Brieftaubenzüchter. Richtig, die erste der rasch aus dem nächsten Schlag geholten Tauben hatte auf dem linken Flügel einen Stempel. Es ist gar kein Zweifel, dass diese Brieftauben dazu bestimmt waren, den in und um Lüttich sich bildenden Franktireurbanden Nachrichten über den Fortgang der Gewehrfabrikation zu geben. In langen Körben führte der Materialienwagen die beschlagnahmten Brieftauben dem Bataillon zu — und noch am selben Abend ging die Meldung über meine Erkundung an die Brigade ab. Gewiss sind sofort von der Etappen-Inspektion Massregeln getroffen worden, um eine Bewaffnung des Lütticher Gesindels durch die Hausindustrie dieses Gebietes unmöglich zu machen.
Je mehr wir uns Lüttich nähern, desto zahlreicher werden die grauenvollen Zeugen des Krieges. Sämtliche Häuser, aus denen unsere Truppen beschossen wurden, sind in Brand gesteckt worden. Zehn, zwölf verqualmte Ruinen bilden die Ortschaft Rabosé. Neben der Strasse liegen erschossene Pferde, halbverbrannte Ochsen und Schweine. Der Gestank ist fürchterlich. Oben auf der den Ort und das Tal beherrschenden Anhöhe sind Schützengräben ausgehoben. In diesen haben die belgischen Truppen unsere Leute, die den Ort stürmten, mit einem dichten Kugelregen empfangen. Aber das unheimliche Vorrücken der Preussen ging weiter und weiter, trotz des Kugelregens, trotz der Stacheldrähte, die den Belgiern als unüberwindliche Hindernisse gelten. Und nach einem letzten verzweifelten Schnellfeuer flohen die Belgier.
Während das Bataillon abkocht, besuche ich den auf freiem Felde angelegten Friedhof. Eine Reihe ganz frischer Gräber mit weissen Holzkreuzen. „Unser lieber Kompagniechef Hptm. v. W.“ las ich am ersten. Eine zweite Hügelreihe trägt die Helme der hier bestatteten tapferen Mannschaften. Und weiterhin liegen Belgier. Der bei weitem grössere Teil von ihnen ist aber kriegsgefangen abgeführt worden.
Von drüben schallt das eifrige Durcheinander der tausend Mann, die sich ihre Mahlzeit an den Kochfeuern bereiten. Der Adjutant, der vielgewandte, bewährt sich als Gentleman-Koch. Ein Spanferkelchen, das noch vor einer halben Stunde durch das von allen Bewohnern verlassene Dorf quiekte, röstet am Spiess. Aber es ist ein Manöverbild mit gar ernstem Hintergrund. Dicht bei dem kleinen Feldfriedhof steht ein Haus in hellen Flammen. Franktireurs haben heute früh aus den Fenstern auf eine Ulanenpatrouille geschossen. Einer der Burschen ist erwischt worden. Man hat ihn an die nächste Mauer gestellt und niedergeknallt und das Haus in Brand gesteckt. Blutrot geht die Sonne unter. Die roten Flammen des