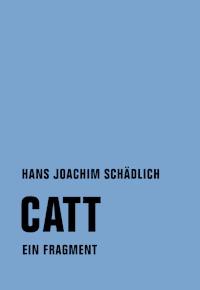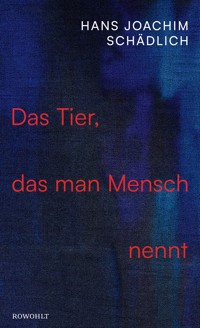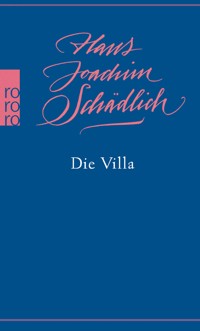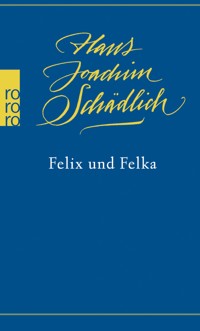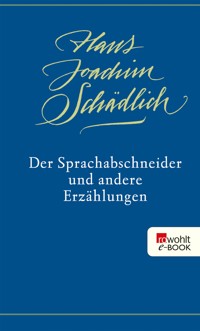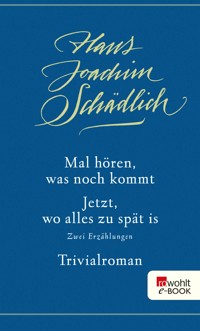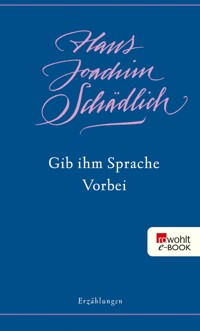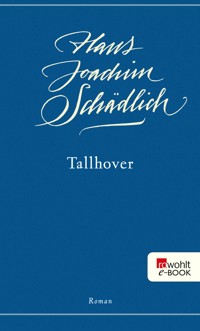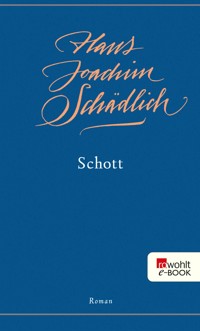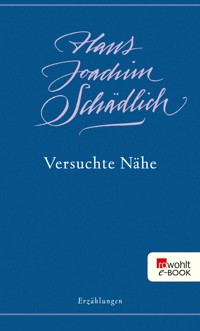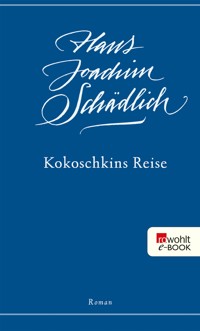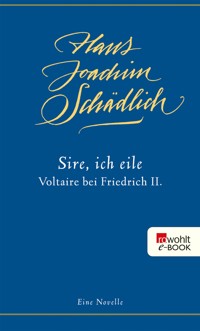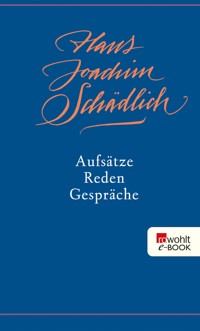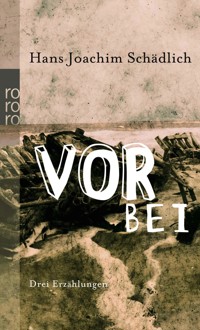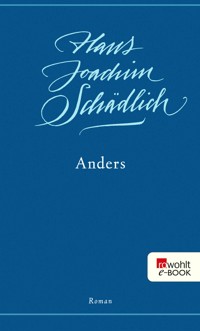
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Schädlich: Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
«Wenn du lange genug glaubst, daß du von etwas nichts weißt, dann weißt du am Ende wirklich nichts davon.» Zwei lakonische ältere Herren reden über «Fälle» von Menschen, denen es gelingt, sich nicht nur vor der Umwelt, sondern auch vor sich selbst ganz anders zu präsentieren, als sie sind. Oder über solche, die wirklich anders werden.Und über solche, die nur «anders» sind als die «normale» Umgebung. «Ein wichtiges, fesselndes Buch.» (Der Spiegel) «Hans Joachim Schädlich erzählt von der Isolation, in die gerät, wer nicht mit den anderen in Übereinstimmung lebt. Was die meisten Menschen einfach wegstecken, die Tatsache des politischen, aber auch des persönlichen Verrats, nimmt sich der Erzähler dieses Romans zu Herzen.» (Süddeutsche Zeitung) «Schädlich brilliert als zornig genauer Kartograph grotesker Maskierungen.» (Der Spiegel) «Kein Enthüllungsbuch. Aber wohl ein Anschauungsbuch menschlicher Abgründe.» (Hessischer Rundfunk)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Hans Joachim Schädlich
Anders
Roman
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
«Wenn du lange genug glaubst, daß du von etwas nichts weißt, dann weißt du am Ende wirklich nichts davon.»
Zwei lakonische ältere Herren reden über «Fälle» von Menschen, denen es gelingt, sich nicht nur vor der Umwelt, sondern auch vor sich selbst ganz anders zu präsentieren, als sie sind. Oder über solche, die wirklich anders werden.Und über solche, die nur «anders» sind als die «normale» Umgebung.
«Ein wichtiges, fesselndes Buch.» (Der Spiegel)
«Hans Joachim Schädlich erzählt von der Isolation, in die gerät, wer nicht mit den anderen in Übereinstimmung lebt. Was die meisten Menschen einfach wegstecken, die Tatsache des politischen, aber auch des persönlichen Verrats, nimmt sich der Erzähler dieses Romans zu Herzen.» (Süddeutsche Zeitung)
«Schädlich brilliert als zornig genauer Kartograph grotesker Maskierungen.» (Der Spiegel)
«Kein Enthüllungsbuch. Aber wohl ein Anschauungsbuch menschlicher Abgründe.» (Hessischer Rundfunk)
Über Hans Joachim Schädlich
Hans Joachim Schädlich, 1935 in Reichenbach im Vogtland geboren, arbeitete an der Akademie der Wissenschaften in Berlin, bevor er 1977 in die Bundesrepublik übersiedelte. Heute lebt er wieder in Berlin. Für sein Werk bekam er viele Auszeichnungen, u.a. den Heinrich-Böll-Preis, Hans-Sahl-Preis, Kleist-Preis, Schiller-Gedächtnispreis des Landes Baden-Württemberg, Lessing-Preis, Samuel-Bogumil-Linde-Preis, Großen Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, Bremer Literaturpreis, Corine-Preis und Joseph-Breitbach-Preis.
Weitere Veröffentlichungen
Versuchte Nähe
Tallhover
Schott
Trivialroman
Der Sprachabschneider
Ostwestberlin
Mal hören, was noch kommt / Jetzt, wo alles zu spät is
Gib ihm Sprache. Leben und Tod des Dichters Äsop
Der andere Blick
Vorbei
Kokoschkins Reise
Sire, ich eile ...
Narrenleben
Inhaltsübersicht
1
Mein letzter Freund hat verlauten lassen: «Endlich kann ich tun, was ich schon immer wollte.»
Ich bin allergisch gegen solcherart Verlautbarung, besonders bei Awa. Er konnte schon immer tun, was er wollte; es liegt in seiner Natur.
«Vierzig Jahre habe ich auf diesen Tag gewartet», hatte Awa hinzugesetzt.
Ich war empört, aber mir versagte die Stimme. Hätte ich mich im Spiegel sehen können, so wäre ich meiner Empörung gewahr geworden: mir stieg das Blut zu Kopf, ich wurde schmallippig.
Awa gewahrte offensichtlich nichts. Anders hätte er nicht fortfahren können: «Ich habe Dinge erlebt – ganze Romane könnte ich darüber schreiben. Zum Beispiel vorgestern.»
Ich hätte erwidern sollen: «Du hast nicht genug erlebt, um auch nur einen einzigen Roman zustande zu bringen. Im übrigen: man muß gar nichts erlebt haben. Und vor allem: du kannst gar nicht schreiben.» Ich schwieg.
Ich beneide Awa darum, daß er immer tut, was er gerade will. Was tat er denn in jenem Moment anderes? Hat er mich etwa gefragt, wie es mir geht? Sah ich vielleicht, als wir uns trafen, glücklich aus? Im Gegenteil!, nehme ich an.
Ich hatte Grund, unglücklich auszusehen. Ich war gerade von unserer Freundin Ida gekommen. Ich hatte ihr zum tausendsten Mal erklärt, daß ich sie liebe. Sie hatte zum fünfhundertsten Mal geantwortet: «Awa liebt mich auch.»
«Und du?» hatte ich zum zweihundertfünfzigsten Mal wissen wollen.
«Ich?» hatte Ida zum hundertsten Mal geantwortet, «ich liebe euch beide!»
Was tat Awa? Er sagte, was er gerade wollte: «Zum Beispiel vorgestern. Vorgestern rief ein Mann mich an, der behauptete, wir seien einander vor gut zwanzig Jahren in einer Klinik begegnet. Ich konnte mich zuerst nicht an den Mann erinnern. Aber als er gesagt hatte, daß ich eine Vorliebe für Muzio Clementi geäußert und ihm sogar die ersten Takte der Klaviersonate Opus 25, Nummer 5, in fis-Moll, vorgepfiffen hätte, da erinnerte ich mich. Jetzt kam mir sogar seine Stimme bekannt vor. Er nannte seinen Namen, und ich wußte, daß er die Wahrheit gesagt hatte. Der Mann heißt Rudolf Rauch. ‹Denken Sie einfach an Zigaretten›, sagte er, ‹und Sie wissen meinen Namen.›
Er hatte sich zwanzig Jahre lang mein Gesicht und meinen Namen gemerkt, denn auf meine Frage, wie er auf mich gekommen sei, sagte er: ‹Ich habe Sie kürzlich bei Wertheim gesehen.› Da dachte ich mir: ‹Sieh doch einfach im Telefonbuch nach und ruf ihn an.›
Ja. Ich fragte ihn, warum er mich nicht im Kaufhaus angesprochen habe. Rauch sagte: ‹Das wäre mir zu direkt gewesen.› Er fragte mich, wie es mir gehe.
‹Gut›, sagte ich, ‹ich habe seit meinem Klinikaufenthalt nie mehr Beschwerden gehabt.›
‹Ich schon›, sagte er, ‹ich habe bis heute Beschwerden. Aber ich habe gelernt, damit zu leben. Übrigens bin ich schon seit Jahren Invalide. Viel Geld habe ich nicht, aber es reicht. An Zigaretten und Kaffee fehlt es nie. Meine Wohnung ist klein und billig. Ich bin geschieden. Meine Kinder sind erwachsen.›
An dieser Stelle unseres Gesprächs wußte ich nicht weiter. Aber Rauch erinnerte mich daran, daß auch er ein Liebhaber der Musik sei; ob ich mich dessen entsinne? Er habe sogar Lieder komponiert. Nach eigenen Texten. ‹Darf ich Ihnen zwei Lieder vorspielen?›
Ich sagte notgedrungen: ‹Ja, gerne.›
‹Moment›, sagte er, ‹ich gehe mit dem Telefon zum Klavier.›
Zehn Sekunden später spielte und sang er mir zwei Lieder vor. Den Telefonhörer mußte er auf das Klavier gelegt haben. Der Ton schepperte. Die Lieder klangen nicht schlecht.
Rauch sagte: ‹Gefallen sie Ihnen?› – ‹Ja›, sagte ich. ‹Ich bedaure, daß ich keine Lieder komponieren kann.›
‹Dafür können sie etwas anderes›, meinte er. Und: ‹Wie wäre es, wenn Sie mich einmal besuchen kämen? Ich könnte Ihnen noch andere Lieder von mir vorspielen.›
‹Na ja,›, sagte ich, ‹es wäre mir lieber, Sie in einem Café zu treffen.›
‹Einverstanden›, sagte Rauch, ‹wie gefällt Ihnen Freitag, 17 Uhr, im Café Savo?› – ‹Gut›, sagte ich, ‹aber vielleicht erkenne ich Sie nicht wieder.›
‹Keine Sorge, ich mache mich schon bemerkbar.›
Ich war zehn Minuten vor 17 Uhr im Café. In einer Ecke saß ein abgerissener, verschmutzter, dürrer Mann mit zotteligem Langhaar. Er trank Tee und rauchte eine Zigarette. Er saß gekrümmt, hatte ein Oktavheft vor sich, murmelte, schrieb etwas auf, kratzte sich am Kopf, summte einige Töne. Ob er ein Lied komponiert?, dachte ich. Manchmal sah er von seiner Arbeit auf und blickte ängstlich-unwillig zu mir herüber. Ich konnte mich nicht dazu entschließen, zu ihm hinzugehen. Ich saß, trank Kaffee und wartete. Nach dreißig Minuten bin ich gegangen.
Heute rief Rauch mich an. ‹Ich konnte nicht ins Café kommen. Mein Kreislauf war ins Trudeln geraten.›»
Ich mußte jetzt zu Awa sagen: «Du kannst dich sonnen in deiner Eitelkeit. Jemand hat sich zwanzig Jahre lang dein Gesicht gemerkt und was du ihm vorgepfiffen hast.»
«Und meinen Namen!»
«Dein Name ist nur ein Klang.»
«Er hat drei Buchstaben.»
«Ich jedenfalls hätte dich nicht wiedererkannt. Sieh dich doch an. Verglichen mit damals, als du in der Klinik warst, bist du ein anderer. Zumindest äußerlich. Ich sage nicht, daß du schlechter oder besser aussiehst. Daß Rauch dich nach zwanzig Jahren erkannt hat, spricht sehr für ihn.»
«Das weiß ich nicht.»
«Aber was geht Rauch mich an. Ich muß mit dir über Ida reden.»
«Schon wieder?»
«Ich kann es nicht mehr ertragen, daß sie, eine erwachsene Frau, sich wie ein Kind beträgt.»
«Gerade das liebe ich.»
«Als sie noch jung und schön war, hat sie sich meiner Phantasie so stark bemächtigt, daß ich hingerissen wurde, zeitlebens für sie zu sorgen.»
«Sie ist mit jedem Jahr schöner geworden. Aber hast du für sie gesorgt? Vergiß doch nicht, daß sie auf eigenen Beinen steht. Zeitweise hat sogar sie für dich gesorgt.»
«Ich kann mir nicht helfen», sagte ich, «oft hatte ich den Eindruck, daß sie ihren Beruf für bloßen Spaß hält.»
«Das beklagst du?» sagte Awa. «Ich liebe es.»
«Sie denkt nicht daran, was gewesen ist, sie denkt nicht an das, was kommt, sie klebt nur an der Gegenwart.»
«Während du natürlich ganz in der Vorstellung lebst!»
«Auch in der Vergangenheit.»
«Sei doch froh, daß Ida dir den Alltagskopf zurechtrückt.»
«Wenn ich an ihre Nüchternheit denke, dann läuft mir allmählich die Galle über.»
«Anders als nüchtern möchte ich sie mir gar nicht vorstellen.»
2
Manchmal höre ich mir einen üblichen Vortrag an. Letztens breitete der Redner eine endlose Menge von Daten aus, zog aber keine Schlußfolgerungen daraus. Vielleicht hielt er seinen Vortrag für ein Poem, das für sich selbst spreche. Seine Zuhörer betrachtete er offenbar als Liebhaber der Poesie, die sich ihren eigenen Reim auf seine Datenmenge machen sollten.
Unter den Zuhörern befanden sich einige Fachkollegen. Wie immer nach einem Vortrag wollten wir im Club noch Wein trinken. Ich setzte mich neben eine Frau unbestimmten Alters, die ungewöhnlich geschminkt war. Ich bestellte ein Glas Rotwein, und als der Wein gebracht war, sagte die Frau zu mir: «Sie kennen mich vielleicht nicht mehr, aber ich kenne Sie.»
«Wie das. Sie sind mir vollkommen unbekannt.»
«Nein», sagte sie, «dank Ihrer war ich vor sieben Jahren fünf Monate lang auf der Forschungsstation in der Antarktis.»
«Das tut mir leid.»
«Neinnein», sagte sie, «ich war Ihnen damals dankbar, und ich bin es noch heute.»
«Wie heißen Sie.»
«Adriana.»
«Ich erinnere mich nicht.»
«Sie waren es», sagte sie, «der im Beirat für meinen Forschungsaufenthalt gestimmt hat.»
«Der Beirat hat acht Mitglieder. Mir kommt kein Verdienst zu.»
«Dochdoch», sagte sie.
«Was tun Sie heute», fragte ich.
«Ich beschäftige mich noch immer mit der Wirkung von Ozon auf den Organismus.»
«Und wo leben Sie?»
«Hier, in der Stadt. Mit meiner Tochter Antonia.»
«Wie alt ist Ihre Tochter.»
«Sechs Jahre. Übrigens, Sie kennen den Vater meiner Tochter.»
«Ich?»
«Ja, er ist ein Kollege von Ihnen.»
In diesem Augenblick betraten drei große, breitschultrige Männer den Club. Adriana sagte halblaut: «Jetzt kommt die Mafia. Entschuldigen Sie mich.»
Sie stand auf, ging zu den drei Männern und begrüßte den größten von ihnen überschwenglich. Die drei fanden einen Tisch, und Adriana setzte sich zu ihnen. Sie blieb mindestens fünfzehn Minuten dort.
Als sie an meinen Tisch zurückgekehrt war, sagte ich: «Ihre persönlichen Beziehungen zur Mafia verwundern mich.»
«Ach», sagte sie, «das ist alles lange her, mindestens fünfzehn Jahre. Der Große war ein Geschäftspartner meines Mannes.»
«Sie sind verheiratet.»
«Geschieden. Bei uns ist es üblich, mit achtzehn Jahren zu heiraten.»
«Und Ihr geschiedener Mann gehört zur Mafia.»
«Damals gab es bei uns noch keine Mafia.»
«Was tut der Große jetzt.»
«Er besitzt eine Fabrik. Er ist Millionär. Und er studiert Religionsgeschichte. Aber wie gesagt: Sie kennen den Vater meiner Tochter.»
Adriana nannte den Namen des Mannes, und ich erinnerte mich. «Ja», sagte ich, «er hat eine Arbeit über die Tag- und Nachtgleiche geschrieben.»
«Dank Ihrer», sagte Adriana, «war er vor sieben Jahren fünf Monate lang auf der Forschungsstation in der Antarktis. Meine Tochter ist ein Forschungsstationskind.»
«Ich hoffe, der Vater Ihrer Tochter kümmert sich um sein Kind.»
«Nun ja», sagte Adriana, «ich muß ihm beibringen, daß sich die Unterhaltssumme erhöht hat.»
3
Awa war bei Ida. Er hat gesagt, sie sei ungehalten über mich. Ich scheine zu meinen, sie sei zu nichts anderem da, als mich aufzuheitern. Aber ihre Geduld habe allmählich ein Ende.
Ich weiß nicht, was Awa ihr erzählt hat.
Sie eigne sich weder zu meiner Erholung noch zu meinem Trost.
Ich bin entsetzt. Habe ich Ida jemals Grund für solche Sätze gegeben?
Sie sichere ihr Dasein durch harte Arbeit, und es erbittere sie, daß ich ihr ihre Kinderlosigkeit vorwerfe.
Bin ich etwa verrückt? Wer hätte denn der Vater sein sollen! Awa? Ich? Wie hätte Awa als Vater von Idas Kind sich mir gegenüber verhalten? Wie hätte ich mich als Vater von Idas Kind Awa gegenüber verhalten? Wie hätte Ida sich verhalten? Sie wäre dem Vater ihres Kindes am nächsten gewesen. Unerträglich. Ich bin froh, daß Ida kinderlos ist.
Ich scheine den Mann als den eigentlichen Menschen zu betrachten. Aber ich solle mich einmal ansehen: ganz davon zu schweigen, daß es mit meiner körperlichen Ansehnlichkeit nicht mehr weit her sei. Bei meiner Neigung, mich in die Vergangenheit oder gar in eine nebelhafte Zukunft zu denken, und das in meinem Alter!, gerate mir das Nächstliegende aus dem Blick.
Bin ich so?
Sie werfe mir meinen Geiz vor; oder wenn es schon kein Geiz sei, so sei es doch meine Unfähigkeit, das Leben zu genießen.
4
Katharinenkloster! Was weiß denn ich vom Katharinenkloster. Nur, daß es im Süden des Sinai liegt. Das habe ich Awa geantwortet.
Aber er: «Das ist alles?»
«Ja.»
«Du weißt nicht, was es mit dem Kloster auf sich hat?»
«Nein!»
«Tischendorf?»
«Wie?»
«Konstantin von Tischendorf?»
«Nein.»
«Codex Sinaiticus?»
«Nie gehört.»
«Also erstens …»
Ich finde die besserwisserisch-belehrende Art Awas widerwärtig. Wenn er mir «Erstens, zweitens, drittens» erklärt, was ich seines Erachtens wissen sollte, dann weiß ich schon, daß er das alles gerade erst irgendwo gelesen hat.
«Erstens liegt das Katharinenkloster nicht einfach irgendwo im Süden des Sinai, sondern am nördlichen Fuß des Dschebel Santa Katarina.»
«Aha.»
«Das ist der ‹Berg Sinai›, der Gesetzgebungsberg der Bibel …»
«Ich verstehe!!»
«Stell dir vor: Das Kloster wurde im Jahr 530 als eine Festung gebaut.»
«Das ist mir zu lange her, das kann ich mir nicht vorstellen.»
«Ein griechisch-orthodoxes Kloster.»
«Meinetwegen.»
«Vielleicht sollten wir einmal hinfahren.»
«Von Israel aus?»
«Oder von Ägypten aus.»
«Das ist mir zu heiß, das kann ich nicht aushalten.»
Jetzt wollte ich mir das Kloster vorstellen. Eine anderthalbtausend Jahre alte Klosterfestung in den Bergen. Aber es gelang mir nicht.
Ich sagte: «Und Tischendorf? Dein Konstantin von?»
Awa blieb sachlich. «Er hat das Katharinenkloster dreimal besucht.»
«Muß ich jetzt fragen: warum?»
«Tischendorf war Theologe und Paläograph, Kenner ältester Schriften. Ein großer Palimpsestenforscher und Schriftausleger. Er suchte den ursprünglichen Text des Neuen Testaments. Deshalb wollte er zum Sinai und nach Jerusalem und sonstwohin.»
«Trabt jetzt Kara Ben Nemsi durch die Wüste?»
«Am 12. Mai 1844 nachmittags um drei brach Tischendorf mit drei Beduinen und einem Dragoman als Übersetzer von Kairo auf, um zum Katharinenkloster zu reiten. Er mußte die ganze Küche mit sich führen: Reis, Hühner in einem Hühnerbehälter, Tee, Kaffee, Wasser in großen Tonkrügen undsoweiter. Auf einem Kamelrücken, mitten unter den bewaffneten Söhnen der Wüste, ein vogtländischer Doktor der Theologie. Am 24. Mai in der Frühe langte er vor dem Kloster an. Er machte sich durch Rufe bemerkbar. Es öffnete sich in rund zehn Metern Höhe eine Tür, und an einem Seil wurde ein Korb heruntergelassen. Zu ebener Erde gab es keine Tür. Tischendorf legte seine Empfehlungsschreiben in den Korb, der sogleich in die Höhe gezogen wurde. Nach kurzer Zeit ließen die Mönche ein Seil mit einem Querholz herab; Tischendorf setzte sich auf das Holz, hielt sich am Seil fest und wurde in die Höhe gehaspelt.»
Ich sagte zu Awa nur: «Was ist ein vogtländischer Doktor der Theologie?»
«Tischendorf ist im Vogtland geboren, in Lengenfeld.»
«Ist das wichtig? Ich habe noch nie etwas von diesem Ort gehört.»
«Im Kloster wollte Tischendorf so bald wie möglich in die Bibliothek. Eine alte Aufschrift am Portal bezeichnete den Bibliotheksraum als Heilort der Seele oder geistliche Apotheke. Aber Tischendorf war vom Zustand der Bibliothek entsetzt. Umherliegende Blätter zeigten ihm, daß uralte kostbare Manuskripte von den unwissenden Klosterbrüdern barbarisch zerstört worden waren. Mitten im Raum stand ein großer Korb, der die Überreste beschädigter Handschriften enthielt. Der Klosterbibliothekar, ein gewisser Kyrillos, erwähnte beiläufig, man habe schon zwei Korbfüllungen dieses Zeugs verbrannt. Die dritte Ladung werde auch bald ins Feuer geworfen.»
«Ich frage mich, ob Tischendorf überhaupt in unsere Sammlung gehört.»
Awa sagte: «Kannst du eine Geschichte nicht erst einmal bis zu Ende anhören?! Jedenfalls, Tischendorf nahm einige Blätter aus dem Korb und bemerkte schnell, daß es wertlose Stücke waren. Schließlich aber zog er eine Anzahl von Pergamentblättern hervor, deren Schrift auf das höchste Alter schließen ließ. Tischendorf datierte die Schrift in das 4. Jahrhundert. Die Blätter mußten seit der Gründung des Katharinenklosters in der Bibliothek gelegen haben, seit 1300 Jahren. Es war die älteste griechische Handschrift, die die Welt bis dahin kannte. Es waren 129 Blätter aus der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. 43 Blätter durfte Tischendorf an sich nehmen. Die übrigen 86 Blätter hielten die Klosterbrüder zurück.»
«Und weiter?»
«Tischendorf legte dem Bibliothekar Kyrillos dringend nahe, die restlichen Blätter sorgsam zu hüten. Er sagte ihm auch, daß er zurückkommen und bis dahin die kaiserliche russische Regierung ins Interesse zu ziehen versuchen werde. Der russische Kaiser war schließlich der mächtigste Glaubensgenosse des Klosters.»
«Na bravo. Tischendorf war losgezogen, um das Neue Testament zu suchen, aber gefunden hatte er das Alte. Und von dem kriegte er auch nur 43 Blätter.»
«Aber er hat nicht lockergelassen. 1853 ist er zum zweiten Mal losgefahren.»
«Von Lengenfeld im Vogtland?»
«Von Leipzig. Dort war er 1850 Honorarprofessor geworden. Im Januar machte Tischendorf sich auf den Weg. Er wollte endlich das älteste Neue Testament finden. Die 86 Blätter des Alten Testaments, die er 1844 hatte zurücklassen müssen, wollte er diesmal kaufen oder wenigstens ganz genau abschreiben. Aber diesen alten großen Schatz fand er nicht wieder. Der Klosterbibliothekar Kyrillos, dem Tischendorf die Blätter 1844 ans Herz gelegt hatte, wußte nicht, was aus den Blättern geworden war. Der Schatz war verschollen. Und vom Neuen Testament keine Spur. Enttäuscht reiste Tischendorf im Mai nach Leipzig zurück.»
«War’s das?»
«Nein. Die verschwundenen Blätter des Alten Testaments ließen Tischendorf keine Ruhe. Das nächste, was er tat: er wurde bei der russischen Regierung vorstellig. Die orthodoxe Christenheit empfand den russischen Kaiser als ihren obersten Schutzherrn.»
«Das hast du schon gesagt.»
«Von ihm erhoffte Tischendorf sich Protektion.»
«Wie. Tischendorf fuhr zuallererst von Leipzig nach Petersburg?»
«Ach was. Nach Dresden. Dort residierte der kaiserlich-russische Gesandte Wolkowsky. Tischendorf erbot sich, als Beauftragter Alexanders II. im Orient wichtigste heilige Handschriften aufzuspüren und zu kaufen. Diese Handschriften sollten dann Eigentum des russischen Kaisers sein. Der russische Kulturminister Norow, ein Orientkenner, kam höchstpersönlich nach Leipzig und besprach mit Tischendorf die Details. Bald darauf befürwortete die Kaiserliche Akademie in Petersburg Tischendorfs Vorhaben. Der Bruder des Kaisers, Großfürst Konstantin, die Kaiserin Maria und die Mutter der Kaiserin waren höchst angetan. Schließlich trug Norow dem Kaiser die Sache vor; Tischendorf erhielt den Auftrag, sich als Abgesandter des russischen Kaisers auf den Weg zu machen.»
«Dauert deine Geschichte noch lange?»
«Sie ist gleich zu Ende. Fürst Wolkowsky, der russische Gesandte in Dresden, übergab Tischendorf eine große Summe in russischem Gold für den Ankauf alter Handschriften und für die teure Reise. Tischendorf brauchte den Empfang nicht einmal zu quittieren.
In den ersten Januartagen 1859 machte Tischendorf sich zum dritten Mal auf die Reise nach Ägypten. Alexandrien, Kairo, schließlich eine Kamel-Expedition durch die sinaitische Wüste. Am 30. Januar traf er im Katharinenkloster ein. Der alte Bibliothekar Kyrillos, mit dem Tischendorf seit 1844 befreundet war, freute sich über das Wiedersehen. Dem Abt Dionysios war Tischendorf durch die russische Regierung schon angekündigt. Wieder suchte er nach den 86 Blättern, die ihm seit 1844 nicht aus dem Kopf gegangen waren. Aber sie blieben unauffindbar. Es war Tischendorf zumute wie 1853: hoffnungslos.
Er bestellte für den 7. Februar Beduinen und Kamele für den Rückweg nach Kairo. Er hielt es für unwahrscheinlich, daß er je noch einmal die Strapazen einer Sinai-Expedition würde auf sich nehmen können; er wollte sich für immer vom Sinai verabschieden und unternahm in den folgenden Tagen Ausflüge in die Umgebung des Klosters. Nach einem anstrengenden Ausflug, den er mit dem Hausverwalter des Klosters, einem jungen Mönch aus Athen, unternommen hatte, lud der Mönch ihn noch zu einem Erfrischungstrunk in seine Zelle ein. Der Mönch holte aus einer Ecke ein Paket hervor, das in ein rotes Tuch gehüllt war, legte das Paket auf den Tisch und sagte: ‹Ich habe hier ein griechisches Altes Testament.›
Tischendorf schlug das Tuch zurück, und vor ihm lag ein Stapel großer Pergamentblätter: Was sah er? Die 86 Blätter, die er 1844 schon einmal in der Hand gehalten, aber im Kloster hatte zurücklassen müssen. Doch es war noch viel mehr! Weitere 112 Blätter mit alttestamentlichem Text. Und 148 Blätter, die das Neue Testament enthielten. Das Neue Testament in uralter Handschrift. Tischendorf war am Ziel. Nebenbei gesagt: Es war der älteste und vollständigste Text des Neuen Testaments, eine Handschrift aus dem 4. Jahrhundert.
Wie aber die Handschrift aus dem Katharinenkloster schaffen? Tischendorf wollte, daß die Mönche es ihm erlaubten, die Handschrift nach Rußland zu bringen, als ein Geschenk für den russischen Kaiser. Er bot dem Kloster eine reiche Goldsumme, und dem Hausverwalter auch. Aber die Mönche zögerten. Tischendorf brannte darauf, die Texte der Handschrift zu veröffentlichen. Er bat die Mönche, ihm die Handschrift wenigstens zu leihen. Er wollte sie nach Kairo mitnehmen, in das Tochterkloster, wo er sie in Ruhe würde abschreiben können. Damit waren die Mönche einverstanden, aber einer von ihnen widersprach. Deshalb mußte der Abt Dionysios die Sache entscheiden; der Abt hielt sich gerade in Kairo auf.
Am 7. Februar ritt Tischendorf nach Kairo, am 13. Februar war er dort. Schon am nächsten Morgen stellte er sich im Tochterkloster der Sinaibrüder ein. Er fand Dionysios vor, und der entschied, daß die Handschrift in das Kairoer Tochterkloster gebracht werden dürfe.
Jetzt wurde ein Beduinenscheich losgeschickt, die Handschrift vom Katharinenkloster abzuholen. Weil Tischendorf dem Scheich eine hohe Belohnung in Gold versprach, falls er sich nur möglichst beeile, stellte der einen wahren Rekord auf. Innerhalb von acht Tagen war er in Kairo zurück. Kaum zu fassen, daß der unersetzliche Schatz auf einem Kamelrücken durch die Sinaiwüste transportiert worden war.
Man schloß auf dem russischen Konsulat einen Vertrag, der vorsah, daß Tischendorf jeweils acht Blätter der Handschrift in sein Hotel mitnehmen durfte. Dort, im Hotel des Pyramides, am Esbekije-Platz, schrieb er die Handschrift ab. Er hatte zwei Deutsche engagiert, die das Griechische beherrschten, den Arzt Dr. L’Orange aus Königsberg und einen Apotheker aus Leipzig, die halfen ihm bei der Abschrift. 132000 kurze Zeilen mußten abgeschrieben und revidiert werden. Zwischen 5 und 6 Uhr stand Tischendorf auf; gegen 7 Uhr kamen der Doktor und der Apotheker, mit denen Tischendorf Kaffee trank. Um 12 Uhr wurde im Salon reichlich gefrühstückt, und ab 14 Uhr saßen die drei wieder am Arbeitstisch bis 18 Uhr. Nach dem Einbruch der Dunkelheit gab es das Mittagessen. So ging es zwei Monate lang.
Tischendorf hegte noch immer die Hoffnung, das unschätzbare Original zu erwerben.»
«Du hattest gesagt, die Geschichte sei gleich zu Ende.»
«Zwar hätte Tischendorf schon einen großen Triumph feiern können, wenn er auch nur mit der Abschrift zum Druck gekommen wäre. Aber er wollte das Original.
Der Idee, die Handschrift dem russischen Kaiser zu schenken, waren die Klosterbrüder nicht abgeneigt; sie wollten sich für immer der kaiserlichen Unterstützung versichern und rechneten zudem mit einem großzügigen Gegengeschenk. Die Schenkung mußte allerdings von ihrem Erzbischof gebilligt werden. Der Erzbischof aber war gerade gestorben, und die Wahl eines Nachfolgers konnte lange auf sich warten lassen.
In dieser Situation reiste Tischendorf nach Konstantinopel und suchte den kaiserlich-russischen Botschafter bei der Hohen Pforte, Fürst Lobanow, auf. Lobanow sollte und wollte Tischendorf im Interesse des russischen Kaisers helfen.
Tischendorf kam der Gedanke, daß Fürst Lobanow in seiner offiziellen Eigenschaft ein Papier ausstellen könnte, das ungefähr folgendermaßen lauten sollte: ‹Herr Tischendorf hat mir mitgeteilt, daß die Sinaiten den Vorsatz haben, das alte Bibelmanuskript durch seine Vermittlung dem Kaiser zum Geschenk zu machen. Da dies aber nicht eher offiziell ausgeführt werden kann, als bis der neuerwählte Chef der Sinaitischen Brüderschaft offiziell anerkannt worden, so wünscht Tischendorf, das besagte Manuskript unterdessen nach Petersburg zu entleihen zum Behufe der Kontrolle seiner Abschrift während des Druckes. Indem der unterzeichnete kaiserliche Gesandte diesen Wunsch Herrn Tischendorfs unterstützt, erklärt er ausdrücklich, daß die besagte Handschrift, wenn sie demselben nach Petersburg geliehen wird, nichtsdestoweniger Eigentum der Sinaiten bleibt, bis der Superior im Namen seiner Brüderschaft, schriftlich oder durch eine Deputation, die Darbringung an den Kaiser förmlich vollzogen haben wird.›
Lobanow war einverstanden.
Mit diesem Schreiben fuhr Tischendorf nach Kairo zurück.
Der Klosterkonvent folgte Lobanow; Tischendorf sollte die Handschrift jetzt ausgehändigt bekommen. Eingeschlagen in das rote Tuch, landete das Konvolut am 28. September in seinem Hotel, überbracht von Dienern des Tochterklosters.
Nun hielt ihn nichts mehr. Am 9. Oktober reiste er ab. Erster Halt war Wien. Hier zeigte Tischendorf dem Kaiser Franz Joseph die Handschrift. Von Wien ging es nach Dresden, um König Johann von Sachsen die Kostbarkeit vorzuführen. In Dresden traf Tischendorf auch den russischen Gesandten, Fürst Wolkowsky, der ihn mit Gold ausgestattet und auf die Reise geschickt hatte. Im Palais der russischen Gesandtschaft wurde die Handschrift für einige Tage öffentlich ausgestellt. Zeit für eine Reise nach Leipzig zu seiner Frau Angelika, nahm er sich nicht. Angelika Tischendorf mußte nach Dresden kommen.
Endlich, am 1. November, konnte Tischendorf von Dresden nach Petersburg reisen. Am 21. November legte Tischendorf die Gegenstände seiner Sammlung im Chinesischen Saal des kaiserlichen Residenzschlosses Zarskoje Selo auf sechs Tischen zur Schau aus: nicht nur die älteste Handschrift des Alten und des Neuen Testaments, sondern auch alle anderen Handschriften, die er gefunden hatte, und einige ägyptische Antiquitäten. Einen der Tische schmückte er mit Jericho-Rosen.
Kaiser Alexander II. und Kaiserin Maria ließen sich von Tischendorf eine ganze Stunde lang unterrichten.
Einige Zeit später wurden die Handschriften und Altertümer in der Kaiserlichen Bibliothek öffentlich ausgestellt.
Vor seiner Abreise Mitte Dezember bekam Tischendorf ein kaiserliches Geschenk zugestellt: 5000 Taler.»
«Momentchen mal. Du bist mit der Handschrift schon beim russischen Kaiser, aber ich habe nicht gehört, welche Sicherheiten Tischendorf den Sinaibrüdern geboten hat. Oder brauchte er ‹den Empfang› der Handschrift ‹nicht einmal zu quittieren›?»
«Er hat in Kairo den Empfang am 28. September quittiert: ‹Ich, der Unterzeichnende, Konstantin Tischendorf, zur Zeit unterwegs im Nahen Osten in einer Mission unter Auftrag von Alexander II., Zar aller Russen, bestätige durch das vorliegende Schreiben, daß die Heilige Bruderschaft vom Berge Sinai, in Übereinstimmung mit dem Brief seiner Excellenz des Botschafters Lobanow, mir leihweise ein altes Manuskript des Alten und Neuen Testaments ausgehändigt hat, welches Eigentum des zuvorgenannten Klosters ist und 346 Folia sowie ein kleines Fragment enthält. Dieses werde ich mit nach St. Petersburg nehmen, um die Kopie, die zuvor von mir angefertigt worden ist, mit dem Original zu vergleichen während der Zeit, in der das Manuskript zur Veröffentlichung gelangt.
Das Manuskript ist mir anvertraut worden unter den Bedingungen, die in dem zuvorgenannten Brief von Herrn Lobanow am 10.9.1859 festgelegt sind. Ich verspreche, dieses Manuskript der Heiligen Bruderschaft vom Sinai zurückzubringen, unbeschädigt und in gutem Erhaltungszustand, auf ihr frühestes Ersuchen.›»
«Und? Hat Tischendorf das Manuskript zurückgebracht?»
«Nein.»
«Das glaube ich nicht.»
«Es gab doch den Brief von Lobanow. Tischendorf hat sich darauf bezogen: die Handschrift bleibt ‹Eigentum der Sinaiten, bis der Superior … die Darbringung an den russischen Kaiser vollzogen haben wird.›»
«Ich borg dir mein Auto, und du gibst es mir nicht zurück, weil ich es dir schließlich schenke. Ungefähr so?»
«Du willst es mir schenken, und bis dahin borgst du es mir. So ungefähr.»
«Was ist mit der Handschrift geschehen.»
«Ein Teil der Handschrift wanderte mit Tischendorf nach Leipzig; Tischendorf sollte das Alte und Neue Testament bei Giesecke & Devrient in Leipzig drucken lassen. Der Erscheinungsort der Ausgabe sollte aber Petersburg heißen. Der andere Teil der Handschrift blieb vorläufig im russischen Außenministerium verwahrt.
1862, im Herbst, stand das 1000jährige Jubiläum der russischen Monarchie ins Haus. Bis dahin wollte Alexander II. die Ausgabe in Händen halten. Tischendorf blieben zwei Jahre Zeit für den komplizierten Druck.
Ostern 1862 hatte er die riesige Arbeit geschafft. Die prächtige Ausgabe des Alten und Neuen Testaments lag als ‹Bibliorum Codex Sinaiticus Petropolitanus› vor. Da hast du den kompletten ‹Codex Sinaiticus›.»
«Aber ich habe noch nicht das ‹von›.»
«Ach, das kam 1869. Da wurde Tischendorf durch Alexander II. der erbliche Adel verliehen. Die sächsische Regierung hat ihn bestätigt, was sonst.»
«Druckort des ‹Codex Sinaiticus› war Leipzig, Erscheinungsort war Petersburg.»