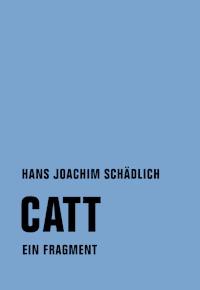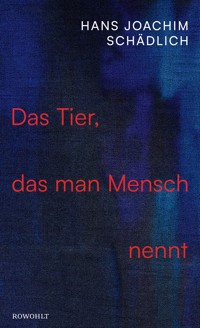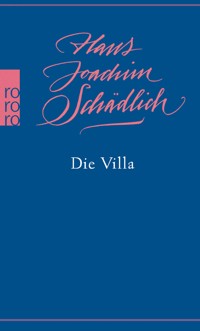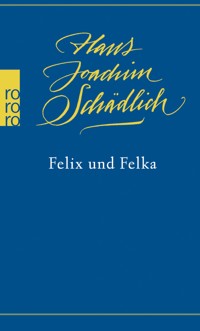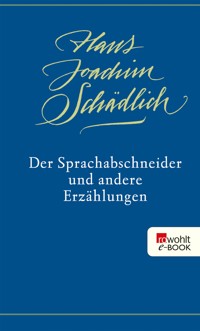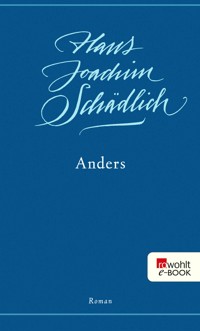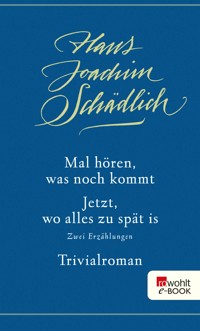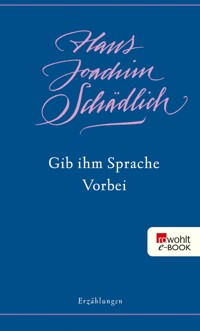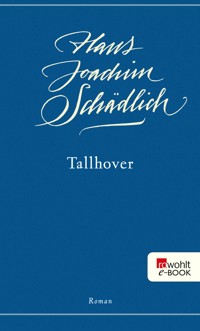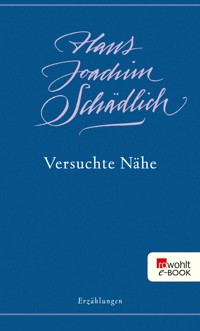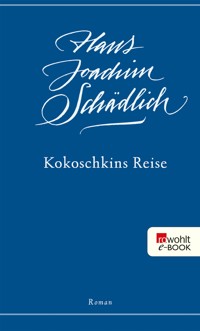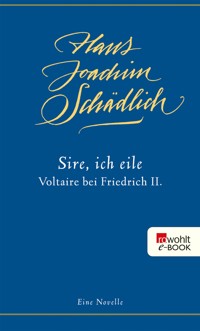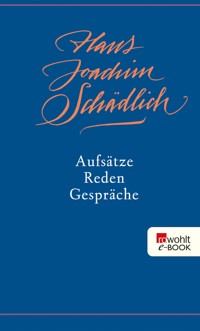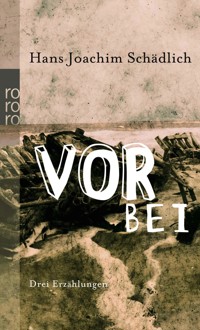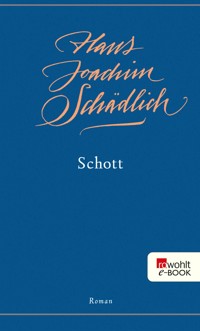
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Schädlich: Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
Der Roman handelt von dem Versuch des Erfinders, Flaneurs, Autofahrers, Rauchers und Hundehassers Schott, die Pilotin Liu zu finden. Sie fliegt Passagier- und Kampfflugzeuge. Sie fürchtet das Feuer. Sie wehrt Schotts Liebe ab. Aber mit wem spricht Schott, wenn er mit Liu spricht? Sie leben nicht in der gleichen Zeit. «Hans Joachim Schädlich ist der große Lakoniker unter den deutschen Autoren. Seine Sprache ist einfach, aber scharf und sezierend, das Ungeheure geschieht wie nebenbei.» (DIE ZEIT)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Hans Joachim Schädlich
Schott
Roman
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Der Roman handelt von dem Versuch des Erfinders, Flaneurs, Autofahrers, Rauchers und Hundehassers Schott, die Pilotin Liu zu finden. Sie fliegt Passagier- und Kampfflugzeuge. Sie fürchtet das Feuer. Sie wehrt Schotts Liebe ab. Aber mit wem spricht Schott, wenn er mit Liu spricht? Sie leben nicht in der gleichen Zeit.
«Hans Joachim Schädlich ist der große Lakoniker unter den deutschen Autoren. Seine Sprache ist einfach, aber scharf und sezierend, das Ungeheure geschieht wie nebenbei.» (DIE ZEIT)
Über Hans Joachim Schädlich
Hans Joachim Schädlich, 1935 in Reichenbach im Vogtland geboren, arbeitete an der Akademie der Wissenschaften in Berlin, bevor er 1977 in die Bundesrepublik übersiedelte. Heute lebt er wieder in Berlin. Für sein Werk bekam er viele Auszeichnungen, u.a. den Heinrich-Böll-Preis, Hans-Sahl-Preis, Kleist-Preis, Schiller-Gedächtnispreis des Landes Baden-Württemberg, Lessing-Preis, Samuel-Bogumil-Linde-Preis, Großen Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, Bremer Literaturpreis, Corine-Preis und Joseph-Breitbach-Preis.
Weitere Veröffentlichungen
Versuchte Nähe
Tallhover
Trivialroman
Der Sprachabschneider
Ostwestberlin
Mal hören, was noch kommt/Jetzt, wo alles zu spät is
Gib ihm Sprache. Leben und Tod des Dichters Äsop
Anders
Der andere Blick
Vorbei
Kokoschkins Reise
Sire, ich eile ...
Narrenleben
Inhaltsübersicht
Hans Georg Heepe gewidmet
Schott hat sich entschlossen, zu zweit zu leben.
Liu, der er diesen Entschluß soeben mitgeteilt hat, sieht ihn großäugig an.
Liu kennt Schott. Sie sagt, Zu zweit! Willst du mit dir selber leben?
Schott sagt, Sie sind eine Person, die ich am tiefsten kenne. Ich hätte an dich gedacht.
Es ist gleich gültig, ob SCHOTT mit diesen oder anderen Sätzen anfängt. In jedem Fall ist jeder Satz von Anfang an zweifelhaft. Und zweifelhaft bleibt jeder Satz bis zum Ende; deshalb ist es gleich gültig, ob SCHOTT mit diesen oder anderen Sätzen aufhört.
Es werden Leser erwartet, die Schotts Geschichte ästhetisch nicht befriedigt. Entweder des Inhalts (ein anderer Begriff des Ästhetischen) oder der Form wegen oder sowohl des Inhalts als auch der Form wegen, und zwar entweder der Erzählform oder der Sprachform wegen oder sowohl der Erzählform als auch der Sprachform wegen.
Des Inhalts wegen vielleicht, weil es nicht jedermanns Sache ist, Einzelheiten einer Verbrennung zur Kenntnis zu nehmen oder Einzelheiten des einen oder anderen Geschlechtsaktes, oder des einen und des anderen, oder Einzelheiten einer Verbrennung und einiger Geschlechtsakte.
Die ästhetische Befriedigung ist allerdings kein literarischer Zweck.
Andererseits kann es Leser geben, die Schotts Geschichte ästhetisch befriedigt. Entweder des Inhalts oder der Form wegen oder sowohl des Inhalts als auch der Form wegen.
Liu setzt sich in ihrer Küche an den Tisch und stützt den Kopf in die Hände. Liu besitzt schwarzes Haar; unter den schwarzen Haaren finden sich mehrere weiße, vorwiegend in den Gegenden der Schläfen. Lius Haar ist schulterlang und gewellt.
Schott setzt sich. Er steht wieder auf und sieht sich um.
Liu sagt, Der Aschenbecher ist im Arbeitszimmer. Du rauchst, aber es geht mich nichts an.
Leser, die hungrig sind auf unnützes Wissen, erhalten die Mitteilung, daß Schott weder mit dem Verfasser des SCHOTT identisch ist noch auch bloß irgendwelche einzelne Züge desselben trägt, äußere oder innere. So, beispielsweise, ist Schotts Haar trotz Schotts Alter dunkelbraun und dicht, das Haar des Verfassers aber hellgrau und licht. Der Verfasser neigt zu schneller, unkontrollierter Rede, Schott keinesfalls.
Schott sollte eine Ansicht über seine Nikotinsüchtigkeit äußern wollen, bevor er sich, den Aschenbecher in der Hand, an Lius Küchentisch setzt, oder er sollte bedauern wollen, daß Liu sagt, die Folgen seiner Nikotin- und Kondensat-Inhalation seien absehbar. Er sollte vielleicht sagen wollen, daß er sich selbst verachte, weil er Tabakrauch gern einatme, obwohl er über die voraussichtlichen Schäden an seinem Körper unterrichtet worden sei, oder er sollte sagen wollen, Lius deutlich spürbare Mißbilligung sei berechtigt, oder er sollte lediglich sagen wollen, er könne nicht anders. Noch lieber sollte er Lius Teilnahmslosigkeit bezweifeln oder sogar bestreiten wollen, sie als vorgeblich erweisen, Liu vorführen, daß ihr viel an ihm liege, daß er oder es sie etwas angehe, weil doch nur Lius Teilnahme an seiner Person es sei, woran ihm gelegen.
Schott setzt sich, den Aschenbecher in der Hand, an Lius Küchentisch und sagt, Was denkst du jetzt.
Nun stell schon den Aschenbecher hin. Und gib mir eine Zigarette.
Liu atmet Rauch ein, Schott atmet Rauch ein.
Daß du mich das fragen mußt, Schott. Du hast doch noch nie mit jemandem leben gekonnt. Warum solltest du es jetzt können.
Ich will es können. Ich will es können lernen.
Warum willst du es plötzlich.
Wenn ich es wollen kann, lerne ich es vielleicht.
Liu vernachlässigt ihre Frage und sagt, Ausgerechnet ich soll deine Schule sein.
Es kann vermutet werden, daß einige Leser sogar wissen wollen, warum Schott Schott heißt.
Ganz verfehlt wäre die Annahme des einen oder anderen dieser einigen Leser, Schott stehe als Person in der Nachfolge von Bernhard Schott, als Schotts Sohn oder Schotts Enkel oder Schotts Urenkel, und neben der Edition Schott gehörten Bücher, Lexika, Zeitschriften und Schallplatten zu seinem Programm. Nein. Wäre es so, Schott wäre ein anderer. Auf die Ausmalung, wer Schott, wäre er solcherart ein anderer, wäre, wird verzichtet.
Noch weniger steht Schott zu F. Schott in Beziehung, der seinen Unterhalt als Hilfslehrer der französischen und englischen Sprache und als Übersetzer aus dem Englischen verdiente.
Die Gelegenheit, mit biographischen Daten um sich zu werfen, verleitet zu der Bemerkung, daß von F. Schott weder das Todesjahr noch der vollständige Vorname bekannt ist.
Die leserliche Vorstellung, Schott führe sich auf Anselm Schott zurück, wäre zwar verlockend, aber falsch. Verlockend nicht nur, weil es schätzbar sein könnte, einen Vorfahren zu besitzen, dem das Glück zuteil wurde, in einem Ort wie Maria Laach gestorben zu sein, sondern auch, weil Anselm Schott das Glück zuteil ward, ein Meßbuch der heiligen Kirche verfaßt zu haben, das seiner Tiefe und Länge wegen einfach der Schott zu heißen kam.
Die womöglich nächstliegende Vermutung eines oder eines anderen Lesers, Schott sei Nachfahre von Otto Schott, wäre auch falsch. Das Bedauern gilt Schott. Wer zählte nicht gern einen Ahnen zu seinen Ahnen, dessen Glasfabriken 1916 die erste Stelle unter den Glasfabriken einnahmen. Da Schott Brillenträger und Teetrinker ist, wüßte es Schott im Fall einer Nachfahrenschaft um so anhänglicher zu schätzen, daß Otto Schott es verstand, homogene Gläser mit erwünschten optischen Eigenschaften sowie, mit der Hilfe seiner Genossen, jenes Glas zu erzeugen, in welchem Schott ohne weiteres seinen Tee aufgießt.
Zuletzt könnte Schott wärmendes Gefallen daran finden, daß Otto Schott Schotts Großvater mütterlicherseits stark ähnelt.
Aber leider.
Zuallerletzt wäre der Irrtum auszuräumen, Schott könnte in verwandtschaftlicher Verbindung zu Anton Schott aus Hinterhäuser im Böhmer Wald stehen. Schott steht in gar keiner Verbindung zum Böhmer Wald.
Liebhaber des Semikolons, denen eine Neigung zu konstruktivistischen Gespinsten nicht verwehrt werden kann, müßten enttäuscht sein, falls sie Schott für einen späten, namentlich reduzierten Abkömmling von Justus Georg Schottel gehalten haben sollten; er ist es nicht.
Selbst die Tatsache, daß Schott nach einer Antwort auf die Frage sucht, wie es mit Leib und Seele des Menschen kurz vor dem Tod, im Tod und nach dem Tod bewandt sein werde, liefert keinen Beweis für persönliche Verwandtschaft mit Schottel. Schottel war nicht der erste, Schott ist nicht der letzte. Schott weiß von Schottel übrigens nichts.
Die andere mögliche Annahme, Schotts Name sei von dem einen oder anderen der genannten und ungenannten Schotts wenigstens entliehen, ist ebenfalls verfehlt.
Vollkommen abwegig wäre eine formselige Überschätzung rein lautlicher Erscheinungen, wie sie höchstens von spitzfindigen Phonetikern geleistet werden könnte, aber immerhin. Der Gleichklang zweier Konsonanten im Namen des Verfassers und im Namen Schotts legt eine persönliche Verwandtschaft beider oder eine Art partieller Namensanleihe des einen bei dem anderen ebensowenig nahe wie die Kenntnis des Verfassers von der Verfassung Schotts sie nahelegt.
Immer wieder begegnet eine kränkende Unterschätzung der poetischen Vorstellungskraft oder der ausgedehnten Kenntnis von Verfassern oder der poetischen Vorstellungskraft und der ausgedehnten Kenntnis von Verfassern.
Von neugierigsten Lesern wird hartnäckig ignoriert, daß poetische Vorstellungskraft oder ausgedehnte Kenntnis oder poetische Vorstellungskraft und ausgedehnte Kenntnis es Verfassern erlaubt beziehungsweise erlauben, ganz von sich selber abzusehen und dagegen von dem Inneren und Äußeren anderer Personen zu sprechen, die es unter Umständen sogar gar nicht gibt. Anders gesagt: die es gar nicht gab, bevor Verfasser von ihnen gesprochen hatten.
Der Name Schotts rührt von einer eingebildeten Wertbestimmung eines wirklichen Vorfahren Schotts her; zudem ist der Name in Schotts Generation längst verstümmelt. Die Verstümmelung, die im 17. Jahrhundert eintrat, steigert die betreffende Wertbestimmung und verbirgt sie zugleich.
Kurz: Schott heißt Schott, weil schon sein Vater Schott hieß, sein Großvater, sein Urgroßvater, sein Ururgroßvater, und der Vorname Robert wurde Schott von seinem Vater beigelegt.
Das ist vorläufig alles.
Liu sagt, Warum ausgerechnet ich.
Das habe ich dir gesagt.
Liu sagt, Es war nicht der Grund. Ich kenne viele Leute tief.
Schott hält die Zigarette in der Höhe des Mundstücks; er zieht an der Zigarette, Zeige- und Mittelfinger berühren die Lippen. Es kann der Eindruck unverhohlener Gier auf Nikotin entstehen.
Schott sagt, Du zwingst mich zu Sätzen, die du weißt.
So bist du, Schott. Kennst mich besser als du andere kennst, aber verstehst nicht genug von mir.
Schott hat zwei Tage zuvor ein frisches Taschentuch in die Schublade des Küchentisches gelegt. Er hat gewußt, daß er es brauchen würde. Er zieht die Schublade auf und will das Taschentuch herausnehmen, um sich die Stirn zu wischen, aber das Taschentuch ist weg. Schott schiebt die Schublade zu.
Deshalb weißt du auch nicht, ob ich zu zweit leben will, sagt Liu.
Die Art, in der Liu diesen Satz sagt, kann betrübt und vorwurfsvoll oder rechtfertigend und abweisend heißen.
Schott sagt, Daß du es könntest, glaube ich.
Die Art, in der Schott diesen Satz sagt, kann werbend und hoffnungsvoll oder fordernd und anmaßend heißen.
Du fragst mich nicht einmal, ob ich es will, sagt Liu.
Schott sagt, War es keine Frage?
Ich will nicht verstanden haben, was gemeint war, ich will hören, was gemeint ist.
Du kennst mich, sagt Schott.
Liu sagt, Ob ich es könnte, weiß ich nicht. Selbst wenn ich es wollte.
Schott raucht die zweite Zigarette wie die erste.
Liu sagt, Rauchen ist auch eine Sache der Ästhetik.
Schott steht auf.
Du gehst also, sagt Liu.
Schott nimmt den Aschenbecher.
Liu sagt, Kränk mich nicht und laß den Aschenbecher stehen. Ich bin müde. Ich will schlafen. Ich muß gleich wieder aufstehen.
Anstatt in die rechte Straße einzubiegen, in der Schott wohnt, biegt Schott in die Auffahrt der Stadtautobahn ein, er fährt auf der Stadtautobahn in südliche Richtung.
Ein Auto mit einem Autofahrer kann die Stadtautobahn über jede Ausfahrt, die es mit ihm erreicht, verlassen, vorausgesetzt, die Ausfahrt ist nicht gesperrt. Mit einem solchen Gedanken im Kopf, das heißt mit einem solchen Gedanken fährt Schott gelegentlich an mehreren Ausfahrten vorbei. Gelegentlich verläßt er die Stadtautobahn erst nach 15 bis 20 Minuten in seinem Auto und über eine Ausfahrt, fährt auf Stadtstraßen in nördliche Richtung und fährt schließlich in die Straße, in der er wohnt, entweder von links oder von rechts.
Binnen 300 Metern fahren vor und hinter Schott und links und rechts von Schott, auch vor und hinter den Autos, die links und rechts von Schott fahren, Autos. Die Autos vor Schott und vor den Autos, die links und rechts von Schott fahren, fahren binnen 30 Sekunden derart langsam, daß Schott und die Autos hinter Schott und die Autos, die hinter den Autos fahren, welche links und rechts von Schott fahren, binnen 30 Sekunden derart langsam fahren.
Das heißt, Autos werden gefahren und fahren. Selbstverständlich fahren viele Autos auch, wenn sie nicht gefahren werden. Die Frage eines Kunden an den Verkäufer eines älteren Gebrauchtwagens, ob das Auto fahre, quittiert der Verkäufer mit dem Satz, Natürlich fährt es. Der erschreckte Blick eines Autofahrers auf ein entgegenkommendes Auto, in dem kein Fahrer zu sehen ist, unterrichtet auf andere Weise vom Sachverhalt. In diesem Fall ist das Auto entweder ohne Fahrer abgefahren (so etwas begegnet als menschliches oder technisches Versagen oder als Verbrechen, das von Zeit zu Zeit zugleich als menschliches Versagen auftritt) oder der Fahrer ist, am wahrscheinlichsten infolge eines akuten Krankheitszustandes, zur Seite gesunken oder gesackt. Es kann sich übrigens jedesmal, wenn von Fahrern die Rede ist, auch um Fahrerinnen handeln.
Der Kürze halber, die aus mehreren Gründen geraten erscheint, wird von fahrenden Autos statt von gefahren werdenden Autos geredet. Fahrende Autos, in denen kein Fahrer zu sehen ist, sind nicht beteiligt.
Die Gründe, aus denen Kürze geraten erscheint, werden jetzt nicht genannt, aber später.
Trotz des geringen Tempos aller Autos vor Schott und vor den Autos, die neben Schott fahren, sind die Autos vor Schott und die Autos vor den Autos, die neben Schott fahren, nicht gleich langsam.
Erst fahren die Autos vor Schott unvermutet ein wenig schneller als die Autos vor den Autos, die neben Schott fahren. Schott fährt sogleich ein wenig schneller. Er läßt die Autos neben sich augenblicklich neben sich hinter sich, so daß er links und rechts andere Fahrer in anderen Autos neben sich hat, als die Autos vor ihm wieder ebenso langsam fahren wie die Autos neben ihm. Der Fahrer des Autos links von Schott ist ungeduldig; er schlägt mit der rechten flachen Hand auf den Rand des Lenkrades. Der Fahrer des Autos rechts von Schott ist eine jüngere Frau, die das Lenkrad mit beiden Händen festhält; sie hat ihr Haar im Nacken hochgebunden, so daß das hochgebundene Haar den Eindruck eines Pferdeschwanzes erweckt.
Dann fahren die Autos vor dem Auto, das links von Schott fährt, ein wenig schneller. Der Fahrer des Autos links von Schott schlägt nicht mehr mit der rechten flachen Hand auf den Rand des Lenkrades, sondern hält das Lenkrad mit beiden Händen fest und fährt sogleich ein wenig schneller. Das Auto, das links neben Schott fuhr, hat Schott jetzt links vor sich, so daß er links ein anderes Auto mit einem anderen Fahrer neben sich hat, als das Auto neben ihm wieder ebenso langsam fährt wie Schott. Der Fahrer des Autos links von Schott ist Raucher.
Schließlich fahren die Autos vor dem Auto, das rechts von Schott fährt, ein wenig schneller. Die Frau, deren Haar, obwohl es im Nacken hochgebunden ist, nicht mehr den Eindruck eines Pferdeschwanzes erweckt, fährt sogleich ein wenig schneller. Das Auto, das rechts neben Schott fuhr, hat Schott jetzt rechts vor sich, so daß er ein anderes Auto rechts neben sich hat, als das Auto neben ihm wieder ebenso langsam fährt wie Schott.
Schott, der wegen der Sätze, die Liu gesagt hat, auf der Stadtautobahn schnell dahinfahren wollte, einerseits, um Lius Sätze zu vergessen, andererseits, um die nötigen Antworten zu bedenken, kann unter den vorherrschenden Umständen der Stadtautobahn weder vergessen noch denken. Ihm ist von einer Minute zur anderen übler zumute. Nervös berührt er mit dem Daumen und dem Zeigefinger der rechten Hand die Nasenspitze, das linke Ohrläppchen, die Unterlippe, greift in die rechte Jackentasche (eine Bewegung, die von dem Sicherheitsgurt behindert ist), und vermißt die Zigaretten, zu seinem Ärger, der in diesem Moment sein allergrößter ist, obwohl das geringe Tempo der Autos vor und neben ihm eher zu größerem Ärger Anlaß bietet.
Die Autos vor dem Auto von Schott und vor den Autos neben Schott bremsen, das Auto vor Schott bremst, die Autos neben Schott bremsen, Schott bremst. Schott wünscht sich, daß die Autos hinter dem Auto hinter Schott rechtzeitig bremsen und daß das Auto hinter Schott rechtzeitig bremst. Über die Autos hinter den Autos neben Schott denkt Schott in diesem Augenblick nicht nach. Das Auto hinter Schott und die Autos hinter dem Auto hinter Schott bremsen rechtzeitig. Schott vermutet es, weil er weder einen Aufprall spürt noch Geräusche anderer Aufprälle vernimmt. Aus dem letzten Grund schließt er auch, daß die Autos hinter den Autos neben ihm rechtzeitig bremsen. Die Autos neben ihm bremsen rechtzeitig, das sieht er. Alle genannten Autos bremsen so lange, bis sie stehenbleiben, das heißt, sie werden so lange gebremst.
Schott bewegt die Kurbel an der Innenseite der linken Tür im Uhrzeigersinn. Das Fensterglas der Tür senkt sich. Daß es das Fensterglas der linken Vordertür ist, braucht nicht ausdrücklich gesagt zu werden. Da von der linken Tür gesprochen ist, kann jedermann schlußfolgern, daß Schotts Auto auf der linken Seite nur eine Tür hat. Der Ausdruck Vordertür erübrigte sich wahrscheinlich auch dann, wenn Schotts Auto auf der linken Seite zwei Türen, eine Vorder- und eine Hintertür, hätte, weil es erfahrungsgemäß schwierig ist, von dem Fahrersitz aus die Kurbel an der Innenseite einer linken Hintertür im Uhrzeigersinn zu bewegen. Ist der Schluß gezogen, daß Schotts Auto auf der linken Seite nur eine Tür hat, liegt die Vermutung nahe, daß Schotts Auto auf der rechten Seite auch nur eine Tür hat. Es existieren vermutlich keine Personenautos in der Stadt, die auf der linken Seite eine Tür, auf der rechten Seite zwei Türen haben.
Schott bewegt die Kurbel im Uhrzeigersinn so lange, bis sie sich nicht mehr im Uhrzeigersinn bewegen läßt. Im Unterschied zu manchen Autotürfenstern, die nicht gänzlich in der Autotür versinken, ist das Fensterglas in der Tür von Schotts Auto gänzlich versunken. Schott legt den Ellenbogen auf den Rand des Autotürfensterrahmens. Es ist logisch der untere Rand des Rahmens, auf den Schott den Ellenbogen legt, und es ist logisch der linke Ellenbogen, den Schott auf den Autotürfensterrahmen legt.
Die Stadtautobahn ist an der Stelle, an der Schotts Auto stillsteht, gänzlich eben. Schott kann ohne Sorge den Fuß vom Bremspedal nehmen. Schott blickt aus dem Fenster auf die Gegenfahrbahn.
Obgleich es Schott naheliegt, zuerst Lius Satz zu bedenken, sie wisse nicht, ob sie, selbst wenn sie es wollte, zu zweit leben könnte, will Schott zuerst Lius Satz bedenken, sie wolle nicht verstanden haben, was gemeint gewesen sei, sie wolle es hören.
Die Autos, die auf der Gegenfahrbahn heranrasen und vorbei, zerschneiden aber Schotts Absicht.
Hätte Schott sogar die Hoffnung gehegt, der Aufenthalt hinter, vor und zwischen haltenden Autos sei eine Gelegenheit zur Erholung, wäre Schott zu der Feststellung veranlaßt gewesen, diese Hoffnung habe getrogen.
Schott öffnet den Sicherheitsgurt und zieht ein Taschentuch aus der linken Hosentasche. Er wischt sich die Stirn und sagt, Warum habe ich dieses Taschentuch nicht in Lius Küche genommen. Schott spricht, aber mit niemandem.
Schott hört die Sirene eines Polizei- oder eines Rettungsautos. Er nimmt an, daß das Polizei- oder Rettungsauto nicht vor ihm, sondern hinter ihm erscheint. Im rechten Außenrückspiegel erblickt Schott gemischtes Licht, blaues und gelbes je im Rhythmus von Blaulicht. Zwischen Schotts Auto und dem Auto rechts von Schott ist nach Schotts Schätzung genügend Platz für ein Polizei- oder Rettungsauto. Das Geräusch der Sirene eines Polizei- oder Rettungsautos wird lauter, das blaugelbe Licht wird heller, zwischen Schotts Auto und dem Auto rechts von Schott fahren ein Polizeiauto mit blauem und ein Rettungsauto mit gelbem Warnlicht sowie je einer tönenden Sirene hindurch.
Die Autos vor Schotts Auto und vor den Autos links und rechts neben Schott beginnen zu fahren, Schott schließt den Sicherheitsgurt, die Autos links und rechts neben Schott beginnen zu fahren, Schott fährt an. Nach zirka einhundert Metern sieht Schott die linken hinteren Blinkleuchten der Autos blinken, die vor dem Auto fahren, das rechts von Schott fährt. Die Autos vor dem Auto vor Schott fahren langsamer, das Auto vor Schott fährt langsamer, Schott fährt langsamer. Schott sieht, daß die Autos auf der rechten Fahrbahn auf die Fahrbahn zu gelangen suchen, auf der Schott fährt. Schott fährt langsamer als langsam. Er läßt es zu, daß das Auto vor dem Auto, das rechts von ihm fährt, auf die Fahrbahn gelangt, auf der er fährt. Das Auto, das vor dem Auto rechts von ihm fuhr, fährt vor ihm, der Fahrer des Autos winkt ihm mit der rechten Hand zu.
Das Auto rechts von Schott bleibt etwas zurück. Schott sieht im rechten Außenrückspiegel, daß es hinter Schott auf die Fahrbahn gelangt, auf der Schott fährt. Schott sieht im Innenrückspiegel, wie der Fahrer dem Fahrer des Autos zuwinkt, das hinter dem Auto fährt, das hinter Schott auf die Fahrbahn gelangt ist, auf der Schott fährt.
Die rechte Fahrbahn ist jetzt frei, weil in weniger als einhundert Metern Entfernung ein Polizist auf der rechten Fahrbahn steht und seinen rechten Unterarm in Brusthöhe rhythmisch streckt und anwinkelt.
Schott sieht schon das Gesicht des Polizisten.
Auf der rechten Fahrbahn im Rücken des Polizisten steht das Rettungsauto mit gelbem Warnlicht. Die Flügel der Hintertür des Rettungsautos sind geöffnet. Hinter dem Rettungsauto steht das Polizeiauto mit blauem Warnlicht. Aber das Polizeiauto steht in einiger Entfernung hinter dem Rettungsauto. Das sieht Schott aus einiger Entfernung.
Nun erkennt Schott das Polizistengesicht. Es ist ein altes Gesicht ohne Aufregung. Es muß anstrengend sein, den rechten Unterarm in Brusthöhe rhythmisch anzuwinkeln und zu strecken, sagt Schott, ohne daß ihn jemand hört, außer ihm.
Noch ehe Schott den Polizisten und das Rettungsauto erreicht, sieht Schott, daß in der Lücke zwischen dem Rettungs- und dem Polizeiauto sein eigenes Auto umgestürzt auf der rechten Fahrbahn liegt, quer, die Räder gen Himmel. Als Schott den Polizisten und das Rettungsauto erreicht, sieht Schott, daß in der Lücke zwischen dem Rettungsauto und dem Wrack seines eigenen Autos er selbst auf der Fahrbahn liegt, quer, die Augen gen Himmel. Er ist halb mit einer grauen Decke bedeckt. Zwei Träger einer Bahre hantieren an den Gurten der Bahre.
Als Schott genauer hinsieht, sieht er, daß nicht er es ist, der auf der Fahrbahn liegt.
In der folgenden Sekunde fährt Schott an dem Polizeiauto vorbei, das in ausreichender Entfernung auf der rechten Fahrbahn steht.
Schott schaltet das Autoradio an. Alle Autos vor Schott und das Auto links neben Schott und die Autos vor dem Auto neben Schott fahren so langsam, daß ein älterer Mann oder eine ältere Frau oder beide, unter Umständen Hand in Hand, vor einem der Autos vor Schott oder vor dem Auto links neben Schott oder vor einem der Autos vor dem Auto neben Schott oder vor Schotts Auto einhergehen könnten, ohne sich sonderlich beeilen zu müssen.
Der Gedanke Schotts an einen älteren Spaziergänger oder an eine ältere Spaziergängerin oder an zwei ältere Spaziergänger, einen Gänger und eine Gängerin, endet am Anfang der Verkehrsmeldung. Der Sprecher sagt, daß auf der Stadtautobahn in Richtung Süden, kurz hinter der Auffahrt, die Schott benutzt hat, ein schwerer Verkehrsunfall.
Da Schott über den Unterschied von Fall und Unfall nachsinnt, also versonnen geradeaus blickt, weiß er nicht, welches Auto links von ihm und welches Auto rechts von ihm und welcher Fahrer das Auto links von ihm und welcher Fahrer das Auto rechts von ihm fährt.
Die Unruhe, in der Schott sich befindet, steht für Schott in unangenehmem Gegensatz zu der Ruhe, die ihn zunehmend angenehm erfüllt, wenn er gelegentlich ziellos auf der Stadtautobahn südwärts fährt. Aber ob er diese Unruhe als unbehaglich oder jene Ruhe als behaglich empfindet – er findet zwar inmitten von Autos, einer Unmenge oder Menge, den Zusammenhang zwischen dieser Unsumme von Autos und jenem Unfall, aber zwischen der Unmasse der Autos und ihrer Masse findet er keinen Zusammenhang, und er findet auch keinen zwischen Unfall und Fall.
Links von Schott fährt ein großer schwarzer Wagen mit einer Antenne mitten auf dem Dach. Schott möchte in dieser Nacht noch einmal mit Liu reden. Er nimmt den Hörer des Autotelefons und wählt die Telefonnummer. Liu sagt mit zwar schläfriger Stimme, aber unverwundert, Ja? Was ist los? Schott sagt, Wenn jemand Grund hat, zu dieser Zeit von sich zu sprechen, so bin ich es deshalb, weil ich mich soeben gesehen habe.
Ach Schott, du siehst doch zu jeder Zeit dich.
Liu, hör zu.
Ja, sagt Liu.
Schott sagt, Du schläfst.
Nein, sagt Liu.
Schott sagt, Gut. Ich rede nicht davon, daß du schlafen kannst, und ich kann nicht schlafen.
Doch, du redest davon, sagt Liu.
Schott sagt, Ja.
Du könntest schlafen, sagt Liu.
Schott sagt, Nein.
Gut, sagt Liu.
Schott sagt, Es könnte plötzlich zu spät sein.
Aber als Schott genauer hinsieht, sieht er, daß nicht er es ist, der im Auto telefoniert, sondern es ist der Fahrer des großen schwarzen Wagens links neben ihm.
Die Antenne mitten auf dem Dach vibriert leicht, und die Antenne auf dem linken hinteren Kotflügel vibriert stark, weil sie länger ist.
Die Frau, die in der Wohnung unter der Wohnung von Schott wohnt, eine kleine, magere, weißhaarige Frau mit gebeugtem Rücken, schiefer Schulter, runzligem Gesicht, öffnet die Wohnungstür einen Spaltbreit, als Schott vorbeigeht.
Herr Schott!
Schott bleibt stehen. Frau Semper. Sie sollten die Kette vorlegen, ehe Sie die Tür öffnen. Weiß man, wer vorbeigeht? Erst gestern haben zwei junge Männer eine alte Frau erwürgt, die unvorsichtig war.
Frau Semper lacht. Ich höre, wie Sie Ihre Tür aufschließen, ich höre, wie Sie Ihre Tür zuschlagen, ich höre, wie Sie Ihre Tür abschließen. Ich höre, wie Sie die Treppe herunterkommen, bei mir vorbeigehen. Das können nur Sie sein. Sie gehen jeden Tag zur selben Zeit.
Ja.
Ich kann nicht mehr gut laufen. Können Sie mir was mitbringen?
Ja.
Ein Glück, daß jeden Tag der Briefträger vorbeikommt. Aber Post bringt er mir keine. Ich habe niemanden mehr.
Aber Frau Semper. Ihre Kinder.
Die schreiben nicht. Die kommen auch nicht.
Aber Frau Semper. Ich habe gesehen, daß Ihre Tochter hier war.
Selten.
Und Ihr Sohn.
Noch seltener. Können Sie mir Mohrrüben mitbringen? Die Mohrrüben raspeln, Zucker und Zitrone darangeben, das ist gut für die Augen, Herr Schott. Rohe Mohrrüben. Esse ich jeden Tag. Ich kann nicht mehr gut sehen. Aber Sie, Herr Schott. Das wäre gut für Ihre Augen, bei Ihrer Arbeit.
Ja.
Hier ist Geld.
Schott traut seinen Augen mehr als seinen Ohren. Nicht, daß er besonders gut sähe. Nicht, daß er besonders schlecht hörte. Aber als ein Mann seines Alters hatte er mehrfach Gelegenheit, sich an Gehörtes erinnern zu wollen und an Gesehenes. Das Gehörte war nach längerer Zeit zerbrochen. Er verfügte nur über Bruchstücke, aber, wie die Artikellosigkeit des Wortes Bruchstücke es andeutet, nicht über alle. Es konnte sich eine andere Bedeutung des Gehörten einschleichen. So daß es nicht übertrieben wäre, Schotts partielle oder totale Unfähigkeit zur Erinnerung von Gehörtem zu behaupten. Und so befindet sich Schott heute noch.
Übrigens hat er sich geprüft. Er hat etwas Hörbares, menschliche Rede, mittels eines Gerätes aufgezeichnet. Der Vergleich des Aufgezeichneten, also unstrittig des Gehörten, mit seiner Erinnerung an das Gehörte war für Schott hinlänglich aussagekräftig.
Schott hält es aber für unziemlich, jedes Gespräch, das er, sei es direkt oder telefonisch, führt, mittels eines Gerätes aufzuzeichnen. Er scheut die Verwunderung der Gesprächsteilnehmer, wenig vertrauter oder äußerst vertrauter.
Schott denkt ungern an eine Unterredung mit einem angesehenen Lehrstuhlinhaber, einem einflußreichen Vertreter des Faches, in dem auch Schott sich versucht. Schott, soviel ist zu sagen, versucht sich jedoch nicht an einer Universität. Die Unterredung fand in einer Universität statt, im Geschäftszimmer des Lehrstuhlinhabers.
Der Lehrstuhlinhaber saß hinter einem Schreibtisch auf einem Schreibtischsessel, Schott saß vor dem Schreibtisch auf einem Stuhl. Schott meint, der folgende Zwischenfall wäre vermieden worden, hätte Schott ebenfalls auf einem Sessel gesessen. Schott hätte den rechten Oberschenkel bequem über den linken Oberschenkel legen und das winzige Gerät auf der restlichen Fläche des linken Oberschenkels abstellen können. Das Gerät hätte an dem rechten Oberschenkel Halt gehabt und wäre durch den rechten Oberschenkel ohne weiteres vor dem Blick des Lehrstuhlinhabers geschützt gewesen.
Der Stuhl mit einer ziemlich steilen Lehne ließ eine bequeme Sitzhaltung, zu der zu rechnen ist, daß ein Oberschenkel über den anderen Oberschenkel gelegt wird, gar nicht zu. Außerdem lag die Sitzfläche des Stuhles höher als die Sitzfläche des Schreibtischsessels. Da der Lehrstuhlinhaber ein ziemlich großer Mann war und ist, auch im Sitzen nicht kleiner wurde und wird, Schott jedoch ziemlich niedrig gewachsen ist und im Sitzen nicht höher wird und wurde, lag Schotts Körper vollständig im Blick des Lehrstuhlinhabers, zumal der Stuhl weit vom Schreibtisch entfernt aufgestellt war. Der Körper des Lehrstuhlinhabers lag nicht vollständig im Blick Schotts.
Schott unternahm den Versuch, das Gerät unbemerkt in einer seiner Hände zu halten, die er, bei steiler Sitzhaltung, auf das Knie stützte, nämlich in der rechten Hand, einen Versuch der Verhohlenheit, der einem kühler denkenden Mann von vornherein als untauglich hätte erscheinen müssen. Als Schott vor den Worten des Lehrstuhlinhabers, Nun, Herr Schott, das Gerät mit dem Zeigefinger der rechten Hand in Gang setzen wollte, entglitt Schott das Gerät und fiel auf den Boden. Der Lehrstuhlinhaber wartete nicht, bis Schott sich gebückt und das Gerät aufgehoben hatte. Er sagte, Was haben Sie da, Herr Schott, und erhob sich aus dem Schreibtischsessel. Schott hob das Gerät auf. Ohne daß Schott vorzeigte, was er da hatte, sah der Lehrstuhlinhaber, der im Umgang mit derlei Gerätschaft bewandert zu sein schien, was Schott da hatte. Der Lehrstuhlinhaber sagte, Einen Recorder!, so daß Schott nicht Einen Recorder! zu sagen brauchte.
Schott bedauert, daß das Gerät nicht eingeschaltet war, als ein Dialog einsetzte, aber angesichts der auffälligen Spannung, die über oder in dem Dialog lag, erinnert sich Schott ausnahmsweise des Gehörten genau. Er hörte den Lehrstuhlinhaber, und er hörte sich.
Das ist doch die Höhe.
Verstehen Sie doch
Nein.
Ich
Sie. Gilt Ihnen mein Wort so wenig
Im Gegenteil, ich
Sie. Sie vertrauen mir nicht
Ich
Ich betrachte dieses Gespräch als beendet. Leben Sie wohl, Schott.
Es war Schott nicht gegeben, dem Lehrstuhlinhaber zu erklären, daß er, Schott, sich selber nicht vertraute, genauer gesagt, seinem Erinnerungsvermögen. Schott ging ohne Gruß aus dem Geschäftszimmer des Lehrstuhlinhabers.
Welcher Nachteil sich für Schott aus dem Verlauf dieser Unterredung ergab, wird später erwähnt.
Unangenehmer ist Schott der Gedanke an eine nächtliche Unterredung mit einer wesentlich jüngeren Frau. Obwohl die jüngere Frau nicht bemerkte, daß die Unterredung aufgezeichnet wurde, bemerkte sie doch, daß Schott anders war als sonst. Sie sagte zum Beispiel, Wie redest du heute, Schott.
Auch bei Telefonaten scheut Schott seine Befangenheit. Wenn er solche Gespräche hörte, hatte er das Gefühl, jemanden hinter einer Tür belauscht zu haben, obwohl er sich selber an dem Gespräch auf der anderen Seite der Tür beteiligt hatte. Er verdächtigte sich auch, ein wenig anders geredet zu haben angesichts des Geräts, inhaltlich und formal. Formal anders sogar bei der Aussprache der Verschlußlaute und der unbetonten Endungen.
Seit langem benutzt Schott statt eines Aufnahmegeräts kleine Notizblöcke, in die er nach manchen Gesprächen kleine Notizen schreibt.
Obgleich Schott seinen Augen mehr traut als seinen Ohren, bezweifelt er manchmal auch die Augen. Die nächtliche Fahrt auf der Stadtautobahn nährt seinen Zweifel. Jetzt ist Schott unsicher, ob er Liu in ihrer Küche sagen sehen hat, was er sie hat sagen hören.
Die Frau, die in der Wohnung unter der Wohnung von Schott wohnt, öffnet die Wohnungstür, als Schott vorbeigeht.
Herr Schott!
Schott bleibt stehen. Frau Semper?
Herr Schott, stellen Sie sich vor: an meiner Strickjacke war der unterste Knopf locker. Ich dachte, ehe ich den Knopf verliere, reiße ich den Knopf ab. Ich reiße den Knopf also ab und lege den Knopf auf den Eßtisch. Damit ich den Knopf vor Augen habe. Damit ich den Knopf zur Hand habe, wenn ich den Knopf annähen will. Ich will den Knopf also annähen, hole mir Nadel und Faden, aber wie ich den Knopf vom Tisch nehmen will, ist der Knopf weg. Ich denke, das kann doch nicht sein. Der Knopf lag doch eben noch auf dem Tisch. Habe ich den Knopf weggenommen? Habe ich den Knopf woandershin gelegt? Nein. Aber der Knopf ist weg. Also ich suche den Knopf. Im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in der Küche, im Bad. Sogar in der Toilette. Ich finde den Knopf nicht. Stellen Sie sich vor: eben war etwas noch da, und plötzlich ist es weg. Einfach weg. Kennen Sie das? Schließlich sage ich mir, nimmst du halt einen anderen Knopf. Sieht zwar nicht gut aus, aber was sollst du machen. Ich suche mir im Nähzeug einen anderen Knopf, setze mich zum Nähen an den Tisch, und wie ich auf den Tisch sehe, liegt doch da der Knopf, den ich die ganze Zeit gesucht hatte.
Frau Semper, Sie haben die Türkette nicht vorgelegt.
Ach, wer soll mir was tun, bei mir ist nichts zu holen.
Die Familie, die die Wohnung über der Wohnung von Schott bewohnt, eine kleine Familie, bestehend aus drei Personen, Kind, Frau, Mann, oder Frau, Kind, Mann, oder Mann, Kind, Frau, oder Kind, Mann, Frau, oder Frau, Mann, Kind, oder Mann, Frau und Kind, hält in der Wohnung ein mittelgroßes, hochläufiges Tier mit langgestrecktem Kopf, stehenden Ohren, nackter, feuchter Nase, kräftigem Gebiß, dessen erster unterer Backenzahn und vierter oberer Vorbackenzahn zu Reißzähnen ausgebildet sind, mit schlankem, in den Flanken eingezogenem Rumpf, mit hängendem, buschigem Schwanz. Schotts Wissens ein vorwiegend fleischfressendes Tier.
Der Mann, die Frau und das Kind, ein weibliches, verlassen jeden Morgen außer samstags und sonntags die Wohnung, aber ohne das Tier. Als erste Person verläßt der Mann die Wohnung.
Schlüge der Mann die Wohnungstür nicht krachend zu, schreckte Schott dennoch aus längerem oder kurzem Schlaf auf von tierischem Geheul, das ausbricht, wenn Bewohner die Wohnung verlassen, Mann oder Frau, oder Mann und Frau, oder Mann und Kind, oder Frau und Kind, oder Mann, Frau und Kind. Das Kind verläßt also die Wohnung nie allein, seines Alters oder seiner Jugend wegen. Schott ist aber sicher, daß tierisches Geheul auch ausbräche, falls das Kind die Wohnung allein verließe.
Ist die Tür zugeschlagen, folgt dem Geheul lautes Gebell, das die Luft zerhackt. Ist die Luft zerhackt, folgt hirnzerreißendes Gejaule. Ist das Hirn zerrissen, folgt heiseres Gebelfer, das Schott krümmt. Hat Schott sich gekrümmt, folgt rasendes Gekratz. Dieses Tier hat keine andere Wahl, da es die stumpfen Krallen nicht zurückziehen kann.
Könnte das Tier die stumpfen Krallen zurückziehen, wäre es ein Kletterer. Es könnte die Tür anspringen, sich an kleinen Vorsprüngen der Türfüllung festkrallen, die Tür hinaufklettern bis zu einem der beiden kleinen Milchglasfenster oberhalb der Tür, die Scheibe mit der nackten feuchten Nase eindrücken, den langgestreckten Kopf aus dem Fenster recken und dem Mann hinterherbelfern. Allerdings bestünde für das Tier die Gefahr, sich an den zackigen Resten der Scheibe, die im Rahmen geblieben sind, den Hals aufzuschneiden. Das Tierblut flösse an der Innen- und Außenseite der Tür herab. Das Tier würde, ob es gerade bellte, jaulte oder belferte, augenblicklich Geheul ausstoßen, wild strampeln, den Halt verlieren, bestenfalls zurückfallen, wobei weitere Schnitte oder Risse am Hals unvermeidbar wären, schlimmstenfalls aber an einer hervorragenden Glasspitze, die tief in den Hals eingedrungen sein könnte, hängenbleiben, blutig röcheln, zuckend verbluten.
Falls die Frau oder das Kind oder die Frau und das Kind den Vorgang bemerkte oder bemerkten, käme sie oder es oder kämen beide aus einem der Räume, sähe oder sähen das heulende und strampelnde oder röchelnde und zuckend verblutende Tier über der Tür hängen. Die Frau oder das Kind oder die Frau und das Kind wüßte oder wüßten nicht, was tun. Entweder aus Angst an sich oder aus Angst vor dem Tier, oder entweder aus Ekel vor dem Blut oder aus Mangel an Kraft, seelischer und körperlicher. Der Mangel an körperlicher Kraft folgte, zumindest für die Frau, vielleicht aus dem Mangel an seelischer. Immer davon abgesehen, daß der Mann auf der Haustreppe gar nicht bemerkte, daß das Tier, den Kopf dem Mann nachgereckt, eben verblutete.
Falls aber der Mann das Ereignis akustisch wahrnähme, bliebe er stehen, wendete sich um, neigte den Kopf, spränge die Treppenstufen hinauf, bis er den Vorfall optisch wahrnähme, zöge den Schlüssel aus der Hosen- oder Jackentasche, schlösse die Tür ungeachtet des Tierblutes, das den Türgriff und das Schlüsselloch bereits überlaufen hätte, hastig auf, stieße den Türflügel gedankenlos zurück, so daß der Hals des Tieres, falls es ausgerechnet über jenem Türflügel hinge, sich noch tiefer in die Glasspitze bohrte. Welchen Laut das Tier in diesem Moment ausstieße, bliebe der Beurteilung eines Tierkenners überlassen, zum Beispiel eines Metzgers, dem es gelegentlich einer Schlachtung geschieht, daß er einem Schlachtopfer den Hals durchschneidet, ohne daß es zuvor gelang, das Tier, etwa mittels eines Hammerschlages, genügend zu betäuben. Da es dem Mann vermutlich an Geduld mangelte, einen Stuhl oder gar eine Leiter zu holen, auf den Stuhl oder auf die Leiter zu steigen und das strampelnde und heulende oder zuckende und röchelnde, blutig röchelnde und zuckend verblutende Tier aus der gefährlichen Glasspitze zu heben, packte er das Tier bloß, es aus seiner Position zu lösen, und zerrte es doch nur tiefer in die Glasspitze, so daß es endgültig verendete, also nicht mehr strampelte und heulte oder röchelte und zuckte. Jetzt erst holte der Mann eine Leiter oder einen Stuhl, vielleicht unter den Augen der Frau oder des Kindes oder der Frau und des Kindes, die oder das oder die glücklicherweise zu spät aus einem der Räume käme oder kämen.
Falls aber der Mann gar nicht bemerkt hätte, daß das Tier, den Kopf dem Mann nachgereckt, eben verblutete, stünde die Frau oder das Kind oder stünden die Frau und das Kind unter dem Tier und schriee oder schrien.
Das Kind schriee still, regelrecht haltlos, wobei es sich am Nachthemd der Frau festhielte, die Frau schriee in Worten, die den Willen Gottes bemühten oder den Namen des Hundes oder den Namen des Mannes, und versuchte, die Augen des Kindes mit beiden Händen zu bedecken. Die Frau oder das Kind wäre oder die Frau und das Kind wären hilflos. Folglich bliebe ihr oder ihm oder ihr und ihm nichts zu tun. Daß die Frau, mit Hilfe eines Stuhles oder einer Leiter, dem Hunde zur Seite geeilt wäre, nachdem sie das Kind, falls es aus einem der Räume gekommen wäre, in einen der Räume zurückgebracht und die Tür zugedrückt hätte, ist nicht zu erwarten. Eher wäre sie zum Telefon gegangen oder geeilt oder gestürzt, oder doch gegangen, in letzterem, oder ersterem, Fall ehestens schleppend, in einer Art Betäubung, und hätte wahllos eine Nummer gewählt, wahrscheinlich die Nummer der Arbeitsstelle des Mannes, aber der Mann hätte nicht ans Telefon geholt werden können, weil er unterwegs zu seiner Arbeitsstelle gewesen wäre, sogar noch eine ganze Weile.
Der Mann schlägt die Tür krachend zu, Schott schreckt aus kurzem Schlaf auf von tierischem Geheul. Dem Geheul folgt Gebell, das die Luft zerhackt, dem Gebell folgt Gejaule, das das Hirn zerreißt, dem Gejaule folgt Gebelfer, das Schott krümmt, dem Gebelfer folgt Gekratz, rasendes.
Schott ist wach, sieht auf die Uhr, es ist zu früh für einen Anruf bei Liu. Schott ist müde, er legt sich zurück in der Erwartung weiteren Schlafs und schläft allmählich, etwa binnen fünfzehn Minuten, wieder ein.
Als zweite und dritte Person verlassen die Frau und das Kind die Wohnung, etwa sechzig Minuten nach dem Mann, somit nach ungefähr fünfundvierzig Minuten weiteren Schlafs für Schott. Schott schreckt aus weiterem Schlaf auf von tierischem Geheul. Dem Geheul folgt Gebell, das die Luft zerhackt, dem Gebell folgt Gejaule, das das Hirn zerreißt, dem Gejaule folgt Gebelfer, das Schott krümmt, dem Gebelfer folgt Gekratz, rasendes.
Schott, zerhackte Luft atmend, zerrissenen Hirnes, gekrümmt, ist wach, sieht auf die Uhr, es ist zu spät für einen Anruf bei Liu. Schott wünscht, das Tier könnte die stumpfen Krallen zurückziehen und wäre ein Kletterer.
Abgeneigt jeder Person, die die Haustreppe hinuntergeht oder hinaufgeht oder hinuntergeht und hinaufgeht oder hinaufgeht und hinuntergeht, also abgeneigt auch dem Briefträger, der die Haustreppe täglich hinaufgeht und hinuntergeht, steht Schott vom Bett auf. Bis zum Eintreffen des Briefträgers bleiben noch drei Stunden, zirka.
Die Frau, die in der Wohnung unter der Wohnung von Schott wohnt, öffnet die Wohnungstür, als Schott vorbeigeht.
Herr Schott!
Schott bleibt stehen. Frau Semper.
Können Sie mir was mitbringen? Ich kann nicht mehr gut laufen.
Ja.
Können Sie mir Petersilie, Schnittlauch und Dill mitbringen? Petersilie, Schnittlauch und Dill schön waschen, auf ein Tuch legen, bis kein Tropfen Wasser mehr dran ist, auf ein großes Schneidbrett tun, mit dem Wiegemesser ganz feinschneiden, alles mischen, und immer dick aufs Butterbrot. Das ist gut für den Kreislauf, Herr Schott. Frische Kräuter. Esse ich jeden Tag. Mein Kreislauf ist nicht mehr in Ordnung. Aber Ihrer, Herr Schott. Das wäre gut für Ihren Kreislauf, bei Ihrer Arbeit.
Ja.
Hier, das Geld.
Schott erwägt einen Vorschlag. Wie wäre es, will er sagen oder schreiben, im Hausflur, also parterre, Hausbriefkästen an der Wand zu befestigen. Dem Briefträger bliebe es erspart, täglich die Haustreppe hinaufzugehen und hinunterzugehen. Zwar bedenkt Schott, daß jeder Wohnungsmieter täglich mindestens einmal die Treppe hinuntergehen müßte, um nachzusehen, ob Post gekommen ist, und wieder hinauf. Er bedenkt auch, daß in einigen Wohnungen zwei oder mehr Mieter mit eigener Anschrift wohnen, die je die Treppe hinuntergehen und hinaufgehen müßten. Da aber ohnehin jeder Bewohner mit eigener Anschrift täglich mindestens einmal das Haus verläßt, um einzukaufen, käme keine zusätzliche Begehung der Treppe vor. Manche Bewohner gehen sogar nur die Treppe hinunter, um zu verreisen. Insgesamt ginge mindestens eine Person weniger täglich die Treppe hinunter, der Briefträger. Abgesehen von Besuchern des einen oder anderen Bewohners, die aber zur Beruhigung Schotts sogar manchmal an einem Tag die Treppe nur hinaufgehen und an einem anderen Tag erst wieder hinunter. Die gesamte Berechnung gilt nur für Bewohner, die höher wohnen als Schott.
Schott bedenkt aber auch, daß die Hausverwaltung höchstenfalls geneigt wäre, Hausbriefkästen zu installieren, wenn die Mieter bereit wären, die Kosten für Hausbriefkästen und Installation selber zu zahlen. Schott muß solche Bereitschaft bezweifeln.
Ein Gespräch mit einem Mieter auf der obersten Etage verlief unbefriedigend. Wieso, hatte der Mieter gesagt. Mich stört der Briefträger nicht. Im Gegenteil. Ich gehe gar nicht jeden Tag raus. Müßte nur wegen der Post die Treppe runter. Warum dafür noch zahlen?
Schott erwägt ferner, ein Abkommen mit dem Briefträger zu treffen. Er möge wenigstens die Treppe vorerst nur hinaufgehen. Im obersten Stockwerk könne er sich auf dem Treppenabsatz aufhalten, so lange er wolle. Und möge die Treppe erst dann wieder hinuntergehen, wenn Schott seine erfinderische Arbeit für den Tag abgeschlossen habe und selber aus dem Haus gegangen sei, gegen sechzehn Uhr. Welche Antwort der Briefträger hierauf bereit hätte, will Schott bedenken, nachdem er bedacht hat, welche Folgen es seines eigenen Erachtens für den Briefträger und für die Mieter des obersten Stockwerks haben könnte, willigte der Briefträger in ein Abkommen ein.
Der Briefträger könnte auf dem Weg in das oberste Stockwerk, zu seinem Tagesplatz auf dem Treppenabsatz, die Post für die Bewohner des Hauses je in die Briefkästen werfen; die Last der Posttasche nähme auf dem Weg nach oben ab, der Briefträger gelangte zwar atemlos, aber erleichtert im obersten Stockwerk an. Erleichtert gelangt er allerdings immer im obersten Stockwerk an. Nur, es wäre, wie an früheren Tagen, gewiß, daß mindestens die Bewohner dieses Hauses ihre Post ohne Verspätung erhielten.
Schott hätte auf dem Treppenabsatz im obersten Stockwerk vorsorglich einen Sessel, einen kleinen Tisch und eine Leselampe aufgestellt. Des weiteren einen Kühlschrank, für Getränke an Sommertagen, die im obersten Stockwerk erfahrungsgemäß heiß ausfallen, besonders auf dem unlüftbaren Treppenabsatz, und eine Kochplatte, für Getränke an Wintertagen, die im obersten Stockwerk erfahrungsgemäß kalt ausfallen, besonders auf dem unheizbaren Treppenabsatz. Der Kühlschrank stünde auch im Winter dort, weil es Briefträger gibt, die trotz Kälte kalte Getränke trinken. Die Kochplatte stünde auch im Sommer dort, weil es Briefträger gibt, die trotz Hitze heiße Getränke trinken. Für Wintertage ferner einen elektrischen Heizofen mit Gebläse sowie einen Garderobenständer für Wintermantel oder Winterjacke. Diesen Heizofen zöge Schott einem Ölradiator vor, weil die Wärme, die ein Ölradiator liefert, ungezielt verströmt, also bloß aufsteigt und im Treppenhaus durch die undichte Bodentür entweicht, ohne den Briefträger gewärmt zu haben. Hingegen könnte der Briefträger den starken warmen Luftstrom des Heizofens mit Gebläse direkt auf seinen Körper richten, entweder auf den Oberkörper, falls er den Ofen auf den kleinen Tisch stellte, oder auf den Unterkörper, falls er den Ofen auf dem kleinen Tisch mittels einer Unterlage, etwa eines Buches, ankippte, oder auf die Beine, falls er den Ofen auf den Fußboden stellte, oder auf die Füße, falls er den Ofen auf dem Fußboden mittels einer Unterlage, etwa zweier Bücher, stark ankippte.
Der elektrische Heizofen stünde auch im Sommer dort, ebenso die Garderobe. An besonders heißen Tagen könnte das Gebläse des Ofens als Ventilator benutzt werden, falls es gelänge, das Gebläse unabhängig von der Wärmequelle des Ofens in Gang zu setzen. An die Garderobe wäre im Sommer die Sommerjacke zu hängen, oder das Oberhemd an besonders heißen Tagen.
Unbelüftet ist der Treppenabsatz im obersten Stockwerk nicht. Es dringt Luft durch die Öffnung der Haustür ins Haus, steigt im Treppenhaus auf, erreicht den Treppenabsatz im obersten Stockwerk, entweicht durch die undichte Bodentür. Oder es dringt Luft durch die Ritzen des Daches, fließt durch die undichte Bodentür, erreicht den Treppenabsatz im obersten Stockwerk, fällt im Treppenhaus ab, entweicht durch die Öffnung der Haustür. Luft gelangt auf den Treppenabsatz auch durch die Öffnungen zweier Wohnungstüren im obersten Stockwerk, selbst, wenn die Wohnungsmieter die Fenster ihrer Wohnungen nie öffnen; die Fenster ihrer Wohnungen sind undicht, und durch die Rauchabzugsrohre der Badeöfen dringt Luft in die Wohnungen, zumindest, wenn die Badeöfen nicht beheizt sind. Aber auf dem Treppenabsatz im obersten Stockwerk ist kein Fenster vorhanden.
Die Bodentür ist in doppelter Weise undicht, in herkömmlicher und in auffälliger. Zwischen Türrahmen und Tür befinden sich luftdurchlässige Zwischenräume, und die Tür ist an zwei Stellen luftdurchlässig verrostet. Ein kräftiger Mann ohne Scheu könnte die untere Rostfläche leicht mit einem einzigen Fußtritt zerstoßen.
Das Buch, das der Briefträger brauchte, um den Heizofen auf dem kleinen Tisch anzukippen, wäre nach Schotts Vorstellung ein Buch der Wahl, die der Briefträger treffen sollte. Das zweite Buch, das der Briefträger brauchte, um den Heizofen auf dem Fußboden stark anzukippen, ebenso. Allerdings ließe Schott es nicht bei zwei Büchern, weil der Briefträger unter Umständen entweder nur ein Buch oder gar kein Buch zur Lektüre parat hätte. Schott legte ein drittes Buch der Wahl, die der Briefträger treffen sollte, bereit. Schotts Interesse für die Wahl, die der Briefträger treffen könnte oder sollte oder träfe, ist zeitweise groß.
Bedenken hegt Schott zuerst wegen der Folgen für die Mieter des obersten Stockwerks. Gingen sie achtlos an der Leselampe, dem kleinen Tisch, dem Sessel oder an dem Sessel, dem kleinen Tisch, der Leselampe vorüber? Nähmen sie keine Notiz von dem Kühlschrank? Wäre oder bliebe ihnen der Garderobenständer und der Heizofen oder der Heizofen und der Garderobenständer gleichgültig? Ließen sie die Bücher links oder rechts liegen? Was geschähe, säße in dem Sessel der Briefträger, hinge an dem Garderobenständer der Wintermantel oder die Winterjacke, stünde neben dem Tisch die Briefträgerumhängetasche, kochte auf der Heizplatte in einem Wasserkessel, den Schott auch bereitgestellt hätte, Wasser für eine Kanne Tee, oder tränke der Briefträger aus einem großen Henkelglas, das Schott bereitgestellt hätte, trotz Kälte ein kaltes Bier, und stünde auf dem kleinen Tisch, neben Teekanne und Kaffeekanne, Teetasse und Kaffeetasse, Teebüchse und Kaffeebüchse, Zucker und Sahne, die Schott sämtlich bereitgestellt hätte, der Heizofen angekippt mittels eines Buches und strömte ein starker warmer Luftstrom gegen den Oberkörper des Briefträgers, während ein zweites Buch aufgeschlagen neben dem Heizofen auf dem Tisch läge, ein drittes Buch aber, unaufgeschlagen, auf dem Kühlschrank? Was geschähe?
Oder was geschähe, säße in dem Sessel der Briefträger, hinge an dem Garderobenständer an diesem besonders heißen Tag das Oberhemd, stünde neben dem Kühlschrank die Briefträgerumhängetasche, tränke der Briefträger aus einem großen Henkelglas ein Bier, oder kochte auf der Heizplatte in einem Wasserkessel trotz Hitze Wasser für heißen Tee, und stünde auf dem kleinen Tisch neben Teekanne und Kaffeekanne, Teetasse und Kaffeetasse, Teebüchse und Kaffeebüchse, Zucker und Sahne der Heizofen angekippt mittels eines Buches, und strömte ein starker Luftstrom gegen den Oberkörper des Briefträgers, nachdem es gelungen wäre, das Gebläse unabhängig von der Wärmequelle in Gang zu setzen, während ein zweites Buch aufgeschlagen neben dieser Art Ventilator auf dem Tisch läge, ein drittes Buch aber, unaufgeschlagen, auf dem Kühlschrank? Was geschähe?
Können die Folgen für die Mieter von den Folgen für den Briefträger überhaupt genügend unterschieden werden?
Erschräke ein Mieter, erschräke dann auch der Briefträger? Empörte sich ein Mieter, empörte sich dann auch der Briefträger? Fragte, schriee oder brüllte ein Mieter, fragte, schriee oder brüllte dann auch der Briefträger? Fiele ein Mieter in Ohnmacht, fiele dann auch der Briefträger in Ohnmacht? Suchte einen Mieter eine Afterschließmuskelinsuffizienz heim, suchte dann auch den Briefträger eine Afterschließmuskelinsuffizienz heim? Erlitte ein Mieter einen Herzinfarkt, erlitte dann auch der Briefträger einen Herzinfarkt?
Der Mieter könnte jeweils eine Mieterin sein. Wäre der Briefträger jung, die Mieterin ebenfalls, holte die Mieterin dann aus der Wohnung einen weiteren Sessel? Wenn ja, stellte sie den Sessel vor den Sessel des Briefträgers? Wenn ja, setzte sie sich in den Sessel? Wenn ja, sähe der Briefträger, daß die Mieterin im Sommer unter kurzem Rock keine Hose trüge?
Wäre der Briefträger alt, die Mieterin jung, holte die Mieterin dann aus ihrer Wohnung einen weiteren Sessel? Wenn ja, stellte sie den Sessel vor den Sessel des Briefträgers? Wenn ja, setzte sie sich in den Sessel? Wenn ja, sähe der Briefträger, daß die Mieterin im Sommer unter kurzem Rock keine Hose trüge?
Wäre der Briefträger jung, die Mieterin alt, holte die Mieterin dann aus ihrer Wohnung einen weiteren Sessel? Wenn ja, stellte sie den Sessel vor den Sessel des Briefträgers? Wenn ja, setzte sie sich in den Sessel? Wenn ja, sähe der Briefträger, daß die Mieterin im Sommer unter langem Rock keine Hose trüge?
Wäre der Briefträger alt, die Mieterin ebenfalls, holte die Mieterin dann aus ihrer Wohnung einen weiteren Sessel? Wenn ja, stellte sie den Sessel vor den Sessel des Briefträgers? Wenn ja, setzte sie sich in den Sessel? Wenn ja, sähe der Briefträger, daß die Mieterin im Sommer unter langem Rock keine Hose trüge?
Der Verfasser sagt, Wäre ich doch ein Briefträger und eine Mieterin.
Der Briefträger könnte eine Briefträgerin sein. Wäre die Briefträgerin jung, der Mieter ebenfalls, stellte sich der Mieter vor den Sessel der Briefträgerin? Wenn ja, sähe die Briefträgerin, daß die Hose des Mieters offenstünde?
Wäre die Briefträgerin alt, der Mieter jung, stellte sich der Mieter vor den Sessel der Briefträgerin? Wenn ja, sähe die Briefträgerin, daß die Hose des Mieters offenstünde?
Wäre die Briefträgerin jung, der Mieter alt, stellte sich der Mieter vor den Sessel der Briefträgerin? Wenn ja, sähe die Briefträgerin, daß die Hose des Mieters offenstünde?
Wäre die Briefträgerin alt, der Mieter ebenfalls, stellte sich der Mieter vor den Sessel der Briefträgerin? Wenn ja, sähe die Briefträgerin, daß die Hose des Mieters offenstünde?
Der Verfasser sagt, Wäre ich doch eine Briefträgerin und ein Mieter.
Wäre der Briefträger ein Briefträger, und zwar ein junger, der Mieter ein Mieter, und zwar ebenfalls ein junger, setzte sich der Mieter auf die Sessellehne? Wenn ja, was dann?
Wäre der Briefträger ein Briefträger, und zwar ein alter, der Mieter ein Mieter, und zwar ein junger, setzte sich der Mieter auf die Sessellehne? Wenn ja, was dann?
Wäre der Briefträger ein Briefträger, und zwar ein junger, der Mieter ein Mieter, und zwar ein alter, setzte sich der Mieter auf die Sessellehne? Wenn ja, was dann?
Wäre der Briefträger ein Briefträger, und zwar ein alter, der Mieter ein Mieter, und zwar ebenfalls ein alter, setzte sich der Mieter auf die Sessellehne? Wenn ja, was dann?
Der Verfasser sagt, Wäre ich doch ein Briefträger und ein Mieter, dann wüßte ich mehr.
Wäre der Briefträger eine Briefträgerin, und zwar eine junge, der Mieter eine Mieterin, und zwar ebenfalls eine junge, setzte sich die Mieterin auf den Schoß der Briefträgerin? Wenn ja, und die Mieterin trüge im Sommer keine Hose unter dem kurzen Rock, was geschähe?
Wäre der Briefträger eine Briefträgerin, und zwar eine alte, der Mieter eine Mieterin, und zwar eine junge, setzte sich die Mieterin auf den Schoß der Briefträgerin? Wenn ja, und die Mieterin trüge im Sommer keine Hose unter dem kurzen Rock, was geschähe?
Wäre der Briefträger eine Briefträgerin, und zwar eine junge, der Mieter eine Mieterin, und zwar eine alte, setzte sich die Mieterin auf den Schoß der Briefträgerin? Wenn ja, und die Mieterin trüge im Sommer keine Hose unter dem langen Rock, was geschähe?
Wäre der Briefträger eine Briefträgerin, und zwar eine alte, der Mieter eine Mieterin, und zwar ebenfalls eine alte, setzte sich die Mieterin auf den Schoß der Briefträgerin? Wenn ja, und die Mieterin trüge im Sommer keine Hose unter dem langen Rock, was geschähe?
Der Verfasser sagt, Wäre ich doch eine Briefträgerin und eine Mieterin, dann wüßte ich noch mehr.
Wäre der Briefträger eine Briefträgerin, junge oder alte, was trüge die Briefträgerin im Sommer: eine lange Hose oder einen kurzen oder einen mittellangen Rock?
Wäre der Briefträger eine Briefträgerin, junge oder alte, was trüge die Briefträgerin im Winter: einen mittellangen Rock oder eine lange Hose?
Trüge der Mieter, der eine Mieterin wäre, im Winter eine lange Hose, wie bemerkte der Briefträger oder die Briefträgerin, daß die Mieterin auch unter der langen Hose keine Hose trüge?
So viele Antworten auf so viele Fragen wüßte Schott nicht. Noch weniger wüßte Schott, was geschähe, falls zwei Mieter gleichzeitig auf den Briefträger oder auf die Briefträgerin träfen, nämlich zwei junge Mieter, oder ein junger und ein alter Mieter, oder zwei junge Mieterinnen, oder eine junge und eine alte Mieterin, oder zwei alte Mieter, oder zwei alte Mieterinnen, oder falls drei Mieter gleichzeitig auf den Briefträger oder auf die Briefträgerin stießen, nämlich drei junge Mieter, oder zwei junge Mieter und ein alter Mieter, oder ein junger