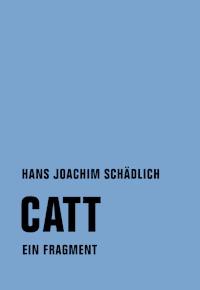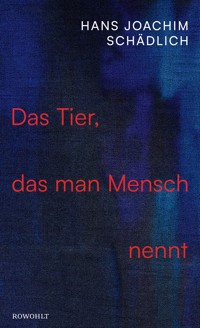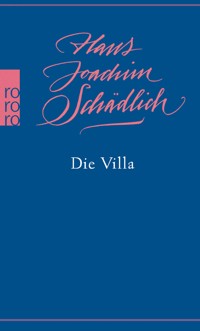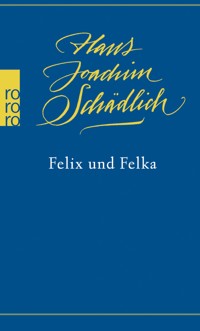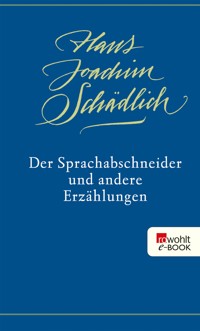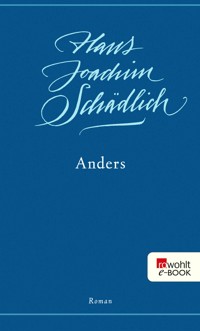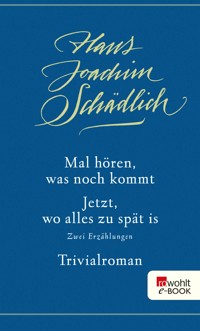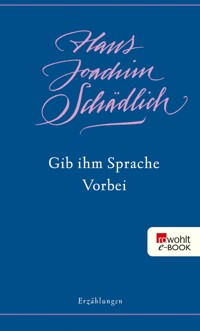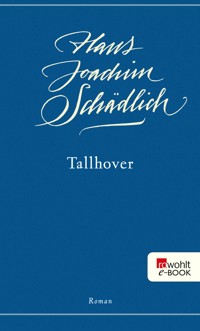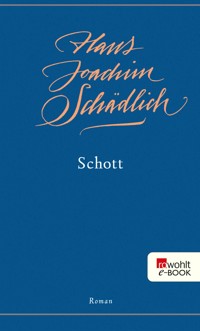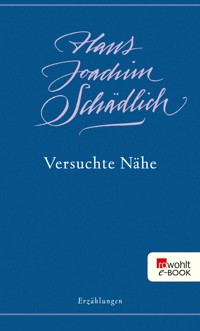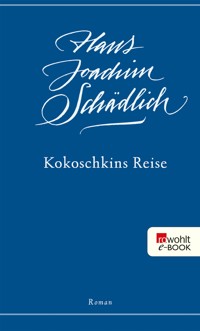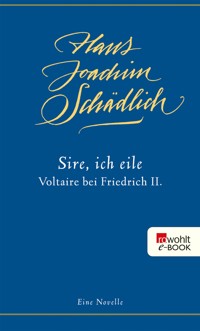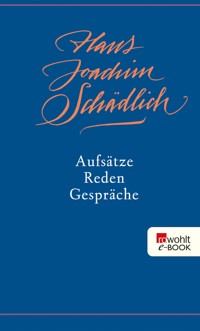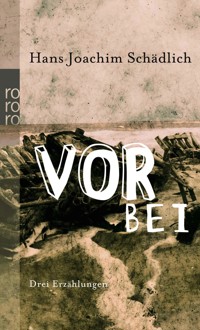9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Schädlich: Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
Nach dem Erfolg seiner Novelle «Sire, ich eile» über Friedrich II. und Voltaire erzählt Hans Joachim Schädlich nun die Geschichte zweier Narren. Joseph Fröhlich (1694–1757), gelernter Müller aus der Steiermark, wohlbestallter kurfürstlich-königlicher Taschenspieler und Lustiger Rat am Dresdner Hof, Vertrauter Augusts des Starken – der Einzige, der ihn duzen darf –, fürsorglicher Familienvater, der sich am Elbufer auf einem Grundstück, das August ihm geschenkt hat, ein Haus baut: ein menschenfreundlicher und wohltätiger Mann. Doch auch ein Spielball des Kurfürsten. Ganz anders das Leben von Peter Prosch (1744–1804), einem Tiroler aus ärmsten Verhältnissen und von heiter-naivem Naturell, der in Österreich und Süddeutschland von Fürstenhof zu Fürstenhof zieht – ihm ist es nicht vergönnt, eine Stelle zu erlangen. In einem fiktiven Brief an Joseph Fröhlich beklagt er, dass die Fürsten und ihre Günstlinge üble, oft grausame Scherze mit ihm treiben: Man will ihm ein Kind unterschieben, man erklärt ihn zum Taufpaten eines Esels, man heftet ihm einen falschen Bart an und steckt ihn in Brand, man bindet ihn am Sattel eines wilden Pferdes fest – alles zur Belustigung der Herren. Er erduldet es, denn: «Je mehr ich ertrage, desto größer ist mein Ertrag.» Hans Joachim Schädlich macht erneut, kunstvoll und verknappt, zwei historische Gestalten und ihre Zeit lebendig. Mit diesem Roman über Macht und Moral, Abhängigkeit und Selbstachtung fügt er seinem Werk ein weiteres Bravourstück hinzu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Hans Joachim Schädlich
Narrenleben
Roman
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Nach dem Erfolg seiner Novelle «Sire, ich eile» über Friedrich II. und Voltaire erzählt Hans Joachim Schädlich nun die Geschichte zweier Narren.
Joseph Fröhlich (1694–1757), gelernter Müller aus der Steiermark, wohlbestallter kurfürstlich-königlicher Taschenspieler und Lustiger Rat am Dresdner Hof, Vertrauter Augusts des Starken – der Einzige, der ihn duzen darf –, fürsorglicher Familienvater, der sich am Elbufer auf einem Grundstück, das August ihm geschenkt hat, ein Haus baut: ein menschenfreundlicher und wohltätiger Mann. Doch auch ein Spielball des Kurfürsten.
Ganz anders das Leben von Peter Prosch (1744–1804), einem Tiroler aus ärmsten Verhältnissen und von heiter-naivem Naturell, der in Österreich und Süddeutschland von Fürstenhof zu Fürstenhof zieht – ihm ist es nicht vergönnt, eine Stelle zu erlangen. In einem fiktiven Brief an Joseph Fröhlich beklagt er, dass die Fürsten und ihre Günstlinge üble, oft grausame Scherze mit ihm treiben: Man will ihm ein Kind unterschieben, man erklärt ihn zum Taufpaten eines Esels, man heftet ihm einen falschen Bart an und steckt ihn in Brand, man bindet ihn am Sattel eines wilden Pferdes fest – alles zur Belustigung der Herren. Er erduldet es, denn: «Je mehr ich ertrage, desto größer ist mein Ertrag.»
Hans Joachim Schädlich macht erneut, kunstvoll und verknappt, zwei historische Gestalten und ihre Zeit lebendig. Mit diesem Roman über Macht und Moral, Abhängigkeit und Selbstachtung fügt er seinem Werk ein weiteres Bravourstück hinzu.
Über Hans Joachim Schädlich
Hans Joachim Schädlich, 1935 in Reichenbach im Vogtland geboren, arbeitete an der Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin, bevor er 1977 in die Bundesrepublik übersiedelte. Heute lebt er wieder in Berlin. Für sein Werk bekam er viele Auszeichnungen, u.a. den Heinrich-Böll-Preis, Hans-Sahl-Preis, Kleist-Preis, Schiller-Gedächtnispreis, Lessing-Preis, Bremer Literaturpreis, Berliner Literaturpreis und Joseph-Breitbach-Preis. Zuletzt veröffentlichte er die Novelle «Sire, ich eile. Voltaire bei Friedrich II.» – «das wunderbare Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem Historiker und dem Schriftsteller Hans Joachim Schädlich» (Frankfurter Allgemeine Zeitung).
Inhaltsübersicht
Jan, Susanne und Anna gewidmet
Erster Teil
«Name?»
«Fröhlich, Joseph.»
«Geboren?»
«Ja.»
«Das Jahr?»
«Sechzehnvierundneunzig.»
«Wo?»
«Im Bett meiner Mutter.»
«Der Ort!»
«Alt-Aussee.»
«Dann sind Sie ein Bayer?»
«Hören Sie! Alt-Aussee liegt in der Steiermark.»
«Ein Steirer.»
«Na also.»
«Beruf?»
«Müller.»
«Müller?»
«Müller.»
»Ich dachte …»
«Wollen Sie noch mehr wissen?»
«Familie?»
«Eine Frau und zwei Kinder.»
«Wohnhaft?»
«Bayreuth.»
Dieser kleine Beamte des Markgräflichen Hofes. Ich mochte ihn nicht. Er fragte mich wie ein Gendarm einen Bettler. Es war aber längst ausgemacht, daß ich als Hof-Taschenspieler bei Markgraf Georg Wilhelm antreten sollte. Na schön, ich hätte freundlicher zu diesem Schreiber sein können. Schließlich notierte er nur die nötigen Angaben für meine Legitimation bei Hofe.
Ich unterschrieb die Angaben und hielt bald darauf das Papier in Händen.
Meine Frau Ursula freute sich. Wir konnten in Bayreuth sicher leben.
Ich mußte mit meinen Taschenspieler-Künsten nicht mehr auf dem Markt auftreten:
Wie man Wasser und Bier in einem Glas derart mischt, daß das Bier unten und das Wasser oben zu stehen kommt, und man sodann das Bier durch das Wasser austrinkt.
Oder: Wie man einen Brief in einem Ei versteckt.
Oder: Wie man einen Degen durch den Kopf sticht.
Bei Hofe mußte anders agiert werden, aber ich kann nicht behaupten, daß es besonders schwer gewesen wäre, den Unterhaltungsanspruch des Markgrafen und der Markgräfin, ja der Bayreuther höfischen Gesellschaft zu erfüllen.
Fröhlich ging nur in seiner Tracht aus dem Haus. Er trug ein buntes gemustertes Hemd, einen weißen Spitzenkragen, weiße Manschetten, eine weite gelbe oder rote Kniehose, breite Hosenträger, eine blaue, weiße oder schwarze Joppe mit goldenen Knöpfen, halbhohe schwarze Stulpenstiefel und einen hohen, blumenverzierten grünen Spitzhut mit Schlappkrempe.
Sein Äußeres erregte Aufsehen.
Oft liefen ihm Kinder nach.
Die Leute meinten, er sehe alpenländisch aus.
Einmal sollte ein Theaterstückchen mit einem Wilderer aufgeführt werden, dem ich das Handwerk zu legen hatte.
Der Markgraf Georg Wilhelm und die Markgräfin saßen im Publikum.
Ich hatte mir ein Eulenkostüm machen lassen mit breiten Schwingen und einem großen Eulenkopf. Meine Armschwingen endeten in scharfen Krallen.
Den Wilderer spielte ein junger Bursche, der nicht allzu schwer war. Ich schwebte an einem Seil vom Schnürboden und warnte den Jungen. Als er dennoch seine Büchse anlegte, stürzte ich mich auf ihn, packte ihn und ließ mich bis unter den Schnürboden hieven.
Das war anstrengend, aber nicht besonders originell.
Die Zuschauer klatschten wie wild, so etwas hatten sie noch nicht gesehen.
Markgraf Georg Wilhelm ließ mich rufen:
«Du bist nicht nur ein Taschenspieler.
Du bist auch ein Schauspieler und Artist.
Exzellent, Fröhlich, exzellent.
Weiter so!»
Die Markgräfin sagte:
«Dich hat der Himmel geschickt. Ich habe mich selten so gut unterhalten.»
Beim Geburtstag des Markgrafen durfte ich an der Festtafel sitzen.
Ich weiß nicht mehr, was im ersten Gang alles serviert wurde.
Ich nahm zuerst von der Hechtsuppe. Die Lerchenpastete ließ ich aus. Aber eine gegrillte Taube und gefüllte Artischocken habe ich gegessen.
Im zweiten Gang kamen gebratene Rebhühner, gedämpfte Fasane, saures Rehfleisch, Wildschweinkeule mit Waldpilzen, Lammkoteletts in süßsaurer Soße, Poularde in Champagner mit frischen Champignons und verschiedene Salate auf den Tisch.
Rebhuhn und Fasan bin ich nicht gewohnt. Mir war Wildschwein mit Pilzen das liebste.
Zur Taube und zu den Artischocken habe ich Weißwein getrunken, zum Wildschwein roten.
Zum Nachtisch wurden gezuckerte Pistazien, kandierte Apfel- und Birnenstücke, kandierte Kirschen, Marzipan, Orangengelee, süße Mandeln, gebackene Sultaninen, glasierte Walnüsse und glasierte Haselnüsse aufgetischt.
Und natürlich Kaffee und Tee und Schokolade.
Ich habe von allem ein bißchen genascht und heiße Schokolade dazu getrunken.
Den anderen Tag ging ich zur Hofküche.
Ich klopfte.
Ein Herein! hörte ich nicht.
Ich öffnete die Tür und sagte:
«Darf ich eintreten?»
Einer sagte:
«Eigentlich nicht. Aber sei’s drum.»
Es war offenbar der Oberküchenmeister. Neben ihm arbeiteten drei Köche.
Ich sagte:
«Das Festessen gestern war selbst ein Fest.»
«Dankedanke, der Herr.»
«Ich bin der Joseph aus der Steiermark.»
«Angenehm. Ich bin der Christian aus Sachsen.»
«Ich komme aus Alt-Aussee.»
«Soso. Ich komme aus Dresden.»
«Wie kommt es, daß Sie in Bayreuth arbeiten?»
«Ich bin der Oberküchenmeister in der Dresdner Hofküche. Der Kurfürst Friedrich August hat mich für eine Woche nach Bayreuth ausgeliehen. Der Markgraf ist sein Schwager. Am Geburtstag des Markgrafen sollte ich ganz groß für ihn kochen, damit er seine Lebensfreude wiederfindet. Er ist oft recht schwermütig.»
«An der Geburtstagstafel war er sehr fidel.»
«Ich weiß. Augusts Leibspeisen haben ihm wohlgetan.»
«Leibspeisen?»
«August liebt vor allem Wildbret. Hase, Hirsch, Reh, Wildschwein, Wildenten, Wildgänse, Wildtauben, Rebhühner, Birkhühner.
Aber er liebt auch Fisch. Karpfen, Aal, Forelle, Hecht, Lachs. Und natürlich süße Sachen.
Das Wild jagt er oft selbst. In den Wäldern um Moritzburg bei Dresden und um Hubertusburg bei Oschatz.
August ist ein passionierter Jäger. Bei der Sauhatz steht er dem Tier manchmal direkt gegenüber. Die Jagd ist seine größte Leidenschaft. Die Jagd auf wilde Tiere und schöne Frauen.»
Die Schwester des Markgrafen Georg Wilhelm, Christiane Eberhardine, war 1693, im Alter von einundzwanzig Jahren, mit August dem Starken verheiratet worden. Sie ist die Mutter des Erbprinzen Friedrich August, der 1696 in Dresden zur Welt kam.
Weil sie sich geweigert hatte, mit August dem Starken 1697 zum Katholizismus zu konvertieren, wurden ihr die Rechte der mütterlichen Obhut beschnitten.
Die Erziehung des Erbprinzen lag in den Händen von Augusts Mutter, Anna Sophia.
Christiane Eberhardine zog sich vom Dresdner Hof zurück und lebte im Schloß Pretzsch bei Wittenberg, das August ihr anläßlich der Geburt des Thronfolgers geschenkt hatte.
Der Markgraf meinte, seine Schwester könne eine Aufheiterung vertragen. Er schickte ihr seinen Hoftaschenspieler Fröhlich.
Die streng protestantische Kurfürstin, die in Sachsen als «Betschwester» verspottet wurde, fand Gefallen an den Schnurrpfeifereien ihres katholischen Gastes.
Ich machte eine schöne rote Rose augenblicklich weiß, indem ich sie über geanzündeten Schwefel hielt.
Oder ich ließ aus dem Wasser Feuer aufflammen.
Zu diesem Zweck hatte ich vor der Reise aus einem Ei durch ein Löchlein Eiweiß und Dotter herausgebracht und das leere Ei in der Sonne getrocknet.
Sodann hatte ich Schwefel, Salpeter und gelöschten Kalk in das Ei gefüllt und das Löchlein mit Wachs verschlossen.
Ein Diener mußte eine Wanne mit Wasser füllen.
Ich warf das Ei aus gehörigem Abstand in die Wanne.
Aus dem Wasser flammte Feuer auf.
Oder ich machte, daß eine Nadel auf einem Spiegel aufrecht fortging.
Ich kehrte der Kurfürstin den Rücken und bestrich den Nadelkopf mit dem einen Pol eines Magneten, die Nadelspitze aber mit dem anderen Pol.
Nun wandte ich mich der Kurfürstin wieder zu und legte die Nadel auf einen glatten flachen Spiegel.
In der Rechten hielt ich den Spiegel, die Linke mit dem Magneten applizierte ich unter dem Spiegel direkt unter die Nadel, und zwar nur mit dem einen Pol.
Der Magnet hob die Nadel in die Höhe, ich bewegte den Magneten unter dem Spiegel, und die Nadel wanderte auf der Spitze über das Glas.
Nun hielt ich den anderen Pol gegen die Spiegel-Unterseite. Das andere Ende der Nadel wandte sich dem Magneten zu, und die Nadel wanderte auf dem Kopf.
Fröhlich war auf seiner ersten Reise nach Dresden unterwegs, wo er vor August dem Starken, dem Kronprinzenpaar und dem höfischen Gefolge im Holländischen Palais auftreten sollte.
Meinen ersten Auftritt in Dresden verdanke ich der Empfehlung von Johann Adolph II., einem Vetter von August dem Starken, der seit 1723 General der kursächsischen Kavallerie war.
Ich produzierte im Holländischen Palais meine Sciencen.
August der Starke, dem ich in die Augen sah, zog mich an.
Ich mochte ihn.
Ich dachte, mit ihm könnte ich mich verstehen.
Er ließ mich nach der Tafel rufen.
Ich stand nahe vor ihm.
Er sagte:
«Du gefällst mir. Du kannst nach Dresden kommen. Ich mache dich zu meinem Lustigen Rat.»
Ich war glücklich.
Er fragte:
«Was sagst du?»
«Es gibt für mich nichts Schöneres. Ich muß in Bayreuth meinen Abschied einreichen.»
«Mein Schwager wird dich freigeben. Was ist Bayreuth gegen Dresden.»
Dresden.
Friedrich August I., genannt der Starke, Kurfürst von Sachsen und König in Polen, setzte alles daran, Dresden zu einer europäischen Metropole zu machen.
Künstler und Naturforscher von Rang wie die Baumeister Matthäus Daniel Pöppelmann, Johann Friedrich Karcher, Zacharias Longuelune, Johann Gottfried Fehre, Johann Christoph Knöffel, George Bähr, die Bildhauer Balthasar Permoser, Benjamin Thomae, Johann Joachim Kändler, Johann Christian Kirchner, der Juwelier Johann Melchior Dinglinger, die Forscher Johann Friedrich Böttger und Walther von Tschirnhaus standen im Dienst des Dresdner Hofes.
Sie ließen sich von August zu einzigartigen Leistungen anregen.
Der Bau des Zwingers unter der Leitung von Pöppelmann und Permoser, der Bau des Opernhauses am Zwinger unter Pöppelmann, der Umbau der Augustusbrücke unter Pöppelmann und Fehre, der Bau des Wasserpalais Pillnitz unter Pöppelmann, die Anlage des Großen Gartens unter Karcher, der Bau der Frauenkirche unter Bähr, der Umbau des Jagdschlosses Moritzburg und des Holländischen Palais zum Japanischen Palais unter Pöppelmann und Longuelune, die Erfindung des Porzellans durch Böttger und Tschirnhaus, die Porzellanplastiken von Kändler, die Prunkwerke von Dinglinger, darunter «Der Hofstaat zu Delhi», «Der Thron des Großmoguls Aureng-Zeb» und «Das goldene Kaffeezeug», die Schatzkammer des Grünen Gewölbes im Residenzschloß, die Hofmaler Ádám Mányoki, Louis de Silvestre und Bernardo Bellotto, der sich Canaletto nannte, und die Aufführungen der Hofoper unter Adolph Hasse begründeten den Ruf und den Ruhm des barocken Dresden.
Der Buchhändler Crell in Dresden hat über mich geschrieben, daß ich auf meinem weiß-schwarz-fleckigen Pferd, das ich «Tiger» nannte, einhergeritten kam.
Die Assemblée im Holländischen Palais sei mit meinen Kunststücken sehr zufrieden gewesen.
Crell hat mir einen aufgeweckten Geist bescheinigt. Er schrieb, ich sei dabei sehr gelassen und wisse mich trefflich in die Leute und deren Stand zu schicken.
Diese Zeilen habe ich in Bayreuth meiner lieben Ursula gezeigt.
Ich sagte:
«Du kannst dir Dresden nicht vorstellen. Bayreuth ist auch schön: die Eremitage, das alte Schloß.
Aber Dresden!
Das Residenzschloß.
Der Zwinger.
Das Opernhaus.
Die Brühlsche Terrasse.
Das Palais im Großen Garten.
Ich habe mir alles zeigen lassen.»
«Willst du nach Dresden?»
«Ja! Aber vorher muß ich nach Alt-Aussee.»
«Unser Hausstand …»
«Ich löse ihn auf.»
«Ach, Joseph. Die schrecklich weite Reise in die Steiermark.»
«Sorge dich nicht. Du bleibst mit Jacob und Wilhelmine Sophie ruhig in Bayreuth. Ich komme zu euch zurück.»
Am 18. Dezember 1726 starb Fröhlichs Gönner in Bayreuth, Markgraf Georg Wilhelm.
Dessen Vetter, der die Nachfolge antrat, Georg Friedrich Karl, hielt Fröhlich am Bayreuther Hof.
Im März 1727 gebar Fröhlichs Frau Ursula den zweiten Sohn des Paares, Carl Adolph Christian Friedrich.
Als Paten seines Söhnchens konnte Fröhlich Johann Adolph II., den Vetter von August dem Starken, gewinnen.
Im Mai 1727 traf Fröhlich ein harter Schlag: Zwei Monate nach der Geburt des Söhnchens starb, sechsunddreißigjährig, seine Frau Ursula.
Er stand mit drei Kindern, Jacob, Wilhelmine Sophie und dem Säugling Carl Adolph, allein da.
Eva Christiane Zöbler, Magd im Hause Fröhlich, kümmerte sich um die Kinder.
Joseph Fröhlich sah, daß sie gut war zu den Kindern, und heiratete sechs Wochen nach Ursulas Tod die neunzehnjährige Eva Christiane.
Fröhlich zog es endlich nach Dresden.
Obwohl in Bayreuth besoldet, gefiel ihm die Stimmung nicht mehr: Der Nachfolger des Markgrafen Georg Wilhelm, Georg Friedrich Karl, ein strenger Pietist, ließ den kunstfreundlichen und lebensbejahenden Geist seines Vorgängers vermissen.
Vielleicht mochte Fröhlich auch nicht mehr an dem Ort sein, wo seine geliebte Ursula gestorben war.
Er bat um seine Entlassung und reiste im September 1727 mit Frau Eva und den drei Kindern nach Dresden.
Fröhlich kutschierte das schwere Fuhrwerk, das beladen war mit Betten, Hausrat, Kisten, Koffern. Er saß mit Jacob und Wilhelmine Sophie auf dem Bock. Frau Eva saß mit dem kleinen Carl Adolph auf dem Arm im Wagen.
Bei der Werkstatt des Bildhauers Permoser am Seitenflügel des Zwingers hielt Fröhlich an.
Permoser wußte Rat.
«Fahrt in die Salzgasse hinter der Baustelle der Kirche Unserer Lieben Frau. Bei der Witwe Nitzschewitz findet ihr Wohnung. Ihr Mann war Hoffourier. Es gibt einen Pferdestall. Mein Geselle Kändler führt euch. Er geht euch auch beim Abladen zur Hand.»
Schon am nächsten Tag stellte Fröhlich sich im Residenzschloß bei August dem Starken ein.
Ich stand vor dem Kurfürsten und König.
Er winkte mich näher zu sich heran und sagte:
«Willkommen, Monsieur Fröhlich. Ich habe schon auf dich gewartet. Für mich bist du Joseph. Du darfst als einziger ‹du› zu mir sagen.»
August überreichte mir ein Pergament und sagte:
«Hier findest du, was dir versprochen wurde.»
Ehe ich einen Blick auf das Pergament warf, fragte ich:
«Was ist das?»
«Ich ernenne dich zum kurfürstlich-königlichen Hoftaschenspieler und zu meinem Lustigen Rat. Außerdem – zum Bürgermeister von Narrendorf.»
Ich verbeugte mich leicht und fragte:
«Was habe ich zu tun?»
«Bring mich einmal pro Tag zum Lachen oder zweimal zum Lächeln.»
Ich überlegte, wie ich den König anreden könnte, und entschloß mich zu «August».
«Ich danke dir, August. Sag mir bitte: Wo liegt das Narrendorf?»
«In deinem Kopf.»
August gab mir zum Abschied ein Tatschkerl auf die linke Wange. So war ich fürs erste entlassen.
Zu Hause las Fröhlich das Pergament. Es enthielt nichts über seine Besoldung.
Fast immer, wenn ich zu ihm kam, fast immer, wenn er mich entließ, gab er mir einen Klaps auf die Wange.
Ich empfand diesen leichten Schlag als eine rauhe Liebkosung.
Wenn August aufgeräumt war, fiel der Schlag heftiger aus, wie eine Maulschelle.
War August übelgelaunt, versetzte er mir einen saftigen Watschen.
Was sollte ich tun.
Ich schäme mich bei dem Gedanken, daß mir etwas fehlte, wenn ich keine Dachtel bekam.
Bald nach der Ankunft der Familie Fröhlich in Dresden starb im Alter von sechs Monaten das Söhnchen Carl Adolph.
Frau Eva gab sich die Schuld am Tod des Jungen.
«Ich habe doch für ihn getan, was ich konnte», klagte sie und weinte.
Fröhlich sagte:
«Du hast keine Schuld. Er wollte nicht leben. Er wollte zu seiner Mutter.»
Wie konnte Fröhlich fröhlich sein?
Er mußte es. Es war sein Beruf.