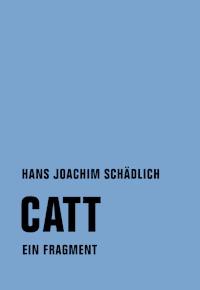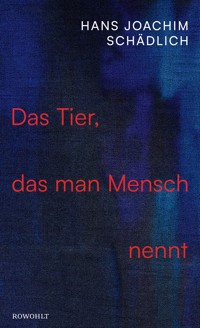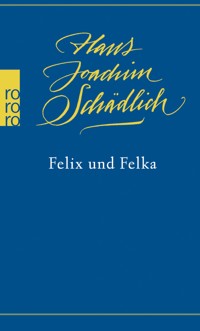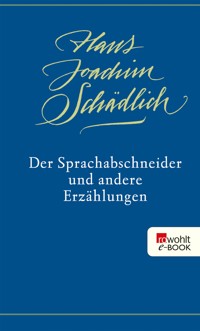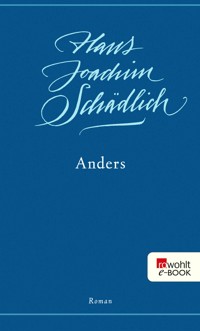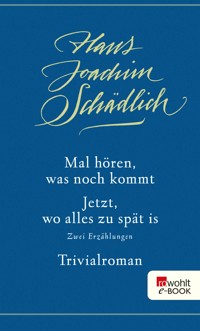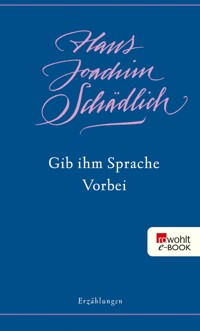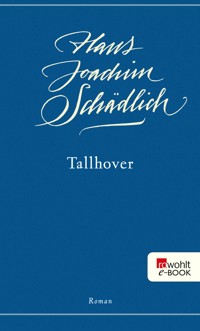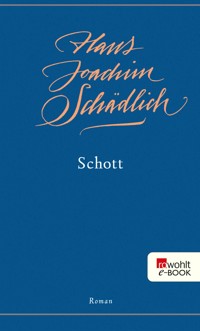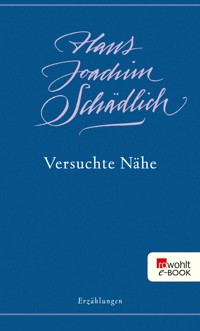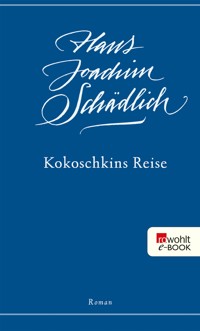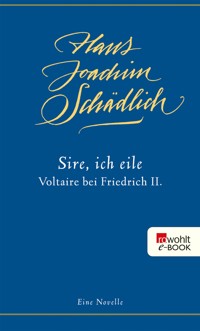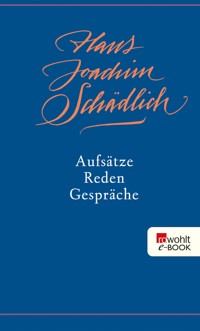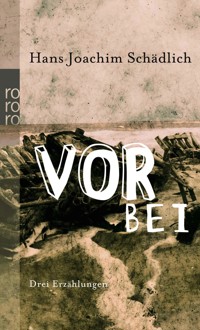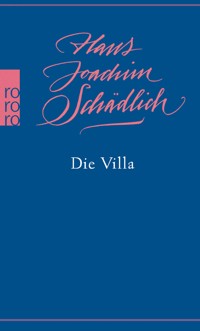
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Gründerzeitvilla wie aus dem Bilderbuch. Bewohnt wird sie seit 1940 von der Familie Kramer. Doch die sorglose Zeit währt nicht lange. Der Vater, Wollkaufmann und überzeugter Nationalsozialist, kann angesichts der Verbrechen des Nazi-Regimes nicht länger an seinem Glauben festhalten. Nach seinem frühen Tod wird die Familie von den Schrecken des Krieges eingeholt. Hans Joachim Schädlich hat sich den Jahren zwischen 1931 und 1950 zugewandt, der Zeit vom Ende der Weimarer Republik bis zu den Anfängen der DDR. In virtuoser Verdichtung führt er vor Augen, wie eine Familie im Widerstreit von Wahn und Gewissen diese Jahre erlebt. Die Villa wird zum Gleichnis - exemplarisch für die Umbrüche des 20. Jahrhunderts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Hans Joachim Schädlich
Die Villa
Über dieses Buch
Eine Gründerzeitvilla wie aus dem Bilderbuch: schmiedeeisernes Tor, zu Seiten der Auffahrt der große Springbrunnen, der Eingang flankiert von hohen Kandelabern, Rhododendron und Rosen im verwunschenen Park, zweigeschossige Treppenhalle, Salon, Herren- und Speisezimmer, Stuck, Bleiglasfenster, Zimmerfluchten unten wie oben, Parkett oder gefliest. Bewohnt wird die Villa, die in der vogtländischen Kleinstadt Reichenbach steht, seit 1940 von Hans und Elisabeth Kramer, ihren vier Kindern und dem Personal. Doch die sorglose Zeit währt nicht lange. Der Vater, Wollkaufmann und überzeugter Nationalsozialist, kann angesichts der Verbrechen des Naziregimes an seinem Glauben nicht festhalten. Er und seine Angehörigen werden von den Schrecken des Krieges eingeholt.
Hans Joachim Schädlich hat sich in seinem neuen Buch den Jahren zwischen 1931 und 1950 zugewandt, der Zeit vom Ende der Weimarer Republik bis zu den Anfängen der DDR. In virtuoser Verdichtung führt er vor Augen, wie eine Familie im Widerstreit von Ideologie und Moral, Wahn und Gewissen die Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegsjahre erlebt. Getreu seiner Maxime, daß das Entscheidende einer Erzählung die Leerstellen sind, schafft er Raum für eindrucksvolle Bilder, Stimmungen und auf faktenreichem Wissen fußende Imaginationen. Die Villa wird zum Gleichnis – exemplarisch für die Umbrüche des 20. Jahrhunderts.
Vita
Hans Joachim Schädlich, 1935 in Reichenbach im Vogtland geboren, arbeitete an der Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin, bevor er 1977 in die Bundesrepublik übersiedelte. Für sein Werk bekam er viele Auszeichnungen, u.a. den Heinrich-Böll-Preis, Hans-Sahl-Preis, Kleist-Preis, Schiller-Gedächtnispreis, Lessing-Preis, Bremer Literaturpreis, Berliner Literaturpreis und Joseph-Breitbach-Preis. 2014 erhielt er für seine schriftstellerische Leistung und sein politisches Engagement das Bundesverdienstkreuz. Hans Joachim Schädlich lebt in Berlin.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2020
Copyright © 2020 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Privat
ISBN 978-3-644-00172-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Krista Maria Schädlich gewidmet
Prolog
Das zweiflügelige hohe Parktor. Schmiedeeisern, alle Stäbe mit Zierspitze, Typ Lanze. Halbhohe Zwischenstäbe. Der Parkzaun zu beiden Seiten des Tores in gleicher Art.
Die leicht geschwungene Auffahrt, vorbei am großen Springbrunnen, zum Haupteingang auf der Westseite.
Fünf Stufen zur massiven eichenen Außentür. Links und rechts der Treppe zweiflammige, drei Meter hohe Kandelaber.
Säulen tragen das Vordach über dem Eingang.
Der Windfang geräumig. Gefliester Fußboden. Ein Messing-Schirmständer.
Die Tür in die Treppenhalle. Ein erster großer Raum. Der Platz der Garderobe. Ein Bleiglasfenster. Die raumbreite dreistufige Treppe in die Haupthalle, Hochparterre.
Die Räume im Hochparterre – der Salon, das Herrenzimmer, das Speisezimmer, der Wintergarten – untereinander verbunden und, mit Ausnahme des Wintergartens, von der Diele her zugänglich. Die Küche mit einer Tür in den Wintergarten, von dem eine türbreite zwölfstufige Treppe in den Park auf der Südseite führt.
In der Diele die Türen zur Toilette, zu Abstellräumen und zur Kellertreppe.
Die Diele und die Wohnräume mit Parkettböden, Küche und Wintergarten gefliest.
Die Decken des Salons, des Herrenzimmers und des Speisezimmers stuckverziert.
Die Treppenhalle zwei Geschosse hoch. Der Treppenlauf ins Obergeschoß zu einem Zwischenpodest auf mittlerer Höhe.
Über dem Podest ein hohes Bleiglasfenster. Vom Podest die Treppe in gegenläufiger Richtung. Das Treppengeländer: schmiedeeiserne Rankenornamente.
Im Obergeschoß: der Salon als Vorzimmer des Büros, das Büro, das erste Kinderzimmer, das große Schlafzimmer mit einem geräumigen Einbau-Kleiderschrank und Waschtisch, das zweite Kinderzimmer mit einem runden Turmgelaß. Über dem Gelaß ein runder Bodenraum.
Auf der Vorderseite der Villa der Turm, von Säulen getragen, die das Fenster des darunterliegenden Salons einrahmen. Ein spitzes Dach krönt den Turm, überragt das Flachdach der Villa.
Der Salon mit dem Büro verbunden, das erste Kinderzimmer mit dem großen Schlafzimmer. Alle Räume – wie im Hochparterre – von der Diele her zugänglich.
Die Diele und alle Räume parkettiert, die Decken stuckverziert.
Im Dachgeschoß ein Turmzimmer mit Alkoven und Einbauschränken, das große Fenster zur Nordseite. Zwei kleine Fenster nach Westen und Osten.
Außer dem Turmzimmer das Badezimmer, die Toilette und mehrere einfache Bodenkammern mit kleinen überdachten Fenstern. Im Dachgeschoß Dielenböden.
Im Souterrain der Villa eine geräumige Zweizimmerwohnung und der Heizungskeller, der Kokskeller, der Kartoffelkeller und weitere Vorratsräume. Die Fenster aller Kellerräume mit Schmuckgittern.
Das Souterrain mit einem separaten Eingang auf der Ostseite.
Die Villa von einem breiten Rundweg umschlossen. Zwischen Haus und Wegesrand weißer Rhododendron auf der Nordseite, Rosen auf der Südseite.
Der südliche Teil des Parks eine Phantasielandschaft. Auf eingefaßten Wegen unter hohen Bäumen durch ein Labyrinth von Blumenrabatten, Steingärten, Farnen. Eine geschwungene Eisenbrücke mit Schmuckgeländer überspannt zwischen zwei Felsblöcken eine breite Vertiefung, die ein Flußbett vorstellen soll.
In der nordöstlichen Ecke des Parks eine Garage. Die Zufahrt eine Abzweigung des Rundweges.
Neben der Garage ein Hundezwinger, vor dem Zwinger eine Hundehütte.
In einigem Abstand Kaninchenställe. Eine Teppichstange.
Die Villa ein Gründerzeitbau, 1890 errichtet.
«Ich wollte keine Kinder», sagte Elisabeth Kramer. «Ich wollte nicht heiraten. Ich wollte nach der Volksschule in Oberheinsdorf was Soziales lernen und wollte in die Welt. Aber mein Vater hat nur die Jungs was lernen lassen, die gar keine Lust dazu hatten.
‹Die Töchter heiraten sowieso›, hat er gesagt. ‹Wozu also.›
Er hat mich nach der Volksschule, da war ich fünfzehn, bloß auf die Handelsschule in Reichenbach geschickt. Buchhaltung, Steno, Maschineschreiben. Von Sechsundzwanzig bis Achtundzwanzig. Danach hab ich in seinem Kontor gearbeitet.
Aber das Kaufmännische hat mich nicht interessiert.
Dann kam der Hans und hat mich mit ’nem Kind belegt. Ich wollte gar nicht mit ihm schlafen. Ich hatte auch nichts davon. Zum ersten Mal mit ’nem Mann geschlafen und schon ’n Kind.
Am sechsundzwanzigsten April Einunddreißig haben wir in Oberheinsdorf geheiratet. Ich hab keine Erinnerung an meine Hochzeit. Ich weiß bloß, daß ich den ganzen Tag geweint hab. Ich war unglücklich, weil ich heiraten mußte. Im September ist der Georg auf die Welt gekommen.
Da war die Gerda, die Schwester vom Hans, schlauer. Die war auf der SS-Bräuteschule. Die haben sie aufgeklärt. Die mußte nicht heiraten.
Hans hab ich Neujahr Neunzehndreißig in Schöneck kennengelernt. Im Oktober Dreißig haben wir uns verlobt.
Ich war achtzehn, er dreiundzwanzig. Hans hat mir ein schönes Foto geschenkt, das hab ich zu Hause stolz vorgezeigt.
Mein ältester Bruder, der Alfred, hat gesagt:
‹Dein Freund ist doch ’n kleiner Itzig.›
Ich hab gesagt:
‹Was ist denn das.›
‹Na, ein Jude›, hat er gesagt.»
Paul Ruttig, der Vater von Elisabeth Kramer, stammte aus armen Verhältnissen; sein Vater war Handweber.
Paul Ruttig, geboren am 13. Februar 1873 in Schöneck/Vogtland, wollte es zu etwas bringen. Er war ehrgeizig und fleißig.
Seine Frau, Elise Martha Wenzel, geboren am 3. März 1874 in Schöneck/Vogtland, kam aus einer Kantorenfamilie.
Paul Ruttig und Elise Martha Wenzel heirateten 1894.
Bis 1903 wohnte das Ehepaar mit vier Kindern zur Miete in Hauptmannsgrün.
1903 baute Paul Ruttig in Oberheinsdorf ein Haus. Ein unterkellerter, geräumiger Backsteinbau. Im Hochparterre die Diele, Vorsaal genannt. Von der Diele die Treppe ins Obergeschoß und die Treppe in den Keller. Nach der Diele der Flur. Drei große Zimmer: das Kontor, die gute Stube, die nur bei besonderen Gelegenheiten betreten wurde, das Wohnzimmer. Die Wohnküche, der sich ein Vorratsraum anschloß; er wurde Käfterle genannt. Im Obergeschoß vier Zimmer, eines das Schlafzimmer von Paul und Martha, und ein Bad mit einem kupfernen Badeofen und einer freistehenden Wanne.
Hinter dem Haus, am Rand einer Wiese, der Raumbach. Der Gemüsegarten auf der Westseite des Hauses.
Paul und Elise Martha Ruttig bekamen elf Kinder.
Elisabeth war das zehnte Kind.
Paul Ruttig arbeitete in der Verwaltung der Deutschen Wollentfettung AG. 1898 war sie in Oberheinsdorf gegründet worden, zu der seit 1902 vom Bahnhof Oberheinsdorf ein Gleis auf den ‹Fabrikberg› führte.
Die Wollentfettung bereitete Rohwolle für die Verarbeitung in Spinnereien auf. Das Wasser für die Wollentfettung bezog der Betrieb aus einem nahegelegenen großen Teich, der von einem ständigen Zufluß gespeist wurde.
Paul Ruttig wußte, woher die Rohwolle kam, und er wußte, wohin die aufbereitete Rohwolle ging.
Hier entwickelte er seine Geschäftsidee. Er gründete eine Firma für den Großhandel mit Rohwolle und betrieb sie in seinem eigenen Haus in Oberheinsdorf.
Die Rohwolle kaufte er in verschiedenen Ländern nach der Prüfung von Wollmustern, die er anforderte, dann ließ er die Wolle in Deutschland waschen und verkaufte sie an Spinnereien, auch in Reichenbach.
Für seine Handelstätigkeit mußte Paul Ruttig nicht reisen. Er konnte alles durch eine ausgedehnte Korrespondenz mit Lieferanten und Käufern bewältigen.
Die Firma florierte. In seinem Kontor stapelten sich im Wandregal die Wollkörbe mit den Wollmustern.
Hans Kramer, 1907 im thüringischen Greiz geboren, hatte eine unruhige Kindheit und Jugend. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges lebte er bei den Eltern in Greiz, wo sein Vater Oswald Kramer als kaufmännischer Angestellter arbeitete. Als der Vater eingezogen wurde und die Mutter zu ihrer Schwester nach Leipzig ging, um dort das Lebensmittelgeschäft des Schwagers führen zu helfen, der auch Soldat geworden war, wurde Hans zu seinen Großeltern nach Mylau bei Reichenbach gegeben. Dort war der Großvater Direktor einer Weberei.
In Mylau kam Hans Kramer in die Volksschule. Noch während des Krieges wechselte er auf die Realschule in Reichenbach.
Nach Kriegsende kaufte sein Vater ein Mietshaus mit einem Ladengeschäft in Schöneck im oberen Vogtland. Er eröffnete eine Drogerie mit Kolonialwarenhandlung, der eine Kaffeerösterei und eine kleine Likörfabrikation angeschlossen waren. Zu seiten der Drogerie eine Zapfstelle für Benzin mit zwei Zapfsäulen.
Hans Kramer mußte seine Großeltern in Mylau verlassen und von der Realschule in Reichenbach auf die Volksschule Schöneck wechseln.
Nach der Konfirmation in Schöneck zog er zurück zu seinen Großeltern, die sich inzwischen in Leipzig niedergelassen hatten. Er ging dort in eine kaufmännische Lehre und besuchte die Öffentliche Handelslehranstalt ÖHLA in der Löhrstraße 3–5. Abends absolvierte er Sonderkurse mit dem Ziel, die Matura abzulegen, um anschließend an der Handelshochschule Leipzig, der HHL, zu studieren.
Sein Vater Oswald Kramer war dagegen. Er sagte:
«Matura! Studieren! Das ist verlorene Zeit. Lern was Praktisches und verdien Geld!»
Auf Geheiß seines Vaters zog Hans Kramer im Alter von sechzehn Jahren nach Plauen, arbeitete ein Jahr lang in einer Drogerie und besuchte die Drogistenfachschule. In Zwickau legte er die Drogistenfachprüfung ab. Danach arbeitete er in der väterlichen Drogerie in Schöneck.
Wie es der Wunsch seines Vaters gewesen war: Er hatte etwas Praktisches gelernt und verdiente Geld.
1924 trat er dem ‹Völkischen Block› bei, einem Wahlbündnis der Rechten, das sich gebildet hatte, nachdem die NSDAP im Gefolge des Münchner Hitler-Putsches vorübergehend verboten worden war.
Im Frühjahr 1929 übernahm er in Schöneck die zweite Drogerie, die sein Vater gekauft hatte.
In Schöneck gründete er die örtliche Gruppe der ‹Kampfgemeinschaft des gewerblichen Mittelstandes gegen Warenhaus und Konsumverein›, eine Organisation, die sich gegen jüdische Warenhäuser und gegen die gewerkschaftlichen Konsumgenossenschaften richtete. Er leitete die Schönecker Gruppe bis zum Sommer 1932.
Hilde Ruttig, eine ältere Schwester von Elisabeth, arbeitete als Büroangestellte in Dresden. Sie war musisch begabt, spielte Klavier, sang, und sie las mit Leidenschaft Romane.
Ihr Verlobter, ein Dresdner Bauingenieur namens Willi Fiebig, bestärkte sie in ihren Interessen. Er schenkte ihr Bücher und Noten, ging mit ihr ins Theater und in Konzerte.
Es war ausgemacht gewesen, 1928 zu heiraten.
Er reiste mit Hilde nach Oberheinsdorf, um sich ihren Eltern vorzustellen.
In Ruttigs Wohnzimmer saß Hilde mit Willi Fiebig, ihren Eltern und Elisabeth am Kaffeetisch.
Hilde fragte:
«Wo ist Fritz?»
Paul Ruttig:
«Das möchte ich auch wissen.»
Elisabeth:
«Er ist in den Wald gerannt. Das macht er immer, wenn er sich schlecht fühlt.»
Willi Fiebig sah Hilde fragend an.
Hilde schwieg.
Die Tür ging auf, und Fritz polterte ins Zimmer.
Fritz unrasiert, das Haar wirr, das Hemd zerrissen, die Hose von Erde schmutzig.
Paul Ruttig:
«Wo hast du dich herumgetrieben.»
Fritz:
«Ich war in Dänemark, meine Mutter besuchen.»
Martha Ruttig:
«Ach, Fritz.»
Fritz:
«Und ich baue in Dänemark ein Wasserkraftwerk.»
Paul Ruttig:
«Du weißt nicht einmal, was Elektrizität ist.»
Fritz:
«‹Elektra› heißt ‹das Beste›, und ‹zitieren› heißt ‹das Beste schnell wohin bringen›.»
Paul Ruttig:
«Du Quatscher.»
Fritz nahm eine drohende Haltung an, sank aber sogleich wieder in sich zusammen. Er sagte noch:
«Ich brauche sofort ein Auto.»
Martha Ruttig stand auf, nahm Fritz bei der Hand und brachte ihn aus dem Zimmer.
Nach dem Besuch in Oberheinsdorf trennte sich Willi Fiebig von Hilde.
Er sagte:
«Wir können keine Kinder haben.»
Paul Ruttig hatte seinem Schwiegersohn schon vor der Hochzeit mit Elisabeth angeboten, in seine Oberheinsdorfer Wollhandelsfirma einzutreten.
Obwohl Hans Kramer sich in Schöneck noch nie wohlgefühlt hatte und den Drogerieberuf gerne aufgegeben hätte, zögerte er, weil er seinen Vater nicht mit den beiden Drogerien alleinlassen wollte.
Schließlich aber erklärte sich Oswald Kramer mit dem Wunsch seines Sohnes, den Beruf zu wechseln und Wollhändler zu werden, einverstanden.
Mitte 1932 zog Hans Kramer mit Frau und Kind nach Oberheinsdorf und trat in die Firma seines Schwiegervaters ein, um Wollkaufmann zu werden.
Bereits Ende 1931, ein halbes Jahr nach der Hochzeit, war Hans Kramer noch in Schöneck in die NSDAP eingetreten. Er erhielt seine Mitgliedskarte mit der Nummer 907850 unter dem Datum des 1. Februar 1932.
In Oberheinsdorf betätigte er sich von Anfang an in der NSDAP, zuerst als Stützpunktleiter, später als Ortsgruppenleiter der Ortsgruppe Oberheinsdorf, zu welcher der Ort Hauptmannsgrün gehörte.
Oberheinsdorf hatte Mitte der dreißiger Jahre etwa vierhundert, Hauptmannsgrün etwa siebenhundert Einwohner.
Das Wollgeschäft sagte Hans Kramer zu. Er fand schnell in die neue Arbeit. Anders als sein Schwiegervater nahm er persönlichen Kontakt zu den Kunden auf. Er traf sich in Reichenbach und anderswo mit Spinnereibesitzern und bot ihnen Wolle direkt an.
Gelegentlich eines Geschäftsabschlusses sagte ein Reichenbacher Fabrikant bei Cognac und Zigarre:
«Mal ehrlich, Herr Kramer, Sie sind doch ein Jud.»
Hans Kramer erschrak. Der NSDAP-Stützpunktleiter ein Jude?
Er sagte:
«Wie kommen Sie denn darauf?»
«Na, schwarze Locken. Und Ihre Nase.»
Von jetzt an ließ sich Hans Kramer das Haar kürzer schneiden und bürstete es jeden Morgen mit warmem Wasser glatt.
Energisch betrieb er die Komplettierung seines Ahnenpasses, den er sich vom ‹Reichsverband der Standesbeamten Deutschlands› hatte schicken lassen, um den Nachweis seiner ‹arischen Abstammung› führen zu können.