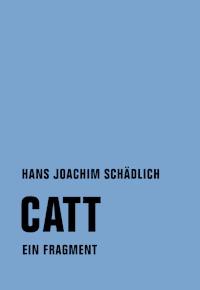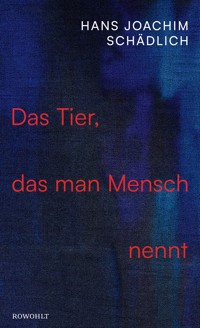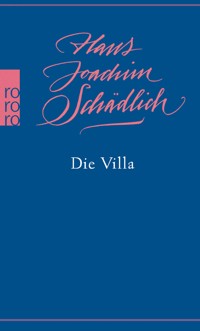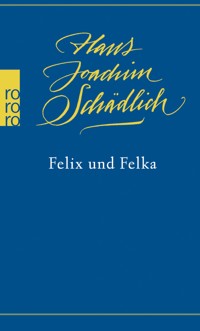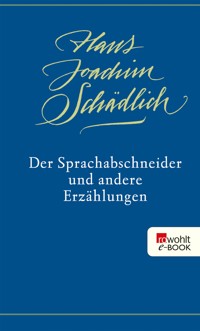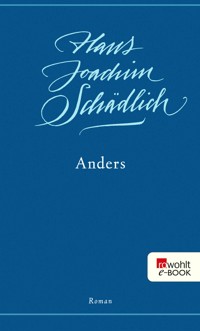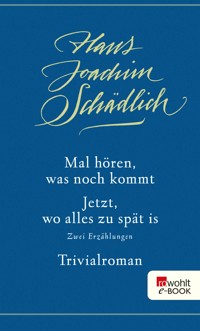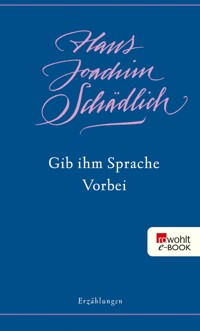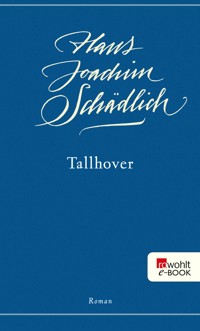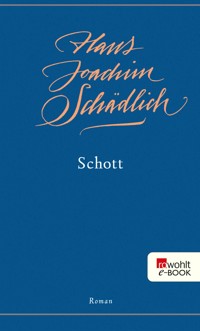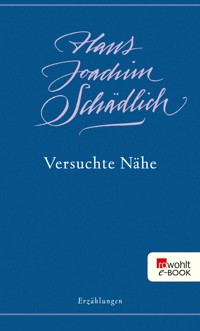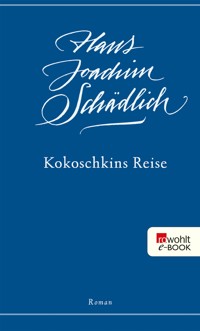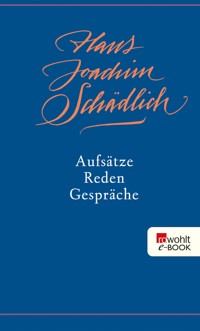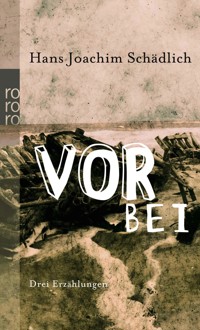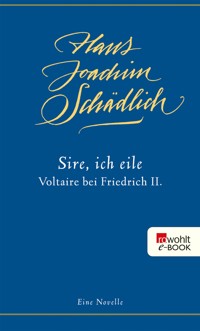
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Schädlich: Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
Enttäuscht von Versailles geht Voltaire 1750 an den Hof des Königs von Preußen. Bald erweist sich, daß er und Friedrich nach Temperament und Lebensgewohnheiten unverträglich sind. Es kommt zum Bruch. Voltaire ist in Gefahr, er macht sich auf die Reise. Die preußischen Beauftragten in der Freien Reichsstadt Frankfurt halten ihn auf Befehl Friedrichs fest: Sein Gepäck wird beschlagnahmt, er wird unter Hausarrest gestellt, erfährt Erniedrigung und Willkür. Friedrich und Voltaire sehen sich nie wieder. Der Philosoph bei Hofe – Hans Joachim Schädlich führt nicht nur die Unvereinbarkeit von freiheitlichem Geist und absolutistischer Macht vor Augen. Er rückt auch Voltaires berühmte Gefährtin Émilie du Châtelet ins Bild und eine große aufgeklärte Liebe. «Ein Meister der Reduktion, der mit dieser Reduktion eine ungeheure Intensität erreicht.» (Süddeutsche Zeitung) «Sire, ich eile» ist ein spöttisches Bravourstück, das allen denkbaren Heldenverehrungsbüchern zum Friedrich-Jubiläum den Schneid abkauft.» (RBB Kulturradio) «Wieder einmal gelingt es Schädlich, mit karger Sprache und knappen Sätzen eine atemberaubende Konstellation wie einen Krimi für uns zu inszenieren.» (Die ZEIT) «Sire, ich eile» ist das wunderbare Ergebnis zwischen dem Historiker und dem Schriftsteller Hans Joachim Schädlich.» (FAZ) «Schlechte Nachricht für Fridericianer aller Fraktionen: Hans Joachim Schädlichs Novelle ist eine Frechheit, eine hübsche Volte im Geiste Voltaires. Ätzend knapp und kühl luzid.» (Spiegel Online) «Hans Joachim Schädlich zeigt hier einen Modellfall für das Verhältnis von Geist und Macht … eine literarisch hoch aufgeladene Lektüre.» (Deutschlandradio Kultur)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 91
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Hans Joachim Schädlich
Sire, ich eile
Voltaire bei Friedrich II
Novelle
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Enttäuscht von Versailles geht Voltaire 1750 an den Hof des Königs von Preußen. Bald erweist sich, daß er und Friedrich nach Temperament und Lebensgewohnheiten unverträglich sind. Es kommt zum Bruch. Voltaire ist in Gefahr, er macht sich auf die Reise. Die preußischen Beauftragten in der Freien Reichsstadt Frankfurt halten ihn auf Befehl Friedrichs fest: Sein Gepäck wird beschlagnahmt, er wird unter Hausarrest gestellt, erfährt Erniedrigung und Willkür. Friedrich und Voltaire sehen sich nie wieder.
Der Philosoph bei Hofe – Hans Joachim Schädlich führt nicht nur die Unvereinbarkeit von freiheitlichem Geist und absolutistischer Macht vor Augen. Er rückt auch Voltaires berühmte Gefährtin Émilie du Châtelet ins Bild und eine große aufgeklärte Liebe.
«Ein Meister der Reduktion, der mit dieser Reduktion eine ungeheure Intensität erreicht.» (Süddeutsche Zeitung)
«Sire, ich eile» ist ein spöttisches Bravourstück, das allen denkbaren Heldenverehrungsbüchern zum Friedrich-Jubiläum den Schneid abkauft.» (RBB Kulturradio)
«Wieder einmal gelingt es Schädlich, mit karger Sprache und knappen Sätzen eine atemberaubende Konstellation wie einen Krimi für uns zu inszenieren.» (Die ZEIT)
«Sire, ich eile» ist das wunderbare Ergebnis zwischen dem Historiker und dem Schriftsteller Hans Joachim Schädlich.» (FAZ)
«Schlechte Nachricht für Fridericianer aller Fraktionen: Hans Joachim Schädlichs Novelle ist eine Frechheit, eine hübsche Volte im Geiste Voltaires. Ätzend knapp und kühl luzid.» (Spiegel Online)
«Hans Joachim Schädlich zeigt hier einen Modellfall für das Verhältnis von Geist und Macht … eine literarisch hoch aufgeladene Lektüre.» (Deutschlandradio Kultur)
Über Hans Joachim Schädlich
Hans Joachim Schädlich, 1935 in Reichenbach im Vogtland geboren, arbeitete an der Akademie der Wissenschaften in Berlin, bevor er 1977 in die Bundesrepublik übersiedelte. Heute lebt er wieder in Berlin. Für sein Werk bekam er viele Auszeichnungen, u.a. den Heinrich-Böll-Preis, Hans-Sahl-Preis, Kleist-Preis, Schiller-Gedächtnispreis des Landes Baden-Württemberg, Lessing-Preis, Samuel-Bogumil-Linde-Preis, Großen Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, Bremer Literaturpreis, Corine-Preis und Joseph-Breitbach-Preis.
Weitere Veröffentlichungen
Versuchte Nähe
Tallhover
Schott
Trivialroman
Anders
Der andere Blick
Vorbei
Familienstücke
Gib ihm Sprache / Vorbei
Der Sprachabschneider und andere Erzählungen
Kokoschkins Reise
Narrenleben
Aufsätze, Reden, Gespräche
Inhaltsübersicht
Krista Maria Schädlich gewidmet
Erster Teil
1.
Voltaire blickte aus dem Fenster. Er sah das Portal der Pfarrkirche Saint-Gervais.
Das alte Haus in der Rue de Longpont bebte vom Glockengeläut der Kirche, aber Voltaire gab vor, das mache ihm nichts aus. Der style classique der Kirchenfassade gefiel ihm. Zudem: Der Organist war ein Mitglied der Familie Couperin.
Voltaire hatte in der schmalen Straße noch etwas anderes im Blick. Das Haus des Sieur Dumoulin, der einen Handel mit Stroh betrieb. Dumoulin war auf die Idee gekommen, aus Stroh Papier zu machen. Wie aber die Produktion finanzieren? Voltaire übernahm es.
Dumoulin produzierte Packpapier, der Handel florierte, Voltaire avancierte zum Papierfabrikanten.
Es genügte nicht, daß Zaire im August 1732 an der Comédie Française triumphal aufgenommen worden war. Es mußte Geld verdient werden.
Ein heller Sommerabend.
Voltaire sah eine Kutsche die enge Straße heraufkommen. Sie hielt vor dem Haus.
Es stiegen aus der Comte de Forcalquier und seine Geliebte, die Herzogin von Saint-Pierre. Und – aber diese Frau erkannte Voltaire nicht.
Obwohl er nichts im Hause hatte, rief er hinunter, er lade die drei ein, bei ihm zu Abend zu essen.
Forcalquier antwortete, Voltaire möge mit ihnen zum Essen aufs Land fahren.
Voltaire setzte sich in der Kutsche neben die Unbekannte. Forcalquier stellte sie vor: die Marquise du Châtelet.
Voltaire wußte auf der Stelle, daß er die junge Frau längst kannte: Gabrielle-Émilie Le Tonnelier de Breteuil. Er hatte sie im Hause ihres Vaters, des Comte de Breteuil, kennengelernt. 1725 war sie mit dem Marquis du Châtelet-Lomont verheiratet worden.
Die vier fuhren nach Charonne und kehrten in einem Landgasthof ein. Auch im Gasthaus saß Voltaire neben Madame du Châtelet. Seit diesem Abend konnten die beiden nicht mehr voneinander lassen.
Es war Liebe.
François und Émilie.
2.
Émilies Ehemann, der Marquis du Châtelet-Lomont, Comte de Lomont und Seigneur de Cirey, war schon mit dreißig Generalmajor. Später, 1744, Generalleutnant; höher konnte er nicht steigen.
Er war der Besitzer ererbter Güter und eines Palastes in Paris, des Hôtel du Châtelet. Ein schwergewichtiger Mann, der Émilie um Haupteslänge überragte. Seine Lieblingsbeschäftigung war die Jagd. Er liebte auserlesene Speisen und Weine.
Der Marquis redete gerne vom Krieg, Émilie von Philosophie.
Im September 1725 wurde Émilie zum ersten Mal schwanger. Im Juni 1726 gebar sie ihre Tochter Françoise-Gabrielle Pauline, die sogleich in die Hände einer Kinderfrau kam.
Émilie sah ihre Tochter jeden Tag, aber immer nur kurz.
Bald nach der Geburt Françoise-Gabrielle Paulines wurde Émilie wieder gesellig. Ihr Ehemann war zu seinen Truppen zurückgekehrt.
Es dauerte nicht lange, bis Émilie erfuhr, daß ihr Ehemann sich eine junge Geliebte zugelegt hatte, eine Schönheit aus dem Elsaß. Er gab zu verstehen, daß Émilie das Recht habe, sich einen Liebhaber zu nehmen.
Sie entschied sich für den Marquis Robert de Guébriant, einen Neffen des Maréchal de Maillebois. Zwar sah der gut aus, aber er war eitel, wenig gebildet, langweilig.
Émilie entließ ihn bald und wählte den Comte Pierre de Vincennes, der kleiner war als sie und dick. Aber er galt als Kenner der Metaphysik, und das zog sie an.
Zu Anfang des Jahres 1727 nahm auch die Geschichte mit Vincennes ein Ende.
Émilies Ehemann kam von seinen Truppen in die Stadt zurück, schwängerte Émilie zum zweiten Mal, und heraus kam im November 1727 Louis-Marie Florent.
Im Hôtel du Châtelet stellte sich zuweilen der Herzog von Richelieu zum Diner ein, Louis François Armand du Plessis. Er war der Großneffe des Kardinals Richelieu, des Ersten Ministers unter König Ludwig XIII. Richelieus Frau war im Sommer 1729 gestorben. Ein Jahr lang trauerte er um die Herzogin und hielt sich vom Versailler Hof fern. Aber er ging zu Diners bei Freunden.
Zu seinen Freunden gehörten die Châtelets.
Émilie kannte ihn schon lange; ihre Mutter war eine Verwandte der Herzogin von Richelieu. Richelieu schätzte nicht nur Émilies Schönheit, er war eingenommen von ihrer Intelligenz.
Im November 1728 war Voltaire von England nach Frankreich zurückgekehrt, zuerst nach Saint-Germain-en-Laye und im April 1729 nach Paris.
Seit seiner Schulzeit im Lycée Louis-le-Grand war Voltaire mit dem Herzog von Richelieu befreundet. Sie besuchten einander, und Richelieu erzählte Voltaire von den Gesprächen mit Émilie.
Voltaire interessierte sich kaum für Émilie; er glaubte noch nicht an die Existenz intellektueller Frauen.
Im Herbst 1730 wurde Émilie die Geliebte Richelieus. Seine literarischen und philosophischen Interessen begegneten ihrer Belesenheit auf philosophischem und metaphysischem Feld. Sie beschäftigte sich mit Mathematik und Physik. Und sie übte sich in der Übersetzung lateinischer Verse.
Nach ihrer Trennung blieben Richelieu und Émilie Freunde bis zu Émilies Tod.
3.
Im Sommer 1733, als Voltaire und Émilie zueinander fanden, war Voltaire neununddreißig Jahre alt, Émilie sechsundzwanzig.
Voltaire war verliebt wie ein Schuljunge.
Émilie schrieb an den Herzog von Richelieu, für sie sei Voltaire der Inbegriff des idealen Mannes.
Beiden machte es das größte Vergnügen, Konventionen zu mißachten und Paris zu schockieren.
Sie gingen in die Oper, obwohl es für einen Mann von Stand tabu war, sich mit seiner Mätresse in der Oper zu zeigen.
Sie fuhren nach Versailles und betraten den Audienzsaal, obwohl es sich für einen Mann und seine Mätresse von selbst verstand, nicht gemeinsam vor den König zu treten.
Voltaire schlief bei Émilie im Hôtel du Châtelet, oder Émilie schlief bei Voltaire in der Rue de Longpont.
Hätte der Marquis du Châtelet nicht eingreifen müssen?
Bei der Hochzeit des Herzogs von Richelieu mit der Herzogin Sophie von Guise im lothringischen Montjeu lernten Émilies Ehemann und Voltaire einander kennen.
Der Marquis war mit seiner Mätresse, Mademoiselle d’Anjou, nach Montjeu gekommen. Er fand Voltaire sympathisch, und Voltaire fand den Marquis sympathisch.
Émilie hatte nichts einzuwenden gegen die Mätresse ihres Mannes; er tolerierte Émilies Liebhaber.
1733 hatte Voltaire Le temple du goût veröffentlicht. Die Schrift trug ihm die Feindschaft vieler Schriftsteller und Künstler ein, die er einer schonungslosen Kritik unterworfen hatte.
An eine Wahl in die Akademie war nicht mehr zu denken.
Nicht genug damit.
1734 veröffentlichte er ohne offizielle Druckerlaubnis die Lettres philosophiques sur les Anglais. Am Schluß des sechsten Briefes hatte er geschrieben:
«Wenn es in England nur einen Glauben gäbe, müßte man Despotismus fürchten; gäbe es zwei, schnitten sie sich die Hälse ab; aber es gibt dreißig davon, und sie leben glücklich und in Frieden.»
Und im zehnten Brief:
«In Frankreich ist Marquis, wer will; und wer immer aus einer Provinz in Paris ankommt mit Geld, das er ausgeben kann, und einem Namen auf -ac oder -ille, kann sagen: ‹Ein Mann wie ich, ein Mann meines Standes›, und in Ruhe einen Kaufmann verachten … Ich aber weiß nicht, was einem Staat nützlicher ist, ein wohlgepuderter Herr, der genau weiß, zu welcher Stunde der König sich erhebt, zu welcher er zu Bett geht, und der sich etwas von Größe gibt, wenn er im Vorzimmer eines Ministers die Rolle eines Sklaven spielt, oder ein Kaufmann, der sein Land bereichert … und zum Guten der Welt beiträgt.»
Das Freiheitsverlangen und der Fortschrittsglaube Voltaires – der Kirche und den Staatsautoritäten war es zuviel.
Noch in Montjeu erreichte Voltaire eine Nachricht aus Paris: Die Lettres philosophiques waren gemäß einem Urteil des Parlaments verboten und zur Verbrennung durch Henkershand verurteilt worden.
Falls er in Paris erscheine, werde er verhaftet und in die Bastille geworfen. Voltaire wollte auf die Gefängnishaft verzichten. Er hatte die Bastille 1717 und 1726 kennengelernt.
4.
Im Dezember 1725 war François-Marie Arouet, der sich 1719 Voltaire genannt hatte, in der Comédie Française, in der Garderobe der Schauspielerin Adrienne Lecouvreur, auf den Chevalier Guy Auguste de Rohan getroffen.
Der Chevalier verachtete Voltaire wegen dessen bürgerlicher Herkunft.
Er sagte:
«Arouet? Voltaire? Oder wie heißen Sie doch gleich?»
Voltaire sagte:
«Ich bin nicht wie jene, die den Namen entehren, den sie erhalten haben. Ich werde den Namen, den ich mir gegeben habe, unsterblich machen.»
Rohan fühlte sich beleidigt und hob seinen Stock.
Voltaire zog seinen Degen.
Adrienne Lecouvreur täuschte angesichts des drohenden Streits eine Ohnmacht vor, und die beiden ließen voneinander ab.
Einige Tage darauf speiste Voltaire bei dem Herzog von Sully, Maximilien Henri de Bethune, mit dem er befreundet war.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: