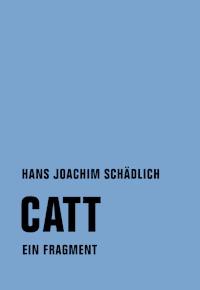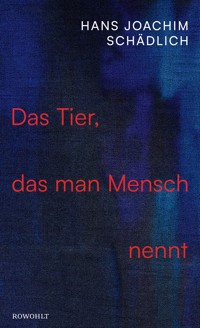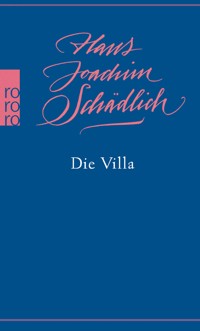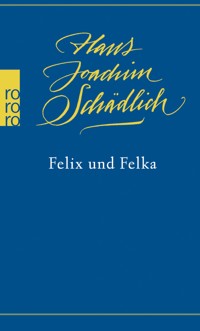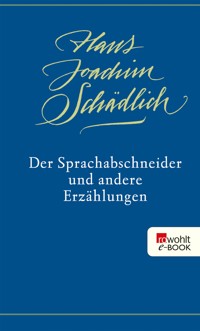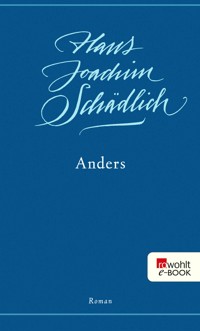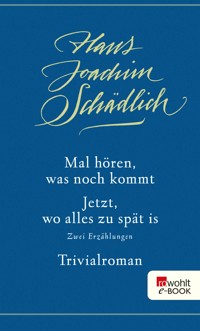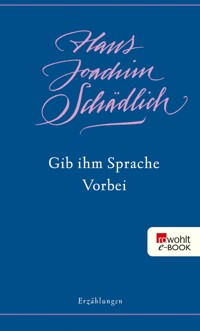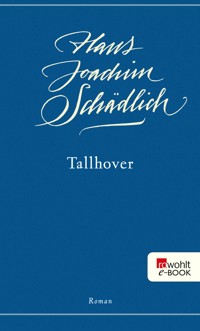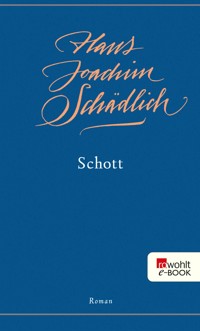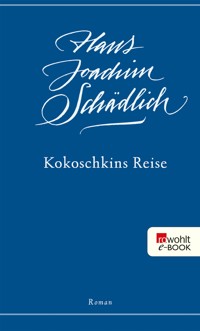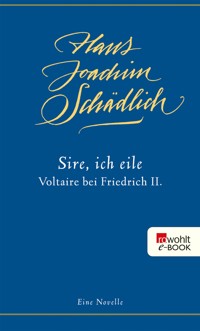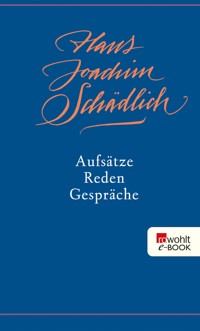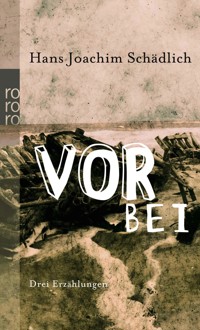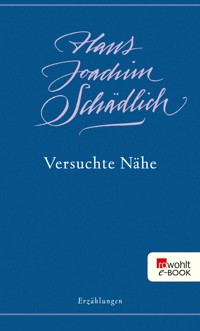
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Schädlich: Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch enthält 25 sehr unterschiedliche Geschichten – Parabeln, Short Storys, Skizzen, Genrebilder, kaum ein Text länger als zehn Seiten. Die Sammlung wirkt auf den ersten Blick disparat, doch zeichnet sie sich tatsächlich durch eine geradezu verblüffende Einheitlichkeit aus. Denn alle diese Geschichten gehen auf einen einzigen Impuls zurück: «Alle Erzählungen in Versuchte Nähe beschäftigen sich mit dem Alltag der DDR. Auch wenn es nicht auf den ersten Blick sichtbar wird. Die Provokation bestand vielleicht gerade darin. Denn dass es nicht auf den ersten Blick sichtbar ist, verstärkt die Provokation.» (Herta Müller)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Hans Joachim Schädlich
Versuchte Nähe
Erzählungen
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Dieses Buch enthält 25 sehr unterschiedliche Geschichten – Parabeln, Short Storys, Skizzen, Genrebilder, kaum ein Text länger als zehn Seiten. Die Sammlung wirkt auf den ersten Blick disparat, doch zeichnet sie sich tatsächlich durch eine geradezu verblüffende Einheitlichkeit aus. Denn alle diese Geschichten gehen auf einen einzigen Impuls zurück: «Alle Erzählungen in Versuchte Nähe beschäftigen sich mit dem Alltag der DDR. Auch wenn es nicht auf den ersten Blick sichtbar wird. Die Provokation bestand vielleicht gerade darin. Denn dass es nicht auf den ersten Blick sichtbar ist, verstärkt die Provokation.» (Herta Müller)
Über Hans Joachim Schädlich
Hans Joachim Schädlich, 1935 in Reichenbach im Vogtland geboren, arbeitete an der Akademie der Wissenschaften in Berlin, bevor er 1977 in die Bundesrepublik übersiedelte. Heute lebt er wieder in Berlin. Für sein Werk bekam er viele Auszeichnungen, u.a. den Heinrich-Böll-Preis, Hans-Sahl-Preis, Kleist-Preis, Schiller-Gedächtnispreis des Landes Baden-Württemberg, Lessing-Preis, Samuel-Bogumil-Linde-Preis, Großen Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, Bremer Literaturpreis, Corine-Preis und Joseph-Breitbach-Preis.
Weitere Veröffentlichungen
Tallhover
Schott
Trivialroman
Der Sprachabschneider
Ostwestberlin
Mal hören, was noch kommt / Jetzt, wo alles zu spät is
Gib ihm Sprache. Leben und Tod des Dichters Äsop
Anders
Der andere Blick
Vorbei
Kokoschkins Reise
Sire, ich eile ...
Narrenleben
Inhaltsübersicht
Versuchte Nähe
Ein Feiertag; immerhin ist es ein Feiertag, ein heller Anzug rechtfertigt sich; und er geht später, wird später als sonst zu seinem Platz gefahren.
Die Fahrt ist nicht das einzige an diesem Morgen, einem sonnigen, wie er bemerkt hat zu früher Stunde; es täuschen sich manche und würden nicht tauschen mit vierzehnstündiger Beschäftigung täglich, auch an einem Feiertag.
Vor der Fahrt, die ihn entspannt, wenn er, zurückgelehnt, dem Zentrum der Stadt sich nähert durch fahnenreiche Straßen: Gespräche, in denen er, schnell wechselnd, anordnet, wünscht, empfiehlt, rät, unterrichtet wird in umfassender Weise, aber kurz, geordnet nach den Wichtigkeiten; vor den Gesprächen, vor einfachem Frühstück, das dem Rat von Ärzten folgt wie alle Mahlzeiten – heute mit Grund reicher: der Besuch des Arztes, des Blutdruckes wegen und der Dosierung einiger Medikamente, und: Schwimmen nach Vorschrift, einhundert Meter wenigstens, im Hausbad, gesellig begleitet von Mitarbeitern, denen es ehrenvoll und vergnüglich.
Die Fahrt ist schön; er ißt eine Apfelsine, vorsichtig trotz der Serviette, er trägt einen hellen Anzug; noch kauend schlägt er die Zeitung auf, das Bekannte, er weiß es, und doch.
Auch dem Fahrer gefallen diese Fahrten mit ihm, sein aufmunterndes Wort, seine Aufgeräumtheit, die übertragbar ist.
Er ist nicht der erste am Ziel, soll es nicht sein, zahlloses Personal ist längst eingetroffen, und auch die anderen, seine Kollegen, die ihn begrüßen, gut gelaunt. Noch ist die Runde nicht vollzählig, Gäste aus dem Landesinneren und Fremdländer werden erwartet, die Gelegenheit erhalten sollen, geehrt zu werden und zu ehren. Die ihn persönlich kennen, Gäste, unternehmen bei ihrer Ankunft zu seiten des Podestes den Versuch, herüberzuwinken, lächelnd, freundschaftlich. Meist kann er zurückgrüßen, auch, wenn er mit einem Kollegen ein Wort wechselt gerade.
Es ist warm, man sieht Blumen am Rande des Podestes, die trennende Ordnung der Arbeit ist noch außer Kraft, die Gelöstheit läßt manches Gespräch zu, das nicht möglich wäre anders für manchen.
So ist es immer an diesem Tag, er mag ihn, und er mag ihn nicht. Die große Anstrengung, drei Stunden, vier, in der Sonne, sichtbar zu sein allen. Doch unleugbar ist auch Erheiterung, Belebung, Stärkung durch die Nähe der vielen, so daß Lust und Scheu einander widerstreiten.
Der Gedanke, er könnte fehlen an diesem Tag, kann nicht gedacht werden. Sogar Krankheit, allerdings leichtere, darf kein Grund sein. Unbeachtet können bleiben, die Unpäßlichkeit als Vorwand für Streit ansehen wollen und nur gelten lassen als Krankheit von Größerem. Die aber einfache Sorge spüren müßten um ihn und Sorge also um Größeres, in seiner Krankheit selber sich geschwächt fühlend, sollen unbesorgt bleiben und wollen es.
Viele außer diesen, Feiertagsgäste auf der Suche nach Erzählbarem, auch Kinder, wären bloß enttäuscht. Auf Bilder verwiesen, die ihn zwar deutlicher zeigen als er sich selbst zeigt aus einiger Entfernung für Zuschauer. Es ist aber der Satz Ich habe ihn gesehen von unerklärtem Gewicht und muß gesagt werden können.
Und andere Gründe als Krankheit gibt es: die Geschäfte, denen er fernbleibt für drei, vier Stunden; auch die anderen, die die Geschäfte lenken mit ihm, sind versammelt. Nie hat man ihn von seinem erhöhten Platz aus, unter den Augen Tausender, hinter der blumengeschmückten Umrandung, telefonieren sehen. Nie ist bemerkt worden, daß Boten ihm Nachricht übermitteln und forteilen mit seiner Weisung. Nicht einmal sprechen sieht man ihn, nachdem die Glockenschläge erschallt sind, die Fanfare ertönt ist, den Beginn anzuzeigen. Ein Scherzwort vielleicht, dem Nachbarn zur Linken oder Rechten zugeworfen, gewiß nicht die Geschäfte betreffend. Nur mit den Vorüberziehenden spricht er, später. Verläßliche Männer an seiner Stelle müssen die Ordnung in Gang halten solange, gestützt von Personal wie an jedem Tag.
Das Podest, welches die Passanten und Zuschauer mehrfach überragt, ist von einem Seil umgeben unten, etwa in Hüfthöhe. In kurzen Abständen ist hinter oder vor dem Seil Personal postiert, das zum Schutz dient und auch wie Schmuck ist. Die jungen Männer, uniformiert und leichtbewaffnet, werden für die Dauer des Vorbeizuges nicht ausgetauscht. Sie haben andere abgelöst, die vor ihnen dort standen und andere abgelöst haben; so, daß das Podest geschützt ist seit zwei Tagen.
Andere, nicht uniformiert, sind zahlreich unter die Zuschauer gemischt, haben sich auf Dächern nahegelegener Häuser eingerichtet und sitzen an Fenstern, die des schönen Wetters wegen geöffnet sind. Die Leiter des Personals stehen selbst auf dem Podest, müssen aber in dieser Minute keine Mühe auf die Arbeit ihrer Leute verwenden, da jede Möglichkeit mehrfach besprochen wurde und hohe Verantwortliche für diesen Tag benannt sind.
Eine Ansprache ist zu halten, so ist es Brauch, und ein aufstrebender Kollege, jüngst in den engsten Kreis aufgenommen, tritt an die Mikrofone. Der Redner sagt, was auch er gesagt hätte, daß nämlich den Tätigen gedankt werde für Leistung.
Nicht vollbracht zu seinem Nutzen oder dem des Redners, sondern zum Nutzen der Tätigen selbst und des großen Vorhabens. Wenn also gedankt wird, so ist es das Vorhaben, das Sprache gewinnt durch den Mund eines Redners, und es danken sich die Tätigen durch den Dank des Redners selbst.
Der Beifall ist stark nach kurzer Rede, auch er und seine Kollegen klatschen, und der Redner auch, die Lautsprecher übertragen es. Den Beifall des Redners, obwohl mißdeutbar, versteht der Vertrautere als Beifall für etwas.
Aus großer Höhe sieht man nicht, daß er nach links blickt, ohne den Kopf zu drehen, links steht der General, dem von unten, vom Platz her, der umsäumt ist von Tausenden, gemeldet wird, dies nach neuerlichem Fanfarenstoß, daß alles angetreten sei. Er sieht hinunter auf dieses ausgezeichnete Bild. Ein schwer widerstehliches Verlangen, sich hinunterzubeugen, den Kopf seitwärts auf den Fußboden zu legen, das rechte Auge ungefähr in der Höhe der Köpfe, den Geräuschen der Fahrzeuge, ihrem Geruch, Lack, Blech, Gummi, ganz nahe.
Sie sehen herüber, in der kurzen Stille, der Tag ist sonnig, für eine Sekunde schließt er die Augen, atmet tief ein, der Gedanke an ihre Stärke, solch einen Augenblick hat dieser Tag.
Stärkender als starkes Kampfgerät ihr Blick, obgleich Schüler noch, des Generals, aber die das Leben geringachten vor dem großen Vorhaben, und zahllosen Männern, sehr jungen, vorgesetzt sein sollen nach beendeter Lehre. Andere, ausgelernt, Barette kühn auf ihren Köpfen, ausgerüstet mit dem Mut von Falken, auf schwebenden Halt Vertrauende, die vom Himmel sich stürzen auf den Feind, sehen ihn an. Er möchte die Hand auf ihre Schulter legen: Ihr, meine Festen.
Allen. Diesen und den anderen, auf dem Lande, dem Wasser und am Himmel. Unvermögend wäre das teuere Kampfgerät ohne sie. Unzulässige Selbstverleugnung ist es, freilich sympathische, daß ihr Mund den neuen Panzer, den aufsehenerregenden, «Kampfmaschine» getauft hat.
Doch auch umgekehrt, denkt er; was vermöchten sie ohne Maschinen, fahrende, schwimmende, fliegende?
Freunde aus Fleisch und Freunde aus Stahl, keinem kann der Vorzug gegeben werden, vorzüglich sind beide, und unübertrefflich, wenn sie vereint.
Es weckt ihn aus solchen Gedanken der Zug der Tätigen, dessen Spitze den Blick schon passiert hat. Die schöne Ordnung ist abgelöst, er bedauert es und bedauert es nicht über dem Anblick der Vielfalt.
Auf eigens gezimmerten Stellagen, die von vier Personen getragen, werden, nähern sich hoch über den Köpfen die Porträts bärtiger Männer. Hinter ihnen, in mehreren Reihen, tragen starke Jünglinge Fahnen, die sie leicht hin- und herschwenken. Auf kunstvoll drapierten Lastwagen, die im Schrittempo vorbeirollen, haben die Tätigen Zeichen der Tätigkeit plaziert: eine Maschine für den Landbau, von der es heißt, sie sei die soundsoviel Tausendste; ein großes Zahnrad, von einem breiten weißen Band umgürtet, auf dem zu lesen steht, wie die Erbauer von Zahnrädern vorankommen wollen; eine Kabeltrommel, deren Kabel die Stelle allen Kabels vertritt, das erzeugt wurde. Die Zeichen rühren ihn, er sieht sie gern, doch weiß er, daß Erklärung von Absicht und sprichwörtlicher Eifer nicht ausreichen.
Die Tätigen begleiten die Wagen und folgen ihnen; Väter, Söhne auf ihren Schultern, zeigen ihren Söhnen ihn. Die Kinder schwenken Papierfähnchen in den Landesfarben oder Sträußchen.
Trotz der Entfernung bis zu denen, die vorbeiziehen, sind ihre Gesichter zu erkennen, und, er hat ein gutes Auge. Es ihnen gleichzutun, die lachen, winken, ist leicht. Aber daß so viele ihn sehen und sich einprägen, möchte er aufwiegen und sieht in die Gesichter, die, ihm am nächsten, herankommen und fortgehen, um sie zu behalten. Seine Augen wandern unablässig von rechts nach links; einzelne Züge, die ihm auffallen, will er sich merken, doch sie wechseln zu schnell für diese Absicht. Er stellt, sein Gedächtnis zu stützen, Vergleiche an, Namen murmelnd wie Notizen, vergleicht, die er sieht, mit seinen Kollegen, Mitarbeitern, und sieht, da es seinem Auge mühselig wird, der Menge zu folgen, nur die, die er kennt.
Fragt sich, hat Zeit heute, was andere sonst für ihn sich fragen und andere, wie er den vielen, die ihn sehen, erscheint. Zuerst: wer sind die, sie tragen eine Adresse voran auf einem Schild oder Band, aber nie eines einzelnen, und er, den sie sehen als einen einzelnen, will einzelne: wo wohnt der, der dort lacht, wann ist der losgegangen zu einer Straßenecke, die ihm jemand genannt hat, und: warum geht der dort unten, will er, daß er ist, wie er sein soll, damit er, wie er ist, sein will?
Warum sagt ihm niemand, fragt er, wie es ist, wenn einer dort geht und ihn sieht. Und, warum versetzt ihn keiner in den da, der dort geht, daß er eins wäre mit dem, wie er an der Straßenecke, weit entfernt von hier, ankommt, seine Kollegen, die schon da sind, begrüßt, oder begrüßt wird von denen, die kommen, eine Zigarette raucht, wartet, und losgeht endlich, langsam, der Zug stockt, und geht weiter, schon hört er den Lautsprecher, der Grüße übermittelt den Ankommenden, wendet den Kopf nach links, dem Podest entgegen, lacht hinüber und winkt sich zu.
Sieht, als er sagen will, So also, daß er, ohne verstanden zu werden, aber es ist vom Mund ablesbar, ein Wort vertrauter Verbundenheit ruft, und ruft es.
Er folgt der Lust, weiterzuziehen mit den vielen, die sich bald verlieren am Ende der großen Straße, nach diesem feiertäglichen Vorbeigang ist er durstig und kauft wie andere an einem Kiosk zwei Biere, die er schnell trinkt, muß aber bleiben, hinunterblicken, lachen, winken, den Vorbeiziehenden öfter freundschaftliche Neigung bekundend, unterstützt von seinen Händen, die er vor der Brust zusammenlegt als wolle er sie waschen, bis in Kopfhöhe anhebt und wie schüttelnd hin- und herbewegt auf einer kurzen Strecke zwischen sich und den Passanten. Er kann nicht fortgehen und nach gleicher Zeit wie die Vorübergehenden, die nicht länger als zwei Stunden unterwegs sind von ihrer Straßenecke bis zu den Kiosken am unteren Ende der Allee, Bier trinken, oder essen. Und anderes, wozu den anderen, denen er mit einem Strauß Blumen jetzt zuwinkt, die also vor ihm gelegen haben müssen, Gelegenheit gegeben ist am Ende der Straße, ist ihm verwehrt, und er muß es bedenken am Morgen.
Leichter ist es, zwei Stunden, drei, unter sonnigem Himmel die asphaltierte Straße entlangzugehen im Gespräch mit anderen, von Musik, wenngleich lauter, begleitet, als diese Zeit und länger in der Sonne zu stehen, fast unbewegt, von den Händen abgesehen und dem jetzt häufigeren Wechsel des Standbeins, und ganz ohne Erfrischung.
Willkommen in solcher Lage ist der Anblick von Festwagen, auf welchen sportliche Jünglinge Handstände vollführen oder längere Zeit auf dem Kopf stehen und junge Mädchen, in roten oder schwarzen Trikots, wie die Jünglinge das Zeichen des Landes auf der Brust, seidene Tücher schwingen im Rhythmus angedeuteten Tanzes oder mit Reifen umgehen nach Art von Jongleuren.
Er winkt den Gelehrten, die, so sagt er, der Absicht und dem Eifer die Einsicht hinzufügen, und winkt ihnen wie älteren Brüdern. Ihre Eigenart, Dingen nachzudenken ohne täglichen Zweck, sondern um des Einsehens willen, ist nützlich dem großen Vorhaben, weiß er, und hat sich dessen versichert.
Jetzt schon zum zweitenmal, während er die Linke zum Gruß erhebt, sieht er auf seine Armbanduhr, von plötzlicher Müdigkeit befallen, die vor allem sich ausdrückt in dem Wunsch, einige Minuten zu sitzen, und ungern bedenkt er, daß, nach vorgesehener, aber doch kurzer Mittagspause der Besuch fremdländischer Gäste erwartet wird, der, nach der Ordnung, wieder nur stehend, und aber herzlich, empfangen werden muß.
Nur von den Bühnenkünstlern kommt noch Aufmunterung. Viele kennt er, nicht nur aus der Entfernung der Loge, sondern bei anderer Gelegenheit sind sie ihm begegnet, und er hat sie ins Gespräch gezogen aus Sympathie für die Kunst der Verwandlung. Hauptsächlich zieht ihn an gesungenes Handeln oder handelnder Gesang. Denen zu lauschen, die dem Wort zweifachen Klang verleihen und also zweifache Kraft! Und gehört werden noch, wenn die Sprache, deren sie sich bedienen, unverstehbar, Italienisch oder gestört. Bedauern muß er, daß ihm das Amt versagt, starker Neugier auf die Maschinerie unter, über und hinter der Bühne nachzugeben, jene verästelte Apparatur, die in der Hand geschickter Leute jedes gewünschte Bild herzustellen vermag. Er erlaubt sich die Vorstellung, die Bühnenkünstler zögen in Kostümen jener Gestalten vorüber, die ihm besonders wert.
Die am längsten gewartet haben an einer Straßenecke und jetzt, zu den letzten zählend, vorübergehen, schon eilig, sind kaum noch zu Reihen geordnet; manche, bemüht, ihre Kinder zum Gehen anzuhalten oder in lebhaftem Gespräch mit dem Nachbarn, blicken nicht mehr herauf. Der Vorbeizug hat für sie geendet nach mehrstündiger Dauer, unerachtet des Podestes.
Solche Achtlosigkeit ist ihm, obgleich selber müde, unbehaglich. Es stört ihn die Beobachtung, daß die Vorüberziehenden, wie er, zu Aufmerksamkeit sich zwingen müssen. Daß die Unbehaglichkeit, je weniger Tätige, meist achtlos, vorüberziehen, sich steigert zu Nervosität, registriert er mit dem Wunsch nach vernünftiger Erklärung. Sogar Unsicherheit gibt er sich zu angesichts der wenigen, die die Straße vor dem Podest noch passieren, und hätte doch ehestens unsicher sein sollen vor den vielen davor, dem Unübersehbaren, das vorbeugender Kontrolle vielköpfig sich zu entziehen scheint. Niemand nimmt wahr, daß kurze Verlorenheit sich seiner bemächtigt. Auch seinen Kollegen, die in unmittelbarer Nähe stehen, etwas hinter ihm, und stets noch fröhlich winken gelegentlich, bleibt es verschlossen.
Jetzt stört es ihn, daß er nicht jeden Mann des Personals, das ringsum verteilt ist, von Angesicht kennt, um jeden mit eigenen Augen aufsuchen, von den Passanten und Zuschauern unterscheiden zu können. Stellte er sich den Platz als berechenbar vor, sollte am Ende des Vorbeizuges nur Personal zurückbleiben, das den Blick von dem Zug der Tätigen endlich abwendet und von allen Seiten zu ihm herüberblickt: Es ist nichts. Auch über dir der Himmel ist sauber.
Sehr kurze Zeit will er denken, das eigene Personal, bewaffnet, starre ihn an: aus der Menge, die verschwunden ist, von Häuserdächern herab und aus geöffneten Fenstern, die leichten, entsicherten Waffen auf ihn richtend; ein Bild, das er, lächelnd, winkend noch einmal, sogleich abweist.
Wenig später gibt ein Offizier, dem aufgetragen ist, das Ende anzuzeigen, ein vereinbartes Zeichen; aus den Lautsprechern kommt ein Lied, das immer ertönt am Ende des Vorbeizuges, und wer kann, singt mit, ausgenommen das Personal auf den Dächern.
(1975)
Teile der Landschaft
1
Ihre ausgedehnten Kiefernwälder in den abgelegeneren Teilen der Landschaft noch fast unberührt. Ihre Wiesen sehr tröstlich, zumal im Frühling.
In der Nähe einer Kreisstadt, nördlich des Fläming, die für Herstellung von Tuchen, Hüten, Möbeln, Papierwaren, Nahrungsmitteln erwähnt wird, werden die Luche und Waldungen oft besucht von Ausflüglern, viel an Sonn- und Feiertagen, aber nicht Meter für Meter. Weiter abseits finden sich auch dann Plätze von großer Abgeschiedenheit.
Unter dem Baum der nördlichen Halbkugel Kiefer, unweit spätherbstlicher Wiese, das Gesicht aufwärts, die rotgelbe Rinde des oberen Stammteils noch verfolgend bis in den Wipfel, der sich von anderen Wipfeln trennt durch Höhe, ist der farblose Himmel erwünscht gleichgültig, wie die Stämme der Bäume links, rechts, die Geräusche der Vögel, Zeichen selbstversprochener Besänftigung alles.
In der Augenhöhe die Empfindlichkeit des Halms ist abgewehrt hinter geschlossenen Augen. Die große Schwere, die die Hände, Handflächen zur Erde, befällt und den Kopf einer Frau.
Spaziergänger, deren Kinder vorauslaufen wie oft und nach ersten Ausrufen der Entdeckung zurückbeordert werden mit lauter Namensnennung und deutlicher Geste. Dies zuerst in dem Wunsch, die Störung der Liegenden, obgleich liegend auf kaltem und nassem Boden, zu vermeiden und einen Weg einzuschlagen, der das natürliche Interesse der Kinder anders wecke.
Da aber die Kinder darauf beharren, daß die Frau einen, nach den Worten der Eltern, fremden Ausdruck zeige, entscheidet sich der Mann, näherzugehen und kann die Frau nicht länger für störbar halten. Er läuft zurück und verabredet, in geringer Entfernung zu warten, bis die anderen ein Kommando der städtischen Polizei bewegt hätten, Auto und Träger an diese Stelle zu schicken.
Später das Gutachten erklärt, der Tod der jungen Frau, die als fünfundzwanzigjährig, ohne festen Wohnplatz, der Aufsicht entgangen, elternlos identifiziert wird, sei eingetreten durch Kälte.
2
Sie betritt den Bahnhof ihrer Stadt sieben Stunden vor dem Ende des Tages und hat noch dreißig Minuten bis zur Abfahrt irgendeines Zuges. Im Restaurant kauft sie zwei schnell eßbare Gerichte. Sie ißt eines, der Mann neben ihr hätte sich ihrer nach flüchtiger Beschreibung erinnert. Die letzte Station des Zuges ist eine weiter entfernte, größere Stadt.
Mit Mühe um diese Zeit findet sie die Wohnung eines Mädchens, das einen Raum mit ihr und anderen bewohnt hatte für Monate vor einiger Zeit. Das Mädchen fragt und ist mit der Antwort, die keine zweite Frage zulassen will, zufrieden. Die junge Frau bleibt zwei Tage, ißt weniges, trinkt, und liegt aber häufig wach, betrachtet viele Veränderungen des Lichts an der Decke des Zimmers. Sie verläßt die Wohnung des Mädchens abends, und ihr Abschied ist dem Mädchen wie eine Umkehr des Abschieds vor einiger Zeit. Der Zug, in den sie einsteigt, nur, daß er noch abfährt an diesem Abend, soll ihr sicher sein, bringt sie ihrer Stadt wieder näher.
In einer kleineren Stadt, deren Namen sie nicht liest, steigt sie aus, weil das Geräusch der Bewegung, noch verstärkt von der Dunkelheit, Angst in ihr hervorruft. Die Wege durch die Stadt, in der spät wenige Menschen zu treffen sind, die Straßen halb dunkel, an Kreuzungen das blauklare Licht von hohen Lampen, beruhigen sie ohne Ermüdung. Die Häuser, die sie gesehen hat, vergißt sie, und sieht sie zum erstenmal auf dem zweiten Weg durch die gleiche Straße. So erscheint ihr die kleinere Stadt sehr groß, die Straßen ohne ein Ende. Sie findet einen Bahnhof, auf dem sie angekommen ist, und kann auf einer Bank in der Halle ausruhen. Sie sitzt bis zum Morgen, beobachtet erst die Angestellten des Gebäudes, später die ersten Benutzer, denen sie folgt.
Im Zug will sie fragen, ob sie sich in die Richtung bewege, aus der sie gestern gekommen ist oder vor drei Tagen. Aber niemand kann ihr antworten, und das Gefühl, daß es Mühe kostet, ihre Frage zu verstehen, ermüdet die Befragten noch mehr.
Sie steigt aus in der nächsten Stadt und hat ihre Frage vergessen. Nur kurze Zeit läuft sie durch den Ort. In einer breiteren Straße winkt sie einem Auto, der Fahrer hält, ihre Antwort versteht er nicht wie sie. Sie schweigt, bald ist ihr die Straße bekannt, sie will aussteigen, aber der Fahrer hält nicht, sie öffnet die Wagentür. Als sie über das Feld fortläuft, schreit der Fahrer, der jetzt neben dem Wagen steht, hinter ihr her. Sie läuft bis zum Waldrand, setzt sich auf die Erde. Es ist warm genug für eine Stunde Ruhe. Sie lehnt sich zurück, raucht. Die stärkeren weißen und schwächeren schwarzen Zweige der Birke vor der Farbe des Mittags sind alles, was ihr nötig erscheint. Nur die zu große Nähe der eigenen Stadt stört.
An diesem Abend und einem anderen kommt ihr der geringe Besitzsinn eines Hauseigentümers in der Vorstadt zustatten. Anspruchslos ist aber auch die Einrichtung des Holzhauses. Der Besitzer, nach dem Zustand des einzigen Raumes, muß nicht mehr erwartet werden zu dieser Jahreszeit. Am dritten Tag in diesem Viertel, nachdem sie, wie an anderen Tagen, Weißbrot, Zigaretten, Getränk gekauft und im nahen Wald die hellen Stunden verbracht hat, schlafend oder hinaufschauend in den Wipfel über rotgelbem Stamm, geht sie nicht mehr in das Holzhaus zurück.
3
Sie geht gern von einer Freundin in ihrer Stadt fort, die sie aufgenommen hatte nicht ohne das Gefühl, freundlich zu sein und belastet. Sie kam abends, sie kannte gut genug niemanden sonst, immerhin bewohnt die Freundin ein einziges Zimmer neben kleiner Küche.
Die Gewohnheit der jungen Frau, in die Nacht hinein wachzuliegen bei Licht und unablässig zu rauchen, erträgt die Freundin schwer schon am ersten Abend. Auch ist am Abend des nächsten Tages zu sehen, daß sie keine Mühe verwenden will auf sich. Gegen die morgendliche Zusage, den vorgeschriebenen Weg zur schriftlich benannten Amtsstelle zu gehen, ist sie den Tag im Zimmer geblieben, hat wenig Vorrätiges gegessen, alles benutzte Gefäß und Besteck liegt, wo es liegengeblieben, Bücher, die sie aufgeschlagen hat, an mehreren Plätzen, sie sitzt und raucht, der Plattenspieler gibt laut etwas her, was ihrer Erwartung nicht entspricht. Die Besorgung von Trinkbarem, der sie schnell nachging sonst, war ihr erspart durch die Vorsorge der Freundin für Gäste, unter denen sie nicht erwartet war, aber Gast ist sie. Die Freundin verwendet viel Sorgfalt auf unbetroffene Haltung und Stimme.
Am zweiten Tag ist sie auf dem Weg zu jener Amtsstelle, die Kraft hat, Wohnraum und Arbeit ihr zuzusprechen, und hat sich für den Gang Kleidung geliehen von der Freundin und Geld. Bleibt aber draußen, zwar wartet sie lange vor dem Haus. Als sie friert, läuft sie die Straße zurück bis zur Ecke, wartet wieder. Geht dann noch am Nachmittag durch die Stadt, langsam, und kommt zurück nach flüchtigem Einkauf von Trinkbarem, das sie vor ihrer Freundin zu verstecken sucht.
Obgleich Ermahnung weniger in der Absicht der Freundin gelegen hatte als Hilfe, kann ein ungeduldiger Satz, daß sie einmal doch zum Amt müsse um Arbeit, der Grund gewesen sein für hastigen Auszug und offene Tür.
Gegen tägliche Vernunft also schlägt sie zum zweitenmal nützliche Arbeit aus, die gefunden worden wäre in einem Betrieb der Stadt, wechselt den Platz, ehe Arbeit angenommen, ohne Zustimmung und muß von diesem Tag an mit Strafe rechnen für Rückfall. Die Wohnung, die sie bekommen hätte, kann sie nicht in sauberem Zustand halten, und nicht will sie sich melden an jedem ersten Dienstag im Monat.
(Noch, als sie den ersten Tag in einer weiter entfernten, größeren Stadt vergehen läßt, erscheint die Freundin, die sich also eine Nacht geduldet, vor der städtischen Polizeibehörde, das Ausbleiben anzusagen und, den beunruhigten Zustand der jungen Frau vor Augen gestellt, polizeiliche Suche dringend zu erbitten. Der Beamte muß aber vielmals erklären, daß Weisung und Kraft der Behörde nur reichen für Suche verschollener Kinder.)
4
Die Reise von dem Ort der Erziehung zu Arbeit in eine Kreisstadt nördlich des Fläming führt endlich vorüber an Waldungen, die erkannt werden. Die junge Frau ist ausgestattet mit einem Schein, der als Legitimation dient bis zum übernächsten Tag, vorzulegen der zuständigen Amtsstelle in ihrer Stadt, ausgestattet mit Eigengeld in Höhe von siebenundneunzig Mark und dreiundachtzig Pfennigen, dem Erlös aus erziehender Arbeit in fünfzehn Monaten, abgerechnet die Ausgaben für Zeitungen, zusätzliche Lebensmittel und Gegenstände des persönlichen Gebrauchs, und ausgestattet mit einer Fahrkarte. Ohne weiteren Ausweis, der ordnungsgemäß gesandt worden wäre, von dem vollziehenden Hauptmann an das nördliche Kreisamt der Polizeibehörde, hätte sie ihn fünfzehn Monate vorher eingebracht, und nicht verloren lange davor am Ufer eines Sees, sorglos, das Wasser beobachtend, gleichgültig gegen Tageszeit und Weg. Sie ist allein im Abteil, das doch wenigstens acht Personen aufnehmen kann, sie hat in der letzten halben Stunde beinahe geschlafen, ungewohnt allein, und sich langsam entfernt von einem Raum, der aufgenommen hatte dreißig Schlafende und ihre Worte und Handlungen. Schwer zurücklaßbar ist doch das Gesicht eines Mädchens, das den Raum vor ihr verlassen hat. Die Eisenbahn erreicht die Kreisstadt nachmittags, der Zug gilt der jungen Frau als Teil des Ortes, von dem er mit ihr kommt.
Der Weg zu dem Haus, in dem sie ein gemietetes Zimmer mit eigenem Mobiliar, obgleich wenigem, verlassen hatte, ist ihr fremd von vielen Eiligen um diese Stunde. Ihr Name, auf kleinem Schild neben der Klingel unter dem Namen des Wohnungsinhabers ehedem, ist durch fremden Namen ersetzt. Der Inhaber, zu dieser Zeit zurückgekehrt von der Arbeit und müde, antwortet doch freundlich, daß es vernünftiger Erwägung entsprochen, das Zimmer erneut zu vermieten, und sein gutes Recht, da das Geld gebraucht werde, die Möbel seien verwahrt in einem Bodenraum, zu ihrer Verfügung. Mietschuld für drei Monate nach dem Ausbleiben sei, wenn nicht anders, mit einem Teil des Mobiliars abtragbar, nur als Vorschlag. Also, sie wisse, daß zu Unruhe kein Anlaß, da die zuständige Amtsstelle, wie man ermittelt habe, für Bereitstellung von Wohnraum verantwortlich sei.
Sie geht ohne Einwand die Treppe hinunter, weiß doch, daß der Inhaber nicht unrecht hat, beharrt also nur kurz, wortlos, auf der Vorstellung ihres Zimmers. An diesem Tag ist es zu spät, noch zur Amtsstelle zu gehen, sie geht umher in der Stadt bis zu ihrer Freundin.
5
Nicht auf freiem Fuß befindlich seit dem fünfundzwanzigsten Juni des Jahres vor der Rückkehr, zu dreizehn Uhr des fünfzehnten Tages darauf geladen zur Verhandlung in ihrer Sache, der als Relikt überkommenen Verhaltensweise eines geringen Kreises von Personen, die, mißachtend die Regeln für gemeinsames Leben, sich der Arbeit entziehen. Aus unerklärter Ursache in ihrem Falle. Denn nicht vergleichbar ist sie denen, die neben ihr sitzen wegen Scheu vor achtstündiger Tätigkeit täglich, obwohl zu Tätigkeit fähig, und Mittel für ihren Unterhalt aus täglich wechselndem Verhältnis zu weither gereisten Besuchern der nahen Hauptstadt beziehen, also eingezogen werden müssen wenige Zeit vor dem großen Festspiel aus Gründen des Eindrucks. Nicht vergleichbar auch anderen, die auf Zuwendung hoffen von Tätigen, oder Brot, Wein, Tabak, manchmal Kleidung, sich zueignen in weitläufigen Kaufläden. Zu erklärender Auskunft zeigt sich die junge Frau nicht bereit, eher zu ärgerlicher Abwehr, wie gegen lästige Anmaßung. Daß sie aber fünf Monate gegen Zurede, Mahnung, Warnung sich geweigert hat, gleichmäßiger und nützlicher Arbeit nachzugehen, kann unerachtet der Ursachen leicht errechnet werden und muß nach dem Gesetz als Gefahr gelten für öffentliche Ordnung. Soviel aber macht sie geltend, daß sie nicht dem Gemeinwesen zur Last gefallen, wie es nun, nach dem Willen des Gemeinwesens, der Fall sein werde teilweise.