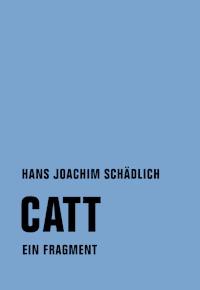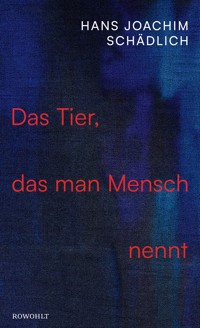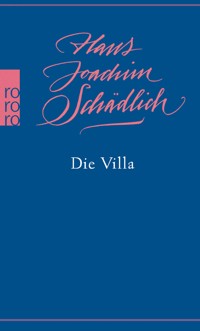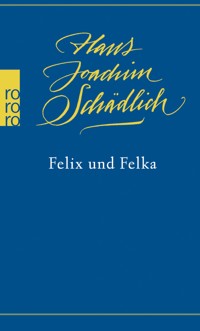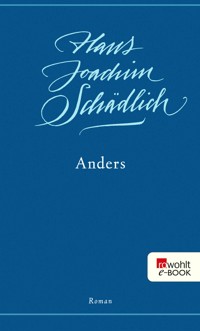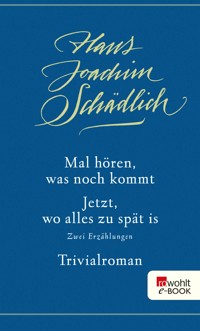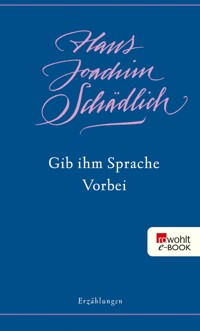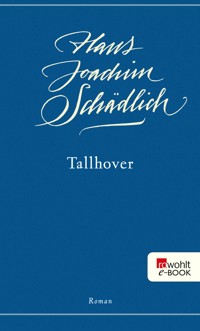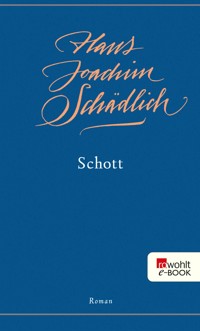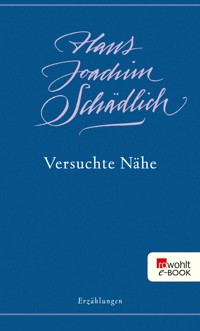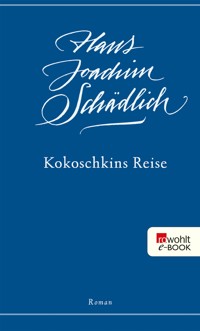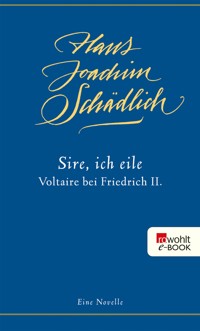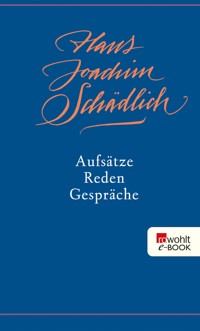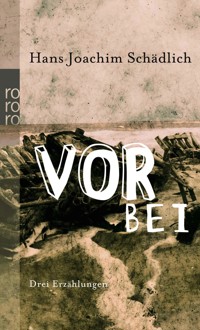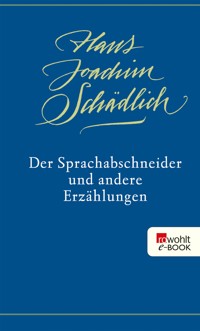
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Schädlich: Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
«Diese Kurzprosa ist nun tatsächlich geradezu überfrachtet mit politischen und historischen Anliegen, aber ihre gedrechselten Sätze schaffen eine Verpackung für das Erzählte, die wie eine Mumie die Form abgibt, in der sich der Inhalt dauerhaft halten wird. Denn wir wissen ja: Je mehr Zeit vergeht, desto wichtiger wird den Nachgeborenen die erstaunliche Verpackung und immer unwichtiger die Pharaone, deren Körperreste sie beherbergt.» (Ruth Klüger)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Hans Joachim Schädlich
Der Sprachabschneider und andere Erzählungen
Herausgegeben von Krista Maria Schädlich
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
«Diese Kurzprosa ist nun tatsächlich geradezu überfrachtet mit politischen und historischen Anliegen, aber ihre gedrechselten Sätze schaffen eine Verpackung für das Erzählte, die wie eine Mumie die Form abgibt, in der sich der Inhalt dauerhaft halten wird. Denn wir wissen ja: Je mehr Zeit vergeht, desto wichtiger wird den Nachgeborenen die erstaunliche Verpackung und immer unwichtiger die Pharaone, deren Körperreste sie beherbergt.» (Ruth Klüger)
Über Hans Joachim Schädlich
Hans Joachim Schädlich, 1935 in Reichenbach im Vogtland geboren, arbeitete an der Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin, bevor er 1977 in die Bundesrepublik übersiedelte. Heute lebt er wieder in Berlin. Für sein Werk bekam er viele Auszeichnungen, u.a. den Heinrich-Böll-Preis, Hans-Sahl-Preis, Kleist-Preis, Schiller-Gedächtnispreis des Landes Baden-Württemberg, Lessing-Preis, Samuel-Bogumil-Linde-Preis, Großen Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, Bremer Literaturpreis, Corine-Preis, Joseph-Breitbach-Preis und den Berliner Literaturpreis.
Weitere Veröffentlichungen
Versuchte Nähe
Tallhover
Schott
Trivialroman
Anders
Der andere Blick
Vorbei
Familienstücke
Gib ihm Sprache / Vorbei
Kokoschkins Reise
Sire, ich eile ...
Narrenleben
Aufsätze, Reden, Gespräche
Inhaltsübersicht
Schattenbehälter
Wer eintrat in sein Zimmer, hatte den Garten vor Augen, kobaltblaue Papageien und purpurne Anemonen. Unter den Bäumen geht ein Bach, der von den Bergen kommt. Aber die Baumkronen sind verdeckt, da hätte das Zimmer höher sein müssen.
Das Haus, in dem Nikolaus Schimmel wohnte, war alt. Der Garten war älter, und flandrisch: das war der Gobelin, den Nikolaus Schimmel hatte. Bei Nikolaus Schimmel hätte einer einen chinesischen Gong kaufen können oder eine venezianische Ampel oder einen elfenbeinernen Gottessohn, der mit Silbernägeln an ein Kreuz aus Ebenholz geschlagen war.
Das, wofür Leute was geben, Zinngeschirr und Drehorgeln, Silberleuchter, Kuckucksuhren, Petroleumlampen, Truhen, Spinnräder und Schaukelstühle, das hatte Nikolaus Schimmel alles. Das Zinngeschirr war nicht geputzt, und an den Truhen die Eisenbeschläge mit den alten Jahreszahlen waren noch dieselben.
Nikolaus Schimmel hatte ein Gasthausschild aus Würzburg, das gab es vielleicht einmal, und eine Wiege, nur das Fußbrett war zerbrochen. Er hatte Klarinetten, Ziehharmonikas, eine Schlagzither, da fehlten die Begleitsaiten, Geigen, Bratschen, dazu Stimmgabeln. Er hatte Tabakspfeifen, vierzig verschiedene, und Hüte. Er hatte Barette, Federhüte, Filzhüte, eine Kapotte und einen Chapeau claque. Nikolaus Schimmel hatte Pferdegeschirre, meistens Kumtgeschirre, Kehrleinen für Schornsteinfeger, einen Schiffskompaß und Würfelbecher. Er hatte Münzen, nie weniger als zwei von jeder, damit er jede mit Avers und Revers auslegen konnte, Spieluhren, Kameen und Intaglios, Fingerringe, Medaillons, Uhrketten, Ohrringe, Agraffen und einen Stirnreif aus Gold. Nikolaus Schimmel hatte einen großen Laden, da waren die Wände Regale, und in der Mitte stand ein Ladentisch, die Hälfte für die Registrierkasse.
Alles, was Nikolaus Schimmel hatte, schrieb er auf. Alles, was Nikolaus Schimmel aufgeschrieben hatte, tat er in seinen Sekretär. Und alles, was er in seinen Sekretär getan hatte, war unverkäuflich.
Wer was brauchte, der kaufte bei Nikolaus Schimmel Nägel, Vogelkäfige, Grammophonplatten, Bratpfannen, Parfümzerstäuber, Schlüssel, Perlmuttknöpfe, Bilderrahmen, Blumenkästen, Spielkarten, Brennscheren, Holzpantoffeln und Plätteisen. Und auch sonst alles. Aber nichts, was unverkäuflich war.
Manches, was Nikolaus Schimmel hatte, das hatten auch andere. Aber alles, was manche anderen hatten, das hatte Nikolaus Schimmel. Und er hatte alle Spiegel.
Aber Nikolaus Schimmel wußte auch alles.
Er sah unterm Kreuz knien, wer knien mußte, und schrieb den Brief, den wer geschrieben hatte unter der oder der Petroleumlampe. Er sah die Uhr und wußte, wem sie die Zeit zugeteilt hatte, und er saß im Gasthaus, in Würzburg, aß vom Zinngeschirr und rauchte die und die Pfeife, da hing sein Filzhut neben der Kapotte, die gehörte wer, und ihr gehörte die Spieluhr, und das Medaillon trug sie auch. Nikolaus Schimmel zahlte mit seinen Münzen.
Und da konnte auch ruhig einer Sachen sagen, die ganz einfach klingen, Gezwitscher und Getschilp, Nikolaus Schimmel sagte gar nichts, er wußte, daß Sperlinge und Rotkehlchen und Zeisige reden, und er verstand sie, das genügte ihm. Er hatte einen großen Vogelkäfig. Jeden Tag stellte er den auf das Blumenbrett vom Hoffenster, manchmal ließ er ihn offen, aber sie kamen wieder, oder es waren andere.
Manchmal kam ein Mann in den Laden, kaufte das und das, hatte schon alles und hatte bezahlt, blieb noch, vor den Ringen und Medaillons, bei den Truhen hinten. Nikolaus Schimmel sagte nichts. Das sah Nikolaus Schimmel, ob einer bloß taxierte. Der Mann wollte gehen und hatte nichts gesagt, ging und kam wieder, sehen, was Nikolaus Schimmel alles hatte.
Aber die Spiegel, die Nikolaus Schimmel hatte, die hat keiner alle gesehen. Das Glas bemalt an den Rändern, und Spiegel die Rahmen, oder Glas, graviert: Wandspiegel. Die meisten in Holz, gekrönt von Ziergiebeln oder nicht, vergoldet, einer geschnitzt, lackiert manche. An manchem Kerzenhalter. Putztischspiegel, Necessaires, zierliche Kästchen, Kamm und Schere darin, und zierlichere Spiegel in Schildpatt. Handspiegel, schön gravierte Rückseiten, metallgerahmt, gedrechselte Griffe, in Holz gerahmt und vergoldet wieder. In Leder oder Metall Taschenspiegel, aufgeklappt ausgelegt im Regal, ein Bildnis die Innenseite des Klappdeckels, oder der Deckel fein ziseliert, vielleicht Silber. Aufgeschrieben waren sie alle. Nikolaus Schimmel sah in den Spiegel und sah darin jeden, der in den Spiegel gesehen hatte, und jeder, der in den Spiegel gesehen hatte, der hatte eine Geschichte, und jede Geschichte muß Nikolaus Schimmel aufschreiben.
Über seine Spiegel sprach Nikolaus Schimmel nie. Nur einmal, zu einem Mädchen, dem gefiel ein wunderbarer Spiegel, den Nikolaus Schimmel hatte. Das ist der Spiegel der Königin, hatte Nikolaus Schimmel gesagt, das Mädchen hatte gelacht, Königin. Ideen hat der. Nikolaus Schimmel brachte was durcheinander, er dachte, die Kapotte, und die Spieluhr mit den Intarsien, und das Medaillon, von dem immer die Kette gefehlt hatte, das gehörte alles dem Mädchen. Wenn er im Gasthaus saß, hängte er seinen Filzhut neben die Kapotte, in Würzburg.
Von allen Spiegeln am meisten liebte er einen, der war von seinem Vater. Alle Spiegel, die er hatte, gehörten ihm, aber den nannte er seinen Spiegel. Das war ein Handspiegel, in Holz gefaßt, mit einem runden Griff. Der Rahmen war mit Feldblumen bemalt, auch der Griff. Auf dem Rahmen oben saß ein Vogel, aus Holz geschnitzt, ein singender Vogel. Der Blumenmaler konnte aber mehr. Auf die Rückseite des Spiegels hatte er ein fernes Ufer gemalt, bergan Häuser, und im Vordergrund ein blaues Wasser, und Segelschiffe, mit Ballen beladen. Der Schiffskompaß von Nikolaus Schimmel hatte etwas damit zu tun. Obgleich, die Segelschiffe waren groß, mit Ballen beladen, aber ob sie seetüchtig waren, und die Berge im Hintergrund, die Sache war unentschieden. Die Häuser waren vielleicht Montreux oder Rapperswil, vielleicht war es der Genfer See oder der Vierwaldstätter oder die Sehnsucht nach dem offenen Meer, die nicht auskommt ohne die Berge im Rücken. Morgens, kaum, daß er wach war, sah er in seinen Spiegel, konnte sein Gesicht sehen und wußte, er lebt.
Wie zwei Alte in seinen Laden kamen, waren die Tage schon kälter. Die Lampe auf seinem Sekretär brannte immer. Warum wollen die Alten verkaufen, was der Mann unterm Arm trägt. Gut eingewickelt ist es, in ein warmes Schultertuch. Die Frau hat einen Pelzkragen, der hat gute Tage gesehen, und der Mantel des Alten, schwarzes Wolltuch, der Alte hält sich gerade. Nehmen Sie das, sagt er, es ist nicht ums Geld, und er wickelt aus, was er da unterm Arm hatte, die Frau hilft ihm, besorgt. Und Nikolaus Schimmel sieht schon, das sieht er selten. Weil er abwehrt, sagt die Alte, Es ist gut so. Die Kinder sind fort, die kamen sonst manchmal, was sollen wir noch mit der großen Wohnung.
Nikolaus Schimmel hält den Spiegel bloß. Da können die Alten beruhigt sein. Er sieht ihnen nach. Den Spiegel trägt er nach hinten, der muß eingeschrieben werden. Nach Hause gehen sie, die Alten.
Sieh nicht in den Spiegel, sagt Nikolaus Schimmel. Nach Hause gehen sie, im Regen. In der Diele ist es dunkel, auch an helleren Tagen. Dort hing der Spiegel, die Alten schweigen. Der Alte geht in sein Zimmer. Die Verwirrungen der Stadt, Unzahl der Gesichter, die Überfälle des Lärms, vergißt er, vor seinen Büchern, unter dem schwachen Holzgeruch der Regale. Wenn es dunkler wird, trinken sie ihren Tee, im großen Zimmer, am Tisch vor dem Fenster, das den Blick auf die Straße hat. Der Alte hat eine Decke um die Knie. Unter den Regen ist Schnee gemischt, die Schritte der Fußgänger bleiben sichtbar. Eine kleinere Wohnung wird wärmer sein, zwei Zimmer. Die Alten lieben auch nicht mehr die hohen Decken. Daß sie den Tausch fürchten, denkt jeder allein. Der Spiegel war das erste. Bilder, manche Möbel, Kristall, in den nächsten Wochen. Das läßt ihnen Zeit. Von den Kindern wird Post kommen.
Der Spiegel kommt ins Regal, vorn, dem Ladentisch gegenüber.
Einer, der nicht wußte, daß Spiegel unverkäuflich waren, bei Nikolaus Schimmel, oder wußte er es, kam in den Laden, ging herum, den kannte Nikolaus Schimmel nicht: Was Besonderes sollte es sein, altes. Den da, sagt er, und meint den Spiegel der Alten. Kostet? Nikolaus Schimmel ist leise, den nicht und keinen. Den muß ich haben, sagt der Mann. Hier, er zeigt Geld. Nikolaus Schimmel ist still. Da geht der Mann, sagt noch ein Wort und geht. Daß es Nikolaus Schimmel angst ist vor dem Spiegel der Alten.
Gegangen, eilig, sonst hättest du dir Zeit genommen, Alte, die Wäsche aufzuheben vom Fußboden, die Bücher hättest du ordentlich aufgestellt, Alter, deine Bücher. Und die Briefe, unterm Himmel liegen sie, im Schnee.
Wie fahrt ihr denn, so kommt ihr nicht weit, leg dir das Tuch um, und du, Alter, wo ist dein Mantel. Auf der Straße, im Scheinwerferlicht des zweiten Lastwagens, halten sie sich. Die Unbekannten auf dem ersten Wagen drängen sich aneinander, für zwei ist kein Platz mehr. Die Alte auf den zweiten Wagen, sagt einer.
Auf dem schwarzen Fußboden einer Turnhalle, die erfüllt ist von Geschrei und Dunkelheit, sitzt der Alte, suchend. Er ruft ihren Namen nicht, zu viele rufen Namen. Er sieht hinüber zur Tür, die in die Halle führt, wer von Flüchen hereingedrängt wird. Die Füße von Suchenden, die ihn nicht sehen, und die Rufe verwirren ihn.
Der andere Wagen fährt weiter. Hinter ihm fahren andere. Schnell ist für viele kein Platz auf dem zweiten. An der Tür einer Turnhalle fragt die Alte nach dem ersten Wagen aus ihrer Straße. Niemand antwortet ihr. Sie antwortet nicht auf Fragen nach einem Wagen aus einer Straße. Die Turnhallen der Stadt gleichen sich.
In der Nacht, auf dem Fußboden, verliert die Alte alle Regung. Die Frau neben ihr, die fiebert, sagt den Namen des Kindes, das sie suchen muß. Vor dem Morgen sind die Augen der Alten fremd. Der Tag geht vorbei an ihr.
Wie das Land, das sie nicht sieht hinter der Wand des Waggons.
Aber der Alte bleibt bei seiner Hoffnung. Von der Tür entfernt, zu der er nicht mehr hinübersieht, liegen Matten. Nachts findet er einen Platz dort. Das Brot, das er bekommt, verzehrt er sorgfältig. Aufmerksam befolgt er die Befehle, die ihm zugebrüllt werden.
Er sucht sich einen Platz in einer Ecke des Waggons, wo er nicht getreten wird und die Kälte nur Kälte ist. Am Ende der Fahrt, vor den Baracken, sucht er die Gesichter ab. In den fremden Gesichtern sieht er vertraute Gesichter der früheren Tage. In der Baracke die feuchte Kälte wird nur abgehalten von den Körpern der Männer, die neben ihm liegen auf der Pritsche. Die Namen, die sie ihm sagen, hört er nicht. Er nennt sie wie die, die er erkennt. Seine Lippen bewegen sich ohne Stimme.
Daß sie sich aufstellen müssen, im Schnee, sagen ihm zwei, die ihm aufhelfen. Fünf stehen in einer Reihe. Sie halten ihn in ihrer Schwäche im Frost.
Der Schnee, den der Alte sieht, wird schwarz in der dritten Stunde.
Wie Nikolaus Schimmel durch den Laden geht, die Ladentür aufschließen am Morgen, sieht er, das Wort ist an sein Ladenfenster geschrieben, mit weißer Farbe. Er liest es in den Spiegeln, im Laden. Nikolaus Schimmel wird müde. Zur Ladentür geht er nicht. Alles, was er aufgeschrieben hat, nimmt Nikolaus Schimmel aus seinem Sekretär. Er liest nach, was unverkäuflich ist, und jedes Stück, das in seinen Papieren steht, das sieht er sich an in seinem Laden. Den ganzen Tag hat er zu tun, bis in die Nacht. Und nichts fehlt. Von den Spiegeln liest er die Geschichten, die er aufgeschrieben hat, aber es sind wenige, und viele Spiegel.
Nikolaus Schimmel legt das Bündel Papiere auf seinen Sekretär, auf die Papiere legt er den Spiegel, den er am liebsten hat. Er sitzt in einem großen Laden, die Decke ist eine Kuppel über ihm. Die Wände gehen fort, und Nikolaus Schimmel ist allein. Aus der Kuppel in großer Höhe fallen langsam gezackte Blätter auf Nikolaus Schimmel nieder von einem Baum. Die Blätter segeln tiefer und sind blau. Die Blätter torkeln durch Zweige und sind Schmetterlinge. Die Schmetterlinge schwimmen durch Glas und sind violette Fische. Die Fische fallen auf die Erde und sind Vögel.
Die Ladenfensterscheibe zersplittert, und Nikolaus Schimmel steht auf. Er macht Licht an im Laden, das Schloß an der Ladentür zerbricht. Nikolaus Schimmel bleibt stehen. Der Mann, der den Spiegel nicht bekommen hat und keinen, steht im Laden mit anderen Männern, die aussehen wie er.
Zum Regal geht er, dem Ladentisch gegenüber, und nimmt den Spiegel der Alten. Er sagt, Da hast du deinen Spiegel, und schlägt ihn gegen die Tischkante. Die Männer ziehen Kästen heraus, halten sie hoch, so in Schulterhöhe, und kippen sie aus: Nägel, Knöpfe, Schlüssel. Sie ziehen eine Spieluhr auf, Nikolaus Schimmel hatte nur Spieluhren, die spielten. Sie stecken Münzen, Ringe und Medaillons ein, die angeln sie vorsichtig aus der Vitrine, den Glasdeckel hat einer eingedrückt. Einer, den kennt Nikolaus Schimmel jetzt, geht zu jedem Spiegel, aber nicht zu den Wandspiegeln. Jeden Spiegel, zu dem er geht, schlägt er gegen die Tischkante. Er stößt die Spinnräder um und geht zu den Truhen. Er nimmt Zinnteller aus den Truhen, für die Wandspiegel. Aber einen läßt er. Für den nimmt er eine Geige und schlägt die Geige in das Glas. Da hört Nikolaus Schimmel, wie die Spiegel zerbrechen. In den Scherben am Fußboden sieht er die Sohlen der Männer. Die Männer nehmen das Bündel Papiere vom Tisch und zerreißen die Blätter und lachen: sein Spiegel ist auf die Erde gefallen.
(1971)
Der Sprachabschneider
Montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags und sonnabends klingelt genau neben Pauls Ohr pünktlich um sechs Uhr dreißig der große Wecker so laut, daß Paul glaubt, er träume von einem großen lauten Wecker, der genau neben seinem Ohr klingelt. Weil es aber, glaubt Paul, ein Traum ist, dreht er sich auf die andere Seite und will weiterschlafen. Weil aber der Wecker in Pauls Traum so laut klingelt, daß Paul wach geworden ist, wird Paul wach, dreht sich um und sieht pünktlich um sechs Uhr einunddreißig auf den Wecker, der gerade geklingelt hat. Der Wecker klingelt ja gar nicht, denkt Paul. Hab ich also doch geträumt.
Was müßte Paul jetzt tun, überlegt Paul. Er überlegt eine Weile, dann fällt es ihm ein: den Oberkörper aufrichten, die Bettdecke zurückschlagen, die Füße auf den Fußboden setzen. Uh! Kalt! Paul deckt sich bis unters Kinn zu. Sonst ist alles still. Oder? Alles ist still. Paul schließt die Augen und denkt: Der Schlaf nach dem Aufwachen ist der gesündeste.
Da geht die Tür auf, Pauls Mutter sagt viel zu laut: «Aufstehen, Paul!» und knipst das viel zu helle Licht an. Die viel zu laute Stimme von Pauls Mutter und das viel zu helle Licht sind zu viel für Paul. Mit dem warmen Bett und dem gesunden Schlaf nach dem Aufwachen ist es aus. Paul richtet den Oberkörper auf, schlägt die Bettdecke zurück und setzt die Füße auf den Fußboden. Uh! Noch kälter, als Paul gedacht hat. Immer, wenn es morgens kalt ist, ändert Paul die Reihenfolge: er zieht sich erst an, dann wäscht er sich.
Das Frühstück dauert bei Paul nur fünf Minuten. Er hat es aber nicht eilig, in die Schule zu kommen.
Auf dem Weg zur Schule gibt es immer etwas zu sehen, und warum soll Paul nicht zusehen, wenn es etwas zu sehen gibt? Paul kam schon öfters zu spät, weil er zusah, was es zu sehen gab. Er sagte dann, er habe verschlafen. Einmal sagte er, es habe unterwegs soviel zu sehen gegeben. Als der Lehrer aber fragte, was es gewesen sei, hatte Paul keine Lust, davon zu erzählen. Da sagte der Lehrer, das sei eine faule Ausrede von Paul, weil Paul nicht zugeben wolle, daß er verschlafen habe.
Seit diesem Tag macht Paul sich um Punkt sieben Uhr auf den Schulweg. Pauls Mutter sagt jeden Morgen: «Warum gehst du so früh, Paul?» Sie wundert sich aber nicht sehr. Sie weiß, daß Paul immer viel Zeit braucht. Deshalb findet sie es eigentlich richtig, daß er so früh geht.
Das erste, was Paul sieht, ist ein riesiger weißer Baum, der hoch am Himmel über Paul hinwegschwebt. Ein schwebender Himmelsbaum, denkt Paul. Ein weißer Riesenbaum. Ein riesiger Weißbaum über Paul. Ein riesiger Himmels-Weißbaum. Ein weißer Himmels-Riesenbaum.
Nach sieben Schritten, Paul geht sehr langsam, ist der Baum ein Elefant. Sechs Schritte später ist der Elefant eine Lokomotive. Fünf Schritte später ist die Lokomotive ein Bett. Der Wind macht aus der Wolke, was er will: einen Wolkenbaum, einen Wolkenelefanten, eine Wolkenlokomotive, ein Wolkenbett.
Paul, der noch müde ist, säße gern auf dem Wolkenelefanten und ritte gemächlich zur Schule. Noch lieber läge er in dem Wolkenbett. Er würde natürlich nicht schlafen. Nur dösen. Die dünnen Wolkenfetzen, die neben der Bettwolke durcheinandersegeln, sehen wie Sauerkraut aus. Ab und zu könnte Paul sich eine Portion Sauerkraut vom Blauhimmel langen.
Jetzt hat Paul die Straßenbahnhaltestelle erreicht. Wenn es keine Wolkenlokomotive ist, eine Straßenbahn ist auch etwas. Paul stellt sich hinter den Fahrer und sieht zu, wie der Fahrer klingelt und losfährt. Eigentlich hat Paul die Klingelei nicht gern. Sie erinnert ihn daran, daß die Zeit vergeht und die Schule bald anfängt. Die Fahrgäste drängeln, und Paul muß aufpassen, daß er in dieser Drängelei nicht fortgeschoben wird. Ein älterer Mann sagt zu einem jüngeren Mann: «Jeden Morgen fahre ich mit dieser Bahn, und jeden Morgen ist es dieselbe Fahrerei. Ein Geruckel und Gezuckel, daß die letzte Müdigkeit verfliegt, wenn du noch müde bist.» Die Bahn ruckelt und zuckelt weiter, doch Paul hört nicht länger auf die Morgenunterhaltung der beiden Männer. Er sieht gerade, daß es zu regnen anfängt.
Die Regenschauer stürzen auf die Straßenbahn wie haushohe Wellen auf ein Schiff. Das Wasser schlägt an die Scheiben und läuft in Strömen an den Scheiben herab, so daß Paul ringsum nur noch Wasser sieht. Die Straßenbahn bahnt sich neben einem Lastauto, das mit Kohle beladen ist, mühsam einen Weg durch das Wasser auf der Straße. Kurz vor der Schule sind die Schienen so buckelig und ausgebeult, daß das Straßenbahnschiff plötzlich stampft und schlingert. Der Kapitän geht auf halbe Fahrt. Das Lastschiff mit Kohle schiebt sich vor das Straßenbahnschiff. Hinter das Straßenbahnschiff hat sich ein froschgrünes Autoboot für zwei Personen gesetzt, das nach links in einen schmaleren Straßenkanal abbiegen will. Neben das Straßenbahnschiff darf jetzt niemand mehr fahren, weil die Straßenbahn hält. Aus der entgegengesetzten Richtung kommt eine andere Straßenbahn, die an Pauls Straßenbahn vorbeifährt. Zwischen den beiden Straßenbahnen ist so wenig Platz, daß wahrscheinlich nicht einmal Paul zwischen die beiden Straßenbahnen passen würde.
Paul steigt aus. Bis zur Schule ist es nicht mehr weit. Paul würde gern einen Umweg machen, doch es ist schon sieben Uhr vierzig. Außerdem regnet es. Deshalb beeilt sich Paul.
Nach seinen Begegnungen mit einem Wolkenelefanten und einem Straßenbahnschiff wundert es Paul jetzt nicht mehr, daß vor der Schule ein Mann auftaucht, dessen Anblick auch einem größeren Jungen als Paul die Sprache verschlagen muß.
Der Mann spannt einen großen grünen Regenschirm auf, steigt auf einen Holzkasten, der wie ein Koffer aussieht, und singt! Richtiger Gesang ist es aber nicht. Paul hört einen Raben, ein Dielenbrett und einen Bären. Der Bär brummt, das Brett knarrt, der Rabe krächzt:
«Übernehme gegen Lohn
Aufsicht über Präposition.
Suche dringend Prädikat,
biete frischen Wortsalat.
Kaufe einzeln und komplett
Konsonanten (außer Z).
Wer tauscht alte Stammsyllaben
gegen fertige Hausaufgaben?»
Paul kommt gerade noch zur rechten Zeit in die Klasse. Heute hat Paul Biologie, Mathematik, Russisch, Deutsch, Deutsch, Russisch. Die Schule ist wie jeden Tag. Paul ist nicht besonders fleißig, und Paul ist nicht besonders faul. Er wartet heute ungeduldiger auf die große Pause, weil er mit allen Spielern seiner Fußballmannschaft über das Training sprechen will. Nach dem Unterricht geht Paul schnell nach Hause. Den Mann auf dem Holzkoffer und sein Lied hat er vergessen.
Paul will vor dem Fußballtraining seine Hausaufgaben hinter sich bringen. Gerade will Paul das Deutsch-Heft aufschlagen, als es an der Wohnungstür klingelt. Paul öffnet die Tür einen Spaltbreit und vergißt, den Mund wieder zuzumachen.
Vor der Tür steht der Mann mit dem Holzkoffer. «Mein Name ist Vielolog», sagt der Mann mit brummender, knarrender und krächzender Stimme. «Ich möchte dir einen Vorschlag machen.» Dabei klopft er auf seinen Koffer.
Paul sagt: «Meine Eltern sind auf Arbeit, komm bitte heute abend wieder.»
Aber der Mann sagt: «Ich übernehme eine Woche lang deine Hausaufgaben, wenn du mir alle deine Präpositionen und … sagen wir mal … die bestimmten Artikel gibst. Das ist ja nicht viel.»
Paul überlegt. Dann sagt er: «Wie soll ich dir meine Präpositionen oder so was geben. Die hab ich doch nicht im Schrank.»
«Du sagst einfach, daß du sie mir gibst, und fertig. Du kriegst natürlich ’ne Quittung.»
Da denkt Paul: Eine ganze Woche lang keine Hausaufgaben! Und ich brauche bloß zu sagen: ‹Ich geb dir meine Präpositionen und … und was? Ach so, die bestimmten Artikel.› Na, wenn es weiter nichts ist. Paul sagt: «In Ordnung. Ich geb dir meine Präpositionen und die bestimmten Artikel.» Er führt den Mann in sein Zimmer. Vielolog stellt den großen grünen Regenschirm in die Ecke, öffnet den Holzkoffer und holt einen Notizblock heraus. Während er die Quittung schreibt, kann Paul sehen, was in dem Koffer ist. Es sind kleine Holzkästchen, und auf jedem Kästchen klebt ein Zettel. Paul liest auf einem Zettel das Wort ‹Pronomen› und einen Namen, der ihm sehr bekannt vorkommt. Es ist ein Junge aus der achten Klasse, erinnert sich Paul, und er denkt:
Bin ich ja nicht der einzige. Vielolog, der an Pauls Tisch sitzt, überreicht Paul die Quittung und macht sich sogleich an Pauls Hausaufgaben. Paul steckt die Quittung in die Hosentasche und sagt: «Ich gehe Sportplatz.»
Da lächelt Vielolog zufrieden.
Am Abend will Pauls Mutter wissen, ob Paul seine Hausaufgaben erledigt hat. «Ja», sagt Paul.
«Und was hast du sonst noch gemacht?» fragt Pauls Mutter.
«Och», sagt Paul, «Ich war Fußballtraining. Hinterher saßen wir noch Eisdiele.»
Pauls Mutter starrt Paul an, sagt aber nichts. Sie denkt: Vielleicht hat Paul sich wieder etwas Neues ausgedacht.
Als er von dem Regen erzählt, den er am Morgen erlebt hat, sagt Paul: «Regen stürzte Straßenbahn wie haushohe Wellen ein Schiff.»
Pauls Mutter sagt: «Du kannst mir doch nicht erzählen, daß die Straßenbahn von dem Regen umgefallen ist!»
«Hab ich doch gar nicht gesagt!» sagt Paul.
In der Schule geht es erst richtig los. Pauls Mitschüler merken gleich, daß mit Paul etwas nicht stimmt. Immer, wenn er etwas sagt, sehen sie ihm auf den Mund. Als Paul in der Geographiestunde aufgerufen wird und sagen soll, wohin der Main fließt, sagt Paul: «Main fließt Rhein.»
Da lachen alle, sogar Pauls Freunde. Und der Lehrer sagt: «So rein fließt der Main gar nicht, Paul.»
Zum Direktor, der in der Pause den Korridor entlangkommt und wissen will, ob Pauls Lehrer noch in der Klasse ist, sagt Paul: «Nein, Lehrer ist nicht Klasse.»
Der Direktor ist eine Sekunde lang sprachlos. Paul vergißt vor Aufregung, was der Direktor sagt. Etwas Angenehmes ist es jedenfalls nicht.
Daß Paul aber keine Hausaufgaben zu machen braucht, findet er wirklich schön. Endlich kann er nach der Schule tun, was er will. Am liebsten spielt er Fußball. Aber er ist allein. Die anderen kommen immer erst auf den Sportplatz, wenn sie ihre Hausaufgaben gemacht haben. Was soll Paul so lange tun? Er legt sich ins Gras und sieht in den Himmel. Er langweilt sich.
Am Montag darauf ist die Zeit ohne Hausaufgaben vorüber. Paul kommt von der Schule nach Hause und seufzt, weil er das Gefühl hat, daß für ihn mehr hätte herausspringen müssen als eine Woche ohne Hausaufgaben. Es macht Paul gar keinen richtigen Spaß mehr zuzusehen, was es zu sehen gibt, weil er es nicht mehr richtig erzählen kann. Und es macht auch gar keinen richtigen Spaß mehr, etwas zu sagen. Die Mitschüler lachen, der Lehrer glaubt, Paul macht dumme Witze, und der Direktor schimpft.
Zwei Wochen hätte ich mindestens verlangen müssen, denkt Paul und setzt sich an seinen Tisch. Da klingelt es. Wieder steht Vielolog vor der Tür.
Paul bittet ihn herein und sagt: «Du mußt mir noch eine Woche geben!»
«Gut, aber nicht umsonst», knarrt das Dielenbrett.
«Was willst du denn?» fragt Paul.
«Ich will alle deine Verbformen», krächzt es aus dem Mann.
«Alle meine Verbformen?» ruft Paul erschrocken.
«Den Infinitiv kannst du meinetwegen behalten», brummt der Mann.
Paul überlegt: Immerhin, Infinitiv reicht vielleicht. Ich könnte jeden Nachmittag schwimmen gehen, bis die anderen zum Fußballspielen kommen. Und heute nachmittag ist Zirkus! «Einverstanden», sagt Paul. Vielolog öffnet den Koffer, holt ein neues Kästchen heraus, schreibt ‹Verbformen› und Pauls Namen darauf. Paul bekommt seine Quittung und macht sich auf den Weg zum Zirkus.
Die Vorstellung fängt erst um fünfzehn Uhr an. Paul kann sich vorher die Tierschau ansehen. Vor den Käfigen, in denen die Löwen liegen, trifft Paul seinen Freund Bruno.
Paul fragt: «Gehen du auch Zirkus?»
Bruno sagt: «Paul, was ist los mit dir?»
«Nichts», antwortet Paul. «Wann machen du Hausaufgaben?»
Bruno sagt: «Nun hör aber auf, Paul!»
An der Zirkuskasse sagt Paul gar nichts. Er gibt Bruno das Eintrittsgeld, und Bruno kauft zwei Karten.
Ehe die Vorstellung beginnt, fragt Paul noch: «Bruno, was gefallen dir besser, Akrobatik oder Dressur?»
«Am besten gefällst du mir», antwortet Bruno.
Da schweigt Paul bis zum Ende der Vorstellung, obwohl er gerne etwas gesagt hätte.
Bruno hat zuletzt beinahe ein schlechtes Gewissen.
Am Abendbrottisch muß Paul seinen Eltern unbedingt vom Zirkus erzählen.
«Herrlich sein Dressuren», sagt er. «Ein Tiger springen ein brennender Reifen. Ein Elefant sitzen ein großer Hocker.» Pauls Eltern werden sehr traurig, als sie Paul reden hören. Er hatte ihnen beim Abendbrot immer von seinen Erlebnissen erzählt. Jetzt bringt er nur noch solche Sätze zustande.
Vater, der sich nichts anmerken lassen will, fragt: «Und die Akrobaten?»
«Es geben Trapezkünstler und einen Seiltänzer», sagt Paul. «Seiltänzer halten jede Hand einen Regenschirm, und seine Schultern tragen er ein Mädchen.»
Jetzt sieht Paul, daß seine Eltern sehr traurig sind.
Als Paul in sein Zimmer gegangen ist, sagt Mutter: «Zuerst dachte ich, Paul hat sich einen Spaß ausgedacht. Aber das ist schon kein Spaß mehr. Was ist bloß mit ihm los?»
«Ist Paul vielleicht krank?» fragt Vater.
Mutter sagt: «Nein, bestimmt nicht. Das hätte ich gemerkt. Es muß irgend etwas anderes sein. Was ist es bloß?»
«Warten wir ab», sagt Vater, «wir müssen Geduld haben.»
In der Schule sagt Paul so wenig wie möglich. Seine Mitschüler warten nur darauf, daß er etwas sagt, und prusten gleich los. Sie glauben, daß Paul einen Dreh gefunden hat, die Lehrer auf den Arm zu nehmen. Nur Fritz, der nie Pauls Freund war, sagt in der Pause zu Paul: «Sein du kleines Knirpschen, müssen du Kindergarten gehen. Oder Mutti Rockzipfel bleiben.»
Der Klassenlehrer bestellt Paul schließlich zu sich und sagt sehr ärgerlich: «Wenn das so weitergeht, dann müssen wir ein ernstes Wort mit dir reden. Was denkst du dir eigentlich? Du glaubst wohl, du kannst dir alles erlauben, wie? Nimm dich gefälligst zusammen und hör mit den Faxen auf!»
Paul zuckt nur mit den Schultern.
Nachmittags geht er ganz allein ins Schwimmbad, sucht sich ein einsames Fleckchen auf der Liegewiese und grübelt. Im Unterricht geht es nur noch, wenn Paul ‹seine› Hausaufgaben vorliest. Vielolog ist sehr klug. Er macht Pauls Hausaufgaben nicht besser, als es Paul getan hätte. Wenn Paul aber selber etwas sagen muß oder wenn eine Arbeit geschrieben wird, bei der man in ganzen Sätzen antworten muß, dann ist es schlimm für Paul. Die Lehrer glauben, Paul macht absichtlich alles falsch. Es vergeht keine Stunde ohne einen Tadel, es regnet Vieren und Fünfen, und alle Lehrer schimpfen mit Paul.
Paul schläft in der heißen Sonne ein. Er träumt aber gar nichts. Er wacht auf und fragt sich, wie lange er nicht mehr richtig geträumt hat. Eine Woche? Oder schon zwei?
Das Wasser im Schwimmbecken ist so frisch, daß Paul seine Grübeleien wieder vergißt. Die zweite Woche vergeht sehr schnell. Paul schweigt meistens.
Am dritten Montag sagt er zu Vielolog: «Ich können gar nichts mehr allein machen. Du dürfen mich jetzt nicht sitzenlassen.»
Vielolog ist zufrieden. Aber umsonst tut er natürlich nichts.
Paul sagt: «Du haben schon genug!» Doch Vielolog läßt sich nicht beirren.
Schließlich gibt Paul nach: «Also, was verlangen du?»
Und Vielolog sagt: «Von jedem Wort, das mit zwei Konsonanten anfängt, verlange ich den ersten Konsonanten. Das ist ja nicht viel.»
Schon am nächsten Tag begreift Paul, worauf er sich diesmal eingelassen hat.
Mutter trägt ihm beim Frühstück auf, nach der Schule einkaufen zu gehen. Paul soll zehn Schrippen, vier Bratwürste, eine Tüte Hafer-Flocken und eine Tüte Graupen kaufen. Außerdem braucht Mutter ein Tütchen Staubzucker, weil sie Plätzchen backen will. «Soll ich’s dir aufschreiben», fragt Mutter, «oder merkst du’s dir?»
Paul sagt: «Nicht aufschreiben.»
Nach der Schule geht Paul in den kleinen Lebensmittelladen an der Ecke.
Die Verkäuferin fragt: «Was möchtest du, Paul?»
Paul schnurrt Mutters Bestellung herunter:
«Zehn Rippen, vier Ratwürste, eine Tüte Hafer-Locken und eine Tüte Raupen. Und ein Tütchen Taubzucker, Mutter wollen Lätzchen backen.»
Die Verkäuferin, die von Paul gehört hat, sagt ernst: «Tut mir leid, Paul, das haben wir nicht. Versuch’s doch mal woanders.»
Paul stolpert verwirrt aus dem Laden. Den ganzen Nachmittag läuft er durch die Stadt. Er will schon umkehren, als er endlich Vielolog aus einem Haus kommen sieht. Vielolog trägt in der Linken seinen Regenschirm, in der Rechten trägt er seinen Holzkoffer.
«Vielolog!» ruft Paul.
Vielolog dreht sich um und wartet.
Atemlos bleibt Paul vor Vielolog stehen und sagt so schnell er kann: «Ich wollen alles wiederhaben!»
Aber Vielolog lacht Paul einfach aus. «Da kann ja jeder kommen», sagt er. «Wir haben ein ehrliches Geschäft gemacht, und damit basta. Oder habe ich etwa nicht deine Hausaufgaben erledigt?» Paul ist verzweifelt.
«Ich geben dir meine Indianer, Autos und Lugzeuge. Und meinen Fußball!» sagt Paul.
Vielolog lacht einfach. «So was sammle ich nicht», sagt er. «Aber ich habe eine Idee.»
Er öffnet seinen Koffer und holt ein Blatt Papier heraus. «Du kriegst alles von mir zurück», sagt er, «wenn du herausfindest, was auf diesem Blatt fehlt. Ich gebe dir einen Tag Zeit. Wir treffen uns hier.» Paul reißt Vielolog das Blatt aus der Hand und rennt nach Hause. Mutter ist sehr ärgerlich, weil Paul nichts eingekauft hat. Jetzt muß Mutter selbst einkaufen gehen, obwohl sie von der Arbeit müde ist. Paul verschwindet in seinem Zimmer und liest das Blatt von Vielolog. Auf dem Blatt steht:
Vielolog, der unterdessen nach Hause gegangen ist, hopst um seinen Tisch, wirft kleine Holzkästchen in die Höhe und singt:
«Faulpaul,
paulfaul,
kann nur auf zwei Beinen stehen,
aber denkt, aber denkt,
wird wohl auch mit einem gehen,
hat das andre mir geschenkt.
Was ich krieg, das hat er nicht,
was ich hab, das kriegt er nicht.»
Vor lauter Schadenfreude kriegt Vielolog einen dunkelroten Kopf.
Er muß nach Luft schnappen, setzt sich auf seinen Holzkoffer und japst: «Kriegt er nicht, kriegt er nicht!»
Paul kann die halbe Nacht nicht schlafen. Am nächsten Tag bittet er Bruno um Hilfe.
Sie treffen sich nach der Schule bei Paul, und Paul weiht Bruno in das Geheimnis ein.
«Mensch, Paul», sagt Bruno, «du warst aber leichtsinnig.»
«Wissen ich ja», sagt Paul, «was sollen ich denn jetzt tun?»
«Du mußt alles, was du Vielolog gegeben hast, von neuem lernen», antwortet Bruno.
«Und wie?» fragt Paul.
«Du schlägst in deiner Grammatik nach und im Wörterbuch. Und wenn du nicht weiterkommst, helf ich dir.»
Gesagt, getan.
Paul schlägt seine Grammatik auf und findet heraus, daß es heißen muß: ‹Es gibt einen Mann …›
Er probiert vor dem ‹r› in ‹roße› alle Konsonanten aus und kommt darauf, daß ein ‹g› fehlt: ‹große›.
«Ich haben es!» sagt er. «Satz heißen: ‹Es gibt einen Mann große Ohren›. Stimmen das, Bruno?»
«Nein», sagt Bruno, «da fehlt noch was.»
Wieder sieht Paul in seiner Grammatik nach und sagt: «‹Es gibt einen Mann mit große Ohren.› Nein, ‹… mit großen Ohren.›»
«Stimmt!» ruft Bruno.
Satz für Satz kommt Paul der Sache auf die Spur. Manchmal muß Bruno nachhelfen. Auch für Bruno ist es gar nicht einfach. Aber leichter ist es für ihn doch, weil er alles im Kopf hat.
Paul dagegen muß immer erst in der Grammatik oder im Wörterbuch nachsehen.
Am Ende ist das Blatt über und über bekritzelt. Paul hat mit einem blauen Filzstift geschrieben, und das Blatt sieht so aus:
Ach, den Rest will Paul gar nicht mehr sehen. Es ist spät geworden. Paul steckt das Blatt in die Tasche.
Bruno begleitet ihn bis zur verabredeten Straßenecke.
Vielolog ist schon da.
Paul hält ihm das Blatt vor die Nase, und Vielolog läßt vor Ärger seinen Holzkoffer fallen.
«Also gut», brummt er.
Umständlich kramt er in seinem Koffer, holt vier Kästchen hervor, öffnet sie und schüttet sie aus.
«Da!» krächzt er.
Paul sagt: «Von mir kriegst du nie mehr auch nur die kleinste Silbe!» Er dreht sich um und läuft mit Bruno davon.
Vielolog hört nur noch, wie Paul ruft:
«Vielolog! Du Sprachabschneider!»
Lust auf Gottes Mühle
Wenn die Rede ist von einer Gestalt, welche bekannt ist aus mehreren Geschichten, darunter der Geschichte von Kirchen, Bewegungen, Sonnenstaaten, größerer Anschaulichkeit wegen genannt G., Mann oder Frau, –
G. ist, von Jugend auf, hingegeben an, überzeugt von, verschworen mit (weder nüchterne noch erhebende Wortwahl kann Achtbarkeit in Zweifel ziehen).
Verschworene Hingebung, hingegebene Überzeugtheit etc. bringe, zunächst, hervor eifrige oder eifernde Tat, eingeschlossen zuversichtliche Unduldsamkeit, welche, in leichtem Fall, des Wortes sich bedient (später folge kleine, jedoch unnachgiebige Gelassenheit).
Die innewohnende Neigung, dem Tum, als der Lehre, in reiner Strenge nachzufolgen, verleitet G. zur Blindheit für wiederkehrendes Mißverhältnis: zwischen Idee und irdischer Schaffung. In dunklem Anspruch, das Höchste zu gewinnen bereits für Montag, Dienstag, stoße G. auf das Wirkliche, verwickle sich trotz warnenden Fingerzeigs oder kumpanischer Ermahnung, beharre, widerstehe (außer Glaubenswissenshärte tue Wirkung, daß Umstehende herblicken, ferner: Stolz), und äußere, besten Vermögens, Irr-Tum.
Die Geschichtemacher, Lenker des Verwirklichten, denen G. nah verbunden im Wissenglauben, wissen aber, da sie, Überblicks halber, höherstehen, besser als G., ob Lehre und Erde verträglich.
Nicht erbittlich wie gegen Schmäher und Hasser muß, der Reinheit zunutze, verfahren werden gegen solches, das an Werdung sich stößt, gegen G. Als Strafe soll gelten, daß waltender Brüderundschwesternbund, mit welchem G. Hirn, Herz, Atmung teilt, von sich abtrenne den Bessermacher.