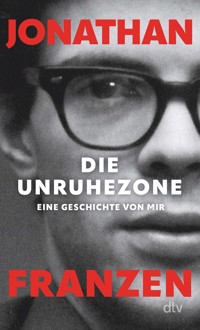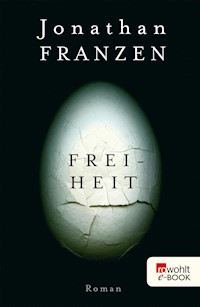10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Sind gute Bücher noch von Belang? Dieses Buch ist es.« TIME Virtuos und pointiert setzt sich Jonathan Franzen mit dem Geist seiner Zeit auseinander und offenbart ganz persönliche Erfahrungen: In fünfzehn Essays ergründet er »die Schwierigkeit, in einer lärmenden und zerstreuenden Massenkultur Individualität und Vielschichtigkeit zu bewahren: die Frage, wie Alleinsein geht«. Gegen eine medial beschleunigte Welt und von Ideologien gefärbte Wahrnehmung setzt er die kreative Abgeschiedenheit, den genauen Blick, das Lesen. Entstanden ist eine Sammlung seiner Gedanken zu vielfältigen Themen, sei es die Alzheimer-Erkrankung seines Vaters, die Liebe zu alten Dingen oder das amerikanische Postwesen. Vor allem aber stellt er Überlegungen zum Schreiben an – poetologische Herzstücke des Bandes sind sein berühmter Harper's-Essay und der Aufsatz über William Gaddis alias »Mr. Schwierig«.. Nach wie vor erhellend und aktuell. »Diese Sammlung unterstreicht seine Eleganz, seinen Scharfsinn und seine Kühnheit als Essayist, außerdem die wache, kluge Art der Selbstwahrnehmung, die ähnlich beeindruckend und gewinnend ist wie die von Joan Didion.« Jane Maslin, The New York Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Virtuos und pointiert setzt sich Jonathan Franzen mit dem Geist seiner Zeit auseinander und offenbart ganz persönliche Erfahrungen: In fünfzehn Essays ergründet er »die Schwierigkeit, in einer lärmenden und zerstreuenden Massenkultur Individualität und Vielschichtigkeit zu bewahren: die Frage, wie Alleinsein geht«. Gegen eine medial beschleunigte Welt und eine von Ideologien gefärbte Wahrnehmung setzt er die kreative Abgeschiedenheit, den genauen Blick, das Lesen. Entstanden ist eine Sammlung seiner Gedanken zu vielfältigen Themen, sei es die Alz heimer-Erkrankung seines Vaters, die Liebe zu alten Dingen oder das amerikanische Postwesen. Vor allem aber stellt er Überlegungen zum Schreiben an – poetologische Herzstücke des Bandes sind sein berühmter Harper’s-Essay und der Aufsatz über William Gaddis alias »Mr. Schwierig«. Nach wie vor erhellend und aktuell.
Von Jonathan Franzen ist bei dtv außerdem lieferbar:
Freiheit
Jonathan Franzen
Anleitung zum Alleinsein
Essays
Aus dem Englischen von Eike Schönfeld
Für Kathy Chetkovich
Ein Wort zu diesem Buch
Mein dritter Roman, Die Korrekturen, an dem ich viele Jahre gearbeitet hatte, erschien eine Woche vor dem Einsturz des World Trade Center. Es war eine Zeit, in der es so aussah, als müssten die Stimmen von Ego und Handel verstummen – eine Zeit, in der man sich, um mit Nick Carraway im Großen Gatsby zu sprechen, «die Welt auf immer uniformiert und in einer Art moralischer Habtachtstellung» wünschte. Doch Geschäft ist Geschäft. Binnen achtundvierzig Stunden nach der Katastrophe gab ich schon wieder Interviews.
Meine Befrager interessierten sich besonders für das, was sie den «Harper’s-Essay» nannten. (Niemand benutzte den eigentlichen Titel Perchance to Dream, «Vielleicht ein Traum», den man ihm bei der Zeitschrift gegeben hatte.) Ein typisches Interview begann mit der Frage: «1996 kündigten Sie in Ihrem Harper’s-Essay an, Ihr drittes Buch werde ein großer Gesellschaftsroman sein, der den kulturellen Mainstream aufs Korn nimmt und der amerikanischen Literatur neue Impulse gibt; glauben Sie, mit den Korrekturen haben Sie das eingelöst?» Einem Befrager nach dem anderen erklärte ich, nein, ganz im Gegenteil, meinen dritten Roman hätte ich in dem Essay kaum erwähnt, die «Ankündigung» sei von einem Redakteur oder Überschriftenmacher der Sonntagsbeilage der Times frei erfunden worden, und weit davon entfernt, das Entstehen eines großen Gesellschaftsromans anzukündigen, der zum Mainstream Neues beizutragen habe, hätte ich den Essay vielmehr als eine Gelegenheit begriffen, ebenjener Art von Ehrgeiz abzuschwören. Da die meisten Interviewer den Essay gar nicht gelesen hatten und die wenigen, die ihn doch gelesen hatten, ihn missverstanden zu haben schienen, bekam ich einige Übung darin, seinen Inhalt klar und knapp zu formulieren; im November, nach meinem hundertsten oder hundertzehnten Interview, hatte ich mir eine hübsche kleine Korrekturformel zurechtgelegt, die folgendermaßen anfing: «Nein, eigentlich drehte sich der Harper’s-Essay darum, dass ich mein Selbstverständnis als Schriftsteller, der gesellschaftliche Verantwortung trägt, aufgebe und lerne, aus Spaß und zur Unterhaltung zu schreiben …» Ich war irritiert und mehr als nur ein wenig gekränkt, dass anscheinend niemand in der Lage war, diesen schlichten, klaren Gedanken aus dem Text herauszulesen. Wie vorsätzlich dumm, so dachte ich, doch diese Medienleute waren!
Im Dezember beschloss ich dann, eine Sammlung Essays zusammenzustellen, die den vollständigen Text von Perchance to Dream enthalten und deutlich machen sollte, was ich darin gesagt hatte und was nicht. Doch als ich das Harper’s-Heft vom April 1996 aufschlug, stieß ich auf einen offensichtlich von mir verfassten Essay, der mit einer achthundert Zeilen langen Klage von solch quälender Schärfe und dürftiger Logik begann, dass nicht einmal ich ganz mitkam. In den fünf Jahren, seit ich den Essay geschrieben hatte, hatte ich doch tatsächlich vergessen, dass ich ein sehr zorniger und theorielastiger Mensch gewesen war. Ich war von apokalyptischer Sorge darüber erfüllt, dass die Amerikaner viel fernsehen und wenig Henry James lesen. Ich war wie ein religiöser Fundamentalist, der sich einredet, dass der Welt, weil sie nicht seinen Glauben teilt (in meinem Fall den Glauben an die Literatur), zwangsläufig das Ende bevorsteht. Ich hielt unsere amerikanische Volkswirtschaft für ein einziges Komplott mit dem besonderen Ziel, meine künstlerischen Ambitionen zu hintertreiben, alles, was ich an der Zivilisation schön fand, auszumerzen und dabei auch den Planeten zu drangsalieren und zu zerstören. Von dieser zornigen und verzweifelten Warte aus war das erste Drittel meines Essays geschrieben, und zwar in einem Ton hochtheoretischen Grolls, der mich jetzt ein wenig schaudern ließ.
Keine Frage, schon 1996 wollte ich mit dem Essay den Ausbruch eines feststeckenden Schriftstellers aus dem Gefängnis seiner zornigen Gedanken dokumentieren. Weswegen ein Teil von mir auch dazu neigt, das Stück genau so wieder abzudrucken, wie es damals erschienen war, als Beleg meines früheren Fanatismus. Allerdings nehme ich an, dass die meisten Leser ein begrenztes Verlangen nach Verkündigungen haben wie:
Wenn ich den tonangebenden Kreisen von Wirtschaft und Regierung glaubte, so schien es mir, dass kein einziger der Ansicht wäre, dass Bücher eine Zukunft haben, hätten wir Washington und die Wall Street nicht in der Raserei erlebt, eine halbe Billion Dollar für eine Datenautobahn bereitzustellen, deren Befürworter im Hinblick auf die Verheerungen, die das beim Lesen anrichten würde («Sie müssen sich eben daran gewöhnen, am Bildschirm zu lesen»), Lippenbekenntnisse ablegten, ihre Gleichgültigkeit dem gegenüber aber nicht verbergen konnten.
Da schon ein bisschen davon tief blicken lässt, habe ich meine schriftstellerische Freiheit genutzt, den Essay um ein Viertel zu kürzen und ihn gründlich zu überarbeiten. (Auch habe ich ihn in «Wozu der Aufwand?» umbenannt.) Obwohl er noch immer sehr lang ist, hoffe ich, dass die Lektüre jetzt weniger strapaziös und die Argumentation schlüssiger ist. Zumindest möchte ich darauf zeigen und sagen können: «Sehen Sie, die These ist doch wirklich ganz klar und einfach, genau wie ich es gesagt habe!»
Was für den Harper’s-Essay gilt, gilt für die vorliegende Sammlung als Ganzes. Ich möchte, dass dieses Buch in Teilen das Dokument einer Entwicklung ist: von einer zornigen und angstbestimmten Isolation hin zur Akzeptanz – gar dem Lobpreis – dessen, sowohl ein Lesender als auch ein Schreibender zu sein. Nicht dass es nicht noch vieles gäbe, das einen wütend und ängstlich machen könnte. Der Durst unserer Nation nach Öl, der uns schon zwei Präsidenten namens Bush und einen hässlichen Golfkrieg beschert hat, droht, uns in einen Langzeitkonflikt im Mittleren Osten zu verwickeln, dessen Ausgang ungewiss ist. Obwohl man es nicht für möglich gehalten hätte, scheinen die Amerikaner ihrer Regierung noch unkritischer gegenüberzustehen als 1991, und die Verlautbarungen der führenden Medien sind in ihrem Chauvinismus sogar noch monolithischer geworden. Während der Kongress erneut gegen die Einführung leicht umzusetzender Normen zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs von Geländewagen plädiert, kann man den Vorstandsvorsitzenden der Firma Ford in Fernsehspots ebendiese Fahrzeuge patriotisch verteidigen sehen, wobei er erklärt, die Amerikaner dürften niemals «irgendwelche Grenzen» akzeptieren.
Angesichts so vieler Ungeheuerlichkeiten Tag für Tag habe ich mich bei den anderen Essays in dem Buch auf minimales Feilen beschränkt. «Die erste Stadt» liest sich ohne das World Trade Center ein wenig anders, «Riesenschlafzimmer» entstand, bevor John Ashcroft mit seiner offenkundigen Gleichgültigkeit gegenüber Persönlichkeitsrechten Justizminister wurde, die Aufregung um Milzbranderreger hat die Nöte mit der amerikanischen Post, beschrieben in «Auf dem Postweg verloren», weiter verschärft, und dass Oprah Winfrey mich aus ihrer Büchersendung ausgeladen hat, verleiht dem anschaulichen Wort «elitär» überall dort, wo es auftaucht, neuen Glanz. Die diversen Einzelaspekte sind für mich jedoch von geringerer Bedeutung als das all diesen Essays zugrunde liegende Thema: die Schwierigkeit, in einer lärmenden und zerstreuenden Massenkultur Individualität und Vielschichtigkeit zu bewahren: die Frage, wie Alleinsein geht.
(2002)
Das Gehirn meines Vaters
Eine Erinnerung. An einem trüben Vormittag im Februar 1996 bekam ich von meiner in St. Louis lebenden Mutter mit der Post ein Valentinspäckchen, das eine kitschig pinkfarbene Grußkarte, zwei 100-Gramm-Schokoladenriegel Mr. Goodbars, ein hohles rotes Filigranherz an einer Fadenschlinge und eine Kopie des neuropathologischen Berichts der Gehirnautopsie meines Vaters enthielt.
Ich erinnere mich noch an das hellgraue Winterlicht jenes Vormittags. Ich erinnere mich, wie ich die Süßigkeiten, die Karte und das Zierherz im Wohnzimmer liegenließ und mit dem Autopsiebericht ins Schlafzimmer ging, mich dort hinsetzte und ihn las. Das Gehirn (so begann er) wog 1255 g und wies eine parasagittale Atrophie mit Erweiterung der Sulci auf. Ich erinnere mich, wie ich Gramm in Pfunde und Pfunde in die vertrauten vakuumverpackten Äquivalente in einer Supermarktfleischtruhe umrechnete. Ich erinnere mich, dass ich, statt weiterzulesen, den Bericht zurück in den Umschlag schob.
Einige Jahre vor seinem Tod hatte mein Vater an einer von der Washington University gesponserten Studie über Gedächtnis und Altern teilgenommen, und eine der Vergütungen für die Teilnehmer bestand in einer kostenlosen Gehirnautopsie nach dem Tod. Vermutlich wurden weitere Vergütungen in Form von Gesundheitschecks und Behandlungen gewährt, die meine Mutter, die Gratisgaben aller Art liebte, veranlasst hatten, meinen Vater zu drängen, sich dafür zur Verfügung zu stellen. Wahrscheinlich war Sparsamkeit auch ihr einziger bewusster Beweggrund, den Autopsiebericht meinem Valentinspäckchen beizufügen. So sparte sie zweiunddreißig Cent Porto.
Meine klarsten Erinnerungen an jenen Vormittag im Februar sind visuell und räumlich: die gelben Mr. Goodbars, mein Gang vom Wohn- ins Schlafzimmer, das Spätvormittagslicht einer Jahreszeit, die von der Wintersonnenwende ebenso weit entfernt war wie vom Frühling. Ich weiß allerdings, dass man selbst solchen Erinnerungen nicht trauen darf. Den neuesten Theorien zufolge, die auf einer Unmenge neurologischer und psychologischer Forschungen der vergangenen Jahrzehnte basieren, ist das Gehirn kein Album, in dem Erinnerungen jede für sich wie unveränderliche Fotos aufbewahrt werden. Eine Erinnerung ist vielmehr, mit den Worten des Psychologen Daniel L. Schachter, eine «temporäre Konstellation» von Aktivität – eine zwangsläufig ungefähre Erregung neuraler Kreisläufe, die eine Reihe sensorischer Bilder und semantischer Daten in die flüchtige Empfindung eines erinnerten Ganzen einbinden. Diese Bilder und Daten sind nur selten das ausschließliche Merkmal einer bestimmten Erinnerung. Ja noch während jenes Valentinsvormittags griff mein Gehirn auf schon vorhandene Kategorien von «rot» und «Herz» und «Mr. Goodbar» zurück; der graue Himmel in meinen Fenstern war mir von tausend anderen Wintervormittagen vertraut, und Millionen meiner Neuronen widmeten sich schon einem Bild meiner Mutter – ihrer Knickerigkeit beim Frankieren, ihrer romantischen Zuneigung zu ihren Kindern, ihres schwelenden Zorns auf meinen Vater, ihres eigenartigen Mangels an Takt und so weiter. Meine Erinnerung an jenen Vormittag besteht daher, entsprechend den jüngsten Modellen, aus einer Reihe fest installierter Nervenverbindungen zwischen den maßgeblichen Bereichen des Gehirns sowie einer Prädisposition der gesamten Konstellation, sofort – chemisch, elektrisch – aufzuleuchten, wenn ein Teil des Kreislaufs stimuliert wird. Man sage «Mr. Goodbar» und bitte mich, frei zu assoziieren, und mir wird, wenn nicht «Diane Keaton», so doch bestimmt «Gehirnautopsie» einfallen.
Derart würde meine Valentinserinnerung funktionieren, selbst wenn ich sie jetzt zum allerersten Mal hervorkramte. Tatsache ist aber, dass ich mich an jenen Vormittag im Februar seither unzählige Male erinnert habe. Ich habe die Geschichte meinen Brüdern erzählt. Ich habe sie als «unerhörten Muttervorfall» Freunden vorgetragen, die derlei Dinge immer gerne hören. Ich habe sie, zu meiner Schande muss ich das gestehen, sogar Leuten erzählt, die ich kaum kenne. Jedes neuerliche Erinnern und Wiedererzählen festigt die Konstellation von Bildern und Wissen, aus denen die Erinnerung besteht, ein Stückchen mehr. Auf der Zellebene brenne ich, Neurowissenschaftlern zufolge, die Erinnerung jedes Mal ein wenig tiefer ein, verstärke die dendritischen Verbindungen zwischen ihren Bestandteilen, fördere das Aufflammen jener spezifischen Synapsengruppen. Eine der großen Anpassungsleistungen unseres Gehirns, die Eigenschaft, die unsere graue Masse so viel schlauer als jede bislang entwickelte Maschine macht (die vollgestopfte Festplatte meines Laptops oder ein World Wide Web, das sich beharrlich und ausgesprochen detailliert an eine «Beverly Hills 90210»-Fanseite erinnert, die zuletzt am 20. 11. 98 aktualisiert wurde), ist unsere Fähigkeit, nahezu alles zu vergessen, was uns je widerfahren ist. Ich speichere allgemeine, weitgehend kategoriale Erinnerungen an die Vergangenheit (ein Jahr in Spanien, diverse Besuche indischer Restaurants in der East Sixth Street), aber relativ wenige konkrete Episoden. Jene Erinnerungen aber, die ich speichere, rufe ich immer wieder ab und festige sie dadurch. Sie werden buchstäblich – morphologisch, elektrochemisch – Teil der Architektur meines Gehirns.
Das Erinnerungsmodell, das ich hier in einer recht freien und laienhaften Zusammenfassung dargestellt habe, reizt den Hobbywissenschaftler in mir. Es scheint gut zu der verwandten Verschwommenheit und Fülle meiner eigenen Erinnerungen zu passen, und das Bild neuraler Netzwerke, die sich in ungeheurer Parallelität mühelos selbst koordinieren, um mein gespenstisches Bewusstsein und mein erstaunlich robustes Ichgefühl zu schaffen, flößt mir Respekt ein. Ich finde es schön und postmodern. Das menschliche Gehirn ist ein Netz aus hundert Milliarden Neuronen, vielleicht sogar zweihundert, mit Billionen Axonen und Dendriten, die vermöge wenigstens fünfzig verschiedener chemischer Transmitter Quadrillionen von Botschaften austauschen. Das Organ, mit dem wir das Universum sehen und ihm einen Sinn geben, ist mit komfortablem Vorsprung der komplexeste Gegenstand, den wir in diesem Universum kennen.
Und dennoch ist es auch ein Klumpen Fleisch. Irgendwann, vielleicht noch an jenem Valentinstag, zwang ich mich dazu, den gesamten pathologischen Bericht zu lesen. Er beinhaltete auch eine «Mikroskopische Beschreibung» des Gehirns meines Vaters:
Teile der frontalen, parietalen, okzipitalen und temporalen Großhirnrinde wiesen vielerorts senile Plaques von vorherrschend diffusem Typus auf, dazu eine minimale Anzahl neurofibrillärer Knäuel. Im HE-gefärbten Gewebe fanden sich zahlreiche Lewy-Bodys. Die Amygdala wies Plaques, vereinzelte Fibrillen und eine leichte Minderung der Neuronendichte auf.
In der Todesanzeige, die wir neun Monate zuvor in den Lokalzeitungen aufgegeben hatten, schrieben wir auf Drängen meiner Mutter, mein Vater sei «nach langer Krankheit» gestorben. An der Wendung mochte sie das Förmliche und Verhaltene, doch es fiel schwer, nicht auch ihren Groll herauszuhören, die Betonung auf lang. Dass der Pathologe im Gehirn meines Vaters senile Plaques entdeckt hatte, bestätigte, wie es nur eine Autopsie vermochte, einen Umstand, mit dem sie sich viele Jahre lang tagtäglich gequält hatte: Wie Millionen anderer Amerikaner hatte mein Vater Alzheimer.
Das war seine Krankheit. Es war, könnte man sagen, auch seine Geschichte. Aber Sie müssen sie mich schon erzählen lassen.
Alzheimer ist eine Krankheit mit einem klassischen «heimtückischen Ausbruch». Da auch Gesunde mit zunehmendem Alter vergesslicher werden, ist es unmöglich, die erste Erinnerung zu bestimmen, die ihr zum Opfer fällt. Im Falle meines Vaters war das Problem besonders leidig, da er nicht nur depressiv und reserviert und ein wenig taub war, sondern auch starke Medikamente gegen andere Beschwerden nahm. Lange Zeit konnte man seine unlogischen Antworten seiner Hörschwäche, seine Vergesslichkeit seinen Depressionen, seine Halluzinationen seinen Medikamenten ankreiden; und das taten wir ja auch.
Meine Erinnerungen an die Jahre des beginnenden Niedergangs meines Vaters kreisen lebhaft um alles Mögliche, nur nicht um ihn. Ich bin sogar einigermaßen entsetzt darüber, wie viel ich selbst darin vorkomme und wie wenig meine Eltern. Doch in jenen Jahren lebte ich weit weg von zu Hause. Meine Informationen stammten im Wesentlichen aus den Klagen meiner Mutter über meinen Vater, und diese Klagen hörte ich mir mit einem gewissen Vorbehalt an; praktisch mein ganzes Leben lang hatte sie sich bei mir beklagt.
Die Ehe meiner Eltern war, so viel kann ich wohl sagen, alles andere als glücklich. Sie blieben wegen ihrer Kinder zusammen und mangels Hoffnung, dass eine Scheidung sie glücklicher werden ließe. Solange mein Vater arbeitete, regierten sie in ihren jeweiligen Reichen Haushalt und Beruf weitgehend autonom, doch nachdem er 1981, mit sechsundsechzig Jahren, pensioniert wurde, inszenierten sie in ihrem behaglich eingerichteten Vorstadtheim eine Endlosaufführung von Geschlossene Gesellschaft.
Meine Kurzbesuche glichen Einsätzen einer Friedenstruppe der UN, der sie beide leidenschaftlich ihre Argumente gegeneinander vortrugen.
Anders als meine Mutter, die in ihrem Leben nahezu dreißigmal im Krankenhaus gewesen war, erfreute sich mein Vater bis zu seiner Pensionierung bester Gesundheit. Seine Eltern und Onkel waren achtzig, neunzig Jahre alt geworden, und er, Earl Franzen, hatte die Erwartung, mit neunzig auf jeden Fall noch da zu sein, «um mitzukriegen», wie er gern sagte, «was noch alles wird». (Sein anagrammatischer Namensvetter Lear stellte sich seine letzten Jahre ganz ähnlich vor: mit Cordelia «vom Hofe plaudern», um mitzukriegen, «wer da gewinnt, verliert, wer in, wer aus der Gunst» ist.) Mein Vater hatte keine Hobbys und abgesehen vom Essen, den Besuchen seiner Kinder und Bridgepartien wenig, was ihm Freude bereitete; allerdings hatte er am Leben ein episches Interesse. Er sah eine gewaltige Menge Nachrichten im Fernsehen. Es war sein Bestreben, im Alter die sich entwickelnden Geschicke der Nation wie auch seiner Kinder zu verfolgen, solange er nur konnte.
Das Passive dieses Bestrebens und die Gleichheit seiner Tage trugen dazu bei, ihn für mich unsichtbar zu machen. Von den ersten Jahren seines geistigen Verfalls kann ich nur eine einzige Erinnerung abrufen: wie er sich einmal, am Ende der Achtziger, daran abmühte und letztlich scheiterte, bei einer Restaurantrechnung die Höhe des Trinkgeldes zu berechnen.
Zum Glück war meine Mutter eine eifrige Briefeschreiberin. Die Passivität meines Vaters, die ich bedauerlich fand, mich aber nicht weiter kümmerte, war für sie eine Quelle bitterer Enttäuschung. Bis zum Herbst 1989 – einer Zeit, in der mein Vater ihren Briefen zufolge noch Golf spielte und größere Reparaturen am Haus erledigte – waren ihre Klagen rein persönlicher Natur:
Es ist äußerst schwierig, mit einem sehr unglücklichen Menschen zusammenzuleben, wenn man weiß, dass man die Hauptursache dieses Unglücks ist. Schon vor Jahrzehnten, als Dad zu mir sagte, er glaubt nicht an so etwas wie Liebe (dass Sex eine «Falle» ist) und dass er nicht dazu taugt, ein «glücklicher» Mensch zu sein, hätte ich so klug sein müssen zu erkennen, dass keine Hoffnung auf eine Beziehung bestand, die mich erfüllen würde. Aber ich war sehr beschäftigt & mit meinen Kindern und Freundinnen zugange, die ich ja liebte, und vermutlich habe ich mir wie Scarlett O’Hara gesagt, das soll «morgen meine Sorge sein».
Dieser Brief stammt aus einer Periode, in der sich der Schauplatz der elterlichen Kampfhandlungen auf das Thema seiner Hörschwäche verlagert hatte. Meine Mutter behauptete, es sei rücksichtslos, kein Hörgerät zu tragen; mein Vater beschwerte sich darüber, dass es anderen Leuten an der Rücksicht mangele, «lauter» zu sprechen. Die Schlacht endete mit einem Pyrrhussieg, da er sich ein Hörgerät kaufte, das er dann aber nicht tragen wollte. Auch diesmal baute meine Mutter daraus eine moraltriefende Geschichte über seine «Sturheit» und «Eitelkeit» und seinen «Defätismus», doch rückblickend fällt es schwer, nicht zu argwöhnen, dass er sein schlechtes Gehör schon damals benutzte, um ernstere Schwierigkeiten zu kaschieren.
In einem Brief vom Januar 1990 nimmt meine Mutter erstmals auf diese Schwierigkeiten Bezug:
Letzte Woche konnte er einmal seine Morgenmedikamente nicht nehmen, weil er ein paar Verkehrstauglichkeitsprüfungen an der Wash. U. machen sollte, wo er an der Gedächtnis-&-Altern-Studie teilnimmt. In der folgenden Nacht wachte ich vom Geräusch seines Elektrorasierers auf, sah auf den Wecker & da stand er morgens um halb drei im Bad und rasierte sich.
Binnen weniger Monate unterliefen meinem Vater dann schon so viele Fehler, dass meine Mutter gezwungen war, andere Erklärungen zu bemühen:
Entweder ist er überanstrengt oder unkonzentriert, oder es sind irgendwelche geistigen Aussetzer, aber in letzter Zeit hat es immer wieder Vorfälle gegeben, die mir richtig Sorgen machen. Ständig lässt er die Autotür offen oder die Scheinwerfer an & zweimal in einer Woche mussten wir den Autoclub rufen & die Batterie aufladen lassen (ich habe in der Garage jetzt Zettel angebracht & das scheint geholfen zu haben) … Ich würde ihn nicht gern länger als eine kleine Weile allein im Haus lassen.
Die Angst meiner Mutter, ihn allein zu lassen, nahm im Lauf des Jahres an Heftigkeit zu. Ihr rechtes Knie war kaputt, und weil sie von einem früheren Bruch schon eine Stahlplatte im Bein hatte, stand ihr eine komplizierte Operation mit anschließender längerer Genesungsphase und Reha bevor. Ihre Briefe von Ende 1990 bis Anfang 1991 sind voller Passagen, in denen sie sich verzweifelt den Kopf zermartert, ob sie sich nun operieren lassen solle und, wenn ja, was sie dann mit meinem Vater machen werde.
Wäre er länger als eine Nacht allein zu Hause und ich in der Klinik, ich wäre ein einziges Nervenbündel, weil er das Wasser laufen lässt, manchmal den Herd nicht ausstellt, überall brennt Licht usw. … In letzter Zeit kontrolliere ich alles, so gut ich eben kann, aber auch so herrscht bei uns ein einziges Durcheinander & wirklich am schwersten ist sein Ärger darüber, dass ich dazwischenfunke – «halt dich aus meinen Sachen raus!!!». Er akzeptiert oder erkennt nicht, dass ich ihm doch helfen will & das ist für mich das Allerschwerste.
Zu der Zeit hatte ich gerade meinen zweiten Roman beendet, also bot ich meiner Mutter an, bei meinem Vater zu bleiben, solange sie ihrer Operation wegen nicht zu Hause war. Um seinen Stolz nicht zu verletzen, vereinbarten sie und ich, so zu tun, als würde ich nicht seinetwegen, sondern ihretwegen kommen. Seltsam war allerdings, dass ich nur halbherzig so tun konnte. Meine Mutter hatte mir die Behinderungen meines Vaters so geschildert, dass es absolut glaubhaft klang, aber dasselbe galt für das Porträt meiner Mutter als nörglerische Unke, wie es mein Vater entwarf. Ich reiste nach St. Louis, weil seine Behinderungen für sie absolut real waren; als ich dann dort war, benahm ich mich, als wären sie das für mich überhaupt nicht.
Ganz wie sie es befürchtet hatte, lag meine Mutter beinahe fünf Wochen im Krankenhaus. Merkwürdigerweise kann ich mich jetzt an kaum eine Besonderheit meines Aufenthalts bei ihm erinnern, obwohl ich mit meinem Vater nie so lange allein gewesen war und es auch nie mehr sein sollte; heute ist mein Eindruck der, dass er vielleicht etwas still war, aber ansonsten ganz normal. Sie mögen nun denken, dass das in direktem Widerspruch zu den früheren Berichten meiner Mutter stand. Und dennoch habe ich keine Erinnerung daran, dass mich dieser Widerspruch gestört hätte. Was ich hingegen habe, ist die Kopie eines Briefs, den ich aus St. Louis an einen Freund schrieb. In dem Brief erwähne ich, dass man die Medikamente meines Vaters angepasst habe, und nun sei alles gut.
Wunschdenken? Ja, in gewissem Maße. Doch eine der Grundeigenschaften des Verstandes ist, dass er aus Bruchstücken unbedingt ein Ganzes machen will. Wir alle haben einen buchstäblich blinden Fleck in unserem Sehfeld, wo der Sehnerv in der Netzhaut endet, doch das Gehirn nimmt stets eine nahtlose Welt um uns herum wahr. Wir erfassen den Teil eines Wortes und hören das ganze. Im Blumenmuster eines Bezugsstoffs erkennen wir ausdrucksvolle Gesichter, unablässig füllen wir Leerstellen aus. In gleicher Weise neigte ich wohl dazu, über das Schweigen und die Absencen meines Vaters hinwegzugehen und ihn als denselben alten, gänzlich ganzen Earl Franzen zu sehen. Ich brauchte ihn weiterhin als Akteur in der Geschichte meiner selbst. In dem Brief an meinen Freund beschreibe ich eine Vormittagsprobe des St. Louis Symphony Orchestra, zu der ich auf Drängen meiner Mutter mit meinem Vater ging, damit ihre Freikarten nicht verfielen. Nach der ersten Hälfte, in der die sehr junge Midori das Violinkonzert von Sibelius nur so herunterfetzte, sprang mein Vater mit erbärmlicher Greisenunruhe von seinem Sitz auf. «So», sagte er, «wir gehen jetzt.» Ich verkniff es mir, ihn zu bitten, noch zu der nachfolgenden Sinfonie von Charles Ives sitzen zu bleiben, aber sein Banausentum, das es für mich war, erboste mich. Auf der Heimfahrt tat er Midori und Sibelius kurz und bündig ab. «Ich verstehe diese Musik nicht», sagte er. «Was machen die denn – lernen die das auswendig?»
Im selben Frühling wurde dann bei meinem Vater eine kleine, langsam wachsende Krebsgeschwulst in der Prostata diagnostiziert. Seine Ärzte empfahlen ihm, sich gar nicht erst behandeln zu lassen, er aber bestand auf einer Strahlentherapie. In einer Art verschobener Einsicht in seinen Geisteszustand bekam er große Angst, dass etwas Schreckliches mit ihm vorging: dass er nun doch nicht über neunzig werden würde. Meine Mutter, die noch ein halbes Jahr nach ihrer Operation innere Blutungen im Knie hatte, brachte für seine, wie sie es nannte, Hypochondrie nicht viel Geduld auf. Im September 1991 schrieb sie:
Ich bin erleichtert, dass Dad jetzt mit seiner Bestrahlung angefangen hat & sie ihn zwingt, jeden Tag [hier ist ein Smiley eingefügt] aus dem Haus zu gehen – ein großes Plus. Er war an einem Punkt angelangt, wo er so nervös,so ängstlich, so depressiv war, dass ich wusste, er musste einfach eine Entscheidung treffen. Da er nämlich so viel herumsitzt (froh darüber, nichts zu tun), hat er zu viel Zeit gehabt, sich über sich Sorgen & Gedanken zu machen – er BRAUCHT Ablenkung! … Mehr & mehr bin ich der Meinung, dass die besten Eigenschaften, die jemand haben kann, 1. eine positive Lebenseinstellung & 2. Sinn für Humor sind – wünschte, Dad hätte sie.
Es folgten einige Monate relativer Zuversicht. Der Krebs war bekämpft, das Knie meiner Mutter wurde endlich besser, und ihr angeborener Optimismus kehrte wieder in ihre Briefe zurück. Sie berichtete, mein Vater habe bei einer Partie Bridge gewonnen: «Jetzt, wo er nicht mehr so zerstreut ist & weniger vorsichtig an das Spiel herangeht, ist er erstaunlich gut & und es ist so ungefähr das Einzige, was ihm Freude macht (& ihn wach bleiben lässt!).» Doch die Sorge meines Vaters um seine Gesundheit legte sich nicht; er hatte Bauchschmerzen, die seiner Überzeugung nach von einem Krebs herrührten. Nach und nach verlagerte sich das Gewicht der Geschichte, die mir meine Mutter erzählte, vom Persönlichen und Moralischen zum Psychiatrischen. «Während des letzten halben Jahrs haben wir so viele Freunde verloren, das ist schon ganz beunruhigend – zum Teil bestimmt wegen Dads Nervosität & Depressionen», schrieb sie im Februar 1992. Der Brief ging weiter:
Dads Internist, Dr. Rouse, hat in Bezug auf die Magenbeschwerden ungefähr das festgestellt (alle klinischen Möglichkeiten hat er ausgeschlossen), was ich schon die ganze Zeit gedacht habe. Dad ist 1. schrecklich nervös, 2. schrecklich depressiv & ich hoffe, Dr. Rouse verschreibt ihm ein Antidepressivum. Ich weiß doch, dass es dagegen etwas geben muss … Im letzten Jahr hat es beunruhigende, bedrückende Dinge in unserem Leben gegeben, das weiß ich sehr wohl, aber Dads Geisteszustand setzt ihm auch körperlich zu & wenn er schon nicht zur psychologischen Beratung geht (Vorschlag von Dr. Weiss), lässt er sich ja vielleicht Pillen geben oder was man eben gegen Nervosität & Depressionen braucht.
Eine Weile war «Nervosität & Depressionen» in ihren Briefen eine feststehende Wendung. Prozac schien meinen Vater aufzumuntern, doch die Wirkung blieb von kurzer Dauer. Schließlich willigte er im Juli 1992 zu meiner Überraschung ein, einen Psychiater aufzusuchen.
Mein Vater war der Psychiatrie gegenüber immer das Misstrauen in Person. Psychotherapie verstand er als einen Eingriff in die Privatsphäre, geistige Gesundheit als eine Frage von Selbstdisziplin und die zunehmend spitzen Vorschläge meiner Mutter, er solle doch einmal «mit jemandem reden», als Akte der Aggression – kleine Handgranaten der Schuldzuweisung, weil sie als Paar so unglücklich waren. Dass er freiwillig einen Fuß in eine Psychiatriepraxis setzte, war Ausdruck seiner Verzweiflung.
Im Oktober, als ich vor meiner Abreise nach Italien noch in St. Louis Station machte, fragte ich ihn nach seinen Besuchen bei dem Arzt. Er machte eine hoffnungslose Geste mit der Hand. «Er ist ungeheuer kompetent», sagte er. «Aber leider hat er mich abgeschrieben.»
Die Vorstellung, dass jemand meinen Vater abgeschrieben hatte, überstieg meine Kräfte. Von Italien aus schickte ich dem Psychiater einen dreiseitigen Appell, es sich noch einmal zu überlegen, doch während ich noch daran schrieb, brach zu Hause alles zusammen. «So ungern ich Dir das mitteile», schrieb meine Mutter in einem Brief, den sie mir nach Italien faxte, «Dads Zustand hat sich dramatisch verschlimmert. Medikamente gegen das Harnproblem, die ihm ein Urologe verschrieben hat, und gleichzeitig Medikamente gegen Depressionen und Nervosität, das hat ihn wieder umgehauen, und die Halluzinationen usw. waren schrecklich.» Sie waren ein Wochenende bei meinem Onkel Erv in Indiana gewesen, wo mein Vater, aus seiner vertrauten Umgebung gerissen, eine Nacht des Wahnsinns entfesselte, die darin kulminierte, dass mein Onkel ihn anbrüllte: «Earl, Herrgott, ich bin dein Bruder Erv, wir haben früher mal in einem Bett geschlafen!» Zurück in St. Louis, hatte mein Vater dann begonnen, gegen die pensionierte Dame zu wettern, Mrs. Pryble, die meine Mutter angestellt hatte, damit sie zwei Tage in der Woche, während sie selbst Besorgungen machte, bei ihm war. Er sah nicht ein, warum jemand bei ihm sein musste, und wenn er die Notwendigkeit dazu dann doch erkannte, sah er nicht ein, warum statt seiner Frau eine Fremde das tat. Er war ein klassischer «Sundowner» geworden, verdöste den Tag und tobte zu nachtschlafender Zeit.
Bald darauf folgte ein trübseliger Feiertagsbesuch, bei dem meine Frau und ich die Sache endlich meiner Mutter aus der Hand nahmen und ihr eine Altenpflegekraft vermittelten, und meine Mutter bekniete meine Frau und mich, meinen Vater so auf Trab zu halten, dass er nachts ohne einen psychotischen Anfall würde durchschlafen können, und mein Vater saß mit versteinerter Miene am Kamin oder erzählte finstere Geschichten aus seiner Kindheit, während meine Mutter sich wegen der Ausgaben, der untragbaren Ausgaben für die Pflegekraft sorgte. Aber soweit ich mich erinnere, redete auch da noch niemand von «Demenz». In allen Briefen, die meine Mutter an mich schrieb, kam das Wort «Alzheimer» genau einmal vor, und da bezog sie es auf eine alte Deutsche, für die ich einmal als Jugendlicher gearbeitet hatte.
Ich erinnere mich an meinen Argwohn und meine Verärgerung vor fünfzehn Jahren, als der Begriff «Alzheimer-Krankheit» allgemein gebräuchlich wurde. Ich sah darin ein weiteres Beispiel für die Pathologisierung des Menschseins, den neuesten Eintrag in die sich unablässig erweiternde Nomenklatur des Opfertums. Auf die Berichte meiner Mutter über meine alte Arbeitgeberin antwortete ich: «Was du da beschreibst, klingt mir ganz nach der Erika, wie sie ohnehin schon war, nur um einiges schlimmer, aber das sind doch noch nicht die Auswirkungen von Alzheimer, oder? Jeden Monat rege ich mich ein paar Minuten darüber auf, dass eine normale Geisteskrankheit modisch und falsch als Alzheimer diagnostiziert wird.»
Von meiner heutigen Warte aus verstehe ich, der ich mich jeden Monat ein paar Minuten darüber aufrege, was für ein selbstgerechter Dreißigjähriger ich mal war, mein Widerstreben, den Begriff «Alzheimer» auf meinen Vater anzuwenden, als Versuch, das Besondere des Earl Franzen vor dem Allgemeinen eines benennbaren Befunds zu schützen. Befunde haben Symptome; Symptome verweisen auf die organische Grundlage von allem, was wir sind. Sie verweisen auf das Gehirn als Klumpen Fleisch. Und wo ich eigentlich akzeptieren sollte, ja, das Gehirn ist ein Klumpen Fleisch, bewahre ich mir offenbar einen blinden Fleck, über den ich dann Geschichten lege, die die seelenartigeren Aspekte des Ichs betonen. Meinen leidenden Vater als Bündel organischer Symptome zu sehen würde mich dazu verleiten, den gesunden Earl Franzen (und mich) ebenfalls in symptomatischen Kategorien zu sehen – unsere geliebte Persönlichkeit auf eine endliche Reihe neurochemischer Koordinaten zu reduzieren. Wer will schon so eine Lebensgeschichte?
Noch jetzt ist mir unwohl, wenn ich Fakten über Alzheimer zusammentrage. Lese ich beispielsweise David Shenks Buch The Forgetting: Alzheimer’s: Portrait of an Epidemic, werde ich daran erinnert, dass mein Vater, wenn er sich in seinem eigenen Viertel verlief oder auf der Toilette zu spülen vergaß, Symptome zeigte, die mit denen Millionen anderer an Alzheimer Erkrankter identisch sind. Es kann etwas Tröstliches haben, in so großer Gesellschaft zu sein, aber ich sehe mit Bedauern, wie bestimmten Irrtümern meines Vaters, etwa seiner Verwechslung meiner Mutter mit ihrer Mutter, die mir damals singulär und mystisch vorkam und aus der ich alle möglichen neuen Erkenntnisse über die Ehe meiner Eltern ableitete, die individuelle Bedeutung abgesprochen wird. Meine Vorstellung von der eigenen Persönlichkeit stellte sich als Illusion heraus.
Senile Demenz gibt es, seitdem Menschen die Mittel haben, sie zu dokumentieren. Solange die durchschnittliche Lebensspanne des Menschen kurz war und hohes Alter vergleichsweise selten, galt Senilität als natürliche Begleiterscheinung des Alterns – vielleicht als Ergebnis von Arteriosklerose im Gehirn. Der junge deutsche Neuropathologe Alois Alzheimer glaubte, Zeuge einer völlig neuen Spielart der Geisteskrankheit zu sein, als er 1901 eine einundfünfzigjährige Frau in seine Klinik aufnahm, Auguste D., die an bizarren Stimmungsschwankungen und schwerem Gedächtnisverlust litt und bei Alzheimers Voruntersuchung problematische Antworten auf seine Fragen gab:
«Wie heißen Sie?»
«Auguste.»
«Familienname?»
«Auguste.»
«Wie heißt Ihr Mann?»
«Ich glaube … Auguste.»
Als Auguste D. vier Jahre später in einer Anstalt starb, bediente sich Alzheimer jüngster Fortschritte in Mikroskopie und Gewebefärbung und erkannte auf Objektträgern mit dem Gehirngewebe die verblüffende duale Pathologie ihrer Krankheit: zahllose klebrig aussehende Klümpchen, die «Plaques», und zahllose Neuronen, die von «Knäueln» aus Neurofibrillen umschlossen waren. Alzheimers Entdeckungen stießen bei seinem Förderer Emil Kraepelin, damals Doyen der deutschen Psychiatrie, der sich mit Sigmund Freud und dessen psycholiterarischen Theorien über die Geisteskrankheit wissenschaftlich aufs heftigste auseinandersetzte, auf großes Interesse. Für Kraepelin lieferten Alzheimers Plaques und Knäuel willkommene klinische Beweise für seine Behauptung, Geisteskrankheit sei im Wesentlichen organisch bedingt. In seinem Standardwerk Psychiatrie nannte er Auguste D. s Leiden Morbus Alzheimer.
Sechzig Jahre nachdem Alois Alzheimer Auguste D. autopsiert hatte, wurde die Alzheimer-Krankheit weiterhin als medizinische Seltenheit ähnlich der Chorea Huntington geführt, obwohl Durchbrüche bei der Krankheitsprävention und -behandlung die Lebenserwartung in den entwickelten Ländern um fünfzehn Jahre verlängerten. David Shenk erzählt die Geschichte einer amerikanischen Neuropathologin namens Meta Naumann, die Anfang der fünfziger Jahre das Gehirn von 210 an seniler Demenz Erkrankten autopsierte und in einigen wenigen sklerotische Arterien, bei der Mehrheit jedoch Plaques und Knäuel fand. Das war der hieb- und stichfeste Beweis, dass Alzheimer weitaus verbreiteter war als bis dahin angenommen; doch Naumanns Arbeit hatte anscheinend niemanden überzeugt. «Sie meinten, Meta redet Unsinn», erinnerte sich ihr Mann.
Wissenschaftliche Kreise waren einfach noch nicht bereit, in Betracht zu ziehen, dass Altersdemenz mehr als nur eine Folge des Alterns sein könnte. Anfang der fünfziger Jahre waren «Senioren» noch keine ihrer selbst bewusste Größe, gab es noch nicht so viele der nun wie Pilze aus dem Boden schießenden Rentnersiedlungen in den warmen Staaten, keine gemeinnützigen Hilfsorganisationen für Menschen über 50, keinen Nachmittagstisch in Billigrestaurants; und diese gesellschaftliche Realität spiegelte sich im wissenschaftlichen Denken wider. Erst in den siebziger Jahren war die Zeit reif für eine Neubewertung der Altersdemenz. Wie Shenk ausführt, «lebten um diese Zeit schon so viele Menschen so lange, dass Senilität nicht mehr als normal oder akzeptabel hingenommen wurde». 1974 verabschiedete der amerikanische Kongress ein Gesetz zur Erforschung des Alterns und gründete das National Institute on Aging, für das bald jede Menge Gelder bereitstanden. Ende der Achtziger dann, auf dem Höhepunkt meiner Verärgerung über den klinischen Begriff und seine jähe Allgegenwart, hatte Alzheimer den gleichen gesellschaftlichen und medizinischen Stellenwert erreicht wie Herzinfarkt oder Krebs – und es gab die entsprechenden Forschungsmittel, um das zu dokumentieren.
Was mit Alzheimer in den siebziger und achtziger Jahren geschah, war nicht bloß ein diagnostischer Paradigmenwechsel. Die Anzahl von Neuerkrankungen ist rapide gestiegen. Da immer weniger Menschen durch einen Herzinfarkt umkommen oder an Infektionen sterben, erreichen mehr und mehr ein hohes Alter und werden dement. Alzheimer-Patienten in Pflegeheimen leben viel länger als andere Patienten, bei jährlichen Kosten von mindestens vierzigtausend Dollar pro Kopf; bis zu ihrer Einweisung bringen sie das Leben der Familienangehörigen, die mit ihrer Pflege betraut sind, zunehmend durcheinander. Schon heute haben fünf Millionen Amerikaner diese Krankheit, bis 2050 könnte die Zahl auf fünfzehn Millionen steigen.
Da mit chronischen Erkrankungen so viel Geld zu machen ist, investieren Pharmaunternehmen fieberhaft in ihre hauseigene Alzheimer-Forschung, während staatlich finanzierte Wissenschaftler Patente nur nebenher anmelden. Doch da das Wesen der Krankheit verborgen bleibt (ein funktionierendes Gehirn ist nicht sehr viel zugänglicher als der Mittelpunkt der Erde oder der Rand des Universums), kann niemand sicher sagen, welche Wege der Forschung zu wirksamen Behandlungen führen werden. Alles in allem scheint unter den Wissenschaftlern der Glaube vorzuherrschen, dass, wer noch unter fünfzig ist, einigermaßen guten Mutes davon ausgehen kann, wirksame Medikamente gegen Alzheimer zu bekommen, wenn er sie eines Tages braucht. Andererseits sagten vor zwanzig Jahren viele Krebsforscher voraus, dass es im Lauf von zwanzig Jahren ein Heilverfahren gegen Krebs geben werde.
David Shenk, der deutlich unter fünfzig ist, vertritt in The Forgetting allerdings den Standpunkt, ein Heilverfahren gegen senile Demenz könnte womöglich kein ungetrübter Segen sein. Beispielsweise schreibt er, eine besondere Auffälligkeit der Krankheit sei, dass die daran «Leidenden» mit fortschreitendem Verlauf oftmals immer weniger litten. Die Pflege eines Alzheimer-Patienten sei gerade deshalb so aufreibend repetitiv, weil der Patient das zerebrale Rüstzeug verloren habe, alles als Wiederholung zu erfahren. Shenk zitiert Patienten, die im Vergessen «etwas Wunderbares» sehen und von einer Steigerung ihrer sinnlichen Wahrnehmung berichten, da sie ein ewiges, vergangenheitsloses Jetzt bewohnen. Ist das Kurzzeitgedächtnis hin, weiß man nicht mehr, wenn man sich zu einer Rose beugt, um an ihr zu riechen, dass man an ebendieser Rose schon den ganzen Vormittag gerochen hat.
Wie der Psychiater Barry Reisberg schon vor zwanzig Jahren beobachtete, spiegelt der geistige Verfall eines Alzheimer-Patienten die neurologische Entwicklung eines Kindes im Rückwärtslauf. Die frühesten Fähigkeiten, die ein Kind ausbildet – den Kopf heben (im ersten bis dritten Monat), lächeln (im zweiten bis vierten Monat), sich ohne Hilfe aufsetzen (im sechsten bis zehnten Monat) –, sind die letzten, die ein Alzheimer-Patient verliert. Die Gehirnentwicklung bei einem heranwachsenden Kind wird durch einen Myelinisation genannten Prozess unterstützt, in dessen Verlauf eine Isolierschicht aus der fettigen Substanz Myelin die Axonverbindungen zwischen den Neuronen zunehmend verstärkt. Da die Regionen des kindlichen Gehirns, die als letzte reifen, die am wenigsten myelinisierten bleiben, sind sie offenbar diejenigen, die durch Alzheimer am leichtesten angegriffen werden. Der Hippokampus, der Kurzzeiterinnerungen zu Langzeiterinnerungen verarbeitet, myelinisiert sehr langsam. Deshalb sind wir nicht in der Lage, vor dem Alter von drei oder vier Jahren dauerhafte episodische Erinnerungen auszubilden, und deshalb finden sich die Alzheimer-Plaques und -Knäuel am Hippokampus zuerst. So erklärt sich die gespenstische Erscheinung der Patientin im mittleren Stadium, die weiterhin gehen und sich ernähren kann, sich aber von einer Stunde auf die andere an nichts erinnert. Das Kind in ihrem Innern ist kein innerliches mehr. Neurologisch betrachtet haben wir es hier mit einer Einjährigen zu tun.
Auch wenn Shenk tapfer versucht, im infantilen Befreitsein des Alzheimer-Patienten von Verantwortung und der kindlichen Konzentration auf das Hier und Jetzt einen Segen zu sehen, weiß ich doch, dass das Letzte, was mein Vater wollte, die Rückverwandlung in ein Baby war. Die Geschichten, die er von seiner Kindheit im Norden Minnesotas erzählte, waren (wie es den Erinnerungen eines Depressiven entspricht) vor allem schrecklich: brutaler Vater, ungerechte Mutter, endlose Hausarbeit, hinterwäldlerische Armut, Vertrauensbrüche in der Familie, schwere Unfälle. Mehr als einmal erzählte er mir nach seiner Pensionierung, die größte Freude in seinem Leben sei es gewesen, als Erwachsener mit anderen Männern zusammenzuarbeiten, die sein Können schätzten. Mein Vater war ein ungemein verschlossener Mensch, und in seinen Augen erfüllte Verschlossenheit den Zweck, das beschämende Innenleben eines Menschen vor den Blicken anderer zu verstecken. Konnte es da für ihn eine schlimmere Krankheit als Alzheimer geben? In den frühen Stadien löste sie die persönlichen Bindungen, die ihn vor den übelsten Konsequenzen seiner depressiven Isolation bewahrt hatten, mehr und mehr auf. In den letzten nahm sie ihm das Panzernde des Erwachsenseins, die Möglichkeiten und Mittel, das Kind in sich zu verbergen. Hätte er doch stattdessen einen Herzinfarkt gehabt.
Mögen Shenks Argumente für die Behauptung, dass Alzheimer etwas Gutes habe, auch wacklig sein, seine Kernthese ist weit schwerer abzutun: Senilität ist nicht nur eine Auslöschung von Sinn, sondern auch eine Quelle von Sinn. Für meine Mutter verstärkten und verkehrten die Verluste durch Alzheimer alte Muster ihrer Ehe. Mein Vater hatte sich immer geweigert, sich ihr zu öffnen, und nun konnte er es in zunehmendem Maße gar nicht mehr. Für meine Mutter blieb er derselbe Earl Franzen, der in seinem Zimmer sein Schläfchen hielt und nichts mitbekam. Paradoxerweise war sie es, die langsam und sicher ihr Ich verlor, indem sie mit einem Mann zusammenlebte, der sie mit ihrer Mutter verwechselte, jede Einzelheit vergaß, die er einmal von ihr gewusst hatte, und schließlich nicht einmal mehr ihren Namen sagte. Er, der immer darauf bestanden hatte, der Tonangebende in der Ehe zu sein, der Bestimmende, der erwachsene Beschützer der kindlichen Frau, er benahm sich jetzt wie das Kind. Jetzt hatte er unziemliche Ausbrüche, nicht mehr meine Mutter. Jetzt lotste sie ihn durch die Stadt, wie sie früher mich und meine Brüder durch die Stadt gelotst hatte. Aufgabe für Aufgabe nahm sie ihrer beider Leben in die Hand. Und auch wenn die «lange Krankheit» meines Vaters für sie eine furchtbare Anstrengung und Enttäuschung war, so bot sie doch die Gelegenheit, langsam in eine Autonomie hineinzuwachsen, die ihr nie gestattet gewesen war: die Gelegenheit, einige sehr alte Rechnungen zu begleichen.
Was mich betraf, so zwang mich die schiere Dauer der Alzheimer-Krankheit, nachdem ich das Ausmaß der Katastrophe erst mal akzeptiert hatte, zu einem unerwartet willkommenen engeren Kontakt mit meiner Mutter. Ich lernte, was ich sonst vielleicht nicht gelernt hätte, dass ich mich fest auf meine Brüder verlassen konnte und sie sich auch auf mich. Und seltsam, obwohl mir meine Intelligenz und mein gesunder Menschenverstand und mein Selbstwertgefühl immer viel bedeutet hatten, merkte ich, dass ich, indem ich mit ansah, wie mein Vater alle drei verlor, immer weniger ängstlich davor war, sie irgendwann selber zu verlieren. Ich wurde allgemein etwas weniger ängstlich. Eine dunkle Tür ging auf, und ich merkte, dass ich in der Lage war, hindurchzugehen.
Die fragliche Tür befand sich im dritten Stock des Barnes Hospital in St. Louis. Ungefähr sechs Wochen nachdem meine Frau und ich meiner Mutter die Pflegekraft vermittelt hatten und in den Osten der USA zurückgefahren waren, überredeten mein ältester Bruder und die Ärzte meinen Vater, sich im Krankenhaus untersuchen zu lassen. Sinn der Sache war, die ganzen Medikamente aus seinem Blutkreislauf zu schwemmen und zu sehen, womit wir es eigentlich zu tun hatten. Meine Mutter half ihm bei der Einweisung und verbrachte den Nachmittag damit, ihm sein Krankenzimmer herzurichten. Als sie, um etwas zu Abend zu essen, ging, war er wie immer halb abwesend, aber kaum war sie zu Hause, bekam sie Anrufe aus der Klinik, erst von meinem Vater, der verlangte, sie solle kommen und ihn aus «diesem Hotel» abholen, dann von den Krankenschwestern, die berichteten, er sei aufsässig geworden. Als sie am nächsten Morgen ins Krankenhaus kam, war er außer sich – von Sinnen, vollkommen ohne Orientierung.
Eine Woche später flog ich wieder nach St. Louis. Meine Mutter brachte mich vom Flughafen direkt zum Krankenhaus. Während sie mit den Schwestern sprach, ging ich ins Zimmer meines Vaters; er lag im Bett, hellwach. Ich sagte hallo. Er gestikulierte wild, ich solle still sein, und winkte mich zu seinem Kissen. Ich beugte mich über ihn, worauf er mich heiser flüsternd bat, leise zu sprechen, weil «die mithörten». Ich fragte ihn, wer «die» seien. Er konnte es mir nicht sagen, doch er ließ die Augen furchtsam rollend durchs Zimmer schweifen, so als hätte er «die» eben noch überall gesehen und wäre nun verblüfft über «ihr» Verschwinden. Als meine Mutter in der Tür erschien, vertraute er mir, noch leiser, an: «Ich glaube, die sind in deine Mutter gefahren.»
Meine Erinnerungen an die darauffolgende Woche sind im Wesentlichen ein Nebel, aus dem ein paar lebensverändernde Szenen herausragen. Ich ging täglich ins Krankenhaus und saß so viele Stunden bei meinem Vater, wie ich es aushalten konnte. Zu keinem Zeitpunkt reihte er zwei zusammenhängende Sätze aneinander. Die Erinnerung, die mir rückblickend am bedeutungsvollsten zu sein scheint, ist sehr eigenartig. Sie ist in ein traumähnliches, dämmriges Innenraumlicht getaucht, sie spielt sich in einem Krankenhauszimmer ab, dessen Schnitt und drangvolle Enge mir von jeder anderen Erinnerung her unbekannt sind, und sie kehrt wieder ohne die chronologischen Markierungen, die meine Erinnerungen normalerweise haben. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob sie aus jener ersten Woche bei meinem Vater im Krankenhaus stammt. Und dennoch weiß ich genau, dass es keine Erinnerung an einen Traum ist. Alle Erinnerungen sind, wie die Neurowissenschaftler sagen, in Wirklichkeit Erinnerungen an Erinnerungen, aber meistens kommen sie uns nicht so vor. Die aber schon. Ich erinnere mich, mich zu erinnern: Mein Vater im Bett, meine Mutter sitzt daneben, ich stehe an der Tür. Wir führen ein bedrückendes Familiengespräch, wahrscheinlich darüber, wohin wir meinen Vater bringen sollen, wenn er aus dem Krankenhaus entlassen wird. Mein Vater verabscheut dieses Gespräch, vielmehr den geringen Anteil, dem er folgen kann. Schließlich ruft er mit leidenschaftlicher Emphase aus, so als hätte er genug von diesem Unsinn: «Ich habe deine Mutter immer geliebt. Immer.» Und meine Mutter vergräbt das Gesicht in den Händen und schluchzt.
Es war das einzige Mal, dass ich meinen Vater sagen hörte, er liebe sie. Bestimmt ist diese Erinnerung echt, weil die Szene mir schon damals ungeheuer bedeutungsvoll erschien, und dann schilderte ich sie meiner Frau und meinen Brüdern und baute sie in die Geschichte ein, die ich mir selbst über meine Eltern erzählte. In späteren Jahren, als meine Mutter darauf beharrte, mein Vater habe nie gesagt, er liebe sie, kein einziges Mal, fragte ich sie, ob sie sich nicht an das eine Mal im Krankenhaus erinnere. Ich wiederholte, was er gesagt hatte, und sie schüttelte unsicher den Kopf. «Kann sein», sagte sie. «Kann schon sein. Daran erinnere ich mich nicht.»
Meine Brüder und ich fuhren im Wechsel alle paar Monate nach St. Louis. Mein Vater erkannte mich jedes Mal als einen, über dessen Anblick er sich freute. Sein Leben im Pflegeheim schien ein endloser, quälender Traum zu sein, bevölkert von Schimären aus seiner Vergangenheit und von all den deformierten und hirngeschädigten Mitpatienten; seine Pfleger waren in dem Traum weniger Akteure als Störenfriede. Anders als viele der Patientinnen, die in einem Moment wie Kleinkinder heulten und im nächsten vor Vergnügen strahlten, wenn jemand sie mit einem Eis fütterte, weinte mein Vater in meiner Anwesenheit nie, und die Freude, die er an einem Eis hatte, kam mir stets wie die eines Erwachsenen vor. Er nickte mir vielsagend zu und lächelte wehmütig, wenn er mir irgendwelche Unsinnsplitter anvertraute, auf die ich mit einem Nicken reagierte, als hätte ich verstanden. Sein häufigstes, beinahe-kohärentes Thema war sein Wunsch, aus «diesem Hotel» herausgeholt zu werden, und dass er einfach nicht begreifen konnte, warum er nicht in einer kleinen Wohnung wohnte und sich von meiner Mutter pflegen ließ.
Im selben Jahr zu Thanksgiving fuhren meine Mutter, meine Frau und ich ins Pflegeheim und brachten ihn samt Rollstuhl in meinem Volvo-Kombi nach Hause. Er war nicht mehr dort gewesen, seit er da noch gewohnt hatte, was zehn Monate her war. Wenn meine Mutter auf eine freudige Dankesbekundung von ihm gehofft hatte, wurde sie enttäuscht; inzwischen beeindruckte meinen Vater ein Ortswechsel nicht mehr als einen Einjährigen. Wir saßen am Kamin und machten aus einer gedankenlosen, schäbigen Gewohnheit Fotos von einem Mann, der, auch wenn er sonst nichts wusste, von einem unseligen Wissen darum erfüllt schien, was für ein klägliches Fotomotiv er abgab. Die Bilder anzusehen ist heute schrecklich für mich: Mein Vater hängt in seinem Rollstuhl wie eine abgesetzte Marionette, die Augen wild starrend, der Mund schlaff, die Brille, von Blitzlicht verschmiert, rutscht ihm fast von der Nase; das Gesicht meiner Mutter eine Maske halbwegs beherrschter Verzweiflung; und meine Frau und ich mit grotesk verzerrter Miene lächelnd, die Hände zu meinem Vater ausgestreckt. Am Esstisch breitete meine Mutter ein Badetuch über ihn und schnitt ihm seinen Truthahn in kleine Stückchen. Unablässig fragte sie ihn, ob er sich freue, zum Thanksgiving-Essen zu Hause zu sein. Er antwortete mit Schweigen, schweifenden Blicken, manchmal einem schwachen Achselzucken. Meine Brüder riefen an und wünschten ihm einen schönen Feiertag; und da, wie aus dem Nichts, kriegte er ein Lächeln und einen kräftigen Klang in seiner Stimme hin, konnte einfache Fragen beantworten, dankte beiden für den Anruf.
Auch dieser Teil des Abends war typisch Alzheimer. Weil Kinder die Regeln des gesellschaftlichen Umgangs sehr früh lernen, hält sich bei vielen Alzheimer-Patienten eine Befähigung zu Höflichkeitsgesten und vagen Anstandsfloskeln selbst dann noch, wenn da längst keine Erinnerungen mehr sind. Es war nicht weiter bemerkenswert, dass mein Vater mit den Feiertagsanrufen meiner Brüder (irgendwie) umgehen konnte. Wohl aber das, was danach passierte, nach dem Essen, vor dem Pflegeheim. Während meine Frau hineinlief, um einen Klinikrollstuhl zu organisieren, saß mein Vater neben mir und musterte das Hausportal, durch das er gleich wieder geschoben werden sollte. «Lieber gar nicht erst gehen», sagte er mit klarer, fester Stimme zu mir, «als wieder zurückmüssen.» Das war nicht vage; der Satz bezog sich unmittelbar auf die konkrete Situation und deutete stark darauf hin, dass mein Vater um sein größer gewordenes Elend und sein Eingebundensein in Vergangenheit und Zukunft wusste. Er bat, dass man ihm den Schmerz ersparen möge, wieder in Bewusstheit und Erinnerung zurückgezerrt zu werden. Und tatsächlich, am Morgen nach Thanksgiving und für den Rest unseres Besuchs war er wieder so verwirrt, wie ich ihn zuvor erlebt hatte, was er sagte, ein Kuddelmuddel wahlloser Silben, sein Körper ein einziges Gefuchtel.
Von den «Fenstern zum Sinn», die laut David Shenk von Alzheimer gewährt werden, ist für ihn das bedeutendste, dass der Tod hinausgezögert wird. Shenk vergleicht die Krankheit mit einem Prisma, das den Tod in ein Spektrum seiner ansonsten fest zusammengefügten Teile auffächert – den Tod der Unabhängigkeit, den Tod der Erinnerung, den Tod des Bewusstseins, den Tod der Persönlichkeit, den Tod des Körpers –, und bestätigt damit den gängigsten Tropus der Krankheit Alzheimer: dass sie deshalb so besonders traurig und erschreckend sei, weil dem Leidenden sein «Ich» lange vor dem Tod seines Körpers verloren geht.
In meinen Augen trifft das weitgehend zu. Als das Herz meines Vaters aufhörte zu schlagen, hatte ich schon viele Jahre um ihn getrauert. Und dennoch, wenn ich mir seine Geschichte vergegenwärtige, frage ich mich, ob die verschiedenen Tode wirklich so voneinander abgespalten werden können und ob Erinnerung und Bewusstsein tatsächlich ein so sicheres Anrecht darauf haben, der Hort der Individualität zu sein. Unablässig suche ich nach einem Sinn in den zwei Jahren, die auf den Verlust seines vermeintlichen «Ich» folgten, und unablässig finde ich ihn.
Vor allem anderen staune ich über das offenkundige Fortbestehen seines Willens. Ich bin außerstande, nicht zu glauben, dass er einen körperlichen Überrest seiner Selbstdisziplin, eine in den Sehnen wirksame Kraftreserve unterhalb von Bewusstsein und Erinnerung aufbot, als er sich zu der Bitte, die er mir vor dem Pflegeheim vortrug, aufraffte. Ebenso bin ich außerstande, nicht zu glauben, dass sein Zusammenbruch am folgenden Morgen, ähnlich dem Zusammenbruch in seiner ersten Nacht allein im Krankenhaus, eine Preisgabe jenes Willens war, ein Loslassen, ein Annehmen des Wahnsinns angesichts unerträglich werdender Gefühle. Auch wenn wir den Beginn seines Verfalls (volles Bewusstsein und klarer Verstand) und dessen Endpunkt (Vergessen und Tod) bestimmen können, war sein Gehirn doch nicht einfach eine computerartige Maschine, die allmählich und unaufhaltsam Amok lief. Während der Alzheimer’sche Abbauprozess einen stetigen Abwärtstrend wie den hier erwarten ließe,
sah das, was ich vom Niedergang meines Vaters mitbekam, eher so aus:
Er hielt sein Kräfte, vermute ich, länger beisammen, als es ihm der Zustand seiner Neuronen eigentlich erlaubt hätte. Dann kollabierte er und stürzte tiefer, als es durch das Krankheitsbild wohl vorgegeben war, und aus freien Stücken blieb er auch tief da unten, an neunundneunzig von hundert Tagen. Was er wollte (in den frühen Jahren Distanz wahren, in den späteren loslassen), war ein integraler Bestandteil dessen, was er war. Und was ich will (Geschichten über das Gehirn meines Vaters, die nicht von einem Klumpen Fleisch handeln), ist ein integraler Bestandteil dessen, woran ich mich erinnern und was ich weitergeben möchte.
Eine der Geschichten, die ich nun also erzählen werde, während ich versuche, mir meine lange Blindheit seinem Zustand gegenüber zu verzeihen, ist die, dass er entschlossen war, diesen Zustand zu verbergen, und dass er sich über eine beachtlich lange Zeit die Charakterstärke bewahrte, das auch zu schaffen. Meine Mutter jedenfalls beteuerte immerzu, dass dem so war. Die Frau, mit der er zusammenlebte, konnte er nicht täuschen, egal, wie sehr er sie drangsalierte; wenn aber Söhne in der Stadt oder Gäste im Haus waren, konnte er sich aufraffen. Die wahre Erklärung für das Rätsel meines Aufenthalts bei ihm während der Krankenhauszeit meiner Mutter war wahrscheinlich weniger meine Blindheit als der zusätzliche Wille, den er aufbrachte.
Nach dem schlimmen Thanksgiving, als uns klargeworden war, dass er nie wieder nach Hause kommen würde, half ich meiner Mutter, seinen Schreibtisch durchzusehen. (Diese Freiheit nimmt man sich beim Durchsehen des Schreibtisches von einem Kind oder einem Toten.) In einer der Schubladen fanden wir Hinweise auf kleine, verdeckte Anstrengungen gegen das Vergessen. Da war ein Haufen Zettel, auf die er sich die Adressen seiner Kinder notiert hatte, eine Adresse pro Zettel, auf manchen dieselbe. Auf einen anderen Zettel hatte er die Geburtsdaten seiner älteren Söhne geschrieben – «Bob 13. 1. 48» und «TOM 15. 10. 50» –, und dann, in dem Bemühen, sich an meins zu erinnern (17. August 1959), hatte er Monat und Tag durchgestrichen und anhand der stehengebliebenen Daten geraten: «JON 13. 10. 49».
Denkwürdig auch die meiner Ansicht nach letzten Worte, die er, ein Vierteljahr vor seinem Tod, zu mir sagte. Ein paar Tage lang hatte ich ihn im Pflegeheim pflichtgemäße neunzig Minuten lang besucht und seinem Gebrummel über meine Mutter und seinen harmlosen Mutmaßungen über gewisse winzige Dinger zugehört, die er unbedingt auf den Ärmeln seines Pullovers und seiner Hose in Kniehöhe gesehen haben wollte. Nicht anders war er, als ich an meinem letzten Vormittag vorbeischaute, nicht anders, als ich ihn zu seinem Zimmer zurückschob und ihm mitteilte, dass ich jetzt abreisen würde. Da sah er zu mir auf und sagte – wieder, wie aus dem Nichts, war seine Stimme klar und fest: «Danke fürs Kommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, mich zu besuchen.»
Höflichkeitsfloskeln? Ein Fenster zu seinem eigentlichen Ich? Ich habe wohl kaum die Wahl, an welche der beiden Deutungen ich glauben soll.
Da ich mich auf die Briefe meiner Mutter stütze, um den Verfall meines Vaters zu rekonstruieren, spüre ich den Schatten der undokumentierten Jahre nach 1992, in denen sie und ich längere Telefonate führten und uns nur noch ganz kurze Mitteilungen schrieben. Dass Platon in seinem Phaidros Schreiben als «Krücke der Erinnerung» bezeichnete, erscheint mir absolut genau: Ohne diese Briefe könnte ich die Geschichte meines Vaters nicht schlüssig erzählen. Doch wo Platon den Niedergang der mündlichen Überlieferung und den Gedächtnisschwund beklagt, den das Schreiben bewirke, bin ich am anderen Ende des Zeitalters des geschriebenen Worts beeindruckt von der Robustheit und Verlässlichkeit von Wörtern auf Papier. Die Briefe meiner Mutter sind wahrer und vollständiger als meine egozentrischen und voreingenommenen Erinnerungen; in dem geschriebenen Satz «er BRAUCHT Ablenkungen!» ist sie für mich lebendiger als in stundenlangen Videoaufnahmen oder in Stapeln von Fotos.