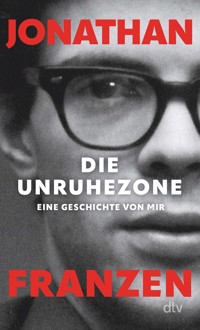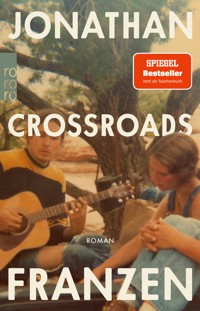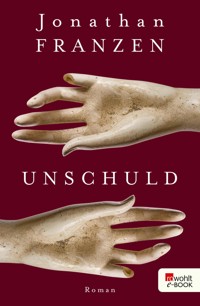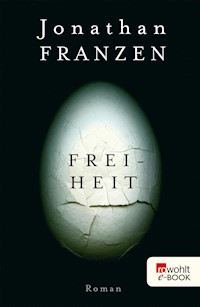9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Nach dem großen Erfolg seines Romans «Freiheit» veröffentlicht Jonathan Franzen nun Essays über das, was ihn nicht loslässt – Umwelt, Reisen und menschliche Beziehungen, immer wieder auch Literatur. Er erzählt von der Jagd auf Singvögel in Mittelmeerländern und der Gefahr, der er selbst ausgesetzt war, als er Naturschützer bei ihrem Kampf gegen das massenhafte Töten begleitete. Er erzählt von einer Reise auf eine kleine, unbewohnte Vulkaninsel vor Chile, auf der er einen Teil der Asche seines Freundes und Rivalen David Foster Wallace verstreute. Fast immer sind es Ambivalenzen, Irritationen, Beunruhigungen, die ihn zum Schreiben brachten: ein Aufenthalt in China, wo er die Umweltzerstörung anprangern wollte und überrascht feststellen musste, dass das Tempo der chinesischen Wirtschaftsentwicklung ihm auch Bewunderung abverlangt; das anhaltende Befremden darüber, wie radikal der Gebrauch von Mobiltelefonen menschliche Beziehungen verändert hat. Und natürlich geht es um Bücher, alte und neue, die ihm wichtig sind und es verdient haben, dass auch der deutsche Leser sie entdeckt. In «Weiter weg» erweist sich Jonathan Franzen erneut als ein Autor, der sich mit sich selbst, mit Literatur und mit den zentralen Themen unserer Gegenwart tiefgreifend auseinandersetzt. Ein bemerkenswertes, provokatives, sprachlich brillantes Buch, geschrieben mit Leidenschaft und durchdrungen von Verlust.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Ähnliche
Jonathan Franzen
Weiter weg
Essays
Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell, Wieland Freund, Dirk van Gunsteren und Eike Schönfeld
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Für Tom Hjelm, wegen seiner Anregungen fürs Schreiben, und für Göran Ekström, wegen seiner Anregungen fürs Reisen
Schmerz bringt dich nicht um
Abschlussrede vor Absolventen
des Kenyon College, Mai 2011
Guten Morgen, Abschlussklasse des Jahres 2011. Guten Morgen, Verwandte, guten Morgen, Fakultät. Es ist mir eine große Ehre und Freude, heute hier zu sein.
Ich gehe davon aus, dass Sie alle wussten, worauf Sie sich einlassen, wenn Sie einen Schriftsteller bitten, diese Rede zu halten. Ich werde tun, was Schriftsteller tun, nämlich über mich selber reden, in der Hoffnung, dass meine Erfahrung einigen Widerhall in der Ihren findet. Ich möchte mich vorarbeiten zum Thema Liebe und deren Rolle in meinem Leben und zu der sonderbaren technokapitalistischen Welt, die man euch jungen Leuten hinterlässt.
Vor ein paar Wochen habe ich meinen drei Jahre alten BlackBerry Pearl durch einen viel leistungsstärkeren BlackBerry Bold ersetzt, mit Fünf-Megapixel-Kamera und 3G-Funktion. Selbstverständlich war ich beeindruckt vom technischen Fortschritt der vergangenen drei Jahre. Auch wenn ich gerade niemanden zum Anrufen, Simsen oder Mailen hatte, wollte ich meinen neuen Bold weiter liebkosen, die wunderbare Auflösung seines Displays, die seidige Führung seines winzigen Trackpads, seine schockierende Schnelligkeit und die betörende Eleganz seiner Graphik genießen. Kurz, ich war vernarrt in mein neues Gerät. Natürlich war ich in mein altes Gerät ebenso vernarrt gewesen, doch hatte unsere Beziehung über die Jahre an Glanz verloren. Es hatte Vertrauenskrisen gegeben, Rechenschaftskrisen, Kompatibilitätskrisen, und gegen Ende hatte ich sogar an der geistigen Gesundheit meines Pearls gezweifelt. Schließlich musste ich mir eingestehen, dass ich unserer Beziehung entwachsen war.
Muss ich extra darauf hinweisen, dass – abgesehen von einer wilden, vermenschlichenden Projektion, in der mein alter BlackBerry traurig war über das Schwinden meiner Liebe – unsere Beziehung gänzlich einseitig verlief? Lassen Sie mich dennoch darauf hinweisen. Lassen Sie mich weiter darauf hinweisen, dass das Wort sexy in der Beschreibung neuer Gadgets allgegenwärtig ist; dass die extrem coolen Sachen, die wir mit diesen Gadgets heutzutage anstellen können – sie mit beschwörenden Worten dazu bringen, etwas zu tun, oder dieses iPhone-Fingerspreizen, mit dem man Bilder größer macht –, auf die Menschen vor hundert Jahren wie magische Beschwörungen und Gesten gewirkt hätten; und dass wir, geht es um eine einwandfrei funktionierende erotische Beziehung, in der Tat von Magie sprechen. Lassen Sie mich – ausgehend von der Logik des Technokonsumismus, der zufolge die Märkte unsere größten Wünsche erkennen und erfüllen – die These in den Raum werfen, dass die Technik mit höchstem Geschick Produkte zu entwerfen gelernt hat, die unserem phantasierten Ideal einer erotischen Beziehung insofern entsprechen, als das Objekt der Begierde nichts fordert und alles gibt, sofort, und uns das Gefühl von Macht vermittelt und keine fürchterlichen Szenen macht, wenn man es durch ein noch begehrenswerteres Objekt ersetzt und in eine Schublade legt: dass es ganz allgemein das ultimative Ziel der Technik ist, das telos von techne, eine natürliche Welt, der unsere Wünsche gleichgültig sind – eine Welt der Hurrikans und des Leidens und der zerbrechlichen Herzen, eine widerständige Welt –, durch eine Welt zu ersetzen, die derart empfänglich ist für unsere Wünsche, dass sie im Grunde bloß eine Erweiterung des Ichs ist. Lassen Sie mich schließlich andeuten, dass die Welt des Technokonsumismus aus ebendiesem Grund Probleme mit der wahren Liebe hat und notgedrungen im Gegenzug der wahren Liebe Probleme macht.
Ihre erste Verteidigungsstrategie besteht darin, den Feind zu kommerzialisieren. Sie alle könnten hier Ihre liebsten, abstoßendsten Beispiele für die Kommerzialisierung der Liebe beibringen. Zu meinen zählen die Hochzeitsindustrie, Fernsehspots, die süße kleine Kinder zeigen oder Autos als Weihnachtsgeschenk empfehlen, und die besonders groteske Gleichsetzung von Diamanten und ewiger Liebe. Die Botschaft lautet in jedem Fall, dass man, wenn man jemanden liebt, ihm etwas kaufen sollte.
Ein verwandtes Phänomen, eine kleine Aufmerksamkeit von Facebook, ist die fortschreitende Verwandlung des Ausdrucks gefallen, etwas mögen, von einer Befindlichkeit in einen Akt, den man mit seiner Computermaus vollführt: von einem Gefühl in eine Erklärung des Konsumentenwillens. Und mögen ist, in der Regel, das Substitut der Konsumkultur für lieben. Das Bemerkenswerte an allen Konsumprodukten – ganz besonders an elektronischen Geräten und Anwendungen – ist, dass sie hergestellt werden, um ungeheuer zu gefallen. In der Tat ist das eben die Definition eines Konsumprodukts – im Gegensatz zu einem Produkt, das einfach nur es selbst ist und dessen Hersteller nicht darauf fixiert sind, dass es gefällt. Ich denke hier an Flugzeugmotoren, Laborausstattungen, ernsthafte Kunst und Literatur.
Doch wenn man das auf Menschen bezieht und sich jemanden vorstellt, der sich über den verzweifelten Wunsch zu gefallen definiert, was sieht man dann? Einen Menschen ohne Integrität, ohne eine Mitte. In eher pathologischen Fällen einen Narzissten – eine Person, die die Beeinträchtigung ihres Selbstbildes, die jedes Nichtgefallen mit sich bringt, nicht erträgt und sich menschlichen Kontakten deshalb entweder entzieht oder sich auf eine extreme, die eigene Integrität opfernde Weise zu gefallen bemüht.
Widmet man jedenfalls seine Existenz dem Gefallenwollen und nimmt deshalb alle möglichen coolen Persönlichkeitsmerkmale an, die gerade gefallen, dann hat man es wohl aufgegeben, als derjenige geliebt werden zu wollen, der man wirklich ist. Und wenn es einem gelingt, die anderen so zu manipulieren, dass man ihnen gefällt, wird es einem zu gegebener Zeit nicht schwerfallen, diese Leute zu verachten, eben weil sie auf einen hereingefallen sind. Diese Leute sind da, damit man sich mit sich selbst gut fühlt – aber wie gut kann dieses Gefühl sein, wenn es einem von Leuten vermittelt wird, die man nicht achtet? Da kann man dann schon mal depressiv werden oder Alkoholiker oder, wie Donald Trump, (vorübergehend) Präsidentschaftskandidat.
Produkte der Konsumtechnologie würden etwas so Unattraktives natürlich niemals tun, sind sie doch keine Menschen. Sie sind allerdings großartige Verbündete und Narzissmus-Helfer. Außer ihrem eingebauten Bestreben zu gefallen verfügen sie auch über das eingebaute Bestreben, uns gut aussehen zu lassen. Vom sexy Facebook-Interface gefiltert, sieht unser Leben gleich viel spannender aus. Wir spielen die Hauptrolle in unseren eigenen Filmen, wir fotografieren uns unablässig, wir klicken mit der Maus, und eine Maschine bestätigt unsere Überlegenheit. Und weil die Technik ja eigentlich nur eine Erweiterung unseres Ichs ist, müssen wir sie, anders als die echten Menschen, für ihre Manipulierbarkeit nicht einmal verachten. Alles ist eine große, endlose Schleife. Der Spiegel gefällt uns, und wir gefallen dem Spiegel. Sich mit jemandem anzufreunden bedeutet schlicht, diesen Jemand in unser Privatkabinett aus schmeichelnden Spiegeln zu integrieren.
Vielleicht übertreibe ich ein bisschen. Mit großer Wahrscheinlichkeit haben Sie es satt, schrullige Einundfünfzigjährige auf die sozialen Netzwerke schimpfen zu hören. Ich möchte hier bloß einen Gegensatz aufbauen zwischen den narzisstischen Tendenzen der Technik und dem Problem der eigentlichen Liebe. Alice Sebold, eine gute Freundin von mir, spricht gern davon, «in die Grube einzufahren und jemanden zu lieben». Sie hat den Schmutz im Sinn, den die Liebe unausweichlich auf den Spiegel unserer Selbstachtung spritzt. Es ist eben so, dass der Versuch, ständig zu gefallen, mit Liebesbeziehungen unvereinbar ist. Früher oder später findet man sich doch in der schrecklichen Schreierei eines Streits wieder und hört Sachen aus dem eigenen Mund kommen, die einem ganz und gar nicht gefallen, Sachen, die das Selbstbild vom fairen, coolen, attraktiven, beherrschten, witzigen Menschen, der gefällt, zertrümmern. Da ist etwas, das wirklicher ist als die Möglichkeit zu gefallen, aus einem zum Vorschein gekommen, und auf einmal hat man ein richtiges Leben. Auf einmal geht es um eine echte Wahl, nicht eine künstliche Konsumentenentscheidung zwischen einem BlackBerry und einem iPhone, sondern um eine Frage: Liebe ich diesen Menschen? Und, auf den anderen bezogen: Liebt dieser Mensch mich? So etwas wie einen Menschen, von dessen wahrem Ich einem jeder Partikel gefällt, gibt es nicht. Deshalb ist eine Welt des Gefallens letztlich eine Lüge. So etwas wie einen Menschen, von dessen wahrem Ich man jeden Partikel liebt, aber gibt es. Und deshalb ist die Liebe für die technokonsumistische Ordnung eine so existenzielle Gefahr: Sie stellt die Lüge bloß.
Ermutigend an der Handy-Seuche in meiner Manhattaner Nachbarschaft ist, dass ich, neben all den SMS-Zombies und brabbelnden Party-Planern auf den Bürgersteigen, dann und wann neben einem Menschen hergehe, der einen waschechten Streit mit jemandem hat, den er liebt. Ich bin sicher, dass diese Leute lieber nicht auf offener Straße streiten würden, aber so ist es nun mal gekommen, und jetzt verhalten sie sich sehr, sehr uncool. Sie brüllen, machen Vorwürfe, betteln, beleidigen. Dergleichen lässt mich hoffen für die Welt.
Was nicht heißen soll, dass es in der Liebe nur ums Streiten ginge oder dass radikal ichbezogene Menschen nicht zu Vorwürfen und Beleidigungen fähig wären. Worum es in der Liebe wirklich geht, ist abgrundtiefe Empathie, geboren aus der Erkenntnis des Herzens, dass der andere haargenau so wirklich ist wie man selbst. Und deshalb ist die Liebe, wie ich sie verstehe, immer konkret. Der Versuch, die ganze Menschheit zu lieben, mag ehrenhaft sein, seltsamerweise jedoch konzentriert er sich auf das eigene Ich und dessen moralisches oder spirituelles Wohlergehen. Um einen konkreten Menschen zu lieben hingegen, sich mit seinen Nöten und Freuden zu identifizieren, als wären sie die eigenen, muss man ein Stück des eigenen Ichs aufgeben.
Als ich ein Senior im College war, belegte ich das erste Seminar, das dort je zur Literaturtheorie angeboten wurde, und verliebte mich in die brillanteste Studentin. Uns beiden gefiel das Gefühl von Macht, das uns die Literaturtheorie sogleich vermittelte – in dieser Hinsicht ähnelt sie der Konsumtechnologie –, und wir schmeichelten uns, wie viel intellektueller wir doch wären als die anderen Kids, die immer noch diese alten zähen Textinterpretationen machten. Aus diversen theoretischen Überlegungen heraus fanden wir es auch cool zu heiraten. Da tauchte meine Mutter auf, die zwanzig Jahre bemüht gewesen war, aus mir einen Menschen zu machen, der sich nach hingebungsvoller Liebe sehnt, und riet mir, ich solle meine Zwanziger «frei und ungebunden» verbringen, wie sie es ausdrückte. Da ich davon ausging, dass sie in allem falschlag, nahm ich natürlich an, dass sie auch hierin falschlag. Ich musste selbst und auf die harte Tour herausfinden, was für eine schmutzige Angelegenheit die Hingabe ist.
Das Erste, was wir über Bord warfen, war die Theorie. Wie meine zukünftige Frau nach einer misslichen Szene im Bett einmal unvergesslich bemerkte: «Du kannst nicht gleichzeitig dekonstruieren und dich ausziehen.» Wir verbrachten ein Jahr auf verschiedenen Kontinenten und begriffen ziemlich schnell, dass es zwar Spaß machte, seitenlange Briefe aneinander mit theoretischen Riffs zu füllen, aber längst nicht so viel Spaß, diese Seiten dann zu lesen. Doch was mir die Theorie wirklich verleidete – und mich vom obsessiven Nachdenken über meine Wirkung auf andere befreite –, war meine Liebe zur Literatur. Es mag eine oberflächliche Ähnlichkeit zwischen der Überarbeitung eines Stücks Literatur und der Aktualisierung der eigenen Internetseite oder des eigenen Facebook-Profils geben, doch eine Seite Prosa hat nicht diese polierte Oberfläche, die das Selbstbild zu schönen hilft. Wenn man das Geschenk, als das man die Literatur anderer begreift, zurückzugeben versucht, kann man am Ende das, was auf den eigenen Seiten verlogen oder aus zweiter Hand ist, nicht ignorieren. Diese Seiten sind auch ein Spiegel, und wenn man die Literatur wirklich liebt, wird man begreifen, dass nur die Seiten bewahrenswert sind, die zeigen, wie man wirklich ist.
Das Risiko besteht hier natürlich darin, zurückgewiesen zu werden. Dann und wann nicht gemocht zu werden, das halten wir alle aus, gibt es doch einen unendlich großen Pool potenzieller Möger. Doch das eigene Ich ganz zu exponieren, nicht nur die gefällige Oberfläche, und dann seine Zurückweisung zu erleben, kann katastrophal schmerzhaft sein. Die Aussicht auf Schmerz ganz allgemein, auf den Schmerz des Verlusts, der Trennung, des Todes macht die Versuchung so groß, die Liebe zu meiden und im sicheren Reich des Gefallens zu bleiben. Meine Frau und ich, die wir zu jung geheiratet hatten, gaben schließlich so viel von uns selbst auf und fügten einander so viel Schmerz zu, dass wir beide gute Gründe hatten zu bereuen, den Sprung jemals gewagt zu haben.
Und doch kann und will ich es nicht wirklich bereuen. Zum einen hat uns das Ringen um ein aktives Würdigen unserer Bindung als Menschen geformt; wir waren keine Helium-Moleküle, die träge durchs Leben schwebten; wir waren gebunden, und wir veränderten uns. Zum anderen – und das könnte heute meine zentrale Botschaft sein – tut Schmerz weh, aber er bringt dich nicht um. Bedenkt man die Alternative – einen narkotisierten, technisch begünstigten Traum von Selbstgenügsamkeit –, dann erscheint der Schmerz als das natürliche Produkt und der natürliche Indikator des Lebendigseins in einer widerständigen Welt. Ohne Schmerz durchs Leben zu kommen heißt, nicht gelebt zu haben. Sogar sich zu sagen: «Oh, zu dieser Herz-und-Schmerz-Geschichte komme ich später, vielleicht wenn ich so dreißig bin», heißt, sich zehn Jahre lang bloß darauf zu beschränken, einen Platz auf dem Planeten zu besetzen und dessen Ressourcen zu vernichten. Es heißt (und ich meine das wirklich im verdammenden Wortsinn), ein Konsument zu sein.
Was ich zuvor gesagt habe – dass die Bindung an etwas, das man liebt, einen dazu zwingt, sich dem zu stellen, der man wirklich ist –, mag insbesondere für das Schreiben gelten, aber es trifft auf so gut wie jede Arbeit zu, die einem viel bedeutet. Ich möchte hier schließen, indem ich über eine weitere Liebe von mir spreche.
Als ich im College war, und noch viele Jahre später, gefiel mir die Natur. Ich liebte sie nicht, aber ganz bestimmt gefiel sie mir. Sie kann sehr schön sein, die Natur. Und da ich für die Kritische Theorie entflammt war und nicht nur nach etwas suchte, was ich falsch finden konnte in der Welt, sondern auch nach Gründen, die dafür Verantwortlichen zu hassen, fühlte ich mich natürlich von der Umweltbewegung angezogen, denn in Sachen Umwelt lief doch gewiss jede Menge schief. Und je mehr ich auf das sah, was falsch war – eine explodierende Weltbevölkerung, explodierende Ressourcenvernichtung, steigende Temperaturen, Vermüllung der Ozeane, Abholzung unserer letzten Urwälder –, desto wütender und hasserfüllter wurde ich. Mitte der Neunziger schließlich, ungefähr zu der Zeit, als meine Ehe zerbrach und ich befand, Schmerz sei das eine, etwas ganz anderes aber sei es, für den Rest des Lebens immer wütender und unglücklicher zu werden, traf ich ganz bewusst die Entscheidung, mir keine Sorgen mehr um die Umwelt zu machen. Ich persönlich konnte nichts Bedeutsames zur Rettung des Planeten beitragen, und ich wollte mich den Dingen widmen, die ich liebte. Auf meinen CO2-Fußabdruck achtete ich nach wie vor, weiter jedoch konnte ich nicht gehen, ohne in Wut und Verzweiflung zurückzufallen.
Und dann passierte mir etwas Komisches. Es ist eine lange Geschichte, im Wesentlichen aber verliebte ich mich in die Vögel. Ich wehrte mich mächtig dagegen, denn Vögel zu beobachten ist uncool, weil alles, was wahre Leidenschaft verrät, per definitionem uncool ist. Stück für Stück jedoch, wider mich selbst, entwickelte ich diese Leidenschaft, und auch wenn die eine Hälfte einer Passion Obsession ist – die andere Hälfte ist Liebe. Und so, ja, führte ich eine pingelige Liste der Vögel, die ich gesehen hatte, und, ja, unternahm alles Erdenkliche, um weitere Arten zu sehen. Doch, und das ist nicht weniger wichtig, wann immer ich einen Vogel sah, irgendeinen Vogel, selbst eine Taube oder ein Rotkehlchen, spürte ich mein Herz vor Liebe überfließen. Und wie ich heute zu erklären versucht habe: Mit der Liebe fangen die Probleme an.
Denn nun, da mir die Natur nicht bloß gefiel, sondern ich einen konkreten und lebendigen Teil von ihr liebte, konnte ich gar nicht anders, als mich erneut um die Umwelt zu sorgen. Die Nachrichten von dieser Front waren nicht besser als damals, als ich entschieden hatte, mich nicht mehr um sie zu scheren – eigentlich waren sie sogar erheblich schlechter –, nur waren die bedrohten Wälder und Feuchtgebiete und Ozeane für mich nicht länger bloß eine schöne Szenerie, an der ich mich erfreute. Sie waren das Zuhause von Tieren, die ich liebte. Und an diesem Punkt kam es zu einem seltsamen Paradox. Meine Wut und mein Schmerz und meine Verzweiflung über den Planeten wurden durch meine Sorge um die wilden Vögel nur noch größer, und doch wurde es, während ich mich mit Artenschutz beschäftigte und mehr über die Gefahren erfuhr, denen Vögel ausgesetzt sind, seltsamerweise leichter, nicht schwerer, mit meiner Wut und meinem Schmerz und meiner Verzweiflung zu leben.
Wie kann das gehen? Zum einen, glaube ich, öffnete mir die Liebe zu den Vögeln die Tür zu einem wichtigen, weniger ich-zentrierten Teil meiner selbst, von dessen Existenz ich nichts gewusst hatte. Statt weiter durch mein Leben als Weltbürger zu driften, Gefallen zu finden und Missfallen zu hegen und mir meine Hingabe für später aufzusparen, war ich gezwungen, mich einem Ich zu stellen, das ich entweder vom Fleck weg zu akzeptieren oder rundheraus abzulehnen hatte. Das eben macht die Liebe mit einem Menschen. Denn für uns alle gilt nun einmal, dass wir eine Weile am Leben sind, aber in Kürze sterben werden. Diese Tatsache ist die Wurzel all unserer Wut und unseres Schmerzes und unserer Verzweiflung. Und vor dieser Tatsache kann man entweder weglaufen oder sie, über den Weg der Liebe, annehmen.
Wie gesagt, die Sache mit den Vögeln kam für mich sehr unerwartet. Bis dahin hatte ich nicht viele Gedanken auf Tiere verschwendet. Vielleicht ist es Pech, dass ich meinen Weg zu den Vögeln so relativ spät im Leben gefunden habe, vielleicht ist es Glück, dass ich ihn überhaupt gefunden habe. Aber wenn so eine Liebe einen erst einmal erwischt, wie spät oder früh auch immer, verändert sie die eigene Beziehung zur Welt. Ich zum Beispiel hatte nach ein paar frühen Experimenten den Journalismus aufgegeben, weil mich die Welt der Fakten nicht so sehr begeisterte wie die Welt der Fiktion. Doch nachdem mich meine Vogelkonversionserfahrung gelehrt hatte, auf meinen Schmerz und meine Wut und Verzweiflung zu- statt davor wegzulaufen, nahm ich eine andere Art journalistischer Aufträge an. Was immer mich zu einem bestimmten Zeitpunkt am meisten abstieß, wurde zu dem, worüber ich schreiben wollte. Im Sommer 2003, als die Republikaner dem Land Dinge antaten, die mich rasend machten, ging ich nach Washington. Ein paar Jahre später ging ich nach China, weil mein Zorn darüber, wie die Chinesen ihre Umwelt verwüsteten, mich nachts nicht schlafen ließ. Ich fuhr ans Mittelmeer, um Jäger und Wilderer zu interviewen, die ziehende Singvögel abschlachten. Und immer, wenn ich dem Feind begegnete, stieß ich auf Menschen, die ich wirklich mögen – in manchen Fällen geradezu lieben konnte. Urkomische, generöse, brillante schwule Mitarbeiter der Republikaner. Furchtlose, wundertätige junge chinesische Naturliebhaber. Einen waffenvernarrten italienischen Juristen mit sehr sanftem Blick, der den Tierrechtler Peter Singer zitierte. In jedem Fall fiel mir die pauschale Antipathie, die ich so leicht entwickelt hatte, nicht mehr so leicht.
Wenn man in seinem Zimmer bleibt und tobt oder spottet oder die Achseln zuckt, wie ich es viele Jahre lang getan habe, sind die Welt und ihre Probleme entmutigend. Wenn man aber rausgeht und sich in eine wirkliche Beziehung zu wirklichen Menschen oder auch nur wirklichen Tieren setzt, besteht die sehr reale Gefahr, einige von ihnen zu lieben. Und wer weiß, was dann mit einem geschieht?
Danke.
(Übersetzt von Wieland Freund)
Weiter weg
Im Südpazifik, achthundert Kilometer vor der Küste von Chile, liegt eine verboten steile Vulkaninsel, zehn Kilometer lang und sechs Kilometer breit, die von Millionen Seevögeln und Tausenden Seebären bewohnt wird, aber frei von Menschen ist. Nur in den wärmeren Monaten fahren ein paar Fischer raus, um Hummer zu fangen. Will man die Insel, die offiziell Alejandro Selkirk heißt, erreichen, so fliegt man in einem Achtsitzer, der zweimal wöchentlich verkehrt, zunächst auf eine etwa hundertfünfzig Kilometer weiter östlich gelegene Insel. Dort steigt man in ein kleines offenes Boot und fährt von der Landepiste zum einzigen Dorf des Archipels, wartet darauf, dass man gelegentlich von einer der Barkassen auf die zwölfstündige Ausfahrt mitgenommen wird, und muss dann oft noch länger, manchmal tagelang warten, bis das Wetter es zulässt, dass man an der felsigen Küste an Land geht. In den sechziger Jahren haben chilenische Tourismusvertreter die Insel nach Alexander Selkirk umbenannt, dem schottischen Seemann, dessen Geschichte vom einsamen Leben auf dem Archipel wahrscheinlich die Grundlage für Daniel Defoes Roman Robinson Crusoe war, aber die Einheimischen verwenden immer noch ihren ursprünglichen Namen, Más Afuera: Weiter weg.
Im Spätherbst des vergangenen Jahres war es mir ein ziemlich starkes Bedürfnis, weiter weg zu sein. Vier Monate lang war ich nonstop mit einem Roman auf Tour gewesen und willenlos meinem Terminkalender gefolgt, bis ich mich mehr und mehr wie die kleine Raute auf dem Ladebalken eines Mediaplayers fühlte. Wesentliche Teile meiner persönlichen Geschichte starben innerlich ab, weil ich zu oft über sie sprach. Und jeden Morgen die gleiche wiederbelebende Dosis Nikotin und Koffein; jeden Abend die gleiche Attacke auf die E-Mails in meinem Postfach; jede Nacht die gleiche Trinkerei für das gleiche hirnvernebelnde bisschen Behagen. Ab einem gewissen Punkt, nachdem ich über Más Afuera gelesen hatte, stellte ich mir vor, abzuhauen und dort, wie Selkirk, alleine zu sein, im Innern einer Insel, auf der niemand, nicht mal zeitweise, lebt.
Außerdem gefiel mir die Idee, in der Zeit dort noch einmal das Buch zu lesen, das gemeinhin als erster englischer Roman gilt. Robinson Crusoe war das großartige frühe Zeugnis eines radikalen Individualismus, die Geschichte des praktischen und psychischen Überlebens eines ganz normalen Menschen in völliger Isolation. Das mit dem Individualismus verbundene Projekt des Romans – die Suche nach Bedeutung in einer realistischen Erzählung – wurde für die nächsten dreihundert Jahre zur kulturell vorherrschenden Form. Wir hören Robinson Crusoes Stimme in der Stimme von Jane Eyre, in den Aufzeichnungen des Manns aus dem Kellerloch, der Erzählung des unsichtbaren Manns und in den Einträgen von Sartres Roquentin. All diese Erzählungen hatten mich einmal begeistert, und schon im englischen Wort novel mit seinem Neuigkeitsversprechen hielt sich eine Erinnerung an jugendlichere Begegnungen, die so fesselnd waren, dass ich stundenlang stillsitzen konnte und nie auch nur an Langeweile dachte. In seinem Klassiker Der bürgerliche Roman. Aufstieg einer Gattung erklärt Ian Watt den Boom der Romanproduktion im 18. Jahrhundert mit dem wachsenden Bedürfnis nach heimischer Unterhaltung, das Frauen empfanden, die – der traditionellen Aufgaben im Haushalt entbunden – zu viel Zeit hatten. Auf sehr direkte Weise war der englische Roman, Watt zufolge, aus der Asche der Langeweile gestiegen. Und Langeweile war es, woran ich litt. Je öfter man Ablenkung sucht, desto weniger effektiv ist jede einzelne, und so musste ich die diversen Dosen erhöhen, bis ich, eh ich mich’s versah, alle zehn Minuten meine E-Mails checkte und meine Tabakklumpen immer größer wurden und meine zwei abendlichen Drinks sich zu vier ausgewachsen hatten und ich es im Computer-Solitaire zu solcher Meisterschaft gebracht hatte, dass es nicht länger mein Ziel war, ein einzelnes Spiel zu gewinnen, sondern zwei oder mehr hintereinander – eine Art Meta-Solitaire, dessen Faszination weniger im Kartenspielen bestand als darin, auf den Wellen von Glück und Pech zu surfen. Meine bis dahin längste Gewinnsträhne war acht.
Ich verabredete eine Mitfahrgelegenheit nach Más Afuera auf einem kleinen Boot, das ein paar abenteuerlustige Botaniker gechartert hatten. Dann stürzte ich mich in eine kurze Konsumorgie bei REI, wo die Crusoe’sche Robinsonade in den Gängen voll ultraleichter Überlebensausrüstung und, vielleicht gerade, durch bestimmte Zivilisation-in-der-Wildnis-Embleme wie dem Martiniglas aus rostfreiem Stahl mit abnehmbarem Stiel überdauerte. Außer mit einem neuen Rucksack, Zelt und Messer stattete ich mich mit ein paar neuartigen Spezialartikeln aus, etwa einem Plastiktablett mit Silikonrand, das sich mit einem Flappen in eine Schüssel verwandelte, Ascorbinsäure-Tabletten, die den Geschmack von mit Jod sterilisiertem Wasser neutralisieren sollten, einem Microfaser-Handtuch, das sich in einem bemerkenswert kleinen Beutel verstauen ließ, biologisch gefriergetrocknetem Chili und einem unkaputtbaren Göffel. Außerdem trug ich große Vorräte an Nüssen, Thunfisch und Proteinriegeln zusammen, denn mir war gesagt worden, dass ich bei schlechtem Wetter ewig auf Más Afuera festsitzen könne.
Am Vorabend meiner Abreise nach Santiago besuchte ich meine Freundin Karen, die Witwe des Schriftstellers David Foster Wallace. Als ich schon im Aufbruch war, fragte sie mich, aus heiterem Himmel, ob ich vielleicht etwas von Davids Asche mitnehmen und auf Más Afuera verstreuen wolle. Ich bejahte, und sie holte eine antike Zündholzschachtel aus Holz, ein winziges Buch mit einer Schublade, füllte etwas Asche hinein und sagte, ihr gefalle der Gedanke, dass ein Teil von David auf einer entlegenen und unbewohnten Insel seine Ruhe finden würde. Erst später, als ich schon losgefahren war, begriff ich, dass sie mir die Asche ebenso sehr um meinet- wie um ihret- oder Davids willen gegeben hatte. Sie wusste von mir, dass mein gegenwärtiges Fliehen vor mir selbst zwei Jahre zuvor, kurz nach Davids Tod, begonnen hatte. Damals hatte ich die Entscheidung getroffen, mich nicht mit dem fiesen Selbstmord von jemandem, den ich so sehr geliebt hatte, auseinanderzusetzen, sondern mich stattdessen in Zorn und Arbeit zu flüchten. Jetzt allerdings, nach getaner Arbeit, war der Umstand, dass David, einer möglichen Interpretation seines Selbstmords zufolge, an Langeweile gestorben war und ohne Hoffnung für seine künftigen Romane, schwerer zu ignorieren. Der schneidende Unterton meiner eigenen Langeweile in letzter Zeit: Könnte er damit zu tun haben, dass ich selbst ein Versprechen gebrochen hatte? Dass ich mir nach Beendigung meines Buchprojekts mehr als flüchtige Trauer und fortdauernden Zorn über Davids Tod gestatten würde?
Und so erreichte ich, am letzten Januarmorgen, in dichtem Nebel einen Fleck auf Más Afuera namens La Cuchara (Der Löffel), tausend Meter über Meereshöhe. Ich hatte ein Notizbuch, ein Fernglas, eine Taschenbuchausgabe von Robinson Crusoe, das kleine Buch mit Davids Überresten, einen Rucksack voll Campingausrüstung, eine grotesk unzulängliche Karte der Insel und keinen Alkohol, Tabak oder Computer dabei. Abgesehen davon, dass ich, statt alleine zu wandern, einem jungen Parkranger und einem Maultier folgte, das meinen Rucksack trug, und dass ich außerdem, auf das Insistieren diverser Leute hin, ein Funkgerät, eine zehn Jahre alte GPS-Einheit, ein Satellitentelefon und mehrere Ersatzbatterien mitgebracht hatte, war ich völlig isoliert und allein.
Zuallererst begegnete ich Robinson Crusoe, weil mein Vater mir daraus vorlas. Neben Les Misérables war es der einzige Roman, der ihm etwas bedeutete. Das Vergnügen, das er darin fand, ihn mir vorzulesen, zeigt, dass er sich mit Crusoe so sehr identifizierte wie mit Jean Valjean (den er, Autodidakt, der er war, «Gene Val Gene» aussprach). Wie Crusoe fühlte sich mein Vater von anderen Menschen isoliert, war entschieden moderat in seinen Gewohnheiten, glaubte an die Überlegenheit der westlichen Zivilisation über die «Wildheit» anderer Kulturen, begriff die Natur als etwas, das man bändigen und ausbeuten müsse, und war ein unverbesserlicher Heimwerker. Selbstdiszipliniertes Überleben auf einer wüsten Insel, umgeben von Kannibalen, das war für ihn die vollkommene Romantik. Er war in einem rauen Städtchen geboren, das sein Pioniervater und seine Pionieronkel gebaut hatten, und bei der Arbeit in Straßenbaucamps im borealen Sumpfland erwachsen geworden. In unserem Keller in St. Louis betrieb er eine gut sortierte Werkstatt, in der er seine Werkzeuge schärfte, seine Kleider flickte (er konnte gut nähen) und aus Holz und Metall und Leder robuste Lösungen für häusliche Instandhaltungsprobleme improvisierte. Mehrmals im Jahr ging er mit meinen Freunden und mir zelten, errichtete, während ich mit meinen Freunden in die Wälder lief, unser Lager und machte sich neben unseren wattierten Schlafsäcken ein Bett aus derben alten Laken. Ich glaube, dass ich ihm in gewisser Weise die Ausrede bot, zelten zu gehen.
Mein Bruder Tom, nicht minder ein Heimwerker als mein Vater, wurde, als er aufs College ging, ein echter Backpacker. Weil ich Tom in allem nachzueifern versuchte, lauschte ich seinen Geschichten über zehntägige Solotrips in Colorado oder Wyoming und sehnte mich danach, selbst ein Backpacker zu sein. Meine erste Chance bekam ich in dem Sommer, als ich sechzehn wurde und meine Eltern überredete, mich an einem Sommerschulkurs namens «Camping im Westen» teilnehmen zu lassen. Für zwei Wochen «Studium» in den Rockys schlossen mein Freund Weidman und ich uns einer Busladung Teenager und Betreuer an. Ich hatte Toms ausgemusterten roten Gerry-Rucksack dabei und (für Notizen zu meinem eher zufällig gewählten Studiengebiet, Flechten) ein Notizbuch, das dem, das Tom immer bei sich trug, exakt glich.
Am zweiten Tag eines Trecks in die Sawtooth-Wildnis in Idaho wurden wir aufgefordert, vierundzwanzig Stunden alleine zu verbringen. Mein Betreuer brachte mich in ein schütteres Gelbkiefernwäldchen und ließ mich dort allein, und sehr bald kauerte ich, obwohl der Tag schön und nicht weiter bedrohlich war, in meinem Zelt. Offensichtlich musste ich, um mir der Leere des Lebens und des Grauens der Existenz bewusst zu werden, nur für ein paar Stunden der menschlichen Gesellschaft beraubt werden. Am nächsten Tag erfuhr ich, dass Weidman, obwohl acht Monate älter als ich, sich derart einsam gefühlt hatte, dass er bis zu der Stelle zurückgelaufen war, von der aus er das Basislager wieder sehen konnte. Was es mir möglich machte, draußen zu bleiben – und mehr noch, mir das Gefühl gab, dass ich es auch länger als einen Tag ausgehalten hätte –, war das Schreiben:
DONNERSTAG, 3. JULI
Heute Abend beginne ich ein Notizbuch. Sollte irgendjemand dies lesen, vertraue ich darauf, dass er mir den übermäßigen Gebrauch des Wortes «ich» verzeiht. Ich kann nicht damit aufhören. Ich schreibe dies.
Als ich heute Nachmittag nach dem Essen zu meinem Feuer zurückkam, gab es einen Augenblick, in dem mir meine Aluminiumtasse wie ein Freund erschien, sie saß auf einem Stein, betrachtete mich …
Eine bestimmte Fliege (jedenfalls glaube ich, dass es ein und dieselbe war) summte heute Nachmittag eine ganze Weile um meinen Kopf herum. Nach einer gewissen Zeit hörte ich auf, sie als ein störendes, garstiges Insekt zu sehen & begann unbewusst, sie als Gegner zu begreifen, den ich eigentlich ganz gern mochte, und dass wir nur miteinander spielten.
Ebenfalls an diesem Nachmittag (das war meine Hauptaktivität) habe ich mich auf einen Felsvorsprung gesetzt, um die verschiedenen Zwecke meines Lebens, wie ich sie zu verschiedenen Zeiten gesehen habe (3 – was die Sichtweisen betrifft), in die Worte eines Sonetts zu fassen. Natürlich ist mir jetzt klar, dass ich das nicht mal in Prosa hinkriege, also war es echt unnütz. Wie auch immer, als ich dabei war, war ich plötzlich überzeugt, dass das Leben Zeitverschwendung wäre oder so was. Ich war so traurig und fertig, dass jeder Gedanke in Verzweiflung mündete. Doch dann sah ich mir ein paar Flechten an & schrieb ein bisschen über sie & beruhigte mich und kam zu dem Schluss, dass sich mein Kummer keinem Sinnverlust verdankte, sondern der Tatsache, dass ich nicht wusste, wer ich war oder warum ich war, und meinen Eltern nicht zeigte, dass ich sie liebte. Ich näherte mich meinem dritten Punkt, aber mein nächster Gedanke schweifte ein bisschen ab. Ich kam zu dem Schluss, dass der Grund für das Obige war, dass die Zeit (das Leben) zu kurz ist. Das stimmt natürlich, aber es war nicht der wahre Grund für meinen Kummer. Plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Ich vermisste meine Familie.
Als ich mein Heimweh erst einmal diagnostiziert hatte, konnte ich es durch Briefeschreiben lindern. Den Rest der Reise schrieb ich jeden Tag an meinem Journal und stellte fest, dass ich mich von Weidman entfernte und zu meinen weiblichen Mit-Campern hingezogen fühlte; nie zuvor war ich sozial so erfolgreich gewesen. Was mir gefehlt hatte, war ein halbwegs sicheres Gefühl für meine eigene Identität gewesen, ein Gefühl, in der Einsamkeit entdeckt, weil ich Worte in der ersten Person Singular zu Papier gebracht hatte.
Ich war noch jahrelang auf mehr Backpacking erpicht, doch nie erpicht genug, um es auch dazu kommen zu lassen. Das Ich, das ich durchs Schreiben entdeckte, so stellte es sich am Ende heraus, war nicht mit dem Ich von Tom identisch. Ich hielt an seinem alten Gerry-Rucksack fest, obwohl er kein sinnvolles Mehrzweck-Gepäckstück war, und träumte meinen Traum von der Wildnis weiter, indem ich für wenig Geld Campingausrüstung kaufte, die ich nicht brauchte, eine Jumboflasche Dr. Bronner’s Pfefferminzseife zum Beispiel, deren Vorteile Tom periodisch pries. Als ich zu Beginn des letzten Schuljahrs den Bus zurück ins College nahm, steckte ich Dr. Bronner’s in den Rucksack, und die Flasche platzte während der Fahrt, sodass sich meine Kleider und Bücher vollsogen. Als ich den Rucksack in einer Wohnheimdusche auszuwaschen versuchte, zerfiel das Gewebe unter meinen Händen.
Más Afuera wirkte, als sich das Boot näherte, nicht einladend. Die einzige Karte, die ich von der Insel hatte, war die ausgedruckte Seite einer Google-Earth-Aufnahme. Ich sah gleich, dass ich die Konturen wohlwollend missinterpretiert hatte. Was nach steilen Hügeln ausgesehen hatte, waren Klippen, und was nach sanften Abhängen ausgesehen hatte, waren steile Hügel. Etwa ein Dutzend Hummerfängerhütten kauerten auf dem Grund einer gewaltigen Schlucht, zu deren beiden Seiten die grünen Schultern der Insel über tausend Meter hoch in eine Schicht dräuend schäumender Wolken ragten. Die See, die während der Ausfahrt einigermaßen ruhig gewirkt hatte, peitschte in mächtigen Wogen gegen eine Felsenkluft unterhalb der Hütten. Um an Land zu kommen, sprangen die Botaniker und ich in ein Hummerboot, das sich der Küste bis auf hundert Meter näherte. Dort kippten die Bootsleute den Außenborder hoch, und wir packten ein Tau, das zu einer Bake führte, und hangelten uns weiter hinein. Als wir uns den Felsen näherten, schlingerte das Boot wüst von Seite zu Seite, Wasser flutete das Heck, während die Bootsleute sich mühten, uns an ein Kabel zu hängen, das uns reinschleppen würde. An Land waren atemberaubende Mengen Fliegen – der Spitzname des Orts ist Fliegeninsel. Aus den offenen Türen mehrerer Hütten pumpten wetteifernde Ghettoblaster nord- und südamerikanische Musik, die sich gegen die beklemmende Gewaltigkeit der Schlucht und die kalt wogende See stemmte. Eine Gruppe großer, toter Bäume hinter den Hütten, bleich wie Knochen, trug zur bedrückenden Atmosphäre noch bei.
Meine Gefährten auf dem Marsch ins Inselinnere waren der junge Parkranger Danilo und ein Maultier mit Pokerface. In Anbetracht der Steilheit der Insel konnte ich nicht einmal so tun, als wäre ich enttäuscht, mein Bündel nicht selber zu tragen. Danilo hatte sich ein Gewehr über den Rücken geschlungen, in der Hoffnung, eine jener vormals eingeschleppten Ziegen zu schießen, die das jüngste Bestreben einer holländischen Umweltorganisation, sie auszurotten, überlebt hatten. Unter grauen Morgenwolken, die sich bald in Nebel verwandelten, marschierten wir über endlose Serpentinen und durch eine üppig mit Macchie bewachsene Klamm – einer eingeführten Pflanzenart, die zur Reparatur von Hummerfallen verwendet wird. Auf dem Pfad fanden sich entmutigende Mengen von Maultiermist, doch das Einzige, was sich vor unseren Augen bewegte, waren Vögel: ein kleiner Grauflanken-Uferwipper und ein paar Juan-Fernández-Bussarde, zwei von Más Afueras insgesamt fünf landlebenden Vogelarten. Die Insel ist außerdem der einzig bekannte Brutplatz zweier interessanter Sturmvögel und eines der seltensten Singvögel der Welt, des Más-Afuera- bzw. Insel-Stachelschwanzschlüpfers, den ich zu beobachten hoffte. Tatsächlich war, als ich nach Chile aufbrach, das Beobachten neuer Vogelarten die einzige Beschäftigung, die mich zuverlässig nicht langweilte. Die Zahl der Más-Afuera-Schlüpfer, von denen die meisten in einem kleinen, hochgelegenen, Los Inocentes genannten Gebiet der Insel leben, wird mittlerweile auf nur noch fünfhundert geschätzt. Sehr wenige Menschen haben je einen gesehen.
Früher, als ich erwartet hätte, erreichten Danilo und ich La Cuchara und sahen im Nebel die Umrisse eines kleinen refugio, einer Rangerhütte. Wir waren in nur etwas mehr als zwei Stunden bis auf tausend Meter gestiegen. Ich hatte gehört, dass es ein refugio in La Cuchara gebe, hatte mir aber eine primitive Hütte darunter vorgestellt und nicht geahnt, vor welches Problem dieses refugio mich stellen würde. Sein Dach war steil und mit Spannseilen im Boden verankert, und drinnen gab es einen Propangasherd, zwei Stockbetten mit Schaumstoffmatratzen, einen unappetitlichen, aber brauchbaren Schlafsack sowie einen Vorratsschrank voll mit Nudeln und Dosen; offensichtlich hätte ich außer ein paar Jodtabletten gar nichts mitbringen müssen und hier trotzdem überlebt. Das refugio ließ mein ohnehin schon irgendwie artifizielles Projekt einsamer Selbstgenügsamkeit noch artifizieller erscheinen, und ich beschloss, so zu tun, als wäre es nicht da.
Danilo hob mein Bündel vom Maultier und führte mich über einen nebelverhangenen Pfad zu einem Bach, durch den genug Wasser rann, um einen kleinen Teich auszubilden. Ich fragte Danilo, ob man von hier nach Los Inocentes laufen könne. Er gestikulierte bergaufwärts und sagte: «Ja, es sind drei Stunden, die cordones entlang.» Ich erwog zu fragen, ob wir nicht gleich hingehen sollten, damit ich mein Lager näher bei den Más-Afuera-Schlüpfern aufschlagen könnte, aber Danilo schien es eilig zu haben, zurück zur Küste zu kommen. Er verschwand mit dem Maultier und seinem Gewehr, und ich beugte mich meinen crusoeischen Aufgaben.
Die erste bestand darin, Trinkwasser zu holen und zu reinigen. Mit einer Filtrationspumpe und einem Segeltuch-Trinkschlauch folgte ich dem, was ich für den Pfad zu dem meines Wissens nicht weiter als sechzig Meter vom refugio entfernten Teich hielt, und verirrte mich sofort im Nebel. Als ich, nachdem ich mehrere Pfade ausprobiert hatte, endlich auf den Teich gestoßen war, brach der Schlauch meiner Pumpe. Ich hatte die Pumpe zwanzig Jahre zuvor gekauft, weil ich gedacht hatte, dass sie mir doch bestimmt gelegen kommen werde, sollte ich je allein in der Wildnis sein, und bis es so weit kam, war das Gummi brüchig geworden. Ich füllte den Segeltuchschlauch mit ziemlich trübem Wasser, betrat, gegen meine Vorsätze, das refugio und goss das Wasser mit ein paar Jodtabletten in einen großen Kochtopf. Irgendwie hatte mich diese einfache Aufgabe eine Stunde gekostet.
Da ich nun schon mal im refugio war, wechselte ich meine von der Kletterei durch Tau und Nebel durchweichten Kleider und versuchte, das Innere meiner Stiefel mit dem überschüssigen Toilettenpapier, das ich gekauft hatte, zu trocknen. Ich entdeckte, dass die GPS-Einheit, das einzige Gerät, für das ich keine Ersatzbatterien dabeihatte, den ganzen Tag lang eingeschaltet gewesen war und Strom verbraucht hatte, und bekämpfte die Angst, die das in mir auslöste, indem ich mit noch mehr Klopapier-Wülsten alles Wasser und allen Schlamm vom refugio-Boden wischte. Schließlich wagte ich mich auf einen Felsvorsprung hinaus und hielt nach einem Lagerplatz jenseits der refugio-Penumbra aus Maultierkot Ausschau. Ein Bussard stieß genau über meinem Kopf herab; ein Uferwipper rief keck von einem Felsbrocken aus. Nach viel Lauferei und viel Für und Wider entschied ich mich für eine Senke, die einigermaßen Schutz vor dem Wind und keine Sicht auf das refugio bot, und dort picknickte ich Käse und Salami.
Ich war seit vier Stunden allein. Ich baute mein Zelt auf, verzurrte das Gestell an einigen Felsen, beschwerte die Heringe mit den größten Steinen, die ich tragen konnte, und kochte auf meinem kleinen Butangaskocher Kaffee. Zurück im refugio, arbeitete ich an meinem Stiefeltrocknungsprojekt, wobei ich alle paar Minuten eine Pause einlegte, um die Fliegen, die beständig hereinfanden, aus dem Fenster zu scheuchen. Offenbar konnte ich mir den Komfort des refugio so wenig abgewöhnen wie die modernen Ablenkungen, denen zu entkommen ich doch angeblich hier war. Ich holte einen weiteren Schlauchvoll Wasser und nutzte den großen Topf und den Propangasherd, um Badewasser zu erhitzen, und es war, nach meinem Bad, einfach viel angenehmer, wieder reinzugehen und mich mit dem Microfaserhandtuch abzutrocknen und mich anzuziehen, als das alles draußen in Dreck und Nebel zu tun. Und weil ich schon so kompromittiert war, machte ich weiter und trug eine der Schaumstoffmatratzen runter zum Felsvorsprung und legte sie in mein Zelt. «Aber das war’s», sagte ich laut zu mir. «Jetzt ist Schluss.»
Abgesehen vom Summen der Fliegen und dem gelegentlichen Ruf eines Uferwippers, war die Stille an meinem Lagerplatz vollkommen. Manchmal lichtete sich der Nebel ein bisschen, und ich konnte die felsigen Hänge und feuchten, farnbewachsenen Täler sehen, bevor sich der Vorhang wieder senkte. Ich holte mein Notizbuch hervor und notierte, was ich in den vergangenen sieben Stunden getan hatte: Wasser geholt, Mittag gegessen, Zelt aufgebaut, Bad genommen. Doch als ich in Erwägung zog, bekenntnishaft zu schreiben, in einer «Ich»-Stimme, stellte ich fest, dass ich mir meiner selbst dafür zu bewusst war. Offenbar hatte ich mich in den vergangenen fünfunddreißig Jahren derart daran gewöhnt, mich selbst zur Erzählung zu machen, mein Leben als Geschichte zu erleben, dass ich die Journale nur noch zur Problemlösung und zur Selbstbefragung nutzen konnte. Selbst mit fünfzehn, in Idaho, hatte ich nicht aus dem Innern meiner Verzweiflung geschrieben, sondern erst nachdem ich sie sicher überwunden hatte, und die Geschichten, die mir etwas bedeuteten, waren nun umso mehr jene, die – ausgewählt, geklärt – im Rückblick erzählt wurden.
Mein Plan für den nächsten Tag war, einen Más-Afuera-Schlüpfer zu sehen. Allein das Wissen darum, dass es den Vogel hier gab, machte die Insel für mich interessant. Wenn ich losziehe, um neue Vogelarten zu beobachten, suche ich nach einer zumeist verlorenen Authentizität, nach den Überbleibseln einer Welt, die jetzt großteils von Menschen überlaufen ist, uns aber noch immer wunderbar gleichgültig gegenübersteht; einen seltenen Vogel zu erspähen, der irgendwie an seinem Leben aus Brüten und Füttern festhält, ist eine dauerhaft transzendente Freude. Ich beschloss, im Morgengrauen aufzustehen und, wenn nötig, den ganzen Tag dafür aufzuwenden, nach Los Inocentes zu finden und zurück. Von der Aussicht auf diese nicht wenig anspruchsvolle Aufgabe ermuntert, machte ich mir eine Schüssel Chili und zog, obwohl das Tageslicht noch nicht geschwunden war, den Reißverschluss zu. Auf der sehr bequemen Matratze, in einem Schlafsack, den ich seit der Highschool besaß, und mit einer Lampe auf der Stirn, legte ich mich hin, um Robinson Crusoe zu lesen. Zum ersten Mal an diesem Tag war ich glücklich.
Einer der ersten großen Fans von Robinson Crusoe war Jean-Jacques Rousseau. Er empfahl den Roman, in Émile, als Grundlagentext für die Kindererziehung. In der feinen Tradition französischer Verhunzung hatte Rousseau nicht den vollständigen Text im Sinn, sondern nur den langen zentralen Abschnitt, in dem Robinson erzählt, wie er ein Vierteljahrhundert lang allein auf einer einsamen Insel überlebt. Wenige Leser würden bestreiten, dass dies der fesselndste Teil des Romans ist, neben dem Robinsons Abenteuer davor und danach (er wird von einem türkischen Piraten versklavt, wehrt die Angriffe riesiger Wölfe ab) routiniert und glanzlos wirken. Zum Teil liegt der Reiz der Geschichte in der Genauigkeit von Robinsons Bericht: den «drei Hüten, einer Mütze und zwei ungleichen Schuhen», die alles sind, was von seinen ertrunkenen Schiffskameraden übrig ist, dem Katalog nützlicher Dinge, die er aus dem Wrack birgt, den Schwierigkeiten der Pirsch auf die verwilderten Ziegen, die die Insel bewohnen, den Einzelheiten der Neuerfindung von Möbeln, Booten, Töpferwaren und Brot. Doch was diese abenteuerlosen Abenteuer wirklich lebendig und verblüffend spannend macht, ist der Umstand, dass der durchschnittliche Leser sie sich so gut vorstellen kann. Ich habe keine Ahnung, was ich täte, würde ich von einem Türken versklavt oder von Wölfen bedroht; sehr gut möglich, dass ich zu große Angst hätte, um zu tun, was Robinson tut. Aber von seinen praktischen Lösungen für Probleme wie Hunger und Schutzlosigkeit und Krankheit und Einsamkeit zu lesen heißt, in die Erzählung eingeladen zu werden und mir vorzustellen, was ich getan hätte, wäre ich ebenso gestrandet, und meine eigene Ausdauer und Findigkeit und Emsigkeit an der Robinsons zu messen. (Ich bin sicher, mein Vater hat das auch getan.) Bis die größere Welt in Gestalt marodierender Kannibalen über die Einsamkeit der Insel hereinbricht, gibt es nur uns beide, Robinson und seinen Leser, und es ist sehr behaglich. In einer actionreicheren Erzählung wären die Seiten, die Robinsons alltägliche Verrichtungen und Gefühle schildern, wohl etwas, was der Kritiker Franco Moretti trocken «Füllsel» genannt hat. Doch die dramatische Entfaltung dieser Art «Füllsel» war, wie Moretti feststellt, eben Defoes große Innovation; solche Geschichten des Alltäglichen wurden zum Inventar realistischer Literatur, bei Austen und Flaubert wie bei Updike und Carver.
Die Gestaltung und teilweise Durchdringung von Defoes «Füllseln» ist schon zuvor Gegenstand großer Formen der Prosaerzählung gewesen: klassischer hellenistischer Romane, die Geschichten von Schiffbrüchen und Versklavungen enthielten; spiritueller Biographien des Katholizismus und Protestantismus; Romanzen aus dem Mittelalter und der Renaissance und spanischer Pikaroromane. Defoes Roman steht außerdem in einer Tradition von Erzählungen oder Pamphleten, die auf dem Leben bekannter Persönlichkeiten basieren oder das zumindest vorgeben; in Crusoes Fall war Alexander Selkirk das Vorbild. Es ist sogar behauptet worden, dass Defoe mit dem Roman ein Stück utopistischer Propaganda bezweckt hat und die religiösen Freiheiten und das wirtschaftliche Potenzial von Englands neuweltlichen Kolonien pries. Die Heterogenität von Robinson Crusoe macht deutlich, wie problematisch, vielleicht sogar absurd es ist, vom «Aufstieg des Romans» zu reden und Defoes Werk als Erstes seiner Art zu beschreiben. Schließlich ist Don Quijote, mehr als ein Jahrhundert zuvor veröffentlicht, offenkundig ein Roman. Und warum sollte man nicht auch die Romanzen Romane nennen, wurden sie doch im 17. Jahrhundert weithin publiziert und gelesen, weshalb die meisten europäischen Sprachen bis heute nicht zwischen Romanze und Roman unterscheiden. Frühe englische Romanciers haben oft ausdrücklich betont, dass ihre Werke keine «bloßen Romanzen» seien; andererseits hatten das schon die Romanzenschreiber selbst getan. Und doch, ab dem frühen 19. Jahrhundert, als die maßgeblichen Vertreter der Form erstmals in verbindlichen Ausgaben von Walter Scott und anderen gesammelt wurden, hatten die Engländer nicht nur eine sehr genaue Vorstellung davon, was sie mit «novels» meinten, sondern exportierten auch viele von ihnen in Übersetzungen in andere Länder. Was also genau ist ein Roman, und warum tauchte das Genre auf, als es auftauchte?
Die überzeugendste Erklärung bleibt die politisch-ökonomische, die Ian Watt vor fünfzig Jahren vorgebracht hat. Die Geburtsstätte des Romans in seiner modernen Form ist nämlich zufällig Europas ökonomisch führende und höchstentwickelte Nation, und Watts Analyse dieser Koinzidenz ist schonungslos, aber beeindruckend. Er verbindet die Verherrlichung des tätigen Individuums, die Entwicklung eines gebildeten Bürgertums, das begierig war, von sich selbst zu lesen, die zunehmende soziale Mobilität (die Schriftsteller dazu veranlasste, die damit einhergehenden Ängste zu verwerten), die Spezialisierung von Arbeit (die eine Gesellschaft interessanter Unterschiede schuf), den Zerfall der alten sozialen Ordnung hin zu einem Sammelbecken individuell Isolierter und, natürlich, die dramatische Zunahme von freier Zeit zum Lesen. Gleichzeitig wurde England rapide säkularer. Die protestantische Theologie hatte die Grundlagen für die neue Wirtschaft gelegt, indem sie die soziale Ordnung als Ansammlung eigenverantwortlicher Individuen mit direkter Beziehung zu Gott neu entwarf; ab 1700 jedoch, als die britische Wirtschaft florierte, war es immer weniger gewiss, ob diese Individuen Gott überhaupt brauchten. Es stimmt, dass, wie jeder ungeduldige kindliche Leser bestätigen kann, viele Seiten von Robinson Crusoe der spirituellen Reise seines Helden gewidmet sind. Auf der Insel findet Robinson Gott, und in Momenten der Krise wendet er sich wiederholt an ihn, betet um Errettung und dankt ihm ekstatisch für die Bereitstellung des dazu Nötigen. Und doch, kaum ist die Krise überstanden, kehrt er jedes Mal zu seinem praktischen Selbst zurück und denkt nicht mehr an Gott; am Ende des Buchs scheinen es eher sein Fleiß und seine Findigkeit gewesen zu sein, die ihn gerettet haben, als die Vorsehung. Die Geschichte von Robinsons Schwanken und seiner Vergesslichkeit zu lesen heißt, nachzuvollziehen, wie sich das Genre der spirituellen Autobiographie auflöst und in realistische Literatur übergeht.
Der interessanteste Aspekt bei der Frage nach dem Ursprung des Romans könnte die Evolution der Lösungen sein, die die englische Kultur für das Problem der Plausibilität gefunden hat: Sollte man eine seltsame Geschichte für wahr halten, weil sie seltsam war, oder sollte ihre Seltsamkeit als Beweis dafür genommen werden, dass sie nicht stimmte? Die Aufregungen um die Frage sind uns noch vertraut (man denke an den Skandal um James Freys sogenannte Erinnerungen), und bestimmt waren sie auch 1719 im Spiel, als Defoe den ersten und bekanntesten Band des Robinson Crusoe veröffentlichte. Der wahre Name des Autors tauchte darin nirgends auf. Das Buch wurde stattdessen als Das Leben und die seltsamen Abenteuer des Robinson Crusoe … Geschrieben von ihm selbst bezeichnet, und viele seiner ersten Leser hielten es für eine nicht ausgedachte Geschichte. Genug andere Leser jedoch bezweifelten ihre Authentizität, sodass sich Defoe, als er im Jahr darauf den dritten und letzten Band veröffentlichte, genötigt sah, ihre Wahrhaftigkeit zu verteidigen. Er bestand darauf, dass im Gegensatz zu den Romanzen, in denen «die Geschichte vorgetäuscht» sei, seine Geschichte, «obschon allegorisch, auch historisch ist», und bestätigte, dass «da ein Mann am Leben ist, und wohlbekannt zudem, dessen Taten billigerweise der Stoff dieser Bände sind». Angesichts dessen, was wir über Defoes wirkliches Leben wissen – wie Crusoe geriet er durch riskante Geschäfte wie die Aufzucht von Zibetkatzen zur Parfümherstellung in Schwierigkeiten, gründliche Erfahrungen mit der Einsamkeit hatte er im Schuldgefängnis gesammelt, in das ihn der Bankrott zweimal brachte –, und auch angesichts seiner Versicherung andernorts im selben Band, dass «das Leben im Allgemeinen nur ein universaler Akt der Einsamkeit ist oder sein sollte», scheint der Schluss, dass der «wohlbekannte» Mann Defoe selber ist, gerechtfertigt. (Bemerkenswerterweise enden beider Namen auf «oe».) Heute begreifen wir den Roman als Abbild eines Wachtraums des Autors, und in Defoes versuchsweiser Behauptung einer weniger als strikt historischen Wahrheit lässt sich eine entscheidende Wendung hin zu diesem Verständnis erkennen – der «Wahrheit» des Romanciers. In ihrem Essay «The Rise of Fictionality» beschreibt die Literaturwissenschaftlerin Catherine Gallagher ein mit solcher Art Wahrheit verbundenes, sonderbares Paradox: Im 18. Jahrhundert hörten die Schriftsteller (mehr oder weniger angefangen mit Defoe) nicht nur auf zu behaupten, ihre Erzählungen seien nicht erfunden; sondern sie gaben sich auch große Mühe, ihre Erzählungen nicht länger erfunden wirken zu lassen – Plausibilität wurde Pflicht. Gallaghers Erklärung für dieses Paradox weist auf einen weiteren Aspekt der Moderne hin, die Notwendigkeit nämlich, Risiken einzugehen. Sobald ein Geschäft auf Investitionen angewiesen war, musste man diverse mögliche Ergebnisse gegeneinander abwägen; sobald Ehen nicht länger arrangiert wurden, musste man auf die Vorzüge potenzieller Partner spekulieren. Und der Roman, wie er sich im 18