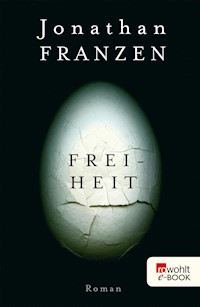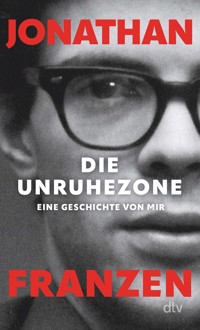
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Franzen über Franzen: sein persönlichstes Buch Über Kindheit, Vögel, deutsche Sprache, über Leben, Lieben und Charlie Brown Jonathan Franzen hatte als Junge nicht nur vor Umkleideräumen und Quallen Angst. Zu Hause kam er sich wie Snoopy vor, der zwischen größeren Wesen einer anderen Spezies lebt. Wenigstens unter Gleichaltrigen wollte er dazugehören, also mied er auf einer Fahrt ins christliche Feriencamp den Bus des »sozialen Tods«. Von einer Österreicherin in irritierend kurzem Rock lernte er erste Brocken Deutsch, und bei seinem Versuch, seine Jungfräulichkeit zu verlieren, spielte Kafka eine Rolle – wie auch auf seinem Weg zum Schreiben. ›Die Unruhezone‹ ist beides: Geschichte einer Jugend im amerikanischen Mittelwesten und eines Erwachsenenlebens in New York. Ein vielfarbiges, mitunter komisch-trotziges Selbstporträt eines Menschen in seiner Zeit. Das weise, komische, hinreißend geschriebene Selbstporträt eines der größten US-Schriftsteller unserer Zeit – »ein wunderbares, zutiefst persönliches Erinnerungsbuch.« Time
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Als Junge hatte Jonathan Franzen nicht nur vor Umkleideräumen und Quallen Angst. Zu Hause kam er sich wie Snoopy vor, der zwischen größeren Wesen einer anderen Spezies lebt. Wenigstens unter Gleichaltrigen wollte er dazugehören, also mied er auf einer Fahrt ins christliche Ferienlager den Bus des »sozialen Tods«. Von einer Österreicherin in irritierend kurzem Rock lernte er erste Brocken Deutsch, und bei seinem Versuch, seine Jungfräulichkeit zu verlieren, spielte Kafka eine Rolle, wie auch auf seinem Weg zum Schreiben. ›Die Unruhezone‹ ist beides: Geschichte einer Jugend im amerikanischen Mittelwesten und eines Erwachsenenlebens in New York. Das weise, mitunter komisch-trotzige Selbstporträt eines der größten US-Schriftsteller unserer Zeit.
Von Jonathan Franzen ist bei dtv außerdem lieferbar:
Freiheit
Anleitung zum Alleinsein
Jonathan Franzen
Die Unruhezone
Eine Geschichte von mir
Aus dem Englischen von Eike Schönfeld
Für Bob und Tom
Haus zu verkaufen
Am Abend hatte es in St. Louis ein Gewitter gegeben. Das Wasser stand in dampfenden schwarzen Lachen auf dem Asphalt vor dem Flughafen, und vom Rücksitz meines Taxis aus konnte ich Eichenäste vor tiefhängenden Stadtwolken schwanken sehen. Die samstagnächtlichen Straßen waren von einem Gefühl des Danach, des Zuspät gesättigt – der Regen fiel nicht, er war schon gefallen.
Das Haus meiner Mutter in Webster Groves war bis auf eine Lampe an einer Zeitschaltuhr im Wohnzimmer dunkel. Ich schloss auf, ging geradewegs zur Hausbar und genehmigte mir den Hammerdrink, den ich mir schon vor dem ersten meiner beiden Flüge versprochen hatte. Wie ein Wikinger empfand ich ein Anrecht auf alle Vorräte, die ich plündern konnte. Mein vierzigster Geburtstag stand bevor, und meine älteren Brüder hatten mich mit der Aufgabe betraut, nach Missouri zu reisen und einen Makler auszuwählen, der das Haus verkaufen sollte. Solange ich in Webster Groves war und mich um den Nachlass kümmerte, gehörte die Hausbar mir. Mir! Dito die Klimaanlage, die ich auf frostig herunterdrehte. Dito der Gefrierschrank in der Küche, dem ich in der Hoffnung, ein paar Frühstückswürstchen darin zu finden, hausgemachten Rindfleischeintopf, irgendetwas Fettes und Würziges, das ich vor dem Zubettgehen würde aufwärmen und essen können, sofort auf den Grund gehen musste. Meine Mutter war immer darauf bedacht gewesen, Lebensmittel mit dem Einfrierdatum zu versehen. Unter zahlreichen Beuteln Preiselbeeren fand ich eingewickelte Schwarzbarsche, die ein Angler aus der Nachbarschaft drei Jahre zuvor gefangen hatte. Unter den Barschen lag eine neun Jahre alte Rinderbrust.
Ich ging durchs Haus und nahm in jedem Zimmer die Familienfotos an mich. Auf diese Arbeit hatte ich mich fast genauso gefreut wie auf den Drink. Meine Mutter hatte auf das Formelle ihres Wohnzimmers und Esszimmers zu viel Wert gelegt, um sie mit Schnappschüssen vollzustellen, aber überall sonst war jedes Fensterbrett und jeder Tisch ein Strudel, in dem sich preisgünstig gerahmte Fotos angesammelt hatten. Eine Einkaufstasche füllte ich mit der Beute von ihrer Fernsehtruhe. Eine weitere Tasche voll pflückte ich wie Spalierobst von einer Wand des Familienzimmers. Auf vielen Bildern waren die Enkel zu sehen, aber auch ich war vertreten – hier lasse ich an einem Strand in Florida ein Zahnspangenlächeln blitzen, hier mache ich bei der Abschlussfeier am College ein verkatertes Gesicht, hier ziehe ich an meinem unheilvollen Hochzeitstag die Schultern hoch, hier stehe ich während eines Alaskaurlaubs, für den meine Mutter, da ging es schon aufs Ende zu, einen beträchtlichen Anteil ihrer Ersparnisse aufgewandt hatte, damit sie uns alle bei sich haben konnte, einen Meter von den anderen entfernt. Das Alaskafoto schmeichelte neun von uns so sehr, dass sie blaue Kugelschreiberpunkte auf die Augen der zehnten gemacht hatte, einer Schwiegertochter, die bei der Aufnahme geblinzelt hatte und nun, mit ihren missratenen Tintenknopfaugen, leicht monströs oder wahnsinnig aussah.
Ich redete mir ein, dass ich, indem ich das Haus entpersönlichte, bevor es der erste Makler besichtigen kam, eine wichtige Arbeit leistete. Doch wenn jemand mich gefragt hätte, wozu es ebenfalls nötig war, dass ich noch an jenem ersten Abend die über hundert Fotos auf einem Tisch im Souterrain stapelte und jedes Foto aus seinem Rahmen riss, schnitt, hebelte oder zog und dann alle Rahmen in Einkaufstaschen kippte und die Einkaufstaschen in Schränken verstaute und alle Fotos in einen Umschlag steckte, damit niemand sie sehen konnte – falls jemand auf meine Ähnlichkeit mit einem Eroberer verwiesen hätte, der die Kirchen des Feindes niederbrennt und seine Ikonen zerstört –, hätte ich zugeben müssen, dass ich meinen Hausbesitz genoss.
Ich war der Einzige der Familie, der hier seine gesamte Kindheit verbracht hatte. Als Teenager hatte ich, wenn meine Eltern ausgehen wollten, die Sekunden gezählt, bis ich für eine begrenzte Zeit die volle Herrschaft über das Haus antreten konnte, und solange sie weg waren, bedauerte ich, dass sie wiederkommen würden. In den Jahrzehnten seither hatte ich die sklerotische Zunahme der Familienfotos grollend mit angesehen und mich darüber aufgeregt, dass meine Mutter meinen Schubladen- und Schrankraum usurpierte, und auf ihre Bitte, meine alten Kartons mit den Büchern und Papieren wegzuschaffen, hatte ich wie eine Hauskatze, der sie Gemeinschaftssinn beizubringen suchte, reagiert. Offenbar glaubte sie, es gehöre alles ihr.
Was natürlich stimmte. Es war das Haus, in das sie zehn Monate lang, an fünf Tagen im Monat, während meine Brüder und ich unserem jeweiligen Küstenleben nachgingen, allein von der Chemotherapie zurückgekommen und ins Bett gekrochen war. Das Haus, von dem aus sie mich ein Jahr danach, Anfang Juni, in New York angerufen und gesagt hatte, sie müsse noch einmal ins Krankenhaus, zu einer weiteren Probeexzision, und dann in Tränen ausgebrochen war und sich dafür entschuldigt hatte, dass sie uns alle nur enttäusche und immer noch mehr schlechte Nachrichten für uns habe. Das Haus, in dem sie, eine Woche nachdem ihr Chirurg bitter den Kopf geschüttelt und ihr den Unterleib wieder zugenäht hatte, die ihr vertrauteste Schwiegertochter über die Vorstellung eines Lebens nach dem Tod befragt und meine Schwägerin eingeräumt hatte, allein schon der Logistik wegen erscheine ihr das ziemlich weit hergeholt, worauf meine Mutter, ihr zustimmend, den Punkt «Sich übers Leben nach dem Tod klarwerden» sozusagen abgehakt hatte und mit ihrer Liste der noch zu erledigenden Dinge in ihrer üblichen pragmatischen Art fortgefahren war, sich anderen Aufgaben zuwendend, die durch ihr Sich-Klarwerden dringlicher denn je geworden waren, wie etwa «Beste Freundinnen nacheinander einladen und für immer Abschied von ihnen nehmen». Es war das Haus, von dem aus mein Bruder Bob sie an einem Samstagvormittag im Juli zu ihrer Friseurin gefahren hatte, die Vietnamesin war und niedrige Preise nahm und sie mit den Worten «Oh, Mrs. Fran, Mrs. Fran, Sie sehen ja furchtbar aus» begrüßte, und in das sie eine Stunde später zurückgekehrt war, um ihre Verschönerung zu vervollkommnen, weil sie lange gehortete Vielfliegermeilen für zwei Businessclass-Tickets eingelöst hatte und Businessclass-Reisen ein Anlass waren, besonders gut auszusehen, was sich auch mit Sich-besonders-gut-Fühlen umschreiben ließ; sie kam, für die Businessclass gekleidet, von ihrem Schlafzimmer nach unten, verabschiedete sich von ihrer Schwester, die aus New York angereist war, um sicherzustellen, dass das Haus nicht leerstand, wenn meine Mutter von dort aufbrach – dass noch jemand da war –, fuhr dann mit meinem Bruder zum Flughafen und flog für den Rest ihres Lebens an die Pazifikküste im Nordwesten. Ihr Haus war, da ein Haus, hinreichend langsamer in seinem Sterben, sodass es für meine Mutter, die als Halt etwas Größeres brauchte als sich selbst, aber nicht an übernatürliche Wesen glaubte, eine Ruhezone war. Ihr Haus war der starke (aber nicht unendlich starke) und unerschütterliche (aber nicht immerwährende) Gott, den sie geliebt und dem sie gedient hatte und der ihr eine Stütze gewesen war, und meine Tante hatte, indem sie zu dem Zeitpunkt kam, etwas sehr Kluges getan.
Jetzt aber musste das Haus schleunigst auf den Markt. Die erste Augustwoche hatte schon begonnen, und das beste Verkaufsargument, das die zahlreichen Mängel des Hauses aufwog (die winzige Küche, den vernachlässigenswerten Garten, das zu kleine Bad im Obergeschoss), war seine Lage im katholischen Schulbezirk, der der Kirche Mary, Queen of Peace zugeordnet war. Angesichts der Qualität der öffentlichen Schulen von Webster Groves verstand ich nicht, warum eine Familie eigens draufzahlen sollte, um in diesem Bezirk zu leben, nur um dann für den Unterricht durch Nonnen nochmal draufzuzahlen, aber es gab so einiges am Katholischsein, das ich nicht verstand. Meiner Mutter zufolge warteten überall in St. Louis katholische Eltern ungeduldig auf Angebote in diesem Bezirk, und man wusste von Familien in Webster Groves, die ihre Zelte abbrachen und bloß ein, zwei Straßen weiterzogen, um nur ja hineinzugelangen.
Leider würden junge Eltern, wenn das Schuljahr erst einmal angefangen hätte, in drei Wochen also, gar nicht mehr so ungeduldig sein. Weiteren Druck verspürte ich dadurch, dass ich meinem Bruder Tom, dem Nachlassverwalter, helfen wollte, seine Arbeit rasch zu beenden. Einen andersartigen Druck verspürte ich vonseiten meines zweiten Bruders, Bob, der mir eingeschärft hatte, nicht zu vergessen, dass es hier um richtig viel Geld ging. («Die handeln einen von 782 000 Dollar auf 770 000 runter und glauben, das sei im Grunde dieselbe Summe», hatte er zu mir gesagt. «Na ja, du verstehst schon, tatsächlich sind das zwölftausend Dollar weniger. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mir fällt vieles ein, was ich mit zwölftausend Dollar lieber machen würde, als sie dem Fremden zu schenken, der mir ein Haus abkauft.») Der richtig starke Druck ging jedoch von meiner Mutter aus, die noch vor ihrem Tod klargestellt hatte, es gebe keine bessere Art, ihr Andenken zu ehren und die letzten Jahrzehnte ihres Lebens zu würdigen, als das Haus für eine horrende Summe zu verkaufen.
Zählen hatte ihr immer Ruhe und Trost gespendet. Außer dänischem Weihnachtsporzellan und ungestempelten Briefmarkensätzen der amerikanischen Post sammelte sie nichts, allerdings führte sie Listen von jeder Reise, die sie unternommen, jedem Land, das sie betreten, jedem der «wundervollen (außergewöhnlichen) europäischen Restaurants», in denen sie gegessen, jeder Operation, der sie sich unterzogen hatte, und jedem versicherbaren Gegenstand in ihrem Haus und ihrem Banksafe. Sie war Gründungsmitglied eines unbedeutenden Investment-Clubs, der Girl Tycoons hieß und dessen Portfolio-Performance sie genauestens verfolgte. In ihren letzten beiden Lebensjahren, als ihre Prognose sich verschlechterte, hatte sie ein besonderes Augenmerk auf den Verkaufspreis anderer Häuser in unserer Gegend gerichtet und deren Lage und Quadratmeterzahl notiert. Auf einem Blatt Papier, auf dem «Leitfaden für die Ausschreibung der Immobilie Webster Woods 83» stand, hatte sie in der Art, wie jemand anders den eigenen Nachruf entwerfen mochte, eine Musteranzeige verfasst:
Zweistöckiges massives Backstein-Kolonialhaus 3 Schlafzimmer zentraler Salon auf schattigem Grundstück in Sackgasse (Privatstraße). Es hat 3 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer mit Erker, Familienzimmer im Erdgeschoss, Wohnküche mit neuem GE-Geschirrspüler usw. Es hat zwei Wintergärten, zwei offene Holzkamine, angebaute Doppelgarage, Einbruch- und Brandmelder, überall Hartholzböden und unterteilten Keller.
Am Fuß der Seite, unter einer Liste neuangeschaffter Geräte und kürzlich erfolgter Hausreparaturen, stand ihre abschließende Schätzung seines Werts: «1999 – gesch. Wert mind. $ 350 000.» Diese Zahl war das Zehnfache dessen, was sie und mein Vater 1965 dafür hatten zahlen müssen. Das Haus stellte nicht nur den Großteil ihres Vermögens dar, sondern war auch noch die bei weitem erfolgreichste Investition, die sie jemals getätigt hatte. Ich war kein zehnmal glücklicherer Mensch als mein Vater, ihre Enkel waren nicht zehnmal gebildeter als sie. Was sonst in ihrem Leben hatte sich auch nur halb so gut entwickelt wie die Immobilie?
«Damit verkauft sich das Haus!», hatte mein Vater ausgerufen, nachdem er in unserem Keller eine kleine Toilette eingebaut hatte. «Damit verkauft sich das Haus!», hatte meine Mutter gesagt, nachdem sie eine Baufirma dafür bezahlt hatte, den Gehweg vor unserem Haus mit Backsteinen neu zu pflastern. Sie wiederholte den Satz so oft, dass mein Vater die Beherrschung verlor und anfing, die vielen Verbesserungen aufzuzählen, die auf ihn zurückgingen, darunter die neue Toilette, mit der das Haus sich, wie sie offenbar glaubte, nicht verkaufen werde; er dachte laut darüber nach, warum er überhaupt so viele Jahre lang jedes Wochenende gearbeitet hatte, wenn man, «damit sich das Haus verkauft», nur in einen neuen Backsteingehweg zu investieren brauchte! Er lehnte es ab, etwas mit dem Gehweg zu tun zu haben, und überließ es meiner Mutter, das Moos von den Backsteinen zu schrubben und im Winter vorsichtig am Eis herumzukratzen. Doch nachdem er eine halbe Ewigkeit damit verbracht hatte, im Esszimmer, gehrend und spachtelnd und streichend, einen dekorativen Deckenstuck anzubringen, standen er und sie voller Bewunderung vor der fertigen Arbeit und sagten mit großer Befriedigung immer wieder: «Damit verkauft sich das Haus.»
«Damit verkauft sich das Haus.»
«Damit verkauft sich das Haus.»
Weit nach Mitternacht löschte ich unten die Lichter und stieg hinauf in mein Zimmer, das Tom und ich uns geteilt hatten, bis er ans College ging. Meine Tante hatte, bevor sie nach New York zurückkehrte, geputzt, und ich hatte soeben alle Familienfotos entfernt, und nun sah das Zimmer also aus, als könnte es Kaufinteressenten gezeigt werden. Kommoden und Schreibtisch waren leer, der Strich des Teppichbodens hatte vom Staubsaugen meiner Tante ein ordentliches Bogenmuster, die Einzelbetten wirkten frisch gemacht. Daher war ich verblüfft, als ich die Tagesdecke zurückschlug und auf der Matratze nahe am Kissen etwas liegen sah. Es war ein Bündel Briefmarken in kleinen Wachspapierumschlägen: die alte Sammlung Briefmarkensätze meiner Mutter.
Das Bündel war hier so eklatant fehl am Platz, dass es mich im Nacken kribbelte – als könnte ich meine Mutter noch in der Tür stehen sehen, wenn ich mich umdrehte. Eindeutig war sie diejenige, die die Marken versteckt hatte. Sie musste es im Juli getan haben, als sie sich bereit machte, das Haus zum letzten Mal zu verlassen. Ein paar Jahre früher hatte ich sie gefragt, ob ich ihre alten Briefmarkensätze haben könne, und sie hatte gesagt, ich könne gern alles haben, was nach ihrem Tod noch da sei. Möglicherweise hatte sie befürchtet, dass Bob, der Briefmarken sammelte, sich das Bündel aneignen würde, möglicherweise hatte sie auch nur Punkte auf ihrer Erledigungsliste abgehakt. Sie hatte die Umschläge aus einer Kommode im Esszimmer genommen und nach oben zu dem einen Ort gebracht, den aller Wahrscheinlichkeit nach ich als Nächster aufsuchen würde. Welch weitsichtiges Mikromanagement! Die private Botschaft, für die diese Briefmarken standen, das komplizenhafte Zwinkern, mit dem sie Bob übergangen hatte, das Signal, das ankam, als die Absenderin schon tot war: Das war zwar nicht der intime Blick, den Faye Dunaway und Warren Beatty in Bonnie und Clyde wechseln, kurz bevor sie erschossen werden, aber immerhin so intim, wie meine Mom und ich es eben sein konnten. Das Bündel jetzt zu finden war, als hörte ich sie sagen: «Ich achte auf meine kleinen Sachen. Du auch auf deine?»
Die drei Maklerinnen, mit denen ich am Tag darauf sprach, waren so verschieden wie drei Freier in einem Märchen. Die erste war eine strohhaarige, schimmerhäutige Angestellte von Century 21, die sich offenkundig überwinden musste, etwas Nettes über das Haus zu sagen. Jedes Zimmer hielt eine neuerliche Enttäuschung für sie und ihren starkparfümierten Kollegen bereit; sie berieten sich mit gedämpfter Stimme über «Potenzial» und «Extras». Meine Mutter war Tochter eines Barmanns gewesen, die ihr Studium nicht abgeschlossen hatte, und ihren Geschmack hatte sie selbst immer gern als «traditionell» bezeichnet, doch ich hielt es für unwahrscheinlich, dass die anderen Häuser, die von Century 21 angeboten wurden, mit wesentlich besserem Geschmack ausgestattet waren. Es ärgerte mich, dass die Maklerin sich nicht von den Pariser Aquarellen meiner Mutter bezaubern ließ. Stattdessen verglich sie unsere heimelige kleine Küche mit den hangarartigen Räumen in neueren Häusern. Wenn ich mich von ihr vertreten lassen wolle, sagte sie, würde sie vorschlagen, das Haus für einen Preis zwischen $ 340 000 und $ 360 000 anzubieten.
Die zweite Maklerin, eine attraktive Frau namens Pat, die ein elegantes Sommerkostüm trug, war die Freundin einer guten Freundin unserer Familie und brachte die besten Empfehlungen mit. Sie kam in Begleitung ihrer Tochter Kim, die in ihrer Firma mitarbeitete. Während die beiden von Zimmer zu Zimmer gingen und hier und dort stehen blieben, um ausgerechnet die kleinen Sachen zu bewundern, auf die meine Mutter besonders stolz gewesen war, erschienen sie mir wie zwei Inkarnationen des häuslichen Lebens von Webster Groves. Es war, als überlegte Pat, das Haus für Kim zu kaufen, ja als wäre Kim bald in Pats Alter und wollte, wie Pat, ein Haus, in dem alles schlicht war und Stoffe und Möbel genau passten. Kind ersetzt Elternteil, Familie folgt auf Familie, der Kreislauf des Vorstadtlebens. Wir nahmen im Wohnzimmer Platz.
«Das ist ja ein ganz reizendes Haus», sagte Pat. «Ihre Mutter hat es wunderschön instand gehalten. Und ich glaube, wir können einen guten Preis dafür bekommen, aber wir müssen schnell handeln. Ich würde vorschlagen, wir bieten es für dreihundertfünfzigtausend an, am Dienstag setzen wir eine Anzeige in die Zeitung, und am nächsten Wochenende machen wir einen Besichtigungstermin.»
«Und Ihre Courtage?»
«Sechs Prozent», sagte sie und sah mich unverwandt an. «Ich kenne schon jetzt mehrere Leute, die sehr daran interessiert wären.»
Ich sagte ihr, ich würde ihr am Ende des Tages Bescheid geben.
Die dritte Maklerin platzte eine Stunde später ins Haus. Sie hieß Mike, war eine hübsche, kurzhaarige Blonde ungefähr in meinem Alter, und sie trug klasse Jeans. Ihr Kalender sei übervoll, sagte sie mit rauchiger Stimme, sie komme gerade von ihrem dritten Besichtigungstermin des Tages, aber gleich nachdem ich sie am Freitag angerufen hätte, sei sie vorbeigefahren, um sich unser Haus anzusehen, und habe sich von der Straße aus in es verliebt, seine äußere Anmutung sei phantastisch, sie habe sofort gewusst, dass sie es auch innen sehen müsse, und, wow, genau wie sie es erwartet habe – gierig ging sie von Raum zu Raum –, es sei hinreißend, es quelle über von Charme, es gefalle ihr innen noch besser, und sie fände es ganz ganz ganz ganz ganz wunderbar, diejenige zu sein, die es verkaufen werde, wirklich, wenn das obere Bad nicht so klein wäre, könnte sie sogar bis $ 405 000 hochgehen, diese Gegend sei ja so begehrt, so begehrt – ich wisse das doch mit dem katholischen Schulbezirk Mary, Queen of Peace, oder? –, aber sogar trotz des problematischen Badezimmers und des bedauerlich kleinen Gartens wäre sie nicht überrascht, wenn das Haus in den Dreineunzigern wegginge, außerdem könne sie noch andere Dinge für mich tun, ihre Grundcourtage sei fünfeinhalb Prozent, aber wenn der Käufermakler aus ihrer Gruppe sei, könne sie auf glatte fünf runtergehen, und wenn sie selbst die Käufermaklerin sei, könne sie sogar bis auf vier runtergehen, mein Gott, es sei so schön, was meine Mutter gemacht habe, das habe sie gleich gewusst, als sie es von der Straße aus gesehen habe, sie wolle dieses Haus unbedingt – «Jon, ich will es unbedingt», sagte sie, mir in die Augen schauend –, und übrigens, ein kleiner Hinweis noch, sie wolle ja nicht prahlen, bestimmt nicht, aber sie sei die letzten drei Jahre bei Wohnimmobilien in Webster Groves und Kirkwood ununterbrochen die Nummer eins gewesen.
Mike erregte mich. Die schweißfeuchte Vorderseite ihrer Bluse, die Art, wie sie in ihren Jeans ging. Sie flirtete unverhohlen mit mir, bewunderte das Ausmaß meiner Ambitionen, verglich sie zu meinen Gunsten mit ihren (obwohl die ihren nicht unbeträchtlich waren), hielt meinem Blick stand und redete ununterbrochen mit ihrer schönen, rauchigen Stimme. Sie sagte, sie verstehe vollkommen, warum ich in New York leben wolle. Sie sagte, es sei so selten, dass sie jemandem begegne, der, wie ich offensichtlich, etwas von Begehren, von Hunger verstehe. Sie sagte, sie würde den Verkaufspreis des Hauses zwischen $ 380 000 und $ 385 000 ansetzen und hoffe, einen Bieterkrieg auszulösen. Als ich so dasaß und sie in ihrem Überschwang beobachtete, kam ich mir wie ein Wikinger vor.
Der Anruf bei Pat hätte nicht so schwer sein müssen, aber er war es. Ich sah in ihr eine Mom, die ich enttäuschen musste, eine Mom, die im Weg stand, ein quälendes Gewissen. Sie schien Dinge über mich und das Haus zu wissen – zutreffende Dinge –, die mich beklommen machten. Der Blick, mit dem sie mich bedacht hatte, als sie mir ihre Courtage nannte, war skeptisch und taxierend gewesen, als könnte jeder vernünftige Erwachsene sehen, dass sie und ihre Tochter für die Aufgabe ganz offensichtlich die besten Maklerinnen seien, sie sich aber frage, ob auch ich das sehen könne.
Ich wartete mit meinem Anruf bis halb zehn, bis zur letztmöglichen Minute. Genau wie ich befürchtet hatte, verbarg sie ihre Überraschung und ihr Missfallen nicht. Ob es mir etwas ausmache, ihr zu sagen, wer der andere Makler sei?
Mir waren Geschmack und Gestalt von Mikes Namen bewusst, als er durch meinen Mund glitt.
«Oh», sagte Pat matt. «Verstehe.»
Mike wäre auch für meine Mutter nicht die richtige gewesen, ganz und gar nicht. Ich sagte Pat, die Entscheidung sei mir sehr schwergefallen, die Auswahl zu treffen sei richtig schwierig gewesen, und ich sei ihr dankbar, dass sie vorbeigekommen sei, und es tue mir leid, dass sie und ich nicht –»
«Na, dann viel Glück», sagte sie.
Danach machte ich den Lustanruf, den Ja-Freitag-Abend-kann-ich-Anruf. Mike, zu Hause, vertraute mir mit gedämpfter Stimme, als sollte ihr Mann nicht mithören, an: «Jon, ich wusste, dass Sie mich nehmen würden. Ich habe die Verbindung zwischen uns sofort gespürt.» Die einzige leichte Komplikation, sagte sie, sei, dass sie seit langem schon Ferienpläne mit ihrem Mann und den Kindern habe. Sie verreise am Freitag und könne das Haus erst ab dem Monatsende zeigen. «Aber machen Sie sich keine Sorgen», sagte sie.
Ich bin mitten im Land, mitten im Goldenen Zeitalter der amerikanischen Mittelschicht aufgewachsen. Meine Eltern kamen ursprünglich aus Minnesota, zogen südwärts, nach Chicago, wo ich geboren wurde, und siedelten sich schließlich in Missouri an, dem kartographischen Angelpunkt des Landes. Als Kind legte ich großen Wert auf die Tatsache, dass kein US-amerikanischer Bundesstaat mit mehr Staaten gemeinsame Grenzen hat als Missouri (er und Tennessee grenzen an acht) und dass dessen Nachbarn an so abgelegene Staaten wie Georgia und Wyoming stoßen. Das «Bevölkerungszentrum» der Nation – welches Getreidefeld oder welche Landstraßenkreuzung auch immer die jüngste Volkszählung als den demographischen Schwerpunkt Amerikas ermittelt hatte – war nie mehr als ein paar Autostunden von unserem Wohnort entfernt. Unser Winter war besser als der in Minnesota, unser Sommer besser als der in Florida. Und unsere Stadt, Webster Groves, lag in der Mitte dieser Mitte. Es war keine so reiche Vorstadt wie Ladue oder Clayton; sie lag nicht so nahe an St. Louis wie Maplewood oder so weit davon entfernt wie Des Peres; rund sieben Prozent der Bevölkerung waren Angehörige der Mittelschicht und zugleich schwarz. Webster Groves war, wie meine Mutter, Goldlöckchen zitierend, gern sagte, «genau richtig».
Sie und mein Vater hatten sich in einem Philosophie-Abendseminar an der Universität von Minnesota kennengelernt. Mein Vater war Angestellter der Great Northern Railroad und nahm an dem Kurs rein aus Vergnügen teil. Meine Mutter arbeitete ganztags als Sprechstundenhilfe und sammelte langsam Scheine für einen Abschluss in Kindesentwicklung. Sie begann eines ihrer Referate, der Titel lautete «Meine Philosophie», mit einer Selbstbeschreibung als «durchschnittliches junges amerikanisches Mädchen – durchschnittlich insofern, als meine Interessen, Zweifel, Gefühle und Vorlieben denen eines Mädchens meines Alters in jeder beliebigen amerikanischen Stadt gleichen». Dann aber bekannte sie sich zu tiefen Zweifeln an der Religion («Ich glaube fest an die Lehren Christi, an alles, wofür Er steht, aber beim Wunderglauben bin ich mir nicht so sicher»), was ihre Behauptung, «durchschnittlich» zu sein, als etwas offenbarte, das einem Wunsch viel näher kam. «Ich verstehe dieses Zweifeln nicht als bestimmend für die Welt insgesamt», schrieb sie. «Im Leben des Menschen gibt es ein eindeutiges Bedürfnis nach Religion. Ich behaupte, sie ist richtig für die Menschheit, aber ob sie es für mich ist, weiß ich nicht.» Außerstande, sich Gott und dem Himmel und der Wiederauferstehung zu verschreiben, und skeptisch gegenüber einem Wirtschaftssystem, das die Weltwirtschaftskrise ausgelöst hatte, schloss sie ihr Referat, indem sie das eine benannte, an dem sie nicht zweifelte: «Ich glaube fest an das Familienleben. Ich finde, dass das Heim die Grundlage wahren Glücks in Amerika ist – viel mehr, als Kirche oder Schule es jemals sein können.»
Ihr ganzes Leben hasste sie es, wenn sie nicht dazugehörte. Allem, was uns tendenziell vom Rest der Gemeinschaft trennte (ihr fehlender Glaube, das Überlegenheitsgefühl meines Vaters), musste mit einem Prinzip begegnet werden, das uns wieder in die Mitte zog und half, uns einzufügen. Jedes Mal, wenn sie mit mir über meine Zukunft sprach, betonte sie, dass der Charakter eines Menschen wichtiger sei als seine Leistungen und dass ein Mensch, je mehr Fähigkeiten er habe, desto mehr der Gesellschaft schulde. Leute, die sie beeindruckten, waren immer «äußerst tüchtig», aber niemals «schlau», «talentiert» oder auch nur «hart arbeitend», weil Leute, die sich «schlau» fanden, eitel oder selbstsüchtig oder arrogant sein konnten, wohingegen Leute, die sich für «tüchtig» hielten, beständig an ihre Schuld der Gemeinschaft gegenüber erinnert wurden.
Die amerikanische Gesellschaft meiner Kindheit war von ähnlichen Idealen geprägt. Landesweit war die Einkommensverteilung nie gerechter gewesen und sollte es auch nie wieder sein; der typische Firmenchef brachte nur vierzigmal mehr nach Hause als sein Arbeiter mit dem niedrigsten Lohn. 1965, kurz vorm Höhepunkt seiner Laufbahn, verdiente mein Vater $ 17 000 im Jahr (gut das Doppelte des Landesdurchschnitts) und hatte drei Jungen an öffentlichen Schulen; wir besaßen einen mittelgroßen Dodge und einen 51-cm-Schwarzweißfernseher; mein wöchentliches Taschengeld betrug 25 Cent, zahlbar sonntagvormittags; ein Wochenendspaß mochte darin bestehen, dass ein Dampfgerät gemietet wurde, um alte Tapeten abzulösen. Für die Liberalen war die Jahrhundertmitte eine Zeit des unhinterfragten Materialismus im Innern, des dreisten Imperialismus nach außen, der Verweigerung von Chancen für Frauen und Minderheiten, der Umweltzerstörung und der unheilvollen Hegemonie des militärisch-industriellen Komplexes. Für die Konservativen war sie eine Zeit der verfallenden kulturellen Werte, einer aufgeblähten Bundesregierung, ruinöser Steuersätze und sozialistischer Wohlfahrts- wie Rentensysteme. In der Mitte der Mitte hingegen, wo ich zusah, wie die alten Tapeten sich in schweren, hautartigen, nach Brei riechenden Bahnen lösten, um sich sogleich wieder an den Arbeitsstiefeln meines Vaters festzukleben, gab es nichts als Familie und Haus und Nachbarschaft und Kirche und Schule und Arbeit. Ich steckte als Kokon in Kokons, die ihrerseits in Kokons steckten. Ich war der Nachzüglersohn, dem mein Vater, der mir wochentags jeden Abend vorlas, seine Liebe zu dem depressiven Esel I-Ah in den Kinderbüchern von A. A. Milne anvertraute und dem meine Mutter zur Zubettgehzeit ein Wiegenlied vorsang, das sie sich zur Feier meiner Geburt selbst ausgedacht hatte. Meine Eltern waren Widersacher, und meine Brüder waren Rivalen, und jeder beklagte sich bei mir über jeden, aber alle waren sie vereint darin, mich amüsant zu finden, und es gab nichts an ihnen, das nicht zu lieben war.
Muss ich dazu sagen, dass das nicht so blieb? Meine Eltern wurden älter, und meine Brüder und ich flohen das Zentrum geographisch und landeten an den Küsten, und parallel dazu floh das ganze Land das Zentrum wirtschaftlich und landete bei einem System, in dem das reichste Bevölkerungsprozent heute sechzehn Prozent des Gesamteinkommens verdient (1975 waren es noch acht). Schöne Zeiten für einen amerikanischen Vorstandsvorsitzenden, schwere Zeiten für seinen Arbeiter mit dem niedrigsten Lohn. Schöne Zeiten für Wal-Mart, schwere Zeiten für die, die Wal-Mart im Weg sind, schöne Zeiten für Extremisten im Amt, schwere Zeiten für gemäßigte Herausforderer. Wunderbar für Rüstungsunternehmer, beschissen für Reservisten, großartig für Lehrstuhlinhaber in Princeton, mörderisch für Privatdozenten am Queens College, hervorragend für Manager von Rentenfonds, mies für die, die auf einen solchen gesetzt haben, besser denn je für die Spitzenkräfte, härter denn je fürs Mittelmaß, phänomenal für Gewinner eines Texas-Hold-’Em-Pokerturniers, ein Elend für die, die nach Videopokerspielen süchtig waren.
An einem Augustnachmittag sechs Jahre nach dem Tod meiner Mutter, gerade wurde eine amerikanische Großstadt von einem Hurrikan zerstört, ging ich mit meinem Schwager auf einer hippen kleinen Gebirgsanlage im Norden Kaliforniens golfen. Es waren schwere Zeiten für die in New Orleans, aber schöne Zeiten für die an der Westküste, wo das Wetter ideal war und die Oakland A’s, ein unterbezahltes Baseballteam, dessen Auf und Ab ich gern verfolge, in ihrer alljährlichen Aufholjagd begriffen waren. Meine größten Sorgen waren an diesem Tag, ob ich ein schlechtes Gewissen haben sollte, weil ich meine Arbeit schon um drei beendet hatte, und ob mein Lieblingsbioladen die Meyer-Zitronen für die Margaritas haben würde, die ich zum Après-Golf machen wollte. Anders als George Bushs Kumpel Michael Brown, der in jener Woche an Maniküre und Restaurantreservierungen dachte, hatte ich die Ausrede, nicht der Chef des Katastrophenschutzes zu sein. Bei jedem Ball, den ich mit einem Hook ins Gehölz oder in ein Wasserhindernis schlug, witzelte mein Schwager: «Immerhin hockst du nicht ohne Trinkwasser auf einem Dach und wartest, dass dich ein Hubschrauber aufsammelt.» Zwei Tage später, als ich nach New York zurückflog, fürchtete ich, Katrinas Nachwirkungen könnten für unangenehme Turbulenzen sorgen, doch mein Flug verlief ungewöhnlich glatt, und das Wetter an der Ostküste war warm und wolkenlos.
In den Jahren seit dem Tod meiner Mutter waren die Dinge gut für mich gelaufen. Statt verschuldet und den Mietkontrollgesetzen der Stadt ausgeliefert zu sein, besaß ich nun eine hübsche Wohnung in der East Eighty-first Street. Als ich sie, nach zwei Monaten in Kalifornien, betrat, hatte ich das Gefühl, in eine fremde Wohnung zu kommen. Ihr Bewohner war offenbar ein wohlhabender Manhattaner mittleren Alters, der ein Leben führte, um das ich in meinen Dreißigern andere aus der Ferne beneidet hatte, wobei ich meinen Versuchen, mich hineinzuphantasieren, erst mit vager Verachtung begegnet und schließlich erlegen war. Wie seltsam, dass ich nun die Schlüssel zur Wohnung dieses Mannes hatte.
Die Frau, die in meiner Abwesenheit auf sie aufpasste, hatte alles sauber und ordentlich hinterlassen. Ich hatte immer nackte Böden und eine minimalistische Einrichtung bevorzugt – hatte das «Traditionelle» schon als Heranwachsender sattgehabt – und sehr wenige Dinge aus dem Haus meiner Mutter mitgenommen, nachdem sie gestorben war. Küchenutensilien, Fotoalben, ein paar Kissen. Einen Werkzeugkasten, den mein Großvater gezimmert hatte. Ein Gemälde von einem Schiff, das die Morgenröte aus den Narnia-Chroniken sein mochte. Eine Auswahl kleiner Sachen, an denen ich aus Treue zu meiner Mutter festhielt: eine Onyxbanane, eine Süßigkeitenplatte von Wedgwood, einen Kerzenlöscher aus Zinn, einen Messingbrieföffner mit Niellogriff samt dazugehöriger Schere in einem grünen Lederfutteral.
Da es so wenige Dinge in der Wohnung gab, dauerte es nicht lange, bis ich merkte, dass eines davon – die Schere aus dem Futteral – während meiner Zeit in Kalifornien verschwunden war. Meine Reaktion war die des Drachen Smaug in Der Hobbit, als ihm auffällt, dass von seinem Berg kostbarer Gegenstände ein Goldpokal fehlt. Aus den Nüstern Rauch speiend, tobte ich durch die Wohnung. Als ich die Frau, die auf die Wohnung aufpasste, befragte und sie sagte, sie habe die Schere nicht gesehen, hatte ich Mühe, ihr nicht den Kopf abzubeißen. Ich wühlte alles durch, jede Schublade und jeden Schrank zweimal. Es empörte mich, dass ich von allen Sachen, die verschwinden konnten, ausgerechnet etwas verloren hatte, das von meiner Mutter war.
Empört war ich auch über die Folgen von Katrina. In jenem September konnte ich eine Zeitlang nicht ins Internet gehen, eine Zeitung aufschlagen oder auch nur an einem Automaten Geld ziehen, ohne mit Aufrufen konfrontiert zu werden, den obdachlosen Opfern des Hurrikans zu helfen. Die Benefiz-Maschinerie war so weitreichend und gut organisiert, dass sie fast schon amtlich wirkte – wie die «Unterstützt unsere Truppen»-Schleifen, die über Nacht an jedem zweiten Wagen im Land aufgetaucht waren. Ich aber fand, Katrinas obdachlosen Opfern zu helfen sei Aufgabe der Regierung, nicht meine. Immer hatte ich Kandidaten gewählt, die meine Steuern erhöhen wollten, weil ich Steuernzahlen für patriotisch hielt und weil meine Vorstellung davon, wie man mich in Ruhe zu lassen hat – mein libertäres Ideal! –, an eine ordentlich finanzierte, ordentlich geführte Zentralregierung geknüpft war, die es mir ersparte, jede Woche hundert verschiedene Ausgabeentscheidungen zu treffen. Ein Beispiel: War Katrina so schlimm wie das Erdbeben in Pakistan? So schlimm wie Brustkrebs? So schlimm wie Aids in Afrika? Weniger schlimm? Um wie viel weniger schlimm? Ich wollte, dass meine Regierung das alles regelte.
Es stimmte natürlich, dass Bushs Steuersenkungen mir zusätzliches Geld in die Tasche steckten und dass selbst diejenigen, die nicht für ein privatisiertes Amerika gestimmt hatten, immer noch verpflichtet waren, gute Staatsbürger zu sein. Doch da die Regierung so viele ihrer vormaligen Verpflichtungen aufgegeben hatte, gab es nun Hunderte neuer Anliegen, für die man spenden sollte. Bush hatte nicht nur den Katastrophen- und Hochwasserschutz vernachlässigt; abgesehen vom Irak war da kaum etwas, was er nicht vernachlässigt hatte. Warum sollte ich gerade für diese Katastrophe etwas lockermachen? Und warum Leuten, die, wie ich fand, das Land zugrunde richteten, politischen Beistand leisten? Wenn die Republikaner so entschieden gegen einen starken Staat waren, sollten sie doch ihre eigenen Anhänger bitten, etwas lockerzumachen! Schließlich war es möglich, dass die Anti-Steuer-Milliardäre und Anti-Steuer-Mittelständler, die ihre Anti-Steuer-Abgeordneten in den Kongress gewählt hatten, allesamt großzügig für die Hilfsbemühungen spendeten, aber ebenso wahrscheinlich war es, dass diese Leute, die es für ungerecht hielten, wenn sie von ihren $ 2,8 Millionen Jahreseinkommen nur $ 2 Millionen und nicht alles behalten durften, insgeheim auf die Anständigkeit der gewöhnlichen Amerikaner zählten: uns also für dumm verkauften. Wenn Privatspenden an die Stelle von Bundesausgaben traten, hatte man keine Ahnung, wer schmarotzte und wer den doppelten Beitrag leistete.
Was alles heißen sollte: Mein Impuls, mildtätig zu sein, war meiner politischen Wut nun deutlich nachgeordnet. Dabei war ich gar nicht gern so polarisiert. Ich wollte ja einen Scheck ausschreiben können, weil ich Katrinas Opfer aus dem Kopf haben und wieder mein Leben genießen wollte, denn als New Yorker, fand ich, hatte ich das Recht, mein Leben zu genießen, weil ich auf der Terroristen-Zielscheibe Nummer eins der westlichen Hemisphäre lebte, dem bevorzugten Reiseziel eines jeden künftigen Irren mit einer tragbaren Atomwaffe oder einem Pockenspender, und weil das Leben in New York noch schneller von großartig zu grauenvoll umschlagen konnte, als es in New Orleans geschehen war. Ich leistete meinen Beitrag als Bürger vermutlich schon dadurch, dass ich mit den vielen neuen Fadenkreuzen lebte, die George Bush mir – wie auch jedem anderen New Yorker – durch das Anzetteln seines nicht gewinnbaren Krieges im Irak, durch das Verschleudern Hunderter Milliarden Dollar, die man zur Bekämpfung tatsächlicher Terroristen hätte einsetzen können, durch die Aktivierung einer neuen Generation Amerika hassender Dschihadisten und die Vergrößerung unserer Abhängigkeit von ausländischem Öl auf den Rücken gemalt hatte. Die Scham und die Gefahr, Bürger eines Landes zu sein, das die übrige Welt mit Bush identifizierte: War das nicht Last genug?
Zwei Wochen war ich, mit solchen Gedanken beschäftigt, nun wieder in der Stadt, als ich von einem protestantischen Pfarrer namens Chip Jahn eine Ketten-E-Mail bekam. Ich hatte mit Jahn und seiner Frau in den siebziger Jahren Kontakt gehabt und sie vor kürzerem in ihrer Pfarrei im ländlichen Süden Indianas besucht, wo er mir seine zwei Kirchen gezeigt und seine Frau mir erlaubt hatte, auf ihrem Pferd zu reiten. Der Betreff seiner E-Mail lautete «Louisiana-Mission», was mich eine weitere Spendenbitte fürchten ließ. Doch Jahn berichtete lediglich von den Sattelzügen, die Mitglieder seiner Kirchengemeinden mit Vorräten beladen und nach Louisiana gefahren hatten:
Einige Frauen aus der Gemeinde sagten, wir sollten uns an der Hurrikanhilfe beteiligen und einen Laster in den Süden schicken. Die Foertschs wollten einen Lkw beisteuern, und Lynn Winkler und die Firma Winkler Foods wollten Lebensmittel und Wasser stellen …
Unsere Pläne konkretisierten sich in dem Maß, in dem Spendenzusagen hereinkamen. (Knapp über $ 35 000 an Spenden und Zusagen. Über $ 12 000 stammten von der Gemeinde St. Peter and Trinity.) Wir schauten uns rasch nach einem weiteren Lkw und Fahrern um. Sie zu finden erwies sich als nicht schwieriger, als das Geld aufzutreiben. Larry und Mary Ann Wetzel standen mit ihrem Lkw bereit. Phil Liebering sollte der zweite Fahrer sein …
Foertschs Lkw hatte den schwereren, aber kürzeren Auflieger, der wurde mit Wasser beladen. Auf Larrys Lkw kamen die Paletten mit den Lebensmitteln und Babysachen. Wegen des hohen Spendenaufkommens kauften wir in letzter Minute noch für $ 500 Handtücher und Waschlappen und 100 Schaumstoffmatten. Beides stand auf Thibodaux’ Wunschliste. Sie freuten sich, uns zu sehen. Das Entladen ging schnell vonstatten, und sie fragten, ob sie Wetzels Anhänger nehmen dürften, um die Kleider zu einem anderen Lagerhaus zu schaffen, weil sie sie dort mit dem Gabelstapler statt per Hand herausholen könnten …
Als ich Jahns E-Mail las, wünschte ich mir, was ich normalerweise niemals wünschte, nämlich einer Kirche in Süd-Indiana anzugehören, damit ich in einem der Lkw hätte mitfahren können. Natürlich wäre es seltsam gewesen, jeden Sonntag in einer Kirche zu sitzen und einen Gott zu besingen, an den ich nicht glaubte. Und dennoch: Hatten meine Eltern an jedem Sonntag ihres Erwachsenenlebens nicht genau das getan? Ich fragte mich, wie ich aus ihrer Welt in die Wohnung eines Menschen gelangt war, den ich gar nicht als mich selbst erkannte. Den ganzen Herbst hindurch versetzte mir, wenn mein Blick auf das halbleere Lederfutteral fiel, das Fehlen der Schere einen neuerlichen Stich. Ich konnte einfach nicht glauben, dass sie verschwunden war. Noch Monate nach meiner Rückkehr durchwühlte ich immer wieder Schubladen und Schrankregale, die ich schon dreimal abgesucht hatte.