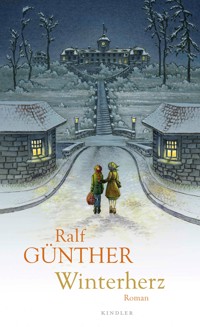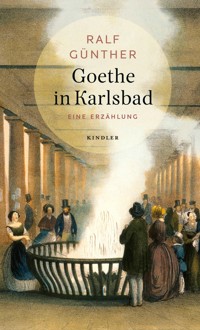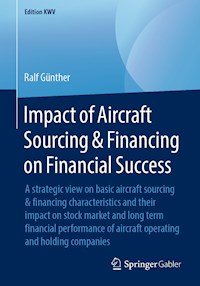9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Ein packender historischer Roman, inspiriert von der wahren Geschichte des berühmten Mediziners Robert Kochs. Hamburg, im August 1892: Verdächtige Krankheitsfälle häufen sich in den Siechenhäusern. Der Erste Bürgermeister vermutet die Cholera – und schweigt. Also schickt die Reichsregierung den kompetentesten Seuchenfachmann nach Hamburg, den sie aufzubieten hat: Robert Koch. Natürlich ist der berühmte Arzt nicht willkommen. Als er die Erreger im Hamburger Trinkwasser nachweist, beginnt für ihn ein Kampf an mehreren Fronten. Da erreicht mit einem der letzten Dampfschiffe von Sylt Hedwig, Kochs Geliebte, die abgeriegelte Hansestadt. Er ist zornig und glücklich zugleich. Denn sie darf nicht offiziell bei ihm sein. Als ein junger Assistenzarzt auf Hedwig aufmerksam wird und Koch die Eifersucht befällt, muss er kühlen Kopf bewahren … Robert Koch: In der Liebe zu Hedwig riskiert er seinen Ruf. Im Kampf gegen die Cholera sein Leben!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 361
Ähnliche
Ralf Günther
Arzt der Hoffnung
Roman
Über dieses Buch
Robert Koch: In der Liebe zu Hedwig riskiert er seinen Ruf. Im Kampf gegen die Cholera sein Leben.
Hamburg, im August 1892: Verdächtige Krankheitsfälle häufen sich in den Siechenhäusern. Der Erste Bürgermeister vermutet die Cholera – und schweigt. Also schickt die Reichsregierung den kompetentesten Seuchenfachmann nach Hamburg, den sie aufzubieten hat: Robert Koch.
Natürlich ist der berühmte Arzt nicht willkommen. Als er die Erreger im Hamburger Trinkwasser nachweist, beginnt für ihn ein Kampf an mehreren Fronten.
Da erreicht mit einem der letzten Dampfschiffe von Sylt Hedwig, Kochs Geliebte, die abgeriegelte Hansestadt. Er ist zornig und glücklich zugleich. Denn sie darf nicht offiziell bei ihm sein.
Als ein junger Assistenzarzt auf Hedwig aufmerksam wird und Koch die Eifersucht befällt, muss er kühlen Kopf bewahren …
Vita
Ralf Günther wurde 1967 in Köln geboren. Als Buch- und Drehbuchautor entwickelte er Kinderserien fürs Fernsehen und schrieb historische Romane. «Der Leibarzt», sein Debüt, wurde ein Bestseller. Es folgten unter anderem «Das Weihnachtsmarktwunder» sowie «Als Bach nach Dresden kam». Ralf Günther lebt in der Nähe von Dresden.
«Du mein Liebstes! Wie weit, wie unendlich weit bist Du von mir fort. Es ist mir, als könnte ich Dich gar nicht erreichen. Wenn doch Wenningstedt nur einige Stunden Eisenbahnfahrt von Berlin wäre, ich glaube, ich wäre schon längst zu Dir geeilt, um Dich zu sehen, so fehlst Du mir. Es ist doch gar zu einsam und öde, wenn Du nicht da bist. Mein einziger Trost ist der, dass ich weiß, wie wohl Du Dich auf Sylt fühlst und wie notwendig die Reise für Dich ist, aber wenn ich des Abends auf dem Balkon sitze, dann sehe ich hinüber nach dem Bahnhof und muss immer an die Abschiedsstunde und den letzten Kuss denken. Und dann wandern meine Gedanken wieder nach dem fernen Strand, und all die schönen Erinnerungen werden wach an unseren gemeinsamen Aufenthalt im vorigen Jahr, wenn wir durch die Gischt wanderten und in einsamen Dünen süße Küsse tauschten.»
Robert Koch am 20. August 1890 an seine Geliebte Hedwig Freiberg
1. Kapitel
«In der Stube, die wir heute gereinigt haben, wurde eine junge Mutter tot aufgefunden. An ihrer Brust lag ihr Kind, ein Säugling, lebend und lächelnd.»
Jakob Löwenberg, Zeitzeuge der Choleraepidemie 1892 in Hamburg
Am 22. August des Jahres 1892 stand der weltberühmte Entdecker des Tuberkel-Bazillus, der ehrwürdige Geheim- und Medizinalrat Dr. Robert Koch, Direktor des Instituts für Infektionskrankheiten Seiner Majestät des Kaisers, am Anleger der Sylt-Tondern-Linie. Schwarz lag die See in der Bucht, die Dünung war schwach, der Morgen windstill. Mit den ersten Sonnenstrahlen erwachte das Element: Das Licht hob die Wellen aus der Dunkelheit und bestrich die Kämme mit Honig.
Der Forscher war auf der Suche nach Antworten. Derzeit vor allem auf das rätselhafte Telegramm des Kaiserlichen Gesundheitsamts. Es hatte ihn am Vorabend erreicht und steckte nun in seiner Westentasche.
--- Brauchen --- Sie --- in --- Berlin --- jetzt ---
Der Befehlston war nicht nur dem Telegraphenstil geschuldet. Es war ein Alarmzeichen der kaiserlichen Behörde und duldete keinen Verzug!
Seit Wochen gab es nur ein Thema: das Vordringen der asiatischen Cholera – zum fünften Mal in diesem Jahrhundert. Seit Wochen hatte sich das Reich unter Führung Preußens, verkörpert durch Kaiser Wilhelm II. und seinen Kanzler Caprivi, sowie das Kaiserliche Gesundheitsamt unter Kochs Ägide darauf vorbereitet: Desinfektionseinheiten der Armee waren über das Reichsgebiet verteilt, Cordons Sanitaires an den Grenzen zu den betroffenen Landstrichen errichtet, die Grenzkontrollen verschärft. Reisende mit Symptomen wurden zurückgewiesen, insbesondere an den Übergängen zum Zarenreich, wo bereits zahlreiche Fälle aufgetreten waren. In den Zeitungen wurden Maßnahmen zur Hygiene abgedruckt: Wasser abkochen, Hände waschen, contagiöse Bereiche desinfizieren. Überall stank es nach Karbol, dem geläufigen Desinfektionsmittel.
Und der Schutz war wirksam: Es blieb bei einzelnen Erkrankten entlang der Grenze – ein Dutzend Tote, nicht der Rede wert für einen derart gefährlichen Erreger und beinahe nichts im Vergleich zu den großen Epidemien der dreißiger, vierziger, siebziger Jahre.
Der Komma-Bazillus war Kochs alter Bekannter. Der Epidemiologe kannte den Erreger aus Kairo und Kalkutta. Jedem Ausbruch der Krankheit war er hinterhergereist, bis er den Verursacher entdeckt und isoliert hatte. Wissenschaftler aus aller Welt schickten Proben in Kochs Berliner Labor, um sicherzugehen. Im Jahr 1884 hatte er einen großen europäischen Kongress zum sicheren Nachweis des Bazillus durchgeführt; hatte den Kollegen aus aller Herren Länder – ein paar Damen waren auch dabei, seitdem sie die Universitäten besuchen durften – gezeigt, wie man Nährlösungen mischte, um den Erreger vermehren zu können. Hatte demonstriert, wie man ihn auf gestocktem Blutserum heranzüchtet, wie man ganze Stämme auf andere Wirtstiere überträgt, um einen gültigen Beweis zu erlangen.
Nun war es anscheinend wieder so weit: Der Erreger vermehrte sich nicht nur in den Nährlösungen der Forscher, er vermehrte sich in den Menschen, vertrocknete sie von innen, ließ seine Opfer erbrechen und defäkieren, bis alle Flüssigkeit aus ihnen heraus war.
Koch spürte Beklemmungen angesichts des Alarms aus Berlin: Ausnahmslos jeder war in Gefahr, die Krankheit verschonte niemanden. Doch im Zentrum des Kaiserreichs, und auch in seinen großen, blühenden Städten, schienen die Menschen in Sicherheit. In Köln, in Berlin, in Magdeburg, in Dresden, in Breslau, in Königsberg: kein einziger Fall bisher. Das Telegramm allerdings sprach eine andere Sprache.
Kochs Blick folgte dem Flimmern des Morgenlichts auf den Wellenkämmen. Jenseits der Honigstreifen, in der Tiefe, herrschte immer noch Dunkelheit. Koch konnte nicht schwimmen, das Wasser war nicht sein Element, und er kannte die Gefahr. Genügsam schwappte die Dünung der Munkmarscher Bucht gegen die Duckdalben, die das Anlanden der Fähre erleichterten. Eben tanzte die Sonne einen Moment lang auf der Horizontlinie. Dann löste sie sich und stieg weiter hinauf.
Von dort, zunächst nur als weiße Rauchsäule über dem Wasser sichtbar, hatte die Fähre Kurs genommen. Die Barkasse verband die Insel Sylt mit dem Umschlaghafen Hoyerschleuse. Der Dampf zeichnete die Spur des Fortschritts in den Morgenhimmel. Wie einfach und schnell war das Reisen zu Wasser geworden! Und wurde immer schneller. Die Strecke von Westerland nach Munkmarsch hatte Koch bereits mit der neuen Dampfbahn zurückgelegt.
Schon erblickte der Mediziner die gewaltigen Schaufelräder an ihren Seiten: Wie Titanenhände pflügten sie sich durch die See. Erste Silhouetten von Fahrgästen zierten die Reling.
Kurz vor dem Einlaufen schwenkte das Heck landwärts, und die Fähre wurde in ihrer ganzen Schönheit sichtbar: die schnittige Form, der nach hinten kippende Schornstein, die Fahne am Heck, im Fahrtwind flatternd.
Koch tastete nach seiner Börse. Die Abreise war überstürzt und die Fahrt nach Berlin weit. Und auch ein Beamter des Kaiserlichen Gesundheitsamts musste für seine Überfahrt bezahlen. Selbst wenn er auf Befehl des Kaisers reiste.
Die ersten Sonnenstrahlen fielen durch das Blumenmuster der Vorhänge bis in Hedwigs Zimmer und auf ihr Laken. Sie tastete nach der Wärme, die der Geliebte dort hinterlassen hatte. Sie hatte gemerkt, wie er aufgestanden war, es konnte nicht lang her sein. Hatte gespürt, wie sich der Männerkörper, während des Schlafs noch fest an sie geschmiegt, nach dem Erwachen widerwillig getrennt hatte. Als er ihren Nacken küsste, hatte der präzis gestutzte Vollbart ein letztes Mal über ihre Schulter gekratzt. Sie hatte gehört, wie er Wasser aus der Kanne in die Schüssel des Waschtischs gefüllt hatte. Wie das Rasiermesser zunächst schleifend über das Abziehleder und dann über die Haut fuhr. Sie kannte das kratzende Geräusch, kannte auch die dazu passende Choreographie: Erst fuhr die Klinge über den Halsansatz, bis zum Knochen des Unterkiefers. Auch um den Ansatz der Wangen herum rasierte er den Rand des Bartes sauber. Zuletzt entfernte er einzelne, widerspenstige Härchen mit einer kleinen Schere. Die Körperpflege war Koch heilig, das hatte Hedwig rasch begriffen. «Hygiene» war ein zentraler Begriff seiner Lehre – und seines Wesens.
Den Schnitt seines Bartes jedoch hatte Koch – wie er Hedwig erzählt hatte – seit dem Studium nicht verändert. Das Rasieren war Routine, eine Angelegenheit von Minuten. Zum Abschluss spülte er die restliche Seife in die Schüssel, indem er sich mit flachen Händen Wasser ins Gesicht warf. Selbst im Halbschlaf identifizierte Hedwig das Geräusch. Schließlich wischte er sich mit einem Handtuch den restlichen Schaum von der Haut. Das Aroma der Rasierseife hätte Hedwig selbst auf einem türkischen Basar wiedererkannt …
Nun war das Knarren der Dielen verklungen. Hedwig rekelte sich allein im großen Bett, die Vision des Geliebten vor Augen.
Noch am Abend zuvor hatten sie beieinandergelegen, in diesen Laken. Erst neckisch und scherzend, dann stumm, die Lippen verbunden. Im innigen Kuss entzündete sich Leidenschaft.
Gerade so rechtzeitig trennten sich ihre Körper, dass Koch in der Lage war, das Telegramm an der Tür zu empfangen: behelfsmäßig in eine Hose geschlüpft, die Träger über den blanken Oberkörper gezogen, schließlich war man im Urlaub.
Durch den schmalen Türspalt nahm er den Alarmzettel entgegen; einen Blick auf das Bett, in dem Hedwig vollständig nackt lag, hatte er nicht zugelassen.
Dennoch hatte die Wirtin beschämt zur Seite geschaut. Der Absender erregte Ehrfurcht: «Kaiserliches Gesundheitsamt Berlin» hatte sie aus dem Kürzel KaiserlGesAmtBer richtig erraten.
Wortlos hatte Koch den Umschlag entgegengenommen und die Tür hinter sich geschlossen. Lesend trug er die Botschaft zum Bett. Die Worte drangen in ihr grenzenloses Glück und sprengten es von innen heraus. An der Kante blieb er stehen. Übersah ihre ausgestreckten Arme. Verkündete: «Ich muss nach Berlin.» Hedwig umschlang seine Hüften, presste ihr Gesicht gegen seinen Bauch, wollte ihn halten, ihn zurückziehen, doch in Gedanken war Koch schon auf Reisen. «Wann geht die erste Fähre am Morgen?»
«Was wollen sie von dir?»
Koch murmelte etwas, während er die dürren Worte erneut las. Natürlich wusste er, worum es ging: die Cholera.
«Ich lass dich nicht gehen!»
Mit aller Kraft hatte Hedwig ihn umklammert. Doch Koch ließ sich nicht zurückhalten. Nicht einmal von einem geliebten Wesen.
Es klopfte. Hedwig musste wieder eingeschlafen sein. Eben noch, so schien es, hatte sie seine Nähe gespürt. Dabei war er schon seit dem Morgengrauen verschwunden. Hedwig achtete darauf, dass das Laken sie ganz umhüllte, dass Brüste und Taille darunter verborgen waren, dann rief sie «Herein».
Im Licht der vollen Morgensonne betrat die Wirtin die Kammer. Auf dem Tablett ein Frühstück. Gleich zog Hedwig der Duft von Toast und Spiegelei in die Nase. Die Gewohnheiten auf den nordfriesischen Inseln waren englisch, zum Morgen trank man Tee. Selbst in Wenningstedt, das nicht so weltgewandt war wie Westerland. Ein Dutzend Häuser, fast alle beherbergten Gäste. Die Insel befand sich im Aufschwung, das geschäftstüchtige Hamburg hatte die Zerstreuung entdeckt, und Berlin war durch die Eisenbahn in Reichweite.
«Der hohe Herr bat mich, Ihnen das Frühstück auf dem Zimmer zu servieren.»
Hedwig entfuhr ein wohliges Geräusch. Die Wirtin lächelte. «Muss ein wichtiger Herr sein, Ihr Gatte. Das Kaiserliche Amt in Berlin!»
Hedwig wusste, dass sie Kochs Inkognito nicht lüften durfte. «Nein, nicht wichtig», sagte sie, «nur fleißig.»
«Ich glaube, ich habe sein Bild schon einmal in der Zeitung gesehen.»
«Ach», versuchte Hedwig, die Spur zu verwischen, «diese kaiserlichen Herren aus Berlin sehen doch alle gleich aus: ein Vollbart, der die Wangen verbirgt, ein Schnurrbart mit gezwirbelten Spitzen über den Mundwinkeln …»
«Nein, ich bin mir sicher: Ich kenne ihn aus der Vossischen Zeitung. War er nicht in Indien? Ist er nicht ein Doktor?»
«Ich danke Ihnen für das Frühstück!» Hedwig stemmte sich in die Höhe. Die Wirtin stellte das Tablett ab und ging zur Tür. Hedwig wusste, dass der Ton zu schroff gewesen war. Schon bereute sie es. Und fand doch nicht mehr heraus aus der Abweisung.
Im Hinausgehen drehte die Wirtin sich noch einmal um. «Sie könnten seine Tochter sein, Fräulein Freiberg!» Empörung schwang in ihren Worten. Das «Fräulein» zu betonen ließ die Wirtin sich nicht nehmen. Sie hatte dieses unsittliche Zusammensein geduldet, hatte die fadenscheinige Lüge akzeptiert, doch gutheißen konnte sie das keinesfalls.
Ein Herr aus dem Kaiserlichen Amt, ein «Geheimer Rat», der sich «Exzellenz» heißen ließ! Mit Nachdruck zog die Wirtin die Tür von außen ins Schloss, der Knall mochte alle anderen Gäste geweckt haben.
Mit einem Schulterzucken kam Hedwig darüber hinweg und betrachtete das Frühstück mit Appetit. Und je länger sie es betrachtete, umso zufriedener war sie mit ihrem Leben, ihrer Liebe, und desto bedeutungsloser wurden alle Vorwürfe.
Ach, man durfte nichts auf die Meinung dieser Krähen geben, die selbst den grandiosesten Tag mit heiserem Krächzen begrüßten.
Die Marschbahn trug den Geheimen und Medizinalrat vom Hafen in Hoyerschleuse über Tondern, Niebüll und Husum nach Altona. Was wie ein Vorort Hamburgs anmutete, war seit dem Ende des Deutsch-Dänischen Krieges preußisches Hoheitsgebiet, mit eigener Polizeigewalt und Posten auf den Straßenzügen, die die Grenze zwischen preußischem und hamburgischem Territorium markierten. Der Bahnhof in Altona hatte direkten Anschluss nach Berlin. Der Zug stand schon unter Dampf. Er fuhr über Hamburger Gebiet, hatte dort aber keinen Aufenthalt. Das Durchqueren der Bahnhofshalle reichte Koch aus, einem Zeitungsjungen die wichtigsten Gazetten aus den Händen zu kaufen.
Mit einer Reisetasche in der Rechten und den Tagesneuigkeiten unterm linken Arm betrat Koch den Wagen erster Klasse. Er rechnete nicht damit, so früh am Morgen weiteren Passagieren zu begegnen. Doch schon im ersten Séparée saß ein Mann, der Kochs Aufmerksamkeit erregte. Nicht weil er Uniform trug, sondern wegen eines Abzeichens des Kaiserlichen Gesundheitsamtes am Revers. Die Schulterstücke wiesen ihn als Stabsarzt aus. Sein Kopfhaar war zurückgewichen, entgegen der gängigen Mode trug er nur einen Lippenbart, die Wangen waren vollkommen blank. Koch öffnete die Schiebtür und betrat das Abteil. Augenblicklich sprang der Mann auf und salutierte.
«Behalten Sie Platz!» Koch winkte den Militärarzt aufs Polster zurück. Der schien irritiert.
«Doktor Koch? Waren Sie etwa auch …?»
Koch stellte die leichte Reisetasche ab und nahm dem Mitreisenden gegenüber am Fenster Platz. Die Aussicht war durch weißen Dampf verwehrt, der sich wie Nebel in der niedrigen Bahnhofshalle verbreitete.
«Kennen wir uns?»
Kaum platziert, sprang der Mann erneut auf: «Stabsarzt Weisser, abgeordnet zum Kaiserlichen Gesundheitsamt.»
Koch musterte den Kollegen. Sein Gesicht war faltenlos. Und er schien ehrgeizig. Immer noch bewahrte er Haltung.
«Ich sah Sie gelegentlich auf den Gängen. Überall spricht man voller Ehrfurcht von Ihnen: über Ihre Arbeit in den Kolonien, Ihre Leidenschaft auf dem Gebiet der Epidemien!»
Der Gepriesene war gegenüber Komplimenten von Fremden vorsichtig. Er nahm sein Gegenüber fest in den Blick. «Und Ihre Satzfetzen eingangs: Wo war ich etwa auch?»
«Na, wissen Sie denn nicht …?»
«Kommen Sie aus Hamburg?», fragte Koch.
Weisser zog eine Tasche heran, die neben ihm auf dem Sitz stand, und legte den Arm darum. «Selbstverständlich. Wir wurden gerufen. Von höchster Stelle, doch ohne Wissen der örtlichen Behörde. Die Person – unser Informant – bittet um absolute Diskretion. Gesundheitssenator Hachmann ist für seine Wutausbrüche bekannt.»
«Steht es so schlimm? Ich dachte, man nimmt an, es sei die harmlose hiesige Abart der Cholera?»
Der Stabsarzt schüttelte den Kopf. Sein Gesichtsausdruck offenbarte höchste Besorgnis. «Es steht schlimmer, als die Behörden zugeben wollen.» Er sah sich um. Sie waren immer noch zu zweit.
Koch musste lächeln. Weisser nahm seine Aufgabe anscheinend sehr ernst. «Berichten Sie!»
Der Arzt straffte seinen Oberkörper. Die Tasche hielt er immer noch umklammert. «Ist das ein Befehl?»
«Ja, Herrgott, natürlich ist das ein Befehl. Reden Sie!»
«Aber …»
«Ich bin ohnehin nach Berlin kommandiert. Ob jetzt oder in vier Stunden – ich werde es erfahren.»
Stabsarzt Weisser musterte Koch. Dann senkte er die Stimme. «Es ist sicher, dass in Hamburg die gefährliche indische Form ausgebrochen ist. Schon gibt es Tote. Niemand weiß, wie viele es sind. Weil sie einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen, was offensichtlich ist, weigern sich die Behörden, Zahlen zu sammeln.»
Eben setzte sich der Zug in Bewegung. Blitzschnell griff Koch nach seiner Reisetasche und sprang auf. Die Zeitungen ließ er liegen. Er war schon fast zum Abteil hinaus, da rief Dr. Weisser ihm hinterher:
«Wohin wollen Sie denn, Dr. Koch?»
«Ich bleibe in Hamburg! Der Nachweis ist einfach! Wir müssen handeln, jetzt!»
Weisser zog eine überlegene Miene und bat Koch zugleich, sich wieder zu setzen. Er rollte mit den Augen.
«Reden Sie Klartext, Mann!», rief Koch.
Endlich löste Weisser seine Tasche aus der Umklammerung und schob sie vor. «Ich habe eine Probe.»
«Sie haben – was?»
«In Hamburg gibt es nur wenige Ärzte, die eine Koch’sche Nährlösung für den Vibrio Cholerae herstellen können. Doch einem ist es gelungen – behauptet er wenigstens.»
«Wer ist es, kenne ich ihn?»
«Der Direktor des Neuen Allgemeinen Krankenhauses: Dr. Theodor Rumpf.»
«Gehört habe ich den Namen, doch zu meiner Zeit gab es keinen Doktor Rumpf in Hamburg.» Koch hatte seine Assistenzarztzeit zu einem kleinen Teil am St. Georger Allgemeinen Krankenhaus verbracht. Sein Blick deutete auf die Tasche. «Darf ich sehen?»
Weisser legte den Arm darüber, ließ sie aber weiter auf seinen Knien stehen. «Dr. Koch!», mahnte er. «Es handelt sich um den Cholera-Erreger!»
Koch lächelte verkniffen. «Gewähren Sie mir einen Blick! Ich werde die Probe schon nicht verschütten.»
Der Stabsarzt machte immer noch keine Anstalten, das Glas auszuhändigen.
«Muss ich Ihnen erst befehlen, Leutnant?» Als Direktor einer preußischen Behörde wusste Koch seinen Rang notfalls mit Ruppigkeit einzusetzen. Das fiel ihm nicht leicht, denn im Harz, Kochs Heimat, war man eher milde gestimmt – und schon gar nicht militärisch.
Widerwillig öffnete Weisser die Metallschlösser. Er händigte Koch ein mit Klemmen verschlossenes und mit gewachstem Hanf versiegeltes Glas aus. Koch schickte sich an, die Spangen zu öffnen.
«Dr. Koch!»
«Herr Stabsarzt», mahnte Koch, «Sie vergessen sich! Der Erreger kann nicht über die Luft übertragen werden.»
Weisser zog sich beleidigt zurück und sah zu, wie Koch mit sichtlicher Kraftanstrengung – nichtsdestotrotz vorsichtig – das Glas öffnete. Die Hanfstränge legte er beiseite, um sie später wieder zum Verschließen benutzen zu können. Koch roch an der Flüssigkeit. Und zuckte zurück. «Das riecht gut. Könnte gelungen sein.»
«Wenn man Dr. Rumpfs Aussage Glauben schenken möchte, hat er den Komma-Bazillus in dieser Lösung isoliert und nachgezüchtet.»
«Was haben Sie noch?» Mit der Beobachtungsgabe des Naturwissenschaftlers hatte Koch entdeckt, dass der Stabsarzt ein zweites Glas in seiner Tasche verbarg. Weisser druckste herum. «Die Stuhlprobe des mutmaßlich ersten Opfers: ein Polier aus dem Hafen. Bei Ausbesserungsarbeiten der Kaimauer am Kleinen Grasbrook brach er zusammen.»
«Warum weiß man in Berlin nichts davon?»
«Der behandelnde Arzt schrieb Brechdurchfall auf den Totenschein.»
«Dilettant!»
«Nein, Diplomat.»
«Ich denke, er ist Arzt!»
«Durchaus. Aber er ist noch kein Mitglied der Hamburger Ärztekammer, möchte es aber zu gern werden. Also vermeidet er, sich in die Nesseln zu setzen. Und schreibt Brechdurchfall statt Cholera.»
«Nun geben Sie schon her!»
Weisser versuchte erneut zu protestieren, doch diesmal ersparte Koch ihm den Hinweis auf die Hierarchie. Ein strenger Blick genügte, und der Stabsarzt händigte ihm das Glas aus. Koch besah sich alles ganz genau. Ein Stofffetzen, hellbraun bis grünlich, mit getrockneten Blutflecken durchsetzt. Ohne zu zögern, öffnete Koch das Glas. Und wieder roch er an den Ausdünstungen. Weisser schreckte unwillkürlich zurück, obwohl der Geruch ihn noch gar nicht erreicht hatte.
Auch Koch streckte das Glas rasch wieder von sich. «Ich kenne diesen Geruch», sagte er schmallippig. «Der Kranke ist mit Kalomel behandelt worden. Dafür spricht auch die grüne Farbe. Haben Sie den Chlorgeruch bemerkt?»
«Die Fahrkarten bitte!»
Die Doktoren zuckten zusammen. Aus einem der Nebenabteile war die Stimme des Schaffners an ihr Ohr gedrungen. Kochs Bewegungen waren schnell und präzise: Er wickelte Hanf und verschloss den Deckel. Just in dem Moment, da der Schaffner das Abteil betrat, waren die Gläser in Weissers Tasche verschwunden. Der Bahnbeamte atmete tief ein und verzog das Gesicht.
«Ist etwas?» Koch trug Unschuldsmiene.
«Dieser Geruch!», sagte der Schaffner.
Koch und Weisser warfen sich Blicke zu.
«Wonach soll es denn riechen?», fragte der Stabsarzt.
«Ist das Alkohol?» Der Schaffner musterte die Reisenden.
«Wir trinken nicht», sagte Weisser.
Wortlos ging der Schaffner dazu über, die Billette zu kontrollieren. Lochte sie und trat – mit vorgehaltener Zange, als müsse er seinen Abgang sichern – rückwärts aus dem Abteil. Schob schließlich die Tür ins Schloss, ohne eine gute Weiterfahrt zu wünschen.
Erleichtert sahen Weisser und Koch einander an. Dann mussten sie sich abwenden, um nicht laut herauszulachen. Da öffnete sich die Abteiltür erneut, und der Schaffner trat ein zweites Mal herein.
«Stimmt etwas nicht?», fragte Koch.
Der Schaffner sah die beiden Herren an, hob den Zeigefinger und sagte dann augenrollend: «Jetzt weiß ich, wie es riecht: nach Krankenhaus.»
Gottlob war der Weg von der Wenningstedter Pension bis hierher nicht weit. Er ging durch einen Dünengrasgürtel mit erheblichen Anstiegen. Die Staffelei und alle Malutensilien trug sie in einem Tornister auf dem Rücken. Kochs unvorhergesehene Abreise hatte ihr einen ganzen, wertvollen Tag zum Malen geschenkt. Nicht, dass der Geliebte sie in ihrer Kunstübung beschränkte. Doch in den bislang raren und kostbaren Stunden ihrer Zweisamkeit wollte sie ganz für ihn da sein.
Mitten in den Dünen rammte Hedwig die dürren Beine ihrer Staffelei in den Sand. Den Sommerhut mit Fliegenschleier, Krempe und Schleifenband hängte sie einfach über die Spitze des Stativs. Der blaue Stoff flatterte im Wind: die Standarte der Kunst. Die Leinwand hatte sie gegen die Streben geklemmt, damit sie nicht weggeweht wurde. Die Wolken über der See waren in Fetzen gerissen. Zumeist begann Hedwig ihre Gemälde, nachdem sie die Horizontlinie bestimmt hatte, mit der zarten Konturierung des Himmels. Sie malte ohne Skizze, direkt in Öl – in Paris war das längst à la mode. Die Bilder der französischen Künstler – Degas, Monet, Toulouse-Lautrec – wurden zum Maßstab für Europa und die ganze Welt.
Hedwig arbeitete konzentriert. Ein Paar am Strand, Arm in Arm vor der aufgehenden Sonne. Ein rot und weiß gestreifter Schirm, nicht, um es vor Regen oder Sonnenstrahlen zu schützen, sondern vor Unheil. Eine Chiffre für eine zerbrechliche Liebe, womöglich für ihre Liebe zu Koch, die von allen in Frage gestellt wurde. Kaum wagte er, sich zu ihr zu bekennen; verbarg die Geliebte vor den Augen der Öffentlichkeit, vor den Ohren seiner Tochter. Die Tränen schossen Hedwig in die Augen, sie würde Koch das Bild widmen.
Hedwig zog noch ein paar kräftige Pinselstriche, nachdem sie die Tränen getrocknet hatte, aber da war ihre Aufmerksamkeit schon abhanden. Sie hatte bemerkt, dass man sie beobachtete. Ein Mann mit gewichstem und gezwirbeltem Schnauzbart, dazu ein kecker Strohhut, hatte sich auf einer nahen Düne postiert, auf der Anhöhe, nur einen Steinwurf entfernt. Und er verunsicherte Hedwig, je länger er da stand und glotzte. Ob sie es wollte oder nicht, galt ihr Interesse nun nicht mehr dem Bild. Der unverschämte Kerl hatte sich gut sichtbar aufgestellt! Er musste sich bewusst sein, dass sie ihn sehen, mehr noch, dass sie ihn schlechterdings nicht übersehen konnte.
Ohne Bewegungen des Kopfes, nur mit einem kleinen Schwenk ihrer Pupillen in die richtige Richtung, war sie in der Lage, den Mann genauer zu betrachten. Sie sah, dass er den Stock, auf den gelehnt er bis dahin gestanden hatte, mit einer energischen Bewegung aus dem Sand zog. Ihn sich unter den Arm klemmte, die Düne hinabschritt und auf sie zu! Der Sand spritzte bei jedem Schritt, und für einen Moment war seine Gestalt zwischen zwei Dünenkämmen verschwunden. Sie wünschte sich inniglich, dass es dabei blieb, aber nein, schon sah sie den Hut, im nächsten Moment würde er den letzten Kamm erklimmen, der sie noch trennte. Sie spürte, dass sie errötete. Zog den Hut vom Kreuz der Staffelei und setzte ihn sich fest auf den Kopf. Band den Fliegenschleier um ihr Kinn und verknotete die Enden. Dann tauchte sie den Pinsel ein und widmete sich der Staffelei. Schon drang sein Keuchen an ihr Ohr. Der Sand war tief, das Fortkommen kostete Kraft. Er kam den Hang hinab und blieb, ein Dutzend Schritte von ihr entfernt, stehen. Offenbar wartete er darauf, dass sie ihn wahrnahm, heranrief, begrüßte. Sie tat nichts dergleichen. Bearbeitete weiter die Leinwand, als bemerke sie ihn gar nicht. Doch anstatt sich abzuwenden und das Weite zu suchen, trat er näher. Hedwigs Herz schlug. Sie löste den Blick nicht von der Leinwand.
«Guten Tag, verehrtes Fräulein.» Er stand jetzt neben der Staffelei. Hedwig konnte sein Rasierwasser riechen, vom Wind herübergetragen. Es war süßlicher als das ihr so bekannte.
Hedwig murmelte einen flüchtigen Gruß. Zum Glück wusste er nicht, wie es in ihr aussah! Still standen sie beisammen, so lange, bis die Spannung unerträglich war.
«Sie wünschen, der Herr?», fragte Hedwig schließlich und war damit die Unterlegene im Nervenkampf.
«Ich wollte nur sichergehen, dass ich nicht aus Versehen auf Ihr Bild geraten bin.» Sein Tonfall war ruhig und höflich. Hedwig zog eine Augenbraue hoch.
«Darf ich?», fragte er und hatte die Staffelei so umrundet, dass er das Gemälde nun von der Vorderseite betrachten konnte. Er stützte sein Kinn in die Hand.
«Sie müssen sich nicht sorgen», sagte Hedwig da, «nichts und niemand gerät zufällig auf ein Gemälde.»
Er warf ihr einen amüsierten Blick zu. Offenbar ein Mann, der den Reichtum des Geistes und die Schlagfertigkeit bei einer Dame zu schätzen wusste.
Hedwig bemerkte seine dunklen Augen. Ein angenehmer Kontrast zum Strohhut. Dann widmete er seine Aufmerksamkeit wieder dem Bild. Immer noch hatten sie einander nicht vorgestellt! Anstatt der Höflichkeit Genüge zu tun, war er ganz in ihr Gemälde versunken – und sie wagte nicht, ihn zu stören.
«Darf ich beschreiben, was ich sehe?»
«Es ist noch nicht fertig.»
«Heißt das: Nein?»
Hedwig legte den Pinsel über die Palette und klemmte ihn mit dem Daumen fest. Dann legte sie sie beiseite und verschränkte die Arme. «Haben Sie etwas dagegen, dass ich einen Apfel esse, während Sie mein Bild interpretieren?» Sie trat einen Schritt zurück. Mit generöser Geste stimmte der Unbekannte zu. Hedwig holte einen Apfel aus dem Tornister und biss hinein.
Währenddessen war der Mann noch tiefer in die Betrachtung gesunken und unterhielt sich eher mit sich selbst. «Es drückt eine Sehnsucht aus. Die Sehnsucht einer jungen Frau, Teil eines Paars zu sein. Aus eins zwei zu machen, sich zu verbinden in der Harmonie des Meeres, verschmolzen mit der Sonne.»
Das Gerede war ihr entschieden zu pathetisch.
«Strand und Meer sind die Symbole der Unendlichkeit», fuhr er fort, «aber auch des Ankommens.»
Hedwig kaute den Apfel. «Tatsächlich? Na, wenn Sie meinen. Ich male, was ich sehe.»
«Irrtum. Sie malen, was Sie sehen wollen.»
Hedwig wusste nicht, was diesen Mann berechtigte, über ihre Kunst zu urteilen. Ihr Tonfall wurde gereizt. «Ich male, was ich sehe.»
«Sind Sie verheiratet?», fragte er sie geradewegs ins Gesicht.
Hedwig musterte den jungen Mann amüsiert. «Holla, mein Herr, so keck?»
«Ich möchte den Inhalt des Bildes verstehen.»
«Ich bin verlobt.»
«So ein Zufall, das war ich auch, bis vorgestern.»
Hedwig machte einen verächtlichen Ton. Was wollte ihr der Herr signalisieren? «Ach. Und was sind Sie jetzt?»
«Verheiratet. Seit gestern», fügte er hinzu. Und Hedwig konnte das Erstaunen nicht verbergen.
Der Fremde rieb sein Kinn zwischen Daumen und Zeigefinger und fuhr fort: «Ich würde sagen, dies Bild drückt die Sehnsucht nach Ihrem Verlobten aus. Paareinheit und Schutz derselben, verkörpert durch den Schirm.»
«Gut möglich.»
«Habe ich Sie in Berlin gesehen? Auf einer Bühne?»
Hedwig warf das Kerngehäuse des Apfels in hohem Bogen in die Dünen. «Das glaube ich nicht. Ich war lange nicht in Berlin.»
«Aber Sie stammen von dort, hab ich recht? Ich hör’s doch am Tonfall.»
Hedwig nahm die Palette wieder auf. Der junge Mann betrachtete sie von der Seite. «Es war», sagte er dann und suchte nach Worten, «eine etwas, wie soll ich sagen, anrüchige Bühne.»
«Ich weiß nicht, was Sie meinen.»
«Ich möchte das Bild kaufen und meiner Braut schenken.»
«Es ist noch nicht fertig.» Und um keinen Zweifel zu lassen, fügte Hedwig hinzu: «In diesem Zustand ist es unverkäuflich.»
«Malen Sie nicht, um Bilder zu verkaufen?»
«Wollen Sie etwas Unfertiges haben?», entgegnete sie.
Der junge Mann lächelte hintersinnig: «Es ist wie in einer Ehe: Wenn man heiratet, ist man unfertig. Man muss sich überraschen lassen, was man bekommt. Und sich dann gemeinsam vollenden.»
Hedwig hatte den Kopf gesenkt. Dann hob sie ihn und sah ihm stolz in die Augen: «Ich würde jetzt gern weitermalen. Falls Sie nichts dagegen haben. Sonst wird es niemals fertig!»
«Die Idee», sagte der junge Mann und tippte sich an den Hut, «ist in vollem Umfang wiedergegeben. Und es ist eine wunderschöne Idee – einer wunderschönen Frau würdig.» Er reichte ihr eine Visitenkarte: Gustav Erlau – Galerist. Darunter, in großen Lettern: Berlin Mitte. Hedwig machte große Augen und wusste rein gar nichts mehr zu sagen.
Der nicht mehr ganz Fremde wandte sich um und entfernte sich. Hedwig atmete aus. Aber das Herz wollte einfach nicht aufhören zu klopfen.
Alle Sicherheitsvorkehrungen waren beachtet: Koch hatte sein mit Karbol getränktes Taschentuch über das Klapptischchen gebreitet. Von diesem wirksamen Desinfektionsmittel hatte er immer ein Fläschchen dabei. Mit der Pipette hatte er einen Tropfen aus der Nährlösung entnommen. Auch das Taschenmikroskop mit seinem ins Messing eingravierten Namen – ein Geschenk der Eltern – trug Koch stets bei sich. Auf einem gläsernen Objektträger lag der Tropfen aus der Lösung. Koch hatte ein Augenlid geschlossen. Das andere Auge kniff er zusammen und sah in die Linse.
«Mir ist nicht ganz wohl dabei, Dr. Koch. Wenn der Schaffner …»
«Die Gefahr der Ansteckung ist nicht gegeben. Wir werden alles desinfizieren.»
«Ich weiß, aber …».
Koch winkte ihn zur Ruhe, er musste sich konzentrieren.
«… ich halte den Versuch», fuhr Weisser fort, «nicht für gefährlich, sondern für vollkommen vergeblich. Nur unter einem guten Mikroskop ist der Bazillus überhaupt zu erkennen. Das schrieben Sie doch selbst, Dr. Koch …»
Mit einer Geste forderte Koch ihn erneut auf zu schweigen. «Ich glaube … es könnte … ja doch … Rumpf hat gute Arbeit geleistet … kein Zweifel … da ist das Komma, wir haben ihn!»
Es lag kein Triumph in Kochs Stimme. Wie auch, seine Entdeckung bedeutete tausendfachen Tod. In dem Moment sah Weisser den Schaffner auf dem Gang. Der Warnruf kam zu spät. Schon hatte er das Abteil erreicht.
«Was tun Sie da?» Der Mann überblickte die Situation, war aber weit davon entfernt, sie zu verstehen. «Dieser Geruch! Was ist das?»
Robert Koch richtete sich auf. Er stellte sich so vor den Schaffner, dass ihm der Blick auf den wissenschaftlichen Aufbau verborgen blieb. Es durfte sich ihm keinesfalls erschließen, worum es ging.
«Untersuchungen im Auftrag des Kaiserlichen Gesundheitsamtes, mein Herr. Nicht der Rede wert. Am besten, Sie vergessen gleich wieder, was Sie gesehen haben.»
«Wie könnte ich diesen Geruch vergessen! Am Ende haben Sie etwas mit dieser Seuche zu schaffen.»
Koch unterdrückte den Reflex, Weisser einen Blick zuzuwerfen.
Der Schaffner war nur noch eine Handbreit von der Erkenntnis entfernt. «Räumen Sie das alles wieder beiseite», sagte er dann mit plötzlicher Milde. «Wenn Sie das Abteil verlassen, möchte ich nichts mehr davon sehen.»
Koch willfuhr seinen Wünschen. Es war der einzig mögliche Ausweg. Der Schaffner durfte den Zug nicht in Panik versetzen!
Im Abgehen, durch Kochs Fügsamkeit sichtlich besänftigt, fügte der Reichsbahnbeamte noch hinzu: «Und öffnen Sie das Fenster!»
«Machen Sie sich keine Sorgen, es hat alles seine Richtigkeit. Ich bin kaiserlicher Geheim- und Medizinalrat.»
Koch langte nach dem Griff, nachdem der Schaffner das Abteil verlassen hatte, und schloss die Tür. Entkräftet ließ sich Weisser auf die Polster fallen. Koch beräumte das provisorische Labor, verstaute das Taschenmikroskop und desinfizierte Griffe und Polster. Seine überaus penible Sorgfalt beunruhigte ihn selbst. Und tatsächlich hatte er allen Grund dazu. Er senkte die Stimme und raunte Weisser zu: «Es besteht kein Zweifel mehr. Es ist die asiatische Form!»
Die Züge von Hamburg und Altona erreichten die preußische Hauptstadt auf dem Anhalter Bahnhof. Die Halle aus gelbem Klinker war niedrig, aber lichtdurchflutet. Die geschosshohen Bögen der Stirnseite, die die Oberlichter im gewölbten Dach rahmten, sorgten für die Helligkeit einer gotischen Kirche. Der Bahnhofsbau war ein Dreiklang aus Stahl, Klinker und Glas, wie es der Mode entsprach. Die Bahnhöfe waren die Kathedralen der neuen Zeit.
Die Rauchfahnen der Eisenbahnen zogen unters Dach und verschlangen sich unentwirrbar. Während Stabsarzt Weisser eine Mietdroschke für die Fahrt zum Kaiserlichen Gesundheitsamt rief – vor dem Seitenausgang zur Möckernstraße warteten sie zu Dutzenden auf Fahrgäste –, eilte Koch zum Telegraphenamt in der Eingangshalle des Bahnhofs. In der Hand nur die Reisetasche, formulierte er im Kopf bereits die Nachricht an Hedwig. Am Schalter bedrängte er die Telegraphistin mittels seines Namens und Titels, eine Nachricht aufzunehmen, die unverzüglich nach Sylt abgehen solle. Eine Warnung, eine Liebesbotschaft, eine mehr als dringliche Bitte: Keinen Kontakt aufzunehmen mit Reisenden aus Hamburg!
Der sonst so kluge und klare Mann war in panischer Sorge um seine Verlobte. Der Weg von Sylt nach Hamburg war kurz und immer beliebter. Und wenn die Seuche schon in Hamburg war … Er hatte Erklärungen angefügt, Beteuerungen, Beschwörungen. Längst war die Zahl erlaubter Zeichen überschritten.
«Das sind zu viele Worte, Dr. Koch, sagen Sie es kürzer, bitte!», mahnte die Telegraphistin. Hinter der Milchglasscheibe erkannte Koch eine hoch getürmte Frisur.
Er zerknüllte das Formular, nahm einen neuen Zettel, formulierte um und strich zusammen. Dann reichte er der Telegraphistin die Zeilen.
«Das sind zwanzig Wörter, Herr Doktor!» Das Kopfschütteln war durch das trübe Glas nicht im mindesten gemildert.
Koch wusste um die Kosten, wusste um die Effizienz, auf die die preußischen Telegraphisten verpflichtet waren, damit das fragile Nachrichtennetz nicht an seine Grenzen geriet. Seit dem Beginn dieser Art der Verständigung war die Menge der verschickten Botschaften schier explodiert. Und die Telegraphistinnen waren angewiesen, keine Banalitäten anzunehmen.
Koch schob den zweiten Zettel beiseite, nahm noch einen und formulierte erneut. Verzichtete diesmal auf alle Erklärungen und Beteuerungen. Weisser stand bereits hinter ihm und mahnte zur Eile: Die Mietdroschke erwarte sie auf dem Vorplatz und die Kaiserliche Gesundheitsbehörde ohnehin längst.
Endlich kritzelte Dr. Koch drei Wörter auf den Zettel und reichte ihn der Dame unter dem Glas durch: «Nicht nach Hamburg!»
Sie schob die Nickelbrille höher auf die Nase. «Das ist alles?»
«Das ist alles», bestätigte Koch.
Mit spitzer Nase drehte sich die Telegraphistin um und reichte den Zettel dem Operateur. Der beugte sich über das Morsegerät und setzte das Telegramm ab. Koch kramte derweil in der Westentasche nach Münzen.
Der Sylter Badestrand maß etwa dreitausend Schritte von Nord nach Süd. Für die Gäste, die selbstverständlich nicht nackt in die Fluten steigen durften, sondern die Alltagskleider gegen eine ebenso taugliche wie sittliche Badekluft tauschten, gab es Badekarren. Dies waren auf eine einachsige Plattform montierte Umkleidekabinen. Für die Männer standen sie auf dem nördlichen, für die Damen auf dem südlichen Strandabschnitt bereit. Hölzerne Tritte führten zu einem Verschlag hinauf, der Privatheit gewährte. Um auch im Badekleid keine unsittliche Erscheinung abzugeben – die Wellen könnten womöglich die Säume so weit aufwerfen, dass Haut zu sehen wäre –, schoben Badeknechte die Wagen mitsamt ihren Passagieren so weit in die Fluten, dass beinahe die Hälfte des Karrens im Wasser stand. Dies ermöglichte dezentes Aussteigen.
Die Badezeiten waren von morgens, sechs Uhr, bis mittags, ein Uhr. So lange gab es Aufsicht und Karren. Nach jener Zeit waren die Badegäste auf sich gestellt. Es war halb ein Uhr, und Hedwig musste sich sputen.
Sie bestieg den Karren, nachdem sie mit dem Wagenknecht – zwangsläufig ein Mann, denn die Aufgabe erforderte Kraft – den Preis für das Hineinschieben ausgehandelt hatte. Er hatte kurze Hosen an, seine Waden waren salzverkrustet.
Ihr Badekleid trug Hedwig im Arm, eingeschlagen in ein Handtuch. So stieg sie die Stufen zum Verschlag hinauf und öffnete ihn. Holzduft, ein wenig modrig, schlug ihr entgegen. Die Feuchte setzte den Planken zu, eine lange Lebensdauer war den Badekarren gewiss nicht beschieden.
Das Innere war denkbar einfach: Eine Bank erleichterte das Umkleiden, schmale Schlitze unter dem Dach sorgten für ein Dämmerlicht, das das Erkennen der Kleidungsstücke ermöglichte – nicht mehr.
Rasch hatte sie ihre Kleidung abgestreift. Sie trug ein Bustier mit verstärkenden Rippen, kein Korsett. Sobald sie im Badekleid war, gab sie das vereinbarte Klopfzeichen, und der Karren setzte sich in Bewegung. Sie hielt sich an den Wänden fest, indem sie beide Arme so weit wie möglich ausstreckte und rechts, links gegen die Latten stemmte. Auf diese Weise hatte sie einigermaßen sicheren Stand. Schon drang Wasser durch die Bodenplanken, zunächst durch die Lücken, dann flutete es um ihre Füße und Knöchel, sodass Hedwig schon die Panik erfasste, der Knecht könne sie zu weit hinausfahren. Der Karren hielt, und der Mann gab das vereinbarte Klopfzeichen, das es Hedwig erlaubte, den Verschlag zu verlassen.
Sie öffnete die Tür der fahrbaren Garderobe, sofort schlug ihr die salzige Brise in die Nase. Hedwig starrte auf die unendliche See. Die Wellen umspielten die Trittbretter zu ihren Füßen, einen Schritt noch nach unten, und auf der zweiten Schwelle schon stand sie im Wasser. Sie setzte den Fuß weiter hinunter und spürte den Sand unter ihren nackten Sohlen, zwischen ihren Zehen. Die Lust der Berührung ließ sie erschauern. Ihr Herz juchzte auf, als sie sich, langsam, aber ohne zu zögern, bis zum Bauch in die Fluten sinken ließ. Hedwig hatte – anders als Koch – schwimmen gelernt. Dennoch blieb sie in einem Bereich, wo sie Sand unter den Füßen behielt. Angehockt ließ sie sich vom flachen Wasser bald hierhin, bald dorthin tragen.
Schon nörgelte der Karrenknecht, wie lange sie denn noch herumplanschen wolle, für diese Art Sportübung lange doch die Badewanne! Außerdem gehe es schnurstracks auf ein Uhr zu. Dann werde er den Karren einfach im Wasser stehen lassen. Sehen durfte er sich nicht lassen, geschweige denn ihr zuschauen. Er musste zwischen den Holmen – so wollte es die Vorschrift der kaiserlichen Badeordnung – ausharren, bis die Dame wieder im Kasten war. Hedwig bat um einen letzten Aufschub, den der Mann knurrend gewährte.
In weitem Bogen schwamm sie noch einmal Richtung hohe See hinaus, nichts vor sich als die Rauchsäule eines hinter dem Wellenhorizont verborgenen Dampfschiffs – womöglich eines der Sylt-Tondern-Linie? – und das weite Wasser der Nordsee.
Als sie umkehrte und schon auf den Badekarren zuhielt, fielen ihr am Ufer, gar nicht weit entfernt, zwei Gestalten ins Auge. Etwas an ihnen schreckte sie auf, sie wusste selbst nicht genau, was es war. Das Paar mochte gerade erst einem an Land zurückgekehrten Karren entstiegen sein, denn sie hielten tropfende Badekleidung in den Händen. Doch anstatt zum Ausgang zu eilen, steuerten sie, dicht an der Grenze vom Männer- zum Frauenbad, auf die Dünen zu. Und nun erkannte sie den Herrn im Strohhut: Es war zweifellos der aufdringliche Passant in den Dünen vom frühen Vormittag. Der Schnurrbart, das dunkle, pomadierte Haar, die breiten Schultern – just derselbe, der ihr Bild hatte kaufen wollen!
Mit einer Dame an seiner Seite strebte er den Dünen entgegen. Und obwohl die Sperrung des Geländes andauerte – es war immer noch vor ein Uhr –, betraten sie den Dünenstreifen und waren alsbald von hohen Grasbüscheln verschluckt. Was hatten sie dort wohl zu schaffen?, fragte sich Hedwig. Und beschloss, ihnen, sobald sie sich ihrer Kleider bemächtigt hatte und wohlbehalten an den Strand zurückgekehrt war, nachzustellen. Haargenau merkte sie sich die Stelle in den Dünen, wo die beiden verschwunden waren. Da setzte sich der Badekarren in Bewegung, ohne dass der Knecht sie gewarnt hätte, und Hedwig musste die letzten Schritte durchs Wasser hüpfen, um auf die Stiegen zu gelangen.
Auf dem Strand gab sie eine lächerliche Figur ab: Mit den Schnürstiefeln war der Marsch beschwerlich. Der Saum ihres leichten Sommerkleides schleifte über den Strand. Schon perlte Schweiß auf ihrer Stirn. Die Stelle, wo das Paar ins Dünengras getreten war, war nicht schwer zu finden. Aber dann verloren sich ihre Fußabdrücke zwischen den Büscheln und waren nur noch hier und da erkennbar. Bald zog Hedwig die Stiefel aus.
Die Zeit floss langsamer als der Schweiß. Schon wollte sie aufgeben, das Paar zu suchen, da hörte sie ein unterdrücktes Kichern, nicht weit von ihr entfernt. Als sei sie von der Strandpolizei mit der Kontrolle dieses Abschnitts beauftragt, trat sie auf den Ort zu, von wo die verdächtigen Geräusche kamen. Noch bevor sie auf dem Dünenkamm angelangt war, hatte sie die beiden entdeckt.
Die Dame – sicherlich die Braut des Mannes, anders konnte es nicht sein – hatte sich ihres Überkleides entledigt und saß nur in Spitzenbustier und Unterröcken im Sand. Der Mann war bereits ohne Hemd, während die Frau sich anschickte, das Korsett aufzuhaken.
Mit einem versehentlichen «Ach» erklomm Hedwig den Kamm. Augenblicklich waren zwei Augenpaare auf sie gerichtet. Die Miene des Galeristen drückte Erkennen aus. «Die Malerin der Morgenstunde!», rief er erfreut. «Herzlich willkommen in den Wällen unserer Sandburg.»
Hedwig war zu verblüfft für eine Antwort.
«Kommen Sie doch zu uns! Gesellschaft ist immer gern gesehen.»
«Gerade eben hatte es noch nicht den Anschein.» Hedwig ärgerte sich über ihre Prüderie. Doch die Hand des Mannes auf der nackten Schulter seiner Gefährtin ließ sich schwerlich übersehen.
«Haben Sie etwas dagegen, wenn wir uns weiter entkleiden?», fragte der Mann und wartete ihre Antwort gar nicht erst ab. Die junge Dame stellte sich noch mit Namen vor, bevor sie das Korsett endgültig öffnete und ihre Brüste dem Sonnenlicht offenbarte.
Als Hedwigs Blick wieder zurück zum Mann wanderte – er hatte sich und seine Begleiterin nochmals vorgestellt: Gustav Erlau und Frieda, geborene Knesebeck –, hatte der sich seiner Hosen entledigt und lag, in ganzer Schönheit der Sonne preisgegeben, im Sand. Die Augen hielt er geschlossen. Zufrieden murmelte er: «Kurz nach dem Mittag ist es hier am wärmsten.»
Hedwig, glühend wie ein Ofen, hatte immer noch das Kleid bis oben zugeknöpft.
«Kennen Sie die Thesen der Sonnenrefomer, mein Fräulein?», fragte Frieda da. «Sie lehnen alle Stoffe ab, die aus einer Fabrik stammen, und versehen sogar ihre Feldarbeit ohne Kleider.»
«Nein, nie gehört», stammelte Hedwig und kam sich furchtbar unwissend vor.
«Die Sonne auf der nackten Haut ist überaus gesund. Man sollte sich mehrmals wöchentlich dem Licht exponieren. Vor allem solche Stellen des Körpers, die sonst nie dem Licht ausgesetzt sind. Das steigert das Wohlbefinden», dozierte Frieda freimütig.
«Mein Name ist Hedwig Freiberg, Kunstmalerin aus Berlin.» Mit der Linken zog sie den Schleifenknoten unter ihrem Kinn auf. Und mit einer feierlichen Geste legte sie die Kopfbedeckung neben sich.
Wenig später saß Hedwig ebenso unbekleidet bei ihren Gefährten. Zufrieden ließ sie sich zurücksinken und grub die Fingerspitzen in den warmen Sand. Nach einer Weile des stummen Genießens fragte Hedwig: «Haben Sie keine Furcht, dass man uns so findet? Nackt in den Dünen?»
Frieda lächelte. «Sollen Sie uns doch verhaften! Die neuen Regeln der Körperhygiene messen dem regelmäßigen Luftaustausch rund um unsere Haut eine eminent wichtige Rolle zu.»
Plötzlich schlug der Mann die Augen auf. «Und Sie? Haben Sie Angst?»
«Ein bisschen», antwortete Hedwig.
«Man wird es uns verzeihen, wir haben gestern geheiratet.»
Hedwig setzte sich auf. «Herzlichen Glückwunsch, das freut mich sehr!» Das Paar dankte artig.
«Können Sie uns nicht malen, zur Feier des Tages?»
Hedwig errötete erneut. «Ich habe nichts bei mir: keine Staffelei, keine Farben …»
«Wir können zu einem anderen Zeitpunkt Modell sitzen», schlug Gustav vor.
Frieda winkte ab. «Ohne mich. Ich sehe mich schon in einem Berliner Museum, nackt, wie der Herrgott mich erschuf. Sie müssen wissen», und damit wandte sich Frieda an Hedwig, «Gustav ist Galerist in Berlin.»
«Ich weiß. Wir sind uns schon begegnet.» Hedwig nickte und kicherte wie ein Backfisch. Aktmalerei hatte zu ihrer Ausbildung bei Professor Graef gehört, doch da waren die Modelle anonym. Und bei weitem nicht so schön wie dieser junge Galerist und seine Gattin. Immer wieder warf Hedwig verstohlene Seitenblicke auf ihre bronzenen Körper. Offenbar waren sie an diese Übung in den Dünen gewöhnt. Das erklärte ihre Kaltschnäuzigkeit.
«Ach, ich fürchte, die Zeit reicht ohnehin nicht mehr», seufzte Gustav. «Für ein Porträt sind doch mehrere Sitzungen erforderlich …»
«Das ist richtig. Sie reisen doch nicht etwa ab?» Das Bedauern war unüberhörbar. Die Jungvermählten strahlten sich an. Dann nickten sie synchron.
«Wohin geht die Reise? Zurück nach Berlin?», fragte Hedwig.
Schweigend sahen sie sich an. Der Mann ließ seiner Braut den Vortritt: «New York», platzte Frieda stolz heraus. Hedwig blieb der Mund offen.
«Es ist unsere Hochzeitsreise», ergänzte Gustav.
Der Galerist ließ mit beiden Händen Sand auf seine Oberschenkel rieseln. Hedwig sah, wie sich die Haufen bis auf wenige Körnchen gleich wieder auflösten. Die Bräune seiner Haut ließ darauf schließen, dass dies nicht das erste sonnenreformerische Bad war. Auch die Braut hatte eine schöne Färbung, allerdings war ihre Haut heller und von der Sonne gerötet. Im Gesicht hatte sie Sommersprossen. Hedwig hätte sie malen mögen.
«Morgen brechen wir nach Hamburg auf. Dort schiffen wir uns auf die MS Normannia