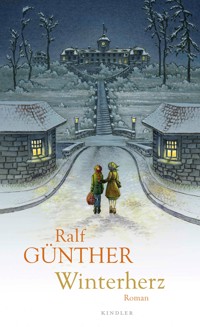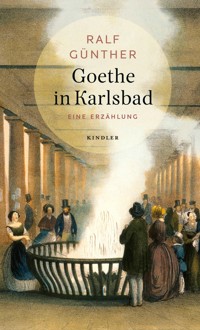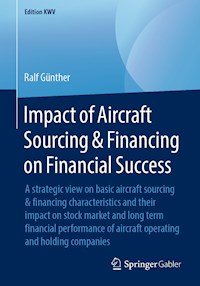19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
War es ein Unfall? Selbstmord? Mord? Der erste Skandal der deutschen Filmgeschichte. Berlin, 1920: Fritz Lang und Thea von Harbou sind das Glamourpaar des frühen deutschen Films. Den Regisseur und die Drehbuchautorin verbindet eine Leidenschaft, die weit über das Künstlerische hinausgeht. Das Filmmärchen hat nur einen Haken: Beide sind verheiratet. Als Langs Ehefrau durch einen Schuss zu Tode kommt, steht der junge Kriminalkommissar Beneken vor einem Rätsel: Hat Langs Ehefrau sich das Leben genommen, weil sie die Schmach des Betrugs nicht aushielt? Wollte sich die Harbou ihrer Nebenbuhlerin entledigen? Oder war Fritz Lang seine Ehefrau lästig geworden? Beneken sucht nach der Wahrheit. Doch keine der Versionen, die die Hauptverdächtigen Lang und Harbou ihm präsentieren, scheint mit den Fakten übereinzustimmen. Wer lügt – und warum? Je tiefer der Kommissar in die schillernde Welt der Filmsets, der Künstlerpartys und Nachtclubs eintaucht, umso mehr gerät er selbst in Gefahr. Und muss erkennen, dass die Wahrheit immer ihren Preis hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Ähnliche
Ralf Günther
Die Könige von Babelsberg
Fritz Lang und die Akte Rosenthal
Roman
Über dieses Buch
Der erste Skandal der deutschen Filmgeschichte
Berlin, 1920: Fritz Lang und Thea von Harbou sind das Glamourpaar des frühen deutschen Films. Den Regisseur und die Drehbuchautorin verbindet eine Leidenschaft, die weit über das Künstlerische hinausgeht. Das Filmmärchen hat nur einen Haken: Beide sind verheiratet. Als Langs Ehefrau durch einen Schuss zu Tode kommt, steht der junge Kriminalkommissar Beneken vor einem Rätsel: Hat die Frau sich das Leben genommen, weil sie die Schmach des Betrugs nicht ertrug? Wollte sich die Harbou ihrer Nebenbuhlerin entledigen? Oder war Fritz Lang seine Frau lästig geworden?
Beneken sucht nach der Wahrheit. Doch keine der Versionen, die die Hauptverdächtigen Lang und Harbou ihm präsentieren, scheint mit den Fakten übereinzustimmen. Je tiefer der Kommissar in die schillernde Welt der Filmsets, der Künstlerpartys und Nachtclubs eintaucht, umso mehr gerät er selbst in Gefahr. Und muss erkennen, dass die Wahrheit immer ihren Preis hat…
«Ralf Günther ist einer der vielseitigsten Autoren des Landes.» Dresdner Morgenpost
Vita
Ralf Günther wurde 1967 in Köln geboren. Als Buch- und Drehbuchautor entwickelte er Kinderserien fürs Fernsehen und schrieb historische Romane. «Der Leibarzt», sein Debüt, wurde ein Bestseller. Es folgten unter anderem «Das Weihnachtsmarktwunder» sowie «Als Bach nach Dresden kam». Ralf Günther lebt in der Nähe von Dresden.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Coverabbildung Waldemar Titzenthaler/ullstein bild via Getty Images
ISBN 978-3-644-01836-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Der erste Tag
Berlin, am Morgen des 26. September 1920, 6:00 in der Früh
«Was zum Teufel?», schimpfte Beneken und eilte auf nackten Sohlen über die Dielen der ausgekühlten Wohnung dem Pochen an der Tür entgegen. Er öffnete und erblickte einen der Fahrer des Schöneberger Kriminalkommissariats. Der salutierte militärisch. «Herr Kommissar, ein Todesfall in Schmargendorf!»
Hastig kleidete Beneken sich an. Da er sich am Vorabend rasiert hatte, verzichtete er nun guten Gewissens darauf. Seine Haut war glatt, sein Bartwuchs spärlich.
Wenig später klemmte er seine Aktentasche unter den Arm. Die Mutter – im Nachthemd, den Halsausschnitt mit zitternden Fingern geschlossen – wollte ihm Stullen aufschwatzen, Karotten, einen Apfel. Beneken lehnte dies alles ab, da der Fahrer unten wartete. Mit einem Kuss auf ihre Stirn verließ er die Hinterhauswohnung.
Vor dem Torweg des Vorderhauses wartete die Dienstlimousine der Mordbereitschaft mit tuckerndem Motor. Beneken stieg auf den Beifahrersitz.
«Es geht zur Hautevolee, wenn ich das so sagen darf!», erklärte der Fahrer ungefragt und fuhr los.
«Das Opfer?», fragte Beneken.
«Nee», grinste der Fahrer, «alle miteinander, die ganze Bagage.»
«Es gibt also bereits Verdächtige?»
«Ein Paar», nickte der Fahrer. «Mord aus Eifersucht.»
«Das wissen Sie schon?»
«Es kann nicht anders sein.»
Beneken richtete den Blick auf das Straßenpflaster. Es glänzte im Licht der Laternen. Um diese Uhrzeit war das dralle, laute Berlin kaum zu erahnen. Einzelne Fuhrwerke mit vorgespannten Pferden und Milch oder Bier auf der Pritsche suchten ihren Weg durch den frühen Morgen.
«Leute vom Kintopp.»
«Wie bitte?»
«Die Verdächtigen sind vom Film.»
Diese Information irritierte Beneken. Mit Schauspielern hatte er nicht viel zu tun. Mit Halsabschneidern, Schwarzmarkthändlern, Luden, ja – aber Filmleute? Normalerweise gingen sie ihrem Handwerk abgeschieden in Neubabelsberg nach, einer Art Künstlerkolonie auf anderthalb Quadratmeilen. Verrückte Leute, am häufigsten sah man sie auf der Leinwand – und seltener im Alltag.
Als der Kommissar die Schmargendorfer Wohnung betrat, blendete ihn ein greller Lichtstrahl. Zu spät hatte er den Ellenbogen vors Gesicht genommen, der Magnesiumblitz aus der Maschine ließ ihn kurzfristig erblinden. Der Fotograf war also bereits bei der Arbeit – aus dem Schlaf gerissen, auch er.
Als Beneken wieder sehen konnte, hatte man ihn schon an den Ort des Geschehens geführt: das Schlafzimmer. Die Stirnseite des Bettes wie die dahinterliegende Wand waren blutbesprenkelt. Ein gewachstes Tuch lag ausgebreitet auf dem Boden. Eben präparierte der Pathologe den Körper für den Abtransport. An Händen und Füßen wurde die Leiche vom Bett gehoben. Beneken fiel auf, dass sich die Totenstarre zwar schon wieder gelöst, aber deutliche Spuren am Rücken hinterlassen hatte. Der Tod musste bereits vor mehreren Stunden eingetreten sein.
Trotz des unhandlichen Kamerakastens bewegte sich der Fotograf geschmeidig über den Tatort. Jede Berührung mit mutmaßlichen Beweisstücken meidend, näherte er sich Beneken und vermeldete, dass die Ermordete aus allen nur denkbaren Blickwinkeln porträtiert sei. Nun sei es eine Sache des Gerichtsmediziners.
Bevor das Tuch über ihr geschlossen wurde, warf Beneken noch einen genaueren Blick auf den Körper. Der Anblick erschütterte ihn. Diese Frau war nicht getötet, sie war zerstört worden. Vom Schädel war nicht mehr viel übrig. Wie mithilfe eines Zerstäubers hatte sich dessen Inhalt über die Umgebung verteilt, selbst der Teppich war gesprenkelt: Blut, Knochensplitter, Hirnmasse, Daunenfedern. Daunen? Beneken pflückte eine vom Bett. Zart ruhte sie auf seinem Handteller. Der Gerichtsmediziner trat von hinten an ihn heran. «Ein Kissen wurde durchschossen. Es ist bereits bei den Asservaten.»
Beneken nickte und steckte die Feder in die Tasche. Dann fiel sein Blick auf den Bereich des Teppichs unmittelbar neben dem Bett. Offenbar hatte hier zum Zeitpunkt des Schusses etwas gestanden – oder wenigstens den Teppich bedeckt –, denn anders als die Umgebung war jener Bereich von Blutspuren verschont. Wie ein Negativ hoben sich die Umrisse des unbekannten Gegenstands gegen den hellen Teppich ab. Der Gegenstand selbst jedoch war verschwunden. Beneken bat den Fotografen, diesen Bereich abzulichten. Dann wandte sich der Kommissar ab, um die angrenzenden Räume zu besichtigen. Und um seinen Magen zu beruhigen. Ein Glück hatte er auf das Frühstück verzichtet.
Abseits des Tatorts war der Blutgeruch nicht mehr so penetrant. Ein dezentes Parfüm lag über allem. Und der gewöhnliche, leicht schweflige Geruch einer mit Holz und Kohle geheizten Wohnung.
Alles in allem war es eine komfortable Bleibe, angefüllt mit Dingen, die Beneken nie zuvor gesehen hatte: Exotische Teppiche hingen an den Wänden, kostbare Porzellanvasen thronten auf dunklen Holzpodesten, geschnitzte Skulpturen und Idole auf kleinen Tischen, sogar ein ausgestopfter Löwe streckte seine Tatzen über den Teppich. Bücher entdeckte Beneken keine, stattdessen Kriminalhefte der Serie Wanda von Brannburg – Deutschlands Meister-Detectivin und Lord Percy vom Exzentric Club auf einem niedrigen dreifüßigen Tisch neben dem Kanapee. Außerdem Unter deutscher Flagge, eine bei ehemaligen Landsern beliebte geheftete Serie aus dem Verlagshaus für Volksliteratur und Kunst. Der Kommissar griff eines der Hefte und musste schmunzeln, Revolver, Kugeln, Leichen, Schlapphüte. In gewisser Weise schien ein Bewohner dieser Wohnung den Gaunern nahezustehen; beinahe wirkte es wie Bewunderung.
In einer etwas kleineren Kammer neben dem Schlafzimmer stand ein Sekretär, darauf eine Schreibmaschine sowie ein Kanapee an der langen Wand. Neben dem Schreibgerät ein Stapel Blätter, Kante auf Kante, sorgfältig zusammengeschoben. Er warf einen Blick auf den Titel: Der müde Tod. Darunter die Namen: Thea von Harbou und Fritz Lang. Einen Moment lang war er versucht, darin zu blättern, dann entschied er sich, erst die Verfasser um Erlaubnis zu fragen. Er prägte sich alles so gut wie möglich ein, dann musste er nicht nach Fotos suchen.
Er warf einen Blick in die Küche. Das Herdfeuer war, anders als daheim bei der Mutter, erkaltet. Der Ascheimer neben dem Herd fiel ihm auf, weil der Deckel schief auf dem Blechrand saß. Er hockte sich hin, ließ die Hand über den gekachelten Boden fahren. Da waren Aschereste ringsum. Sie wollten nicht zur Sauberkeit der Wohnung passen. Er öffnete den Deckel, nahm den Schürhaken und fuhr wie mit einem Kochlöffel durch die graue Masse. Er hatte den richtigen Riecher gehabt: Der Löffel stieß auf Widerstand: Etwas versperrte den Weg des Hakens. Beneken grub und hebelte ein wenig, dann zog er zwei mit Pelz besetzte Hauspantoffeln aus dem Eimer. Über dem Spülstein fegte er mit dem Handrücken die Asche herunter. Es waren Lederpantoffeln. Und das Muster auf dem Leder erinnerte ihn an etwas … Er legte den Deckel wieder auf den Blechrand, wusch sich die Hände und nahm die Pantoffeln mit.
Als er ins Schlafzimmer zurückkehrte, war das Wachstuch über der Leiche geschlossen. Der Assistent des Pathologen hob das Bündel mal hier, mal dort an und zog Seile darunter. Als er den Kopf anhob, schlug die Ecke des Tuches zurück, und der zerschmetterte Schädelrest lugte wieder heraus. «Nich’ so neujierig, Kleene», murmelte er und wickelte ungerührt das Wachstuch wieder darum.
«Wann hat man sie so zugerichtet?», fragte Beneken mit trockenem Mund. «Es müssen Stunden vergangen sein …»
Der Pathologe strich sich über den Schnäuzer. «Da haben Sie aber einen scharfen Blick, Kollege! Die Beteiligten erschienen am gestrigen Abend von sich aus im Kommissariat. Da war die Frau schon tot – nicht doch so, du Hornochse! Entschuldigen Sie, Herr Kommissar.» Der Pathologe knuffte den Assistenten vom Körper der Toten fort. Dann verzurrte er die Schnüre eigenhändig und fachgerecht. «So und so: überkreuz, verstehst du? Sonst klatscht dir beim Aufladen die ganze Chose auseinander.» Die Miene des Gehilfen gab keine Auskunft darüber, ob er verstanden hatte.
«Alles muss man selber machen!», beklagte sich der Gerichtsmediziner mit dem Walrossbart. Er hatte die Physiognomie eines Engländers, nur das Tweedjackett fehlte. Mit vereinten Kräften wuchteten sie den zarten Leichnam auf die Schulter des Gehilfen. Seine Beine zitterten, aber er tat Schritte zur Tür hin.
«Benötigen Sie Hilfe?», rief Beneken ihm hinterher.
Der Assistent blieb stumm. Der Pathologe winkte ab. «Im Krieg war er Lazaretthelfer. Leichenbuckeln ist sein Geschäft.» Der Blick des Pathologen fiel auf die Pantoffeln. «Was haben Sie da gefunden?»
«Pantoffeln.»
«Das sehe ich. Aber wo?»
«Im Ascheimer.»
«Ungewöhnlicher Ort für Pantoffeln.» Der Pathologe strich sich mit der Rechten über den Schnauzbart. Beneken überreichte ihm die Schuhe. «Wären Sie so freundlich und untersuchten diese Flecken? Würde mich nicht wundern, wenn sie sich als Blutstropfen entpuppten.»
Vorsichtig nahm der Pathologe die Pantoffeln in Gewahrsam und bugsierte sie in einen Asservatenbeutel aus dunklem Packpapier.
«Warum ist so viel Zeit vergangen, bis wir gerufen wurden?», fragte Beneken.
Der Pathologe zuckte mit den Schultern und versuchte eine Erklärung: «Am späten Abend war keiner von den Kriminalern mehr auf der Wache.»
«Und die Verdächtigen? Wo sind die?»
«Wie mir zu Ohren kam», der Pathologe senkte die Stimme, «verbrachten sie die Nacht im Adlon.»
«Im Adlon?», fragte Beneken ungläubig nach. «In Moabit war wohl kein Zimmer mehr frei?» Dies war nicht die übliche Arbeitsweise der Mordbereitschaft. In ungeklärten Todesfällen war man normalerweise nicht zimperlich, Verdächtige in Gewahrsam zu nehmen.
«Ich wusste auch nicht, dass es neuerdings Zellen mit fließend Wasser und Goldhähnen gibt.» Der Pathologe zuckte erneut mit den Schultern. «Berühmte Leute, Filmleute. Die haben Spezialregeln.» Er spreizte das Wort mit Absicht.
«Die Gesetze sind für alle gleich», widersprach Beneken. «Hoffentlich hat man ihnen die Pässe abgenommen.»
«Sie sollen sich jedenfalls am Vormittag im Schöneberger Kommissariat einfinden.»
«Falls sie dann nicht schon geflohen sind.»
«Die? I wo, die laufen nicht weg», mutmaßte der Pathologe. «Weil die ’nen Film kurbeln», beantwortete er die Frage, die er aus Benekens Gesicht gelesen hatte. Der Schnauzbart entblößte ein Lächeln. «Großes Jeschäft, big business, sagt man, das lässt man nicht einfach liegen.»
«Sie meinen, diese Menschen haben keine Angst vor dem Fallbeil?»
Der Pathologe strich sich über den Schnauzbart. «Die gehen nicht unters Beil. Wenn man denen ’nen Strick dreht, dann einen aus goldener Seide. Und riechen tut der nach Eau de Cologne.»
«Wir werden sehen», sagte der Kommissar.
Der Pathologe konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. «Ich kenne Ihren Leumund, Beneken. Sind ’n harter Knochen! Wenn Sie auch manchmal wie ’n Kindskopf aus der Wäsche schauen.»
Der Kommissar atmete tief durch. Der Mediziner hätte sein Großvater sein können. Doch das berechtigte ihn nicht zu dieser Ansprache. Benekens Aufklärungsquote war die höchste der Abteilung.
«Ich bin keiner, der die Gauner laufen lässt», konterte Beneken knapp. Unter dem Schnauzer meinte er, ein Schmunzeln zu erkennen. Obwohl sie Seite an Seite arbeiteten, war die Rivalität zwischen Kriminalern und Pathologen ebenso sprichwörtlich wie unvermeidlich. Sie ermittelten oftmals aneinander vorbei, manchmal sogar gegeneinander. Die Kriminaler waren die Denker, die Pathologen die Handwerker, die mit Feldschere, Säge und Blutschürze zur Sache gingen. Beneken wiederum gehörte keiner der beiden Gruppen an, war weder Kopfmensch noch Handwerker. Er war für seine zuverlässige Intuition bekannt, hatte oft «den richtigen Riecher». Er trat vor die Spiegelkommode an der Wand neben dem Bett und strich über Parfümflakons. «Dann können wir hier nicht mehr viel ausrichten.»
«So sieht es aus», bestätigte der Pathologe und setzte seinen Hut auf.
Etwas später im Kommissariat
Beneken hatte seine Aktentasche unter den linken Arm geklemmt. Während er die schmucklose Flucht gleichförmiger Türen des Schöneberger Kommissariats durchschritt, studierte er die spärlichen Notizen auf dem Zettel in seiner Hand. Die Namen der Beteiligten kannte Beneken vom Hörensagen: Fritz Lang und Thea von Harbou. Beide waren sie vom Film, beide kurbelten sie bei den großen Produzenten Pommer und May – so viel wusste er aus den Gazetten. Am Vorabend, das hatte ihm der Kriminalassistent mittlerweile berichtet, war Lang höchstpersönlich im Kommissariat vorstellig geworden, um die Selbsttötung seiner Ehefrau anzuzeigen. Die Harbou hatte vor der Tür gewartet. Dann waren sie, Arm in Arm, aus dem Kommissariat getreten, als wollten sie einen Abendspaziergang unternehmen. Ein Verhalten, kaum in Übereinstimmung zu bringen mit der Leiche, die Beneken eben begutachtet hatte …
Der Kommissar näherte sich den Räumlichkeiten für die allfälligen Vernehmungen: blanke Stühle für die Beschuldigten, gepolsterte für die Kriminaler, ein Stehpult für die Stenografinnen, das selten benutzt wurde. Vernehmungen dauerten oft Stunden. Und in dem Maße, wie die Rock- und Kleidersäume kürzer wurden, wuchs die Furcht vor Krampfadern. Das hatte Beneken aus den Unterhaltungen der Damen aufgeschnappt.
An diesem Morgen ließ die Stenografin auf sich warten. Mochte sein, dass sie vor dem Aufbrechen eine Laufmasche entdeckt hatte; oder war ihr die Elektrische vor der Nase weggefahren? Zum Warten verdammt, verharrte Beneken hinter dem quadratischen Tisch. Da führte der Kriminalsekretär einen Verdächtigen herein, der nicht wie einer aussah: weite Hosen mit Nadelstrich, polierte Schuhe, Weste mit goldener Kette; sicherlich hing keine Uhr daran, sondern das berühmte Monokel. Kein Foto des Filmregisseurs in der Lichtbild-Bühne oder im Filmkurier ohne dieses Accessoire.
Die Hemdsärmel hatte Lang mit Manschettenknöpfen um die Handgelenke geschlossen, die dunklen Haare mit Brillantine nach hinten gestrichen. «Wie aus’m Ei jepuhlt», so hätte es Walters Mutter ausgedrückt.
Der Regisseur nahm Platz, als wollte er eine Flasche Champagner bestellen. Dann angelte er ein goldenes Etui aus der Jacketttasche: Importzigaretten der Marke Pharao. Beneken kannte sie dem Namen nach, leisten konnte er sie sich nicht.
Ihre Blicke trafen einander: Neugier auf Stolz. Für einen Kriminaler war es keine schlechte Sache, unterschätzt zu werden. Insofern freute sich Beneken über Langs Attitüde. Allerdings überlegte der Kommissar, ob er es auf einen ersten Machtkampf ankommen lassen und dem Verdächtigen das Rauchen untersagen sollte. Er entschied sich dagegen. Allerorten wurde geraucht, in den Gaststätten, in den Tanzsälen, selbst auf der Plattform der Elektrischen. Herrmann hatte auch damit angefangen. Schon bei seiner ersten Rückkehr von der Front, so erinnerte sich Beneken, hatte der Bruder ihn an einer Selbstgedrehten ziehen lassen.
Sogar die Mutter tat es gelegentlich. Doch sie versuchte es vor Walter zu verbergen. Wenn sie vor dem Schlafengehen noch einmal in den Wäschehof ging, den leeren Korb als Alibi an die Hüfte gestemmt, dann lugte Walter manchmal aus dem Fenster in den Hof. Immer häufiger sah er die Glutspitze bei den Wäschestangen glimmen. Selbstvergessen stand die Mutter dann zwischen Masten und Leinen, reglos, die Schürze um die Hüfte, den Alibi-Korb zu ihren Füßen und paffte Wolken in den windlosen Innenhof.
Walter wiederum nutzte die Zeit, um eine Jazz-Platte auf das geliebte Grammofon zu legen. Ein gebrauchtes Gerät, gekauft von seinem ersten Lohn. Die Platten des Duke Ellington Orchestra hatte er immer zur Hand. Die Scheibe auflegen, das Gerät ankurbeln, dann ging es los. Er wiegte sich im Rhythmus, manchmal improvisierte er Tanzschritte.
Wenn sie wieder in die Stube trat, roch sie wie eine Tabakfabrik. Wie konnte sie bloß annehmen, sie könnte ihren Sohn, den Kommissar, täuschen?
«Was ist das für eine furchtbare Musik, Walterchen?», fragte die Mutter dann, und Walter beendete sein Vergnügen, der Mutter zuliebe. Doch blieb da immer eine Sehnsucht.
Benekens Gedanken kehrten zurück ins Kommissariat. Milde gestimmt vom Bild der Mutter, verzichtete er auf den Machtkampf mit dem um zehn Jahre älteren Regisseur. Solange die Stenografin noch nicht erschienen war, mussten sie sich ohnehin die Zeit vertreiben. Sicherlich war sie auf dem Weg stecken geblieben, irgendeinen Krawall, irgendeinen Aufmarsch gab es immer in dieser aus allen Nähten platzenden Stadt. Tag für Tag und ungezählte Male rückten die Schupos mit gezogenen Knüppeln aus. Von seinem Büro aus konnte er ihre genagelten Stiefel die Treppen hinunterstürmen hören, wenn es zum Einsatz ging.
«Nun, Herr Kommissar? Was haben wir da zu besprechen?» Der Beschuldigte blies Rauch unter die Glühbirne. Die Geheimratsecken ließen das Gesicht spitz erscheinen, es mündete in eine schlanke Nase, der Fluchtpunkt des Charakterkopfes. Der Ausdruck war klug, aber von einer hintergründigen, doppelbödigen Klugheit, fand Beneken. Das Monokel blieb, am Ende der goldenen Kette, in der Westentasche. Langs Blicke aus hängenden, weichen Lidern waren auch ohne dieses Hilfsmittel durchdringend. Der gemütliche Dialekt wollte nicht recht dazu passen. Flüchtig warf Beneken einen Blick auf den Kopf der Akte: Friedrich Christian Anton Lang, geboren in Wien am 5. Dezember 1890, Leutnant der Reserve – natürlich.
Der Kommissar faltete die Hände über der Tischplatte und lehnte sich vor. «Ich bitte den gnädigen Herrn vielmals um Entschuldigung. Wir müssen warten. Die Stenografin ist noch nicht eingetroffen.»
«Stenografin? Was soll der Schnickschnack?»
«Die Vernehmung Verdächtiger wird routinemäßig protokolliert. Das ist Vorschrift. Zu Ihrem eigenen Schutz.»
Für einen kurzen Moment las Beneken Verunsicherung auf dem Gesicht des Beschuldigten. Dann gewann er seine Haltung zurück. Mit etwas milderer Stimme sagte er: «Ich muss schnellstmöglich ins Atelier. Ich wäre Ihnen überaus dankbar, Kommissar, wenn Sie meine Zeit nicht verfeuern täten wie das Morgenjournal von gestern. Haben Sie eigentlich einen Begriff von den Aufgaben eines Filmregisseurs?»
«Zugegeben, nein. Wären Sie so freundlich, Herr Lang, mir einen Begriff davon zu geben?»
Die Hand beschrieb – mitsamt der Pharao – eine generöse Schleife. «Haben’s denn gedient?», fragte der Regisseur, nicht preußisch schnarrend, sondern wienerisch schmeichelnd.
«Vater und Bruder waren an der Westfront», erklärte er, «mein Bruder Herrmann war Meldeläufer, mein Vater Infanterist. Beide sind im Feld geblieben. Ich blieb bei der Mutter.»
Lang stieß erneut Rauch durch die Nase, während er die Beine übereinanderschlug. «Der Regisseur ist der Oberkommandierende des Films. Er befehligt die Truppenteile und setzt sie in Marsch: Requisiteure, Dekorateure, Beleuchter, Schauspieler, Komparsen. Er baut das Bild, er formt die Figuren, er setzt, gemeinsam mit seinem Kameraoperateur, das Licht.»
«Er setzt das Licht?», wunderte sich Beneken über den Ausdruck.
«Ja. Seitdem wir mit künstlichem Licht kurbeln, haben wir in der Hand, wo es hell wird auf dem belichteten Film, und wo es dunkel bleibt. Wir können sogar künstliche Lichtquellen auf dem Bild herstellen, künstliche Sonnen, sozusagen.»
«Und wie kommt die Bewegung in den Film? Es sind doch nur Fotografien, nicht wahr? Viele stehende Bilder die aufeinanderfolgen … Verraten Sie mir den Trick?»
Lang lächelte schulterzuckend. «Die Filmkamera zerstückelt die Bewegungen in der Aufnahme. Sie macht etwa vierzehn bis achtzehn Fotos in jeder Sekunde. Weniger als vierzehn, das zeigt die Erfahrung, dürfen es nicht sein, dann zerfällt die Illusion der Bewegung. Aber wenn wir sie schnell genug vor dem Auge wechseln lassen, übersetzt unser Gehirn diese winzigen Bildsprünge in eine mehr oder weniger fließende Bewegung. Das Gehirn ergänzt die Zwischenräume. Nur manchmal ruckelt es noch …»
«Unser Gehirn ruckelt?»
«Nein, Herrschaftszeiten! Schauen Sie: Die Bewegungen sind noch ruckelig, aber die Operateure experimentieren laufend, um die Geschwindigkeit der Fotomotoren zu erhöhen – mehr Bilder in derselben Zeit, dann hört das Ruckeln auf.»
«In den Kameras stecken Motoren?»
Lang lachte. «Darauf können Sie wetten. In den Ateliers rattert und rumpelt es normalerweise …»
«Warum normalerweise?»
«Weil ich im Moment sinnlos da umherhocke, anstatt die Arbeiten voranzutreiben», erläuterte Lang sarkastisch.
In diesem Moment klopfte es an der Tür des Vernehmungsraumes. Beneken ignorierte das Geräusch.
«Wenn Sie, Herr Lang, am gestrigen Tag eine Kamera zur Hand gehabt hätten, um die Geschehnisse zu filmen, was hätte diese Kamera gesehen?»
Lang schwieg und schien nachzudenken. Beneken ging zur Tür und ließ die Stenografin herein. Sie war sorgfältig, aber nicht aufdringlich geschminkt und hatte ihr übliches Parfüm aufgelegt, eines von der blumigen Sorte. Kein schweres, rosenölhaltiges, eher ein leichtes: Flieder oder Lavendel. Der Duft streifte ihn, als sie an Beneken vorüberging.
Im Vorbeigehen drückte sie ihm eine braune Mappe in die Hand. Beneken öffnete den Deckel. Schnipsel aus Filmzeitschriften, aus Zeitungen und Magazinen quollen ihm entgegen. Auf den Bildern erkannte er den Regisseur. Die Assistenten im Archiv hatten gut gearbeitet.
Wohlwollend ruhten Langs Augen auf der Protokollantin. «Wir haben sehnsüchtig auf Sie gewartet, gnädiges Fräulein», sagte er, spitzte die Lippen, legte den Kopf in den Nacken und blies Rauch in die Luft.
Beneken hielt sich nicht mit Höflichkeiten auf: «Geben Sie mir ein Zeichen, wenn Sie so weit sind.» Die Stenografin nickte und warf ihm einen Blick zu, Beneken wich aus.
Sie nahm nicht am Stehpult, sondern auf einem der Stühle Platz, zog ihren Block hervor und tippte mit dem Stift zweimal aufs Papier, bis er in die richtige Position zwischen ihren Fingern gerutscht war. Sie schlug die Beine über, und Beneken registrierte die feinen Strümpfe, die unter dem Saum zum Vorschein kamen. Als sie ihm einen kecken Blick zuwarf, wandte er rasch die Augen ab.
«Beginnen wir», sagte die Stenografin. Da klopfte es erneut.
«Hat man denn hier niemals seine Ruhe», klagte der Kommissar. Mit wenigen Schritten war er bei der Tür. Diesmal stand der Assistent des Gerichtsmediziners davor. «Wir sind mitten in der Befragung», sagte Beneken knapp.
Der Kriminalassistent suchte nach Worten. «Das … weiß ich.»
«Warum stören Sie mich dann?»
Der Assistent deutete steif eine Verbeugung an. «Der Herr Pathologe wünscht, Sie möchten den Beschuldigten zur Bertillonage vorstellen, Herr Kommissar.» Die Bitte wurde mit langen Pausen hervorgebracht. Beneken empfand Mitleid mit ihm.
«Richten Sie ihm aus, dass es noch ein paar Minuten dauert.»
«Aber der Herr Pathologe ist streng!», beharrte der Assistent in unbedingter, auf der Kadettenschule geschliffener Loyalität.
Beneken seufzte. Als Benjamin der Abteilung hatte er es unter den Älteren ohnehin schwer. «Nun gut», sagte er. «Gehen wir in die Erkennungsdienstliche Abteilung.» Zufrieden wandte sich der Assistent ab und schritt voraus.
«Herr Lang», erhob der Kommissar die Stimme, «ich bitte Sie, uns zu folgen.»
«Folgen? Wohin?», ließ der Regisseur sich aus dem Gespräch mit der Stenografin reißen.
«Das erfahren Sie auf dem Weg.»
Lang beugte sich über ihren Handrücken und presste einen Kuss darauf.
«Soll ich mitkommen?», fragte die junge Frau irritiert.
«Natürlich sollen Sie das», polterte Beneken. «Gott im Himmel, was ist denn heute los?»
«Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Kommissar, es liegt nicht an Ihnen. Wir vom Lichtspiel bringen immer alles durcheinander.»
Die Stenografin kicherte, der Regisseur folgte dem Kommissar mit wippenden Schritten. Der Gerichtsdiener ging voraus, die Stenografin beschloss den Zug.
Bertillonage
«Verraten Sie mir jetzt, wohin es geht?», fragte Lang.
«Zur Bertillonage», antwortete Beneken ungerührt.
«Was ist das?», fragte Lang. Seine Selbstsicherheit war verflogen. Die Schritte hallten durch den langen Flur, den sie gegen einen noch längeren eingetauscht hatten. Allerdings waren auf diesem die Fenster mit Gitterstäben versehen.
«Kommt das in Ihren Krimiheften nicht vor?», fragte Beneken auf gut Glück.
«Ach, die lese ich nicht so sorgfältig. Das ist reiner Zeitvertreib», antwortete Lang frei heraus, und Beneken freute sich über die Offenheit des Regisseurs.
«Nun, dann gebe ich Ihnen auch Auskunft: Wir nehmen Ihre Maße auf», antwortete Beneken.
Das Monokel fiel aus Langs Augenhöhle und baumelte nun an der Kette. «Für die Verbrecherkartei?»
«Für unsere Akten», wiegelte Beneken ab.
«Ich lasse mich nicht vermessen wie ein Gauner. Woher nehmen Sie das Recht?», protestierte Lang.
Beneken hob die Hände und senkte die Stimme, um den Regisseur zu beschwichtigen. «Es ist ein Routinevorgang. Wir müssen das tun.»
«Ich habe mitansehen müssen, wie meine Frau sich umbrachte. Ich habe Menschen – Kameraden – von Maschinengewehren zerstanzen gesehen. Was maßen Sie sich an!»
«Unsere Gesetze behandeln alle gleich – auch Sie.»
Beneken öffnete eine Tür und ließ dem Regisseur den Vortritt. Die Südfront war von großen – allerdings vergitterten – Fensterscheiben erhellt. Tageslicht flutete den Raum. Ein fotografischer Apparat stand auf einem erhöhten Podium. Das Objektiv war auf ein Arrangement ausgerichtet, das Lang vertraut vorkommen musste: ein Stuhl vor einer bescheidenen Kulisse. Bloß dass der Prospekt weder eine Landschaft noch ein Interieur darstellte, sondern ein Netz horizontaler und vertikaler Linien. Am Rand waren Maße notiert. Am ehesten hatte der Aufbau Ähnlichkeit mit einer Vorlage für technische Zeichner, fand Beneken.
Der Gerichtsmediziner stellte sich Lang vor und bat ihn, auf dem Stuhl Platz zu nehmen. Lang musste eine Stufe hinaufsteigen, der Sitz stand auf einer Drehscheibe.
Der Fotograf – Beneken hatte ihn eintreten hören – postierte sich hinter der Kamera, verborgen unter einem schwarzen Tuch, um die Linse und die Blenden einzurichten. Als er wieder hervorkam, nahm er eine Art Galgen in die Hand.
«Auf diese Art bin ich noch nie fotografiert worden», sagte Lang pikiert und nahm auf dem Stuhl Platz. Hände ergriffen seinen Schädel, um ihn in die Vorrichtung zu spannen. Lang entwand sich: «Ich muss doch sehr bitten!» Er strich sich über die Haare, um sie wieder glatt an den Schädel zu legen. Sobald er sich erneut gegen die Klemme lehnte, wurde er – nun etwas vorsichtiger – angefasst und eingespannt. Langs Gesicht versteinerte. Schließlich wurde er in Position gedreht – in rechtem Winkel zur Kamera. Zischend flammte ein Blitz auf, der Fotograf hatte das Magnesiumpulver entzündet. Dann drehte der Diener den Stuhl auf der Scheibe um exakt neunzig Grad. Am unteren Rand der Drehscheibe waren die Bogenminuten angezeichnet. Lang saß nun im Profil zur Schussrichtung der Linse. Erneut zischte der Galgen, der Blitz erhellte den Raum, Beneken spürte die Wärme der kontrollierten Explosion.
Dann bat der Gerichtsmediziner den Lichtspielregisseur zur Vermessung vor die Wand mit den Skalen und forderte ihn auf, den Arm auszustrecken. Der Gehilfe legte ein Maßband an.
«Ich protestiere!», sagte Lang in erregtem Ton. «Das ist erniedrigend. Ich bin österreichischer Staatsbürger. Ich verbitte mir diese Behandlung. Das wird ein Nachspiel haben!»
Während der Gehilfe Lang mit weiteren Instrumenten traktierte, um Schädelbreite, Nasenlänge und die Distanz zwischen den Schulterblättern zu vermessen, nahm der Gerichtsmediziner mit dem Walrossschnauzbart Beneken beiseite, um ihm interessante Erkenntnisse zu eröffnen: dass man Blutspritzer unter der Kleidung der Toten gefunden habe – sehr, sehr unwahrscheinliche Blutspritzer.
«Was genau verstehen Sie unter unwahrscheinlich?», fragte Beneken leise.
«Solche, die unter den angenommenen Bedingungen nicht denkbar sind», erläuterte der Schnauzbart.
«Ich verstehe nicht, was Sie meinen.»
Im Hintergrund hörten sie Lang immer noch poltern. Der Schädelumfang, die Fingerglieder: Er protestierte gegen jede Erhebung. Man musste seine Finger einzeln und mit Gewalt in einen Farbschwamm tauchen, als man ihm die Abdrücke nach Francis Galtons Methode nahm. Nachdem man sie auf eine Karte gepresst hatte, betrachtete Lang die blau gefärbten Kuppen, als gehörten sie nicht zu ihm. Beneken wandte sich wieder dem Pathologen zu. «Haben Sie jemals von einer Toten gehört, die sich nach ihrer tödlichen Verletzung die Kleidung wieder anstreift?», fragte der Mediziner Beneken mit eindringlichem Blick.
Beneken gab keine Antwort. Wollte der Mann ihn veralbern?
«Anders kann ich mir die Spuren nicht erklären: getrocknetes Blut auf der Haut der Toten – und auf der Innenseite des Stoffes. Auf der Außenseite nurmehr fleckig. Das Gewebe ist kaum durchtränkt, das Blut war schon gestockt, als man sie wieder ankleidete.»
«Man kleidete die Leiche an?» Die Vorgänge, die sich in Benekens Vorstellung allmählich zu einem Ablauf fügten, waren absurd: zwei Personen, die einen leblosen Körper ausgehfertig machten, als wollten sie noch einen Spaziergang mit der Leiche unternehmen.
«Und dies alles, nachdem der Schuss fiel?»
«Richtig. Das scheint mir die einzig sinnvolle Erklärung zu sein. Oder haben Sie eine bessere?»
Auf dem Rückweg in Benekens Büro blieb Lang wortkarg. Die eingefärbten Fingerspitzen spreizte er ab. Es war, als hätte man ihn gegen eine reduzierte Version seiner selbst ausgetauscht.
Der Regisseur Lang erzählt einen Film.
Diesmal schlug Lang die Beine nicht über. Bis die Stenografin ihren Platz eingenommen und ihren Block geöffnet hatte, starrte er vor sich hin. «Herr Kommissar, schauen Sie, ich bin kein Verbrecher!»
«Herr Lang», erhob Beneken die Stimme, «wenn Sie gestern eine Kamera zur Hand gehabt hätten, wenn diese Kamera den Tod Ihrer Gattin fotografiert hätte, was würden wir auf diesem Film sehen?»
Lang nahm einen tiefen Zug aus der Zigarette und begann. Im Sprechen quoll Rauch aus seinem Mund wie aus dem Schlot eines Spreedampfers. «Ein unglücklicher Tod, ein veritables Unglück. Vor allem: ein vollkommen überflüssiger Tod.»
«Was würden die Menschen im Lichtspieltheater sehen?», beharrte Beneken.
Lang blickte dem Kriminaler in die Augen, als wolle er seine Vertrauenswürdigkeit prüfen. Dann öffneten sich seine Lippen. Beneken empfand sie als sinnlich, die Zähne waren gepflegt. Eine überaus angenehme Erscheinung, dachte Beneken.
«Ein Liebespaar», begann Lang und nahm einen Zug. Sein Mund gebar eine weitere Wolke. «Es sinkt im Kuss aufs Kanapee. Die Gesichter weiß wie der Mond. Leidenschaft ist darauf gezeichnet, ihr Mund weit geöffnet. Der Mann reißt sich die Krawatte vom Hals, das Weib öffnet die Knöpfe ihrer Hose.»
«Die Frau trägt eine Hose?»
«Ja. Das ist jetzt modern, fragen Sie mich nicht, warum!»
Beneken schwieg, Langs Äußerung berührte ihn unangenehm. Ohne eine Bemerkung des Kommissars abzuwarten, fuhr Lang fort: «Sie sinken in eine Umarmung. Weitere Kleidungsstücke fliegen durch den Raum. Die Kamera folgt ihrem Flug, bis … eines über dem Objektiv der Kamera hängen bleibt. Das Bild verdunkelt sich, Ende.»
«Moment. So leicht kommen sie mir nicht davon.»
Lang aschte die Zigarettenspitze ab und warf einen Blick auf die Stenografin. Die war ganz auf ihren Block konzentriert. «Schade», sagte er dann.
«Erzählen Sie, was passiert weiter in Ihrem Film?», beharrte Beneken.
Lang seufzte. «Nun gut, hören Sie: Der Regisseur hat die Aufnahme abgebrochen, der Requisiteur das Kleidungsstück vom Objektiv gezogen. Als die Leinwand den Blick wieder freigibt, sehen wir ein Paar auf dem Kanapee, die Gliedmaßen ineinandergeflochten. Leidenschaftliche Küsse. Die Kamera springt nah heran: Mit spitzen Fingernägeln knöpft die Frau das Hemd des Mannes auf. Sie sind rot lackiert, aber das sieht nur der Regisseur, für das Publikum im Saal sind sie am Ende grau wie alles, nur etwas heller als das samtgrüne Kanapee …»
Der Stift der Stenografin eilte über das Papier.
«Kommen Sie zur Sache», mahnte Beneken.
Lang lächelte vieldeutig. «Im Film kosten wir Spannung aus. Stellen Sie sich dramatische Musik vor: Streicher und Bläser, ein sich steigerndes Stakkato. Wir befinden uns im